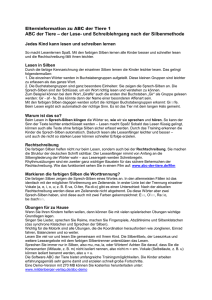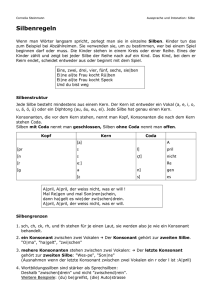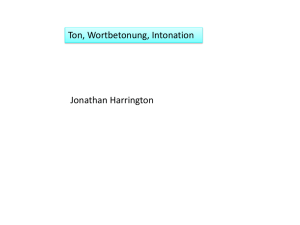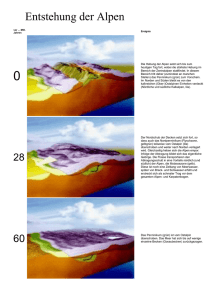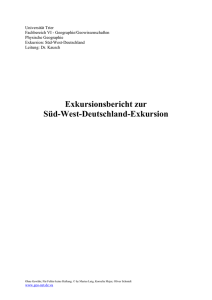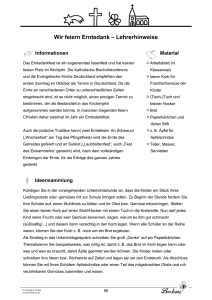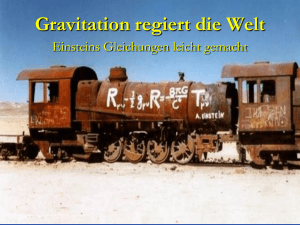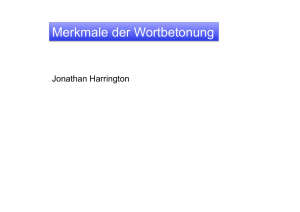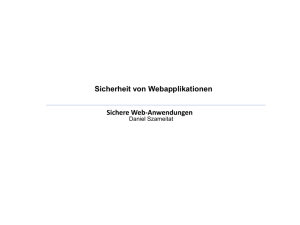Metrik und Gestik bei Brecht
Werbung
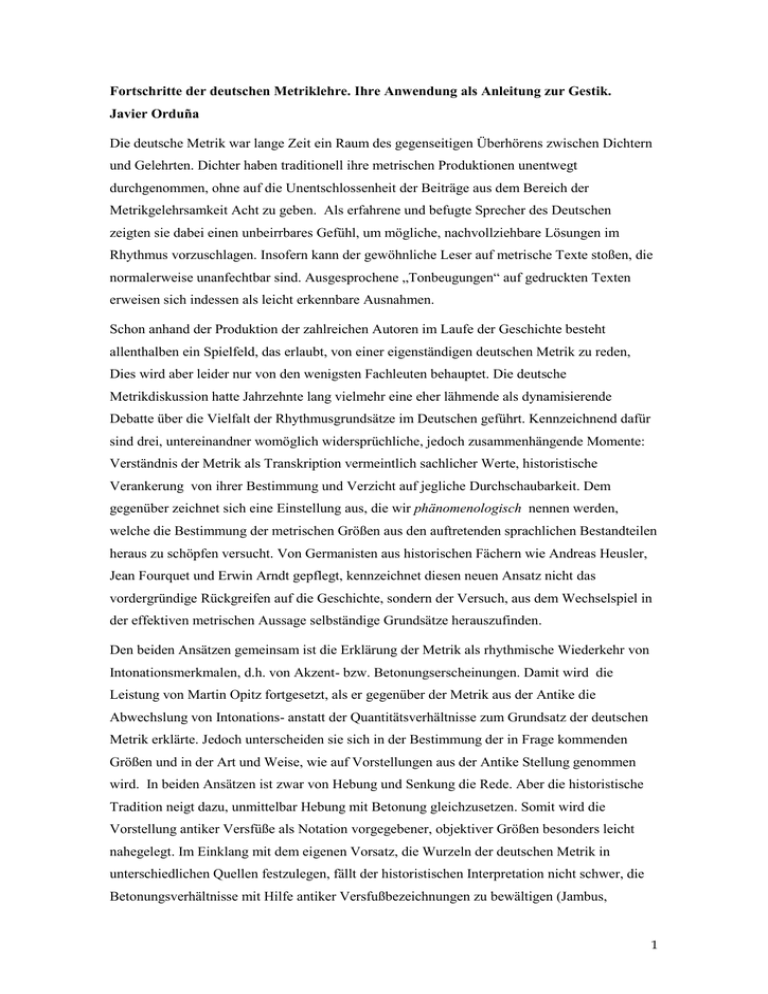
Fortschritte der deutschen Metriklehre. Ihre Anwendung als Anleitung zur Gestik. Javier Orduña Die deutsche Metrik war lange Zeit ein Raum des gegenseitigen Überhörens zwischen Dichtern und Gelehrten. Dichter haben traditionell ihre metrischen Produktionen unentwegt durchgenommen, ohne auf die Unentschlossenheit der Beiträge aus dem Bereich der Metrikgelehrsamkeit Acht zu geben. Als erfahrene und befugte Sprecher des Deutschen zeigten sie dabei einen unbeirrbares Gefühl, um mögliche, nachvollziehbare Lösungen im Rhythmus vorzuschlagen. Insofern kann der gewöhnliche Leser auf metrische Texte stoßen, die normalerweise unanfechtbar sind. Ausgesprochene „Tonbeugungen“ auf gedruckten Texten erweisen sich indessen als leicht erkennbare Ausnahmen. Schon anhand der Produktion der zahlreichen Autoren im Laufe der Geschichte besteht allenthalben ein Spielfeld, das erlaubt, von einer eigenständigen deutschen Metrik zu reden, Dies wird aber leider nur von den wenigsten Fachleuten behauptet. Die deutsche Metrikdiskussion hatte Jahrzehnte lang vielmehr eine eher lähmende als dynamisierende Debatte über die Vielfalt der Rhythmusgrundsätze im Deutschen geführt. Kennzeichnend dafür sind drei, untereinandner womöglich widersprüchliche, jedoch zusammenhängende Momente: Verständnis der Metrik als Transkription vermeintlich sachlicher Werte, historistische Verankerung von ihrer Bestimmung und Verzicht auf jegliche Durchschaubarkeit. Dem gegenüber zeichnet sich eine Einstellung aus, die wir phänomenologisch nennen werden, welche die Bestimmung der metrischen Größen aus den auftretenden sprachlichen Bestandteilen heraus zu schöpfen versucht. Von Germanisten aus historischen Fächern wie Andreas Heusler, Jean Fourquet und Erwin Arndt gepflegt, kennzeichnet diesen neuen Ansatz nicht das vordergründige Rückgreifen auf die Geschichte, sondern der Versuch, aus dem Wechselspiel in der effektiven metrischen Aussage selbständige Grundsätze herauszufinden. Den beiden Ansätzen gemeinsam ist die Erklärung der Metrik als rhythmische Wiederkehr von Intonationsmerkmalen, d.h. von Akzent- bzw. Betonungserscheinungen. Damit wird die Leistung von Martin Opitz fortgesetzt, als er gegenüber der Metrik aus der Antike die Abwechslung von Intonations- anstatt der Quantitätsverhältnisse zum Grundsatz der deutschen Metrik erklärte. Jedoch unterscheiden sie sich in der Bestimmung der in Frage kommenden Größen und in der Art und Weise, wie auf Vorstellungen aus der Antike Stellung genommen wird. In beiden Ansätzen ist zwar von Hebung und Senkung die Rede. Aber die historistische Tradition neigt dazu, unmittelbar Hebung mit Betonung gleichzusetzen. Somit wird die Vorstellung antiker Versfüße als Notation vorgegebener, objektiver Größen besonders leicht nahegelegt. Im Einklang mit dem eigenen Vorsatz, die Wurzeln der deutschen Metrik in unterschiedlichen Quellen festzulegen, fällt der historistischen Interpretation nicht schwer, die Betonungsverhältnisse mit Hilfe antiker Versfußbezeichnungen zu bewältigen (Jambus, 1 Trochäus, Daktylus, Anapäst, Choriambus...). Allerdings wurde oft übersehen, dass es sich dabei um eine gleichnishafte Übertragung handelt, was nicht wenige Probleme und offene Fragen hinter sich zieht. Seinerseits nimmt sich der phänomenologische Ansatz die Bestimmung der Hebung besonders genau vor. Sie wird nicht mehr als objektive, sondern als kontextuelle Größe angesehen. Dazu ist dann ein Erklärungsrahmen notwendig, der nicht mehr nur durch die Übertragung antiker Versfußvorstellungen geliefert werden kann. Vielmehr ist man auf eine eigene Taktbestimmung angewiesen, die letztendlich eine neue Lesart der deutschen Metrik stiften wird. 1. Offene Fragen der traditionellen Metriklehre. Die gleichnishafte Anwendung von Vorstellungen wie „Länge“ bzw. „Kürze“ oder „Jambus“ bzw. „Trochäus“ ermöglicht zwar einen schnellen Einblick in die charakteristische Abwechslung der deutschen Metrik, aber sie geben bald Anlass zu irreführenden Erwartungen. Unter „Länge“ verstand man in der Praxis „betonte Silbe“. Handelte es sich jedoch tatsächlich um absolut betonte oder um eventuell betontere Silben, also absolute oder relative Werte? Mit „Jambus“ bzw. „Trochäus“ bezeichnete man die Abwechslung, die das Deutsche so wie andere germanische Sprachen kennzeichnet. Konnte jedoch die eingeschlichene Vorstellung absoluter Größen das Bild nicht verzerren und Größen erwarten lassen, wo dies nicht unbedingt der Fall ist? Worauf soll sich der Interpret beziehen, um eine Reihenfolge als Jamben oder Trochäen zu bezeichnen – reicht es mit der ersten Silbe des ersten Verses einer Strophe? Wie verhielt es sich sonst mit den Füßen „Daktylus“ ( ) bzw. „Anapäst“ ( ), die in der Antike an die Stelle des Spondeus ( ) treten konnten? Um diese und ähnliche Fragen drehen sich letztendlich die Bestrebungen der Metriklehre. Treffende Antworten sind bestimmt für die metrische Schöpfung durch Dichter kaum relevant. Doch sie mögen nicht nur dem Vortragenden von Hilfe sein, sondern auch dem Interpreten von Nutzen, um weitere Spuren zur Bewertung einer dichterischen Produktion zu unternehmen. Der Auseinandersetzung aus fremdsprachlichen Standpunkten kann die deutsche Metrik ferner einen großen Dienst erweisen. Sie ermöglicht nämlich einen tiefgreifenden Einblick in die Prosodie einer germanischen, akzentzählenden Sprache, was sich je nach dem Standpunkt sprachtypologisch als sehr hilfreich erweisen mag. Einer nachvollziehbaren Antwort der aufgestellten Fragen stehen allerdings jene Auffassungen im Weg, die hinter den Hebungen deutscher Verse prinzipiell betonte Silben, hinter den Senkungen prinzipiell unbetonte erwarten, so wie bei Paul/Glier als Definition der „gebundenen Rede“ behauptet wird: „Was sie grundsätzlich von Prosa unterscheidet, ist die Regelmäßigkeit, in der hier der Wechsel von betonten und unbetonten Silben geordnet sind“ (Paul/Glier 1979: 12). Paul und Glier – um bei dem Beispiel zu bleiben – weisen zwar in Anlehnung an Heusler 2 auf relativierende Momente der deutschen Prosodie hin, wenn sie zwischen „hebungsfordernden“, „hebungs- und senkungsfordernden“ und „senkungsfordernden Silben“ im Deutschen unterscheiden. Doch letztendlich zeigen sich Paul und Glier der Gleichsetzung zwischen Hebung und Betonung bzw. Senkung und unbetonter Silbe verpflichtet und haben es nicht nötig, sich durch eine nähere Bestimmung des Taktbegriffes mit den Besonderheiten der Hebung als metrischer Erscheinung auseinanderzusetzen. Takt ist bei ihnen immer noch Synonym für Versfuß, also eher ein Notationswerkzeug als ein Bestimmungsrahmen. Dem Problem um das jeweils unterschiedliche, bald schwer zu bestimmende Gewicht der Silben im Deutschen kommt man stellvertretend da entgegen, indem man auf Vorstellungen wie Hauptund Nebenhebung zurückgreift, die sich an die Vorstellung von Haupt- und Nebenbetonung anlehnen. Dadurch werden indessen kaum metrische Belange hervorgehoben, sondern eher melodische Aspekte grammatischer bzw. pragmatischer Art. Solange aber gültige Mittel zur Bestimmung der metrischen Wiederkehr auf sich warten lassen, wird sich das intuitive Irren auf der Suche nach Anhaltspunkten bekräftigen, die dann nach jeder dritten, fünften, zehnten Zeile wieder berichtigt werden müssen Eng verbunden mit der Gleichsetzung von Hebungen und betonten sowie Senkungen und unbetonten Silben steht die Annahme, dass die Abwechslung der Silben im Deutschen sich als Anreihung von Jamben oder von Trochäen bestimmen lässt; mit der Besonderheit, dass gelegentlich der eine oder der andere Versfuß durch seine entsprechende Verlängerung Anapäst oder Daktylus ersetzt werden kann. Dabei taugt gewöhnlich im Gedicht bzw. in der Strophe die erste Silbe des ersten Verses als Bezugspunkt. Fängt der Vers mit unbetonter Silbe an, dann geht man oft davon aus, es handele sich um einen Jambus. Folgende Stelle aus Brechts Vom Brot und den Kindlein würde somit drei Jamben mit jeweils weiblicher, paroxytoner Kadenz und männlicher, oxytoner Kadenz ausweisen: (1) Es ist das Brot verschimmelt [ ] Weil’s keiner essen will. Dem gegenüber wurde als Trochäus der Vers bezeichnet, der mit betonter Silbe anfängt, so wie folgender Auszug aus Brechts Das Schiff nachweisen sollte, wo ferner die beiden ersten Verse weibliche, die beiden letzten männliche Kadenz ausweisen: (2) Und seit jener hinblich und mich diesen Wassern die entfernten Himmel ließen Fühl ich tief, daß ich vergehen soll. [ ] [....] Ließ ich mich den Wassern ohne Groll. [] 3 Die Anreihung kann in großen Zügen nachvollzogen werden. Immerhin treten schon in einer kleinen Auswahl von Versen bald Unebenheiten auf. Die traditionelle Metriklehre kann dazu recht aufgeschlossene Bestimmungen liefern, wie z.B. bei Behrmann: Die Versbeschreibung unterscheidet den Eingang, das Innere und den Ausgang des Verses; der Ausgang heißt auch Kadenz, Fall. Der Verseingang ist auftaktig oder auftaktlos [...] Das Versinnere ist mehr oder weniger geregelt. Die starrste Regelung ist das Alternieren, die ungebrochne Folge von Hebung und Senkung oder Senkung und Hebung in gleichen Takten; die loseste die Füllungsfreiheit [...] (Behrmann 1989: 15). Schon im kleinen Rahmen der beiden Gedichte, woher die vorherigen Auszüge stammen, stellen sich Problemfälle dar, die durch Behrmanns Bestimmung zwar vorgesehen werden, indessen aber tiefgreifende Fragen nach der Reichweite der Metriklehre stellen lassen. Beispiel (3) gibt die ersten Strophe vom Gedicht Vom Brot und den Kindlein wieder. (3) Sie haben nicht gegessen [ ] Das Brot im hölzernen Schrein Sie riefen, sie wollten essen [ ] Lieber die kalten Stein. * Im 2. und 3. Vers finden wir Füllungen von zwei Senkungen, die zwar durch die Vorstellung des Anapästes bzw. des Daktylus mit berücksichtigt sein können, aber im 4. Vers tritt ein unmöglicher Jambus zu Versanfang ein. Es handelt sich offensichtlich um die Folge betont/unbetont. Dass inmitten von jambischen Versanfängen sich Trochäen melden, ist allerdings keine Seltenheit. Welche Folge soll das haben? Sind die nächsten Silben alsdann auch als Trochäen vorzulesen? Sollte eine Doppelsenkung wie nun im 2. und 3. Vers folglich nicht mehr als Anapäst sondern als Daktylus aufgefasst werden? Das Ganze lässt eine gewisse Gleichgültigkeit vermuten. Wenn aber die Reihenfolge der Abwechslung gleichgültig ist, welchen Anspruch auf Richtlinien zum Votragen bzw. zur literaturwissenschaftlichen Analyse kann Metrik haben? Auch die Zuordnung der Kadenz sollte geklärt werden. Die Regelmäßigkeit, wie sich männliche und weibliche Kadenzen ablösen, sowie die Auswirkung auf den Duktus des Vortragens sind Felder, die durch ein metrisches Schema mit berücksichtigt werden sollen. Wie Beispiele (1) und (2) zeigen, scheint mal die weibliche, mal die männliche Kadenz einfach in der Überzahl zu sein. Wenn Rhythmus Wiederkehr ist und metrisches Schema dann Bestimmung eines Rhythmus, sollte etwa nicht die Metriklehre die Gegenüberstellung zwischen Kadenzarten mit größerer Genauigkeit einbeziehen? 4 Besagte Ungereimtheiten sind ohne Zweifel auf die Gleichsetzung von Hebung und Betonung bzw. Senkung und unbetonter Silben zurückzuführen. Obwohl sie in der Praxis von den deutschsprachigen Dichtern kaum beachtet wurde, wurde sie zu festem Bestandteil der Metriklehre. Nur wenige Gelehrte haben sich degegen aufgelehnt und auf die grundlegende Relativität der deutschen Betonung aufmerksam gemacht. Zu diesen Ausnahmefällen gehört Karl Philipp Moritz, dessen Lehre seinerzeit von Goethe und Schiller genau beachtet wurde. Wie später der phänomenologischen Lehre geht es Moritz darum, die Bedingungen herauszufinden, wie aus unstabilen Akzentverhältnissen im konkreten metrischen Text verlässliche Hebungen bzw. Senkungen entstehen können. Zugegebenerweise hat Moritz den Sachverhalt mit Hilfe einer schwer nachvollziehbaren, durch die Epoche bedingten Mischung von antiken Fragestellungen und für die späte Zeit womöglich unzumutbaren Grammatikbegriffen bewältigt, aber den Kern der Diskussion erfasst er unzweideutig:: Im Versbau der Alten entstand das Metrum erst durch die künstliche Zusammenstellung kurzer und langer Silben; in unserm Versbau entsteht die Länge und Kürze der Silben selbst erst durch ihre Zusammenstellung (Wagenknecht 1981: 311). Bekanntlich verdankte kein Geringerer als Goethe Moritzens Prosodie den Mut, die erste, in Prosa verfasste Version der Iphigenie metrisch umzuschreiben: Iphigenia in Jamben zu übersetzen, hätte ich nie gewagt, wäre mir in Moritzens Prosodie nicht ein Leitstern erschienen. [...] Es ist auffallend, daß wir in unserer Sprache nur wenige Silben finden, die entschieden kurz oder lang sind. Mit den andern verfährt man nach Geschmack oder Willkür. Nun hat Moritz ausgeklügelt, daß es eine gewisse Rangordnung der Silben gebe, und daß die dem Sinne nach bedeutendere gegen eine weniger bedeutende lang sei und jene kurz mache, dagegen aber auch wieder kurz werden könne, wenn sie in die Nähe von einer andern gerät, welche mehr Geistesgewicht hat. Hier ist denn doch ein Anhalten, und wenn auch damit nicht alles getan wäre, so hat man doch indessen einen Leitfaden, an dem man sich hinschlingen kann. Ich habe diese Maxime öfters zu Rate gezogen und sie mit meiner Empfindung übereinstimmend getroffen (Goethe 1956: 157). Moritzens Einfachheit mag indessen nicht nur seine Zeitgenossen im 18. Jahrhundert verwirrt haben, sondern auch Leser aus der Spätzeit. Hierbei lässt sich fragen, ob bei Wagenknecht nicht ein ironischer Nebenton zu vernehmen wst, als er davon Notiz nimmt: Allerdings hat sich Moritz die Sache auch wieder allzu schwer gemacht. Die prosodische Grundregel, „welche bisher von unsern guten Dichtern, größtentheils bloß nach einem natürlichen Gefühl des Richtigen, beobachtet worden“ ist, dürfte sich, in Rücksicht auf „Wortaccent“ und [sic!] „Silbenstellung“, einfach genug wie folgt formulieren lassen: „Im prosodischen Sinne schwer[sic!]ist eine Silbe dann, wenn sie schwerer und leicht [sic!], wenn sie leichter ist als im Schnitt die Silben ihrer unmittelbaren Nachbarschaft“ (Wagenknecht 1981: 31). 1 Vgl. Moritz, Carl Philipp (1973), Versuch einer deutschen Prosodie. Mit einem Vorwort zum Neudruck von Thomas S. Paine. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft. Internet: <http://www.lrz-muenchen.de/~mellmann/skripte /moritz-prosodie.pdf>, S. 123. 5 Darin hat Moritz offensichtlich die Erkenntnisse der Sprachwissenschaft lange vorweggenommen. Je nach der Fokussierung kann eine gleiche Silbe recht unterschiedliche Betonungen bekommen, da der deutsche Wortakzent zwar als morphologisch unvoreingenommen einzustufen ist, allerdings pragmatisch höchste Wirksamkeit aufzeigt2. Die Besonderheit rührt aus der Eingentümlichkeit des festen Akzents der germanischen Sprachen. Der germanische Akzent ist grammatisch unvoreingenommen, während z.B. im Spanischen Akzente wie bei canto/cantó oder término/terminó als unverwechselbare, unbedingt aufrecht zu erhaltende Morpheme auftreten. Der feste Akzent der germanischen Sprachen mag zwar einen morpholexikalischen Wert immer noch beibehalten, doch er weist dann eher ko-okkurrienden Charakter aus. Im Minimalpaar über’setzen vs. ’übersetzen bahnt der Akzent zwar unterschiedliche lexikalische Werte ein, aber nicht ausschließlich, denn Syntax und Morphologie treten ebenso zur Disambiguierung bei. Dies gewährleistet die grundlegende Unvoreingenommenheit des deutschen qua germanischen Akzents, worauf letztendlich Goethes Erstaunen über Moritzens Anleitungen sowie Kiparskys Hypothesen zu den Schweregraden der deutschen Silben zurückzuführen sind (Kiparsky 1989, Wagenknecht 1981). Die Umsetzung einer solchen Einsicht in die Praxis besteht offensichtlich unabhängig von jeder theoretischen Auseinandersetzung. Auf Beispiele für die Unbeständigkeit und Relativitat des germanischen Wortakzents stößt man genauso oft in der Alltagssprache wie in ihrer metrischen Stilisierung. Ein besonders einprägsames liefert Schiller in dem kleinen Auszug aus dem Gedicht An den Frühling im Beispiel (4), dessen erste Fassung um vier Jahre älter ist als Moritzens Deutsche Prosodie. Die Zusammenstellung der Aussage weist offensichtlich nach, dass ein gleiches Pronomen „DU’ in daraufolgenden Positionen unterschiedliche prosodische Werte bereit stellt: (4) Und DU? –DU gibst es mir? In der Metriklehre der Bundesrepublik, wo noch 1972 Heusler beanstandet wurde (Schlawe 1972, 38 ff.), hätte wohl eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit den Ansätzen des vorphänomenologischen Moritz’ eine deutliche Alternative zur Starrung der transkriptorischen Erwartungen bedeutet. Stattdessen hat da Wagenknecht z. B. vorgezogen, an dem Prinzip der Gleichsetzung zu halten, anstatt sich in die Verarbeitung relativierender Ansätze einzulassen. Hebung und Betonung weiterhin gleichzusetzen bedeutete, das Wesen der Metrik auf die Darstellung vorgegebener Unterschiede bzw. Spannungen einzuschränken. Metrik wurde somit 2 Vgl.Pheby: „Ein wichtiger Anhaltspunkt für die Wahrnehmung starker Silben besteht darin, daß der Wechsel zwischen schwachen und starken Silben rhythmisch geordnet ist: Im fließenden Redestrom erfolgt die Artikulation von starken Silben in zeitlichen Abständen, die so regelmäßïg sind, daß sie phonologisch als gleich gelten, und zwar unabhängig von der Zahl (meist 0 bis 4) der dazwischen liegenden schwachen Silben: [...]// manche ko / llegen / wisSEN DAS ABER / nicht //“ (Pheby 1981: 851) 6 hauptsächlich als ein Transkriptionsproblem angesehen3. Bei aller Schwierigkeit, einen gemeinsamen Nenner für die Größen der unterschiedlichen, im Deutschen zahlreich vertretenenen Prosodien herauszufinden, galt es wenigstens, die Größenspannung bzw. den Unterschied zwischen objektiven Betonungsvarianten wiederzugeben. So paradox es klingen mag, erweisen sich die Erwartung auf mechanische Widerspiegelung und der Verzicht auf jede Vorstellung der Durchsichtigkeit hinsichtlich der Metrik als aufeinander bezogene, gegenseitig korrelierende Einstellungen. Als Bindeglied untereinander tritt allerdings die historistische Metriklehre auf. Höchst bezeichnend erscheint hierzu Wagenknechts Diktum, deutsche Metrik sei eigentlich Versgeschichte: Erst recht bilden Silbenzählung und Reimbindung kein durchgehendes Charakteristikum. Wie die Geschichte der deutschen Literatur überhaupt ist auch die ihrer metrischen Formen wesentlich durch die Übernahme und Anverwandlung fremder Muster bestimmt – vor allem aus der Antike, aber auch aus den Literaturen Frankreichs und Englands. Viele der gebräulichsten Versmaße (Hexameter, Alexandriner, Blankvers) geben ebenso wie viele der Strophenmaße und Gedichtformen (Sapphische Strophe, Terzine, Sonett) schon mit ihren Namen die Herkunft aus dieser oder jener außerdeutschen Literatur zu erkennen. Darum ist eine deskriptive Metrik des Deutschen nur als historische, als Geschichte verschiedener deutscher Metriken, als Versgeschichte möglich (Wagenknecht 1981: 30). Der Hinweis auf die Geschichte stellt eine nachvollziehbare Dimension der Metrikdiskussion dar, solange die Frage nach Verbindungsbedingungen von Hebung und Senkung ausgeklammert bleibt. Wagenknecht greift zwar kursorisch auf vorphänomenologische Einblicke zurück, wie Moritzens Silbenrelativismus oder Kiparskys Silbenschweregrade; aber er zeigt sich letztendlich vor dem Historismus kaum gefeit. Als Grund dafür ist eine Art epistemologischer Relativismus anzuführen: in der deutschen Metrikkunst seien nämlich allzu viele Metriksorten vertreten; daher ließe sich keine besondere Sorte als für das Deutsche charakteristische ausmachen: „Eine ‚Deutsche Metrik’, verstanden als Inbegriff der Regeln, nach denen die Gesamtheit [sic!] der deutschen Versdichtung bestimmt wäre, gibt es offenbar nicht. Ich habe sechs verschiedene ‚Metriken’ angeführt und könnte diese Zahl noch vermehren“ (Wagenknecht 1981: 30). Andere Autoren haben sich ferner zum Taktbegriff Heuslers ausdrücklich bekannt. Jedoch reichte es nicht aus, dass Heuslers Terminologie übernommen wurde, um vor verblendendem Historismus geschützt zu sein, wie z.B. Paul/Glier und Behrmann je aufweisen. Bei aller Bereitschaft, den Taktbegriff des Schweizer Mediävisten zu übernehmen, bleibt doch ein letzter Einblick in die germanische Prosodie verwehrt, solange eine musikalische bzw. akustische 3 Eng verbunden mit der Überzeugung, die deutsche Metrik sei hauptsächlich das Ergebnis unterschiedlicher Einflüsse (s.u.), steht die Ansicht, dass Notationsfragen klarer und ergiebiger aussehen als Fragestellungen über Prosodiegrundsätze. Dem würde Wagenknechts Fazit zur Notation entsprechen: “In Abwägung der Vorzüge und Nachteile, die jedes der genannten (sowie der hien ungenannt gebliebenen) Notationsverfahren mit sich führt, möchte ich dafür halten, dass die ältere deutsche Verslehre nicht schlecht beraten war, als sie die Zeichenschrift der antiken Metrik für ihre Zwecke übernahm [...] Sobald nur ein für allemal sichergestellt ist, daß die Symbole der Klassischen Philologie hier[sic!] noch keine bestimmte Prosodie definieren, stehen sie zur einheitlichen Kennzeichnung von Metren der prosodisch unterschiedlichen Systeme bereit” (Wagenknecht 1981: 23). 7 Auffassung des Taktes vorherrscht und eine funktionell aufgeschlossene, phänomenologisch zur Abstraktion ausgerichtete Interpretation ausbleibt. Fehlt der Ausblick auf den Takt als Rahmenbedingung und überwiegt dagegen sein Verständnis als akustische Größe, dann sind die Interpreten der Unbestimmtheit ausgesetzt, wann die Anreihung von Hebungen und Senkungen als Reihenfolge von Jamben, wann von Trochäen abzulesen ist. Ähnlich wie der Lautschall an sich noch kein Phonem ausmacht, sondern dies erst durch das Abheben gegenüber anderen Lauten möglich wird, so bedeuten weder Betonung noch unbetonte Silbe an sich unbedingt eine Hebung bzw. eine Senkung. Erst die Zusammenstellung macht es möglich. Als drittes Kennzeichen der traditionellen Metriklehre darf schließlich die Skepsis genannt werden, die bei Wagenknecht nicht undeutlich zu verspüren ist. Besonders entschieden vertritt diese Perspektive der dänische Germanist Leif L. Albertsen, als er vollkommen die Möglichkeit einer Bestimmung der deutschen Metrik in Abrede stellt. Dabei preist er einerseits die Ernüchterung an, die gegenüber Heuslers Ansätzen die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts gekennzeichnet haben soll, „nachdem [...] die üblichsten Wahnvorstellungen von ihren Erkenntniseffekten als heute veraltet zurückgewiesen wurden“ (Albertsen 1984: 18). Andererseits führt Historismus bei ihm zu jener resignativen Einstellung,welche nicht nur auf Durchsichtigekeit verzichtet, sondern auch jede Aussagekraft der Metrik, es sei denn man versteht sie als dokumentarisches Zeugnis einer ererbten Kulturvielfalt: Wenn uns also die Metrik weder erzählen kann, welche psychologische Wirkung jeweilige Verse auf nicht erfahrene Rezipienten haben, noch (abgesehen von Ausnahmen), wie der Autor seine Verse gelesen haben wollte, noch wie sie heute zu lesen sind, bleibt vielleicht noch die Hoffnung auf ein immerhin zusammenhängendes System [...] Aber die Metrik läßt sich heute nicht mehr als ein symmetrischer Palast oder als eine organisiserte Fabrik veranschaulichen, eher noch als eine unsystematische Ansammlung von überwiegend einstöckigen Villen; der Metriker macht im Viertel seinen Abendspaziergang und trinkt seinen Wein im Garten des einen oder anderen Nachbarn (1984: 16). 2. Leistungen des phänomenologischen Taktes Gegen diese alte, innerhalb der Metriklehre der Bundesrepublik besonders heftige Skepsis stellen sich die Ausblicke von eben bewanderten Mediävisten bzw. Sprachhistorikern wie Heusler, Arndt und Fourquet. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Vertiefung der älteren Einsicht, der deutsche Vers beruht auf der Abwechselung zwischen Hebung und Senkung, ohne aber von vornherein Hebung und Betonung gleichzusetzen. Von da an ist den bereits gestellten Fragen kaum Einhalt zu gebieten: Wie lassen sich in einem mutmaßlichen jambischen Bau Trochäen zu Versanfang erklären? Wie kann man sich für Hebung oder Senkung entscheiden bei zwei in ihrem Schweregrad ähnlichen Silben? Wohin gehören zwei sog. Kürzen: zum Anapäst oder etwa zum Daktylus? Falls zwischen zwei Hebungen zwei 8 Senkungen auftreten, handelt es sich etwa um einen Choriambus, um einen Daktylus oder um einen Anapäst? Muss die eine oder die andere Kadenz immer in der Überzahl sein? Wozu ist Metriklehre überhaupt nützlich? Grundlegend für den Erklärungsansatz ist die Bestimmung des Taktes durch Erwin Arndt, der bald die Berührungspunkte seiner Vorschläge mit denen Jean Fourquets bescheinigt hatte: Der [metrische] Rahmen ist taktmäßig gegliedert. Unter Takt verstehen wir den etwa gleichen Zeitabstand von Hebung (= betonte Silbe, auch Iktus genannt) zu Hebung, von Iktus zu Iktus. Die Gleichheit – die ungefähre Gleichheit – dieser Zeitspannen von Hebung zu Hebung bleibt auch im Vers erhalten und hörbar [...] Im Vers bedeutet der Takt aber keine wirkliche Sprechgruppe [...] Verstakt und Sprechtakt (Glied, Kolon) decken sich nicht, sondern nur ihre Hebungen. Der Verstakt ist nur eine begriffliche Einheit, der Sprechtakt eine reale (Arndt 1996: 63; Kursivdruck sic!). Die Bestimmung des Taktes als abstrakter Rahmen bedeutet eine entscheidende Wende gegenüber der herkömmlichen Gleichsetzung von Hebung und Betonung. Die Vorstellung vorgegebener Versfüße konnte somit durch die Bestimmung des Taktes als rhythmusstiftende Instanz ersetzt werden. Solange man an solide Betonungsverhältnissen festhielt, war nämlich kein Taktbegriff nötig. Sobald aber von der Unbeständigkeit, sogar Unvorhersagbarkeit des deutschen Wortakzents ausgegangen wurde, war man auf irgendwelchen Bezugsrahmen angewiesen. Erst der Rahmen sollte darüber Bescheid sagen, was Hebung, was Senkung ist. Dazu gehörte vorerst die Einsicht, man dürfe nicht mehr über die metrischen Verhältnisse loser Wörter spekulieren. Es helfe nichts zu behaupten, dass Wörter wie „lachen“ oder „Lachende“ einen Trochäus oder einen Daktylus darstellen, denn der Takt stellt keine absolute Größe mehr dar. Er ist vielmehr Bestandteil einer wiederkehrenden Kette. Innerhalb der Kette können wohl beide Wörter selbständige Takte darstellen, aber sie müssen es nicht. Kraft der Fokussierung kann jeder mutmaßliche Akzent abgeschwächt werden, wie uns (4) zeigte. Darüber hinaus stellt sich gleich die Frage nach der Funktion besagten abstrakten Rahmens. Inwieweit tragen Anreihung und Rhythmus zur Bestimmung dessen bei, wann eine Silbe als Hebung, wan als Senkung gelten kann? In der Tradition von Karl Philipp Moritz macht Fourquet hierbei einen endgültigen Schritt, als er die Grundregel („regle fondamental“) aufstellt: Le remplissage du temps faible ne doit pas dépasser, en poids accentuel, celui du temps fort; il doit être inférieur ou au plus égal, ce qui peut s’exprimer par un symbole mathématique : S(enkung) ≤ H(ebung) […] le temps fort d’une mésure peut être occupé par n’importe quelle syllabe, même la plus faible, pourvu que le remplissage du temps faible soit aussi faible; exemple ‘|seli|ge Ge|schlehter’. En allemand : ‘Hebungsfähig ist jede Silbe, auf die nicht eine tonstärkere folgt’ (Fourquet: 13; Fettdruck sic!). Fourquets Zuspitzung von Moritzens Behauptungen führt somit eine grundlegende Unterscheidung zwischen Betonung und Hebung ein. Anscheinend handelt es sich um eine geringfügige Voraussetzung, in der Tat aber stellt es eine hohe Herausforderung dar, wie bei 9 Dichtern zweiten Ranges leicht einzusehen ist. Indem der Takt als semiotischer Rahmen gründlich erschöpft wird, wird jede Silbe als hebungsreif angesehen, unabhängig gleichsam von ihrem Kennzeichen als betont oder unbetont im Aussprachewörterbuch. Prosodisch zieht die Regel das allzu tagtägliche Erlebnis der Abschwächung herbei. Theoretisch muss die Silbe nach der Hebung das Gewicht der Hebung nicht übersteigen. In der Praxis heißt es, im Takt kann die Senkung dermaßen abgeschwächt werden, dass die Aussage keinen Schaden, sprich Tonbeugung erleidet. Paradoxerweise scheint diese Bedingung nicht besonders schwer bei volltönigen Silben zu erfüllen zu sein, wie bei der eventuellen Abschwächung von „GING„ in (5), aus Brecht Apfelböck oder die Lilie auf dem Felde: (5) Die Tage gingen und die NACHT GING AUch A| Hs|H s | H s | H s | H Λ| Eigentlich stellt sich die Herausforderung erst bei der Nachbildung des alten pyrrhischen Versfußes (), also wenn bei zwei mutmaßlich unbetonten, prinzipiell senkungsreifen Silben, ein bedeutenderes Vortragen der ersten abverlangt wird. Dies geschieht in den Versen 2 und 3 vom Beispiel (6), aus Brechts Vom Brot und den Kindlein, wo offenkundig keine Tonbeugung eintritt Dabei kann zum Einen anhand des Zahladjektivs „ein“ ein erster Blick auf die Unterstützung der Deixis durch die Metrik geworfen werden. Zum Zweiten kann man einschätzen, wie entschieden der Dichter von Fourquets Grundregel Gebrauch macht. Die eEpenthese erlaubt einen Takt zu schaffen, während im dritten Vers eine ähnliche Kombination von anscheinend unbetonten, doch taktfähigen Silben auftritt wie in der Regelbestimmung durch Fourquet. (6) Die werden sich noch stürzen [] A| H s | H s | H s | Auf EIN STÜckELEIn Brot A | H s | H s| H Λ| Mit wenigEN GEwürzen [] A| H s| H s|H s | Immerhin pflegte Brecht diese unterste Füllung des Taktes nicht so häufig wie andere Klassiker. Schiller z.B. schien durch diese Art Pyrrhische Füllung die Zwänge der Klassizismus aufsprengen zu wollen. Doch ab und zu trifft man auch bei Brecht auf solche Lösungen, wie (7) aus Exerzitien vom Mitmensch nachweist: (7) Sie wartetEN. MIt Schwamm und Leinen! A | H s| H s | H s | H s | Sie grüßten mIT TROmpetenschall. 10 A |H s | H s | Hs| H Λ| Der Takt stiftet somit eine kontextuelle Bestimmung von Hebung und Senkung, welche die empirische, naturalistische Gleichsetzungserwartung um vieles und Entscheidendes ergänzen . kann. Es handelt sich um einen Mittelweg, durchaus künstlicher Natur, zwischen der sprachtypologischen Veranlagung und der Vielfalt der tagtäglichen Sprechweise. Als ausgesprochen akzentzählende Sprache enthält das Deutsche in der Pragmatik und Intonation der offenen Rede zwar ein zahlreiches Repertoire an Abschwächungsszenarien, das weit über die ein- bis dreisilbigen Takte der Kunstmetrik geht. Doch die Kunstmetrik bringt eine wirksame Selektion aus solchen Spannungsmöglichkeiten hervor. Dadurch wird der Takt zu einem eleganten, ökonomischen, leistungsfähigen, also einem stilisierten Zitat der deutschen Prosodie. Er fußt auf einer Voraussetzung, gleichsam einem Verbot. Abgesehen von systematischen Ausnahmen wie der männlichen Kadenz muss nämlich prinzipiell in der zweiten Silbe die Möglichkeit zur Senkung bestehen. Damit wird zugleich der Tonbeugung vorgebeugt. Solange aber dies gewährleistet wird, lassen sich die gewöhnlichen Intonationstendenzen des Deutschen durchsetzen. Ferner bedeutet die Pflege eines Schemas keineswegs eine starre Leseweise. In deren Anreihung lassen Takte ferner nicht selten interessante Interpretationsmöglichkeiten offen, die sich umso verlockender ausschlagen, je strenger die zu überwindenden Hürden sind. Die genauere Bestimmung von Takt und Hebung zeigt weitere Vorteile auf, wodurch die Bestimmung eines metrischen Schemas an Leistungskraft gewinnt: A) Anders als bei dem traditionellen Schwanken zwischen Jambus und Trochäus, dessen Zuordnung gewöhnlich erst auf Grund der ersten Vers- bzw. Gedichtensilbe erfolgte, geht der phänomenologische Taktbegriff vom Trochäusgebilde aus; d.h. von der Anreihung von Hebung und Senkung. B) Das Bild des Trochäus ermöglicht einen verlässlichen Ansatz. Die Zählung geht von der ersten Hebung aus. Somit kann ebenso der alte Begriff des Auftaktes auf systematische Weise erklärt werden. Beim Auftakt handelt es sich um eine Übergangssilbe, die sowohl leicht als auch schwer sein kann. Gewöhnlich ist sie leicht, was des Öfteren Anlass zur Einstufung als Jambus gegeben hat. Doch sie kann auch einen schwereren Grad ausweisen, wie der 4. Vers vom Beispiel 3 nachwies. Der Auftakt besteht darüber hinaus gewöhnlich aus einer einzigen Silbe. Allerdings untersteht er einer Voraussetzung. Er muss nämlich durchgehend in der ganzen Strophe bzw. Komposition entweder durchweg auftreten oder durchweg ausbleiben. C) Die Bestimmung des Taktes als Trochäusgebilde liefert eine nachvollziehbare Erklärung für die Kadenz. Sie ist keine gelegentliche Art mehr vom Versende, sondern sie gehört vollkommen zum metrischen Schema. Die paroxytone, die sogenannte weibliche Kadenz wird als letzter 11 vollständiger Takt, die oxytone, die sog. männliche Kadenz als unvollständiger letzter Takt bestimmt. Vgl. Beispiel (6). D) Die männliche Kadenz erweist sich somit als systematische einsilbige Variante des Grundtaktes. Eine zweite, jedoch außer der antiquisierenden Dichtung kaum systematische Variante stellt das Daktylusgebilde dar, d.h. die Reihenfolge Hebung/Senkung/Senkung. Gemäß Fourquets Vorschlag sollte man bei der Schemenangabe lieber die Bezeichnung anisosyllabisch (“mit ungerader Silbenzahl”) verwenden. Den Hinweis kann man freilich nachvollziehen, wenn es darauf ankommt, herkömmliche überschnelle Assoziationen mit den alten Metren zu vermeiden. Bei Dichtern wie Heine und Eichendorff ermöglichen anisosyllabische Lösungen eine Verlängerung der Aussage, die sich dann als empfindsames, eventuell klagendes Unterstreichen hören lässt. Doch gleichzeitig eröffnet der Anisosyllabismus eine Interpretationsspanne. Wie sonst des Öfteren eröffnet der Anisosyllabismus im 3. Vers von Beispiel (3) eine gewisse Leerstelle, je nachdem welcher Takt für anisosyllabisch gehalten wird. Gegenüber der unmarkierten, profillosen Aussage von (8a), stellt (8b) ein deutliches, geradezu ausschließendes Unterstreichen des Subjekts dar: (8a) Sie riefen, sie WOllten essen A| H s s| H s |H s | (8b) Sie riefen, SIE wollten essen A| H s | H s s |H s | Damit legt der Takt eine von Brecht durchaus wahrgenommene Besonderheit der Metrik an den Tag. Das metrische Schema kann dazu leiten, unscheinbare Textstellen zu unterstreichen und somit die gestische, bezeichnende Rede des Autors mit zu vollziehen. Kaum eine andere Verschriftlichungsart lässt eine so feinfühlige Anleitung walten. E) Wie ab Beispiel (5) festgestellt werden kann, gewinnt die Notation in der phänomenologischen Metriklehre an Klarheit. Einerseits wird die Taktgrenze angegeben, was in der traditionellen Notation durch Strich und Haken nicht gewöhnlich war. Andererseits wird nicht nur der Auftakt angegeben (hier durch „A“), sondern auch der ausbleibende Taktteil der sog. männlichen Kadenz. In Anlehnung an Fourquet wird hier dafür „Λ” („leimma“) weiter benutzt. Darüber hinaus schlage ich vor, die Abkürzungen „H“ und „s“ für Hebung und Senkung zu benutzen, was gegenüber dem gewöhnlichen akzentuierten „x“ für Hebung erstmal eine computerfreundliche Lösung darbietet. Dadurch kann ferner die kritische Perspektive zur Annahme bekräftigt werden, in der Metrik habe man mit sachlichen, natürlichen Größen zu tun. Vielmehr geht es hier erneut um die Stilisierung einer Veranlagung, keinesfalls um eine Transkription. Die Position „s“ kann ruhig von der gleichen Silbe bzw. dem gleichen Wort gefüllt werden, die oder das eben die Position „H“ besetzt hat, wie Beispiel (4) nun als (9) zeigt: 12 (9) Und DU? –DU gibst es mir? A | H s | H s| H Λ Auch bei Brecht findet man diese anspruchsvolle Umkehrung metrischer Werte; vgl. (10): (10) Wenn er da wAR, WAr für einen Abend H s |H s | H s|H s | H s | Der Umfangssunterschied zwischen den erschlossenen Gebieten verbietet zwar einen angemessenen Vergleich, doch als epistemologische Leistung lassen die Schritte zur Grundlegung einer phänomenologischen Metriklehre durchaus an die Schritte des Ferdinand de Saussure in der Anbahnung des linguistischen Strukturalismus erinnern. So wie der Neugrammatiker und Fachman für Sprachgeschichte neben seinen Beiträgen zur vergleichenden Sprachwissenschaft, im Cours de linguistigue générale die Frage nach dem semiotischen Wert sprachlicher Zeichen mit beispielloser Folgerichigkeit aufgworfen hat, haben sich die Mediävisten bzw. Sprachhistoriker Andreas Heusler, Jean Fourquet und Erwin Arndt folgerichtig die Frage der Spielregeln vorgenommen, die für den metrischen Bau gelten. Anstatt sich auf die Belege aus der Geschichte einzuschränken, versuchen alle drei Fachleute, die Grundlage zu bestimmen, wodurch die Rezeptionsvorgänge aus anderen metrischen Traditionen erst effektiv werden konnten. 3. Anwendungen der Metrikkritik. Gegenüber dem herkömmlichen Heranziehen historischer Bestimmungsmomente bedeutet die phänomenologische Metrikkritik einen deutlichen Fortschritt in der Beschreibung der künstlerischen Bearbeitung der Prosodie des Deutschen. Es bleiben zwar noch weite Felder im Schatten der Diskussion, wie zum Beispiel eine bessere Bestimmung der Schrift-LautZugehörigkeit, doch der Gewinn an Explizitheit scheint unbestreitbar. Genauso wie bei vielen anderen schriftlich geregelten Sprachen, besonders denjenigen, wo der dynamische Akzent eine lebhafte Evolutionsbewegung bedingt, lassen sich im Deutschen oft Anlässe offensichtlichen Mangels an Übereinstimmung zwischen Schrift und Laut wahrnehmen. In einer aus typologischer Sicht recht archaischer Sprache wie Deutsch ist ein Zeichen dafür u.a. die Schreibung abgeschwächter Flexionsformen. Oft entspricht da die grafische Gestaltung nicht mehr dem tatsächlichen mündlichen Gebrauch. Da aber Metrikanalyse mit Hilfe von konventionellen grafischen Normen erfolgt, ist es kein Wunder, wenn da gelegentlich Unstimmigkeiten auftreten, was die genaue Bestimmung von Takten anbelangt. Auch wenn sich solche Unstimmigkeiten gewöhnlich als harmlos für die kunstmetrische Analyse erweisen, treten trotzdem genügend Verwirrung stiftende Fälle auf. Sie mahnen, den eventuellen Mangel an Übereinstimmung zwischen Orthografie und Aussprache nicht zu 13 übersehen. Beispiel (11) könnte mit Hilfe eines anderen Gedichtes von Bertolt Brecht, diesmal aus den Buckower Elegien, eine solche Einschränkung nahelegen. (11) Der Blumengarten Am See, tief zwischen Tann und Silberpappel A| H s | H s | H s |H s |H s | Beschirmt von Mauer und Gesträuch ein Garten A| H s | H s| H s |H s |H s | So weise angelegt mit monatlichen Blumen A | H s | H s | H s | H s s [s] | H s | Daß er vom März bis zum Oktober blüht. A| H s | H s| H s |Hs | H Λ| Hier, in der Früh, nicht allzu häufig, sitz ich A| H s | H s| H s|H s s | H Λ| A| H s | H s| H s|H s | H s Und wünsche mir, auch ich mög allezeit A| H s|H s |H s |H s |H Λ| In den verschiedenen Wettern, guten, schlechten A| H s| H s s| H s |H s | H s | Dies oder jenes Angenehme zeigen. A | Hs| Hs|H s|H s |H s | A5W A5W A5W A5M A5M?/A5W? A5M A5W A5W Die Bestimmung des kunstmetrischen Schemas zeigt, wie streng und zugleich offen sich die Fünfheber mit Auftakt („A 5“), oft fünfhebige Jamben genannt, auswirken. Es wird auf den Endreim verzichtet. Trotzdem zeigt sich eine deutliche Spannung zwischen Anfang und Ende des Gedichts einerseits und dessen Mitte andererseits und zwar mit dem Pronomen „ich“ im 5. Vers. Je nachdem, ob die Reihenfolge von den letzten Takten entweder als Daktylus und männliche Kadenz („M“) oder aber als Trochäus und weibliche Kadenz („W“) interpretiert werden, ergeben sich recht unterschiedliche Lesarten. Sie beleuchten das Spielfeld der Kunstmetrik in den Händen des Dichters. Allerdings grenzt das Beispiel in gewissem Sinne an den Rand der Kunstmetrik. Es zeigt zugleich, was für Unstimmigkeiten die Zuordnungsverhältnisse zwischen mündlicher Sprache und Orthografie hervorrufen können. Auch wenn im 5. Vers die Auslassung der Beugungsendung bei „sitz“ eintritt, bleibt im 3. Vers die Endung bei „monatlichen“ völlig erhalten, obwohl offensichtlich die Flexionsform für Dativ Plural vollkommen abgeschwächt wird. Die Verwendung eines abgesteckten Taktbegriffes stellt mittlerweile zwei verschiedenen Interessenfeldern Werkzeuge zur Verfügung: der Vortragskunst und der Interpretation. Jahrhunderte lange Trennung zwischen Metriklehre und Metrikwerk hat bewiesen, dass bei der Ausnutzung der deutschen Prosodie Dichter keine Betreuung seitens der Gelehrten nötig haben. Doch um deren Leistungen im doppelten Sinne zu interpretieren, also um sie vorzutragen bzw. sie genauer auszulegen, mag ein fester Metrikbegriff von Hilfe sein. An die Möglichkeiten, die sich dabei eröffnen, wollen wir hier nur bruchstückhaft erinnern, indem weitere Beispiele aus dem abgegrenzten Feld von Brechts Produktion in den 20er Jahren herangezogen werden. 14 Die Metriklehre bewährt sich als ein hilfreiches, ergänzendes Werkzeug für die Textanalyse. Neben anderen Werkzeugen hilft sie festzustellen, ob der Autor beim Vortragen mit bestimmten Absichten gerechnet hat. So wie der Rhythmus auf die Bewährung des sprachlichen Kunstwerkes als mündliches Phänomen angelegt ist, kann die Metrik genauso gut als Testmittel herangezogen werden, um die Annahmen aus weiteren Beobachtungspunkten zu bestätigen oder auszuschlagen. Da Verskunst im Vortragen ihre Erfüllung findet, darf davon ausgegangen werden, dass der Dichter für eben diesen Moment Anleitungen in den Text eingearbeitet hat. Besonders wirksam zeigt sich hier die performative Deixis, wozu in der Schriftlichkeit kaum Mittel zur Verfügung stehen, es sei denn es handelt sich um vortragsunbanhängige Verfahren wie Fett- und Kursivdruck oder die Ausrufe- bzw. Anführungszeichen. Ohne nach diesen befremdenden Mitteln zu greifen, kann der Dichter über die Metrik indessen seine Anleitungen erteilen, wie uns die metrische Analyse zeigt. Recht ergebnisreich zeigt sich die Metrik im Bereich der Pronominalisierung und der Deixis. Brecht bewies dabei große Kunst, als er in Frage kommende Personalpronomina, gelegentlich auch Possessivpronomina jeweils in die Hebung oder in die Senkung gesetzt hat. In Exerzitien vom Mitmensch(12) kann man bewundern wie das Personalpronomen “er” dann in der Hebung ist, wenn der Protagonist seine Identität durchsetzt, während umgekehrt das gleiche Pronomen in der Senkung bzw. im Auftakt steht, wenn es um die Perspektive der Anderen geht. (12) Schrie ER LAUt auf, als ER ROt, elend A| H s | H s | H s | H s | [...] Von nun an sind sie ihm gewogen. A |H s| H s |H s|H s | Er ist ihr KIND, Er ist ihr Mann. A |H s | H s| H s | H Λ | Ebenso ergiebig erweist sich die metrische Analyse beim Aufspüren möglicher Verwendungen des bestimmten Artikels als Demonstrativpronomen. Beispiel (13) stammt aus dem Gedicht Von der Kindesmörderin Maria Farrar. Prinzipiell handelt es sich um sog. fünfhebige Jamben, d.h. die oben herangezogenen Fünfheber mit Auftakt. Beispiel (13) aber zeigt eine Stelle, wo der Vorleser entweder einen Sechsheber vorträgt oder einen besonders hastigen Fünfheber. In dieser wahrscheinlicheren Lösung müssen indessen das Pronomen für die Kindesmörderin („ihr“) dramatisch abgeschwächt und die umgangssprachliche Pronominalisierung des Artikelworts „den“ folgerichtig durchgenommen werden: (13) Jedoch gelINGT ES Ihr, dEN SCHMERZ GEheimzuhalten. A| Hs | H s s | H s s | H s| H s | Persiflierter Hohn statt Hohn mag als Grundgestus dieses Gedichts genannt werden, so wie der Dichter ausdrücklich zu verstehen gibt („Doch sie war nicht, wie andre Mütter sind, obschon — / Es liegt kein Grund vor, daß ich sie verhöhne”). Insofern kann der Dichter ebenso gut den 15 Spielraum der Metrik meisterhaft ausnutzen, um die tiefen, doch gezwungenermaßen aufzugebenden Gefühle der Kindesmörderin darzustellen. Das unscheinbare, für die Maria Farrar stellvertretende Pronomen “ihr” nimmt im Beispiel (14) die Hauptposition im vorletzten Takt ein. Somit muss das Pronomen besonders vehement durch den Vorleser hervorgehoben werden. Sonst würde da Tonbeugung eintreten: (14) Denn ihre Sünd war schwer, doch IHR LEId groß A| Hs |H s |H s | H s | H Λ| Ähnlich wie Artikelwörter und Pronomina bieten übrige Synsemantika wie Konjunktionen außerordentliche Chancen, unerwartete Hervorhebungen, sogar eine Umkehrung der Erwartungen, hervorzurufen. Ein weiteres Gedicht aus der Hauspostille, wo Hohn anvisiert wird, ist Apfelböckoder oder die Lilie auf dem Felde. Daher stammt Beispiel (15), wo die Aufzählung deutlich die Gefühle überwiegt. Dazu mag die Setzung der sonst unscheinbaren Konjunktion „und“ in die Hebung entschieden beitragen. Die Entscheidung erfährt ein wirksames Pendant dadurch, dass die auserlesene, erhabene Form des Verbs werden durch die dunkle Setzung in die Senkung düpiert wird, was sich gleich in Einklang mit der trivialen Wahl der neuen Schlafstätte erweist: (15) Da weinte Jakob UND WArd krank davon. A | H s |H s | H s |H s | H Λ| Und schlief von nun an nur auf dem Balkon. A| H s | H s| H s | H s | H Λ| Die Verselbständigung schablonenhafter Teile der Rede auf Kosten vollsemantischer Stellen wird in Von der Kindesmörderin Maria Farrar noch durch einen bestimmten Takt im Refrain bekräftigt. Dem Vorleser wird dabei die Möglichkeit der Reduktion des Verbs „braucht“ nahegelegt wird und dies zwar in allen neun Strophen des Gedichtes. Indem er sich dem Publikum zuwendet, soll er Folgendes (16) beteuern: (16) [.... ....] wollt nicht in Zorn verfallen Denn alle KreatUR BRAUcht Hilf von allen. A | H s | H s| H s | H s | H s |. Brechts meisterhafte Anwendung in der Behandlung der Metrik lässt sich schließlich ebenso schätzen, wenn es um die strengere Form auftaktloser Verse geht; wenn der Dichter sich also vornimmt, durchweg auf die Überganssilbe des Versanfangs zu verzichten. Dies erfordert einen durchgehenden Versanfang in Hebung, was gemeinhin als Gelegenheit zu einem erhabeneren, aufdringlicheren Ton wahrgenommen wird. Doch der Dichter der Dreigroschenoper weiß ebenso sehr genau den besten Nutzen aus der Senkung zu ziehen. Gleichsam als Einladung an den Sänger, dass er um Schweigen mahnend den Finger vor den Mund führt, setzt der Dichter die Negationswörter ergerade in die Senkung des 4. Verses vom Beispiel (17). 16 (17) Und das große Feuer in Soho H s | H s| H s s | H s | Sieben Kinder und ein Greis H s| H s | H s | H Λ| In der Menge Mackie Messer, den H s| H s |H s s|H s| Man nicht fragt, und der nichts weiss. H s| H s |H s | H Λ Die wenigen Beispiele, die angeführt worden sind, mögen gezeigt haben, welche begrifflichen und anwendungsbezogenen Gewinne aus der phänomenologischen Metrikkritik gezogen werden können. Einerseits wird auf grundsätzliche, für die Bestimmung rhythmischer Schemata unausweichliche Fragen nachvollziehend geantwortet. Andererseits liefert sie ein zusätzliches Werkzeug zur Analyse vorgegebener Texte. Dadurch gewinnt die Interpretation in ihrer zweifachen Ausrichtung verlässliche Anleitungen, sowohl als Textinterpretation wie auch im Sinne eine performativen Ausführung. Schon aus diesem Grunde scheint es angemessen, die traditionellen historistischen Annäherungen an den deutschen Versbau um das Taktverständnis der phänomenologischen Metriklehre zu ergänzen. Bibliografie: Albertsen, Leif Ludwig. 1984. Neuere deutsche Metrik. Bern u.a.: Peter Lang. Arndt, Erwin. 1996 (1958). Deutsche Verslehre: ein Abriß. Berlin: Volk und Wissen. Behrmann, Alfred. 1989. Einführung in den neueren deutschen Vers. Von Luther bis zur Gegenwart. Stuttgart: Metzler. Bockelmann, Eske. 1991. Propädeutik einer endlich gültigen Theorie von den deutschen Versen. Tübingen: Niemeyer. Brecht, Bertolt. 1981. Die Gedichte von Bertolt Brecht in einem Band. Herausgegeben vom Suhrkamp Verlag [...] in Zusammenarbeit mit Elisabeth Hauptmann. Frankfrut/M.: Suhrkamp. Fleischer, Wolfgang u.a. (Hrsg.). 1983. Kleine Enzyklopädie. Deutsche Sprache. Leipzig: Bibliographisches Institut. Gasparov, M. L. 1996. A History of european versification, edited by G.S. Smith with L. Holford-Strevens. Oxford: Clarendon Press. Goethe, Johann Wolfgang von (1956): Italienische Reise. In Goethes Werke. Hamburger Ausgabe. Hrsg. von Erich Trunz. Hamburg, Wegner. Bd. 11. Kiparsky, Paul. 1989. Rhythm and meter. Ed. by J.K. and Gilbert Youmans. San Diego: Academic Press. Heusler, Andreas. 1956 [1925]. Deutsche Vergeschichte mit Einschluß des altenglischen und altnordischen Stabreimverses. Berlin: de Gruyter. Fourquet, Jean. [1935]. Éléments de metrique allemande. Strasbourg/Paris: Faculté de Lettres de l’Université de Strasbourg/Les belles lettres. Fourquet, Jean.1989. Principes de métrique allemande. Paris : Hachette. Fourquet, Jean. 2001. Ce qui me reste en mémoire. Propos recueillis par Danielle Buschinger […]. Amiens: Presse du «Centre d’Études médiévales», Université de Picardie. Frank, Horst J. 1993. Handbuch der deutschen Strophenformen. Tübingen: Francke. Jünger, Friedrich Georg. 1987 (1952). Rhythmus und Sprache im deutschen Gedicht.Stuttgart: Klett-Cotta. 17 Moritz, Carl Philipp. 1973 (1786). Versuch einer deutschen Prosodie. Mit einem Vorwort zum Neudruck von Thomas S. Paine. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft. Internet: <http://www.lrz-muenchen.de/~mellmann/skripte /moritz-prosodie.pdf> Orduña, Javier. 2005. «Metrikstudien als Treffpunkt angewandter Germanistik», Estudios Filológicos Alemanes 8. S. 55-70. Orduña, Javier. 2006. «Sprachrhythmus als prosodische Herausforderung im Sprachkontakt Spanisch-Deutsch», Estudios Filológicos Alemanes 11 (Im Druck). Paul, Otto / Ingeborg Glier. 1979 (1961). Deutsche Metrik. München: Max Hueber. Pheby, John. 1981. “Phonologie”. In Grundzüge einer deutschen Grammatik; von einem Autorenkolleltiv unter der Leitung von K.E. Heidolph, W. Flämig u. W. Motsch, Berlin: Akademie. S. 839-898. Schlawe, Fritz. 1972. Neudeutsche Metrik. Stuttgart: Metzler. Sonderegger, Stefan. 1979. Grundzüge deutscher Sprachgeschichte. Berlin/NewYork: De Gruyter. Völtz, Michael. 1991. „Das Rhythmusphänomen“. Zeitschrift für Sprachwissenschaft 10/2. S. 284-296. 18