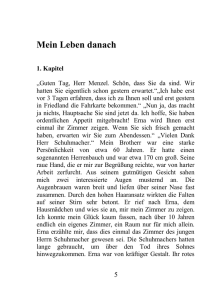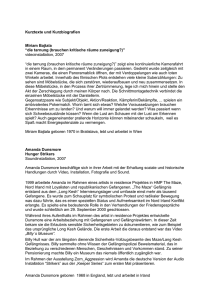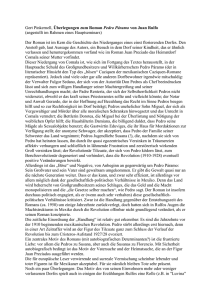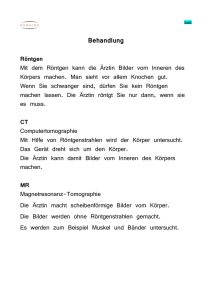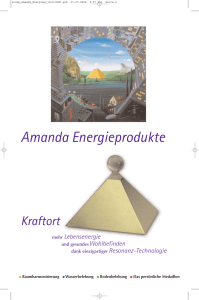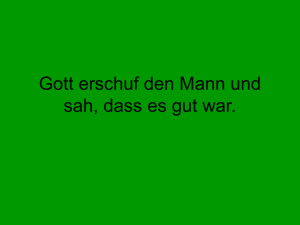Wenn Bücher wirklich erzählen könnten... Konsequenzen -1
Werbung

Wenn Bücher wirklich erzählen könnten... Konsequenzen -1Im Grunde weiß ich gar nicht so recht, wo ich mit meiner Geschichte beginnen soll. Vielleicht wird es das Beste sein, wenn ich mich zunächst vorstelle: Ich bin ein Taschenbuch und ich kann mit Stolz auf sage und schreibe zweihundertvierzehn akkurat gedruckte Seiten blicken. Das war’s dann aber auch schon, denn von sonderlich spannendem oder gar mitreißendem Inhalt scheinen die besagten Zeilen nicht zu zeugen. Warum sonst werde ich stets spätestens nach einer halben Stunde von meinen Lesern wieder zusammengeklappt und achtlos zur Seite gelegt? Das ist nicht nur äußerst frustrierend, sondern wirklich zum Weinen. Tja, was soll ich noch länger lamentieren? Das ganze Dilemma begann in der Buchhandlung am Rosenwall. Erst am Morgen war ich von den liebevollen Händen einer älteren Dame herausgeputzt und zwischen lauter prominenten Autoren in das Regal gestellt worden. „So, hier wirst du dich sicher gut verkaufen“, nickte sie mir lächelnd zu. Damals machte ich mir keine Gedanken darüber, weshalb mir die kluge Frau genau diesen Platz zugedacht hatte. Heute weiß ich, dass sie es tat, weil ich mein Dasein wohl sonst als Ladenhüter gefristet hätte. Nun, dies geschah glücklicherweise nicht. Bereits um die Mittagszeit interessierte sich eine gut gekleidete Frau Mitte zwanzig für ein Buch in meiner Nachbarschaft. Sie trug einen kleinen Jungen auf dem Arm, welcher seine klebrigen Hände immer wieder nach mir ausstreckte und mich schließlich aus dem Regal riss. „Das Buch gefällt dir wohl, Ole?“, fragte sie mit sanfter Stimme. Der Zwerg fühlte sich ertappt und ließ mich fallen. Ich stürzte aus großer Höhe auf den Rücken und blieb angeschlagen liegen. „Oje, sieh dir nur das arme Buch an“, begutachtete sie mich. „So wird es wohl niemand mehr kaufen.“ Während der Kleine vor Vergnügen gluckste, begab sich seine Mutter an die Kasse. „Ich nehme dieses Buch“, erklärte sie der alten Dame. „Oh, der Rücken ist beschädigt. Ich werde Ihnen ein anderes Exemplar aus dem Lager holen.“ „Das ist nicht nötig, ich werde es ohnehin mit in den Urlaub nehmen. Da kommt es nicht so drauf an.“ „Wie Sie wünschen“, entgegnete die Buchhändlerin erleichtert. „Wohin soll die Reise denn gehen?“ „Nach Mallorca. In zwei Tagen geht es los.“ „Ach, wie sehr ich Sie beneide. Ich weiß gar nicht, wann ich zum letzten Mal im Urlaub war. Es muss eine Ewigkeit her sein“, seufzte sie. „Ich nehme das Buch gleich so“, erklärte die Mutter des Jungen. „Plastiktüten schaden nur der Umwelt.“ „Das ist sehr umsichtig. Ich lasse Ihnen das Buch zwei Euro günstiger.“ „Das ist wirklich nicht nötig“, erwiderte die Kundin mit hochrotem Kopf. „Doch, doch, ich bestehe darauf.“ Peinlich berührt steckte sie mich in ihren Rucksack, zahlte und ging. Das wahre Leben hatte also für mich begonnen. Aus einem schmalen Spalt spähte ich ins Freie und konnte kaum glauben, wie groß die Welt außerhalb des Ladens wirklich war und ich würde sie nun entdecken. Dass ich dabei nur ein Verlegenheitskauf war, war mir egal. Für mich waren die klebrigen Hände des Jungen der verlängerte Arm des Schicksals. -2Mit jeder Stunde, die dem Antritt der Reise näher rückte, wurde Maria nervöser. Den ganzen Morgen schon herrschte in der Wohnung hektische Betriebsamkeit. Von meinem Platz auf der Kommode aus hatte ich alles im Blick. Immer wieder fiel ihr etwas Wichtiges ein, das unbedingt noch in den Koffer musste. Lutz, ein von künstlicher Sonne gebräunter Dreißiger, stand kurz davor, seine Geduld zu verlieren. „Hast du jetzt endlich alles?“ „Ja, ja, du hast gut reden, aber wehe, ich habe irgendetwas vergessen, dann bist du es doch, der Theater macht“, verteidigte sich Maria mürrisch. „Denk an die Obergrenze von 20 kg fürs Gepäck. Ich habe nicht die geringste Lust, Unsummen zuzuzahlen, weil du wieder zehn Paar Schuhe mitschleppen musst.“ Damit zog Lutz die Wohnungstür hinter sich zu. „He, wohin gehst du?“, rief sie ihm durch das Treppenhaus nach. „Ich fahr noch schnell an die Tanke“, vernahm sie seine Worte, ohne die Notwendigkeit seines Vorhabens nachvollziehen zu können. „Ich bin in einer halben Stunde zurück.“ „…aber du hast doch erst gestern getankt“, entgegnete sie gedämpft, während sie die Haustür ins Schloss fallen hörte. Maria zuckte die Achseln und machte sich daran, ihren Koffer noch einmal aus und wieder einzupacken. Vielleicht hatte Lutz ja Recht? Sieben Paar Schuhe mussten es nun wirklich nicht sein. Endlich war es soweit, die Koffer waren gepackt und im Wagen verstaut. Ole war sicherheitshalber in eine frische Windel gewickelt und Lutz hatte seinen Reisepass doch noch gefunden. „Hast du das Wasser abgestellt und den Gashahn zugedreht?“, erkundigte sich Maria zum dritten oder vierten Male bei ihrem Mann. Der verdrehte genervt die Augen und murmelte sich etwas in den kleinen Mongolenbart, den er sich zu Marias Verdruss seit neuestem stehen ließ. „Wie bitte?“ „Nichts“, entgegnete Lutz angefressen. „Können wir dann endlich los? Der Flieger wartet nicht auf uns.“ Maria und Lutz schienen nicht weniger aufgeregt, als ich es war. So sah es jedenfalls zu diesem Zeitpunkt für mich aus. Woher sollte ich wissen, dass sich die beiden schon seit einiger Zeit nicht mehr so gut verstanden? Während dies Maria auf den beruflichen Stress ihres Mannes schob und sich durch den Urlaub frischen Wind für ihre Ehe erhoffte, trug Lutz ein Geheimnis mit sich herum, welches ihm sehr zu schaffen machte. So lag ich also noch immer auf der Kommode neben der Wohnungstür und musste tatenlos mit ansehen, wie zunächst Lutz und schließlich auch Maria und Ole achtlos an mir vorbei ins Treppenhaus eilten. Am liebsten hätte ich laut hinter ihnen hergerufen, aber diese Möglichkeit ist mir leider nicht gegeben. Hilflos musste ich mit anhören, wie sich der Schlüssel im Schloss drehte und sich Marias Hackenschuhe über die Treppenstufen entfernten. Eine gewisse Traurigkeit ergriff mich. Wie gern wäre ich mit ihnen in den Urlaub geflogen, doch daraus würde nun nichts mehr werden. Ich erinnerte mich an die sanften Hände der Buchhändlerin und stieß einen tiefen Seufzer aus. Sollte mein neues, aufregendes Leben etwa schon an dieser Stelle in triste Einsamkeit verfallen? Ob ich am Ende nicht doch besser in dem Regal der Buchhandlung aufgehoben gewesen wäre? Ich war gerade dabei, mit meinem Schicksal zu hadern, als ich das erneute Klappern eines Schlüssels vernahm. Ich hatte mich nicht getäuscht. „Ah, da bist du ja, fast hätte ich dich vergessen.“ Oh wie schön das Leben doch plötzlich wieder war. Maria war extra wegen mir noch einmal zurückgekehrt. Sie nahm mich an sich, presste mich an ihre Brust und herzte mich. War ich eigentlich ein männliches oder ein weibliches Buch? Fest stand eigentlich nur, dass mein Verfasser ein Mann war. „Was hätte ich während der endlosen Warterei nur ohne dich gemacht?“, sprach sie und steckte mich in ihren Rucksack. Dann wurde es für einige Zeit dunkel um mich herum. Da ich bislang herzlich wenig von der Welt gesehen hatte, fiel es mir schwer, die verschiedenen Geräusche einzuordnen, die mich während der nächsten Stunden begleiteten. Mit Freuden hätte ich eine meiner unbedruckten Seiten dafür gegeben, wenn ich zwischendurch auch nur einen einzigen Blick auf das hätte wagen können, was sich außerhalb des Rucksackes tat. Ich weiß noch genau, wie gespannt ich war, als mich Maria endlich aus meinem Gefängnis befreite und ich zum ersten Mal die Welt von oben sah. Maria hielt mich direkt neben einem kleinen Fenster, an dem ich hunderte kleiner und großer Wolken vorbeifliegen sah. Oles Kopf lag auf ihrem Schoss und seine Füßchen auf den Beinen seines Vaters. Der Kleine schlief tief und fest. Fast hatte ich den Eindruck, als würde er leise schnarchen. Wie friedlich es hier oben im Himmel war. „Gefällt dir das Buch wenigstens?“, erkundigte sich Lutz nach einer Weile bei Maria. „Kann ich noch nicht sagen“, entgegnete sie zögerlich. „Bisher ist es eher langweilig.“ Das Zeichen zum Anschnallen unterband das zweifelhafte Lesevergnügen. Ole musste aus seinem Nickerchen gerissen werden, was er sogleich in energischer Tonlage quittierte. Das Flugzeug begann heftig zu vibrieren. Während einigen Mitreisenden der kalte Schweiß auf die Stirn trat und ängstliche Kinderschreie durch das Flugzeug gellten, entdeckte Ole seine Liebe zur Fliegerei. Er lachte vor Vergnügen und freute sich seines Lebens. Ich wusste, dass irgendetwas an diesem Kind nicht stimmte. Mein eingedellter Rücken konnte ein Lied davon singen. Immerhin war der Spuk nach fünf Minuten vorbei und wir hatten wieder festen Boden unter den Füßen. Was mich betraf, so verschwand ich wieder in der Dunkelheit von Marias Rucksack. Erst am Abend hatte meine Langeweile endlich ein Ende. Ich wurde auf ein Schränkchen neben dem Bett abgelegt. „Du wirst doch wohl jetzt nicht lesen?“, ließ Lutz ein gewisses Unverständnis durchblicken. „Ich bin müde, es war ein anstrengender Tag.“ „Dann schlaf doch“, entgegnete Maria schnippisch. „Das ist ja ohnehin das einzige, was dich seit einiger Zeit noch ins Bett treibt.“ Lutz zog ärgerlich seine Brauen zusammen. „Fang bitte nicht schon wieder an. Lass mich einfach nur in Ruhe.“ „Okay, aber dann reg dich aber auch nicht auf, wenn ich noch etwas lese.“ Lutz winkte ab, legte sich nieder und zog sich die Decke über den Kopf. Mir war’s irgendwie peinlich. Immerhin war ich der Grund für ihren Streit gewesen. So sah es für mich zumindest aus. Dennoch war ich sehr erfreut, als mich Maria zu sich ins Bett nahm und an der Stelle weiter las, an der sie das Lesezeichen eingelegt hatte. Einige Seiten weiter, ich hatte die kleine Auseinandersetzung längst vergessen, trat plötzlich das schlimmstmögliche Ereignis im Leben eines Buches ein. Der Supergau schlechthin. Auf der Seite, die Maria gerade las, wurde es feucht. Druckerschwärze verlief, verwischte mehrere Buchstaben zu einem unansehnlichen Fleck. An einer zweiten und einer weiteren Stelle geschah das Gleiche. Aus Marias Augen quollen große Tränen, kullerten über ihr trauriges Gesicht und tropften herunter. In meiner Verzweiflung rief ich, so laut ich konnte, um Hilfe, doch wie sollte sie mich hören, wo meine Rufe doch zwischen den Seiten verhallten? Immer mehr Tränen ergossen sich über meinen Körper. Noch hatte Maria nichts von dem Leid bemerkt, welches sie mir ungewollt zufügte. Sicher, streng genommen, waren einige verwischte Buchstaben nichts gegen ihre Traurigkeit, doch allmählich durchfeuchteten ihre Tränen das Papier und begannen auch noch die nächste Seite zu verwischen. Wenn sich mein Innenleben nicht gänzlich zur Unlesbarkeit entstellen sollte, musste ich etwas unternehmen und zwar sofort. Jetzt zählte nur noch der blanke Selbsterhaltungstrieb. Mit einem einzigen heftigen Ruck schaffte ich es, mich ihren Fingern zu entwinden. Der Rest war ein Kinderspiel. Geschickt rutschte ich über den glatten Stoff der Decke aus der Gefahrenzone. Der anschließende Sturz auf den Fußboden ließ sich leider nicht vermeiden. Wenigstens plumpste ich nicht wieder auf den Rücken. Durch den Sturz, oder vielmehr auf das dabei hervorgerufene Geräusch, wurde Maria wieder auf mich aufmerksam. Sie wischte sich die Tränen aus dem Gesicht, hob mich auf und legte mich zurück auf das kleine Nachtschränkchen neben ihrem Bett. Bevor sie das Licht löschte, sah sie noch eine ganze Weile zu Lutz hinüber. Noch ahnte ich nicht, welche Probleme die beiden miteinander hatten, aber allmählich dämmerte mir, dass ich vielleicht der Anlass, aber keinesfalls der Grund für ihren Streit gewesen war. Gänsehaut Eigentlich müsste diese Geschichte ‚ein Leben in der Warteschleife’ heißen. Seit zwei Tagen lag ich hier nun schon auf diesem Beistelltisch im Hotelfoyer herum und hoffte immer wieder aufs Neue, von irgendjemandem mitgenommen zu werden. Die Leute sahen mich, lasen die Buchbeschreibung und legten mich wieder zurück. Können Sie sich vorstellen, wie deprimiert ich war? Ja, ja, ich bin ein Buch zweiter Klasse, aber muss ich mir deshalb auf meinen Gefühlen herumtrampeln lassen? Andererseits konnte ich ja noch froh sein, dass mich die Putzfrau hierher gelegt hatte. Zumindest war es nicht langweilig. Von meinem Platz aus konnte ich eine Menge Leute vorbeilaufen sehen. Manche standen vor der Rezeption und beschwerten sich. Wenn Urlaub die schönste Zeit des Jahres sein soll, verstehe ich nicht, warum manche Leute die Hälfte dieser Zeit damit verbringen, sich über irgendwelche Kleinigkeiten zu ärgern. Andere setzten sich an einen der Tische, um sich mit irgendeinem Gesellschaftsspiel die Zeit zu vertreiben. Weiter hinten hing ein großer Fernseher an der Wand, vor dem sich allabendlich meistens Männer einfanden, um die Nachrichten des Tages zu verfolgen. Plötzlich rollte eine ältere Dame im Rollstuhl auf die kleine Ablage zu. Mir stockte der Atem, das Herz schlug mir bis zum Hals. Die anderen Bücher und Illustrierten drängelten sich mit ihren bunten Bildern in den Vordergrund. Wie sollte ich da eine Chance haben, mitgenommen zu werden? Die Dame schob die Zeitschriften zur Seite, ihre Hand öffnete sich, es durchströmte mich heiß und kalt, doch sie griff nach einem anderen Buch mit hübschem Einband. Traurig musste ich mit ansehen, wie sie es aufschlug und einige Zeilen darin las. Voll depri atmete ich einige Male tief durch und verdrückte die Tränen, um die Druckerschwärze nicht zu verwischen. Ich konnte es kaum fassen, als sie das Buch zur Seite legte und mich in die Hand nahm. „Na und du, steht in dir auch derselbe niveaulose Abklatsch wie in den anderen Boulevardlektüren?“ Tja, was sollte ich dazu sagen? Abgesehen von meinem Autor, der natürlich von mir überzeugt war, galt ich bislang eher als langweilig. Die alte Dame schlug eine meiner vorderen Seiten auf und las darin. Nach einer Weile wippte sie unentschlossen den Kopf und schlug eine Seite in meiner Mitte auf. Schließlich lächelte sie zufrieden. „Na, da scheine ich ja endlich mal wieder auf eine nette Geschichte gestoßen zu sein.“ Stolz wie Oskar lag ich auf ihrem Schoß, während sie ihren Rollstuhl in Bewegung setzte und schließlich an einen der Lesetische rollte. Ein aufmerksamer Kellner fragte nach einem Wunsch und brachte kurz darauf einen Martini Bianco. „Na, dann erzähl mir von dir“, sagte sie und begann zu lesen. Ach, wenn ich das nur könnte, dachte ich im Stillen. Sicher war schon mehr als eine Stunde vergangen, zumindest kam es mir so vor, als die alte Dame durch eine junge Frau und ein nur unwesentlich älteren Mann aus ihren Gedanken gerissen wurde. „Ach, hier bist du, Tante Ursel. Wir suchen dich die ganze Zeit“, erklärte der junge Mann. „Wir haben uns Sorgen um dich gemacht“, ergänzte seine Begleiterin. „Das ist lieb von euch“, lächelte die Tante, „…aber unnötig. Ich komme schon allein zurecht.“ „Wenn das so ist, hast du sicher nichts dagegen, wenn wir ein wenig am Strand spazieren gehen“, schlussfolgerte ihr Neffe. „Mit dem Rollstuhl können wir da ohnehin nicht gehen.“ Die alte Dame winkte ab. „Geht nur, ich habe mir ein gutes Buch genommen.“ Ein gutes Buch, rutschten mir ihre Worte wie Öl hinunter. Während sie gingen, wandte sich die junge Frau noch einmal herum. „Wir haben übrigens schon zu Abend gegessen.“ Die Stirn der Tante krauste sich. Sie tat einen tiefen Seufzer und widmete sich wieder der Stelle des Textes, an der sie unterbrochen wurde. Das Lesen fiel ihr jedoch schwer, ich spürte es deutlich. Die Worte der jungen Leute gaben ihr offensichtlich zu denken. „Ach, Ursel“, murmelte sie vor sich hin. „Du kannst nicht erwarten, dass sie sich den ganzen Tag um dich kümmern. Sie sind jung, sie wollen etwas erleben. Du wärst ihnen doch nur ein Klotz am Bein.“ Hätte ich einen Hals, so hätte sich während dieser Worte sicher ein Kloß darin befunden. Es war bestimmt nicht leicht, sein Dasein als Buch zu fristen, aber ein in die Jahre gekommener Mensch hatte es allem Anschein nach deutlich schwerer. „Darf ich Ihnen noch etwas zu trinken bringen?“, riss sie der freundliche Kellner aus der Verlorenheit ihrer Gedanken. Die alte Dame schreckte auf und griff sich an die Brust. „Haben Sie mich jetzt aber erschreckt.“ „Oje, das tut mir sehr Leid“, sorgte sich der Spanier. „Halb so wild, es geht schon wieder“, lächelte sie prustend. „Ich glaube, es ist besser, wenn ich zunächst in den Speisesalon hinüberrolle.“ „Wie Sie wünschen“, entgegnete der Kellner. „Gestatten Sie, dass ich Sie schiebe?“ Das Gesicht der alten Dame hellte sich auf. „Es gibt eben doch noch Kavaliere.“ Den Rest des Abends verbrachten die Tante und ich an dem Lesetisch mit dem warmen Licht, der sich unweit der Bar und dem freundlichen Kellner befand. Vielleicht bestellte die alte Dame viel öfter als sonst gewohnt den geliebten Martini. Vielleicht auch nur deshalb, weil sie den netten Kavalier so gern um sich hatte? Fakt ist, dass sie mit vorgerückter Stunde immer lustiger und ausgelassener wurde, was sicherlich ihrem überdurchschnittlichen Zuspruch am Martini zuzuschreiben war. Dass ihr Neffe und seine Verlobte während dieser Zeit nicht im Foyer zu sehen waren, blieb an diesem Abend eher eine Randnotiz. Wie die Gute schließlich in ihr Hotelzimmer und letztendlich in ihr Bett kam, wird wohl auf ewig ein Geheimnis zwischen dem Kellner und einem der Zimmermädchen bleiben. Den Morgen des folgenden Tages beschränkte sich Tante Ursel darauf, den Geist des Wermuts aus ihrem Kopf zu vertreiben. Da er sehr hartnäckig war, reagierte er auf Speisen und laute Geräusche äußerst empfindsam. Was wiederum zur Folge hatte, dass die Gute das Angebot ihres Neffen, sie zum Frühstück zu begleiten, unter einem Vorwand ausschlug und ihn vor der Tür zu ihrem Zimmer stehen ließ. Es wäre ihr sicherlich mehr als peinlich gewesen, wenn ihr Neffe sie in diesem Zustand zu Gesicht bekommen hätte. Stattdessen betrachtete sie sich in einem Handspiegel. Im anmutsvollen Alter von 64 Jahren sieht man am Morgen leider nicht mehr so knackig aus, befand sie sich selbstgerecht betrachtend. Schönheit ist halt vergänglich, seufzte sie, nach diesem feuchtfröhlichen Trinkgelage kann ich meinen Anblick niemandem zumuten. Ihre Stirn legte sich in Falten. Ursel Röber, du bist nicht mehr die Jüngste, derartige Ausschweifungen geziemen sich nicht für dich. Es war der Hunger, der die alte Dame gegen Mittag aus dem Hotelzimmer trieb. Sie stopfte mich in eine Umhängetasche, die sie über einen der Griffe ihres Rollstuhls schob und verließ ihr Quartier. Die Tür zum Apartment ihres Neffen blieb auch nach wiederholtem Klopfen verschlossen. Tanja und Thomas warten sicher in der Lobby auf mich, sprach sie, wie so oft, mit sich selbst. Doch dort waren sie nicht. Auf ihrer Suche wurde sie von einem der Hotelboys angesprochen. „Ich habe eine Nachricht für Sie“, begann er. „Herr und Frau Ammelung nehmen an einem Ausflug nach Santa Ponsa teil. Ich soll Ihnen ausrichten, dass sie erst gegen Abend zurück sein werden.“ Die Traurigkeit in den Augen der alten Dame blieb dem jungen Spanier nicht verborgen. „Kann ich etwas für Sie tun, Senora?“ „Danke nein“, schüttelte sie den Kopf, „…ich komme schon zurecht!“ Während sie allein am Tisch saß und sich das Essen hinunterwürgte, ärgerte sie sich über sich selbst. Wie gern hätte ich Thomas und seine Verlobte auf diesem Ausflug begleitet, aber ich musste mich ja am Vorabend betrinken. Nun sitze ich wieder den ganzen Tag hier herum und halte Maulaffen feil. Sie schob den Teller zur Seite und schüttelte verdrießlich den Kopf. „Schmeckt es Ihnen nicht?“, erkundigte sich sogleich einer der Kellner. „Oh doch, ich habe nur keinen Appetit.“ „Sie sollten nicht allein speisen“, befand der Ober, während er sich im Saal umschaute. „Wie wäre es, wenn ich Sie an einen anderen Tisch schiebe?“ Er deutete auf einen älteren Herrn, der genau wie sie allein zu sein schien. „Nein, wirklich nicht“, blockte sie ab. „Es ist alles in bester Ordnung.“ Das dem ganz und gar nicht so war, war offensichtlich, doch was hätte der aufmerksame Kellner tun sollen? Er nickte der alten Dame freundlich zu und widmete sich wieder seiner Arbeit. Ursel saß noch eine Weile am Tisch, beobachtete die anderen Touristen, wie sie sich am Büfett bedienten und wieder von der Masse braungebrannter Sonnenanbeter verschluckt wurden. Ihr geschäftiges Treiben erinnerte sie an einen Ameisenhaufen, in dem alle scheinbar ziellos umherirrten und doch jeder ein bestimmtes Rädchen im Uhrwerk des Lebens darstellte. Sie alle hatten ihren festgelegten Platz, nur der ihre schien mit jedem neuen Tag bedeutungsloser zu werden. Seit jenem verhängnisvollen Autounfall, bei dem sie ihren geliebten Ehemann verlor und selbst so schwer verletzt wurde, dass sie den Rest ihres trivial gewordenen Lebens im Rollstuhl verbringen musste, fiel sie ihren Mitmenschen nur noch zur Last. Schon oft hatte sie daran gedacht, Anton zu folgen, doch bislang waren es stets die Worte des Verstorbenen, die sie von diesem Schritt abhielt: Du musst dich an jedem Tag aufs Neue dem Leben stellen. Es ist feige, vor seiner Verantwortung davonzulaufen. -2Die alte Dame hatte den Speisesaal verlassen und ihren Rollstuhl an den kleinen Tisch gelenkt, an dem sie bereits am Vorabend in mir gelesen hatte. Sie hielt nach dem freundlichen Kellner Ausschau. Von ihm erhoffte sie sich etwas über die Zeit zu erfahren, die ihr nicht mehr in Erinnerung war. Immerhin wusste sie nicht, wie sie in ihr Bett gelangt war. Da sie ihn nicht entdecken konnte, ging sie ihren Gedanken nach und legte sich die Worte zurecht, die sie ihrem Neffen an den Kopf werfen wollte. War es ein Fehler gewesen, Thomas und Tanja die Reise zu finanzieren? Wenn sie ehrlich war, hatte sie sich den Urlaub anders vorgestellt. Sie wollte etwas erleben, zusammen mit den beiden die Insel erkunden und nicht allein im Hotel herumsitzen. Das hätte sie auch daheim haben können. Letztendlich ärgerte sie sich über sich selbst. Wie konnte sie nur so naiv sein und davon ausgehen, von ihrem Neffen um ihrer selbst Willen umhegt zu werden? Zu Hause kümmerte er sich schließlich auch nur dann um sie, wenn er ihr Geld brauchte. Ursel Röber sah mich seufzend an. Ach, wenn du nur meine Gedanken erraten könntest, dann wüsstest du sicher auch, ob es richtig wäre, Thomas und Tanja für ihre Gesellschaft zu bezahlen. Aber das kannst du ja nicht. Schon blöd, wenn man kein Mund zum reden hat, aber andererseits würde ein sprechendes Buch sicherlich für reichlich Wirbel sorgen, nicht wahr? Dafür ist die Geschichte, die du zu erzählen hast, recht unterhaltsam, lobte sie mich und schlug die Seite auf, die sie zuletzt gelesen hatte. „Ein Martini, Frau Röber?“, unterbrach sie die inzwischen vertraute Stimme des Kellners. Die Angesprochene legte mich auf ihren Schoß und blickte auf. „Ich hoffe, Sie nicht wieder erschreckt zu haben.“ „Nein, diesmal habe ich Sie erwartet.“ „Ich hoffe, es geht Ihnen gut?“, erkundigte sich Pedro. „Nun, hätten Sie mich heute Vormittag gefragt…“ Die alte Dame ließ den Satz unvollendet. „Aber, woher wissen Sie meinen Namen?“ Der Kellner lächelte. „Sie wissen wohl nicht zufällig, wie ich in mein Bett kam?“ Pedro zuckte die Achseln. „Wie sollte ich?“ „Danke.“ Der Spanier nickte kaum merklich. „Darf ich fragen, ob Sie allein auf Reisen sind?“ „Weshalb wollen Sie das wissen?“, beantwortete sie das Interesse des Kellners mit einer Gegenfrage. „Entschuldigen Sie, ich wollte nicht neugierig sein. Ich habe mich nur gewundert, weil ich Sie nie mit einer anderen Person sah. Entschuldigen Sie.“ Pedro wandte sich, um zu gehen. „Nein, nach einem Martini steht mir heute wirklich nicht der Sinn.“ „Wie wäre es dann mit einem frisch gepressten Orangensaft?“, hielt er inne. „Gott bewahre, davon bekomme ich Falten.“ Der Spanier sah die alte Dame verstört an. „War nur ein Scherz“, lächelte sie. „Ich liebe Orangensaft.“ Irgendwann im Laufe des Nachmittags erzählte Ursel Röber dem Kellner von ihrem Neffen und dessen Verlobten. Ja, sie erzählte ihm sogar von ihrem verstorbenen Ehemann und der Tragödie die zu ihrer Behinderung führte. Warum sie dies tat, wusste sie im Grunde selber nicht. Vielleicht auch nur deshalb, weil es ihr einfach gut tat. „Ich habe morgen meinen freien Nachmittag“, sagte er plötzlich. „Wie wäre es, wenn ich Ihnen meine Insel zeigen würde?“ Ursel sah dem gutaussehenden Mann auf den Ring an seinem Finger und dann tief in seine braunen Augen. „Weil Sie Mitleid mit mir haben?“ „Nein“, entgegnete Pedro energisch. „Einfach nur deshalb, weil Sie mir sympathisch sind.“ „Okay, dann bin ich dabei!“ „Schön, ich freue mich. Mein Name ist übrigens Pedro García Àlvarez.“ „Meinen Namen kennen Sie ja bereits.“ „Si.“ Es war spät, als Thomas und Tanja von ihrem Ausflug zurückkehrten. „Ich hoffe, es geht dir inzwischen wieder besser, liebe Tante“, schlug der Neffe ungewohnte Töne an. „Es geht.“ „Fein, dann kannst du uns morgen ja an die Westküste nach Valdemossa begleiten.“ Die liebe Tante kniff skeptisch ein Auge zusammen. „Tja, für morgen habe ich leider schon eine Verabredung.“ Thomas und Tanja sahen sich verwundert an. „Du hast eine Verabredung?“, konnte es Tanja kaum glauben. „So ist es und nun seid mir bitte nicht böse, aber ich möchte ausgeschlafen sein. Ich bin ja schließlich nicht mehr die Jüngste.“ „Aber das geht doch nicht“, entrüstete sich Thomas. „Du kannst doch nicht einfach…?“ „Was kann ich nicht? Du vergisst, dass ich volljährig bin und als solches immer noch für mich allein entscheiden kann.“ Der Neffe lehnte sich entsetzt zurück. „Kannst du mir wenigstens mit ein wenig Geld aushelfen?“ Die alte Dame fühlte sich in ihrem Verdacht bestätigt. Daher wehte also der Wind. Das Interesse ihres Neffen galt also wieder einmal nicht ihrer Person, sondern ihrem Geld. „Wie viel brauchst du?“, fragte die Tante enttäuscht. „Na ja“, druckste Thomas herum. „Wir müssen auswärts essen und die Fahrt selbst kostet auch noch.“ „Wie viel!“ Der junge Mann schluckte. „Zweihundert müssten reichen.“ Die alte Dame griff in ihre Handtasche und holte ihr Portmonee hervor. „Hier sind fünfhundert, aber bis zu unserer Abreise will ich nicht mehr wegen Geld von euch belästigt werden.“ „Ja, ja, natürlich, du kannst dich voll und ganz auf mich verlassen“, erwiderte Thomas zufrieden. „Das wäre das erste Mal.“ -3Wie abgesprochen wartete Pedro am nächsten Morgen vor der Einfahrt des Hotels. Der klapprige Seat hatte seine besten Jahre weit hinter sich. Pedro half der alten Dame beim Einstieg, klappte den Rollstuhl zusammen und verstaute ihn auf dem Rücksitz. „Wenn es Ihnen recht ist, fahren wir zunächst nach Palma. Ich möchte Ihnen die Kathedrale so zeigen, wie sie nur wenige Touristen zu sehen bekommen.“ „Ich begebe mich vertrauensvoll in Ihre Hände.“ Um Punkt zehn erlebte Ursel, wie sich die Sonne in den Rosetten der Ornamentfenster der Kathedrale La Seu verfing und ein faszinierendes Lichtspiel in den Altarraum zelebrierte. Ein unvergleichliches Erlebnis, welches nicht nur in ihr, sondern auch in Pedro Begeisterung auslöste. Zur Mittagszeit fuhren wir durch Inca, eine Stadt, in der die Zeit stehen geblieben scheint. Freunde von Pedro erwarteten uns bereits zum Mittagessen. Ursel wurde so herzlich von ihnen aufgenommen, als gehörte sie zur Familie. Nachdem sich die alte Dame etwas ausgeruht hatte, ging die Fahrt über Port de Pollenca nach Mirador es Colomer, wo sie Pedro über einen gut befestigten Weg zu einem etwa zweihundert Meter über dem Meer gelegenen Aussichtspunkt schob. „Mein Gott, Pedro, so etwas Schönes habe ich noch nie gesehen“, staunte Ursel über die fantastische Aussicht. „Es freut mich, wenn ich Ihnen damit eine Freude machen konnte.“ „Warum opfern Sie ihre Freizeit für mich? Sie kennen mich doch gar nicht.“ „Ich möchte, dass Sie nicht nur den Kummer mit nach Hause nehmen, der Ihnen hier widerfährt, sondern auch ein paar Erinnerungen an meine Heimat.“ Ursel winkte ab. „Ich bin es gewohnt, allein zu sein.“ Pedro schüttelte erschüttert den Kopf. „Ich verstehe euch Deutsche nicht.“ „Wir sollten den herrlichen Tag nicht mit der Frage nach Gut und Böse vertun, es ist wie es ist und ich bin zu alt, um etwas daran zu ändern.“ Pedro griff nach seinem Rucksack und holte Brot, Käse, Obst und eine Flasche Wein hervor. „Sie haben Recht, genießen wir die Aussicht und denken wir nicht an morgen, denn jeder Tag, an dem wir traurig sind, ist ein nutzloser Tag.“ Ich dachte an die anderen Bücher in den Regalen der Buchhandlung am Rosenwall zurück. Wie es ihnen wohl inzwischen ergangen war? Ob auch sie ein solch abenteuerliches Leben hatten? Vielleicht warteten sie immer noch auf einen Käufer, oder sie standen hinter dickem Glas in irgendeiner Vitrine und hofften geduldig darauf, irgendwann noch einmal gelesen zu werden. Allmählich begriff ich, wie viel Glück ich eigentlich hatte. Der Rückweg führte uns durch schier endlos erscheinende Serpentinen, die sich in einem ständigen auf und ab durch das Tramuntanagebirge schlängelten. In Valdemossa besichtigten wir ein Kloster, in dem einst Frederik Chopin und George Sand lebten. Pedro bemühte sich rührend um die alte Dame, erklärte und beschrieb ihr Hintergründe und Zusammenhänge. Die Frau im Rollstuhl wunderte sich über das Wissen, mit dem Pedro glänzte. „Warum arbeiten Sie nicht als Fremdenführer?“, fragte sie ihn, nachdem sie ihre Fahrt fortgesetzt hatten. „Dazu brauche ich ein abgeschlossenes Studium“, erklärte der Spanier. „Was hält Sie ab?“, forschte die alte Dame nach. „Sie hätten ganz sicher das Zeug dazu.“ „Wer weiß“, seufzte Pedro, „vielleicht setze ich eines Tages mein Studium fort?“ „Weshalb haben Sie es abgebrochen?“ „Es ging nicht anders“, wich Pedro aus. „Was soll das heißen?“, hakte die Frau neben ihm nach. Ursel Röber wusste nur zu genau, dass sie sich mit ihrer Neugier auf einem sehr schmalen Pfad bewegte, aber irgendetwas in ihr trieb sie dazu, dass sie in ihrem Bemühen, mehr über das Schicksal des Kellners herauszufinden, nicht nachlassen durfte. Obwohl sie diesen Mann erst wenige Tage kannte, schätzte sie seine Art, seine Freundlichkeit und die Ruhe, die von ihm ausging. Folglich war es nur allzu verständlich, wenn sie sich für seine Lebensumstände interessierte. „Also schön, Sie lassen mir ja doch keine Ruhe. Wir machen einen kleinen Umweg über Marratxi.“ Die alte Dame schwieg, obwohl es ihr äußerst schwer fiel. Pedro stoppte den alten Seat vor einer heruntergekommenen Finca. Irgendwie passten Haus und Auto zueinander. „Was wollen Sie mir hier zeigen?“, konnte sich die alte Dame nun nicht länger zurückhalten. „Sie sind herzlich eingeladen“, entgegnete Pedro. Noch während der Kellner seinen Gast aus dem Auto in den Rollstuhl hievte, traten eine junge Frau und ein kleines auf zwei Krücken gestütztes Kind aus dem Haus. Es bedurfte keiner Worte, um den Grund für Pedros Studiumsabbruch zu begreifen. „Papa“, strahlte die Kleine über das ganze Gesicht. „Ist das die Deutsche, von der du uns erzählt hast?“ „Ja das ist sie“, erwiderte Pedro. „Guten Tag.“ Die Frau im Rollstuhl wunderte sich über das nahezu akzentfreie Deutsch des Mädchens. „Hallo, wie heißt du denn, mein Kind?“ „Angela, aber Sie können mich ruhig Angie nennen, das tun alle.“ „Gern, dann kannst du aber auch Ursel zu mir sagen.“ Die Kleine warf einen fragenden Blick auf ihren Vater. Der überlegte einen Moment und nickte. „Das ist meine Frau Alexandra“, stellte Pedro die junge Frau vor, die ihre Hände mittlerweile auf Angies Schultern gelegt hatte. „Seien Sie uns herzlich willkommen.“ „Wenn ich geahnt hätte, dass ich Ihnen mit diesem Ausflug Ihren Mann vorenthalte, hätte ich ganz sicher nicht eingewilligt“, entschuldigte sich Ursel Röber. „Aber nein, weshalb denn? Mein Mann hat uns erzählt, wie traurig Sie sind. Wenn es ihm gelungen ist, Ihnen eine Freude zu machen, so ist uns dies mehr als ein Trost.“ „Nosotros vamos entar“,1 sprach Pedro zu seiner Frau. Da sich im nächsten Moment alle in Bewegung setzten, kombinierte ich, dass seine Worte eine Aufforderung waren, ins Haus zu gehen. „Wenn es Ihnen recht ist, bleiben wir zum Abendessen hier“, schob Pedro den Rollstuhl über den schmalen Steinplattenweg zum Haus. „Wir können Ihnen leider keinen Luxus bieten, aber was wir geben, kommt vom Herzen.“ Die alte Dame zitterte vor Rührung. Ich konnte es deutlich spüren, steckte ich doch immer noch in der kleinen Tasche die an ihre Rollstuhl hing. „Wie kommt es, dass Ihre Familie so gut deutsch spricht?“, erkundigte sich Frau Röber. „Alexandra kommt aus der ehemaligen DDR. Sie bestand darauf, Angie zweisprachig aufwachsen zu lassen.“ „Weshalb muss sie an Krücken laufen?“ „Sie hatte als Kleinkind Meningitis.“ „Was bedeutet das für Ihre Tochter?“, hakte Ursel Röber nach. „In ihrem Fall wachsen das linke Bein und auch der Fuß langsamer als rechts. Es ist wie eine Schere, die immer weiter auseinander driftet.“ „Lässt sich denn da nichts machen?“ Pedro schüttelte den Kopf. „Vielleicht später einmal, wenn Angie erwachsen ist. Bis dahin kann man nur hoffen, dass sich ihr Becken nicht noch schiefer stellt.“ „Ihre Tochter ist also der Grund, weshalb Sie Ihr Studium unterbrachen“, sinnierte die alte Dame. Pedro lächelte mild, sah zu seiner Tochter und dann wieder zu seinem Gast. „Kann es einen besseren Grund geben?“ Ich versuchte, die Situation aus den Augen eines Menschen zu sehen. Es war nicht nur Pedros Selbstlosigkeit, die mich dabei beeindruckte, es war auch die Selbstverständlichkeit, mit der das Kind sein Schicksal ertrug. Und dann war da noch Alexandra, die ihr sicherlich angenehmeres Leben in Deutschland gegen diese doch sehr einfache Behausung eingetauscht hatte. Am meisten jedoch imponierte mir, wie liebevoll die drei miteinander umgingen. Sie schienen trotz aller Unwägbarkeiten glücklich zu sein. Vielleicht müssten sich die Menschen erst von allen materiellen Zwängen befreien, um den Blick für das wirklich Wichtige erkennen zu können. Allzu viele hatte ich zwar bislang noch nicht kennengelernt, aber dieser Kellner und seine Familie waren die einzigen, die ihr Leben meisterten. „Bist du mit deiner Familie im Urlaub, Ursel?“, erkundigte sich Angie gerade heraus. „Mein Neffe und seine Verlobte haben mich begleitet“, erklärte die alte Dame. „Warum lassen sie dich dann so oft allein?“ „Angie, so etwas fragt man nicht“, schritt Alexandra ein. Die Frau im Rollstuhl suchte nach der richtigen Antwort, sah das kleine Mädchen an, welches noch immer geduldig wartete, sah dann wieder zu ihrer Mutter hinüber, überlegte fieberhaft, obwohl sie die Antwort längst wusste und schüttelte doch achselzuckend den Kopf. „Ich weiß es nicht“, log sie. „Sie haben dich nicht lieb“, entgegnete der Kindermund. „Angie!“, fuhr nun auch Pedro dazwischen. „Nein, lassen Sie, Ihre Tochter hat Recht“, blockte Ursel. „Mein Neffe hat mich wirklich nicht sonderlich gern. Es ist eher mein Geld, welches er liebt.“ „Bist du denn reich?“ „Nein, mein Schatz, reich bin ich nun wirklich nicht“, lachte die alte Dame. „Angie, es wird Zeit für deine Übungen“, erhob sich Alexandra peinlich berührt. „Verabschiede dich bitte von unserem Gast.“ „Aber es ist doch noch gar nicht so spät“, protestierte das Mädchen. „Tu, was ich dir sage.“ „Okay“ Angie streckte der alten Dame die Hand entgegen. „Besuchst du uns morgen wieder?“ „Möchtest du das denn?“ „Wenn du bei uns bist, musst du nicht allein sein.“ „Dann komme ich gern.“ 1 Wir gehen hinein Alter schützt vor Torheit nicht -1Da lag ich also wieder auf meinem angestammten Platz und wartete mehr oder weniger geduldig darauf, von irgendeiner Leseratte mitgenommen zu werden. Einerseits hätte ich Hanna gern nach Hause begleitet, schon allein, um zu sehen, ob sich ihre Eltern auch in Zukunft auf ihre elterlichen Pflichten besinnen, andererseits war mein bisheriges Leben in diesem Hotel von so vielen Abenteuern erfüllt, dass ich sicher mehr erlebt hatte, als so manch anderes Buch. Inzwischen konnte ich mir ein Dasein gefangen in irgendeiner Vitrine beim besten Willen nicht mehr vorstellen. Auch wenn ich inzwischen etwas lädiert aus meinen Seiten schaute, so war dies eben der Preis für diese Episoden. Vielleicht war es aber auch gerade dieser Umstand, der mich für andere Leser interessant machte. Die Hand, die im nächsten Augenblick nach mir griff, war schwitzig und roch stark nach Zigarettenqualm. Sie gehörte zu einem Mann, der sich offensichtlich nur noch mit Mühe auf den Beinen hielt. Warum tranken die Leute im Urlaub nur so viel? Wollten sie auf diese Weise ihrem Alltag entfliehen? Ich hoffte darauf, wieder zurückgelegt zu werden. Nun, mein Hoffen war vergebens. Der fast zwei Meter große Hüne klemmte mich zwischen seine ungepflegten Pfoten und watschelte an die Bar. „Ich weiß nicht so recht, meine Liebe, ich fürchte, diesmal haben wir uns wohl das falsche Hotel ausgesucht“, rümpfte Amanda beim Anblick des auf die Bar zuwankenden Herrn die Nase. „Nur Geduld, meine Liebe, wir sind erst seit zwei Tagen hier. Was nicht ist, kann noch werden.“ „Dein Wort in Gottes Ohr, liebste Emmi.“ Die beiden Damen ignorierten die Blicke, die ihnen der Möchtegerncasanova zuwarf. Ein solcher Primat war weit unter ihrem Niveau. Im Grunde wollten sie gerade ihren Aufenthaltsort wechseln, als ein wohl situierter älterer Herr die Hotellobby betrat. Der Kofferträger hatte mit der Bagage des Mannes seine liebe Mühe. Die zahllosen Gepäckstücke waren offensichtlich alles andere als leicht. Die Garderobe des Herrn zeugte von seinem erlesenen Geschmack und sie verriet den beiden interessiert schauenden Damen, dass dieser Mann der gehobenen Gesellschaft angehörte. Obwohl nicht bei ARD oder ZDF, lag ich auf der Bar gewissermaßen direkt in der ersten Reihe. „Mein Name ist Freiherr von Saswitz“, stellte er sich dem ergeben dreinblickenden Hotelmanager hinter der Anmeldung vor. „Meine Sekretärin hat in Ihrem Hause ein Appartement gebucht.“ Gleichzeitig sah sich der Mann vor dem Tresen naserümpfend um. „Willkommen im ‚Jaime Royal’. Es ist uns eine Ehre, Freiherr von Saswitz“, bekundete der Manager geradezu überschwänglich, „…Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Der blaublütige Herr sah sich hektisch um. „Bitte, nicht so laut, ich bin inkognito.“ Der Manager zog den Kopf ein. „Selbstverständlich.“ Im nächsten Moment winkte er den Boy heran und reichte ihm den Schlüssel zum Apartment seines herrschaftlichen Gastes. „Es wird alles zu Ihrer vollsten Zufriedenheit sein“, dienerte der Manager. „Wir werden sehen“, versetzte Freiherr von Saswitz mit dem Anflug eines majestätischen Lächelns auf seinen Lippen. Die Sache schien interessant zu werden. Ich war gespannt, wie es mit jenem mysteriösen Herrn weiter ging, denn eines war mir so klar wie das Amen in der Kirche. Diesen Herrn hatte ich nicht zum letzten Mal gesehen. „Hast du das gesehen, Emmi?“, stupste Amanda ihre Freundin an. „Natürlich, aber hast du auch gehört?“ Amanda zog ein verdrossenes Gesicht. „Du weißt, dass ich seit dem Flug unter einem Tinnitus leide.“ „Du machst dir eben immer viel zu viel Stress, meine Liebe.“ „Was kann ich dafür, wenn ich so große Angst vor dem Fliegen habe. Wir hätten ja auch mit dem Auto nach Wien fahren können.“ „Um Himmels Willen“, schreckte Emmi auf. „Ein drittes Mal hätte ich deine egozentrische Tante nicht ertragen.“ „Sprich bitte nicht so über Tante Adelheid. Sie hat uns stets gut bewirtet.“ „Dafür durften wir uns aber auch den lieben langen Tag das Geschwätz von ihren drei verblichenen Ehemännern anhören“, seufzte sie, nicht ohne auf den ihrer Meinung nach extrem schmalzigen Wiener Dialekt der Tante hinzuweisen. „Tante Adelheid hat es zumindest verstanden, ein kleines Vermögen anzuhäufen“, erinnerte Amanda. „Dafür mussten aber auch drei Kerle ins Gras beißen. Ich möchte nicht wissen, ob die alle eines natürlichen Todes starben.“ „Emmi!“, empörte sich Amanda so energisch, dass einer der Kellner auf sie aufmerksam wurde. „Kann ich etwas für Sie tun, Seniora?“ „Nein, nein“, wiegelte Emmi ab, „...meine Bekannte hat sich nur etwas erschrocken.“ „Wie kannst du nur so etwas behaupten?“, fasste sich Amanda nur zögerlich. „Ach Gott, meine Liebe, sei doch nicht bloß immer so naiv. Es ist ja wohl unbestritten, dass sich deine liebe Tante stets Männer aussuchte, die kurz vor dem Abnippeln waren.“ „Die hat sie dann aber auch aufopferungsvoll gepflegt“, warf Amanda ein. „Jau, so aufopferungsvoll, dass es der zäheste unter ihnen gerade mal auf ein drei viertel Jahr brachte.“ Amandas Gesichtsfarbe wurde um eine Nuance blasser. „Glaubst du wirklich, dass sie die Herren nicht so gut gepflegt hat?“ Emmi verdrehte die Augen. „Ganz im Gegenteil. Nachdem, was uns die gute Adelheid in ihrem Wiener Kauderwelsch verraten hat, sind alle drei an Herzversagen dahingerafft. Ich schätze, sie hat den dreien ihre letzte Stunde nach allen Regeln der Kunst versüßt.“ In Amandas Gesicht zeichnete sich ein Fragezeichen ab. „Wie meinst du das?“ „Oh, meine Güte, tust du jetzt so, oder bist du wirklich so schwer von Kapee? Sie hat einen nach den anderen dahingeritten!“ Das war der Moment, in dem Amanda auch ihre letzte Gesichtsfarbe verlor und sich der Kellner ein weiteres Mal nach ihrem Wohlbefinden erkundigte. Emmi hatte zu tun, um ihre Freundin auf dem Barhocker zu halten. „Du spinnst doch“, reagierte Amanda inzwischen nicht mehr ganz so überzeugt. „Ja?“, erwiderte Emmi vielsagend. „Na, dann ist es ja gut.“ Die dralle Blondine winkte den Barkeeper heran. „Für mich bitte noch einen Daiquiri. Was ist mit dir, Schätzchen?“ Sie sah Amanda fragend an. „Egal, irgendetwas Doppeltes.“ „Sie haben es gehört, Chef.“ Der Barkeeper zog zunächst die Brauen, dann seine Achseln nach oben. „Okay…“ Der Trunkenbold mit den schwitzigen Pfoten traute seinen Ohren nicht. Er glaubte, dass dies der Augenblick war, auf den er so lange gewartet hatte. Er nahm all seinen Mut zusammen und … stieß an sein Glas. Das Bier ergoss sich über seine Hose. „Hoppala“, sah er die Bescherung rund um seinen Hosenbund. „Ich glaub ich muss mich erst einmal trocken legen.“ Auch wenn ihn niemand wirklich beachtet hatte, waren alle Anwesenden, mich inbegriffen, froh, als er vom Barhocker glitt und in einer der Toiletten verschwand. Emmi begleitete seinen Abgang mit einem tiefen Seufzer. „Und so etwas soll die Zierde der Schöpfung sein.“ Amanda schien von alledem nichts bemerkt zu haben. Ihre Gedanken kreisten nach wie vor um die Verflossenen von Tante Adelheid. „So etwas hätte ich nicht von ihr gedacht“, schüttelte Amanda nach einigen Minuten tiefen Schweigens den Kopf. Schlagartig war ihr bewusst geworden, wie naiv sie all die Jahre gewesen war. „Ich werde sie nie wieder besuchen.“ „Oh“, grinste Emmi breit, „…nicht mehr nach Wien? Na, dann findet das Ganze ja nun doch noch einen versöhnlichen Abschluss.“ „So, meine Damen, hier wären dann der Daiquiri und ein Cuba Libre mit einem doppelten kubanischen Rum.“ „Geben Sie her“, schnaufte Amanda wütend. „Das ist jetzt genau das Richtige.“ Sie fischte den Strohhalm aus dem Glas und entfernte den bunten Papageien, den der Barkeeper liebevoll an den Rand des Cocktails geklebt hatte, setzte an und leerte das Glas in einem einzigen Zug. „So, jetzt geht es mir besser. Hick.“ Emmi und der fassungslos dastehende Kellner warfen sich einen irritierten Blick zu. „Noch so’n Witwentröster!“, überschlug sich ihre Stimme. Emmi winkte ab. „Ich glaube, es ist besser, wenn ich dich aufs Zimmer bringe.“ „Blödsinn, doch nicht jetzt, wo’s endlich gemütlich wird.“ Erst zwei doppelte Cuba Libre später konnte Emmi ihre Freundin zum Aufbruch bewegen. Nachdem ihr die Beine wiederholt den Gehorsam versagten, waren zwei kräftige Hotelboys behilflich, um Amanda in die dritte Etage zu befördern. Dass auch ich bei dieser Gelegenheit von einem der Boys irrtümlich mit auf Amandas Zimmer getragen wurde, muss an dieser Stelle wohl als schicksalhafte Fügung angesehen werden. „Musst du es immer so übertreiben?“, brachte Emmi ihren Unmut zum Ausdruck. „Du weißt doch ganz genau, wie du auf die harten Sachen reagierst.“ „Wie meinst du denn das nun wieder?“, kicherte Amanda ambivalent. „Leg dich jetzt hin und schlaf deinen Rausch aus“, befahl Emmi zunehmend ungehaltener, während sie ihrer Freundin die Schuhe aus und die Decke bis an den Hals zog. „Ich gehe noch mal runter und versuche etwas über den blaublütigen Neuankömmling herauszufinden.“ Ihr Blick fiel auf mich. „Was hast du denn da nur für einen Schundroman?“ An dieser Stelle hätte ich am liebsten laut protestiert, aber das war mir ja leider nicht möglich. „Wenn’s dir recht ist, nehme ich das Buch mit hinunter. So etwas sieht immer gut aus.“ Ihre Worte verhallten ungehört. Amanda war bereits mit dem nächsten Atemzug eingeschlafen. Muss ja ein Teufelszeugs sein, dieses Cuba Libre, dachte sich Emmi, während sie die Tür zum Hotelzimmer ihrer Freundin hinter sich zuzog. Wie gut, dass ich auf zwei Einzelzimmer bestanden habe, dachte sie sich im Hinblick auf den derben Alkoholgeruch, der die Luft in Amandas Apartment schon bald vernebeln würde. Sie zog die Karte durch den schmalen Schlitz des Scanners. Ein Summton und ein kleines Lämpchen, welches einen Augenblick lang grün aufleuchtete, gaben den Weg zum Eintritt in ihr eigenes Zimmer frei. Es lag dem von Amanda gegenüber und hatte einen weitaus schöneren Meerblick. Aber das war Nebensache. Sie waren letztendlich an diesen Ort gereist, um eine lukrative Männerbekanntschaft zu machen oder um es mit anderen Worten zu sagen: sie wollten hier den großen Wurf landen, um fürs Alter auszusorgen. Viel Zeit blieb ihnen für dieses Unterfangen nicht. Zum Einen waren sie beide weit über vierzig und nüchtern betrachtet, begann ihre Fassade bereits zu bröckeln. Da halfen auch Pasten und Farbe nur noch wenig. Zum Anderen waren ihre letzten finanziellen Mittel für die Reise nach Mallorca draufgegangen. Für Saint-Tropez oder Monte Carlo hatte es leider nicht gereicht. So mussten sie alles auf diese eine letzte Karte setzen und darauf hoffen, dass es einen betuchten Herrn in ihr Hotel verschlug. -2Emmi hatte sich nach allen Regeln der Kunst gestylt, aufgebrezelt, wie ihre Freundin Amanda bei dieser Gelegenheit spöttisch bemerkt hätte. Für Emmi war es nichts anderes, als das Bestmögliche aus sich herauszuholen. Grad so wie ein alterndes Auto, welches vor dem Verkauf noch einmal aufpoliert wird. Freie Marktwirtschaft eben. Ist die Nachfrage gering, muss man das Angebot interessant machen. Im Vertrauen auf die Erfahrung der vergangenen Jahre und dem festen Willen, dem Schicksal ein letztes Mal auf die Sprünge zu helfen, legte das Angebot den Daumen auf die Anforderungstaste des Aufzugs und beobachtete an den aufleuchtenden Zahlen, in welchem Stockwerk sich der Lift gerade befand. „Wie lange dauert das denn noch?“, murmelte sie vor sich hin. „Wenn ich gewusst hätte, dass es bis Mitternacht dauert, ehe diese verdammte Sardinendose hier ist, wäre ich die Treppen gegangen.“ „Na, na, na“, vernahm sie plötzlich eine tiefe Stimme hinter sich. „Eine so attraktive Lady wird doch nicht fluchen.“ Emmi zuckte zusammen. Ein warmer Schauer lief ihr über den Rücken. Sie erkannte einen gut gebauten Mann hinter sich. „Es ist doch eine Zumutung, wie lange das dauert. Es kann doch nicht so schwer sein, einen vernünftigen Aufzug zu konstruieren.“ „Ist es auch nicht“, entgegnete der Mann lächelnd. „Wie wollen Sie das denn beurteilen?“ „Ich baue solche Konservendosen.“ „Auch das noch, ein Monteur“, seufzte Emmi genervt. „Sie haben mir gerade noch gefehlt.“ Ein kurzes ‚Bing’ kündigte Die Ankunft des langersehnten Aufzugs an. Die Türhälften schoben sich langsam auseinander. Zu ihrer Überraschung schaute sie in das erlauchte Gesicht jenes Freiherrn, den sie bereits bei seiner Ankunft bemerkt hatte. Sie betrat den Fahrstuhl, wandte sich kurz entschlossen um und versperrte dem vermeintlichen Monteur den Weg. „Wie Sie sehen, ist alles überfüllt. Sie müssen folglich den nächsten Aufzug nehmen.“ Der Mann auf dem Korridor sah Emmi verwundert an. Der Platz im Aufzug hätte locker für fünf weitere Personen gereicht. Nichtsdestotrotz spielte er ihr Spiel mit. „Sie haben Recht, wir wollen doch nicht riskieren, dass der Fahrstuhl womöglich abstürzt.“ Emmis Lächeln verschwand hinter den sich zuschiebenden Aufzugstüren. Der Mann im Fahrstuhl sah sie nicht weniger verwundert an. „Ich leide an Klaustrophobie“, erklärte sie überzeugend. „Das ist sicherlich äußerst unangenehm.“ „Halb so wild“, winkte Emmi ab. „Ich habe gelernt, damit zu leben.“ Der Freiherr nickte betont distinguiert. „Ich schätze Frauen, die sich ihrem Schicksal stellen.“ „Und ich mag Männer, die Verständnis für die Probleme ihrer Mitmenschen haben.“ Der Mann mit dem silbergrauen Haar fühlte sich geschmeichelt. „Wenn ich mich Ihnen vorstellen darf? Mein Name ist Saswitz.“ „Emmi zur Strassen“, nickte ihm die Blondine zu. „Wenn Sie Zeit und Lust haben, würde ich gern mehr über diese Krankheit erfahren. Wie wäre es mit einem Drink an der Bar?“ Dieser Fisch hatte schneller angebissen, als es Emmi zu hoffen wagte. Offensichtlich hatte sie mit ihrer kleinen Notlüge einen perfekten Köder ausgeworfen. „Wenn Sie sich wirklich dafür interessieren, kann ich Ihre freundliche Einladung ja gar nicht ausschlagen.“ Meine Güte, was für eine Schleimerei. Da hatten sich offenbar zwei Menschen gefunden, die von dem jeweils anderen mehr als angetan waren. Die folgende Konversation möchte ich Ihnen eigentlich ersparen. Der Abend schloss mit einer Verabredung für den nächsten Morgen. „Wenn es Ihnen recht ist, werde ich uns einen Tisch auf der Terrasse reservieren“, schlug Freiherr von Saswitz vor. „Ich freue mich“, willigte Emmi frohen Herzens ein. Ein galanter Handkuss besiegelte ihr Rendezvous. Sie sah dem Gentleman alter Schule nach, sah, wie er beschwingt lässig über den Korridor wippte. Ja, murmelte sie vor sich hin. Der könnte es sein. Zunächst schloss sie die Tür zu ihrem Zimmer, sah sich seufzend um, dann schloss sie ihre Augen und stellte sich den Luxus vor, der sie schon bald umgeben würde. Fast eine Minute stand sie so da, mit dem Rücken gegen die Tür gelehnt und träumte. Als sie die Augen jedoch wieder öffnete und unsanft in die spartanische Realität ihres winzigen Zimmers zurückgeholt wurde, war sie bereit, alles daran zu setzen, was nötig war, um dieses Leben so schnell und so weit wie möglich hinter sich zu lassen. Ihre Augen strahlten nun Zuversicht aus und in ihrer Mimik zeichnete sich Entschlossenheit ab. Ihr Blick fiel auf den alten Schundroman, wie sie mich zu Beginn unserer Bekanntschaft betitelt hatte. „Ich glaube fast, du hast mir Glück gebracht.“ Zu allem Überfluss drückte sie nun auch noch ihre Lippen auf meinen Einband und hinterließ einen roten Fettfilm. Als wenn ich nicht schon genug mitgemacht hätte. „Du wirst mich von nun an immer begleiten.“ Noch war ich mir nicht darüber im Klaren, ob ich glücklich darüber sein sollte. -3Noch bevor sich Emmi am nächsten Morgen auf die Terrasse begab, die sich an den Speisesaal lehnte, suchte sie ihre Freundin auf, um sie von den neusten Entwicklungen zu unterrichten. „Ehrlich gesagt, finde ich es nicht gerade fair von dir, dass du meine Unpässlichkeit sofort für deine Zwecke ausgenutzt hast“, beschwerte sich Amanda bei ihrer Freundin. „Du hast deinen Rausch wohl immer noch nicht so ganz ausgeschlafen“, entgegnete Emmi mit gekrauster Stirn. „Seit wann gibt es zwischen uns beiden Konkurrenz? Habe ich dich in all den Jahren jemals hängen lassen? Wenn es mir gut ging, hast du ja wohl immer davon profitiert.“ „Ach ja, schon gut“, griff sich Amanda an den Kopf. „Es geht mir einfach noch ziemlich besch…eiden.“ „Was mich angesichts der nicht unerheblichen Menge an kubanischem Rum, die du dir zu Gemüte geführt hast, nicht sonderlich wundert“, kicherte Emmi. „Es wäre nett, wenn du dich nicht ganz so lautstark über meinen Kater freuen würdest.“ „Ist ja schon gut, meine Liebe. Ich lasse dich erst einmal allein. Sieh zu, dass du wieder auf die Beine kommst.“ Amanda hielt ihre Freundin am Arm. „Du erstattest mir aber nachher unverzüglich Bericht, nicht wahr?“ Emmi grinste breit. „Ist doch Ehrensache.“ Als ihre Freundin auf die Zimmertür zusteuerte, fiel Amanda das Buch auf, welches Emmi während ihres Besuchs auf die Kommode abgelegt hatte. „Was hast du denn da für ein merkwürdiges Buch?“ „Wieso, ich nahm an, es sei deines.“ „Nee.“ „Na, dann hast du ja nichts dagegen, wenn ich es mitnehme.“ „Warum sollte ich?“ Freiherr von Saswitz, eigentlich inkognito, saß bereits an dem Tisch mit der schönsten Aussicht. Ein ganz in weiß livrierter Kellner wuselte geschäftig herum und mühte sich redlich alles so herzurichten, dass sein erlauchter Gast zufrieden war. Als Saswitz seine Urlaubsbekanntschaft bemerkte, erhob er sich, ging auf sie zu und reichte ihr seinen Arm, um sie an den Tisch zu geleiten. „Ich bin überwältigt, verehrter Saswitz, mit wie viel Geschmack Sie unser Frühstück herrichten ließen.“ „Dies ist nicht mehr als eine kleine Geste meiner Wertschätzung und nichts im Vergleich zu Ihrer atemberaubenden Erscheinung“, schleimte Saswitz. „Aber bitte, nehmen Sie Platz.“ Der Kellner schob Emmi den Stuhl unter den Allerwertesten. Endlich gab es wieder jemanden, der ihr mit der gebotenen Aufmerksamkeit begegnete. Ein Interesse, welches sie so lange schmerzlich vermissen musste. „Darf ich fragen, in welcher Branche Sie tätig sind?“, lenkte Emmi das Gespräch sehr schnell in eine für sie bedeutsame Richtung. „Ich bin eine Heuschrecke“, lachte der Freiherr. Emmi sah ihn verwundert an. „Oder sagen wir lieber, ich bin das, was man in der Finanzwelt als eine Heuschrecke bezeichnet.“ Emmi verstand immer noch nicht. „Ich kaufe marode Firmen auf, die kurz vor der Insolvenz stehen, zerschneide sie wie eine Torte und verkaufe die besten Stücke meistbietend.“ „Dann sind Sie weniger eine Heuschrecke als ein Konditor“, stellte Emmi in ihrer unbestechlichen Naivität fest. Saswitz blickte seine Tischdame einige Augenblicke verwundert an, dann begann er schallend zu lachen. „Das ist gut, das ist gut!“, wiederholte er einige Male verzückt. „Ich bin ein Konditor. Herrlich! Sie sind ja nicht mit Gold aufzuwiegen, meine Teuerste. Ich vermute, wir werden noch viel Spaß miteinander haben.“ „Warum nicht“, entgegnete Emmi. „Ich bin für alles zu haben.“ Ihr Gegenüber verstummte schlagartig, lächelte Emmi lasterhaft an und stieß einen leisen Pfiff aus. „Wirklich für alles?“ Emmi fuhr sich aufreizend mit der Hand durch das gefärbte Haar. „Es kommt schon sehr darauf an, wer mit mir Spaß haben will.“ Bruno von Saswitz sah seine vermeintliche Eroberung durchdringend an. „Ein Mann, der weiß was er will.“ „Also hier steckst du!“, unterbrach eine Emmi nur zu gut bekannte Stimme das Tete-a-tete. Amanda war zu neuem Leben erwacht und wollte sich, entgegen aller Absprachen, zu ihnen setzen. Emmis Blicke glichen dem Mündungsfeuer einer Kalaschnikow. „Hast du unsere Verabredung vergessen?“, fragte sie ihre Freundin vorwurfsvoll. „Verabredung?“, wiederholte Emmi gedehnt. „Aber ja, wir wollten zusammen frühstücken.“ Amandas Blicke glitten zu Bruno hinüber, der das Gespräch der beiden Frauen amüsiert verfolgte. „Sie hat es vergessen“, zuckte sie mit den Achseln. „Aber ich kann sie verstehen.“ Emmis Tischpartner erhob sich. „Saswitz“, stellte er sich vor. „Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Wollen Sie sich nicht zu uns setzen. Ich weise den Kellner sofort an, Ihnen ein weiteres Gedeck aufzutragen.“ „Amanda hat sicherlich bereits gefrühstückt!“, feuerte Emmi eine letzte Warnung an die Adresse ihrer Freundin ab. „Ich will die traute Zweisamkeit nicht stören“, entgegnete Amanda gedehnt, „…aber gegen ein kleines Häppchen hätte ich tatsächlich nichts einzuwenden. „Fein.“ Saswitz bot ihr galant einen Stuhl an. „Ich bin entzückt, dass Sie uns mit Ihrer Gesellschaft erfreuen.“ „Und ich erst“, beteuerte Emmi mit einem Unterton, der keinen Zweifeln offen ließ. „Herr von Saswitz ist eine Heuschrecke“, griff Emmi den Stand ihres Gesprächs erneut auf. „Hatten wir uns nicht auf Konditor geeinigt?“, schaute der Freiherr scheinbar beleidigt. „Heuschrecke?“, stutzte Amanda. „Konditor?“ „Ich verkaufe Sahnestücke“, amüsierte sich Saswitz. Die arme Amanda schien überfordert. Sie starrte ihre Freundin irritiert an. Emmi machte sich einen Ulk daraus, ihre Freundin im Unklaren zu lassen. Ein wenig Strafe sollte schon sein. Leider klärte Saswitz die Situation für Emmis Geschmack ein wenig zu früh auf. „Wenn das so ist, verdienen Sie Ihr Geld im Grunde mit dem Leid anderer Menschen.“ „Nun, so pauschal kann man das sicher nicht sagen“, erklärte der Freiherr. „Wenn ich die Firmen aufkaufe, sind sie längst am Boden“, rechtfertigte er sich. „Im Grunde sorge ich dafür, dass am Ende nicht alles den Bach hinuntergeht.“ „Dann sind Sie also kein Konditor, sondern eher ein Robin Hood der Neuzeit?“, entgegnete Amanda zynisch. „Ich hoffe nur, Sie verteilen den so schändlich gemachten Gewinn auch unter den Bedürftigen?“ Das Gesicht des Freiherrn erstarrte innerhalb eines einzigen Wimpernschlags zu einer eisigen Maske. Nicht einmal seine Pupillen bewegten sich. Emmi sah bereits ihre Felle schwimmen. Wie konnte ihr Amanda nur eine solche Chance vermasseln? Spätestens bis zum Abend hätte ihr dieser dicke Fisch aus der Hand gefressen. Nun hatte sie mit ihrer Missgunst das Netz zerrissen, mit dem sie ihren Fang an Land ziehen wollte. Als die Zeiten noch besser waren, wäre sie in vergleichbarer Situation aufgestanden, um sich weitere Peinlichkeiten zu ersparen, doch die Zeiten waren alles andere als gut. Genauer gesagt, waren sie mehr als besch…eiden. Zwei, höchstens drei Monate konnten sich die beiden Freundinnen noch über Wasser halten, dann wären sie pleite. Das wusste auch Amanda. Umso weniger verstand Emmi, was in ihre Freundin gefahren war. Saswitz reagierte ganz und gar nicht so, wie es Emmi erwartet hatte. „Das wird ja immer besser“, lachte er. „Was für ein Aufstieg: von der Heuschrecke zum Konditor und nun zum Beschützer der Armen. Zu Ihrer Frage, meine Teuerste. Ich sage immer: Jeder bekommt, was er verdient. Wodurch bestreiten Sie eigentlich Ihren Lebensunterhalt?“ Amanda sah fragend zu ihrer Freundin hinüber. Die faltete lässig die Hände, stützte ihren Kopf darauf und lächelte lauernd zurück. „Mein verstorbener Mann, Gott hab ihn selig, hinterließ mir genug, um mir jegliche Gedanken über solche Banalitäten zu ersparen.“ Der Freiherr horchte auf. „Wie traurig. Wer sich keine Gedanken um das Heute machen muss, verlernt von dem zu träumen, was morgen sein wird.“ „Oh, wie schön Sie das gesagt haben“, mischte sich Emmi wieder in das Gespräch. „Reine Lebenserfahrung, meine Liebe. „Ein Mensch ohne Träume ist nicht mehr als eine tote Hülle.“ „So ein Blödsinn!“, erhob sich Amanda erzürnt. „Das werde ich mir nicht länger anhören.“ „Was willst du? Herr Saswitz hat doch Recht. Wann haben wir das letzte Mal etwas wirklich Verrücktes unternommen?“ Amanda zuckte mit den Achseln. „Weiß nicht, ist mir auch egal. Ich gehe jetzt jedenfalls träumen.“ Emmis Stirn krauste sich. „Ich werde von einem richtigen Mann träumen. Vielleicht von einem Robin Hood der Neuzeit.“ Damit verschwand Emmis Freundin. „Was für ein Abgang“, schwärmte Saswitz kopfschüttelnd. „Ist Ihre Bekannte immer so burschikos?“ „Die Ärmste musste kürzlich eine schmerzliche Erfahrung machen. Seitdem ist sie nicht besonders gut auf Männer zu sprechen“, log Emmi. „Aha, dann wird mir natürlich einiges klar. Dann hoffe ich umso mehr, an Ihnen die Ehre der Männerwelt wiederherstellen zu dürfen.“ „Nun, ich für meinen Teil habe den Glauben an das Gute im Manne nicht gänzlich verloren“, erklärte die Blondine, „allerdings wäre ein wenig frischer Glanz sicher nicht vergebens.“ „Wenn Sie gestatten, würde ich heute Nachmittag schon mit der ersten Politur beginnen.“ Was für ein Gesülze, dachte ich mir, während ich aufmerksam zuhörte. Viel versnobter ging es nun wirklich nicht mehr. Obwohl mir das Gequatsche fast die Seiten verbog, war ich gespannt, in welche Richtung sich die Geschichte weiterentwickelte. Welches Ziel die beiden Frauen mit ihrer Reise verfolgten, war mir klar, wohingegen mir der Freiherr ein Rätsel mit sieben Siegeln war. „Warum nicht? Eine Chance haben Sie verdient“, erwiderte Emmi jovial. „Sie werden es ganz bestimmt nicht bereuen“, versprach Saswitz. „Sie haben meine Neugier geweckt.“ „Das freut mich. Ich erwarte Sie dann gegen 15 Uhr in der Lobby.“ Emmi warf ihrem Kavalier einen verheißungsvollen Blick zu, ehe sie sich erhob. „Ich werde pünktlich sein“, verhieß sie erwartungsvoll. Abschiedsreise -1Ich blickte aufgeregt um mich, hoffte, bangte und konnte doch nicht fassen, einfach an einem der Tische zurückgelassen worden zu sein. Bereits eine halbe Stunde lag ich so da. Mutterselenallein, traurig und bei jedem Fluggast, der an mir vorbeieilte, darauf hoffend, beachtet und mitgenommen zu werden. Doch so sehr ich mich auch bemühte, im steten Luftzug des Terminals durch das Rascheln meiner Seiten ihre Aufmerksamkeit zu erregen, so wenig konnte ich letztlich ihre Aufmerksamkeit gewinnen. So blieb mir also nichts, als der Dinge zu harren, die da auf mich zukommen würden. Irgendwann bemerkte ich eine junge Frau, die nach einem freien Tisch Ausschau hielt. Sie trug einen Rucksack auf dem Rücken. In der Hand hielt sie einen Trinkbecher. Während sie sich meinem Tisch näherte, bemerkte ich den Kummer, den sie in ihren Augen trug. Leider nahm sie letztlich an einem der Nebentische Platz. Ich beobachtete sie mit gebotener Zurückhaltung. So bemerkte ich nicht, wie sich eine Frau in einem blauen Kittel näherte. Sie schob einen Wagen mit Reinigungsutensilien vor sich her. „Senorita“, wandte sie sich an die junge Frau am Nebentisch. Sie nahm mich auf und streckte mich dieser entgegen. „Deins?“ Die junge Frau schüttelte den Kopf. „Nein.“ Mein Herz klopfte. „Nada.“ Die Spanierin zögerte keine Sekunde, zog mich samt ihrer Gummihandschuhe zurück und steckte mich in den grünen Sack, der an ihrem Wagen baumelte. Mir stockte der Atem. Das also war mein Ende. Sang und klanglos, entsorgt zwischen Schmutz und von Essensresten verschmierten Papptellern. Ich bereute dennoch nichts. So spektakulär, wie mein Leben verlief, so trivial war mein Abgang. „He, Moment!“, vernahm ich plötzlich die Stimme der jungen Frau vom Nebentisch. „Warten Sie!“ Kurz darauf spürte ich die inzwischen feuchte Gummihand auf meinem Einband. Sie übergab mich an meine Retterin. „Ich nehme es mit.“ Die Spanierin nickte. „Si.“ Wenige Atemzüge darauf betrachteten wir uns gegenseitig. Nun, da ich ihr direkt in die braunen Augen sehen konnte, bestätigte sich meine erste Wahrnehmung. In ihnen lag eine tiefe Trauer. „So, dann will ich doch mal sehen, was in dir steckt, mein kleiner Freund“, sprach sie mit sanfter Stimme zu mir. „Oh weh, du hast sicher schon so manches hinter dir“, sagte sie, während sie die Wasserflecken und all die anderen Wunden betrachtete, die ich auf meinen verschiedenen Odysseen erlitten hatte. Sie überflog die Kurzzusammenfassung und die Einleitung. „Ich will ehrlich zu dir sein, kleiner Freund, wenn du mir in einer Buchhandlung begegnet wärst, hätte ich dich ganz sicher nicht erstanden, aber wo du mich nun schon einmal begleitest, nehme ich es als Wink des Schicksals. Vielleicht bist du ja auserwählt, um mich auf meinem letzten Weg zu begleiten? Ich horchte auf. Ihr letzter Weg? Was um alles in der Welt wollte sie damit sagen? Und überhaupt, die Art, in der sie zu mir sprach, war mir zwar sehr angenehm, aber alles andere als gewöhnlich. Offensichtlich steuerte ich geradewegs in ein neues Abenteuer. „Oje, nun habe ich doch glatt die Zeit vergessen.“ Sie trank hastig ihre Cola aus und verstaute mich in den Rucksack, den sie mit sich führte. „Wir müssen uns beeilen, kleiner Freund. Am Ende fährt uns der Bus noch vor der Nase weg.“ Ich war gespannt, wohin mich unsere Reise führen würde. Mehr als merkwürdig kam mir allerdings bereits zu diesem Zeitpunkt die Tatsache vor, dass die junge Frau keinen Koffer mit sich führte. Die Fahrt mit dem Bus führte uns quer über die Insel, in die Bucht von Alcudia. Das ehemalige Fischerdorf Can Piccafort war in den vergangenen Jahren zu einem begehrten Ferienort geworden, welches in der Hauptsaison um die zehnfache Zahl der Einwohner anwuchs. Vor dem Hotel Tonga stieg die junge Frau mit dem Pferdeschwanz aus. Sie sprang geradezu aus dem Bus, was mich um ein Haar aus dem Rucksack geworfen hätte. Es gelang mir nur mit Mühe, das Gleichgewicht zu halten. Mein Blick flog an der schlichten Fassade des eher nüchternen Gebäudes in die Höhe. Mindestens zwölf Stockwerke reckten sich da dem Himmel entgegen, warfen einen langen, schlanken Schatten in den angrenzenden Pinienhain. Ein abgebrochener Wolkenkratzer, der nicht so recht in diese Urlaubslandschaft passen wollte. Meine Besitzerin nahm allerdings kaum Notiz davon. Sie eilte die Eingangsstufen hinauf und baute sich vor dem marmorierten Tresen der Anmeldung auf. „Hallo, mein Name ist Fischer – Clarissa Fischer. Ich habe hier ein Zimmer gebucht.“ „Guten Tag. Willkommen im Hotel Tonga“, lächelte ihr eine freundliche Mallorquinerin entgegen. „Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Anreise.“ „Ja, danke.“ „Wenn Sie so nett wären und mir den Hotelgutschein aushändigen?“ Clarissa Fischer griff in ihren Rucksack und förderte zunächst mich und anschließend das gewünschte Schriftstück zu Tage. Die Dame im Empfang nahm das Papier entgegen und erledigte die entsprechenden Formalitäten. „Wie ich sehe, haben Sie ein Zimmer im obersten Stockwerk gebucht.“ „Ich hoffe auf eine gute Aussicht“, erwiderte Clarissa mit einem gequälten Lächeln. „Ich habe Ihnen ein Appartement mit Meerblick herausgesucht. Ist dies recht?“ Clarissa nickte zufrieden, während sie den Zimmerschlüssel an sich nahm. „Der Fahrstuhl ist gleich rechts“, deutete die Mallorquinerin in die besagte Richtung. „Ihr Gepäck wird Ihnen umgehend hinaufgebracht.“ „Danke, aber ich habe keine Koffer. Was ich brauche, trage ich bei mir.“ Die Frau hinter dem Tresen zeigte sich verwundert. „Dann bleibt mir nur, Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hause zu wünschen.“ Ich spürte förmlich, wie uns ihre Blicke nachhingen. Was ich durchaus verstehen konnte. Immerhin hatte ich mich auch schon über den Umstand gewundert, dass Clarissa ohne jegliches Gepäck reiste. Es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis sich die Türhälften des Fahrstuhls auseinander schoben. Nun, was den allgemeinen Zustand des Hotels betraf, musste ich feststellen, dass diese Herberge seine besseren Tage wohl bereits hinter sich hatte. Alles erschien alt und verwohnt. Eine umfassende Renovierung war längst überfällig. So dauerte es denn auch eine ganze Ewigkeit, ehe der Lift die angewählte Etage erreicht hatte. Clarissa orientierte sich kurz und bog in den rechten Gang ein. Der abgewetzte Läufer dämpfte die Schritte ihrer Sneakers nur unwesentlich. Ich malte mir aus, wie es sich nachts anhören musste, wenn jemand mit Stöckelschuhen durch den Flur stakste. Wenigstens befand sich das Zimmer ganz am Ende des schmalen Flures. Stickige Luft schlug uns entgegen, als Clarissa die Tür öffnete. „Unfassbar!“, sprach sie zu selbst. „Die haben hier nicht mal gelüftet.“ Ungehalten warf sie den Rucksack auf das Bett und riss den schweren, lichtundurchlässigen Vorhang zur Seite. Dann schob sie die Balkontür zur Seite und trat hinaus. „Mensch, ist das eine geile Aussicht“, verwandelte der atemberaubende Ausblick jede Enttäuschung über das gebuchte Hotel innerhalb eines einzigen Wimpernschlages in Wohlgefallen. Zu gern hätte auch ich einen Blick riskiert, aber vom Bett aus war das leider unmöglich. Stattdessen verfolgte ich, wie sich Clarissa auszog und ihre Sachen neben mir auf das Bett warf. Ich bemerkte, wie schlank sie war, zu dünn für mein Gefühl. So dünn, dass sich ihre Knochen unter der Haut abzeichneten und diese wie dünnes Papier erscheinen ließ. Nun, mir fehlt es an Wissen, um einschätzen zu können, was in dieser Hinsicht als normal zu betrachten ist, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, dass Clarissa nicht gesund war. -2- In den folgenden Tagen verbrachten wir viel Zeit auf dem Balkon. Immer dann, wenn sie ein Kapitel ausgelesen hatte, legte sie mich zur Seite und sprach mit mir. Ein Verhalten, welches völlig neu für mich war. Ich empfand dies eigentlich als sehr angenehm, erhob es mich doch in eine Stellung, in der ich mich plötzlich als bedeutsam und in ihr Leben eingebunden fühlte. Aber war es auch normal, mit einem Buch zu sprechen? Auch wenn die Charaktere meiner bisherigen Leser sehr unterschiedlich waren, so tat dies keiner von ihnen. „Ob all die Dinge, die zwischen deinen Zeilen stehen, wohl der Wahrheit entsprechen? Was meinst du, mein kleiner Freund?“ Selbst wenn ich ihr eine Antwort hätte geben können, so hätte ich ihre Frage nicht aufzulösen vermocht. Ich wusste es nicht. Clarissa ließ ihren Blick nachdenklich in die Ferne schweifen. In ihren Augen lag Wehmut, eine gewisse Traurigkeit, die ihren Ursprung ganz sicher nicht in der Gegenwart und auf dieser Insel fand. Ihre tiefen Augenhöhlen verrieten mir, dass die Quelle dieser Schwermut weit zurückliegen musste. Minutenlang saß sie so da, starrte ohne jegliches Ziel über die Balkonbrüstung und sinnierte. „Sag, mein kleiner Freund, wenn unsere Begegnung tatsächlich kein Zufall war, verstehe ich die Bedeutung nicht, die darin liegen mag. So sehr ich mich mühe, in deiner Geschichte einen Sinn zu sehen, den ich mir zu Eigen machen könnte, so wenig kann ich einen Zusammenhang zwischen deinen Zeilen und meinem Schicksal erkennen.“ Vom Meer her kommend war eine frische Brise aufgezogen, kündigte einen baldigen Wetterwechsel an. Clarissa erhob sich, drehte ihren zarten Körper in den Wind und schloss die Augen. Sie schien den Wind mit all seiner Kraft, die er hier oben mit sich führte, in ganzer Intensität spüren zu wollen. Innerhalb weniger Minuten zogen dunkle Wolken auf, verhüllten die Sonne und entluden schließlich mit aller Wucht ihre nasse Fracht. Es goss wie aus Kübeln. Ich lag nach wie vor aufgeschlagen, gottlob mit der Schrift nach unten, auf dem kleinen Plastiktisch und harrte voller Hoffnung auf meine Rettung, doch Clarissa schien dieser Welt inzwischen vollends entrückt zu sein. Sie reckte ihre Hände beschwörend zum Himmel. Geradeso, als stände sie mit den Mächten des Universums in direktem Kontakt. Offensichtlich genoss sie die Naturgewalten, ja, als forderte sie diese geradezu heraus. Von ihr konnte ich in diesem Moment keine Rettung erwarten. Lange würde mich der Einband nicht mehr schützen, so viel war klar. Abgesehen davon bildete sich auf dem kleinen Tisch eine Pfütze, die mit jeder Sekunde mehr Regenwasser aufnahm und mir somit stetig näher kam. Es glich einem Wunder, als der Regen so unvermittelt erstarb, wie er losgebrochen war. Clarissa war triefend nass. Sie öffnete erst ihre Augen, als die Sonne wieder zum Vorschein kam und bemerkte erst im folgenden Moment, wie schlimm mir der Regen zugesetzt hatte. Einige meiner Seiten waren auch dieses Mal buchstäblich durch bis auf die Lettern. Ich zürnte mit meinem Schicksal. Hatte ich nicht schon genug durchgemacht? Die Antwort auf meine Frage fand ich in den Ereignissen begründet, die ich seit dem Kauf in der kleinen Buchhandlung erlebte. Egal wie ramponiert ich mittlerweile auch dreinschaute, um nichts in der Welt wollte ich dies mit einem wenn auch noch so gemütlichen Regal in irgendeiner Bibliothek tauschen. „Ach je, wie dumm von mir, dich dem Regen auszusetzen“, haderte Clarissa mit sich bei dem trostlosen Anblick, den ich ihr bot. „Wie konnte ich dich nur vergessen, mein kleiner Freund?“ Sie nahm mich auf und trug mich ins Bad. Selber pitschenass griff sie nach einem Handtuch und tupfte vorsichtig meine feuchten Seiten ab. „Es tut mir so Leid“, seufzte sie verzweifelt. Plötzlich kullerten Tränen über ihr hageres Gesicht. Konnte es wirklich sein, dass sie wegen mir weinte? Auch wenn sich meine feuchten Seiten von der wärmenden Sonne wellten, so erholte ich mich doch recht schnell und ohne große Blessuren von diesem Schreck. Clarissa hingegen schien es mit jedem Tag ihres Urlaubs schlechter zu gehen. Ich machte mir große Sorgen um sie. -3Die folgenden Tage erlebte ich Clarissa wie ein Nachtgespenst. Obwohl sie präsent war, schien sie an einem anderen Ort zu sein. Sie war nicht einfach nur mit ihren Gedanken abwesend, sie hatte sich ihre ganz eigene Welt geschaffen, eine Welt die sie mit unüberwindlichen Mauern umgab. An einem dieser Nachmittage, wir lagen wie üblich am Strand und dösten vor uns hin, wurde Clarissa von einem dieser sich für unwiderstehlich haltenden Baywatchbubis angegraben. „Hallo, was haben wir denn hier für eine süße Strandnixe?“, schleimte er sofort drauflos, während er sie mit seinen Blicke ungeniert auszog. „Bist wohl erst angekommen?“, schlussfolgerte er wegen der zarten Blässe ihrer Haut. „Lange genug, um nicht auf solche Windeier wie dich hereinzufallen!“, entgegnete Clarissa barsch. „Wie kommt es nur, dass du mir bislang entgangen bist?“, spielte Casanova unbeirrt seine Platte ab. „Es war nicht leicht und hätte ich geahnt, dass du mir an dieser Stelle über den Weg läufst, hätte ich mich an den Nordpool gelegt.“ Adonis schluckte. Offensichtlich hatte sein Selbstwertgefühl gerade einen herben Rückschlag erlitten. „Na, dann grüß mir die Pinguine.“ Clarissa verdrehte die Augen. So ein Schwachkopf, dachte sie. So viel zum Thema blond und blöd! „Dazu müsste ich mich dann wohl eher auf einer Eisscholle in der Antarktis sonnen.“ Der blonde Germane verstand die Welt nicht mehr, weshalb er es vorzog, seine angekratzte Platte einige Meter weiter erneut abzuspielen. „Scheißkerle!“, schimpfte ihm Clarissa kaum hörbar nach. Zu diesem Zeitpunkt verstand ich nicht, weshalb sie derart heftig auf die Anmache des Knaben reagierte. Auch wenn die Art seiner Anmache zu wünschen übrig ließ, konnte sie sich im Grunde doch ebenso gut über ein wenig Aufmerksamkeit freuen. Wir blieben also für uns. Nach all den Abenteuern hatte ich weiß Gott nichts gegen ein wenig Ruhe einzuwenden, aber ein klein wenig Abwechslung wäre sicher nicht verkehrt gewesen. Wenn Clarissa nicht in mir las, schrieb sie in ein schwarzes Buch, welches sie ebenso wie mich stets bei sich trug. All meine Versuche, mit der hochnäsigen Kladde ins Gespräch zu kommen, scheiterten. So blieb mir nur ein gelegentlicher Blick, wenn sie besagtes Buch aufgeschlagen zur Seite legte. Leider brachte dies wenig, weil mir die von Clarissa handschriftlich verfassten Buchstaben gänzlich unbekannt waren. „Nun stell dich nicht so an“, forderte ich allmählich die Geduld verlierend. „Du siehst doch selbst, wie traurig Clarissa ist. Vielleicht kann ich ihr helfen.“ Das schwarze Buch schüttelte sich herablassend. „Pah, was willst du schon für sie tun können?“ „Nun, ich kann immerhin auf einige Erfahrung verweisen“, versuchte ich zu überzeugen. „Nur so viel, ich bin ein Tagebuch und schon deshalb zu absoluter Diskretion verpflichtet. Gleich auf der ersten Seite musste ich ihr dies geloben.“ Ich überlegte einen Augenblick. „Also stimmt es - Clarissa braucht Hilfe!“, schlussfolgerte ich aus den Worten des Tagebuchs. „Ich habe nichts von dem gesagt.“ „Natürlich nicht“, beschwichtigte ich. „Aber du musst doch zugeben, dass Clarissa sehr unglücklich ist.“ Das Taschenbuch seufzte. „Es ist in der Tat schon lange her, dass sie glücklich war. Seither ist viel Trauriges geschehen. Es ist nur allzu verständlich, wenn sie nun alles hinter sich lassen will.“ „Wie meinst du das?“ „Ich meine nichts! Ich habe schon viel zu viel gesagt. Lass mich in Ruhe. Du wirst an ihrem Schicksal nichts ändern können.“ Ich war hellhörig geworden. Zugleich kam ein Gefühl innerer Unruhe in mir auf. Das alles im Zusammenhang mit der Äußerung gesehen, die sie bei unserem Eintreffen vor dem Hotel gemacht hatte, ließen sämtliche Alarmglocken in mir schrillen. Clarissa wollte sich offenkundig das Leben nehmen. Was aber war der Hintergrund für diese Tragödie? Ich musste es herausfinden, koste es, was es wolle. Die Antwort auf all meine Fragen lag direkt neben mir, doch wie sollte ich diese bornierte Kladde zum Reden bringen? „Im Grunde hasse ich jede Form von Gewalt, aber wenn man mir keine andere Wahl lässt, kann ich schon mal meine Prinzipien vergessen.“ „Willst du mir Angst machen?“ „Wie kommst du denn darauf?“, fragte ich mit unschuldsvoller Miene. „Sieh her“, entblößte ich einige meiner lädierten Seiten. „Das sind Wunden, die ich mir zuzog, als ich dem Schicksal Paroli bot.“ „Offensichtlich bist du nicht allzu gut dabei weggekommen“, witzelte das Tagebuch. „Nun, ich gebe zu, dass es mir nicht leicht gemacht wurde, aber letztendlich konnte ich dem Schicksal einige Male ein Schnippchen schlagen. Du glaubst also nicht allen Ernstes, dass ich mich durch eine so lächerliche Kladde wie dich aufhalten lassen würde?“ „Pah!“, entgegnete das Tagebuch trotzig. Langsam aber sicher riss mir der Geduldsfaden. „Entweder du spuckst jetzt sofort die ganze Wahrheit aus, oder...“ „Oder was?“, fiel mir die Kladde herausfordernd ins Wort. Ich deutete auf die verschlossene Sonnencremtube, der ich mich inzwischen bemächtigt hatte. „Gehen verdammt leicht auf, diese dummen Kappen“, erklärte ich gedehnt. „Wäre doch schade, wenn sich das ölige Zeugs über deine gefühlvoll verfassten Seiten ergießt, oder?“ Das Tagebuch wich entsetzt zurück. „Das wagst du nicht!“ „Es geht möglicherweise um Clarissas Leben. Glaubst du wirklich, dass ich da auf ein paar Seiten Papier Rücksicht nehme?“ „Wenn ich dir sage, was du wissen willst, lässt du mich dann bestimmt in Ruhe?“ Nachtigall, ich hör dir trapsen! Ich versprach`s. „Und erzählst du auch niemandem, dass du es von mir weißt?“ Ich versprach auch dieses. „Jetzt red endlich!“ Das Taschenbuch stieß einen letzten tiefen Seufzer aus. „Clarissa ist HIV positiv getestet.“ Ich durchforstete vergeblich meine Datenbanken. „HIV, was ist das?“ „Ich weiß nur, was mir Clarissa darüber anvertraute“, erklärte das Tagebuch. „Es muss sich um eine unheilbare Krankheit handeln. Die Ärmste hat wohl nur noch einige Monate zu leben.“ Nun wurde mir einiges klar. Anstatt jämmerlich dahinzusiechen, zog es Clarissa vor, dem Schrecken ein jähes Ende zu setzen. Sie war zu stolz, um anderen zur Last zu fallen. Eine ganze Weile lagen wir tief betroffen nebeneinander. Schwiegen uns an, während wir in unseren Gedanken versunken waren und nach einem Ausweg suchten. „Hat sie denn nichts über die näheren Umstände ihrer Krankheit notiert?“, kam mir plötzlich ein Gedanke. „Ich weiß nur, dass sie deshalb von ihrem Freund im Stich gelassen wurde.“ „Ja, ja, in der Not zeigt sich, wer ein wirklicher Freund ist“, stieß ich erneut einen tiefen Seufzer aus. Je mehr Menschen ich kennen lernte, umso weniger verstand ich sie. Einerseits bemüht, sich ein sorgenfreies Leben aufzubauen, rissen sie es durch ihren eigenen Unverstand immer wieder bis auf die Grundmauern nieder. Dabei gingen sie oftmals so ungestüm zu Werke, dass sie selbst auf diejenigen keine Rücksicht nahmen, die ihnen am nächsten standen. Eine derjenigen, die auf der Strecke geblieben waren, lag da im Sand neben uns. Eine attraktive Frau, die ihr junges Leben wegwerfen wollte, ehe es richtig begann. Ich musste dies verhindern – aber wie?