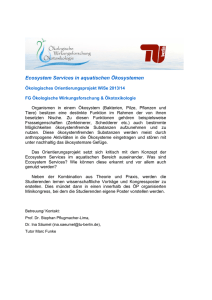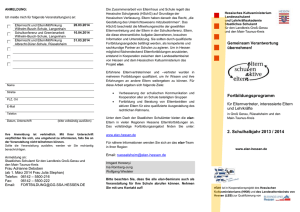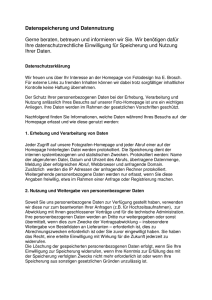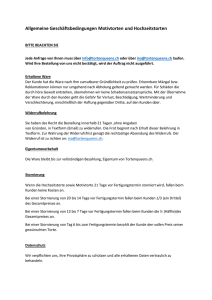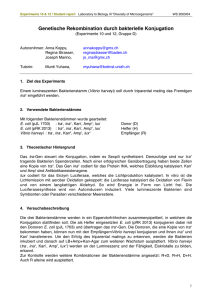Der Chmelir-Fall ist in der Welt-Kriminalgeschichte einzigartig https://sites.google.com/site/kronebreakingnews/ Die Geschichte (Untermauert durch Gerichtsunterlagen, Expertengutachten u. Medienartikeln etc.) des seit über 42 Jahre durchgehend im Gefängnis einsitzenden Juan Carlos Chmelir, geb. Bresofsky am 8.6.1949 in Uruguay ist ein Wahnsinn. Sein Fall hat die Republik insgeheim bereits erschüttert. Heute noch zittern die Republik und die Justiz vor einen öffentlichen Skandal. *Heimopferkind der 1960er Jahren. Als Migrantenkind rassistisch behandelt und durch Erniedrigungen und Misshandlungen traumatisiert. *Post- u. Bankräuber in den 1970er Jahren. 1978 erschoss er einen Postbeamten bei einem Überfall Und wurde 1979 zu einer Lebenslangen Haftstrafe verurteilt *Gefängnisrebell mit spektakulären Protestaktionen 1983-1992, die in der Weltpresse Schlagzeilen machten und betätigte sich in den letzten zwei Jahrzehnten als Whistleblower des Strafvollzuges *mehrfach versuchte und gelungenen Gefängnisausbrüche *1989 Kaperte er auf der Flucht die Ehefrau eines hohen Landespolitikers, daraus sich in der WeltKriminalgeschichte ein noch nie dagewesenes unvorstellbares Drama und Skandal entwickelte. Letztere ist der wahre Hintergrund, warum die Justiz ihm nach über 42 Jahre andauernder Strafhaft trotz ständiger Gesuche - immer wieder die bedingte Entlassung verwehrt, wenngleich über den Häftling in den letzten vier Jahren Sachverständigengutachten mit exzellenteren Prognosen erstellt wurden (Prof. Nedopil 2.7.20/S. 58-68 21.12.16/S. 69, Dr. Schautzer (25.5.16/S. 97-103). Was ist passiert: die Politiker-Ehefrau wurde vom ausgebrochenen Häftling in den tiefen Wälder Kärntens verschleppt und dort mehrfach vaginal und anal penetriert. Anschließend gingen beide u.a. in der breiten Öffentlichkeit herumspazieren und in Cafelokale, ohne das die Politiker-Ehefrau die geringste Gegenwehr unternahm. Allein aus den Polizei- u. Gerichtsaussagen der Politiker-Ehefrau geht eindeutig hervor, das sie mit dem ausgebrochenen Häftling spätesten von einen Zeitpunkt an freiwillig mitgegangen ist. Dann erschien sie mit einer Selbstanzeige des Häftlings bei der Polizei. Um den unfassbaren Skandal zu vertuschen und um die Schande von der Republik abzuwenden brach das Landesgericht Graz mit sämtlichen rechtsstaatlichen Prinzipien und verurteilte den Häftling in einem unvorstellbar korrupten Prozess zu einer 18-jährigen Freiheitsstrafe. Das Kalkül der Justiz, das der Häftling durch jahrzehntelanger Strafhaft geistig und psychisch kaputt geht erfüllte sich nicht. Der Häftling ist physisch zwar schwer krank, geistig jedoch nach wie vor topfit und protestiert heute noch gegen das Urteil, weswegen er für die Justiz als Zeitzeuge und Wissensträger weiterhin eine Gefahr darstellt. Unterlagen belegen nun, dass die Anstaltsbehörde Graz-Karlau – im stillen Zusammenwirken mit dem Grazer Gericht - alles tut um die Lebenserwartung des Häftlings zu verkürzen bzw. offenbar um ihn durch vorsätzliche ärztlicher Vernachlässigung zu beseitigen. Ab die nächste Seite schildert der Häftling in einen Antrag auf Aufschub des Strafvollzuges wegen Haftuntauglichkeit seine sehr ernste gesundheitliche Situation, die durch die Weltpandemie erheblich verschärft wurde. Und ab Seite 6 – 41 geht es um den dramatischen Fall im Zusammenhang der Politiker-Ehefrau. Ab Seite 42- 97 schildert er dann in seinen selbstverfassten Memoiren, was auf der Flucht wirklich passiert ist, letztlich ab Seite 98 – 157 seine Kindheit in Uruguay und die „Integration der Gewalt“ ab seinen Ankunft in Österr. 1962 im staatlichen Heime. Hinweis: Bei anklicken der Nummern in Klammern und Links öffnen die Polizei- u. Gerichtsunterlagen und sonstige Anhänge und Websites in ein eigenes Fenster. Seite 1 von 3 Juan Carlos Chmelir, geb. Bresofsky Justizanstalt Graz-Karlau Herrgottwiesgasse 50, 8020 Graz 01. Oktober 2020 An das Landesgericht Graz, Fr. Richterin Mag. E. Juschitz Conrad v. Hötzendorf-Straße 41, 8010 Graz Betrifft: ANTRAG auf Aufschub des Strafvollzuges wegen Haftuntauglichkeit gem. § 5 StVG Begründung: Gemäß den COVID-19-Risikogruppen-Verordnungen des Gesundheitsministers vom 7. Mai u. 26. September 2020 gehöre ich zu den besonders gefährdeten Personengruppen. Ich bin in das 72. Lebensjahr und seit über 42 Jahren unverhältnismäßig lange in Strafhaft und an fortgeschrittenen und ausgeprägten zentrilobulären Lungenemphysem Stadium Gold 3 chronisch schwer erkrankt sowie an einen Poritistumor und weise darüber hinaus infolge einer Notoperation 2006 in das LKH Linz wegen akuten Bandscheibenvorfalls sowie wegen starken Hörverlust u. Sehverschlechterung in mehrfacher Hinsicht körperlichen Beeinträchtigungen auf (siehe med. Befunde in Beilage (75.)). Meine geringe Lebenserwartung ist allein schon aus den med. Befunden für jeden objektiv feststellbar. Die Voraussetzungen zum Aufschub des Strafvollzugs nach § 5 StVG (sei es auch unter Auflagen des überwachten Hausarrestes) liegen vor u. ergeben sich 1) aus meinen hohen Lebensalter u. Krankheitsbild, 2) aus der akuten Gefahr einer Coronainfektion im Gefängnis unter ungeschützten Bedingungen als besonders gefährdete Person, 3) aus der Verpflichtung der Vollzugs(gerichts)behörden für die Gesundheit, (Rechts-)Sicherheit u. Leben der Gefangenen Sorge zu tragen, insbesondere gegenüber erkrankten u. sonst gefährdeten Gefangene u. 4) aus den Gerichts- u. Vollzugsgutachten zu ON 26 u. 43 aus 19 BE 200/15z sowie zu ON 23 u. 76 aus 24 BE 302/18s des LG Graz, die ein Rückfall meiner Person prognostisch mit höchster Wahrscheinlichkeit ausschließen. Ich absolvierte zwischen 2017 u. 2020 bereits 14 begleitende Sozialtraining-Ausgänge in Graz u. Wien ohne Beanstandungen, zuletzt am 17.2.2020 in Wien (siehe Beilage(80.)). Säumnisse weiteren Entlassungsvorbereitungen innerhalb der letzten dreieinhalb Jahren sind nicht meiner Person zuzuschreiben u. anzulasten, wie aus den Nedopil-Gutachten v. 2.7.2020 auf S. 58-59 erwiesen. Diverse Säumnisse an Entlassungsvorbereitungen, die die hö. Anstaltsleitung verschuldet hat zu Lasten meiner Person, meiner Gesundheit u. meines Leben voranzustellen ist rechtlich unzulässig. (Beweis-)Anträge: 1) herbeischaffen der Krankenakten meiner Person aus der JA Graz-Karlau, 2) herbeischaffen der Gerichtsakten zu GZ: 24 BE 302/18s, 19 BE 59/17t u. 19 BE 200/15z des LG Graz u. 3) fünf beiliegender medizinischer Befunde u. eine Ausgangbestätigung. Sachverhalt: Es gibt derzeit gegen das Coronavirus weder ein wirksames Medikament noch eine verlässlich erprobte Impfung. Es ist zudem allgemein bekannt das viele Menschen, die sich mit den Coronavirus infiziert haben keine Symptome einer Infektion bemerken und aufweisen, sodass die Gefahr evident ist das heute oder morgen das Coronavirus durch den ca. 200 Personen umfassenden Gefängnispersonals u. der sonst in der Anstalt tätigen Personen (Ärzte, Psychologen, Therapeuten, Seite 2 von 3 Lieferanten, Kantinenpersonal etc.), die in die Anstalt Täglich rein- u. rausgehen unbemerkt in die Anstalt eingeschleppt u. verbreitet wird, wie es schon öfters – trotz aller Vorsicht - in Pflege- u. Altersheime u. in Asyl- u. Flüchtlingsunterkünfte etc. passiert ist, zumal schon viele JWB die MNSMasken gelegentlich herunterziehen, was menschlich nachvollziehbar ist, weil stundenlangen Dienst zu versehen mit MNS-Masken ein Wahnsinn ist, eigentlich unmöglich. Zudem gibt es auch keine Verordnungen zum generellen Tragen von Schutzhandschuhe, obwohl bekannt ist, das eine Coronavirusinfektion auch durch berühren von Flächen u. Gegenständen u. anschließenden kratzen oder berühren des Gesichts (Mund, Nase, Augen) übertragbar ist. Ob das Coronavirus heute oder morgen in die Justizanstalt eingeschleppt wird oder nicht ist wohl Spekulativ, davon meine Gesundheit und Leben nicht abhängig gemacht werden darf, sodass zur Sicherung meiner Gesundheit u. meines Leben vom schlimmsten Szenario auszugehen ist. In Freiheit kann ich für meine eigene Gesundheit u. Leben optimal Sorge tragen, indem ich mich z.B. für längere Zeit mit Verpflegungsmittel versorgen und in meinen eigenen vier Wände verbleiben und diese nur gelegentlich für Spaziergänge in der frischen Luft in abgelegen Stellen verlassen kann, während ich im Gefängnis tagtäglich von zahlreichen Justizwachebeamten und von Mithäftlingen kontaktmäßig abhängig bin, wie unten ausgeführt. Allein schon aus den in der Beilagen vorliegenden med. Befunde wird belegt, dass mein physischer Zustand fast dauerhaft von Schmerzen und periodisch von Atemnot sowie von Schwindelgefühlen und Tinnitus begleitet ist, gelegentlich auch von Herzstechen u. Herzdruckschmerzen. Hals- u. Kopfschmerzen wahrscheinlich von den Poritistumor, Tinnitus u. der degenerativen HWSVeränderungen sowie infolge der Lungenerkrankung durch Atemwegsinfektionen u. Rückenschmerzen zufolge der Nachwirkungen des akuten Bandscheibenvorfalls u. OP verursacht. Die psychiatrische Feststellung Prof. Dr. Norbert Nedopil mit Gutachten vom 2.7.2020 (ON 76 S. 32 aus 24 BE 302/18s), wonach ich für mein Alter rüstig aussehe bezieht sich nur auf äußerliche Eindrücke, die allein schon durch die vorliegenden medizinischen Fachbefunde widersprochen wird. Ebenso widersprochen sei, dass ich kontinuierlich in ärztlicher Behandlung bin (ON 76 S. 32). Nach vorliegenden Gerichtsunterlagen wurden sowohl die Richterin als auch Prof. Dr. Norbert Nedopil im Vollzugsverfahren zu 24 BE 302/18s des LG Graz von dem ärztlichen Dienst u. Anstaltsleitung über meinen umfassenden gesundheitlichen Zustand und der ärztlichen Betreuung wissentlich u. somit vorsätzlich falsch informiert (siehe ON 53, 54 u. 61 aus 24 BE 302/18s (78.)), indem die Anstaltsleitung schwererer physischen Erkrankungen und Beeinträchtigungen meiner Person in den Berichte verheimlicht hat. In der hö. Justizanstalt Graz-Karlau bekomme ich in Wirklichkeit keine med. Betreuung u. Behandlung bzgl. meiner Lungenemphysemerkrankung, weder Physiotherapie noch vermehrter Bewegung im Freien bei frischer Luft oder ein bronchialerweiterndes Medikament zur Inhalation, die Indikatoren zur Behandlung und Betreuung von COPD-Lungenerkrankungen sind. Zudem wurde meiner Person bis dato auch eine Grippeimpfung versagt, darum ich sogar auf Eigenkosten ersuchte. Und obwohl ich schon seit Jahren an Lungenemphysem erkrankt bin, wurde meiner Person bis dato von den Anstaltsärzten auch eine Lungenfunktionsmessung oder Spirometrie-Untersuchung versagt. Bzgl. des Poritistumors ist die Lage so, dass ich von Experten des Grazer HNO-Universitätsklinikum beraten wurde, das eine Operation nicht akut notwendig, aber ratsam sei zur Vermeidung bösartiger Ausartung. Gleichzeitig wurde ich informiert, dass die Operation sehr gefährlich sei, weil der Tumor mit Gesichtsnerven und Halsvenen verklemmt ist (siehe med. Befunde) und daher Komplikationen auftreten könnten mit Folgen teilweiser Lähmung der Gesichtsmuskulatur etc., sodass ich von einer Operation Mangel an unmittelbarer Notwendigkeit Abstand nahm. Nichtsdestotrotz wurde von Seiten der hö. Justizanstalt ohne mein Wissen u. ohne meine Seite 3 von 3 Zustimmung zweimal Termine für die Poritistumor organisiert, die ich aus obigen Gründen ablehnte. Für mich liegt der Verdacht nahe, das meiner Person von Seiten der hö. Justizanstalt durch ärztliche Vernachlässigung u. Manipulationen sowie durch verfälschte Berichte der Anstaltsleitung geschadet werden sollte, sowohl gesundheitlich als auch bzgl. meiner Lebenserwartung. In der hö. JA werde ich als besonders gefährdete Person seit Jahren im dritten Stock der Abteilung C4 Haftraum 420 des Zellenhaus-Trakt mit dreißig anderen Insassen in Durchschnittsalter zwischen 25 – 50 Jahren angehalten, die sich um den Coronavirus überhaupt nichts kümmern und dementsprechend nachlässig miteinander umgehen, in der Abteilung zudem ständig ein reges hin und her von Justizwachebeamten und Häftlingen anderer Abteilungen herrscht. Quasi ideale Voraussetzungen, um den Coronavirus von einer Abteilung in die andere einzuschleppen u. zu verbreiten. Während in der Anstalt Infoblätter verteilt werden u.a. mit den Rat MNS-Masken zu tragen und zumindest ein Meter voneinander Abstand zu halten, haben selbst die Galeriegänge in den Abteilungen im Zellenhaus gerade ein Meter breite, sodass, auch wenn man wollte, ein Ausweichen oder voneinander Abstandhalten unmöglich ist, sodass die Infoblätter – fern der Realität – eher als Alibi u. zum Zwecke des Schönredens verteilt werden. An den Rat der Anstaltsleitung MNS-Masken zu tragen hält sich zudem kaum ein Häftling, selbst viele Beamten nicht. Und ich selbst bin infolge meiner COPD-Lungenerkrankung und Atembeschwerden kaum in der Lage eine MNS-Maske zu tragen, da durch das ein- u. ausatmen die MNS-Maske feucht wird und das ein- u. ausatmen erheblich behindert wird, wodurch ich erst recht in Atemnot gerate. Bei der täglichen Gänge zur befrieden der alltäglichen Belange und Bedürfnisse (Brausen, Telefonieren, Kleiderwaschen im Waschraum etc.) sowie bei allfälligen Vorführungen zur Einkaufkantine oder zu Dienststellen in der Anstalt, insbesondere bei der stündlichen Bewegung im freien mit dutzenden anderen Strafgefangenen bin ich somit ständig der Gefahr einer CoronavirusInfektion ausgesetzt, sodass ich seit den Lockdown aus Vorsichtsgründen auf die Teilnahme der Bewegung im Freien unfreiwillig verzichten muss, obwohl bei Lungenemphysem aus ärztlicher Physiotherapie-Indikation sehr viel körperliche Bewegung bei frischer Luft im Freien geraten ist. Hinzukommt, dass ich auch dann, falls ich mich völlig im Haftraum zurückziehen würde und auf meinen täglichen Belange und Bedürfnisse völlig verzichten würde, sind nichtsdestotrotz täglich mehrfachen Kontakte zu Justizwachebeamten bei Haftraumkontrollen, Postverteilung u. Vorführungen etc. sowie bei der Austeilung der Verpflegung (Frühstück, Mittagsmahl, Abendmahl etc.) durch Hausarbeiter und Hausarbeiterhelfer, die allesamt die Verpflegung weder aus hygienischen Gründen oder als Vorsichtsmaßnahme vor den Coronavirus ohne Kopfschutzhaube, Schutzhandschuhe und MNS-Maske austeilen, unausweichlich. Ebenso findet im überbelegten Zellenhaus-Trakt I mit ca. 300 Häftlingen im engsten Raum auch keine Desinfektion von Flächen u. Gegenständen statt. Da herrscht nur Schlendrian. Für die Unterbringung meiner Person und für die familiäre Unterstützung sind unter ON 10 u. ON 73 aus 24 BE 302/18s von meinen Geschwister bereits Bestätigungen erbracht worden sowie für die finanzielle Sicherung zur Lebensunterhalt durch die Mindestsicherung und Heimopferrente, ON 1 S. 23-25 aus 24 BE 302/18s. Ich beantrage weiteres 1) zur Wahrung der Rechtssicherheit Beigebung eines Verfahrenshelfers wegen Mittellosigkeit u. 2) beschleunigte Bearbeitung meines Antrages zum Schutze meiner Gesundheit und Leben. Beilagen fünf med. Befunde von 2016 – 2018 u. eine Ausgangbestätigung Illustrierte Version Dies ist ein unvorstellbar wahres Drama & Gerichtskrimi Dokumentiert und illustriert aus Gerichts- und Medienunterlagen u.a.m. Justiz Krimi – Drama – Tragödie Die Authentizität der True-Story wird durch das brandneues Gerichtsgutachten des renommiersteten Forensiker Europas, Prof. Dr. Norbert Nedopil vom 02. Juli 2020 belegt https://google.com/Prof. Dr. Nedopil-Gutachten 2.7.2020 Häftling verschleppt nach Gefängnisausbruch Politiker-Ehefrau im Wald und… Täter: Ausgebrochener Häftling Opfer!: Politiker-Ehefrau Tatort: Zwischendurch der Wald (Hinweis: bei anklicken der links und fettmarkierten Nummern öffnen die links u. Gerichts- u. Medienunterlagen automatisch (Bequemer), sodass Sie nur mehr auf die jeweilige bezogene Seite durchzublättern brauchen (Bitte berücksichtigen Sie, dass die meisten Dokumente in den späten 1980er Jahre per mechanische Handschreibgeräte gefertigt wurden. Bei manchen Urkunden ist zoomen hilfreich) Gesamter Unterlagen zur Sache u.a. auch bei https://Chmelirs-Odyssee Aus Sicht des Dramas & der Rechtsstaatlichkeit wahrscheinlich der unfassbarste Straffall & Strafprozess der Republik Österreich Bei dieser illustrierten Justizthriller-DOKU geht es um einen höchst dramatischen Kriminalfall im Zusammenhang eines Gefängnisausbruchs August 1989 des Häftlings Juan Carlos Bresofsky-Chmelir aus der Strafanstalt Graz-Karlau und der vermeintlichen Geiselnahme und Verschleppung der Ina P. als Ehefrau eines Oberregierungsrates der steirischen Landesregierung in den tiefen Kärntner Wälder, deren tatsächlichen Verlauf und Tragweite von der Justiz und von der Öffentlichkeit bis heute in wesentlichen verschwiegen bzw. einseitig und verzerrt gegen den mutmaßlichen Täter negativ gerichtet berichtet wird, obwohl die Gerichtsakten beim LG Graz zu GZ: 6 Vr 1998/89, Hv 5/90 eine bisher ungeahnte, unfassbare und unvorstellbare Tragödie, Dramatik und Verschwörung (ver)birgt. Der Leser wird sehr schnell feststellen, dass die Angelegenheit in besonderer Weise dazu verleitet einen nüchternen und objektiven Verstand zur Sache zu verdrängen und stattdessen die Emotionen hochgehen zu lassen zudem der Häftling Chmelir vor kurzem seine persönlich verfassten Memoiren freigegeben hat (unten ab Seite 37 zur Verfügung). Ich bin kein Autor oder sonst ein Vielschreiber. Trotzdem benötige ich nur 36 Seiten um die brisante Angelegenheit nachvollziehbar zu dokumentieren. So einfach ist es – ein Wahnsinn! Die Politiker-Ehefrau Ina P., laut eigenen Angaben zwei tagelang Geisel- und Vergewaltigungsopfer des Gefängnisausbrechers Chmelir hält sich fast ständig mit dem flüchtigen Häftling in Kontakt zur Außenwelt auf, und zwar unmittelbar unter dutzenden Passanten per Spaziergänge in zahlreichen belebten Orten und Städte sowie in Privathäuser, in Supermärke und in Cafelokale unter zahlreichen Privatpersonen, Gäste und Bedienpersonal und begeht wiederholt mit dem flüchtigen Häftling Autostopp. Nach 48 Stunden erscheint sie dann mit einer schriftlichen Selbstanzeige des Gefängnisausbrechers bei der Klagenfurter Polizei (07.) - und das Grazer Gericht verdonnert den Häftling in einen unvorstellbaren Prozess ohne annähernd eines ordentlichen Beweisverfahrens zu einer drakonischen Zusatzhaftstrafe von 18 Jahre Strafhaft. Blättert man durch die gegenständlichen Gerichtsakten, so glaubt man sich unausweichlich in die Ära der Grazer NS-Justiz zurückversetzt (Medienartikel 44.), weil die Verurteilung des Angeklagten zu einer 18-jährigen Zusatzhaftstrafe mit vollem Vorsatz der Verfahrensverantwortlichen auf Unterdrückung der gesamten polizeilichen und gerichtlichen Ermittlungen und der Beweissicherung zur Sache ruht und somit auf keinen ordentlichen Beweisverfahren, weder im Vorverfahren noch in der Hauptverhandlung, genauso nach den Praktiken der NS-Justiz, wie in der Folge belegt und nachgewiesen wird. Hier liegt nicht nur von den Verfahrens- und Prozessverantwortlichen Amtsmissbrauch in kollektiv vor, sondern auch Meineid der Geschwornen, die wissentlich weggeschaut und die somit bewusst und aktiv mitgeholfen haben, nichtsdestoweniger der Verfahrenshelfer Chmelirs der Grazer Rechtsanwaltkanzlei Dr. Richard Kaan. Hierzu werden keine bloßen Behauptungen aufgestellt, sondern der Gerichtsakt 6 Vr 1998/89 des Landesgericht Graz liegt vollständig vor und die wesentlichen Urkunden daraus sind auf der Website bereits abrufbar, jeweils nach den bezeichneten nummern. Wenn unten manche Auszüge nicht klar gefolgt werden können, so kann man die komplette Urkunde auf der Website einsehen oder runterladen und nach Belieben zoomen. Der gegenständliche Gerichtsakt spricht Bände dafür, dass das Grazer Gericht und die Obergerichte zur Sache nach Klassenjustiz agierten sowie rein emotional und schwer befangen, weil Ina P. Ehefrau eines hohen steirischen Landespolitikers war. Die Befindlichkeit der Justiz der Emotionalität und Befangenheit zur Sache dürfte von Gerichtspersonen als auch von den Medien bezüglich der Berichterstattung dazu ausgenützt worden sein, um gegen den Beschuldigten negativste Stimmung zu machen sowie zur Verschleierung der Tatsachen durch massivsten Vorverurteilung. Deswegen werde ich hier zur Dokumentation mit negativen Schlagzeilen in Medienartikeln, die Chmelir in schlechtem Licht rückt genauso nicht unberücksichtigt lassen, wie mich auch nicht mit Zweifel und Kritik gegen die zuständigen Gerichte zurückhalten, nicht weniger auch gegen Ina P. als vermeintliches Opfer, um die Dimension und Kontrast zwischen Fiktion, (Vor-)Täuschung und Realität des wahren Geschehens hervorzuheben. Kinder zu haben und Ehefrau eines Politikers zu sein hebt die Rechtsstaatlichkeit nicht außer Kraft. Auch das Vorleben Chmelirs rechtfertig nicht die Vorgehensweise des Grazer Gerichtes und der Obergerichte die Ermittlungen und die Beweissicherung zur Sache vorsätzlich zu unterdrücken sowie den Beschuldigten sämtliche Verfahrens- u. Prozessrechte beraubt zu haben und wider seine wahre Schuld zu verurteilen, jedenfalls nicht in einen demokratischen Rechtsstaat. Das Bewegungsprofil Ina P. mit dem flüchtigen Strafgefangenen Juan Carlos BresofskyChmelir in der breiten Öffentlichkeit ist beachtlich und unfassbar, das sie nie ernsthaft die Gelegenheit um Hilfe zu schreien oder um zu flüchten wahrgenommen hat. Auszüge aus der Polizeiangaben der Politiker-Ehefrau (08./5, 6). Was spielte sich tatsächlich ab zwischen Ina P. und Chmelir in den tiefen Wäldern Kärntens und zwischendurch in diversen öffentlichen Orten, in Bauerhäuser, in Geschäfte und in Cafelokale und von einen Ort auf den anderem per Autostopp! Zu Chmelirs „wahren verschulden“ und Tatumständen ist auch Fakt, dass Chmelir als flüchtiger Häftling nicht wissen konnte, das Ina P. Mutter ist und Ehefrau eines hohen Grazer Landespolitikers. Schließlich bereute Chmelir seinem verschulden gegenüber Ina P. zutiefst, verfasste eine Selbstanzeige zur Sache (07./1-6) und ließ die Politiker-Ehefrau Ina P. zu einer Zeit aus freien Stücken zur Polizei gehen, zu dieser Zeit weder die Polizei noch die Öffentlichkeit die leiseste Ahnung hatten, was um die Politiker-Ehefrau geschehen ist. Zu den Fakten gehört auch, dass selbst die Politiker-Ehefrau Ina P. zwanzig Jahre später (2009) eine Eingabe an das Gericht richtete, in der Eingabe sie die Entlassung Chmelirs unterstützt und ausdrücklich betont, das Chmelir schon damals das Unrecht seiner Handlungen eingesehen hat (09.): Daher sollte der Leser Emotionen und Befangenheit zur Sache beiseiteschieben und die Angelegenheit zunächst mal objektiv und sachlich betrachten und nach rechtsstaatlichen Prinzipien (be)urteilen und seine scharfe Zunge erst dann verwenden, wenn man sich mit der Materie der Causa vertraut gemacht hat. Wer weiß, was bei diesem Fall heute oder morgen noch rauskommt! Chmelirs „wahren verschulden“ muss deshalb betont werden, weil zwischen seine wahre Schuld und seiner Verurteilung zu einer 18-jährigen Zusatzhaftstrafe nicht nur Welten dazwischen liegen, sondern und insbesondere die Vergewaltigung des Rechtsstaates durch die Justiz selbst und somit eine latente Gefahr für jeden Staatsbürger mitunter heute oder morgen mit einer Justiz in Kontakt zu kommen, die offenbar zu allem fähig zu sein scheint. Denn allein schon (aber nicht nur!) aus wenigen Gerichtsunterlagen lässt sich konkret nachweisen und belegen, dass der Chmelir-Prozess vom 28.6.1991 beim Landesgericht Graz eine Verschwörung aller beteiligten des Schwurgerichtes gegen den Angeklagten war, Geschwornen und Pflichtverteidiger inbegriffen (Hauptverhandlungsprotokoll 01., Zeugenprotokolle Ina P. 08. 10. 11.,Strafurteil 41. u. Chmelirs-Anträge 16. 17.). Der Beschuldigte Chmelir hatte von Anfang an keine Chance auf ein faires Gerichtsverfahrens und Urteil. Das Grazer Gericht hatte offensichtlich nur eines im Sinn: die wahren Tatumstände durch Unterdrückung der Vorermittlungen und der Beweissicherung zur Sache zu vertuschen und den Angeklagten mit allen denkbaren Mitteln schuldig zu sprechen und zu verurteilen, weil die Wahrheit offensichtlich tragisch, dramatisch und unvorstellbar ist – erst recht dramatisiert durch ein Justizkomplott-Prozess gegen den Angeklagten. Das muss man sich regelrecht auf der Zunge zergehen lassen. Die Justiz ist nach den Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit zu Objektivität und der Wahrheitsfindung verpflichtet, § 3 StPO (55./5 – Rechtsvorschrift der Strafprozessordnung). Und was macht sie im ChmelirStraffall! Sie unterdrückt und vertuscht Beweise und biegt sich die Wahrheit aus persönlichem Eifer und aus Eigengutdünken zurecht. Denn speziell der schwersten Kapitalverbrechen an Ina P., die den Beschuldigten zu Lasten gelegt wurden und die teilweise vor den Augen der Öffentlichkeit sowie in privaten Orten unter dutzenden Personen geschehen sein sollten (schwerer Raub, mehrfacher Vergewaltigung unter besonderen Qualen und Erniedrigung u. schwerer Nötigung etc.), wurden die Vorermittlungen und die Sicherung von Beweise zur Sache von Beginn an des Bekanntwerdens des Straffalles und der Einleitung des Strafverfahrens von den Polizei- und Gerichtsbehörden vorsätzlich zur Gänze unterlassen, genauer unterdrückt. Die Intention der Ermittlungsbehörden diesbezüglich weder die Tatorte zu lokalisieren noch unmittelbar vor Ort Beweise zu sichern, ist eigentlich nicht schwer durchzuschauen und zu beweisen. Zum einen hätten die Ermittlungen keine gute Optik auf Ina P. als Ehefrau eines Politikers geworfen mit einen Gefängnisausbrecher in der breiten Öffentlichkeit herumspaziert zu haben und unter anderem auch in Cafelokale ein und aus gegangen zu sein, ohne einen Quietscher gemacht zu haben. Und zum anderen hätten die Ermittlungen und die gesicherten Beweise (dutzende Augenzeugen u.a.m.) mit höchster Wahrscheinlichkeit nach Chmelir erheblich entlastet, mitunter sogar von dem Hauptanklagepunkte freigesprochen, wie unten näher erläutert. Geradezu lächerlich penibel ermittelt und beweise gesichert wurden allerdings nur an unbedeutende Orten, wo Chmelir nach seiner Flucht aus der Strafanstalt vor und nach der vermeintlichen strafbaren Handlungen an die Politiker-Ehefrau Ina P. kleinere Diebstähle in Schrebergartenhütten und in Wochenendhäuser begangen hatte, um sich Nahrungsmitteln und Bekleidung zu besorgen, wofür er sich sogar entschuldigte (51./3 - 5). Da wurde ein großer kriminalistischer Aufwand betrieben und Chmelir sogar zur Lokalisierung der Orten und Objekte der Einbruchsdiebstähle vor Ort ausgeführt (12./17 u. 13./1-6), wobei die geschädigten der Einbruchsdiebstähle auch zum Prozess als Zeugen vorgeladen wurden (14./2 u. 3), während rund herum der Örtlichkeiten und Objekte (Privathäuser, Geschäfte, Cafelokale, Autobesitzer etc.) im Zusammenhang der strafbaren Handlungen an Ina P. einen großen Bogen gemacht wurde, teilweise unter persönlicher Anweisung des zuständigen Untersuchungsrichters Mag. Gernot Patzak an den Polizeidienststellen. Auszug aus den Protokoll des U-Richters (30.). „Kurze Vorgeschichte zur Person Chmelirs“ Am 02. August 1989 brachen drei Häftlinge aus der Justizanstalt Graz-Karlau aus. Darunter der bereits seit 11 Jahren wegen Bank- u. Postüberfälle sowie wegen erschießen eines Postbeamten einsitzenden Strafgefangenen Juan Carlos Chmelir, geborener Bresofsky am 08. Juni 1949 in Uruguay (Medienartikeln 28. 48. 49.). Bei Chmelir handelt es sich in der Tat um keinen gewöhnlichen Häftling, sondern er hat in Österreich eine fatale Vorgeschichte als Heimopferkind der 1960er Jahre (03.) Entschädigungs- und Entschuldigungseingaben der Stadt Wien u. der Landesregierung NÖ). https://kurier.at/rekordhaeftling-fordert-heimopferrente http://wien.orf.at - Gewalt gg. Heimkinder http://kurier.at/methoden-wie-in-konzentrationslagern http://kurier.at/der-schatten-der-nazis/ Näheres zu seiner Kindheit in Uruguay und über seinem erlebten Terror in den Heimen und Jugendgefängnisse in Österreich, schrieb er persönlich in seiner Memoiren „Integration der Gewalt“ (04.) oder unten ab Seite 93. Aus dem Heimopferkind erwuchs jedenfalls ein Rebell, der mitten aus dem Gefängnis heraus – mit erstaunlichem Erfolg - spektakulären Protestaktionen und Gefängnisausbrüche organisierte, um das österreichische Vollzugssystem in der Öffentlichkeit anzuprangern und zu politisieren (Medienartikeln 05. 06.). Spektakuläre eineinhalbtätige Protestaktion 1983 auf den Kirchendach in Garsten gegen gravierende Missstände in der Strafanstalt Garsten (Medienartikeln 45.). Journalisten überredeten ihn nach Zusicherungen ein Augenmerk auf den Vollzug zu behalten schließlich zur Aufgabe. 1989 Flucht aus der Strafanstalt GrazKarlau. 1992 organisierte er in der Strafanstalt Stein eine Revolte. http://www.noen.at/Ex-Haeftlingsfuehrer Jedenfalls ist hinter vorgehaltener Hand ein offenes Geheimnis, das Chmelir bei der Justizwache sowie bis obenauf der Vollzugsbehörden ein verhasster Häftling ist, der die Justiz heute noch – trotz seines hohen Alters von 71 Jahren immer wieder auf Trab hält und anprangert. Früher mit spektakulären Protestaktionen, heute mit scharfer Kritik (54a.) und pikanten Eingaben über Missstände im Gefängnis (54.) bis zu Amtshaftungsklagen gegen die Republik hin. http://www.oe24.at/All e-wussten-Bescheid http://diepresse.com/H aeftling-warnte-schon2013 Bei Missständen in den österreichischen Gefängnissen ist der Name Juan Carlos Chmelir in den Medien untrennbar mit-verbunden. Dementsprechend glaubwürdig, dass das Leben Chmelir hinter Gittern als unbeliebter Häftling der Justizwache und Vollzugsbehörden nicht unbedingt rosig sein kann und sein wird, wird er von der Justiz und Medien wegen seiner Protesthaltung und Kritik gerne auch als Staatsfeind Nr. 1 tituliert. https://www.heute.at/s/haftling -fordert-zwangsversteigerungder-lipizzaner-21976458 Äußerung Chmelir dazu: “Die Gewalteinwirkung und Gewalterfahrung in staatlichen Heime und Jugendgefängnisse in den 1960er Jahren, die ich als halbwüchsiger durch Misshandlungen u. Erniedrigungen und einiges mehr durchmachen musste hat mein Leben und Schicksal negativste geprägt. Noch dazu als ausländisches Kind ohne Deutschkenntnisse, so dass ich mich nicht einmal verbal verteidigen oder mich jemand anderen mitteilen konnte. Diese Weise der völligen Ausgeliefertsein und der innerlichen Erstickung werde ich mein Leben lang nie vergessen und aus meinen Kopf löschen können. Ich bin aus diesem Irrsinn und Wirrwarr der staatlichen Destruktivität als Opfer zum Täter geworden. Das entschuldigt keineswegs meine bisher begangenen strafbaren Handlungen, wofür ich mittlerweile insgesamt mit über fünfeinhalb Jahrzehnten im Gefängnis büße. Unstrittig ist aber auch das mit-verschulden des Staates abertausende Heimkinder durch Gewalt und durch Missachtung der Menschlichkeit fürs Leben schwer geschädigt und geprägt zu haben. Und wenn sich heute die Behörden damit zu rechtfertigen versuchen, dass wegen der Heimerlebnisse keiner kriminell werden muss, so verleugnet und verdrängt sie die Realität. Denn aberhunderte Heimkinder, die damals auf der Flucht vor den Horror in den Heimen waren, waren regelrecht dazu gezwungen im Underground und am Straßenmilieu zu überleben, sei es durch Diebstähle oder auf den Straßenstrich um eine warme Mahlzeit, warme Bekleidung und um eine warme Unterkunft. Als gejagter war anders kein überleben möglich, denn gingen wir zu unseren Eltern stand die Polizei schon vor der Haustür. Als Folge landeten wir dann zu hunderten in Jugendgefängnisse, wo die Tortur weiterging. Anstatt psychologische und therapeutische Betreuung und Behandlung der innerlichen Verletzungen, die wir Heimkinder stets mitschleppten, gab es weiterhin prügeln. Eine fatale Kettenreaktion, die man nicht entkommen konnte, weil die innerlichen Schäden immer schlimmer wurden und weil damals die Barrieren in der Gesellschaft gegen Heimkinder und Vorbestraften halbwüchsige unüberbrückbar waren. Man wurde zum Außenseiter geprügelt und man blieb Außenseiter und man kämpfte sich als Außenseiter durch. Nur wenige gelang es durch glückliche Umstände in einem normalen Leben wieder Fuß zu fassen. Dutzende haben Selbstmord begangen. Unzählige sind infolge der psychischen Verletzungen und Traumatisierung für ihr ganzen leben psychisch krank geblieben oder Drogenabhängig geworden. Und sehr viele sind aus der Erfahrung des überleben-müssen am Straßenmilieu der Kriminalität regelrecht hineingewachsen. Dass ich dann in Erkenntnis der staatlich systematischen Verbrechen in den Kinder- und Jugendheimen und Jugendgefängnisse von einem Zeitpunkt an eine Protesthaltung eingenommen habe und mir zur Aufgabe gemacht habe Missstände und Nazi-Praktiken im Keller und in den Katakomben der Republik aufzuzeigen, da sollte man sie sich nicht wundern, denn es war höchste Zeit und höchstnotwendig. Meine Entscheidung war folgerichtig und eine gute Sache. Auch wenn es vielen bis heute nicht passt. Im Kern des österreichischen Staats ist die Nazi-Gesinnung noch fest verwurzelt. Sie kaschiert es nur mit falscher Freundlichkeit und Galanterie nach außen hin sehr geschickt. Sie hat nie aufrichtig ihre NS-Vergangenheit aufgearbeitet. Deswegen ist ihr Geist durch Überschreitung der menschlichen Hemmschwelle zur bestialischen und industrialisierten Massenmorden und durch den Euthanasieprogramms während der NS-Ära noch erheblich verschmutzt und belastet. Sie ist in Wirklichkeit nur frustriert mit Hitler nicht die Weltmacht erlangt zu haben. Die Welt kann sich glücklich wähnen, das Österreich vom Großkaisertum Maria Theresia zum Zwerg geschrumpft ist. Denn hätte der Staat morgen die Gelegenheit Weltmacht zu erlangen, so kann sich jeder absolut sicher sein, das übermorgen wieder KZ-Vernichtungslagern aus den Boden wachsen würden, wie warmen Semmeln aus den Backofen. Denn an ihre paranoid krankhafte Einbildung „Herrenrasse zu sein“, hat sich Mangel an Erkenntnis und Selbsterkenntnis und Bewusstwerdung nichts geändert“. Ich habe die Ausführungen Chmelirs bewusst einflößen lassen, damit sich jeder ein eigenes Bild seiner Persönlichkeit machen kann. Da ich Chmelir seit Jahren persönlich kenne, kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, das Chmelir nicht im Geringsten von Hass beseelt ist oder von Hass geleitet wird, sondern es ist seine rein geistige Überzeugung, die er sich aus den negativen Erfahrungen jahrzehntelanger Freiheitsentzug in den Katakomben Österreichs gebildet hat. Sein Auftreten ist ruhig und höflich. Er ist stets gepflegt und sauber bekleidet. Selbst der renommierstete Forensiker Europas, Prof. Dr. Norbert Nedopil schrieb über ihn: „Vom Äußeren wirkte Herr Chmelir eher wie ein pensionierter Beamter als ein Gefängnisinsasse“ (Seite 43 unten https://google.com/Prof. Nedopil-Gutachten) „Gründe zum Chmelirs-Gefängnisausbruch“ Chmelir begründete seine Flucht vom 2.8.1989 damit, dass er krank war und schmerzen hatte und das er um sein Leben fürchtete, weil er im Gefängnis keine angemessene ärztliche Hilfe bekommen hätte sowie weil er vom Gefängnispersonal schikaniert wurde, weil er Missstände im Gefängnis aufgezeigt hätte (01./13), sodass er keinen anderen Ausweg sah, als bei Gelegenheit zu flüchten. Wie aus einem Schreiben der Präsidentschaftskanzlei vom 9.5.1990 bestätigt (02.), war Chmelir zur Zeit seiner Flucht u.a. tatsächlich auch an Schilddrüsenüberfunktion und an Zwölffingerdarmgeschwür erkrankt. Jeder Arzt würde nur zu gut bestätigen, dass besonders Schilddrüsenüberfunktion das Nervensystem sehr belastet, die Belastung wiederum in Kombination eines fortgeschrittenen und schmerzhaften Zwölffingerdarmgeschwürs sehr wohl als eine ernsthafte physische Erkrankung eines Patienten bestätigt. Das soll Chmelir weder entschuldigen noch rechtfertigen, sondern von den Fakten und Sachlage her gesehen durchaus berücksichtigt werden, das Chmelir tatsächlich aus einen Zustand der Angst ums eigene Leben aus dem Gefängnis geflüchtet war, berücksichtigt man hinzu sein negativer Stand bei der Justizwache und Vollzugsbehörden allein schon wegen seiner weltweit aufsehenerregenden Protestaktion am kirchendach 1983, die seinerzeit selbst das Bundesministerium für Justiz arg in Misskredit brachte. Wenn man krank ist und es wird einem ärztliche Hilfe verweigert, gerät man eben in Angst und unter Druck, insbesondere wenn man Häftling ist und ausschließlich auf einen einzigen Arzt, nämlich auf den Gefängnisarzt angewiesen ist. Erstaunlich bei den Schreiben der Präsidentschaftskanzlei ist nebenbei bemerkt, dass sie Chmelir der Vergewaltigung vorverurteilt noch bevor ein Prozess stattfand und ein rechtskräftiges Gerichtsurteil vorlag. Offensichtlich von der massiven Medienvorverurteilung Chmelirs beeinflusst, die seinerzeit Wochenlang verbreitet wurde. „Zur Strafsache“ Nach fünf Tagen auf der Flucht, 7. August 1989, stoppte Chmelir verletzt und erschöpft und in Verfolgungspanik geraten in der späten Vormittagsstunden ein Personenwagen, bedrohte die Autofahrerin unter Vorhalt eines Messers vor der Brust und zwang sie zur Fahrt nach Kärnten zur jugoslawischen Staatsgrenze. Die Autofahrerin war keine geringere als die Ehegattin eines Oberregierungsrates der steirischen Landesregierung (Medienartikel 47.) Zwei Tage später, 9. August 1989 gegen 08.00 Uhr erging ein Anruf des flüchtigen Häftlings bei der Kärntner Kronen Zeitung (42.). Gegen 10.30 Uhr erschien dann die Politiker-Ehefrau Ina P. mit einer an Dramatik kaum zu überbietende Selbstanzeige des Gefängnisausbrechers bei der Klagenfurter Polizei, legte die Selbstanzeige Chmelir vor (07.) und gab zu Protokoll, das sie von den flüchtigen Häftling gewaltsam angehalten, mit einen Messer bedroht und verletzt und zur Fahrt zur Staatsgrenze unter Morddrohungen genötigt wurde sowie das sie von Chmelir mehrmals sexuell missbraucht wurde (08./3, 4, 6), sozusagen auf den ersten Blick ein hochdramatischer Kriminalfall. Bei den später von der Polizei sichergestellten PKW von Ina P. konnten keine verwertbaren Gewalt- oder Blutspuren vorgefunden werden (26./5 unten), obwohl Ina P. im Auto durch eine Stichverletzung geblutet haben sollte. Und zum Mysterium und der Kuriosität der Strafsache nicht genug, schrieb Ina P. erstaunlicherweise 20 Jahre später an das Grazer Gericht eine Eingabe zur Unterstützung der bedingten Entlassung seines angeblichen Peinigers (09.). Medienartikeln 27. Unten u. 28. Am 14.8.1989 wurde Chmelir schließlich in Klagenfurt wieder gefasst (Medienartikel 24.). „Prozedere der Vorermittlungen und Beweissicherung“ Die Strafsache zu GZ: 6 Vr 1998/89 wurde beim LG Graz wegen Erpressung, mehrfacher Vergewaltigung, gefährlicher Drohung, Freiheitsberaubung, Nötigung und Körperverletzung eingeleitet. Vorweggenommen habe ich bereits, dass weder die Klagenfurter Polizei noch das Grazer Gericht Ermittlungen zur Sache durchgeführt haben noch beweise gesichert, obwohl aus dem Polizeiprotokoll der Ina P. vom 9.8.1989 klar hervorgeht (08./5, 6), das sie sich mit Chmelir während die 48 Stunden äußerst auffallend oft in unmittelbaren Kontakt zur Außenwelt und zu dutzenden Personen aufgehalten hat. Auf der Straße in belebten Orten und Städte unter zahlreichen Passanten und Autofahrer. In Privathäuser, in Supermärke und sonstige Geschäfte sowie in Cafelokale und in PKWs per Autostopp. Als Ehefrau eines hohen Grazer Politikers und als Mitglied der Oberschicht der Grazer Gesellschaft genoss Ina P. bei den Ermittlungsbehörden des Landesgerichtes Graz offensichtlich eine Sonderstellung der Unantastbarkeit – zum erheblichen Nachteil Chmelirs. Als Integer und normal denkender Mensch kann ich mir angesichts des Bewegungsprofils in der breiten Öffentlichkeit beim besten Willen nicht vorstellen, dass Ina P. tatsächlich in der Gewalt und in Geiselhaft des flüchtigen Häftlings gewesen sein konnte. Umso weniger in Kenntnis, dass die Ermittlungsbehörden mit vollen Vorsatz Ermittlungen und die Sicherung von Beweise zur Sache zur Gänze unterließen bzw. unterdrückten. Ermittlungen nämlich, die zur Konkretisierung und Objektivierung der Anklagepunkte und hiermit zur Klärung der Schuldfrage und die Schwere der Schuld, daraus der Strafausmaß resultiert von der Strafprozessordnung her verpflichtend gewesen wären, § 3 StPO (55./5 – Rechtsvorschrift der Strafprozessordnung). Gerade dieser Umstand der Unterlassung durch die Ermittlungsbehörden schürt unausweichlich den Verdacht in die Höhe, dass zum Nachteil Chmelir vorsätzlich erhebliche Entlastungsbeweise unterdrückt und vertuscht wurden, und zwar mithilfe der medialen Öffentlichkeit, die über den Verlauf des Strafverfahrens regelmäßig informiert war. Denn bei ordentlichen Ermittlungen wären mit Sicherheit dutzende Augenzeugen eruiert worden (Bewohner der Bauernhäuser, Ein- und Verkäufer der Einkaufgeschäfte, Gäste und Servierpersonal der Cafelokale sowie die Autobesitzer der Fahrten per Autostopp etc.), die zur Sache objektiv aussagen hätten können und die zur Hauptverhandlung als objektiven Zeugen vorgeladen hätten werden müssen. Es geschah aber weder das eine noch das andere. Möglicherweise weit mehr Augenzeugen, denn Chmelir schreibt in seiner Memoiren durchaus glaubhaft, das er und Ina P. neben der Einkaufgeschäfte insgesamt vier Cafelokale und zwei Bauernhäuser aufgesucht hätten (32./19, 32, 37, 38, 42, 44, 47, 49, 54), wobei sie im Ort Bleiburg ein und derselbe Caféhaus gleich zweimal aufgesucht hätten, während Ina P. nur von zwei Cafelokalen und ein Bauernhaus spricht. Bezüglich ordentlicher Ermittlungen zur Sache ist unerheblich, das Chmelir Selbstanzeige erstattete und vor den Untersuchungsrichter zu keiner weiteren Aussage mehr bereit war und das er es damit begründete, das er dazu seine Gründe hätte (39./4). Auch der Umstand, dass sich Chmelir in der Selbstanzeige vom 8.8.1989 der besonderen Brutalität gegenüber Ina P. belastete (07./1-4), wird selbst von der Politiker-Ehefrau mit Polizeiprotokoll vom 9.8.1989 widersprochen (08./4 unten): In Normalfall hätte der U-Richter Mag. Gernot Patzak spätesten zu diesem Zeitpunkt alarmiert sein müssen, dass es sich mitunter um ein falsches Geständnis handelt, zumal sich Chmelir schon in seiner Selbstanzeige sowie vor der Klagenfurter Polizei um die Integrität Ina P. außergewöhnlich große Sorgen machte (12./6, 8). Sehr ungewöhnlich jedenfalls, dass sich ein Gangster und Gefängnisausbrecher mehr Sorgen um sein vermeintliches Opfer macht, als um sich selbst. Vor allem in eine hochdramatische Situation. Dem entspricht keineswegs das Bild einer Bestie oder eines Gangsters, der über Leichen geht, wie manchen Medien über Chmelir schrieb. Im Gegenteil, das spricht eigentlich dafür, dass sich Chmelir gegenüber Ina P. jedenfalls von einem Zeitpunkt an tatsächlich anständig benommen haben dürfte, was auch vieles anderes mehr erklären würde. Auch die Eingabe der Politiker-Ehefrau an das Gericht vom 19.4.2009 mit der sie mehr oder weniger seine Entlassung unterstützt (09.). Die Kommunikation zwischen Ina P. und Chmelir ist bis heute nicht abgebrochen. Sie haben zwischendurch sogar persönlich miteinander telefoniert und verständigen sich auch über Journalisten. Das Ganze ist beachtlich, mysteriös, genauer ein Mysterium. In seiner Memoiren schreibt Chmelir jedenfalls ausführlich darüber (32.), sich bei Ina P. wiederholt entschuldigt zu haben sowie ihr vielen Komplimente und Avancen gemacht zu haben. Mitunter hat sich Ina. P. von seinen Komplimenten und Avancen imponieren lassen. Es gibt viele Frauen mit Flair für Gangstern und Abenteuern. Das löst bei vielen Frauen, warum auch immer Bewunderung und Faszination aus. Es darf aber auch nicht übersehen werden, das Chmelir äußerst intelligent ist, was er auch eindrucksvoll mit seinen spektakulären Protestaktionen wiederholt bewiesen hat. Nebenbei dürfte er bei Frauen durchaus Eindruck machen, denn selbst seine mittlerweile Dezember 2018 verstorbene Ex-Frau und Lebensgefährtin Silvia Chmelir blieb bis zuletzt in ihm verliebt (72.) Ich habe schon erlebt dass solche Überlegungen, das Chmelir Ina P. mitunter mit Charme erobert hat sogar bei Journalisten spontanen Hass auslöste, ohne das sie Chmelir persönlich kennen noch das sie je in den gegenständlichen Gerichtakten Einsicht genommen, geschweige denn das sie die Hauptverhandlung beigewohnt hätten. Schon der simple Gedanke, dass sich zwischen Ina P. und Chmelir etwas Gemeinsames angebahnt haben könnte, lässt die Geister offenbar verrücktspielen. Interessant! Bei dem Mysterium des Kriminalfalles kann man tatsächlich nichts ausschließen. Auch nicht, das sich zwischen Ina P. und Chmelir mitunter doch eine gewisse gegenseitige Zuneigung angebahnt hat, die in eine leidenschaftliche Umklammerung mündete. Das sind keine Spekulationen, sondern Überlegungen dazu die Strafsache und das ganze Geschehen um diesen Fall regelrecht einlädt, auch wenn man es nicht wahrhaben will. Chmelir schreibt ja in seiner Memoiren auch darüber, dass Ina P. im Wald plötzlich herumsprang und geradezu begeistert ausrief: „Stellen Sie sich vor! stellen Sie sich vor! Als kleines Kind träumte ich von Räuber und Gendarmspiele und jetzt bin ich selber mittendrinnen“ (32./16). Wenn das stimmt, dann sind die Tragödie und das Drama aufgelegt und erklärt alles; das falsche Geständnis Chmelirs, um Ina P. zu schützen; die Unterdrückung der Ermittlungen und die Beweissicherung zur Sache durch die Polizei- und Gerichtsbehörden sowie die Missachtung der Verfahrens- u. Prozessrechte des Angeklagten als auch die dunklen Tatumstände und die erheblichen widersprüchlichen Angaben Ina P. Für das Mysterium des Kriminalfalles haben mehr oder weniger die Polizei- und die Gerichtsbehörden selbst dafür gesorgt bzw. verschuldet, indem sie ordentlichen Ermittlungen und die Beweissicherung zur Sache unterdrückten. Sodann ist die Causa Trotz die Verurteilung Chmelirs bezüglich der Tatorte, Tatumstände und die zu sichernden Fakten sowie die zu eruierenden Augenzeugen im Grunde bis heute unaufgeklärt geblieben. Unglaublich! Betrachtet wir uns einmal die Angelegenheit aus dem Blickwinkel Ina P. im Vergleich zu ihrer zahlreichen widersprüchlichen protokollarischen Angaben sowie über die Unlogik ihres Verhaltens in eine vermeintliche Situation der Todesangst etwas näher an. Liest man nämlich die protokollarischen Angaben von Ina P. vom 9.8., 24.8. sowie vom 16.10.1989 unvoreingenommen und aufmerksam durch (08. 10. 11.), so fällt die Überzeugung nicht schwer, das dieser Kriminalfall zu einen der tragischsten und dramatischten zählt, der die Kriminalgeschichte kennt. Warum? Ganz einfach, weil zwischen den Zeilen ihrer Aussagen klar erkennbar ist, das sie sich selbst verraten und kompromittiert hat und weil der Verdacht im wahrstem Sinne des Wortes erheblich ist, das Chmelir bewusst ein falsches Geständnis abgelegt hat, um sie zu schützen, weil Ina P. offensichtlich und zumindest von einem Zeitpunkt an mit Chmelir freiwillig mitgegangen ist und ihm – aus welchen Gründen auch immer – beim Fortgang seiner Flucht unterstützte. Freiwilligkeit deswegen, weil es höchst fragwürdig ist, das Ina P. bei derartigen massiven Kontakte zur Außenwelt in unmittelbarer Nähe von zahlreichen Passanten und Personen auf der Straße, in privaten Häuser, in Einkaufgeschäfte, in Cafehäuser sowie wiederholt per Autostopp unterwegs kein einziges Mal die Gelegenheit zur Flucht oder um Hilfe zu schreien vorgefunden haben will, befand sie sich nach eigenen Angaben fast ständig in einen Zustand der Angst und Schrecken und fürchtete sogar um ihr Leben „…man wartet nur mehr auf das Ende“ (01./39 Mitte). Auf den Waldweg in Hart bei Gratkorn völlig allein auf sich gestellt will sie – nach eigenen Angaben - einen Fluchtversuch unternommen haben, und zwar nichtsdestotrotz einer durch Chmelir angesetzten Stichwaffe vor der Brust (08./1 unten, 2 oben). Paradox: als sie dann mit dem Täter geradezu ständig in der breiten Öffentlichkeit unter unzähligen Menschen unterwegs war, will sie keine Möglichkeit mehr dazu gefunden haben! Eine Frau, die tatsächlich mit einem Messer verletzt und permanent bedroht und mehrmals vergewaltigt wird und die ständig in Todesangst ist, ergreift sofort die sich nächstbietende Chance zu flüchten oder um Hilfe zu schreien und geht sicher nicht mit seinen Peiniger in der breiten Öffentlichkeit auf der Straße herumspazieren noch ist sie mit dem Täter mehrmals per Autostopp unterwegs, ebenso nicht ständig in privaten Häuser, in Einkaufgeschäfte und in Cafelokale – und schreibt später ganz sicher auch nicht eine Eingabe an das Gericht und unterstützt seine Entlassung. Umso unglaubwürdiger sind ihrer Angaben auch deswegen, weil eine Frau in Angst und Schrecken und in Todesangst inmitten der breiten Öffentlichkeit selbst die Aufmerksamkeit eines Kindes auf sich gezogen hätte, sodass geradezu ausgeschlossen ist, das keine einzige erwachsene Person was bemerkt haben will und die Polizei unverzüglich alarmiert hätte. Immerhin behauptete Ina P. die meisten Zeit von Chmelir bedroht worden zu sein und das der Täter ihr sogar die meiste Zeit das Messer am Körper angesetzt hat (08./6 unten), gleichzeitig und paradoxerweise relativiert sie dann vor den U-Richter ihre Angaben, ohne vom U-Richter bei so einen bedeutenden Widerspruch hinterfragt zu werden (10./7 oben). Paradox, weil sie zunächst vor der Polizei am 9.8.1989 wiederholt behauptete vom Täter mehrmals verbal bedroht worden zu sein sowie das der Täter ihr zur Bedrohung die meiste Zeit das Messer am Körper angesetzt hat, vor den U-Richter will sie sich dann aber kurz danach nicht mehr daran erinnern. Paradox, weil sich ihr guter Eindruck, dass der Täter ihr nichts mehr antun wird und das der Täter sich sogar darum bemühte, das sie unbeschadet zu ihrer Familie zurückkehrt (09.) sich nicht mit ihrer Behauptung vereinbart, das sie ständig in Angst und Schrecken und in Todesangst gewesen sein konnte. Paradox, weil sie sich im Gegensatz zu ihrer sonstigen Erinnerungslücke und widersprüchlichen und unlogischen Angaben sehr wohl detailliert erinnern kann, wann und wo der Täter bei ihr Vaginal oder Anal einen Samenerguss hatte und wann nicht (08./4, 5 u. 10./5, 6). Paradox, (Entschuldigung, aber es muss gesagt werden) weil sich die Politiker-Ehefrau Ina P. offensichtlich mehr um die geschlechtlichen Handlungen zu konzentrieren schien, als um ihr Leben und um ihre Freiheit, meinte sie doch in Lebensgefahr gewesen zu sein. Geht man zudem davon aus, das Chmelir mitten aus dem Gefängnis heraus, bewacht von zahlreichen Justizwachebeamten nichtsdestotrotz spektakuläre Protestaktionen, Revolten und Gefängnisausbrüche erfolgreich organisierte und durchführte, so kann man Chmelir dann nicht für so dumm verkaufen mit einer tatsächlich in Angst und Schrecken und in Todesangst befindlichen Frau, die er vorher unter anderem bedroht und mit ein Messer verletzt und mehrfach vergewaltigt haben sollte ständig in der Öffentlichkeit herumzuspazieren, ja selbst in Cafehauslokale ein und aus zu gehen. Bei so ein Vorgehen wäre er selbst jede Sekunde in Gefahr geraten, seine Flucht nicht fortsetzen zu können und neuerlich festgenommen oder erschossen zu werden, wenn die Todesangst der Frau plötzlich in Verzweiflungs- und Hilfeschreie explodiert wäre, damit er jedenfalls und zu jeder Zeit rechnen hätte müssen. Aber auch die protokollarischen Angaben Ina P., das Chmelir hinsichtlich der sexuellen Handlungen nicht brutal zu ihr war (08./4 Mitte), ist ebenso alarmierend und unglaublich und erweckt vielmehr den Anschein, als wenn sie Chmelir zu entlasten versuchen würde. Wenn Chmelir sexuell nicht brutal zu ihr war, als was hat sie dann die sexuellen Handlungen empfunden und erlebt!, denn jede Handlung der sexuellen Vergewaltigung stellt ein Akt der Brutalität dar. Bei der Strafbemessung kommt es dann lediglich auf die Gradskala der ausgeübten Brutalität an. Ina P. glaubte über die zwei Tagen in der Gewalt des Täters ständig in Lebensgefahr gewesen zu sein, gleichzeitig überlies sie ihr Leben und Schicksal und Leib voll in den Händen des Täters, obwohl sie in Kenntnis war, dass Juan C. bei einen Postüberfall schon einmal ein Mensch erschossen hatte (08./7). Später vor den U-Richter, ohne je hinterfragt zu werden änderte sie dann ihre Aussage von „Totschlag“ auf „Mord“ (10./3 oben), offensichtlich um Erklärung ringend, warum sie bei den zahlreichen Gelegenheiten nie um Hilfe geschrien oder einen Fluchtversuch unternommen hat. Ina P. überlegte dabei aber nicht, dass mit einen Mörder unterwegs zu sein erst recht und ultimativ Grund genug ist, die sich nächstbietende Gelegenheit zur Flucht oder um Hilfe zu schreien zu ergreifen, anstatt mit einen Mörder durch die Gegend zu spazieren, Privathäuser aufzusuchen, Autostopp zu machen und in Geschäfte und in Cafelokale ein und aus zu gehen. Der Eindruck allein (09.), dass der Täter ihr nichts weiteres antun wird ist kein Garant dafür, insbesondere nicht in der Gewalt eines Mörders, dass der Täter es sich zu jeder Zeit anders überlegen hätte können und das Opfer schließlich doch tötet, um seine Taten zu vertuschen bzw. um nicht vom Opfer verraten zu werden. Kein Mensch, der malträtiert und penetriert wird und der sich in Lebensgefahr befindet verlässt sich einzig auf irgendwelchen Eindrücken, sondern ergreift jeden Strohhalm der Rettung, der sich als nächstes anbietet. Wenn Ina P. von ihren „Eindruck“ derart überzeugt war, dass der Täter ihr nichts mehr antun wird, während der Täter gleichzeitig immer wieder über sie herfällt und sie wiederholt bedroht und vergewaltigt, was hätte bitte noch schlimmeres passieren müssen bis sie endlich um Hilfe schreit oder zu flüchten versucht! Schlimmer noch: der Verdacht liegt sehr nahe, das die Politiker-Ehefrau Ina P. infolge ihrem positiven Eindrucks, dass Chmelir ihr nichts mehr antun wird insgeheim den sexuellen Missbrauch willig im Kauf genommen. Denn wie kann ein Mensch, der immer wieder vergewaltig und mit Mord bedroht wird von einen Täter einen positiven Eindruck gewinnen! Berücksichtigt man das Stockholmer-Syndrom, wonach sich ein Opfer mit dem Täter solidarisiert, so kann es in diesem Straffall nicht zutreffen, weil das besagen würde, das Ina P. aus Verständnis dafür, dass der Täter im Gefängnis seit Jahren mit keiner Frau mehr geschlafen hat sexuellen Handlungen freiwillig zuließ und duldete. Die Politikergattin Ina P. mit Kriminalbeamten bei der Nachkonstruktion ihrer Kaperung (46.) 1989: 37-jährig und als Landwirtin in bester konstitutioneller Verfassung. Hat Ina P. die Situation mitunter dazu ausgenützt, um unter anderem ihre Abenteuerlust und ihre sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen? Und dabei die letzte Chance der Rechtfertigung gestützt auf das Stockholmer-Syndrom verspielt! Zur Erklärung über die Gründe, warum er trotzt jahrzehntelanger Strafhaft nicht entlassen wird, schildert und verrät Chmelir in seiner Memoiren unter anderem auch (32.), das Ina P. ihn erzählt hätte, das sie sich schon seit geraumer Zeit mit ihren Mann nicht gut verstünde und das sie vor zirka 18 Monate das letzte Mal Sex gehabt hätte. Angesichts der Faktenlage und Ina P. positiven Eindruck über Chmelir ist durchaus denkbar, dass Ina P. die lange Entbehrlichkeit an Zuneigung und sexueller Bedürfnis in den tiefen Wäldern Kärntens Befriedigung verschaffte. Das ist keineswegs negativ gemeint, sondern Hut ab vor Ina P. für ihre Courage, falls es so war. Warum soll sich eine vernachlässigte Ehefrau nicht fallen lassen dürfen. Noch dazu in den Händen eines Gangsters in eine Abenteuer hineingerissen, wo die Emotionen so brodeln, wie sonst nirgends! Beim Mann soll es nur ein Kavaliersdelikt sein, wenn dieser seine Ehefrau vernachlässigt und - oft mit den schlimmsten prostituierten - betrügt und bei einer Ehefrau soll es ein Verbrechen sein. Nein! Gleiches Recht auch für die Frau. Hier geht es im Grunde und in erster Linie um die Vergewaltigung des Rechtsstaates durch die Justiz selbst, was bei weitem das schlimmere übel ist. Heute ist Chmelir der betroffene. Morgen kann es aber jeden Bürger treffen, wenn sich innerhalb des Justizapparats kriminelle Netzwerke bilden – oder die sich schon gebildet haben, die willkürlich mit dem Rechtsstaat und deren rechtsstaatlichen Prinzipien umgehen. Bedauerlicherweise lässt sich im Zuge dessen Ina P. nicht weg reden, da die Angelegenheit durchleuchtet werden muss, um auf den Kern des Übels und der Tatsachen zu kommen. Es ist in der Tat höchst fragwürdig, ob Chmelir Ina P. tatsächlich vergewaltigt hat. Dagegen spricht auch, das Ina P. - laut Frauenarzt – nicht die geringste Verletzung im Genital- und Analbereich aufwies (10./9 oben). Und das angeblich nach fünffacher Vergewaltigung innerhalb 48 Stunden! Nicht nur äußerst widersprüchlich, sondern vor allem sehr aussagekräftig sind auch die Angaben von Ina P. vom 9.8.1989, dass Chmelir die Selbstanzeige am 8.8.1989 nachmittags am Rastplatz im Wald verfasst und ihr übergeben hat (08./5 Mitte). Dabei erinnert sie sich genauesten auf die Wetterbedingungen und auf die Uhrzeit der Übergabe. Auch Chmelir bestätigte den 8.8.1989 als Tag der Übergabe (12./8 Mitte, 32./41 unten). Am 16.10.1989 dann vor den Untersuchungsrichter gibt Ina P. widersprüchlich zu Protokoll, dass Chmelir ihr das Schreiben erst am nächsten Tag in Klagenfurt übergeben hätte. Warum Ina P. plötzlich den 9.8.1989 als Datum der Übergabe angibt, liegt wohl auf der Hand. Am Vortag 8.8.1989 war sie mit Chmelir in den Nachmittagsstunden unter anderem in Cafelokale und mehrmals per Autostopp unterwegs. Zu dieser Zeit hatte sie das ChmelirSchreiben mit der Selbstanzeige bereits in ihrem Besitz, sodass sie keinen Grund mehr haben konnte in Angst und Schrecken zu sein, weil sie schon wusste dass ihr nichts mehr passieren würde, andernfalls hätte Chmelir die Selbstanzeige nicht verfasst und ihr übergeben. Zudem ließ Chmelir es zu, das sie ihren Ehemann telefonisch kontaktierte und von ihrer unmittelbaren Freilassung berichtete (08./5 unten). Aus den Angaben Ina P. geht in Wirklichkeit hervor, das sie sich spätestens zu Mittagszeit des 8.8.1989 durchaus im Klaren war, dass sie in absehbarer Zeit zu ihrer Familie zurückkehren wird, was sicherlich keine Angst und Schrecken oder Todesangst ausgelöst haben kann, sondern Erleichterung und Hoffnung. Besonders aussagekräftig ist auch, dass Ina P. mitten in der Hauptstadt Klagenfurt auf der Straße stehenblieb und Chmelir zuschaute, wie er in einen Autobus einstieg, dann wieder ausstieg und ihr zuwinkend in einen anderen Autobus einstieg (11./4, 32./55). Auch hier zeigt sich, dass Ina P. auch dann nicht um Hilfe schrie oder die Flucht ergriff, als sie die besten Chancen dazu hatte. Anstatt schnell das Weite zu suchen, schaute sie Chmelir nur nach. Sehr viel Angst kann Ina P. vor Chmelir nicht gehabt haben! Fürchtete sie sich nicht, dass Chmelir es sich anders überlegen hätte können und umkehrt und sie wieder als Geisel nimmt, zumal sie sehr gehorsam war. Stattdessen schaute sie ihm nach und ging anschließend in die Kirche (10./8 unten) und verschaffte Chmelir damit Vorsprung vor der Polizei, anstatt sofort zur Polizei zu gehen oder sie telefonisch zu verständigen. Ebenso obskur ist, dass Ina P. die Aufforderung der Klagenfurter Polizei nicht Folge leistete, sie möge wegen der Vergewaltigungen und wegen des vermeintlichen Messerstichs einen Arzt aufsuchen und die Atteste der Polizei vorlegen (26./5 oben). Stattdessen gibt sie ohne Vorlage ärztlicher Atteste vor den Untersuchungsrichter zu Protokoll, das sie wegen der Vergewaltigungen bei einem Frauenarzt war und das sie im Genital- und Analbereich keine Verletzungen erlitten hat sowie das sie durch Chmelir auch nicht schwanger geworden ist (10./9 oben). Ferner, dass sie durch die Stichverletzung zirka zwei Wochenlang schmerzen gehabt hat und das die Wunden auch geeitert hat, das sie deswegen aber keinen Arzt aufgesucht hätte und dass sie sich dem Strafverfahren als Privatbeteiligte (PB) nicht anschließt (10./9 oben). Auch hier liegt besondere Paradoxie der Logik vor. Was für ein Mensch sucht keinen Arzt auf, der durch ein Straftäter eine Messerstichverletzung erlitt und die Wunde eitrig wird und 14 tagelang schmerzt! Jeder normaler Mensch würde sofort einen Arzt oder ein Hospital aufsuchen um sich behandeln zu lassen, allein schon um eine Verschlimmerung der Infektion oder sonst um andere gesundheitliche Komplikationen zu unterbinden bzw. zu vermeiden. Oder stecken da andere Gründe dahinter? Wollte Ina P. mitunter nur vermeiden, dass ein Arzt feststellen hätte können, dass es sich in Wirklichkeit um keinen Messerstich handelt? In seiner Memoiren (32./30, 40) behauptet Chmelir nämlich, Ina P. in Wirklichkeit keine Stichverletzung zugefügt zu haben und ihr sogar geraten zu haben, keinen Arzt aufzusuchen damit dieser nicht feststellen könne, dass es sich um keine Stichverletzung handelt. Jedenfalls sei es aber richtig, dass er die Stichverletzung erfunden hätte. um Ina P. bestmöglichen Schutz vor Kompromittierendes zu bieten. Deswegen hätte er vor den Untersuchungsrichter keine Angaben mehr zur Sache gemacht (39./4) und in seiner selbstverfassten Selbstanzeige vom 8.8.1989 (07.) in besonderer Weise bewusst dramatisiert und sich selbst weit über das Maß seiner wahren schuld belastet, zumal er ohnehin damit rechnete bei Ergreifung von der Polizei erschossen zu werden (24.). Außerdem sei er von Anfang an irrtümlich davon ausgegangen, Ina P. entführt und als Geisel genommen zu haben (38./6), was ihm auch über die Medienberichterstattung stets einsuggeriert wurde. Straftaten nämlich, die mit bis zu 20 Jahre Freiheitsstrafe bedroht sind, sodass es ihm egal gewesen sei auch andere Straftaten auf sich zu nehmen, um Ina P. nicht zu schaden. Bei der primären strafbaren Handlungen in Hart bei Gratkorn hat sich tatsächlich um keine Entführung oder um Geiselnahme gehandelt, sondern aus rechtlicher Sicht nur um Nötigung unter gefährlichen Drohungen (siehe Urteil 41./4, 5, 8 oder siehe Strafgesetzbuch 56./54) mit Strafdrohung (nach den damaligen Gesetzgebung) bis zu maximal fünf Jahren Freiheitsstrafe und unter Mittel längeren Qualen bis zu zehn Jahren, §§ 105, 106, 107 StGB. Eine Verurteilung Chmelir wegen Entführung und/oder Geiselnahme erfolgte in der Tat nicht, weil er diese Straftaten nicht verwirklichte. Also irrte er sich tatsächlich. Sämtliche dunklen Tatumstände und widersprüchlichen Angaben Ina P. wurden vom Untersuchungsrichter unaufgeklärt so Stehengelassen. Der U-Richter zeigte schon im Vorfeld in ein Rundschreiben an die Sicherheitsdienststellen wenig Interesse an ordentlichen Ermittlungen zur Sache und forderte sogar die Polizei dazu auf solchen Ermittlungen zu unterlassen (30.). Unglaublich! Aus dem Protokoll des U-Richters Mag. Gernot Patzak Sehr augenfällig und verdächtigt ist auch die unterschiedliche Ausdrucksweise und Sachlage der protokollarischen Angaben von Ina P. vom 9.8., 24.8. u. 16.10.1989 (08. 10. 11.). Während Ina P. am 9.8.1989 von der Klagenfurter Polizei im Protokoll wörtlich zitiert wird, so ist – im Vergleich dazu – die Sprache, die Ausdrucksweise und die Sachlage ihrer Angaben vom 16.10.1989 vor den U-Richter völlig verfremdet und wesentlich schärfer. So z.B.: ist zunächst nur die Rede von „…wegen Postraub und Totschlag eingesessen…“ (08./9 unten). Dann vor den U-Richter wiederum und widersprüchlich von „…wegen Mordes eine lebenslängliche Freiheitsstrafe…“ (10./3 oben). So z. B.: ist zunächst nur die Rede von „…Bezahlt wurde von meinem Geld, welches ich ihm teilweise gegeben habe bzw. eigenhändig bezahlt habe…“ (08./5 oben). Dann vor den URichter nur mehr von „…der Mann durchsuchte die Mittelkonsole und das Handschuhfach und fand insgesamt Schilling 370…wahrscheinlich wurde mit dem Geld bezahlt, was er vorher im Auto gefunden hat…“ (10./4, 6 Mitte). Neben der Erinnerungslücken wegen der gefährlichen Drohungen (10./7) kann sich Ina P. vor den U-Richter plötzlich auch nicht mehr erinnern, ob sie Chmelir Geld gegeben hat noch ob sie eigenhändig bezahlt hat und ob sie Chmelir Gegenstände (Autokarte, Sonnenbrille, Armbanduhr) freiwillig überlassen hat (11./1). Und der U-Richter hinterfragt in keinster Weise ihren unterschiedlichen, dunklen und widersprüchlichen Angaben, lässt es dabei bewenden, andernfalls wäre offensichtlich eine Verurteilung wegen schweren Raubes unter Verwendung eines Messer nicht machbar gewesen. So z.B.: ist zunächst nur die Rede von „…er wollte wieder mit mir schlafen…Er war zwar nicht brutal zu mir, aber es war gegen meinen Willen“ (08./4 Mitte). Dann vor den U-Richter ist nur mehr von „Vergewaltigungen“ die Rede (10./5, 6, 8). „Er war zwar nicht brutal zu mir, aber…“ musste aus dem gerichtlichen Protokoll offenbar verschwinden, andernfalls wäre eine Verurteilung weg schwerer Vergewaltigung unter besonderen Qualen und Erniedrigung ebenfalls nicht machbar gewesen. Die Intention des U-Richters ist nicht schwer zu durchschauen: es musste quasi alles aus den Protokolle verschwinden, was Chmelir entlasten könnte. Dementsprechend darauf abzielend - zur Unterdrückung der Ermittlungen u. Fakten zur Sache - das Rundschreiben an die Polizei (30.). Überhaupt entspricht die Ausdrucksweise Ina P. im Polizeiprotokoll vom 9.8.1989 nicht dieses eines Opfers. Insgesamt verwendet sie die Worten und Ausdrucksweise „wir sind… wir haben…wir gingen…wir machten … wir zogen uns wieder an…“ u.s.f. u.s.f. bei 25-mal. Jedenfalls entspricht ihre Ausdrucksweise nicht diese eines Opfers von dem üblicherweise auszusagen zu erwarten wäre: „Der Täter zwang mich dies und jenes zu tun…der Täter zwang mich da und dort mitzugehen…der Täter zwang mich zur Duldung…“ etc. etc. und nicht „Wir…wir…wir…wir…wir…wir…wir…wir…wir…wir…wir…wir…wir…wir“ So drückt sich eine Person höchsten falls aus, wenn sie mit eine vertraute Person unterwegs war und nicht mit einen Täter, der sie permanent malträtiert, penetriert und bedroht. „Anklageschrift“ Erst mit Erhalt der Anklageschrift (14.) begann sich Chmelir gegen falsche Anklagepunkte zu wehren und erhob Einspruch dagegen. Er bestritt Ina P. brutal vergewaltig zu haben, ihr die Freiheit genommen und finanziell beraubt zu haben. Er widerrief seine Selbstanzeige vom 8.8.1989 sowie seine Niederschrift vom 14.8.1989 und bekannte sich nur der gefährlichen Drohung, der Nötigung zur Fahrt zur Staatsgrenze sowie der sexuellen Nötigung ohne Anwendung von Gewalt, Erniedrigung und Qualen schuldig, letztlich auch der leichten Körperverletzung. Diesbezüglich verständigte er Ina P. auch persönlich (31.), damit sie in Kenntnis ist. Genauer bekannte er sich der gefährlichen Drohung und der leichten Körperverletzung in Verbindung der Nötigung zur Fahrt zur Staatsgrenze schuldig sowie der sexuellen Nötigung ohne Ina P. besonderen Qualen und Erniedrigung zugefügt zu haben, und zwar nach §§ 83 (2), 106 (2), 107 (2) u. 202 (1) StGB (56./44, 54, 55, 110 Strafgesetzbuch) Das Strafausmaß würde unter Anwendung des § 28 StGB zwischen 5 bis 7 ½ Jahre liegen, dazu er sich bekenne. Darüber hinaus würde jeder anderer höherer Freiheitsstrafe nicht seine Schuld entsprechen, denn Ina P. würde selbst bezeugen, dass er nicht brutal zu ihr war noch hat sie je behauptet, das er sie Mittel längere oder über längere Zeit hindurch gequält und erniedrigt hätte. Gefragt, warum er dann in seiner Memoiren die sexuelle Nötigung und die leichte Körperverletzung bestreitet, erklärte er: „Ich bekannte mich in der Hauptverhandlung zu diesen Punkte nur schuldig um Ina P. nicht bloßzustellen, zumal die Strafdrohung für die sexuelle Nötigung und der leichten Körperverletzung den Strafausmaß der gefährlichen Drohung und der Nötigung zur Fahrt zur Staatsgrenze nicht höher gelegen ist (siehe §§ 83, 105, 106, 107 u. 202 StGB 56.). Hätte mir das Grazer Gericht damals einen korrekten Prozess gemacht und ein Urteil angemessen meiner Schuld ausgesprochen, müsste ich heute nicht meine Memoiren schreiben und all das schreiben, was damals auf der Flucht tatsächlich geschehen ist. Mir tut es sehr leid gegenüber Ina P., aber mir geht es aufrichtig nicht darum sie zu kompromittieren, sondern um zu belegen, warum die Justiz meinen Tod in der Zelle anstrebt. Sicher nicht zum Schutze der Integrität von Ina P., sondern zum eigenen Schutz, nämlich paranoid das in der breiten Öffentlichkeit auffliegen könnte, welchen Prozess sie mir nach den Nazi-Praktiken gemacht hat. Außerdem hat mich der Pflichtverteidiger darum regelrecht angefleht, das ich unter anderem auch bei der Vergewaltigung und Messerstich bleiben sollte, weil ich das der armen Frau nicht antun könne, da ich ihn darüber informierte Ina P. in Wahrheit keine Stichverletzung zugefügt zu haben und auch nicht vergewaltigt zu haben. In diesem Zusammenhang versicherte er mir sogar mit dem Richter bereits gesprochen zu haben, wobei der Richter ihm eine Freiheitsstrafe zwischen 5 und 7 Jahre zugesagt haben sollte, wenn ich bei dem anfänglichen Geständnis bliebe. Daraus wurden dann 18 Jahre. Der Pflichtverteidiger hat mich unglaublich hintergangen und getäuscht“. (Ausschnitt vom 7.8.1991 aus den Aktenvermerke der Rechtsanwaltkanzlei 34./3 unten) Hierzu stellte Chmelir wiederholt Beweisanträge auf Lokalisierung der Tatorte sowie auf Tatkonstruktion und Lokalaugenschein vor Ort sowie auf Eruierung aller Zeugen der privaten und öffentlichen Einrichtungen (Bauernhöfe, Cafelokale, Einkaufgeschäfte u. Wagenbesitzer etc.), wo überall er mit der Politiker-Ehefrau war bzw. mitgefahren sind und Ladung der Zeugen zur Hauptverhandlung (16. 17. 18. 19. 20. 21.). Und zwar zur Erbringung des Beweises durch objektiven Augenzeugen Ina P. weder die Freiheit entzogen, ebenso wenig beraubt, erniedrigt oder gequält zu haben sowie zum Beweis dafür, dass er Ina P., abgesehen seiner anfänglichen Drohungen auf den Waldweg in Hart bei Gratkorn und der Nötigung zur Fahrt zur Staatsgrenze in der Folge keinen einzigen mal mehr bedroht hätte, sodass sich Ina P. keineswegs mehr in einen ständigen Zustand der Angst und des Schreckens oder der Todesangst befunden haben konnte, stattdessen sei sie sich stets sicher gewesen wieder nachhause zurückkehren zu können. Speziell der sexuellen Handlungen, verwies er insbesondere darauf, das Ina P. selbst bestätigen würde, das er nicht brutal zu ihr war und auch nie ein Wort der besonderen Qualen und Erniedrigung erwähnt hätte, sodass die die Qualifikation der schweren Vergewaltigung unter besonderen Qualen und Erniedrigung nicht zutrifft. Und speziell der Beschuldigung des schweren Raubes, verwies Chmelir darauf, dass er sich mit dem Geld von Ina P. in keinster Weise bereichert hätte, weil das Geld für lebensnotwendige Nahrungsmitteln und Getränke in Einkaufgeschäfte und in Cafelokale verbraucht wurde, die sie gemeinsam konsumiert hätten, wobei Ina P. zumeist eigenhändig bezahlt hätte (08./5 oben), was nicht möglich gewesen wäre, wenn er durch Raub bereits im Besitz ihres Geldes gewesen wäre. Außerdem ist „…teilweise gegeben habe…“ kein Tatbestand des Raubes. Altarnativ dazu hätten Ina P. und er hungern und dursten müssen, wenn sie sich keine Nahrungsmitteln und Getränke gekauft hätten, sodass eine Bereicherung seiner Person nicht vorliegt und somit auch nicht der Tatbestand des leichten oder schweren Raubes. Ferner seien von den geringen Geldbetrag von ca. Schilling 350 (heute € 25), die Ina P. mithatte Schilling 100 für Benzin bezahlt worden, damit sie genug Benzin im Tank hat, um nachhause zurückfahren zu können (08./2 unten). Und bezüglich der Straßenkarte, der Sonnenbrille und Armbanduhr hätte er Ina P. nur darum gebeten, damit er sich auf der weiteren Flucht zeitlich und örtlich besser orientieren könne, jedenfalls hätte Ina P. zugestimmt, sodass er sie nicht durch Drohungen oder unter Verwendung eines Messers beraubt hätte, was von Ina P. auch nie behauptet wurde. Auch dann nicht, als ihr die Sachen von der Polizei wieder ausgehändigt worden sind (11./1). Die von Chmelir beantragte Ermittlungen und Beweise zur Sache hätten die Klagenfurter Polizei und das Grazer Gericht schon mit Bekanntwerden der Straftaten von sich selbst durchführen und sichern müssen, was jedoch stets unterlassen bzw. unterdrückt wurde, § 3 Strafprozessordnung 55./5) Weiteres erhob er wegen des Nahverhältnisses des Justizpersonals des Grazer Gerichtes zu der Oberschicht der Grazer und steiermärkischen Gesellschaft, darunter auch Politiker, Befangenheitsanzeige und beantragte die Delegierung der Strafsache an einen anderen Gerichtssprengel, da es sich bei Ina P. um die Gattin eines hohen steirischen Landespolitikers handle und das Gericht Graz zur Sache sehr befangen agiere. Der Delegierungsantrag wurde vom Obersten Gerichtshof vom selben OGH-Richter Dr. Rudolf Kießwetter verworfen (52. 53.), der sich für die Strafsache schon im Vorverfahren beim Erstgericht Graz durch Vorentscheidungen und durch Einholung der Strafakten auffallend sehr interessiert und engagiert zeigte – und der schließlich dann auch die Nichtigkeitsbeschwerde Chmelirs gegen das Strafurteil verwarf (43.). Spätestens hier ist erkennbar, dass die Strafsache in Komplizenschaft mit der Spitze der Justiz von langer Hand dirigiert und geplant wurde. Kurz gesagt: sämtliche (Beweis-)Anträge Chmelirs zur Hauptverhandlung (16. 17. 18. 19. 20. 21.), sozusagen fundamentale Rechte eines Angeklagten wurden ganz einfach vom Gericht unbearbeitet liegen gelassen bzw. einfach ignoriert. Zum Verständnis muss gesagt werden, das Chmelir von Mitte August 1989 bis nach der Hauptverhandlung vom 28.6.1991 sowohl in der Strafanstalt Graz-Karlau als auch in der Strafanstalt Stein die meiste Zeit in Isolationshaft angehalten wurde, zumeist in Kellerabteilungen, dementsprechend kommen auch seine Emotionen in den Beweisanträge zur Geltung. Sein gerichtlich bestellter Pflichtverteidiger bot ihm keine angemessene Rechtshilfe und schaute dem Treiben des Gerichtes wohlwissend und tatenlos zu. Und als sich Chmelir bei der Rechtsanwaltskammer darüber beschwerte (33. 34. 35. 36. 37.), wurde von dem Pflichtverteidiger mit Schutzbehauptungen nur mehr gelogen. Ausschnitt vom 3.6.1991 aus den Aktenvermerke der Rechtsanwaltkanzlei (33./2 unten), sozusagen ca. 3 Wochen vor Beginn der Hauptverhandlung vom 28.6.1991. Dass sein Pflichtverteidiger im Aktenvermerk vom 3.6.1991 irritierend log, ist allein schon mit den von Chmelir seit über einen Jahr in den Gerichtsakten vorliegenden und detailliert gestellten Beweisanträge vom 30.4. u. 5.6.1990 (16. 17. 18.) konkret erwiesen. Irritierend deswegen, weil der Pflichtverteidiger einerseits behauptet, das Chmelir keine Beweisliste erstellt hätte, diese sich aber allein schon aus seinen Beweisanträge ergeben. Chmelir wurde von seinen Pflichtverteidiger sogar insofern getäuscht, als das er ihm dahingehend falsch belehrte, das die Beweisanträge, die in der gerichtlichen Voruntersuchung gestellt werden in der Hauptverhandlung automatisch als Beweis gelten muss, andernfalls würden Nichtigkeitsgründen vorliegen. Und in der Hauptverhandlung - um es vorwegzunehmen, nachdem seine Beweisanträge weiterhin ignoriert wurden, belehrte ihm der Pflichtverteidiger "Macht nichts. Jetzt haben wir Nichtigkeitsgründen gegen den Schuldspruch und das Urteil muss dann aufgehoben und in einen anderen unbefangenen Gerichtssprengel neu verhandelt werden“. Wie sich später mit der Zurückweisung der Nichtigkeitsbeschwerde durch den OGH-Richter Dr. Rudolf Kießwetter erwies (43./7), hätten die Beweisanträge unbedingt in der Hauptverhandlung wiederholt werden müssen. Werden sie in der Hv nicht gestellt oder wiederholt, können sie nachträglich nicht als Nichtigkeitsgründe gelten gemacht werden. Der Pflichtverteidiger hat Chmelir sodann arglistig irregeführt und ihm um seine Verfahrensund Prozessrechte betrogen und in der Hv zudem lächerliche Scheinanträge über die Müdigkeit und Schwäche Chmelirs gestellt, die nicht einmal konkret formuliert waren (01./61 unten u. 43./7 oben). Das allerschlimmste: der Pflichtverteidiger verzichtete in der Hv definitiv auf weitere Beweisanträge. Chmelir später: „Das habe ich gar nicht mitbekommen“. Hv-Protokoll 01./61 oben). Selbst das Verfassungsgerichtshof Wien stellte sich zur Sache tot (25.) und beantwortete die Chmelir-Eingabe von September 1990 erst nach der Hauptverhandlung vom 28.6.1991. Ein sehr guter Überblick darüber, was der Pflichtverteidiger zur korrekten Verteidigung Chmelirs tun hätte müssen und was er an Fakten unterschlug, bietet der Antrag auf Wiederaufnahme vom 2008 (15.), der Chmelir auf bitte von Ina P. dann wieder zurückzog. „Der Prozess und das Urteil“ Zur Hauptverhandlung (Hv) vom 28. Juni 1991 wurde Chmelir aus einer Isolationssicherheitszelle des Landesgerichtes Graz vorgeführt, in der er sich gemäß § 103 Abs. 2 Ziffer 4 StVG seit Tagen befand (22.), wobei ihm auch die Aktenunterlagen entzogen wurden, sodass er sich zur Hauptverhandlung nicht vorbereiten konnte. Siehe Strafvollzugsgesetz § 103 Abs. 2 Ziffer 4 (70./22) Laut seinerzeitiger Prozessordnung - eigentlich heute noch hätte Chmelir mindesten drei volle Tage vor Beginn der Hv nicht in Isolation angehalten werden dürfen. Nichtsdestotrotz geschah es in Kenntnis des Vorsitzenden der Hv. Des Weiteren wurde Chmelir vor Beginn der Hv um 08.30 Uhr (01./1) zwischen 07.30 und 08.00 Uhr wegen einer Ordnungswidrigkeit eine verwaltungsbehördliche Verhandlung gemacht (22.). Hinzukommt, das sich Chmelir 1 und 2 Tage vor Beginn der Hauptverhandlung unter Einnahme von starken Schmerz- und Beruhigungsmitteln medizinische Eingriffe unterziehen lassen musste, sodass es höchstfragwürdig ist, ob Chmelir zur Hv tatsächlich Verhandlungsfähig war, siehe Nichtigkeitsbeschwerde (38./4 unten, 5). Bei der Hv verwies Chmelir darauf, dass er zur Hv nur eingeschränkt vorbereitet und verhandlungsfähig sei und gab hierzu auch gesundheitliche Gründe an (01./3 unten, 4 oben). Die Einwände wurden allesamt verworfen. Es folgte dann bis 10.05 Uhr die Befragung Chmelirs über sein Vorleben und der Gründe zur Flucht aus der Strafanstalt (01./5 - 15 oben). Um 10.35 Uhr wurde die Hv dann fortgesetzt und sogleich Beschluss auf Ausschluss der Öffentlichkeit gefasst (01./15 oben). Warum die Öffentlichkeit aus Sittlichkeitsgründen von der Hv überhaupt ausgeschlossen wurde ist ein Rätsel. Denn folgt man die Verantwortung und Befragung des Angeklagten und diese von Ina P. zur Sache (01./15 bis 39), so ist in der Hv kein einziges Wort über sexuelle Handlungen erläutert worden, darüber die Öffentlichkeit nicht schon längst berichtet hätte. Im Hv-Protokoll ist dokumentiert, das sich Chmelir in wesentlichen Punkte der Anklage nicht schuldig bekannte (01./15, 16). Umso klarer ist nun ersichtlich, wie der Vorsitzende der Hv selbst im Strafurteil ein Geständnis Chmelirs zu allen Grunddelikte fälschte (41./9 oben). Offensichtlich beabsichtigte der Vorsitzende damit u.a. die Öffentlichkeit zu suggerieren, dass der Angeklagte voll geständig ist und dass von Seiten des Gerichtes alles rechtens und nach dem Gesetz erfolgte. Und bei einer 18-jährigen Freiheitsstrafe vom Vorsitzenden als mildern die Freilassung Ina P. aus eigenem Antrieb berücksichtigt zu haben kann nur als puren Zynismus verstanden werden. Bei der Berufungsverhandlung bestätigte Chmelir nochmals ausdrücklich, sich nicht zu aller Grunddelikte schuldig bekannt zu haben (69./2). (Hinweis: die Feststellungen des Pflichtverteidigers bei der Berufungsverhandlung, das die Zeugin mehrmals die Möglichkeit zu fliehen gehabt hatte, hätten schon in der Hauptverhandlung vorgebracht werden müssen samt die entsprechenden Beweisanträge, was jedoch nicht geschehen ist. Bei einer Berufungsverhandlung gelten nur Fakten, die in der Hv vorgebracht wurden und sonst nichts). Gefragt, warum er in der Hv nicht selbst nicht die Beweisanträge vorgebracht hat, erwiderte Chmelir: „Bei einer anwaltspflichtigen Verhandlung darf nur der Verteidiger Anträge stellen. Und dadurch, da mir der Pflichtverteidiger einsuggerierte, das die im Vorverfahren gestellten Beweisanträge bei sonstiger Nichtigkeit gelten müssen, habe ich insgeheim darauf gehofft, das dann das Ersturteil vom obersten Gerichtshof aufgehoben wir und in einen anderen Gerichtssprengel stattfindet. Selbst mein Pflichtverteidiger agierte mit allen Tricks gegen meine Verfahrens und Prozessrechte. Ein Wahnsinn, was da aufgeführt wurde!“. Nach Erhalt des Hauptverhandlungsprotokolls zur Erhebung der Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Strafurteil erhob Chmelir dann sofort Antrag auf Berichtigung des Hv-Protokolls wegen erheblichen Mängeln und falschen und irreführender Interpretationen seiner Angaben in der Hv (23.). Die stenographischen Unterlagen des Verhandlungsprotokolls, die Chmelir als Beweis anführte sind seither aus den Gerichtsakten verschwunden. Von 10.35 bis 12.35 Uhr folgte die Verantwortung und Befragung Chmelirs (01./15 bis 38). Dann wurde die Hv erneut unterbrochen und um 12.43 mit dem Beweisverfahren und Befragung von Ina P. und dem Kripobeamten Werner Rampitsch fortgesetzt und endete um 13.15 Uhr (01./38, 41). Rechnet man die Formalitäten der Beschlussfassung zur Wiederherstellung der Öffentlichkeit (01./40 unten) und die Zeugenaussage des Kriminalbeamten Werner Rampitsch ein, so war Ina P. maximal 15 Minuten im Gerichtssaal. Im Grunde ist die Politiker-Ehefrau Ina P. in den Verhandlungssaal nur rein-spaziert und gleich wieder raus-spaziert, ohne das sie Rede und Antwort zu den an ihr begangenen Strafbaren Handlungen geben musste und schon gar nicht das für Aufklärung ihrer widersprüchlichen Angaben und dunklen Tatumstände bei der Klagenfurter Polizei und beim U-Richter gesorgt wurde. Hv-Protokoll 01./64 Mitte Nun dokumentiert aber der Vorsitzende in dem Hv-Protokoll, die Politiker-Ehefrau Ina P. in 20 Minuten insgesamt 20 Seiten ihrer protokollarischen Angaben vom 9.8, 24.8. und vom 16.10.1989 (08. 10. 11.) vorgehalten zu haben (01./38 unten u. 39 Mitte, 43./7) als auch die zweistündige Verantwortung des Angeklagten in der Hv (01./15 bis 38). Abgesehen davon, dass es schon aus der Komplexität der vielfachen Kapitalverbrechen, die den Angeklagten zu Lasten gelegt wurden zeitlich unmöglich ist in nur 15-20 Minuten eine derartige Vielfalt an protokollarischen Vorhalte unterzubringen, geht aus den Hv-Protokoll zudem keine Mündlichkeit der Verhandlung hervor, weder hinsichtlich des hinterfragen Ina P. zu den einzelnen Delikte noch bezüglich ihrer widersprüchlichen Angaben vor der Klagenfurter Polizei und vor dem U-Richter, wie oben bereits geschildert. In seiner Nichtigkeitsbeschwerde verweist Chmelir darauf, was sich in der Hv tatsächlich abgespielt hat (38./11 unten u. 12), nämlich das die Protokolle von Ina P. nur schnell hintereinander vorgelesen wurden und das ihr nur 2-3 Fragen gestellt wurden und das es damit schon sein bewenden hatte. Und führte in seinen Berichtigungsantrag des Hauptverhandlungsprotokolls aus, das der Vorhalt seiner Verantwortung in der Hv durch den Vorsitzenden nur Sekunden gedauert hätte, nämlich einzig und allein: „Der Angeklagte bringt es nun so dar, als wenn sie freiwillig mitgegangen wären (23./2 oben). (Hinweis: Der Berichtigungsantrag-Protokoll ist in der Tat nicht in bester Qualität, allemal aber lesbar und äußerst aussagekräftig zur Sache. Wir arbeiten an die Qualität. Es sind immerhin Jahrzehnte alte Akten, die mit mechanischen Handschreibgeräten gefertigt wurden) Liest man die Verantwortung Chmelirs in der Hv (01./15 bis 38), so kann jedenfalls keine Rede davon sein, das sich Chmelir tatsächlich so verantwortete, wie der Vorsitzender der Hv der Zeugin Ina P. einsuggerierte. Chmelir hat nur eingeräumt sich nicht zu allen Fakten und Qualifikationen der Anklage schuldig zu bekennen (01./15, 16), behauptete in der Hv jedoch niemals, dass Ina P. freiwillig mitgegangen wäre. Offensichtlich beabsichtigte der Vorsitzende der Hv Richter Dr. Horst Gärtner die Zeugin Ina P. zu schockieren und damit gegen Chmelir aufzubringen, damit sie mitunter kein gutes Wort über Chmelir verliert, etwa "Er war nicht brutal zu mir...er hat mich auch nicht gequält und erniedrigt...das Geld habe ich ihn teilweise gegeben bzw. ich habe eigenhändig bezahlt" etc. etc., sodass dann eine Verurteilung z.B. wegen schwerer Vergewaltigung unter besonderen Qualen und Erniedrigung und des schweren Raubes etc. nicht mehr möglich gewesen wäre. Chmelir Äußerung dazu: „Der reinste Nazi-Prozess. Zudem hat sich das Erstgericht das Hauptverhandlungsprotokoll in unglaublicher Weise durch Fälschung zurechtgebogen. Fast allen Angaben von mir beim Prozess sowie diese des Vorsitzenden finden sich im Hauptverhandlungsprotokoll nicht wider oder sind verfälscht dargestellt“. Um 14.25 Uhr wurde dann die Hv fortgesetzt (01./41 Mitte). In der weiteren Folge wurden ab 14.25 bis 16.20 Uhr mehrere Kriminalbeamten und zwei Gerichtssachverständigen als Zeugen befragt, um zu bezeugen dass sich Chmelir bei der knapp 12-stündige Einvernahme vom 14.8.1989 (12./1 oben u. 21 unten) in durchaus guter Verfassung befunden hatte und dass er die Vernehmung und seine protokollarischen Angaben voll konzentriert formuliert, zur Kenntnis genommen und unterschrieben hatte (01./36 unten u. S. 37 oben). Allemal Kripobeamten als Zeugen, die selbst zur Unterdrückung der Ermittlungen und der Beweissicherung zur Sache mitschuldig waren. Der Medienartikel 24. besagt wohl ausreichend in welcher tatsächlichen psychischen Verfassung sich Chmelir während der 12-stündigen Vernehmung vom 14.8.1989 befunden hat. Hinzukommt, dass Chmelir während der Vernehmung wegen Wunden an den Fußsohlen starke Schmerzen hatte (12./10 Mitte), die wunden erst stundenspäter ärztlich versorgt wurden (12./17 oben). Chmelir Äußerung dazu: “Was soll ich dazu sagen! Ich war einfach fertig und es tat mir nur leid, nicht erschossen worden zu sein. Die Kripobeamten haben diktiert und ich habe nur mit dem Kopf genickt. Mir war alles wurscht und ich war nur bestrebt, das Ina P. nicht kompromittiert wird. Am Schluss der Vernehmung lachten sogar die Kripobeamten und sagten zu mir: „Na ja, zumindest hast du dir ein Urlaub mit einer gehobenen Dame gemacht“. Die Hv wurde schließlich mit den Gerichtssachverständigen fortgesetzt, die Chmelir persönlich nie begutachtet hatten bzw. die er wegen Befangenheit abgelehnt hatte (29.) und die sich zu den Straftaten in der Weise äußerten, als wenn sie am 7. bis 9.8.1989 mit Chmelir und Ina P. unmittelbar mit dabei gewesen wären und punkgenau wüssten, was zwischen Chmelir und Ina P. in den zwei Tage abgelaufen ist (01./47, 50 bis 59). Das muss man sich einmal vorstellen! Da gehen Gerichtssachverständigen in einen Gerichtsprozess her und maßen sich an über die Straftaten auf das schlimmste gegen den Angeklagten zu äußern, obwohl sie den Angeklagten zuvor nicht begutachtet hatten sowie in Kenntnis der Aktenlage, das zur Sache absolut keine Vorermittlungen staatgefunden haben noch das Beweise gesichert wurden. Das Gericht hat sich offensichtlich mit der Zeugenladung mehreren Kriminalbeamten, die maßgeblich zur Unterdrückung der Ermittlungen und der Beweissicherung zur Sache beigetragen haben sowie mit gefälligen Sachverständigen gut vorbereitet, um Chmelir mit allen denkbaren Mitteln im Sinne der Anklagepunkte schuldig zu sprechen und zu verurteilen und ihm hierzu nicht die geringste Chance eines ordentlichen Beweisverfahrens und Verteidigung zu bieten. Um 16.20 bis 16.25 Uhr wurde die Hv dann kurz unterbrochen (01./61 oben) und mit Formalitäten betreffend der Fragen an die Geschwornen und mit der Schlussrede des Staatsanwaltes und des Pflichtverteidigers bis 17.45 Uhr fortgesetzt. Anschließend zogen sich die Geschwornen zur Beratung zurück und meldeten sich knapp 20 Minuten später um 18.05 Uhr mit ihren Schuldspruch wieder zurück (01./63 oben). Die Beratung und der Schuldspruch der Geschwornen fielen einstimmig aus: Schuldig im Sinne aller Anklagepunkte (40./3 - 7) Urteil: 18 Jahren Freiheitsstrafe (41./8 Mitte) Ende der Hauptverhandlung: 18.45 Uhr (01./ 64) Der Angeklagte wurde anschließend in seiner Isolations-Sicherheitskellerzelle zurückgebracht und am 1.7.1991 wieder in die Strafanstalt Stein rücküberstellt (22.). Ein unfassbarer Prozess und Urteil Chmelir Kommentar zum Urteil: „Ich bin in Wirklichkeit von einen kriminellen Grazer Justizkartell mit langer Hand bis zum obersten Gerichtshof in Wien verurteilt worden. Das waren keine Schwurgerichtsrichter, sondern kriminelle Beamten und das zieht sich durch den ganzen Justizapparat. Die Blindheit, Dummheit und Komplizenschaft der Öffentlichkeit macht solche Urteile möglich – und ich bin sicher nicht das einzige Opfer“ Damit ist Chmelir als Ex-Heimopferkind erneut zum Opfer erhoben worden Ein Prozess und Urteil ohne polizeilichen und gerichtlichen Vorermittlungen sowie ohne Beweissicherung zur Sache. Ebenso ohne ein ordentliches Beweisfahren und ohne angemessenen Verfahrenshilfe des Angeklagten. Ein Prozess und Urteil mit gefälligen Kripobeamten und Gerichtssachverständigen, die in Kenntnis der Säumnisse des Strafverfahrens ihr Senf gegen den Angeklagten gaben, insbesondere mit unterwürfige Geschwornen, die nur das sehen und hören wollten, was der Ankläger und das Richtersenat genehm war. Alles andere gegenüber stellten sie sich taub und blind. Ein Prozess und Urteil ohne Mündlichkeit in der Hv sowie ohne jegliche Aufklärung der zahlreichen widersprüchlichen Angaben Ina P. sowie der dunklen und hinter-fragwürdigen Tatumstände. Ein Schuldspruch entgegen der Zeugenaussage Ina P., dass Chmelir sexuell nicht brutal zu ihr war noch das Chmelir sie quälerisch und erniedrigen behandelt hätte. Nichtdestotrotz wird Chmelir der brutalsten und quälerischsten und erniedrigten Form der Vergewaltigung zur Höchststrafe von 18 Jahren Freiheitstrafe verurteilt. Ein Schuldspruch entgegen der Zeugenaussage Ina P. nie behauptet zu haben von Chmelir beraubt worden zu sein oder sich beraubt gefühlt zu haben, vielrichtiger das Chmelir das Geld teilweise im Auto gefunden hat bzw. dass sie ihm das Geld teilweise gegeben hat bzw. das sie eigenhändig bezahlt hat. Sowie das das Geld vorwiegend für Nahrungsmittel und Getränke verwendet wurde, die sie gemeinsam teilten und konsumierten. Nichtsdestotrotz wird Chmelir des schweren Raubes unter Verwendung eine Messers zum Zwecke der Selbstbereicherung zur Höchststrafe verurteilt. Ein Schuldspruch, das noch sehr vielen Fragen aufwirft. Woher die Geschwornen und das Richtersenat des Schwurgerichtes die Beweise für ihr Schuldspruch und Urteil entnommen haben, geht aus den Gerichtsakten jedenfalls nicht hervor. Beweis war einzig Ina P., die allein durch ihren stets relativierenden und widersprüchlichen protokollarischen Angaben und der mangelnden Aufklärung fragwürdiger Tatumstände sowie wegen der massivsten Kontakte zur Öffentlichkeit mit Chmelir verdächtigt genug war, ihre Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen. Frägt man beispielsweise den Geschwornen oder den Richtersenat des Prozesses nach den Tatorte in den Bauernhaus, Einkaufgeschäfte und Cafelokale etc. sowie danach, was Chmelir und Ina P. dort wirklich gemacht haben und wie lange sie sich dort aufgehalten haben, so gibt es dazu keine Antworten, den weder die Geschwornen, der Richtersenat, der Staatsanwalt und Pflichtverteidiger wissen bis heute das geringste Bescheid über die Tatorte noch was dort tatsächlich geschah. Unvorstellbar! Am 24.4.1993 wurde dann die Nichtigkeitsbeschwerde verworfen (43.), weil in der Hv von dem Pflichtverteidiger keine sonstigen Beweisanträge gestellt wurden. Vorsitzender der Nichtigkeitsverhandlung beim Obersten Gerichtshof in Wien war kein geringerer als Dr. Rudolf Kießwetter, der schon im Vorfeld im Vorverfahren mit Entscheidungen gegen den Beschuldigten eingegriffen hatte (52. 53.) und der somit sehr wohl Kenntnis über die Unterdrückung der Vorermittlungen und der Beweissicherung zur Sache hatte. Das Komplott gegen einen ordentlichen Verfahren und Prozess zur Sache war und ist offensichtlich schon von langer Hand geplant worden, inbegriffen die Justizspitze des Staates. Zwei aussagekräftige Dokumente zur Sache sind auch die Strafanzeige von Fr. Josephine Maiwald (71.) sowie Chmelirs Antrag auf „Normenprüfung“ beim Verfassungsgerichtshof Wien von 2015 (50.) Juan Carlos Bresofsky-Chmelir sitzt heute noch ein, seit vollendeten 42 Jahren. Das 43 Jahr begann er am 20.6.2020. Seit fast 14 Jahren werden seine Anträge auf Entlassung regelmäßig abgelehnt. Nichtsdestotrotz positiver Prognose-Gutachten, nicht zuletzt brandneu vom 2.7.2010 vom renommiersteten Forensiker Europas, Prof. Dr. Norbert Nedopil https://google.com/Prof. Dr. Norbert Nedopil-Gutachten 2.7.2020 Weiteren Prognose-Gutachten zu seiner Person: https://google.com/Dr. Schautzer-Gutachten (sehr Lesenswert) https://google.com/Prof. Nedopil-Gutachten 21.12.2016 https://drive.google.com/Mag. Sigrid krisper-Gutachten 30.9.2016 Siehe u.a. auch aufschlussreiche Websites mit vielen zusätzlichen Polizei- und Gerichtsprotokolle und Äußerungen Chmelirs zur Sache: https://sites.google.com/site/mariemertenacker/ https://sites.google.com/site/generaldirektionwien https://sites.google.com/site/storychmelir/ u.v.a.m. An eine qualitativ bessere Version der Angelegenheit und der Urkunden wird gearbeitet und nach Fertigstellung auf die Webseiten veröffentlicht In Fortsetzung unten beigefügt: 1. Memoiren Chmelirs der Flucht mit der Politiker-Ehefrau 2. Memoiren Chmelirs der Kinderjahre in Uruguay und der Tortur in staatlichen Heimen in Österreich Ein Augenblick der Ewigkeit für die Ewigkeit Mit dem Gefängnisausbruch 2. August 1989 aus der Strafanstalt Karlau sind mit der PolitikerEhefrau das unfassbarste und das unvorstellbarste in meinen Leben eingetreten: ein Drama und ein märchenhaftes Abenteuer, verknüpft mit ein Polit- und Justizkomplott, weil das vermeintliche Opfer die Ehegattin eines hohen Grazer Ex-Landespolitiker war. Eine Geschichte, die sich dagegen wahrscheinlich schon jeder zu stemmen versuchen wird, nichtsdestotrotz der erleuchtenden Wahrheit und der vorliegenden und nachvollziehbaren Umstände und Fakten, weil es sehr schnell die Emotionen zum kochen bringt. Die österreichische Medien und Justiz versuchen es mit allen denkbaren Mitteln natürlich zu vertuschen, aber Tatsachen und die Wahrheit als solcher lassen sich nicht so einfach wegleugnen und wegvertuschen. Die Wahrheit ist sehr hartnäckig. Alles wäre tatsächlich für ewig ein Geheimnis geblieben, hätte der österreichische Staat und die Justiz diesen Straffall nicht schwersten missbraucht und nunmehr mein Tod im Gefängnis Bestreben, um diesen Missbrauch zu vertuschen. Noch dazu derart dilettantisch missbraucht, weil es eigentlich schon mit einen einzigen Protokoll der gegenständlichen Gerichtsakten 6 Vr 1998/89 des Landesgericht Graz nachvollziehbar und beweisbar ist. Am besten zeigt es Herr J. S. Pieber mit seiner DOKU auf, die meiner persönlichen Niederschrift über das wahre Geschehen auf der Flucht vorausging. Es folgt dann in Anschluss meine Memoiren der Kindesjahre in Rocha/Uruguay und der jahrelangen Tortur in staatlichen Heimen und Jugendgefängnisse in den 1960er-1970er Jahren in Österreich, um die Entwicklung meines Lebens und diese des Dramas zu verstehen. Nach über 55 Jahren Freiheitsentzug eingekerkert in österreichischem Gefängnisse, eingerechnet die Jahren in staatlichen Heimen, habe ich mich der Wahrheitswillen dazu bewegt meine Lebensgeschichte zu schreiben und über Vertrauenspersonen im Internet veröffentlichen zu lassen. Dazu veranlasst hat mich vorwiegend das Bestreben der Justiz meine Person aus Gründen der Vertuschung bis zum Tode hinter Gittern zu belassen, obwohl die Voraussetzungen zu einer Entlassung längst vorliegen. Und einfach nur so in der Haftzelle herumzusitzen und auf meinen Tod zu warten, schien mir nicht angepasst und gerecht. Und Gott möge mir verzeihen, dass mit meiner Memoiren auch die Ex-Politiker-Ehefrau kompromittiert wird, aber eine halbe Wahrheit ist keine Wahrheit. Zuvor erlaube ich mir aber eine kurze Vorschau meines Vorlebens: Ich heiße Juan Carlos Chmelir, geborener Bresofsky am 8.6.1949 in Rocha/Uruguay und bin bis auf die 12-tätige Flucht vom 2. August 1989 aus der Strafanstalt Graz-Karlau seit dem 20. Juni 1978 ununterbrochen hinter Gittern und habe gerade das 43. Jahr begonnen, insgesamt aber schon über 55 Jahren im Kerker der Republik, inbegriffen die Jahre in staatlichen Erziehungsanstalten in den 1960er Jahren. Mein Vater, der väterlicherseits jüdischer Abstammung war musste in den 1930er Jahren wegen der Nazis aus Österreich flüchten und landete u.a. in Uruguay, wo er meine Mutter kennerlernte und 1945 in Montevideo heiratete. Juni 1962 kehrte er mit der ganzen Familie, Mutter und 7 Kinder nach Österreich zurück, um das Hotel „Währingerhof“ im 18. Wiener Bezirk zu übernehmen, das seiner Mutter gehörte, also meiner Großmutter. Nach Streitereien zwischen meinen Vater und der Großmutter um den Zeitpunkt der Übergabe des Hotels und in Ermangelung finanzieller Mitteln für eine größere Wohnung für so eine große Familie mit 7 Kindern, da er von der Großmutter wegen des Streits keine finanzielle Unterstützung bekam, mussten ich und drei Schwestern nach knapp 6 Wochen unserer Ankunft in Österreich in staatlichen Heimen untergebracht werden. Nach einer wunderschönen Kindheit in Uruguay in voller Freiheit und Natur, war die plötzliche Verpflanzung nach Österreich fürs erste einmal ein kultureller Schock, die abrupte Entfernung aus der Familie und Unterbringung in ein Heim dann aber traumatisch, zudem wir Kinder nicht einmal Deutschkenntnisse besaßen und somit auch vor Kommunikation ausgesperrt waren. Nicht genug damit waren die materiellen, die hygienischen und die menschlichen Verhältnisse in dem Heim seinerzeit ähnlich diese eines Nazi-Konzentrationslagers, einfach katastrophal. Um es abzukürzen: als Ex-Heimopferkind staatlicher Heimen in Österreich in den 1960er Jahren, wo ich nur mit Misshandlungen und Erniedrigungen und sonstiger Tortur konfrontiert war und psychisch verletzt und traumatisiert und damit auch in meiner Persönlichkeitsentwicklung und Fortkommen schwer geschädigt wurde, habe ich leider nichts gescheiteres für ein geregeltes Leben gelernt, außer Gewalterfahrung sowie Angst und Misstrauen vor Mitmenschen und vor der Gesellschaft. Durch Entweichungen aus den Heimen vor den Terror und Tortur und als Folge der Verfolgung der Polizei ausgesetzt, musste ich schon als halbwüchsiger im Underground und am Straßenmilieu zu überleben lernen, beginnend mit kleineren Diebstähle bis zum Straßenstrich hin in der Bi- und Homosexuellen Szene. So geriet und wuchs ich allmählich in das Milieu der Kriminalität hinein. Beginnend als gequälter und verfolgter und entgegen einem vernünftigen und geregelten Leben in der Gesellschaft geprägt sowie zum ausgestoßener abgestempelt, der sich als solcher durchs Leben durchzukämpfen versuchte. Ein Kampf, der nicht nur mein eigenes Leben mit mittlerweile 55 Jahre im Keller der Republik zerstört hat, inbegriffen die Jahre in staatlichen Heimen. Ein hartes und fatales Leben als gejagter, Gangster und protestierender mit stets spektakulären und dramatischen Ereignisse und Höhepunkte. Mittellos sowie ohne berufliche Kenntnisse und infolge der Vorstrafen ohne Chance auf eine ständige Arbeitsstelle in irgendwelchen Betrieb oder Firma, da seinerzeit, jedenfalls wohin ich auch kam jeder Betrieb oder Firma Polizeizeugnisse verlangten, beging ich zwischen 1977-78 in Wien mehreren Bankinstitute, Postämter und Geldboten zu überfallen, um mir Geld für existenzielle Notwendigkeiten zu beschaffen, Wohnung, Lebensmitteln, Kleider etc. Dabei schoss und traf ich einen Postbeamten, der 8 Tage später im Spital verstarb und verletzte einen Taxifahrer schwer, der mich hinterher hartnäckig verfolgt hatte. 1979 wurde ich vom Landesgericht Wien mehr oder weniger zu Recht zu einer Lebenslangen Haftstrafe verurteilt, wenngleich ich die Überfälle nicht mit dem Vorsatz beging Menschen zu töten, sondern nur um Geld zu erbeuten. Andererseits hätte ich es mir vorher besser überlegen sollen, dass ein Mensch sehr wohl sterben kann auch wenn man nur einmal auf ihn schießt und nicht sein Tod beabsichtigt, sondern nur um eine Gefahr und Verfolgung abzuwehren. 1980 wurde ich zur Verbüßung der Lebenslangen Haftstrafe in die Strafanstalt Garsten in Oberösterreich überstellt, wo ich 1983 auf den hohen Dach der Garstner Wallfahrtskirche eine eineinhalbtätige spektakuläre Protestaktion gegen massive Missstände in der Anstalt veranstaltete und damit erstmals in Österreich – zum besonderen Unmut der Justizwache und Vollzugs(ober)behörden - in der breiten Öffentlichkeit die Angelegenheit „Strafvollzug“ popularisierte und politisierte, da es bis dahin genauso ein Tabuthema war, wie die Pädophilie in der Gesellschaft. 1984 wurde dann ich in die Strafanstalt Stein verlegt, von wo ich dann Mitte 1988 in die Strafanstalt Karlau verlegt wurde. Vor der Verlegung in die Karlau heiratete ich in Stein meine Langjährige Geliebte Silvia Chmelir (72) und nahm ihren Familiennamen an. Sie war eine wunderbare Lebensgefährtin, die mich über den Jahrzehnten Strafhaft treu begleitete und unterstützte. Trauriger weise ist sie Dezember 2018 unerwartet verstorben. Gegen Mitte 1988 saß ich bereits 11 Jahre hinter Gittern und es ging mir gesundheitlich nicht gut. Ich hatte regelmäßig starke Bauchschmerzen, konnte kaum schlafen und fühlte mich ständig übernatürlich nervös. Erst nach meiner Flucht wurde neben Schilddrüsenüberfunktion auch ein fortgeschrittenes Zwölffingergeschwür diagnostiziert sowie Osteoporose im Halswirbelbereich diagnostiziert (01). Von Hypochondrie kann also keine Rede sein. Visiten beim Anstaltsarzt in der Karlau brachte nichts, außer „Wenn’s in Garsten auf den Kirchendach klettern konnten, können sie nicht so krank sein. Sie bilden sich nur was ein“. Ich wurde zunehmend unruhig und mir wurde fast zur Gewissheit, dass ich ernsthaft erkrank sei und das mich das Gefängnispersonal aus Vergeltung wegen der Protestaktion in Garsten Schaden zufügen will. Damals eine übliche Vorgehensweise des Gefängnispersonals bei Häftlingen, die sich über Missstände beschwerten, eigentlich heute noch. Verzweifelt grübelte ich über Möglichkeiten nach, wie ich mich dagegen zu Wehr setzen könnte. Eines Tages traf ich beim Spaziergang zufällig auf einen Häftling der mich darauf ansprach, ob ich flüchten möchte. Ich kannte ihn nur oberflächig. Er wiederum kannte mich nur von der aufsehenerregenden Protestaktion in Garsten her, der deswegen für mich größten Respekt und Anerkennung hatte. Ich sagte ihn zu, dass ich mit flüchten würde, wenn dazu die Chance gäbe. In den folgenden Tagen stellte er mir einen zweiten Mithäftling vor, der ebenso zu flüchten beabsichtigte. Von diesem erfuhr ich dann, dass die Fluchtplanung mit fertigen Nachschlüsseln etc. schon ziemlich ausgereift sei und erklärte mir die Details darüber. Von den Kanten und Ecken her betrachtet war der Fluchtplan unglaublich schwer. Trotzdem entschied ich mich mitzumachen, angetrieben von Angst um meine Gesundheit, gleichzeitig um die Öffentlichkeit über Telefonate von den Missständen in der Strafanstalt zu informieren. Es ging nur mehr darum, den Tag der Flucht festzusetzen. Wir entschieden uns für den 2.8.1989 als günstigsten Tag. Der Gefängnisausbruch 2.8.1989 Meine Fluchtpartner hatten mit nachgemachten Schlüsseln beste Vorarbeit geleistet, auch mit der genauen Ausspähung der Routine der Justizwache und spähten so auch die Schlupflöcher. Kaum war der Ausruf zum Spaziergang, schon waren wir auf den Weg zur Flucht. Von den oberen Zellenetagen bogen wir ab zu einer Stiegen-Treppe, die direkt zu der Kellerabteilung führte. Die Wärter waren routinemäßig auf eine andere Stiegen-Treppe fokussiert und schauten weder nach oben oder nach unten noch nach rechts oder links. Da die Wärter beim Ausrücken zum Spaziergang zudem keine Zählung der Häftlinge vornahmen, fiel damit keinen Wärter auf, dass wir drei nicht im Spazierhof rausgingen, sodass wir während die eineinhalbstündige Bewegung im Freien niemanden abgingen. In der Kellerabteilung des Zellenhauses drangen wir mit Nachschlüsseln ein. Dort versteckten wir uns in engen Kellerkanalschächten und warteten ab zirka eine halbe Stunde lang bis die Beamten ihre routinemäßige Kontrolle in den Betriebsgebäude beendeten. Die Kontrollen fanden stets nach Einrücken der Häftlinge von der Arbeit statt, um nachzuschauen dass kein Häftling in irgendwelchen Betrieb versteckt zurückgeblieben ist. Als wir uns dann sicher waren, drangen wir mit Nachschlüsseln in der Kellerabteilung des Arbeitsgebäudes ein. Von dort spähten wir zum Hof der Außenmauer und warteten bis der Beamte im Wachturm der Außenmauer seinen Dienst beendete. Wir wussten, dass es nicht lange dauern kann. Das geschah routinemäßig stets ein paar Minuten nach der letzten Inspektion des Arbeitsgebäudes. Als es soweit war, schlugen wir mit einem großen Vorschlaghammer, der meine Fluchtpartnern Tage vorher vorsorglich in den Kellerkanalschächten deponiert hatten, die dicken Glasziegeln eines kleinen Fensters eines Parterrebetriebs ein und schlüpften durch zum Hof hinaus und zur Außenmauer hin. Die zirka vier Meter hohe Mauer überkletterten wir dann mit langen Pfosten, die im Hof neben dem Tischlereibetrieb aufgestapelt lagen. Als wir dann auf der Außenmauer raufgeklettert waren und in die Freiheit sprangen, rannten wir gleich los. Nach zwei-drei Gassen kam uns dann zufällig ein Taxi entgegen, das wir anhielten und als Ziel das allgemeine Krankenhaus Graz angaben. Die Flucht war somit perfekt gelungen. Unmittelbar nach Ankunft im Grazer Krankenhaus trennte sich ein Fluchtpartner, weil er Richtung Tschechoslowakei wollte, während ich und der andere (Mirko) Richtung Jugoslawien bzw. Italien wollten. Letztere war vorher schon besprochen worden und insofern wichtig für mich, weil ich nicht Autofahren kann. Da ich ab meinen 13. Lebensjahr ständig in staatlichen Heime und (Jugend-)Gefängnisse war, hatte ich nie die Möglichkeit den Führerschein zu machen oder sonst wie Autofahren zu lernen. Ich war und machte mich sozusagen von einem Partner abhängig - und wie es kommen musste, stand ich am dritten Tag der Flucht plötzlich allein da. Drei tagelang versteckten wir uns in den Waldhügeln rund um die Stadt Graz herum, um die intensive Polizeifahndung der ersten Tage zu entgehen. Die Kälte, Nässe und Hunger setzten uns zu, insbesondere in der Nacht. Wasser tranken wir aus Bächen. Zum Essen fanden wir in den Bauernfelder nur unreife Maiskolben. Am dritten Tag dann gegen die Abenddämmerung ging mein Fluchtpartner Mirko in einen nahegelegen Dorf in der Absicht ein Auto zu stehlen. Ich sollte im Wald auf ihn warten, denn es wäre schade nach seiner Meinung, wenn wir beide gleichzeitig erwischt würden, falls er beim autoknacken ertappt wird. Das leuchtete mir ein, so blieb ich dann allein zurück und wartete auf seine Rückkehr in der Hoffnung, dass er mit einen Fahrzeug zurückkommt, damit wir endlich von der Gegend um Graz herum wegkommen und zur Staatsgrenze fahren können. Mein Fluchtpartner Mirko kehrte jedoch nicht mehr zurück. Später, nachdem wir uns wieder in die Strafanstalt Stein wieder trafen, erzählte er mir dass er beim Autostehlen beobachtet wurde, weswegen er mit dem gestohlenen Auto das Weite suchen musste, um der Polizei zu entkommen. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich bis heute nicht. Nach 11 Jahren ununterbrochener Haft nunmehr allein auf der Flucht gestellt, war ich ziemlich übersichtlos und ziemlich unbeholfen. Tagsüber versteckte ich mich im dichten Wald und bewegte mich erst im Schutze der Abenddämmerung weiter fort. Sah ich irgendwelche Personen durch Waldwege gehen, so duckte ich mich sofort hinter Baumstämme oder Gestrüpp und hielt den Atem an. So eine Flucht löst eine regelrechte Dauerparanoia aus. In der Nacht trieb es mich an Ortsränder, wo ich mich nach Einbruchsmöglichkeiten umschaute. Ich brauchte ganz dringend was zum Essen und warme Bekleidung, denn meine Kleidung und Sportschuhe waren völlig verdreckt und vom Regen durchnässt, so dass meine Zähne vor Kälte klapperten, waren die Nächte in August noch ziemlich kalt. Auch meine Füße waren durch das ständigen gehen und von der Feuchtigkeit mit Blasen und Entzündungen ziemlich mitgenommen und schmerzten bei jedem Schritt. Zudem war ich im Dunkel der Nacht wiederholt gestolpert und hingefallen, wobei ich mir eine Fußverstauchung und einen großen Splitter auf die rechten Handballen zuzog. Die Fußverstauchung war jedoch nicht so Schlimm, dafür entzündete sich der Splitter an meinen Handballen und schmerzte tagelang, weil ich es nicht rausbekam. Das hat man davon, wenn man sich physisch, mental und psychisch unvorbereitet und unbedacht auf sowas einlässt, nur so spontan und blind drauflos. Das schlimmste aber war, das ich völlig orientierungslos auf und ab marschierte. Ich wusste nur, dass ich vom Graz noch nicht weit genug weg sein konnte, aber in welcher Richtung ich da auf und ab marschierte hatte ich keine Ahnung. Da wurde mir auch so richtig bewusst, wie Ahnungslos und unvorbereitet ich geflüchtet war. Ich ärgerte mich total über mich selbst und machte mir Vorwürfe so Dumm gewesen zu sein, mich von anderen völlig abhängig gemacht zu haben. Insgeheim wünschte ich mir wieder in der Zelle zu sein, verwarf diesen Wunsch aber gleich wieder, wenn ich nur an den Missstände und Schikanen dachte. In den folgenden zwei Tagen gelang es mir in mehreren Bauhütten und Wochenendhäuser einzubrechen und mich dort mit Konservendosen zu ernähren sowie mit wärmerem Bekleidung zu versorgen, schließlich auch mit einem Rucksack und diversen Werkzeuge, Zange, Hammer, Schraubenzieher sowie mit Löffel, Gabel und Messer. Das Werkzeug war vorwiegend für weitere Einbrüche gedacht, um mich während der Flucht weiter versorgen zu können. Denn es war mir klar, das ohne Diebstähle und Einbrüche mein Überleben und die Fortsetzung der Flucht nahezu unmöglich war, war ich doch völlig Mittellos. Die paar Geldscheine, die ich mithatte hatte ich irgendwo im Wald verloren oder, ging mir durch den Kopf, vielleicht hat es mir mein Fluchtpartner Mirko in einen unbeobachteten Moment gestohlen. Wie es auch sei. Ich ließ auch ein Batterieradio mitgehen, so dass ich mich stündlich über die Nachrichten über den Stand der Polizeifahndung informieren konnte. So erfuhr ich auch, dass derjenige Fluchtpartner, der nach Tschechoslowakei wollte bereits am nächsten Tag der Flucht beim Autostoppen auf der Autobahn wieder erwischt wurde. Na ja, ging mir durch den Kopf, jetzt ist er wieder in eine warme Stube. Bei einen der Einbrüche hinterließ ich dem Inhaber des Gartenhauses ein Entschuldigungsschreiben mit einer Erklärung an die Öffentlichkeit sowie mit einer politischen Forderung an das Bundesministerium für Justiz Wien eine justizunabhängige Kommission zur Überprüfung der wahren Praktiken in den Gefängnisse einzusetzen, wobei ich gleichzeitig meine Bereitschaft ankündigte, mich bei Erfüllung der Aufforderung der Vollzugsbehörden freiwillig wieder zu stellen (51/3-5), um mein Anliegen Nachdruck zu verleihen. Der Brief kann wohl nicht besser dokumentieren, warum ich tatsächlich ausgebrochen bin, welche Absichten ich tatsächlich hegte und in welchen gesundheitlichen und emotionalen Zustand ich mich befand. Aspekte meiner Flucht, die sowohl das Gericht Graz und offenbar auch die Öffentlichkeit vertuschten, weil die Flucht und die damit verbundenen Ereignisse ansonsten unter ein ganz anderes Licht zu sehen und zu beurteilen gewesen wären. Nämlich u.a. auch wegen der justizpolitischen Verfolgung und Vernachlässigung eines Häftlings durch das Gefängnispersonal aus Vergeltung, weil dieser auf spektakuläre Weise massiven Missstände in den Gefängnisse in der breiten Öffentlichkeit angeprangert und politisiert hatte. Gegen Morgengrauen des dritten Tages, der ich allein unterwegs war, 7.8.1989, war ich dann so hundsmüde und die Füße brannten derart, dass ich mir zwischen Gestrüpp eine Schlafstätte einrichtete und niederlegte. An einen Schlaf aber war, wie an den Tagen zuvor kaum zu denken. Die Nervenanspannung auf der Flucht, noch dazu unter solchen Umstände ist so stark, das man zwar die Augen zudrückt, aber schon das kleinste knistern lässt einem wieder hochfahren, wie eine Rakete. Man kann sich höchstens ein bisschen entspannen. Trotzdem muss ich zuletzt doch eingeschlafen sein, denn das unmittelbare rascheln und knacken von nahenden Schritte schreckte mich im nun auf. Sofort dachte ich an einen Bären oder sonst irgendwelchen Waldtier. Stattdessen erblickte ich auf zwei-drei Meter Entfernung einen mittelälteren Mann. Auch der Mann sah mich und erschrak, drehte sich schnell um und entfernte sich schnelleren Schritte. Sofort schoss mir durch den Kopf, dass meine Flucht nun zu Ende wäre, weil er mich als einen der Ausbrecher erkannt hat und die Polizei verständigen wird. Ich lag eher am Rande des Waldes zwischen Gestrüpp und nicht weit davon sah man Häuser. Also, schoss mir durch den Kopf, es dauert nicht mehr lange bis er die Polizei verständigt. Später sollte ich über Gerichtsprotokolle erfahren, dass er beim Bundesheer tätig war und an diesen Tag frei hatte und im Wald nach Schwammerln gesucht hatte. Wenn mehrere Strafgefangenen gleichzeitig ausbrechen, noch dazu aus Lebenslanger Haftstrafe, so war mir klar, das intensiver Fahndung und Berichterstattung stattfand. Die kleinste Information könnte ein Heer von Polizeibeamten herbei befördern, dachte ich panisch. Als er außer Sicht war, begann ich zum Laufen, fiel aber immer wieder in Schritttempo zurück, weil die wunden Füße infolge der ständigen feuchten Turnschuhe und Entzündungen nicht mitmachen wollten. Ich geriet in einen asphaltierten Waldweg und gleich danach sah ich auf eine stark frequentierte Landstraße hinab, die ich unbedingt vermeiden musste, denn gerade von dort würde die Polizei oder Gendarmerie kommen, schoss mir durch den Kopf. In diesem Moment hörte ich Motorgeräusche und gleich darauf fuhr ein PKW an mir vorbei. Instinktiv drehte ich mich weg, duckte mich zu Boden um so zu tun, als wenn ich was aufhebe und schaute weg um von dem Fahrer nicht gesehen und erkannt zu werden. Dass es schon die Polizei sein konnte, glaubte ich nicht, da erst wenigen Minuten vergangen sind, seit mich der Fremde im Wald gesehen hat. Ich musste quasi wieder etwas zurück von wo ich gekommen war, denn auf die eine Seite des Waldweges war offener Ackerland, das mir keinen Schutz vor den gesehen zu werden bot und auf die andere Seite ging es ziemlich steil Hügelab. Ich fühlte mich wie ein gehetztes Tier, der panisch vor den gefressen werden gejagt wird und auf der Flucht war. Die fatale Kaperung der Politikergattin Ich marschierte den Waldweg entlang und suchte eine andere Route. Dann hörte ich erneut Motorgeräusche Diesmal dachte ich sofort an die Polizei oder Gendarmerie und mein Herz raste wie verrückt vor Panik. Ich schaute mich um, es war jedoch ein normaler Pkw auf schätzungsweise etwa 100 oder 150 Meter Entfernung und da schoss mir wie aus dem nichts spontan und instinktiv durch den Kopf: „Halte den Wagen an und zwinge den Fahrer mit den Messer dich schnell aus den Gefahrenbereich wegzufahren“. Ähnlich, wie in etwa „Friss, bevor du gefressen wirst“. Man greift in der Verzweiflung die Gelegenheit, ohne zu überlegen Dann ging alles Blitzschnell vor sich. Ich winkte den sich nähernden Pkw, der genau neben mir stehenblieb. 20-30 Meter zuvor hatte ich schon erkannt, dass eine Frau am Steuer saß. Ich griff schnell durch das Fahrersitzfenster und packte die Frau bei der Bluse und mit der anderen Hand hielt ich ihr das Brotmesser, das ich von einer Schrebergartenhütte mitgenommen hatte vor der Brust. Gleichzeitig schrie ich sie an „Fahren Sie mich hier weg. Ich bin aus dem Gefängnis ausgebrochen und die Polizei ist hinter mir her (08/1,2)“. Ich riss die Autotür auf, drängte die Frau auf den Beifahrersitz, stieg gleichzeitig in den Wagen und drängte die Frau über mich auf den Fahrersitz zurück. Ich fuchtelte weiter mit dem Messer vor ihrer Brust und forderte sie auf, sofort wegzufahren. Die Frau war natürlich Toderschrocken und gehorchte mir ohne zunächst vor Schreck ein Wort rauszubringen. Es ging alles so blitzschnell vor sich, so dass die Frau keine Zeit hatte sich zu fassen. Ich hatte in diesem Moment keine Ahnung, dass es sich um die Ehegattin eines Oberregierungsrates der steirischen Landesregierung handelte und dass mir und ihr eine unglaubliche Tragödie und Drama bevorstand. Immer kehrend forderte ich sie eindringlich auf, mich von der Gegend schnell Richtung jugoslawische Grenze wegzufahren und betonte, dass die Polizei jeden Moment eintreffen könnte. In völliger Angst versetzt fuhr sie los, während ich ihr zur Einschüchterung das Messer an der Hüfte angesetzt hielt. „Ich fahre sie weg, ich fahre sie weg, aber bitte tun sie mir nichts an“, bat sie immer wieder. „Es wird ihnen sicher nichts Weiteres passieren, wenn sie mich von hier wegfahren und nicht die Polizei oder sonst jemand zu alarmieren versuchen“, versicherte ich ihr ebenso oft. Durch die ständige Bedrohung hatte die Frau in dieser Situation absolut keine Chance zu flüchten oder irgendwie Alarm zu schlagen oder sonst wie auf sich Aufmerksam zu machen. Wir fuhren quer durch die Stadt Graz bis zur Südautobahn. Dabei hielt ich ihr das Messer zur Bedrohung an die Hüfte angesetzt. Es ist keine Frage - und das habe ich auch immer zugegeben und betont, dass ich mich hierbei eindeutig schuldig gemacht habe. Sieht man aber im Gesetzbuch nach als auch auf Seite 4 des Strafurteils, so erfüllte ich mit den primären Straftaten nur den Tatbestand der schweren Nötigung und gefährlicher Drohung gem. §§ 106 (1) und 107 (2) StGB, die maximal mit 5 Jahren Haftstrafe geahndet werden. Ich wurde allerdings – entgegen der tatsächlichen Ereignisse der Flucht, wie unten weiter geschildert und entgegen der Fakten und der Gerichtsaktenlage - zu einer 18-Jährigen Haftstrafe verurteilt. Die Justiz verpasste mir sozusagen ein Todesstoß, weil die Frau Ehegattin eines hohen Grazer Politikers war und weil meine Beliebtheit bei der Justiz wegen meiner Initiativen gegen Missstände im Gefängnis im Keller war. Ein staatliches System in Österreich zu kritisieren löst viele gefahren aus. Nach Erreichen der Südautobahn nach zirka 20 Minuten fiel die Wucht der Panik und der Spannung allmählich von mir ab und unglaubliche Erleichterung machte sich in mir breit „entkommen" zu sein“. Die Autobahn war zu diesen Vormittagsstunden sehr mäßig befahrbar. Gleichzeitig der Freude „entkommen“ zu sein, wurde mir aber auch klar, was ich eigentlich getan hatte, nämlich eine Frau entführt zu haben Ich blickte zur Frau auf den Fahrersitz hin und war plötzlich schockiert. Die fatale Realität kehrte ein und drang allmählich in mein Bewusstsein. „Um Gottes willen, was hast du getan“, schoss mir durch den Kopf. „Wer ist diese Frau! Das sind schlimmste Folgen für dich, wenn sie dich wieder erwischen. Wie konntest du das nur tun!“ Die Eigenvorwürfe und Befürchtungen flossen nun in meinen Kopf durcheinander herum, wie die wilde Strömung eines Flusses. Nun sah ich die verängstigte Frau neben mir mit klarerem Augen und Bewusstsein. Zuvor war es mir offensichtlich durch den eigenen Panikzustand nicht möglich. Jetzt aber tat sie mir plötzlich wirklich leid. Ich konnte es fast nicht mehr ertragen, dass sie Angst hatte. Als Ex-Heimkind und Häftling mit jahrelangen Gefängnisaufenthalten war ich mehr als zu oft selbst in schrecklichen Situationen der Angst und des Schreckens und gelegentlich auch der Todesangst. Auch wenn es nun nicht glaubwürdig und zynisch erscheinen oder klingen mag, so doch wünsche ich jedenfalls nicht Frauen und Kinder solchen Momente und Erfahrungen. Aber nun hatte ich mal in panischer Angst gehandelt und durch den erwachen daraus änderte ich meine Einstellung gegenüber der Frau. Ich nahm das Brotmesser, mit der ich sie bedroht hatte und das nun auf meinen Schoss griffbereit vorlag und verstaute es in den Rucksack, während ich ein etwas kleineren Messer, das ich unter die Jacke im Rücken im Hosenbund eingesteckt hatte vorsichtshalber dort beließ. Gleichzeitig versuchte ich mich bei ihr zu entschuldigen. „Ich muss mich bei ihnen entschuldigen, was ich ihnen angetan habe. Ich war verrückt vor Panik wieder erwischt zu werden“ (01./22). Sie blickte mich überrascht und erstaunt an und fragte mir, „Was tun Sie da?“, während sie mir zusah, wie ich das Messer in den Rucksack verstaute. „Bitte entschuldigen Sie mich. Ich war total in Panik von der Polizei erwischt zu werden und wieder ins Gefängnis zu müssen. Ich will Ihnen nichts antun. Ich muss verrückt geworden sein. Mich hat ein Mann im Wald gesehen und hat sich schnell wieder entfernt. Er hat mich offenbar als eine der Ausbrecher aus der Karlau erkannt. Deswegen geriet ich in Panik, dass er die Polizei verständigen wird. Und als ich ihr Auto sah, sah ich es als einziger Rettung an, um schnell von der Gegend wegzukommen!“. Die Frau atmete tief ein und erwiderte: „Oh, bin ich erleichtert. Ich glaubte schon, dass es mich persönlich betrifft. Das ich sterben muss“. „Bitte, bitte denken Sie das nicht. Ich bin kein Kinder- oder Frauenmörder. Nein, nein“, versicherte ich ihr mit voller Überzeugung, „Das würde ich nie Tun. Ich bin nur aus dem Gefängnis Karlau ausgebrochen, weil die Schikanen und Missstände nicht mehr auszuhalten waren (08./ 7). Glauben Sie mir, es ist ein Wahnsinn, was sich da abspielt“. "Ja, davon habe ich schon gehört“, erwiderte Sie. Ich weiß nicht warum, offenbar aber aus Gewissen oder aus schlechten Gewissen heraus spürte ich plötzlich eine sehr starke innerliche Bedürfnis, mich bei ihr zu erklären und mich ernsthaft zu entschuldigen, gleichzeitig aber auch um sie zu beruhigen und ihr die Angst zu nehmen. Es wurde mir deutlich bewusst, dass die Frau überhaupt nichts dafür kann, das ich einfach verrückt gehandelt hatte. Ich war plötzlich schockiert über mein handeln. Von dem Moment an bis sie bei der Polizei in Klagenfurt erschien war ich nur mehr bestrebt, die Frau anständig zu behandeln und ihr jedwede Angst zu nehmen, wie nur möglich sowie ihr die Sicherheit zu vermitteln, das ihr absolut nichts mehr passieren wird. Andererseits lag es auch in meinen eigenen Interessen, weil mir bewusst wurde, dass sie ansonsten auf der langen Fahrt zur Staatsgrenze fortwährend in Angst und Schrecken meine Flucht gefährden könnte, indem sie jede sich anbietende Gelegenheit zu entkommen oder um Hilfe zu schreien wahrnehmen könnte. In den weiteren Verlauf schilderte ich ihr ausführlich, warum ich aus dem Gefängnis geflüchtet war und das ich beabsichtige die Öffentlichkeit darüber zu informieren. Dabei schilderte ich ihr auch vielen Missstände im Gefängnis, wobei ich die Schilderung immer wieder mit den Schlussworten unterstrich, „Glauben Sie mir, bitte!“. Umso erstaunter war ich dann, als sie mich unterbrach und zu mir sagte: „Sie brauchen nicht immer zu sagen, das ich ihnen glauben sollte. Ich glaube Ihnen. Ich weiß, dass Sie mir die Wahrheit sagen“. Momentan war ich Perplex und fragte sie, „Wieso wissen sie es?“. „Schauen Sie! Mein Mann ist hoher Regierungsbeamter und ich kann gelegentlich Gespräche unter den Beamten beiwohnen. Von daher weiß ich, das in der Strafanstalt Karlau unmenschliche Haftbedienungen herrschen“. „Ich verstehe nicht, dass selbst Politiker darüber Bescheid wissen und das trotzdem keiner was dagegen tut“, erwiderte ich ihr. „Ja, wissen Sie. Das ist die Krankheit unseres Landes. Jeder hat sein eigenes Reich aufgebaut und keiner traut sich über den anderen. Im Gegenteil, sie unterstützen sich sogar gegenseitig. So macht jeder kleiner Reich, was es will“. Ich fragte sie, wie sie heißen würde und ob ich sie beim Vornamen nennen dürfe, was sie mir zusagte. Das bestritt sie später verständlicherweise, aber das ist nicht so wichtig. Ich blieb zunächst trotzdem per Sie. Erst etwas später duzte ich sie. Während sie ruhig und gemäßigten Tempo das Auto auf der Autobahn fuhr, führten wir in der Folge eine längere Konversation über die Zustände in dem Österreichischen Gefängnisse. In vielerlei Hinsicht schloss sie sich meiner Meinung an oder ich die ihre. Dabei wurde mir klar, dass sie tatsächlich Kenntnisse über den Strafvollzug und über etwaigen Missstände hatte. „Ich bin verwundert, dass sie so kritisch sind. Sie haben ja einen guten Lebenstand“, stellte ich fest. „Das schließt nicht aus, dass ich mich dafür interessiere, was in unseren Land geschieht“, antwortete sie mir unverzüglich mit leichtem Vorwurfton, so als wenn ich ihr etwas unterstellt hätte. Mittlerweile bemerkte ich, wie richtig und wichtig es von mir war in erste Reaktion nach Erreichen der Autobahn das Messer im Rucksack wegverstaut zu haben sowie mich bei ihr wiederholt entschuldigt und ihr die wahren Gründe meiner Wahnsinnstat erklärt zu haben. Nicht zuletzt auch die fortlaufende Konversation zwischen uns hat unglaublich zur Entspannung aus der dramatischen Situation beigetragen, wurde mir bewusst. Die Frau wirkte nun viel entspannter und die Angstzüge in ihrem Gesicht waren weitgehendste gemilderter Form, eher von Ungewissheit und Ratlosigkeit geprägt. Sie grübelt sicher nach, um die Situation einzuschätzen und um einen Ausweg, dachte ich mir. Ich beobachtete sie so unauffällig wie nur möglich, um ihr nicht das Gefühl zu vermitteln, dass ich sie überwache. Als Ex-Heimkind und als jahrelanger Häftling, der selbst schwerste und schmerzvollste Erlebnisse persönlich erleben und zu überleben lernen musste, war mir durchaus ein feineres Gespür angeeignet als manch ein anderer, um in solch einer Situation den Zustand eines anderen einzuschätzen. Nach kurzer Zeit der stille sagte sie dann: „Ja, ich habe es mir überlegt. Ich werde ihnen helfen. Ich fahre Sie zur Grenze, aber versprechen Sie mir, das ich zu meiner Familie zurückkehren darf und das Sie mir nichts antun“. „Sie können sich sicher sein, dass ich ihnen nichts antue und das Sie zurückfahren können, aber ich verlasse mich auf ihr Wort und Versprechen. Es wäre ein Wahnsinn, wenn sie mir helfen würden. Ich wäre ihnen so dankbar dafür“, erwiderte ich ihr enthusiastisch. „Ja, ich verspreche es Ihnen“, betonte sie nochmals. Ich hielt ihr meine gestreckte Hand hin und sagte „Abgemacht!“. Nach kurzem zögern gab sie mir die Hand, gleichzeitig atmete sie auf und erwiderte, „Wissen Sie! Jetzt kann ich in etwa verstehen, was passiert ist und warum. Irgendwie verstehe ich jetzt, warum Sie in Panik gerieten“. „Und bitte entschuldigen Sie mich nochmals, was ich ihnen angetan habe. Ich weiß, es ist für sie fürchterlich. Ich bin jetzt selbst darüber schockiert“, entschuldigte ich mich erneut bei ihr. Natürlich war mir klar, dass ihre Zusage allein schon wegen ihrer Notsituation nicht wirklich freiwillig war, andererseits geschah es aber nicht mehr in eine Art und Weise der brutalen Drohungen und Einschüchterungen, deswegen sie in ständiger Angst und Schrecken versetzt wäre, sondern in eine Art Abmachung zwischen Menschen, die in eine prekären und fast Aussichtlosen Situation nach einen Ausweg suchen. „Wenn wir die Grenze erreicht haben, dann können Sie sicher wieder nach Hause…“, versicherte ich ihr erneut, „…aber ich muss sie gefesselt zurücklassen, damit sie nicht gleich die Polizei alarmieren können. Ich brauche etwas Vorsprung, verstehen Sie!“ (11./2 unten) Sie schaute mich fragend und ängstlich an. „Machen Sie sich aber keine sorgen. Ich denke gerade nach einer Lösung verzweifelt nach. Ich werde Sie nicht irgendwo zurücklassen, wo Sie überhaupt nicht gefunden werden können. Ich brauche nur einen Vorsprung von ein paar Stunden. Bis dahin bin ich sicher an einem Ort angekommen, von wo ich dann die Polizei anrufen und verständigen kann, wo Sie zu finden sind. Das verspreche ich Ihnen…“, versicherte ich ihr erneut, „…oder wir fahren in einen abgelegen Ort und ich nehme das Autoschlüssel mit, während Sie im Auto zurückbleiben, so dass Sie nicht sogleich wegfahren und daher auch nicht gleich die Polizei alarmieren können“, schlug ich ihr vor. „Nein, die Autoschlüssel brauche ich schon“ sagte Sie Stirnrunzeln. „Es geht nur darum, dass ich etwas Vorsprung brauche. Denn wenn Sie zur Polizei gehen, bricht sofort eine starke Fahndung aus und dann habe ich kaum eine Chance. Verstehen Sie!“ „Ja, das glaube ich auch und das verstehe ich. Ich bin nur froh, dass Sie mir nichts antun“. „Sie können sicher sein, dass das nicht passieren wird“, versicherte ich ihr erneut zu. „Ich kann verstehen, dass Sie Momentan in dieser Situation wahrscheinlich zweifeln. Aber wenn Sie wieder zu Hause sind, erinnern Sie sich dann an mein Versprechen. Vielleicht können Sie mir dann verzeihen“. Sie schaute mich abrupt an und ich sah ein leises Lächeln in ihr Gesicht „Das haben Sie aber schön gesagt. Ja, ich werde mich daran erinnern, das kann ich Ihnen versprechen“. Innerlich wusste ich, dass ich Sie anlog. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt überhaupt keinen wirklichen Plan, wie ich aus dieser fürchterliche Schlammassel raus konnte. Ich war mir nur sicher, dass ich der Frau nichts mehr antun wollte und würde und das mein Versprechen ernst gemeint war, aber wie ich das anstellen sollte, um meine weitere Flucht nicht zu gefährden, davon hatte ich zu diesem Zeitpunkt keine wirkliche sichere Vorstellung oder Plan. Nur die vage Vorstellung, dass ich Sie irgendwo zurücklassen musste, von wo sie nicht gleich die Polizei alarmiere könne. In weiterer Konversation, eher um mich selbst von der fürchterlichen Folgen meiner strafbaren Handlung abzulenken, die mir durch den Kopf rasselten, erzählte ich ihr dann von meinen spektakulären Fluchtversuch und der anschließenden Protestaktion Mitte 1983 in Garsten auf dem hohen Kirchendach der Wallfahrtskirche. Daraufhin schaute sie mich verdutzt an. „Ach, Sie waren es! Irgendwie sind sie mir bekannt vorgekommen. Das hat damals viele Schlagzeilen gemacht. Jetzt kann ich auch verstehen, weshalb Sie beim Personal des Gefängnisses unbeliebt sind“. Sie fragte neugierig nach, wie es damals zu dem Fluchtversuch und der Protestaktion kam und ich schilderte es ihr. Ebenso weshalb ich im Gefängnis saß, nämlich weil ich Bank- und Postüberfälle begangen hätte und dabei einen Postbeamten so unglücklich traf, das er 8 Tage später im Krankenhaus verstarb, was Punkt auf Punkt auch stimmte. Ich vermied dabei bewusst die Worte „Mord“ und „Mordversuch“, weswegen ich verurteilt wurde (08./7). Auch hier zeigte sie sich neugierig und ließ sich die Abläufe der Geld-Überfälle und wie es zum Tod des Postbeamten kam näher erzählen. Irgendwie kam es mir so vor, ging mir durch den Kopf, als wenn sie mich (über)prüfen würde oder wollte, offenbar um mich einzuschätzen. Wir waren mittlerweile zirka eineinhalbstunden auf der Südautobahn unterwegs. Sie fuhr stets in gemäßigtem Tempo. Zwischendurch wurden wir auch von Gendarmerieautos überholt und sie zeigte dabei keine Reaktion, während ich mich fast in die Hose machte. Ich nahm die Plastikflasche mit Wasser aus dem Rucksack und bot ihr zu trinken an “Es ist aber Wasser aus Bächen“, informierte ich sie vorher. „Nein. Danke. Ich habe keinen Durst“. „Sie brauchen kein Bedenken zu haben! Ich habe keine ansteckenden Krankheiten“, erklärte ich ihr, weil ich annahm, das sie deswegen aus derselben Flasche zu trinken ablehnte. „Nein, so habe ich es nicht gemeint. Ich habe Momentan wirklich kein Durst“. Die Konversation zwischen mir und ihr verlief mittlerweile so, als wenn dazwischen nichts passiert worden wäre. Sie wirkte mit zunehmender Fahrdauer immer sicherer und selbstbewusster. Sie schaute mir während der Konversation auch öfters und gerade in die Augen, was Menschen, die wirklich Angst haben kaum oder nur selten tun. Menschen, die durch eine bedrohliche Situation verängstigt sind, meiden zumeist den direkten Blickkontakt zu dem Täter oder Peiniger, weil ihnen der Blickkontakt noch mehr Angst und Schrecken einjagt. Nur Menschen in Todesangst starren wie gelähmt den Täter oder den Peiniger an, weil sie jedem Moment mit dem Todesstoß rechnen. Ich schreibe hier aus persönlicher Erlebnisse und Erfahrungen aus meiner Zeit in den staatlichen Heime und (Jugend)Gefängnisse, wo einem allein schon der nahen Anblick eines peinigendes Erziehers oder Wärters Angst und Schrecken einjagte. Jedenfalls verdutzte mich, wie schnell sich die Frau erholt hatte und instinktiv sagte ich mir in Gedanken, „Sei jedenfalls vorsichtig. Vielleicht will sie dich nur täuschen“. Ich schätzte die Frau mittlerweile als eine Konstitutionell und intellektuell sehr starke und sehr intelligente Persönlichkeit ein und empfand zunehmenden Respekt vor ihr, dass sie ihre eigene schwere Situation offensichtlich in den Griff zu bekommen und tapfer zu beherrschen versuchte. Ich fragte sie nach ihrer Familie und sie erzählte mir, dass sie fünf Kinder hätte, dass sie auf ein eigenes Gut arbeiten würde und dass ihr Mann Agrar-Politiker und Oberregierungsrat der steirischen Landesregierung wäre. „Das Sie fünf Kinder haben ist schwer zu glauben“, erwiderte ich ihr und in der Tat konnte ich es nicht glauben. Ich dachte mir, dass sie es nur behauptet um bei mir mehr Rücksicht und Gewissen zu wecken. „Warum können Sie es nicht glauben“, fragte Sie mich überrascht. „Na ja, man sieht es Ihnen nicht an. Sie sehen zu gut aus, als das man annehmen kann, dass Sie schon fünf Kinder hätten“. „Ich habe aber fünf Kinder“, betonte sie. „Und! Sind die Kinder brav und Sie, sind sie Glücklich?“, fragte ich sie. „Ach, wissen Sie. Als Mutter von fünf Kindern und mit der ganzen Arbeit rund herum hat man kaum Zeit für sich selbst“. „Ja, da haben Sie wohl recht. Das weiß ich von meiner Mutter, die acht Kinder gebar. Wir sind acht Geschwister und meine Mutter zog uns am Land fast alleine auf, weil unser Vater stets auswärts arbeitete und kaum zu Hause war. Nur mein kleiner Bruder kam in Wien zur Welt “. „Acht Kinder! Und noch dazu allein! Wo am Land? Sind Sie aus Niederösterreich oder aus Oberösterreich?“ „Nein, nein. Meine Mutter, ich und sechs weiteren Geschwister sind in Uruguay geboren und aufgewachsen“. „Sie kommen aus Uruguay...“ rief sie erstaunt, „Das ist ja in Südamerika. Und wo haben Sie so gut Deutsch gelernt? Mir ist zwar ihr Dialekt aufgefallen, aber das Sie aus Uruguay kommen wäre mir nie aufgefallen. Sie sprechen sehr gut deutsch“. „Danke für das Kompliment. Mein Vater ist in Österreich geboren, musste aber wegen der Nazis flüchten und landete in Südamerika. In Montevideo lernte er dann meine Mutter kennen und heiratete sie 1945. Deutsch habe ich vorwiegend in der Zelle im Gefängnis von selbst durch viel lesen und nachschreiben aus Büchern gelernt“. „Und wie alt waren Sie, als Sie nach Österreich kamen?“ „Wir kamen Juni 1962 nach Österreich. Da war ich dreizehn Jahre alt. Jetzt bin ich 40. Und wie alt sind Sie?“. „Ich bin 36. Und warum mussten Sie unbedingt Geldinstituten überfallen!“ „Ja, das ist eine lange Geschichte. Wissen Sie, als wir nach Österreich kamen wollte mein Vater das Hotel meiner Großmutter sogleich übernehmen, das sie in Wien nach dem zweiten Weltkrieg aufgebaut hatte. Das Hotel war Vaters Grund, warum die ganze Familie nach Österreich kam. Die Großmutter wollte das Hotel aber noch einige Jahre führen. Deswegen gerieten sie in Streit. Es kam dann soweit, dass wir wegen des Streits das Hotel verlassen mussten, aber das Geld meines Vaters reichte nicht aus für eine Wohnung für sieben Kinder. Daher sorgte er dafür, dass einige Kinder in Heime kamen. Darunter war auch ich…“ „Da haben Sie aber ja noch nicht Deutsch gesprochen“ unterbrach sie mich. „Nein, nur Spanisch. Das war eine schlimme Zeit von den ich mich nicht mehr erholte. Zuerst die abrupte Verpflanzung von Uruguay nach Österreich und unmittelbar darauf die Trennung von der Familie. Dann in Horrorischen Heime. Ich flüchtete ständig und zu überleben beging ich anfänglich kleinere Diebstähle. So kam ich auch ins Gefängnis und es wurde immer schlimmer, denn in dem Gefängnisse wird man noch mehr zerstört. Als ich zwischendurch auf der Straße stand, da war meine Familie schon in alle Winde verstreut. Mein Vater und meine Mutter lebten zeitweise getrennt. Meine Geschwister waren teilweise schon verheiratet. Ich fand nur mehr im Straßenmilieu Anschluss. Ja, dann kam es zu den Bank- und Postüberfälle. Irgendwie bildete ich mir ein, das mir der Staat eine Entschädigung für das erlittenen Leid in den Heimen und Gefängnisse schuldet “. „Sie haben eine Wahnsinnsgeschichte. Sowas habe ich noch nie gehört. Und wo wollen Sie jetzt hin?“ „Ich will jetzt nach Uruguay zurück. Es wird nicht leicht sein, aber ich habe in Italien ein paar Freunde und vielleicht können sie mich in einen Schiff unterbringen“. „Aber warum wollen Sie dann nach Jugoslawien?“ „Weil es am nähersten zur Staatsgrenze liegt, um Österreich schneller verlassen zu können. Über Jugoslawien komme ich sicher weniger gefährdet nach Italien. Haben Sie eine Straßenkarte mit, wo ich mich in etwa orientieren könnte?“ „Ja, aber ich glaube nur für Österreich. Schauen sie in Schubfach nach“. Ich entnahm aus dem Schubfach die Straßenkarte. Da diese aber durch das auf und ab und Rütteln des Autos kaum in Ruhe anzuschauen war und sie auch nachsehen wollte, während des Autolenkens jedoch nicht möglich war, fuhr sie kurzfristig auf einen Rastplatz, wo wir gemeinsam die Route zur Staatsgrenze suchten (10./4 unten). Daraus erkannten wir, dass wir bei Wolfsberg die Autobahn verlassen müssten, um so am schnellsten Weg zur jugoslawischen Grenze zu kommen. Wir fuhren weiter und ich legte die Straßenkarte in Schubfach zurück. Dabei fiel mir ein Geldschein auf, der aus einem Führerscheinetui rausragte. Ich nahm das Etui und fand darin ca. 150 Schilling. Mit den Geldscheinen verband ich in der Fantasie sogleich Getränke und Nahrungsmittel, da ich schon seit Tagen nichts Ordentliches zu Essen hatte und ziemlichen Hunger verspürte. „Ina…“, duzte ich sie erstmals „…kann ich das Geld haben, um mir was zum Essen einzukaufen. Ich habe schon seit Tagen kaum was gegessen?“ Sie schaute mich an. „Haben Sie tatsächlich überhaupt nichts gegessen in den letzten Tagen?“. „Nur unreifen Maiskolben und drei-vier Konservendosen, die ich in Gartenhäusern gestohlen habe. Und Wasser trank ich nur aus Bächen. Ich hatte zwar etwas Geld mit, aber das verlor ich auf der Marsch in der Nacht in den Wälder und fand es nicht wieder“. Sie schüttelte den Kopf, „Ja, nehmen Sie es, sie können das Geld haben (08./5). Wo haben Sie überall Eingebrochen! In Graz oder in Gratkorn?“. Irgendwie kam mir infolge ihrer Neugier und Nachfragerei um näheren Auskünfte zeitweise so vor, als wenn ich gerade von der Polizei verhört werde, aber ich fasste es nicht böse auf. „Danke, danke für das Geld. Bei nächstbester Gelegenheit kann ich mir endlich was zum Essen kaufen. Ja, in leer stehenden Garten- und Wochenendhäuser habe ich eingebrochen. Ich weiß nicht wo, irgendwo in der Gegend. Es ging nicht anders. Ich suchte was zum Essen sowie trockene und wärmere Kleidung und diverse anderen Utensilien, die man so alltäglich braucht. Aber ich habe mich bei dem Besitzer entschuldigt. Ich hinterließ ihnen ein Erklärungsschreiben, warum ich aus den Gefängnis ausgebrochen bin, gleichzeitig stellte ich die Forderung an das Bundesministerium für Justiz, das eine Kommission eingesetzt wird, die die wahren Praktiken in dem Gefängnisse untersuchen sollte. Stand darüber schon irgendetwas in der Zeitung?“, fragte ich sie. „Das weiß ich nicht. Ich lese kaum Zeitungen. Dazu habe ich kaum Zeit“ „Wahrscheinlich hat der Besitzer das Schreiben noch nicht gefunden. Wenn ich in Uruguay bin, rufe ich meine Frau an und lasse Ihnen das Geld überweisen“, sagte ich ihr mehr als Verlegenheit heraus, sie angeschnorrt zu haben als ernst gemeint. „Nein, das brauchen Sie nicht. Was! Sie sind verheiratet!?“ „Ja. Meine Frau wohnt in Wien und zu ihr kann ich nicht, weil mich die Polizei sicher als erstes bei ihr vermutet“. „Ja, aber wie halten Sie Kontakt zu ihr. Haben Sie Kinder mit ihr?“ „Ja, ich habe drei Kinder, aber nicht mit meiner jetzigen Frau, sondern von der Hippiezeit her in München in Deutschland“. „Ja, ich habe auch die Hippiezeit miterlebt. Es waren wunderschöne Zeiten. Da haben wir ziemlich rebelliert. Und wie geht es ihren Kindern?“. „Ich habe wenig Kontakt zu ihnen, aber meinen letzten Informationen nach geht es ihnen sehr gut. Sie sind ja schon erwachsen. Mehr möchte ich aber nicht darüber sprechen, weil ich es der Behörden verweigere, um meine Kinder nicht zu kompromittieren“. „Ja, das verstehe ich. Und weiß ihre Frau davon und folgt ihre Frau sie nach Uruguay?“. „Wenn ich einmal in Uruguay bin, glaube ich schon. Wir haben zwar noch nicht ernst darüber gesprochen, weil ich sie von der Flucht nicht informiert habe, um sie nicht zu beunruhigen und zu kompromittieren, aber ich glaube schon. Im Gefängnis kommt sie mich regelmäßig besuchen. Es ist für sie nicht leicht, denn wir müssen Glück haben, das wir uns überhaupt ein Bussi geben dürfen. Körperkontakt beim Besuch ist strikt verboten“. „Das ist aber gemein“, rief sie auffallend spontan und heftig heraus. Irgendetwas fiel mir dabei auf. Rein Instinktiv. Mit „gemein“ kann sie nur damit gemeint haben, sagte ich mir, dass wir ansonsten nichts miteinander haben dürfen, was ein Ehepaar eigentlich ausmacht, darunter eben auch sich zu küssen, Zärtlichkeit auszutauschen und Sex. Ich schaute sie unbemerkt von der Seite an. Eigentlich das erste Mal, dass ich sie so richtig als Frau ansah, sozusagen als das andere Geschlecht. Da verspürte ich das erste Mal eine sexuelle Regung. Weniger körperlich, da ich mich völlig gerädert und Müde fühlte, als vielmehr emotional. Zum ersten Mal wurde mir richtig bewusst, dass sie sehr schön war und dass sie eine sehr weibliche Ausstrahlung und eine sehr schöne Figur hatte. Gleichzeitig konnte ich mir nicht vorstellen, dass sie bei so einer schönen Figur wirklich fünf Kinder hätte. Ich dachte eher, dass sie mich da anlog. Mehr als Neugier infolge ihre heftige Reaktion und um zu sehen, wie sie darauf reagieren würde als tatsächlich aus Verlangen heraus, fragte ich sie, „Ina, kann ich dir was fragen…“. „Ja. Bitte!?“ „Ich habe seit über elf Jahren mit keiner Frau geschlafen. Lässt Du mich bitte. Ich verspreche dir nicht brutal zu sein?“, worauf sie mich überrascht anschaute, genauso schnell aber auch wieder wegschaute. Ich sah, dass sie überlegte. Dann schaute sie mich an und sagte, „Na gut, aber nicht im Auto“ (01./26). Von einem Moment auf den anderen war ich völlig perplex. Ich habe mit einen klaren „Nein“ gerechnet, aber niemals damit das sie zustimmt. „Danke“, würgte ich hervor, „…oder sagst Du es nur aus Angst, das ich dir ansonsten was antue. Ich bin kein Vergewaltiger. Wenn Du nein sagst, so respektiere ich es. Das verspreche ich dir“. Sie schaute mich erneut an und gegenfragte, „Aber was wird ihre Frau dazu sagen!“. Die Frage verdutzte mich erneut. Anstatt mir eine Antwort zu geben, wich sie diese aus und stellte mir stattdessen eine Gegenfrage. Ich antwortete ihr, „Meine Frau wird es natürlich nie erfahren“. „Mein Mann darf es auch nicht erfahren. Ich habe jetzt schon genug Probleme mit ihm“, antwortete sie mir im Gegenzug. Die nächsten Minuten blieb ich Stumm. Auf einmal wusste ich nicht mehr, was ich mit ihr reden sollte. Ich fühlte mich wegen ihrer Bejahung zum Sex und mit ihrer Antwort, dass ihr Mann nichts davon erfahren sollte total verunsichert. Ich überlegte Fieberhaft, ob sie es wirklich ernst meinte oder ob sie mich nur täuschen wollte. Oder ob sie insgeheim ein Flair für Affären und für Ganoven hätte. Ich wurde überhaupt nicht schlau aus der Situation. Es kam mir so unwirklich und unfassbar vor. Ich fand zunächst keine logische Erklärung dafür, außer im Kopf herum zu spekulieren. Sie unterbrach dann die Stille, „Wir sind jetzt gleich in Wolfsberg. Im Tank ist nur mehr ganz wenig Benzin. Ich müsste tanken, sonst kommen wir nicht zur Grenze“. Wir verließen die Autobahn und fuhren in Wolfsberg ein. Ich schaute mich während der Fahrt durch Wolfsberg nach einer Tankstelle um und fragte sie, „Ina, wie viel Benzin brauchst Du, um nach Hause zurückfahren zu können?“ „Na ja, so zirka zehn Liter werde ich schon brauchen”. Kurz vor verlassen Wolfsberg Richtung Grenze entdeckten wir eine Tankstelle und fuhren diese an. „Ina. Alarmiere aber bitte nicht den Tankwart. Tue mir bitte das nicht an. Bleiben wir im Auto sitzen. Der Tankwart soll es machen“, bat ich sie. Sie schaute mich irgendwie Vorwurfsvoll an und erwiderte „Ich habe Ihnen versprochen sie zur Grenze zu fahren und das halte ich auch ein“, antwortete sie mir fast forsch und beleidigt. „Entschuldige bitte. Ich habe es nicht so gemeint“. Da ich nicht wusste, ob sie weiteres Geld mithatte, gab ich ihr 100 Schilling von dem Geld, das sie mir zuvor gegeben hatte (11./4) und sagte ihr, das sie gleich um 100 Schilling tanken sollte, damit sie auch genug Benzin zum zurückfahren hat, was sie auch tat. Nach dem Tanken fuhren wir dann weiter über St. Andrä bis St. Paul. Bei St. Paul entdeckte ich einen Straßenchild den Hinweis „Zollgrenzgebiet“, sodass wir von der Straße in einen schmalen Bauernweg einbogen, da ich wegen der Zollgrenzbeamten nicht unmittelbar zur Grenznähe fahren wollte bzw. in ein Zollgrenzgebiet herumzufahren. Nach ihrer Straßenkarte geschätzt, waren wir nur mehr drei-vier Kilometern von der Grenze entfernt. Im nu glaubte ich eine Lösung gefunden zu haben. „Ina. Ich finde es am besten, wenn Du mich bis zur Grenze begleitest. Und sobald ich durch den Wald die Grenze überquert habe, kannst Du zum Auto zurückgehen und zur Polizei oder nach Hause fahren. So brauche ich dich nicht gefesselt zurückzulassen. Sobald ich über die Grenze bin habe ich dann genug Vorsprung bis Du wieder bei deinem Auto bist. Denn bis die Polizei erfährt, was passiert ist und die jugoslawische Polizei alarmiert ist, habe ich mehr als ein paar Stunden Vorsprung und bin dann schon über alle Berge“. Sie überlegte kurz: „Ja, gut. Aber über die Grenze gehe ich nicht mit“. „Natürlich nicht“, versicherte ich ihr, „kannst mir bitte die Straßenkarte geben, damit ich mich unterwegs orientieren kann?“. „Ja, nehmen Sie es. Ich habe zu Hause noch welche liegen“. Sie nahm ein paar Sachen aus dem Schubfach und versperrte das Auto und trug sich die Sonnenbrillen auf und wir machten uns auf den Weg. „Merke dir aber den Weg, damit du auch zum Wagen zurückfindest“, machte ich sie noch darauf aufmerksam. „Ja, wir sind da kurz vor St. Paul. Das ist leicht zu merken“. Wir schauten auf der Straßenkarte schnell nochmals nach, um den kürzesten Weg zur Grenze zu finden. Entlang der Straße zu gehen verwarf ich wegen der Zollgrenzbeamten. Dabei fanden wir heraus, dass der kürzeste Weg über die auf der Straßenkarte aufgezeichneten Waldwege wäre. So dachten wir, konnten wir in gerader Linie am schnellsten und direkt zur Staatsgrenze gelangen, zumal ich die Grenze wegen der Zollgrenzbeamten ohnehin nicht direkt über die Straße passieren konnte. Nun machten uns wieder auf den weg. Es war erst gegen zwei Uhr Nachmittag. Wir dachten in etwa in eine, maximal in zwei Stunden bei der Grenze zu sein. Wir irrten uns aber gewaltigste. Ich sagte noch zu ihr, „Ina, beeilen brauchen wir uns nicht. Denn bei totalem Tageslicht kann ich die Grenze wegen der Zollbeamten kaum passieren. Die Zollgrenzbeamten beobachten die Grenze sehr wahrscheinlich mit Ferngläsern und gelegentlich auch durch Patrouillen. Ich habe noch nie zuvor eine Grenze schwarz überquert. Daher kenne ich mich nicht so gut aus“. „Ja, das ist möglich. Ich kenne mich da auch nicht aus“, erwiderte sie. „Ich werde jedenfalls die Abenddämmerung abwarten müssen. Aber sobald wir in unmittelbarer Nähe sind, brauchen wir nur das anbrechen der Abenddämmerung abzuwarten, dann kannst Du zum Auto zurück und bis Du beim Auto angekommen bist, da bin ich sicher schon über die Grenze und über alle Berge“. Wir drangen in ein lichtes Wald und marschierten los Richtung Grenze. Plötzlich hüpfte sie spielerisch herum und sagte voller Begeisterung, „Stellen Sie sich vor, stellen Sie sich vor. Als kleines Kind träumte ich von Räuber- und Gendarmspiele und jetzt bin ich selber mittendrinnen“. Ich traute meinen Augen nicht. Ich konnte es nicht fassen. Was ist das für eine Frau, schoss mir durch den Kopf. Gleichzeitig spürte ich eine Riesenfreude, dass sie offenbar überhaupt keine Angst mehr hatte und dass sie die Sache offensichtlich nur mehr als Abenteuer erlebte. Sie ging kurz vor mir. Manchmal bückte sie sich und riss spielerisch ein Grashalm oder ein grüner Zweig vom Waldboden. Dabei fiel mein Blick öfters auf ihr Gesäß. Sie hatte enganliegenden Jeans an. Ihr schöner Hintern, deren Rundungen mit ihrem Schritte erotisch hin und her wackelten, ließ mir die Luft anhalten. Ich spürte die Erregung in mir aufsteigen. Plötzlich war ein Verlangen in mir da, trotz aller Müdigkeit, wie ich zuvor kaum erlebte. Meine ersten Gedanken und mein erstes Verlangen waren ihr nackter Hintern zu sehen, zu küssen, zu streicheln und zu lecken. Verrückt, dachte ich mir. Fast außer Atem vor glühender Erregung und Verlangen - zum Trotz aller Müdigkeit durch die Strapazen der Flucht - sagte ich zu ihr, „Ina, machen wir eine Pause bitte“ und setzte mich sofort am Boden neben einen dicken Baum, mehr um meine Erektion aus Scham zu verbergen. Sie setzte sich neben mir hin, beugte sich nach hinten und stützte sich mit den Ellenbogen kokett auf den Boden. Aus einer Seite ihrer Bluse ragte ihre Brust halb heraus. Wie unter Zwang, blieb mein Blick dort haften. Sie bemerkte es. Spontan griff ich nach ihrer Brust und als meine Hand sie umfasste, spürte ich eine Hitze, als wenn ich in ein offenes Feuer gegriffen hätte. „Mein Gott, was bist Du für eine schöne Frau“, sprudelte aus mir heraus. Sie sagte kein Wort und ließ sich ganz auf den Rücken fallen. Ich sah, wie sich ihre Augen schlossen und wie sich ihre Wangen röteten. Meine Hand streichelte ihre Brüste, glitt langsam und sanft über ihren Bauch bis zum Schoß. Ihr Jean war eng, sodass ich ihre Wölbung deutlich spüren konnte. Behutsam beugte ich mich über sie und wollte Sie auf den Mund küssen. „Nein, bitte nicht. Sein Sie nicht böse, aber Sie haben einen schlechten Mundgeruch“. „Oh, entschuldige. Ich habe nicht daran gedacht“. Irgendwie war ich Momentan Ratlos und verlor fast die Lust, aber es genügte nur ein Blick auf ihre nackten Brüste, um wieder heiß zu werden. Andererseits hatte sie recht, da ich mir schon seit Tagen nicht die Zähne putzen konnte, hatte ich zudem auch Knoblauch gekaut, die ich bei den Einbruchsdiebstählen Tage vorher gefunden hatte. Der Duft ihres Schoßes elektrisierte und erotisierte mich. Ich küsste, streichelte und leckte ihre Wölbung und Po. Wie aus der Ferne hörte ich mir sagen, „Oh, Ina, du bist so schön und so süß“. Sanft und entlang ihren Körper küssend beugte ich mich dann über sie, stemmte mich auf die Hände auf und drängte meine Erregung in ihren Schoss… Als ich wieder halbwegs zu Atem kam, nahm ich sie bei der Hand, schaute sie an und flüsterte ihr, „Oh, mein Gott. So schön habe ich es noch nie erlebt. Du bist eine Göttin der Liebe“. Sie lächelte mich nur an und ließ sich wieder zurückfallen. Ich legte meinen Kopf an ihren nackten Bauch und schwebte in Gefühle, wie ich sie nie zuvor erlebte. Ich spürte keine Müdigkeit mehr. Nur die Wärme ihres Bauches und eine Erfüllung, als wäre ich im Paradies. Ich ruhte mich aus und spürte zunehmend wieder Erregung in mir aufsteigen. Ich drehte mich um und liebkoste wieder ihre erotischen Zonen…und stemmte mich dann auf die Hände wieder auf und drang erneut in sie ein. Ihre Wangen wurden glühendrot und die Spitzen ihrer Brustwarzen stachen fast bedrohlich hervor, gleichzeitig schön und erotisierend. Die Augen hielt sie immer geschlossen. Ihr Mund verkrampfte sich. Es strahlte alles um mich, wie ein göttliches Licht. Ich ließ mich außer Atem auf die Seite fallen, drängte mich gleichzeitig an ihren heißen Körper und legte meinen Arm um sie. Eng gedrängt an ihren leib, wünschte ich mir kein erwachen mehr aus dieser Schönheit der Leidenschaft und wünschte mir in diesen Moment die Ewigkeit herbei. „Hat es Ihnen gefallen“, unterbrach sie dann die Stille. „Es war unglaublich schön, Ina. Ich finde kaum Worte, um es dir zu sagen, wie schön es war. So schön und so stark habe ich es zuvor nie erlebt. Ich bin fassungslos. Du bist eine heiße und wunderschöne Frau. Wie soll ich dir danken! Und hat es dir auch gefallen?“ „So wie Sie. Unglaublich schön“. „Danke, Ina. Das von dir zu hören macht mich sehr glücklich“. Nach Minuten neben ihr, die mir wie eine wunderschöne Ewigkeit vorkamen, standen wir wieder auf und zogen uns wieder an. Ich gab ihr ein frisches Handtuch aus dem Rucksack und drehte mich dezent um. Wir gingen dann weiter. Heimlich beobachtete ich sie. Sie wirkte plötzlich jünger, schöner, fröhlicher. Auf ihr Gesicht lag nun ein leises Lächeln des Glücks und der Zufriedenheit. „Ina. Danke dir…“, schwärmte ich weiter, „Was Du mir geschenkt hast werde ich nie vergessen. Es war so schön, dass ich keine Worte finde. So bezaubernd schön habe ich es noch nie erlebt. Davon habe ich nicht einmal geträumt. Du hast mir eine Welt gezeigt, die unbeschreiblich schön ist“. Sie schaute mich nur an und lächelte strahlend. Es war nicht zu übersehen, dass ihr meine Worte sehr gefielen und schmeichelten. Ich dachte nach. Nein, es waren nicht annähernd irgendwelche Liebegefühle zwischen uns. Das wäre anmaßend und völlig daneben. Dafür kannten wir uns viel zu wenig und zu kurz. Es war etwas ganz anderes. Ich erinnerte mich, wie sie zuvor im Wald herumgesprungen war und begeistert ausrief, „Stellen Sie sich vor, Stellen Sie sich vor! Als kleines Kind träumte ich von Räuber und Gendarmspiele und jetzt bin ich selber mittendrinnen“. Im nu glaubte ich es zu wissen: Abenteuerlust und Faszination, verstärkt wahrscheinlich durch die Spannung der Situation und durch unterdrückten körperlichen Bedürfnisse nach Wärme und Zuneigung, die nun in der geistigen und körperlichen Erotik ausbrach und explodierte. Ich schaute sie wieder an und dachte mir, das diese Frau eigentlich froh war ihr Alltag ein wenig entkommen zu sein. Es war für mich nicht schwer bemerkt zu haben, dass sie offensichtlich schon lange nicht mehr mit einen Mann geschlafen hatte. Und jetzt packt sie die Gelegenheit voll beim Schopf, sagte sie doch zuvor, dass sie für sich selbst kaum Zeit hätte. Mir überkamen viel Respekt vor ihr und eine unglaubliche Bewunderung für ihren Mut. Irgendwie verstand ich sie jetzt, warum sie sich so gab. Sie wollte endlich wieder einmal was erleben und endlich wieder Frau sein, die begehrt wird und nicht nur Mutter und Frau eines lieblosen Mannes. Scheinbar spielerisch und mit kokettem Gang ging sie nunmehr neben mir her. Wir stießen auf einen asphaltierten Waldweg und marschierten diesen entlang, vermeintlich Richtung Grenze. Das glaubten wir wohl nur, sollte sich aber später als ziemlicher Irrtum herausstellen. Sie wirkte nun völlig aufgelöst und zufrieden. Es war eine Wonne sie anzusehen. Eine Pracht der Natur, dachte ich mir, wie ich es zuvor nie erlebt habe. „Weißt Du, Ina…“, schwärmte ich weiter, „Du hast mich ganz schön fertig gemacht. Ich bin jetzt noch außer Atem. Du bist eine Sexbombe“. Sie lachte auf. „Ja, es war schön. Ich habe es auch noch nie so erlebt. Mit meinen Mann habe ich schon seit beinahe eineinhalb Jahren nicht mehr geschlafen“. „Nein! Ein Wahnsinn, Das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wie ist das möglich!?“, tat ich so als wenn ich überrascht wäre, bestätigte aber meine vorherige Vermutung. „Das weiß ich auch nicht. Er verlor plötzlich die Lust. Ich habe gleich den Verdacht gehabt, dass er eine andere gefunden hat. Ich vermute sogar eine Sekretärin, aber ich kann ihn schlecht bei der Regierungsarbeit kontrollieren. Wären nicht die Kinder, würde ich mich von ihm scheiden lassen“. „Das hast Du nicht verdient. Du bist eine so wunderschöne Frau voller Glut. Jeder Mann kann nur davon träumen, so eine Frau zu finden und heiraten zu können…“ „Jetzt übertreiben Sie“, unterbrach sie mich fast ernst geworden. „Nein, Ina. Warum soll ich übertreiben! Ich kenne dich erst ein paar Stunden. Ich war gemein zu dir und trotzdem hast Du mir etwas Geschenk, was ich mein Leben lang nie vergessen werde. Du bist wunderschön und hast das Herz einer Löwin. Wenn ich dein Mann wäre, dann würde ich dich jeden Tag von neuen erobern wollen. Keine Nacht könnte ich dich vermissen“. „Sind Sie immer so Charmant!“ „Nein. Nicht einmal zu meiner Frau. Ich bin zwar lieb zu ihr, aber nicht Charmant. Bei dir ist es aber ganz anders“. „Und wie ist ihre Frau?“ „Sie ist wunderbar und ich liebe sie sehr. Aber jetzt, nach dem ich mit dir so schönes erlebt habe, scheint sie mir nun weit weg. Du und sie ist unvergleichlich und Welten voneinander entfernt. Du hast mir die schönere Welt gezeigt. Und noch dazu trotz der schwierigen Situation für dich“. „Wo haben Sie gelernt, sich so schön auszudrücken?“ „Aufgrund meiner Protestaktionen gegen Missstände im Gefängnis musste ich zeitweise über Jahre in Isolationshaft sitzen. Da habe ich mich durch die Anstaltsbibliotheken durchgelesen und offenbar viel dabei gelernt“. „Waren Sie da immer ganz allein?“ „Ja und Nein. Es durften manchmal Häftlinge zu mir, aber nur von der Justizwache ausgesuchte. Das heißt, zumeist nur Intriganten und Denunzianten, die mich offenbar auszuspionieren sollten, was ich mitunter als nächstes planen würde und so, so dass ich auf solchen Kontakte zumeist freiwillig verzichtete. Das sind übliche Maßnahmen der Justizwache und Vollzugsbehörden gegen Häftlinge, die sich über Missstände Beschwerden und erst recht, wenn sie solchen Aktionen der Aufmerksamkeit gesetzt haben, wie ich am Kirchendach in Garsten“. „Leicht haben Sie es nicht gehabt!“ „Da hast Du recht, aber ich bin davon überzeugt, das richtige zu tun. Ich war ein Heimkind und war auch in Jugendgefängnisse, wie ich dir schon sagte. Was da abgeht, kann sich kein normaler Mensch vorstellen. Ich habe mir einen Lebenssinn gegeben nunmehr aufzuzeigen und nicht immer runterzuschlucken und zu Schweigen, geprägt von meiner eigenen schlechten Erfahrungen in den Heimen und Jugendgefängnisse. Wenn man schweigt, dann wird es nur noch Schlimmer. Der Staat hat das recht uns einzusperren. Das ist keine Frage. Aber es gibt Gesetze und danach muss sich auch der Staat halten. Sie muss uns sogar lernen, die Gesetze einzuhalten, anstatt sich selbst nicht daran zu halten. Sie hat nicht das Recht uns Gefangene willkürlich und wie Tiere, besser gesagt ärger als Tiere zu behandeln“. „Da gebe ich Ihnen recht. Aber mit der Protestaktion auf den Kirchendach haben Sie ganz schön aufgewirbelt! Ich kann mich erinnern, dass danach sehr viele negative Berichte über den Strafvollzug erschienen sind. Hat Ihnen das nicht genügt?“. „Ja, da hast Du recht. Es war schlechthin der Beginn der Berichterstattung über den Strafvollzug in Österreich, denn bis dahin war es nur ein Tabuthema. Aber mittlerweile hat die Justizwache das ausgeschlafen und nun wird es wieder zunehmend menschenverachtender und brutaler in dem Gefängnisse. Deswegen ist es notwendig, das man regelmäßig darauf aufmerksam macht und…“ „Ach, schauen Sie. Dort ist ein Haus“, unterbrach Sie mich plötzlich. Wir näherten uns offenbar einen auf den asphaltierten Waldweg angrenzenden Bauernhof. Eine Frau und ein Mann standen im Hof. „Fragen wir sie um ein Glas kühles Wasser, Ina. Denn das Wasser, das ich noch in der Flasche habe ist schon lauwarm und schmeckt komisch“. „Ja, fragen wir sie. Mittlerweile habe ich auch Durst bekommen“. Am Bauernhaus angekommen, grüßten wir freundlich und baten um ein Glas Wasser, was uns freundlich gewehrt wurde. Ebenso freundlich bedankten wir uns und gingen weiter. „Sie haben sicher geglaubt, dass wir ein Paar sind“, scherzte ich. „Ja, das glaube ich auch“, erwiderte sie und lächelte. „Du bist jetzt viel schöner, Ina“, machte ich ihr wieder ein Kompliment. „Ich fühle mich jetzt auch sehr wohl. Neben einen starken Mann und Rebell“. „Oh, danke für das Retourkompliment. Du bist ein bewunderungswerte Frau“. Mittlerweile war es schon gegen fünf Uhr Nachmittag geworden. Wir schauten auf der Straßenkarte wieder nach. Wir schätzten in zirka eine Stunde an der Grenze anzukommen und marschierten weiter. „Ina, aber so kann es nicht weiter gehen mit deinen Mann. Untern selben Dach aneinander vorbei-zu-leben muss ein Horror sein“, sprach ich sie auf ihre Familie wieder an. Es ging mir nicht aus dem Kopf, wie Dumm ihr Mann sein muss. „Ja, so ist es auch. Wir haben aber fünf Kinder. Schon allein wegen der Kinder kann ich mich nicht scheiden lassen“. „Also, das ist schon ein Wahnsinn. Und was sagen die Kinder dazu?“ „Ach, die Kinder merken nichts davon. Wir spielen ihnen Harmonie vor. Es wäre fürchterlich, wenn auch die Kinder darunter leiden würden“. „Ja, natürlich. Da hast Du recht. Andererseits bleibst aber Du über. Ich mache dir einen Vorschlag…“ „Vorschlag! Was für ein Vorschlag?“ „Heirate mich“ Sie lachte lautstark auf und erwiderte, „Sie sind verrückt“. „Wenn Du lachst, dann bist Du viel schöner. “ „Sie sind aber einer!“ „Ich mache aus dir eine Ganovenbraut und wir ziehen durchs Land, wie Bonnie und Clyde“. Sie lachte wieder auf. „Als Kind habe ich immer gerne Märchen- und Abenteuerromane gelesen. Manchmal träumte ich sogar mit dabei zu sein. Oft fürchtete ich mich zu Tode, gleichzeitig war ich aber auch immer fasziniert“. „Ja, jetzt bist Du sogar mittendrin mit einen, der gemein zu dir war“ „Ja, anfangs hatte ich wirklich fürchterliche Angst, dass Sie mich sogar töten wollen. Sie waren dann aber sehr nett zu mir. Ich habe mitbekommen, wie Sie sich bemüht haben mir die Angst zu nehmen und da wusste ich, das Sie Anfangs nicht anders vorgehen konnten und das Sie im Grunde kein schlechter Mensch sind, denn ein gemeiner Bandit hätte keine Rücksicht genommen“. „Ich danke dir, Ina, dass Du mich so siehst. Es ist so, wie Du es siehst. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid, dir das angetan zu haben. Ich habe zwar Überfälle begangen und dabei einen Postbeamten angeschossen, der bedauerlicherweise Tage später im Krankenhaus verstarb, aber Frauen und Kinder habe ich nie was angetan. Bei dir handelte ich wie ein gehetztes Tier, das in Panik geriet. Es tut mir jetzt wahnsinnig leid. Gib mir die Hand!“. Sie schaute mich überrascht an. Ich nahm ihre Hand, „Ich muss dich spüren. Es ist schön dich zu berühren“. Hand in Hand gingen wir nun schweigend weiter. Die Berührung ihrer Hand tat mir unglaublich wohl. Kurz darauf bog der Weg auf den wir gingen in eine der Staatsgrenze entgegengesetzte Richtung. Momentan wussten wir nicht, was wir tun sollten. Gingen wir den Weg weiter entlang, würden wir uns von der Grenze entfernen. So beschlossen wir den Weg zu verlassen und uns durch die Weglosen Waldlichtungen weiter Richtung Grenze bewegen. Der lichte Wald war voller Unebenheiten und schwierig zu begehen, weil es viele Löcher gab und gelegentlich steil auf und ab ging. Nach einer Stunde schauten wir uns um, ob die Grenze schon zu sehen wäre. Wir hatten beide aber keine Ahnung, wie die Grenze aussehen könnte oder ob diese durch Markierungen zu erkennen sein würde. Wir marschierten weiter los. Nach ungefähr eine halbe Stunde, kamen wir bei einen kleinen Bach an. Ich fühlte meine Plastikflasche mit frischem Wasser. „Schauen Sie bitte ein wenig weg. Ich möchte mich ein bisschen waschen“, bat sie mich. „Ja, natürlich. Warte ein Moment. Ich habe im Rucksack auch Seife, wenn du brauchst“. „Ja, das ist gut“. „Willst auch eine Unterhose und Leibchen. Die habe ich in Gartenhäuser gestohlen. Sie sind rein“. Sie lachte. „Gut, geben Sie mir eine Unterhose. Jetzt bin ich eine Diebin und Komplizin!“ Ich reichte ihr die Sachen und das Handtuch, das sie zuvor verwendet hatte, entfernte mich etwas und nahm Platz neben einen Baum. Ich fühlte mich sicher, dass Sie nicht wegrennen würde, obwohl ich mir diese Sicherheit nicht so ganz erklären konnte. Ich schlüpfte aus meinen Sportschuhen und Socken, um meine brennenden Füße eine Pause zu geben und streckte mich strapaziert hin. Ich fühlte mich total gerädert. Plötzlich, einfach aus dem nichts sah ich vor meinen geistigen Aug einen Schwarzen Ritter im schnellen Galopp über ein Feld reiten, der im Sattel eine entführte Dame mitschleppte. Ich konnte es nicht fassen, aber das Gesicht des Ritters war die meine. Ich sah mich selbst. Wahnsinn dachte ich mir, fast erstarrt vor Überraschung und Unglauben. Was ist das. Warum habe ich so eine geistige Erscheinung. Halluziniere ich schon, fragte ich mich! Ist das mir wirklich passiert! Mitten in einen Märchen geraten zu sein! Jetzt verloren wir uns auch in Leidenschaft. Gott, wie ist das möglich! Ich war Fassungslos. Andererseits ließ mir die unglaublich Entwicklung der Kaperung der Frau bis zur Ausbruch der Leidenschaft wahrlich an ein Märchen glauben. Sie kam barfuß vom Bach zurück, die Turnschuhe in der Hand tragend. Ich schaute sie fragend an, obwohl ich mir schon dachte, dass auch ihr die Füße weh tun würden. „Die Freizeitschuhe sind ein bisschen verschwitzt. Ich lüfte es ein wenig“, antwortete sie meinen fragenden Blicke. „Setzt dich hin“, forderte ich sie auf. Als sie es tat, nahm ich trotzdem ihren beiden Füßen auf meinen Schoss und massierte sie behutsam. „Ach, tut das gut“, stöhnte sie erleichtert auf. Sie schaute auf meine Füße und sagte erschreckt, „Ihre Füße sind aber stark entzündet“. „Ja, ich weiß. Ich bin seit einer Woche unterwegs, teils mit nassen Turnschuhen. Das brennt und tut ganz schön weh. Ich gehe mich jetzt auch waschen. Hilfst mir und wäscht mir bitte den Rücken?“ Ich zog mich nackt aus und während ich mir die Füße und Vorderkörper wusch, wusch sie mir den Rücken. Dabei empfand ich ihre Berührung so erotisch, dass ich wieder eine Erektion bekam. Sie lachte, „Sie können nicht genug bekommen“. „Du bist schuld, weil Du so schön bist“. Ich packte sie bei der Hand und führte sie zu meiner Erregung... sie wurde Blutrot, während ich ihr Hintern streichelte. „Nein, nicht jetzt. Da kann jemand daherkommen. Wir müssen weiter“. Im Rucksack hatte ich noch zwei Konservendosen, aber kein Brot. Ich bot ihr eine Dose an, aber sie wollte nicht. Wir rasteten noch ein paar Minuten und marschierten dann durch den Wald weiter. Mittlerweile war es beinahe schon neunzehn Uhr. Am Himmel machte sich allmählich schon die Abenddämmerung bemerkbar. „Wir müssten eigentlich schon unmittelbar da sein, Ina. Wir müssen jetzt leise sein, denn es gibt vielleicht Zollgrenzpatrouillen im Wald und die könnten uns hören“, sagte ich zu ihr. „Ich weiß nicht. Ich sehe nichts. Vielleicht sind wir schon in Jugoslawien“, bemerkte sie. „Nein, Ina, das kann ich mir nicht vorstellen. Da hätten wir schon was bemerken müssen durch irgendwelchen Markierungen oder Hinweistafeln“. Langsam, fast schleichend bewegten wir uns durch den Wald Hügelauf weiter fort. Im glauben, dass wir schon unmittelbar an der Grenze wären. Als wir eine größere Lichtung erreichten, sahen wir die die Höhe des Waldhügels erreicht zu haben und konnten weit um uns herum sehen. Das Panorama, die sich uns bot konnte nicht schöner und bezaubernder sein. Man sah in der Ferne durch das rosarote Licht des Sonnenuntergangs die Silhouetten von Hügeln und die Bergmassiven die Karawanken. Gleichzeitig besorgte uns, dass wir plötzlich gar nicht mehr wussten, wo es lang ging, insbesondere wo die Staatsgrenze war. In der Ferne sahen wir nur eine befahrene Landstraße sowie ein paar beleuchteten Häuser, offenbar ein Ort. Wir schauten nochmals auf der Straßenkarte nach, wurden aber nicht schlauer. Es blieb uns nichts anderes übrig als nun bergab zu gehen. Das taten wir auch. Bergab zu gehen taten wir uns sichtlich leichter und schneller. Nach zirka eine halbe Stunde, mittlerweile wurde es immer dunkler, schnitt vor uns eine Landstraße den Wald. Wir gingen geradezu drauflos und überquerten es. Anhand der Autotafeln vorbeifahrender PKWs konnten wir, entgegen ihrer Befürchtung erkennen noch in Österreich zu sein. Wir näherten uns ein bewohnter Ort. Die Lichter in den Häusern waren schon aufgedreht. Auf eine der Ortstafel lasen wir Sankt Martin, wobei es auch nur eine Hinweistafel "nach“ Sankt Martin gewesen sein konnte, da es schon dunkelte und nicht genau zu erkennen war. Gleich eingangs des Ortes, auf ca. 50 Meter Entfernung, glaubte ich eine Telefonkabine zu erkennen. Spontan sagte ich zu ihr, „Ina, willst Zuhause anrufen. Dein Mann und die Kinder werden sich schon sorgen machen!“ „Nein, das sage ich ihnen persönlich, wenn ich Zuhause bin“. „Na gut, wie Du meinst. Aber durch den Ort gehe ich nicht. Wir könnten als Fremde von der Gendarmerie kontrolliert werden. In so einem kleinen Ort und zu so einer Zeit ist es oft üblich so. Das weiß ich von der Entweichungen aus dem Heime her“. „Ja, gut, aber was machen wir jetzt!“ „Zuvor habe ich eine Bahngleise Richtung Grenze gesehen. Schauen wir nochmals auf der Straßenkarte nach“, antwortete ich ihr. Mittlerweile war es fast dunkel geworden. Ich hatte ein Feuerzeug mit, sodass wir halbwegs nachsehen konnten. Tatsächlich entdeckten wir auf der Karte eine Bahngleise, die direkt zur Grenze führte. „Wenn wir diese entlanggehen, können wir die Grenze nicht mehr verpassen und müssten eigentlich dann bald da sein. Für dich ist es aber dann zu dunkel“, gab ich ihr zu verstehen. „Ach, machen Sie sich um mich keine sorgen. Entgegen zu ihnen, kann ich dann bei jedem Haus anklopfen oder jede Person ansprechen. Schauen Sie auf sich, dass sie über die Grenze kommen“. Ihre Stimme klang plötzlich streng und etwas ärgerlich. Ich war überrascht. „Es tut mir leid, Ina. Ich habe noch nie zuvor eine Staatsgrenze schwarz überschritten. Dumm, aber da kenne ich mich leider wenig aus…“, versuchte ich mich zu entschuldigen, „…wenn Du willst, dann kannst Du da bleiben und geht’s dann ins Dorf, aber dann habe ich kaum eine Chance, denn bei der Dunkelheit komme ich nicht weit weg“. „Ich habe Ihnen versprochen, dass ich Sie zur Grenze fahre und jetzt begleite ich Sie bis dorthin. Ich denke nur, was ich dann meinen Mann sagen sollte“, sorgte sie sich plötzlich. „Du brauchst ja nur zu sagen, dass Du in dieser Situation keine Chance hattest, weil der Täter bewaffnet war und dich ständig bedrohte“, versuchte ich sie zu beruhigen. Wir erreichten die Bahngleise und marschierten entlang. Mich brannten die Füße wie Feuer, jedenfalls war es aber viel Angenehmer auf den Bahngleisen zu marschieren, als durch holprigen Felder und Wälder. Wir kamen jetzt schneller voran. Nach zirka eine halbe Stunde marsch standen wir plötzlich vor einer Bahntunnel. Links und rechts ging es nur Bergauf. Es blieb uns nichts anderes übrig, als durch den Tunnel zu gehen. Wir drangen in den Stockdunkel Bahntunnel hinein. Ich machte Licht mit dem Feuerzeug, aber es war nur die Gleise schemenhaft zu erkennen. „Ich habe fürchterliche Angst“, sagte sie plötzlich mit zittriger Stimme (08./3 unten). „Gib mir die Hand. Ina! Brauchst keine Angst zu haben. Wenn ein Zug kommt, legen wir uns hin und drücken uns am Boden gegen die Tunnelmauer, so kann nichts passieren“, beruhigte und tröstete sie. Hand in Hand gingen wir weiter. Der Tunnel schien endlos zu sein. Es war Stockdunkel und wir tatsteten uns Schritt auf Schritt voran. Dann endlich sahen wir das Tunnelende durch das Nachtlicht des Mondes. Als wir die Bahntunnel verließen, merkten wir, dass die Gleisen durch den Wald schnitten. Da wir befürchteten, dass jeden Moment ein Zug daherkommen könnte, drangen wir in den Wald. Im Wald wiederum war es Stockdunkel und undenkbar weiterzugehen. Wir gingen wieder zur Bahngleis zurück und tappten uns nebenher weiter vorwärts. Dann endlich lichtete sich der Wald etwas auf, sodass wir weiter weg von den Gleisen gehen konnten. Der Boden war aber nass und löchrig und holprig, so dass wir öfters stolperten. Zwei-dreimal fiel sie hin, schrie leicht auf, meinte aber sich nicht verletzt zu haben. Dann sahen wir ein, dass bei dieser Dunkelheit weiterzugehen nicht mehr möglich war. Im Wald suchten wir uns eine halbwegs trockene Stelle aus, indem wir mit der Hand durch den Boden tasteten. Ich legte ein paar Bekleidungsstücke auf den Boden hin, die ich im Rucksack an Diebesgut mitführte und sie streckte sich hin. Schon zuvor hatte ich ihr ein Pullover gegeben, weil es zunehmend kälter wurde, da sie nur mit einer Bluse unterwegs war. Ich breitete über sie nun zusätzlich meine Sportjacke, die ich in Wochenendhäuser ebenso gestohlen hatte. „Und wo legen Sie sich hin?“ „Ach, nicht so wichtig. Ich lege meinen Kopf auf deinen Bauch, so ist mir auch dann warm“. Ich streckte mich nun auch auf den Boden hin und legte meinen Kopf auf ihren Bauch und während ich das tat, fragte sie schon wieder besorgt, „Was soll ich meinen Mann sagen“. „Sag ihn die Wahrheit, dass du von einem Verbrecher entführt worden bist und keine Chance hattest zu fliehen. Was willst du ansonsten sagen!“, antwortete ich ihr mit betonter Stimme. „Das ist aber nicht wahr. Ich hätte schon fliehen können. Allein schon als ich mich auf den Bach gewaschen habe, weil sie ziemlich weit weg waren“. „Das darfst Du nicht sagen. Ich wäre dir nachgerannt. Du hättest keine Chance gehabt. Mach dir keine Sorgen“. „Nein, das stimmt nicht. Ich weiß, dass Sie kaum rennen können. Am wenigsten im Wald. Ihre Füße sind Wund und Sie hätten mich nicht lange verfolgen können. Ich bin es gewohnt am Feld zu arbeiten und habe eine gute Kondition“. „Ina, was machst du dir da für Gedanken! du konntest einfach nicht fliehen, weil du Angst hattest. Über anderes darfst du dir überhaupt keine Gedanken machen“, antwortete ich ihr mit gehobener stimme. Zunehmend wurde mir klar, dass sie sich Sorgen zu machen begann einen Schritt zu weit gegangen zu sein und dass sie nun über die Konsequenzen nachgrübelte. „Nein, ich habe keine Angst mehr vor ihnen. Ich weiß jetzt, dass Sie mir nichts mehr antun wollen. Ich habe nur Angst, was ich meinen Mann sagen soll und mache mir nur sorgen, was er dazu sagen wird“. Sie machte mich nervös, weil ich wusste, dass sie recht hatte. Sie hätte schon mehrmals flüchten können, wenn sie nur gewollt hätte. Sie machte sich berechtigte Sorgen. „Ina, bitte. Was will dein Mann schon dazu sagen! Es ist ganz einfach. Du sagst deinen Mann, so wie es eben war. Ich habe dich entführt und Du hattest keine Chance. So einfach ist es. Warum zerbrichst Du dir jetzt den Kopf damit“, sagte ich ärgerlich. „Ja, Sie haben recht“, sagte sie nicht ganz überzeugend. Ich legte meine Hand zwischen ihren Schoss und streichelte sie, um sie von ihren sorgen abzulenken, gleichzeitig erregte mich die Berührung ihrer Wölbung. „Nein, bitte nicht. Ich will nicht jetzt. Ich habe fünf Kinder“. Ich wusste, dass es nur eine Ausrede sein kann, denn vorher hatte sie sich auch nicht darum gekümmert fünf Kinder zu haben. „Nimmst Du die Pille?“, fragte ich sie und wurde mir gleichzeitig bewusst, dass wir zuvor auf das gar nicht gedacht hatten. „Ja, ich nehme die Pille. Trotzdem. Ich will jetzt nicht“. „Ich will nur dein Schoss Küssen. Dich nur mit meinen Lippen berühren. Ich habe so ein verrückten verlangen danach“ und öffnete dabei ihr Jean und zog es sanft herunter. Sie wehrte sich nicht dagegen. Ich küsste ihre Schamhaare und streichelte es mit den Lippen. Ich drängte meinen Kopf zwischen ihren Schenkeln…ihr Schoss und Po dufteten zauberhaft… Als wir uns danach langsam beruhigten, legte ich mich auf die Seite, umarmte sie und legte meinen Kopf auf ihre Brust. Ich spürte und hörte ihren Herzschlag, wie das rattern einer dumpfen Maschinenpistole. „Schauen Sie…“, unterbrach sie die Stille zwischen uns, „…Sehen Sie da oben die Sterne, sie glitzern so schön. Jetzt ist ein wunderschöner freier Himmel und man sieht sie deutlich“. Ich schaute auf. Zwischen den Bäumen waren der Nachthimmel und das Leuchten der Sterne klar und wunderschön zu sehen. „Ja, es ist wunderschön. Schau hin…Siehst die große dort, die so schön leuchtet und glitzert!“ „Ja, ich sehe es“ „Dieser Stern schenke ich dir. Es ist so wunderschön und rein wie Du. Wenn du wieder zuhause bist und du manchmal zum Himmel raufschaust und sie siehst, dann weist du, das meine Gedanken bei dir sind. Dieser Stern wird uns für ewig verbinden, den Du und dieser Moment ist für mich unvergänglich“. Ich spürte plötzlich ihre Hand auf meinen Arm. „Ja, sie ist wunderschön. Danke. Sie sind so nett“. „Ina! Nie in meinen leben zuvor war ich so glücklich, als in diesem Moment mit dir. Du bist eine Göttin. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich glaube, dass es Gottes Fügung war, dass wir jetzt da sind. Es kann kein Zufall sein“, sagte ich zu ihr überwältigt darüber, dass sie mich trotz der dramatischen Situation selbstlos zu helfen versuchte, „Ja, irgendwie haben Sie recht. Glauben Sie an Gott?“ „Ja, ich glaube an Gott. Jetzt erst recht, nachdem ich in deiner Nähe sein kann. Ich weiß nicht, was mir Geschehen ist, aber ich bin so unendlich glücklich und zufrieden, das ich aus diesen Momente nie mehr erwachen will“. „Es ist schön, wie Sie das sagen“. „Ja, aber nur Dank dir. Ich kann es nicht fassen, wie wunderbar Du bist. Was für eine starke und mutige Frau Du bist. Ich bin wie betört von dir. Ich beginne dich zu verehren“. Sie lachte auf, „Nein, Priesterin bin ich nicht“. Auch ich lachte auf. „Nein, Priesterin meinte ich nicht. Ich meinte dich zu verehren wie eine Göttin, denn Du bist es. Es ist göttlich, was Du mir schenkst. Ich fühle mich wie im Himmel“. „Na ja! Sie haben auch schon lange mit keiner Frau mehr geschlafen“. „Ja, da hast Du recht. Trotzdem, in so einer Schönheit und Leidenschaft habe ich es vorher nie erlebt. Mit dir ist es ganz tief und die Gefühle sind unendlich schön. Aber ich meinte nicht nur die körperliche Liebe, sondern auch das du mir in so einer Situation nicht fallen lässt und mir sogar zu entkommen helfen willst “. „Werden Sie wirklich an mich denken, wenn Sie in Uruguay sind!?“ „Wie kannst Du sowas fragen. Wie könnte ich dich vergessen! Immer werde ich an dich denken und an unseren glücklichen Momente. Die Sterne da oben sind unseren Zeugen und diese, die ich dir geschenkt habe. Wo immer ich auch sein werde. Ich werde zum Himmel raufschauen, an dich denken und dich immer vor meinen geistigen Augen sehen. Ich werde dich mein Lebelang in die Sternen sehen und deine Liebe schmerzlich vermissen“. „Sie drücken sich aus wie ein Poet! Schreiben Sie gerne?“ „Poet! Nein, das bin ich bei Gott sicher nicht. Ich sage dir jetzt nur, was ich gerade fühle und es ist schön, dass es dir gefällt, wie ich es ausdrücke. Schreiben tue ich eigentlich schon. Teilweise habe ich schon meinen Memoiren zu schreiben begonnen, aber im Gefängnis gibt es derart vielen Missstände, das ich mich auch darum kümmern muss“. „Sie sind auch ein Kämpfer, nicht wahr!“ „Ja, so kann man es sehen. Mein krimineller Weg, aus den tiefsten Sümpfen Österreichs war bis jetzt ein einziger Kampf ums überleben. Ich kämpfe aber aus Überzeugung“. „Ja, ich habe schon bemerkt, dass Sie aus Überzeugung kämpfen. Zum Teil gebe ich Ihnen auch recht. In Österreich gibt es noch vieles zu verändern und zu verbessern. Da haben Sie recht“. „Legst dich ein bisschen auf den Rücken!“, fragte ich Sie aus spontanem Gefühl heraus ihren Rücken und Gesäß wieder berühren und streicheln zu wollen. Es war wie verrückt, aber sie übte auf mich eine unglaubliche Erotik aus. Ihr Körper und Wesen zog mich magnetisch an und ich konnte mich kaum dagegen wehren. Ihre Bereitschaft zur Hingabe war so natürlich, so erotisch, wie nur eine Göttin der Liebe es sein kann. „Warum?“ „Ich möchte so gerne wieder deinen Rücken und Popo streicheln. Ich kriege nicht genug davon. Jeden Millimeter von dir möchte ich immer wieder berühren und liebkosen und für ewig in den Erinnerungen behalten“. „Sie sind schon erstaulich. Na gut“, stimmte sie diesmal zu und drehte sie sich am Bauch. Durch das Mondlicht, das durch die Baumblätter durchschimmerte, sah ich ihre Konturen nur schemenhaft. Ich berührte sie und ließ meine Hand ganz sanft über ihren Rücken und Popo gleiten. Ich erforschte ihre Rundungen, gleichzeitig überströmte mich immer wieder eine herrliche Wärme. Sie stöhnte. Meine Hand glitt bis zu ihren Hals. Sanft massierte ich minutenlang ihren Nacken und Schulter. Sie stöhnte auf, „Oh, das tut gut. Was Sie nicht alles können!“. „Du bist ja wunderschön. Wärest Du meine Frau, ich würde dich jeden Tag streicheln, massieren und Lieben. Dich immer verwöhnen, wie Du verwöhnt werden möchtest“. Sie lachte, „Das glaube ich Ihnen gerne“. Meine Hand und Finger wanderten zwischen ihren Schenkeln und streichelte zwischen der Spaltung ihres Gesäßes. Die Wölbungen um ihre Scheide waren fast hart und heiß. Meine Finger drückten und drängten in ihr, gleichzeitig küsste ich ihr Gesäß… „Bitte nicht“, hörte ich sie sagen, aber ich wollte nicht hinhören. Ich war wie berauscht. Ich küsste sanft ihre Haare und mein Mund suchte ihr Ohr. „Oh, Du schöne Frau…“, flüsterte ich ihr zärtlich zu, „…Alles an dir ist so schön und so süß. Sei meine Göttin und lasse mich. Ich werde ganz lieb sein und dir nicht weh tun. Es ist so heiß und schön“, während meine Erregung ihr Öffnung suchte und dagegen drückte und stieß… Noch voll außer Atem küsste ich danach ihre Haare und entlang ihren Halses, um ihr meinen Dank und Glück zu zeigen. gleichzeitig entschuldigte ich mich bei ihr, mich gehen gelassen zu haben. „Ja, ich verzeih Ihnen. Sie waren trotzdem sehr Rücksichtsvoll. Ich weiß, dass Sie mir nicht wehtun wollten. Sie haben auch schon lange nicht mehr mit einer Frau geschlafen“. „Danke, Ina. Es ist unglaublich schön mit dir. Ich kann es nicht beschreiben. Alles an dir ist so schön und so reizend. Du hast mich verzaubert. So eine Wärme und Begehrlichkeit für eine Frau habe ich zuvor noch nie gefühlt und erlebt. Es ist mir so, als wäre ich in einen Traum und Rausch der Leidenschaft, so unbeschreiblich stark, schön und heiß“. „Auch ich empfinde es so. Ich verstehe mich auch nicht, dass ich mich so gehen lassen kann und konnte. Ich weiß nur, dass es auch für mich wunderschön ist. So habe ich es noch nie erlebt und konnte auch nicht, weil ich noch nie in so eine Situation war. Einfach verrückt!“. „Die Sterne am Himmel sind unseren Zeugen. So Traumhaft schön war es mit dir. Schau manchmal rauf. Ich werde da sein für dich, wenn Du manchmal unglücklich und traurig bist. Ich werde dich über die Sterne ewig beschützen“. „Sie sind ein Schwärmer, aber es ist schön ihre Worte zu hören. Ja, das kann ich ihnen auch versprechen. Ich werde Sie auch nicht vergessen können. Wie könnte ich auch so ein Erlebnis vergessen! Ich bin mit meinen Mann nicht sehr glücklich, aber ich habe Kinder, sonst…“. Sie hielt plötzlich inne. Ich verstand, dass sie nicht weitersprechen konnte und wollte. „Dich als meine Frau an meiner Seite wäre wunderschön. Schöneres könnte ich auf dieser Welt nicht erwarten. Aber ich hätte nichts, was ich dir anbieten könnte. Kein Haus und kein Geld, außer dich ewig zu lieben und zu begehren“. „Und das andere hätten wir auch geschafft“, sagte sie leise auflachend. „Seit Du mir deine Hingabe geschenkt hast, fühle ich mich nur unendlich glücklich und friedlich an deiner Seite. Es ist bezaubernd und wie in einem Märchenwelt. Ich fühle und spüre das Netz der Leidenschaft voller Wärme und Glück, die Du über mich geworfen hast“. „Oh, wie schön Sie das sagen…“, rief sie fast begeistert, „…auch Sie haben mich glücklich gemacht. Ich konnte schon lange nicht mehr Frau sein. An Anfang hatte ich wirklich fürchterliche Angst vor Ihnen. Sie gingen Hart und konsequent mit mir um. Aber als Sie das Messer weglegten und Sie sich bei mir entschuldigten und mir auch erzählten, was passiert war und warum sie mich überfallen haben, da spürte ich sofort, das Sie mir die Wahrheit sagten und das Sie mir nichts mehr antun wollten“. „Ja, ich war in einer Paniksituation und reagierte wie ein gehetztes Tier. Aber als wir dann die Autobahn erreichten und die unmittelbare Gefahr vorbei war, dann habe ich dich zum ersten Mal so richtig angesehen und mir tat die Angst, die Du hattest unglaublich weh. Und wann hast Du mich als Mann gesehen?“. Sie lachte. „Na ja. Nachdem ich mich sicher fühlte, dass Sie im Grunde kein schlechter Mensch sind, fand ich ihr Mut aus dem Gefängnis geflüchtet zu sein sowie ihre Lebensgeschichte sehr spannend. Da fühlte ich nach langem wieder einen Mann neben mir. Das hat mich an Ihnen, ehrlich gesagt, schon imponiert. Und von diesem Moment an sehnte ich mich nach einer Umarmung“. „Ich bin von deiner Offenheit unglaublich begeistert“, sagte ich voller ernst. „Normalerweise bin ich nicht so offen, selbst mit meinen Mann nicht. Bei Ihnen ist es ganz anders“. „Ja, mir geht es auch so, Ina. Es ist schön, wie offen wir uns unterhalten können. Und was hast Du dir gedacht, als ich dir das erste Mal fragte, ob Du mich lässt? Ich war total verunsichert, wie Du reagieren würdest!“ „Sie sind ja ganz schön neugierig…“, sie hielt kurz inne, “…Ich weiß es nicht. Es kam einfach so raus. Ich hatte Sehnsucht nach einer Umarmung. Ich muss verrückt geworden sein. Danach war ich selbst überrascht, aber auch selbst Neugierig wie Sie darauf reagieren würden. Ich habe schon bemerkt, das Sie ziemlich verunsichert waren“. „Ina! Warum bist Du immer per „Sie“ mit mir. Du kannst mich ruhig duzen, wenn Du willst“. „Es ist aus Gewohnheit. Ich bin so erzogen worden“. „Weißt Du, ich war ziemlich überrascht, als Du zusagtest. Ich dachte, das Du nur aus Angst zugesagt hast oder weil Du mich irgendwie täuschen wolltest“. „Ja, das habe ich bemerkt, dass Sie verlegen und nachdenklich wurden. Das hat mir sogar gefallen. Das war eine kleine Rache von mir“, erwiderte sie und lachte auf und setzte fort, „Und wieso kamen Sie auf die Frage mit mir schlafen zu wollen?“. „Um es dir ehrlich zu sagen. Bis dahin dachte ich überhaupt nicht an Sex. Dazu fühlte ich mich zu gerädert und Müde. Erst als wir über meine Frau sprachen. Da sah ich dich erstmals so richtig an und fand dich sehr schön und reizend. Deine Bluse war nur leicht zugeknöpft und durch das offene Wagenfenster blähte es der Wind manchmal auf. Dabei sah ich teile deiner Hüften und Bauch und mir wurde innerlich heiß…“, und setzte wissend fort, ihr nicht ganz die Wahrheit zu sagen, „…ja, und dann habe ich dir gefragt, ohne wirklich zu überlegen. Mehr spontan heraus“. „Ja, so ging es mir auch, als ich Ihnen antwortete. Ich überlegte nicht. Es kam einfach so aus mir raus“, wiederholte sie. „Ich bin jedenfalls glücklich darüber. Es war wunderschön. Das werde ich nie vergessen. Weißt Du, was ich erlebte, als Du dich auf den Bächlein allein gewaschen hast! “. „Nein, was?“ „Ich hatte eine Halluzination, ich sei so etwas wie ein schwarzer Ritter, der eine gehobene Dame entführt und sie im Wald verschleppt und verführt“, vermied aber zu erwähnen, dass ich in der Erscheinung mein eigenes Gesicht gesehen habe, um nicht überheblich zu wirken. Sie lachte herzhaft auf. “Ja, so ähnlich kam man es sehen. Ich habe als Mädchen in einen Buch einmal ähnliches gelesen. Ein Rebell und Räuber entführte eine Prinzessin und galoppierte mit ihr in seiner versteckten Waldhütte. Ich hatte damals fürchterliche Angst, war aber dann fasziniert, weil der Räuber sich wie ein Gentleman benahm und sie sich in ihn verliebte“. „Und! Hast Du dich in mich verliebt!“, rief ich ihr Scherzhaft zu. Sie lachte laut auf. „Nein! Sind Sie verrückt!“, scherzte sie zurück. „Und wie ist die Geschichte ausgegangen?“, fragte ich sie neugierig. „Soweit ich mich erinnern kann, ist sie bei ihm geblieben, Er verliebte sich auch in ihr. Er gab sein rebellisches Leben auf und beide lebten bescheiden, aber glücklich auf seinen versteckt im Wald und bekamen viele Kinder“. „Wirklich, ein wunderschönes Ende. Was meinst Du, ich baue auch eine Waldhütte. Bleibst Du dann bei mir“, scherzte ich. Sie lachte, „Nein. Auch wenn ich wollte würde es nicht gehen. Ich habe fünf Kinder“. „Schade…“, scherzte ich weiter, “Ich hätte dir eine Hütte aus Gold und ein Himmelbett aus Seide gebaut und dich jeden Tag auf Händen getragen“. „Ja, das wäre schön, aber sie haben ja kein Geld“, scherzte sie mit mir weiter. „Kannst Du dich erinnern, wie du an Anfang im Wald plötzlich herum gehüpft bist und fröhlich kindisch so richtig frei heraus gesagt hast, “Stellen Sie sich vor, als Kind träumte ich von…“. „Ja, ja“, lachte sie auf. „…In diesem Moment habe ich für dich und deinen Mut eine unglaubliche Bewunderung gefühlt. Da sah ich dich in meinen Gedanken wirklich als eine Prinzessin, nein als eine Königin, besser als eine Göttin an. Und als Du dich dann gelegentlich vor mir gebückt hast, um Grashalmen und Zweige aus dem Waldboden zu reißen, da sah ich so richtig deinen süßen hintern. Im selben Moment spürte ich eine unglaubliche Anziehung und ein feuriges Verlangen nach dir. Vorher habe ich mich nicht getraut dich anzufassen, obwohl du es mir erlaubt hast“. „Aha! Deswegen wollten Sie eine Pause machen, denn da haben Sie ja zugegriffen. Ich habe schon bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Ich spürte schon, dass das kommt“. „Ja“, erwiderte ich ihr, „…ich konnte nicht mehr anders. Irgendwie verlor sich mein Verstand. Ich war nur mehr wie verzaubert und Feuer und Flamme für dich“. „Das habe ich dann eh gespürt. Sie waren ganz schön wild“, lachte sie und Hüpfte auf. Wir trockneten unser verschwitzten Körper, zogen uns an und kuschelten eng aneinander, um uns gegenseitig zu wärmen und um etwas zum Schlafen. Nach der Hitze der Liebe, spürten wir nun die Frische der Nacht. „Haben Sie es bemerkt…“, hörte ich sie noch sagen, während mir die Augen vor Müdigkeit zufielen. „Was bemerkt, Ina?“. „Na ja, wir haben kein Wort über ihrer Flucht gesprochen und auch nicht, wie es morgen weiter gehen sollte“. „Ja, da hast Du recht. Du lässt mir rund herum alles vergessen. Am liebsten wäre es mir, wenn die Zeit stehen bleiben würde und ich ewig so neben dir liegen bleiben könnte“. Sie fasste nach meiner Hand und drückte sie fest. Trotz der Müdigkeit konnte ich nicht gleich einschlafen. Mein Körper war noch voll von Adrenalin der Liebe aufgeputscht. Ich spürte mein Herz noch rasen. Ihre Hand wurde schlaff und ich spürte, dass sie eingeschlummert oder eingeschlafen sein musste. Ich streichelte zärtlich ihre Hand. Von einem Moment auf den anderen kreisten plötzlich fürchterliche Gedanken in meinen Kopf herum. Obwohl ich todmüde war, konnte ich meine Augen nicht zumachen. So plötzlich, wie mir zuvor der galoppierende Ritter erschienen ist, so plötzlich hörte ich meine innere Stimme, die auf mich einsprach und die mich zu einer innerlichen Unterhaltung verführte: "Töte sie“, sagte die Stimme. „Wenn Du sie nicht tötest, dann ist dein Leben endgültig vorbei. Dann gehst Du in die Hölle zurück und bekommst noch zwanzig Jahre dazu“. Und ich antwortete: „Ich will sie aber nicht töten. Sie hat mir nichts getan. Hast Du nicht gesehen, wie gut sie zu mir ist“. Und die Stimme: „Ja, trotzdem, Du musst sie töten, denn auf dich nimmt auch keiner Rücksicht. Denke an die Isolationsjahre, die Du dann in die Hochsicherheitsabteilungen sitzen wirst müssen. Denke an den Schmach deiner Mithäftlinge und der Beamten. Denke an deine Frau und an deine Geschwister und an alle, die dich kennen. Was werden sie dazu sagen! Die werden dich verachten. Du wirst im Gefängnis verrecken. Nie mehr die Freiheit sehen“. „ Ja, ja…“, antwortete ich, „Vielleicht hast Du recht, aber ich will sie nicht töten. Sie kann nichts dafür. Ich habe sie entführt. Ich kämpfe nicht gegen sie“. Und die Stimme: „Du bist ein Trottel. Wie kannst du auf dich selbst verzichten! Bist du verrückt“. Und ich: „Ja, vielleicht bin ich verrückt. Ich werde sie aber nicht töten. Da kannst Du sagen, was du willst. Das ist nicht meine Absicht und Ziel“. Und die Stimme: „Zwinge sie dann zumindest mit dir solange mitzugehen, bis du wirklich in Sicherheit bist. Gib sie nicht vorher frei. Sie mag dich. Ich glaube sogar, sie will noch eine Weile bei dir bleiben. Du gibst ihr was. Nutze es aus. Das ist deine Chance. Merkst du es nicht. Rede mit ihr“. Und ich: „Ja, ja. Lass mich jetzt in Ruhe. Ich will etwas schlafen. Ich bin Müde“. Und die Stimme zum letzten Mal: „Schlaf du Trottel". Mir wurde aber gleich bewusst, dass die innerliche Konversation keine Halluzination war, sondern eine innerliche Auseinandersetzung mit der eigenen Situation und Konsequenzen meines wahnsinnigen handeln, beeinflusst durch Übermüdigkeit und des innerlichen Drucks, der auf mich lastete. Aufdringliche Vogelgeschwitzter wecke uns auf. Es war bereits der Morgengrauen da. Durch den lichten Wald konnten wir in der Ferne Silhouetten der Berge sehen. Leicht darüber ein Hauch von Morgenröte, vermischt mit Wolken und leichter Nebel. „Siehst Du, Ina! Was für ein herrliches Panorama“, rief ich ihr begeistert zu und zeigte mir der Hand gegen Himmel. „Ja, es ist wunderschön“, erwiderte sie und ich spürte ihre Hand auf meinen Arm. „Wie in einen Märchen schön und Du bist meine wunderschöne entführte Dame, die mein Herz glücklich macht“. Sie lächelte. „Sie hätten wirklich ein Poet werden sollen. Wie Sie sich manchmal ausdrücken ist wirklich sehr schön“. „Danke, aber dazu inspirierst nur du mich“. „Das ist schön, dass Sie mir das sagen“. Ich packte die Sachen im Rucksack und wir machten uns im Morgengrauen auf den Weg. Zuvor putzte und frottierte ich ihr fürsorglich ihre Freizeitschuhe, die vom Vortag feucht und verschmutzt waren. Als wir dann eine größere Lichtung erreichten, sahen wir rund herum verstreut mehrere Bauernhäuser und ein weites Ort. Wie schauten auf der Straßenkarte nach. Auf der Lichtung herrschte schon genug Tageslicht. Die Straßenkarte half uns aber nicht viel weiter. Wir hatten keine Ahnung, wo wir uns Gegenwärtig befanden. Ob in Österreich oder in Jugoslawien. Wir beschlossen uns den Ort zu nähern, um auf der Ortstafel nachzusehen. Dabei fiel mir ein dunkler Fleck auf ihre Jeanshose auf. „Dein Jean ist Schmutzig geworden“, sagte ich ihr. „Sie schaute nach. „Ja, es ist aber Blut. Ich muss mich verletzt haben“. „Wo! Lass mal sehen“. „Nein, es ist nicht so wichtig. Schmerzen habe ich keine“. „Lass mir trotzdem nachsehen, denn Du kannst eine Entzündung bekommen“. Ich bückte mich und zog ihr das Jean runter, während sie sich dagegen strebte. Tatsächlich sahen wir, dass sie sich eine Verletzung zugezogen hatte, ähnlich einer Riss- oder Quetschwunde, die aber nicht mehr blutete. „Tut es dir wirklich nicht weh?“ „Nein, überhaupt nicht“. „Wo ist dir das passiert?“, fragte ich sie. „Ich weiß es nicht. Ich glaube nach dem wir die Eisenbahntunnel verlassen haben. Da bin ich ein paar Mal gestolpert und ausgerutscht“. „Ach ja, jetzt kann ich mich erinnern. Ich bin selber ein paar Mal auf den nassen Boden ausgerutscht. Möglicherweise bist Du wo angestoßen. Auf einen spitzen Ast oder Zweig oder an sonst etwas“. Ich nahm aus dem Rucksack ein Pflasterstück, die ich aus den Notkästchen der Garten- und Wochenendhäuser mitgenommen hatte und deckte ihre Wunde damit zu. Dann zog ich meine Hose aus und tauschte es mit den ihren. Es passte, da wir fast dieselbe Statur hatten. Ich hatte zwar eine Reservehose im Rucksack, diese war aber nicht mehr ganz rein. Die Hose, die ich nun anhatte war jedenfalls unbeschädigt und sauberer als ihr nur blutverschmutze Jean. „Es ist sicherer so, Ina. Denn deine Hose ist verschmutz und hat ein Loch. Die Wunde könnte sich entzünden und eitrig werden. Tut es wirklich nicht weh beim gehen?“ „Nein, nein, wirklich nicht“. Wir gingen weiter. Ich beobachtete sie, ob sie beim gehen Schmerzen zeigte, aber sie bewegte sich unbeschwert und wie eine Gazelle weiter. Eine in jeder Hinsicht unglaublich starke Frau, ging mir durch den Kopf. Ich bewunderte sie mittlerweile in jeder Hinsicht. Nach mittlerer Marschdauer kamen wir beim Ort St. Michael an, umgingen diese aber. Wir sahen bei der Landkarte wieder nach und stellten fest, dass wir seit gestern mehr oder weniger dem falschen Weg Richtung Grenze gegangen waren. Ebenso, dass wir von St. Paul aus die Strecke bis zur Grenze total falsch eingeschätzt hatten. Auch das es leichtsinnig war quer durch den Wald zu gehen, anstatt am Waldesrand der Landstraße folgend, so dass wir uns danach orientieren hätte können. „Zu so eine frühe Stunde möchte ich nicht in den Ortinneren gehen, Ina. Wir würden auffallen und die Gendarmerie könnte uns als Fremde leicht kontrollieren“. „Was sollen wir dann tun?“, fragte sie. „Gehen wir ein Stück in den Wald zurück und reden wir dort in Ruhe“. Dort setzten wir uns hin und sie schaute mich fragend an. „Die Bahnlinie, die wir gestern gegangen sind, führt tatsächlich zur Staatsgrenze, aber wie wir gerade auf der Straßenkarte gesehen haben, zweigt es hin und her, so dass die Strecken immer länger werden. Schätzungsweise bei sieben bis 10 Kilometer. Die Landstraße zur Grenze ist zwar geraderer, aber gefährlich weil uns die Gendarmerie aufhalten könnte, da sie meinen könnte, das wir Vagabundieren oder weil wir was über die Grenze Schmuggeln wollen. Ich bin ratlos, wenn Du mich fragst. Was meinst du?“. „Ja, aber entlang der Bahnlinie können wir es schaffen. Spätesten in drei, vier Stunden könnten wir Dasein“, meinte sie. „Ja, aber ich habe dir gestern schon versprochen, dass du wieder nach Hause zurückfahren kannst…“, erinnerte ich sie, „Du müsstest schon wieder zu Hause sein!“ „Ja, ich weiß. Machen sie sich keine Sorgen. Und ich habe Ihnen versprochen bis zur Grenze mitzugehen“. „Bleibst Du also bei mir, bis ich es über die Grenze geschafft habe?“ „Ja. Ich helfe Ihnen. Machen wir uns auf den Weg“. „Ina, Du bist ein Wahnsinn. Ich liebe dich…“ „Ach, übertreiben Sie nicht“, erwiderte sie lächelnd. Ich schaute ihr in die Augen. „Wie kann ich übertreiben! Du bist ein Engel für mich. Ich bewundere dich und Du zollst mir viel Respekt ein. Ich danke dir vom Herzen“ „Machen wir uns dann schön langsam auf den Weg, denn ein paar Pausen werden wir dazwischen auch machen müssen “. „Ja, Du hast recht. Tut dir die Wunde doch nicht weh?“, fragte ich ihr „Nein, nein. Das geht schon in Ordnung“. „Du bist unglaublich Tapfer. Ich habe so eine Frau wie dich noch nie in meinen Leben getroffen. Hattest Du eine glückliche Kindheit?“, fragte ich sie, während wir uns weiter auf den Weg machten. „Na ja, wie man es nimmt. Meine Eltern waren gut, aber was Regeln betraf, da waren sie sehr streng“. „Also, ich habe in Uruguay eine wunderschöne Kindheit gehabt in voller Freiheit und inmitten der Natur“. „Wo haben Sie dort gelebt und wie ist das Klima dort?“. „Gelebt haben wir vorwiegend am Land, ähnlich einer endlosen Steppenlandschaft nahe dem Meer. Das Klima ist dort subtropisch. Wegen der Nähe zum Äquator Es gibt kein Schneefall in Uruguay. Es regnet nur. Und es ist, bis auf die Regenzeit zwischen Juni und September, relativ immer warm“. „Ja, ich kann mir vorstellen, dass es schön gewesen sein muss. Und sind Sie auch in die Schule gegangen?“. „Ja, aber nicht immer. Der Schulbus war oft kaputt oder der Fahrer krank. Ich habe nur drei Volksschulklassen absolviert. Es ist nicht so, wie in Österreich. Heute geht es Uruguay besser, aber vor Jahrzehnte war es noch Arm. Zu Hause hatten wir kein elektrisches Licht, auch kein Fließwasser, kein Radio, kein Fernsehen, das gab alles nicht. Trotzdem sind wir glücklich aufgewachsen“. „Unglaublich, wenn ich Ihnen zuhöre“. „Und! Ist dir finanziell und materiell gut gegangen als Kind. Hattest Du alles, was Du brauchtest, und wie hast Du die Schule absolviert“. „Ich kann mich nicht Beschwerden. Als Kind vermisste ich nichts. Unsere Familie war und ist gutsituiert. Die Schule habe ich auch sehr gut geschafft. Und trotzdem, so glücklich, wie die ihre, so wie Sie sich begeistert darüber äußern, war meine Kindheit nicht, aber auch nicht unglücklich muss ich sagen“. Unser Weg führte zwanzig, dreißig Meter neben der Bahnlinie. Ich nahm die Wasserflasche aus dem Rucksack und bot es ihr an. Sie machte einen Schluck, spuckte es aber gleich wieder aus. Das Wasser schmeckte warm und schwer. Auch ich spuckte es aus. Ein paar hundert Meter vor uns waren schon ein paar Bauernhäuser zu sehen, offensichtlich ein kleines Bauerndorf beim Jauntal, wie aus der Landkarte zu sehen. „Ina. Gehen wir hin. Die Bauern geben uns sicher Wasser. Ich habe noch siebzig Schilling, die du mir gegeben hast. Vielleicht verkaufen sie uns auch Brot und etwas zum Essen“. „Ja, probieren wir es“. Ich bückte mich, nahm etwas feuchte Erde in der Hand und rieb es auf den Fleck in der Jeanshose. Der Fleck war damit nicht mehr als Blutfleck zu erkennen. „Aber wenn wir beim Bauernhof sind…“ erklärte ich ihr, „…und sie stellen Fragen, dann erzähle ich ihnen, dass wir mit dem Moped unterwegs waren, dass wir ausgerutscht sind und dass der Moped nicht mehr geht. Was meinst Du“. „Ja, das geht, so kann man es sagen“. Wir kamen beim Bauernhaus an und sahen eine Frau und ein Mann bei einem Holztisch im Hof sitzend. Wir gingen zu ihnen hin (08./5). „Guten Morgen“, grüßten wir sie und sie grüßten freundlich zurück. „Wir haben eine bitte. Haben sie ein Glas Wasser für uns“. „Ja, natürlich. Nehmen sie ruhig Platz“, lud uns der Bauer ein, während sich die Bäuerin entfernte, um uns Wasser zu holen. „Wir danken Ihnen. Wissen Sie, wir sind mit dem Moped unterwegs und diese hat plötzlich den Geist aufgegeben. Wir sind jetzt zu Fuß unterwegs und haben noch eine Strecke vor uns. Aber die Landschaft ist so wunderschön, das wir es als eine Wanderung erleben. Es ist eine wunderschöne Gegend bei Euch“. „Ja, da haben Sie recht. Bei uns ist es wirklich schön“, erwiderte der Bauer. Die Bäuerin brachte uns zwei Große Gläser Wasser und wir bedanken uns. Ich nahm das Geld aus der Tasche. „Haben Sie bitte vielleicht ein Stück Brot und Speck. Wir bezahlen dafür. Wir haben nämlich seit gestern nachmittags nichts mehr gegessen? Meine Frau hat schon Hunger“, fragte ich die Bäuerin. „Gerne, aber bezahlen braucht ihr nicht“, antwortete die Bäuerin. Sie entfernte sich wieder und kam kurz darauf mit einem großen Stück Bauernspeck und ein halben Laib Brot zurück. „Wir bezahlen aber gerne dafür“, wiederholte ich. „Nein, nein“, bestanden die Bäuerin und der Bauer gleichzeitig. „Also, wir können uns für die Gastfreundschaft nur herzlichst bedanken. Ich verspreche es nicht, aber vielleicht kommen wir eines Tages mit einer Flasche Wein vorbei und revanchieren uns“. „Da sage ich nicht nein“, erwiderte der Bauer lächelnd, während die Bäuerin ihn vorwurfsvoll ansah. Man sah schon an ihren robusten Körper, dass offensichtlich sie die Hose anhatte. „Kann ich mir irgendwo die Hände waschen, bitte“, fragte plötzlich Ina die Bäuerin. „Ja, kommen sie mit“ und führte sie ins Haus. Ich hatte komischerweise wenig bedenken, nur ein mulmiges Gefühl, weil sie mir vorher nichts gesagt hatte. „Auch die frische Luft ist herrlich bei Euch“, sprach ich den Bauer an, nur um nicht unhöflich zu wirken und schweigend dazusitzen, aber auch um meine mulmiges Gefühl zu übertauchen. „Ja, bei uns ist wirklich guter Boden und guter Luft“. „Man kann Sie und ihre Frau nur beneiden in so eine Idylle zu leben“, lobte ich den Bauer. „Ja, wir sind sehr froh“. Als Ina und die Bäuerin Minuten später zurückkamen, verabschiedeten wir uns Herzlichts und dankend. Als wir dann außer Hörweite waren, zwickte sie mich heftig auf den Oberarm und sagte Lautstark: „Sie sind ganz schön frech, mich als ihre Frau vorzustellen. Und wissen Sie was, ich hätte beinahe losgebrüllt vor Lachen. Sie hätten mich zumindest vorher warnen können, mich als ihre Frau vorzustellen. Woher haben Sie diese Kaltschnäuzigkeit gelernt. Sie haben die Leute von oben bis unten angelogen. Dabei waren sie total nett zu uns.“. Ich lachte. „Was hätte ich sagen sollen! Das ich dich entführt und in den Wald verschleppt habe! Dass ich ein böser Wolf bin! Du hast mich auch überrascht, als Du mit der Bäuerin gegangen bist. Ich habe minutenlang gezittert “, entgegnete ich ihr lächelnd. „Sie sind verrückt. Das ist was anderes. Ich musste dringend auf die Toilette und genierte mich es vor den Bauer zu sagen. Deswegen sagte ich nur, dass ich mir die Hände waschen will. Und als wir drinnen waren, da bat ich sie aufs WC gehen zu dürfen. Sie sind sehr nette Leute“. „Bist Du jetzt auf mich Böse...“, scherzte ich weiter, „Ich liebe dich, was wäre schöner, als wenn Du meine Frau wärest“. „Sie sind verrückt! Ich habe recht!“ und lachte. Da wurde mir erstmals so richtig bewusst, dass wir uns auf wunderbarerweise necken konnten. Ich schüttelte nur den Kopf und konnte es nicht glauben, was zwischen uns geschah. „Ina, bitte, setzen wir uns ein bisschen hin und Essen wir ein bisschen Speck und Brot. Mich plagt ein Mordshunger. Am liebsten hätte ich schon beim Bauernhaus zugebissen, aber ich wollte nicht auffallen“. „Ja, machen wir!“, stimmte sie gleich zu. Auf einer Lichtung, rund herum gedeckt von Bäumen setzten wir uns hin und aßen. Zuvor zogen wir uns die Turnschuhe aus, um unsere Füße frische zu verschaffen. Gleich neben der Lichtung war ein Bachbett, wo wir uns wuschen. Wir wuschen gleichzeitig die Schmutzwäsche, die ich im Rucksack mitführte, durchknetete und breitete es zum Teil auf Ästen und auf Grasflächen aus. Mittlerweile strahlte die Sonne heiß herunter, so dass wir wussten, dass die Wäsche in Kürze wieder trocknen sein würde. „Weißt Du, was mir Sorgen macht, Ina“. „Nein, was meinen Sie“. „Wie soll ich bei totalem Tageslicht über die Grenze kommen! Die Grenzbeamten könnten mich sehen. Ich müsste wenn wir die Grenze erreichen, die Abenddämmerung abwarten. Das würde Stunden dauern. Und wenn Du sogleich gehst, sobald wir die Grenze erreichen, wo wartest Du dann die Stunden ab. Gehst Du aber gleich zur Polizei, dann kann ich gleich mit dir zur Polizei gehen“. „Ja, da haben Sie recht. Ich bleibe bei Ihnen bis Sie die Grenze überschritten haben. Das habe ich Ihnen schon versprochen“. „Danke Ina“. Dabei wurde mir wieder einmal klar, wie planlos und verunsichert ich war, wie ich überhaupt weiterkommen sollte. „Ich mache mir nur sorgen, was ich meinen Mann sagen sollte“. „Warum? Das brauchst Du nicht! Was kannst Du dafür! Ich habe dich entführt und Du konntest dich nicht wehren. Warum machst Du dir solchen Sorgen!“ „Sie wissen genau, dass das nicht stimmt. Ich hätte durchaus schon mehrmals flüchten können, zuletzt sogar auch am Bauernhof“. „So darfst Du nicht denken. Das darfst Du nie sagen. Denke an deinen Mann und an deine Kinder. Du würdest dich, deinen Mann und die Kinder in Verruf bringen, wenn Du nur ein Wort davon sagst“. „Ja gut, aber das wir miteinander geschlafen haben, das sagen wir nicht“. „Auf mich brauchst Du keine Rücksicht zu nehmen. Allein für die Entführung bekomme ich im Falle, dass sie mich lebend erwischen zwanzig Jahre Haftstrafe dazu. Eine höhere zeitliche Strafe gibt es nicht. Daher ist grundsätzlich egal, ob ich jetzt das eine oder das andere Delikt auf mich dazu nehme. Ich an deiner Stelle würde unbedingt sagen, dass Du von mir vergewaltigst wurdest“, erklärte ich ihr in der Überzeugung mit den ersten Straftaten auf den Waldweg bei Gratkorn tatsächlich eine Entführung begangen zu haben. In Wirklichkeit waren es gefährliche Drohung und Nötigung, § 106, 107 StGB. „Nein, nein. Das kann ich nicht sagen. Das stimmt nicht“, betonte sie protestierend. „Das Problem Ina ist, das dir die Polizei und das Gericht dann vielleicht nicht glauben. Immerhin bin ich schon 11 Jahre im Gefängnis, ohne mit einer Frau geschlafen zu haben. Wenn Du sagst, das da gar nichts war, kommst du vielleicht in Verdacht“. „Sie haben mich aber nicht vergewaltigt. Warum soll ein Verdacht aufkommen, wenn wir beide sagen, dass wir miteinander nichts hatten. Ich will nicht, dass mein Mann das erfährt, weil das redet sich dann in der ganzen Stadt und Gemeinde herum“ „Ja, natürlich nicht, das verstehe ich. Stell dir aber vor, was dann los ist, wenn sie dich amtsärztlich untersuchen, was üblich ist bei ein Entführungs- oder Vergewaltigungsopfer und der Arzt stellt dann fest, dass Du mit mir doch Sex hattest. Soweit ich weiß, ist die Polizei und das Gericht verpflichtet beim Opfer eine amtsärztliche untersuchen vorzunehmen“. „Daran habe ich nicht gedacht. Da haben Sie recht“. Sie lief vor etwaigen Konsequenzen rot an. „Na siehst, Ina. Ich habe Erfahrung mit der Polizei und Gerichte. Schau, du hilfst mir und ich helfe dir. Ich bekomme sowieso zwanzig Jahre wegen der Entführung, falls sie mich lebend erwischen. Mehr kann ich nicht bekommen“. Sie fing zu Weinen an. „Bitte nicht, Ina! Du brauchst nicht zu Weinen. Du bist super und hilfst mir. Sollst Du und deine Familie dafür bestraft werden! Das hast Du dir nicht verdient. Du kannst nichts dafür. Ich bin das Arschloch, verzeih mir den Ausdruck“. „Nein, das sind Sie nicht. Im Gegenteil, sie geben sich für mich auf“. „Du bist meine Göttin. Du hilfst mir ja. Du hast dir nichts vorzuwerfen. Vielleicht habe ich Glück und komme bis Uruguay durch. Und wenn nicht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, das ich bei der Festnahme sowieso einen Kopfschuss bekomme“, letztere hätte ich besser nicht gesagt, denn Sie schlunzte erst recht laut auf. Ich nahm sie in die Arme, drückte sie an meine Brust, legte ihren Kopf auf meinen Schoss und streichelte ihr über die Haare. „Ina, ich weiß. Es ist schwer für dich, aber Du musst an dich und an deine Familie denken. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Ich bin schuld. Ich habe es ausgelöst. Ich bin stark Ina, ich werde es schon schaffen. Um mich mach dir bitte keine Sorgen. Ich habe ein Ziel und eine Aufgabe und wenn das eine Ziel weg ist, habe ich den anderen“. „Was meinen Sie damit?“. „Das Ziel ist Uruguay. Komme ich nicht hin, dann habe ich als Alternative gegen die Justizbehörden wegen der Missstände in den Gefängnissen zu kämpfen. Mir wird sicher nicht fad, so oder so nicht“. Sie weinte weiter, aber nun leiser. Ich hielt sie auf meinen Schoss umarmt und streichelte sie zärtlich weiter. Abrupt hörte ich wieder meine innere Stimme in Streitkonflikt meiner fatalen Situation: "Siehst Du, was Du angerichtet hast, du Trottel. Es ist ein Drama, eine Tragödie. Und wie willst Du es jetzt lösen! Kannst Du es mir erklären? Und ich: „Ich weiß es nicht. Ich habe keine Lösung. Ich bin Ratlos. Ich weiß nur, dass ich ihr sicher nichts mehr antun werde“. Und die Stimme: „Na siehst, du Trottel. Du hast keinen Plan. Das habe ich dir schon gestern gesagt. Du könntest sie töten, ohne ihr weh zu tun oder du zwingst sie mit dir einfach weiter mitzugehen. Alles andere führt dich in die Hölle zurück!“. Und ich: „Sie töten, ohne ihr weh zu tun! Wie stellst Du dir das vor!“. Und die Stimme: „Na ja, sie würde zum Beispiel nichts davon merken und auch keine Schmerzen haben, wenn Du ihr den Nacken mit einen kräftigen Schlag brichst. Sie würde nicht das Geringste spüren und mitbekommen“. Und ich: „Ja, da magst Du recht haben, aber ich werde es trotzdem nicht tun. Ich scheiße auf deine Ratschläge. Weißt Du warum!“. Und die Stimme: „ Warum?“. Ich: „Ganz einfach, ich würde mich bis zu meinen Tod mit diesem schlechten Gewissen plagen und das wäre noch schlimmer, als im Gefängnis zurückzukehren oder mit einen Kopfschuss zu enden. Verschwinde also. Ich will nichts mehr von dir hören. Nie wieder“. Und die Stimme: „Verrecke halt dann, du Trottel". Die Bewegung ihres Kopfes auf meinen Schoss beendete die innerliche Konversation und ich fühlte nur Erleichterung, dass diese endlich beendet war. Die dramatische Situation und die fatalen Folgen für mich zettelten diese innerlichen Konflikt aus. Aber ich fühlte mich stark genug, um mich dagegen zu stemmen und diese abzuwehren – und so war es auch. Sie hatte zum Weinen aufgehört. Nun lag sie leise da. Zärtlich streichelten meine Finger über ihren Mund und über ihre zierliche Nase. Weiter entlang der Wangen bis zu ihre Augenlider. Es war ein Akt der Liebkosung, die mich gleichzeitig erregte. Sie merkte es und schaute zu mir auf. Stöhnend streckte ich meinen Körper auf den Boden und spreizte losgelöst die Hände. Sie fasste meine Erregung durch die Hose und öffnete quälend langsam den Hosenschlitz… Was für eine Frau, schoss mir durch den Kopf! Was für Gefühle! Was für Höhepunkte! Was für eine göttliche Hingabe. „Göttlicher und schöner kann es nicht sein, meine Göttin“, und sah ihr tief in die Augen. Sie setzte sich auf. „Bei Ihnen bin ich sehr überrascht, wie stark sie dabei fühlen und wie oft sie können. Ist das immer so!“ „Nur mit dir. So schön und stark erlebte ich es bis jetzt nur mit dir. Deine warme Ausstrahlung, deine Schönheit und deine Leidenschaft, deine Bereitschaft zur Hingabe und deine Güte haben mich fasziniert und verzaubert. Jetzt bin ich glücklich dich entführt zu haben…“ „Sagen Sie sowas nicht“, sagte sie streng. „… denn wie sonst hätte ich in meinen Leben schöneres erleben können! Ich war unglücklich. Jetzt habe ich Momente der Schönheit und Wildheit der Natur mit dir erlebt, die alles andere ins nichts verdrängt und die meine Welt nun leuchten lässt“. „Oh, wie schön Sie das sagen. Sie sind wirklich ein erstaunlicher Mann“. „Und Du bist eine wunderschöne Frau voller Erotik. Du machst mich so heiß, wie keine andere Frau zuvor. Du riechst so süß und sexy. Und jetzt will ich deine Hölle Küssen, die mich so begehrlich macht“. Ich drückte sie sanft auf den Rücken. „Nein, Nein bitte nicht jetzt. Wir müssen weiter“. Ich zwängte meinen Kopf zwischen ihren Schenkeln… „Oh! Sie sind ein Tier, ein wildes Tier…“, hörte ich sie noch sagen. Nach zirka eineinhalbstunden war die Wäsche wieder trocken. Wir sammelten sie auf und ich staute es im Rucksack. Dann machten wir uns wieder auf den Weg entlang der Bahnlinie, um uns an dieser zu orientieren und bis zur Grenze entlangzugehen. „Wie sind Sie eigentlich zur Überlegung gekommen gegen Missstände im Gefängnis zu rebellieren?“, fragte sie mich plötzlich. „Ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich kommt der Antrieb von den schlechten Erfahrungen in den staatlichen Heime und Jugendgefängnisse her. Der Tod meiner Mutter war eigentlich der erste Anstoß, dass ich das ganze Elend rund herum zu durchschauen begann, als auch wie Wahnsinn sich mein Leben entwickelte hat. Bis dahin war es wie ein Schleier, die sich über mich ausgebreitet hatte und mir kein Einblick gewehrte“. „Warum ihre Mutter?“, fragte sie überrascht und erstaunt. „Ich habe meine Mutter abgöttisch geliebt. Und als sie 1978 verstarb machte ich mir Vorwürfe, weil sie in wissen verstarb, das ihr Sohn ein Verbrecher geworden ist und das er bei einen Überfall sogar ein Mensch erschossen hat. Das hat mir so weh getan, dass ich ihr im Geiste schwor zukünftig was Gutes zu tun, damit sie zumindest im Himmel sieht, das ich kein totaler Unmensch bin…“ „Ich bin sprachlos “, unterbrach sie mich kurz, „Sie sind unglaublich!“. „…dann erinnerte ich mich der Torturen in den Heime und Jugendgefängnisse, die ich am eigenen Leib erdulden musste sowie an das Leid vieler anderen Heimkinder und Häftlinge, die ich mit-ansehen musste. Ja, in diesem Moment wusste ich, welche Aufgabe mir bevorstand…“ „Sie überraschen mich immer wieder von neuen. Ihre Geschichte und wie Sie es sprachlich klar verbildlichen ist unglaublich“, unterbrach sie mich erneut. „Na ja, so dramatisch es nicht. Es hätte viel dramatischer kommen können“. „Wie meinen Sie das!?“, fragte sie mich mit weit offenen fragenden Augen. „Über die RAF in Deutschland wirst Du ja was wissen!“ „Ja, natürlich“ „Mit solchen Aktionen trug ich mich in Gedanken in der Zelle herum. Ich hatte als Strafgefangener natürlich nicht die Möglichkeit so zu agieren, wie die RAF. Aber dafür inspirierte mich die RAF dazu mir den Kopf zu zerbrechen, wie ich andersherum spektakuläre Aktionen setzen könnte. So kam ich unter anderem auf die Idee auf den Kirchendach in Garsten zu klettern und dort zu protestieren“. „Ja, und das ist Ihnen wirklich gelungen, denn die Zeitungen und selbst das ORF waren voll davon“. „Ich habe mir damals schon gedacht, dass vielleicht zwei bis drei Journalisten daherkommen. Aber dass es dann zwischen 25 und 30 wurden und dass die Protestaktion letztendlich so spektakulär verlief, das wagte ich nicht einmal zu träumen. Umso froher war ich dann“. Nachdem wir einige Zeit auf Felder und Wiesen entlang der Bahnlinie gegangen waren, kamen wir auch in der Nähe einer Landstraße, unmittelbar darauf in der Näher von St. Michael, wo am Ortseingang ein kleines Bäckereigeschäft zu sehen war. „Wau…“, rief ich spontan, „Ein paar knusprige Semmeln und Butterkipferln, das wäre was. Habe schon Jahre nicht mehr gegessen“. „Gehen wir hin und kaufen wir welche“, meinte sie. „Ja Super! Um die Zeit ist es nicht mehr so gefährlich wegen der Kontrollen der Gendarmerie“. Wir betraten den Bäckereiladen (08./5). Drinnen waren nur eine mittelältere Verkäuferin und ein etwa neun- oder zehnjähriger Bub. Ich mutete sogleich, dass es sicher Mutter und Sohn sind und dass es sich um ein kleines Familiengeschäft handle. Wir grüßten freundlich und bestellten mehreren Semmeln und Butterkipferln. Dabei sahen wir, dass auch frische warme Milch angeboten wurde. Wir bestellten für jeden ein Glas Milch und aßen dazu die Butterkipferln auf einen kleinen Gasttisch, die im selben Verkaufsraum zur Verfügung stand. Anschließend bezahlte ich von dem Geld, die sie mir im Auto gegeben hatte und wir verabschiedeten uns freundlich. „Oh, war das lecker, Ina! Danke dir. Was meinst Du…“, fragte ich sie, „…sollten wir durch den Ort gehen. So könnten wir uns die Füße ein bisschen vor den holprigen Felder und Waldboden schonen. Um diese Zeit ist es nicht mehr gefährlich. Außerdem habe ich eine Idee“. Ich hatte mir nämlich zwischendurch, insbesondere nachdem sie wiederholt geweint hatte und sie sich Sorgen darüber gemacht hatte, was sie ihren Mann sagen sollte, Gedanken darüber gemacht, was ich tun könnte um ihr allen Sorgen zu nehmen. „Was für Idee?“, fragte sie sogleich Neugierig. „Na ja, dazu bräuchte ich eine Kugelschreiber und Papier und die müssten wir kaufen. Vielleicht finden wir im Ort ein Geschäft“. „Und was wollen Sie damit machen? Sie machen es spannend!“, fragte sie ziemlich neugieriger geworden. „Ich denke eine Selbstanzeige zu schreiben, die Du dann nur bei der Polizei zu übergeben brauchst. So ersparst Du dir viel Ärger. Auch vor deinen Mann“. „Glauben Sie!“, zweifelte sie. „Natürlich. Denn dann fragt die Polizei nicht mehr viel nach, weil durch meine Selbstanzeige sowieso alles gestanden ist“. „Na gut, wie Sie meinen. Gehen wir“. „Warte ein Moment“, sagte ich ihr und nahm das Messer aus dem Rucksack, steckte es mir am Rücken unter der Hose und deckte es durch die Sportjacke ab, die ich in einen Gartenhaus gestohlen hatte. „Was soll das! Was haben Sie vor!“, fragte sie verängstigt geworden. „Mach dir keine Sorgen. Ich möchte nur Vorsichtig sein, denn wenn die Wahrscheinlichkeit auch nicht groß ist, so kann doch sein, dass mich jemand als der Gefängnisausbrecher erkennt. In diesem Falle möchte ich nur eine Abschreckungswaffe bei der Hand haben, um die Person vom Leib zu halten, falls dieser mich festhalten will. Vergiss nicht, dass mein Foto wegen der Fahndung sicher durch viele Zeitungen gegangen ist. Dir kann sicher nichts passieren“. „Dann gehen wir besser nicht durch den Ort“, meinte sie. „Aber dann komme ich nicht zu Papier und Kugelschreiber und kann dann nicht die Selbstanzeige schreiben. Gehen wir, es wird schon nichts passieren“. Im Ortszentrum waren nicht viele Passanten noch viel Autoverkehr unterwegs. Nur vereinzelte Passanten kamen uns entgegen. Wir gingen durch den Ort, als wenn nie was gewesen wäre. Wegen Ina hatte ich kaum mehr Bedenken. Wir waren sicher kein Liebespaar, aber die leidenschaftliche Affäre hatte uns menschlich nahegebracht und voneinander auch abhängig gemacht. Ich kannte das Stockholmer-Syndrom und wusste daher, dass sie sich weiter vorgewagt hat, als das durch das Stockholmer-Syndrom zu rechtfertigen wäre, sodass ich ziemlich sicher war, das sie sich nach der Abmachung halten würde, andernfalls müsste sie befürchten, dass ich sie im Gegenzug verraten könnte sexuelle Handlungen freiwillig und willig gewollt und zugelassen zu haben. Nach durchgehen des Zentrums des Ortes, sahen wir einen Supermarkt und strebten diesen gleich an (08./5). Der Parkplatz davor war ziemlich voll, sodass ich kurz überlegte doch nicht hineinzugehen, aber wo sonst, dachte ich mir hätte ich Kugelschreiben und ein Heft kaufen können. Als wir es doch betraten, war ich im nu wie geblendet. Wenn man elf Jahre im Gefängnis im engsten Raum einer Zelle sitzt und allen möglichen Entbehrungen auf sich nehmen muss, wird man von dem riesigen Warenangebot eines Großgeschäftes geblendet und man kommt sich vor, wie in einen Scharaffenland der Waren und Güter. Zahlreichen Menschen machten darin ihr Einkaufstour. Ich schätzte auf den ersten Blick so dreißig bis 40 Personen, die offenbar aus allen Richtungen in diesem einzukaufen kommen. Ich fühlte mich mulmig, weil ich nur Bedenken und Angst hatte, das mich jemand als eine der kalauer Ausbrecher identifizieren könnte. Ich schaute mich um , ob uns jemand besonders beobachtete. Es schien sich keiner für uns besonders zu interessieren, außer normalen Blicken. Neben Kugelschreiber und ein Schreibheft kauften wir gleich dazu Getränke-flaschen, Semmeln, Wurstsachen und Kuchen, bis nur mehr ein paar Schillingen übrigblieben. „Wo ist die Toilette“, fragte sie der Verkäuferin und Kassiererin und sie wies uns den Weg. Sie blieb relativ lange drinnen, so dass ich doch etwas nervös wurde. Andererseits sah man ihr an, dass sie eine Dame war, die viel auf Körperpflege hielt. Als Frau eines hohen Politikers, überlegte ich, gehörte sie zur gehobenen Klasse. Ich hatte da weniger Hemmungen und ging stets hinter einen Baum auf die kleine oder große Seite oder wusch mich irgendwo in einen Bach oder Fluss, während bei einer gehobenen Dame es nur dann zu erwarten ist, wenn es wirklich nicht anders ging. „Ich habe mich gleich auch ein bisschen gewaschen…“, sagte sie zur Rechtfertigung, „Die anderen Toilettengeher werden sich nicht freuen“, setzte sie lächelnd hinzu. „Warum nicht?“, fragte ich sie neugierig geworden. „Ich habe fast das ganze WC Papier zum trocknen verbraucht, weil kein Handtuch da war“, antwortete sie etwas schadenfreudig lächelnd. Nach Verlassen des Ortes marschierten wir gemäßigten Schritte durch ein wildes Feld, auf der rechten Seite verlief die Landstraße, während auf der linken Seite die Bahnlinie in ein lichtes Wald verschwand. Das Wetter, mittlerweile gegen die Mittagsstunden, war herrlich und sehr warm. Einerseits taten mir die Füße schon wieder ziemlich weh, andererseits dachte ich schon die ganze Zeit an die Selbstanzeige, die ich zu schreiben beabsichtigte, sodass ich ihr vorschlug wieder eine Pause zu machen, die sie zustimmte. Wir suchten uns ein Platz auf einer Waldlichtung aus, wo die Sonne durchdrang und machten uns bequem, indem wir uns die Schuhe auszogen und uns auf das wilde Grasland zwischen die Bäume hinstreckten. Ich steckte das Messer in den Rucksack zurück, nahm den Notizblock und Kugelschreiber und legte meinen Kopf auf ihren Schenkel. Plötzlich spürte eine unglaubliche Müdigkeit und es wurde mir schwarz vor die Augen. Ihr Rütteln mit dem Schenkel, schreckte mich auf. Etwas durcheinander, fragte ich sie „Was ist los?“ „Sie sind eingeschlafen. Ich habe Sie schlafen lassen, denn ich kann mir vorstellen, wie Müde Sie sind. Ich habe auch ein bisschen geschlummert. Das Wetter ist wunderbar dazu. Aber jetzt ist es schon fünfzehn Uhr. Wir müssen weiter“. „Da habe ich fast drei Stunden geschlafen. Danke, Ina. Du bist mein Engel. Mir ist richtig schwarz vor die Augen geworden, dann war ich weg, Mehr kann ich mich nicht erinnern“. „Kein Wunder. Sie sind schon seit Tagen nicht richtig zum Schlaf gekommen“. „Ja, wir gehen gleich weiter. Nur ein paar Minuten. Ich schreibe nur schnell die Selbstanzeige, die für dich ganz wichtig ist“. „Gut. Tun Sie es. Ich mache Ihnen dabei Wurstsemmeln?“. Ich nahm die Sachen aus dem Rucksack und gab ihr auch das Küchenmesser, damit sie die Semmeln und Wurst durchschneiden kann. „Sie sind ziemlich unvorsichtig. Mir könnte was einfallen“, scherzte sie. „Was könnte mir schöneres passieren, als von einer Göttin getötet zu werden“, scherzte ich zurück. Wir lachten gleichzeitig lautstark auf. „Was soll ich sagen, das ich Ihnen nicht davongerannt bin, als Sie schliefen“. „Ganz einfach. Ich habe gar nicht geschlafen. Ich war immer wach und hielt ständig ein Aug auf dich. Und das Messer hatte ich immer Griffbereit. Und gefesselt habe ich dich auch, sagst mit den Schubänder. Du hattest ganz einfach Angst. Mehr brauchst und sollst Du auch nicht sagen. Das ist natürlich wichtig. Alles andere schreibe ich jetzt auf“. Ich setzte mich hin und begann zu schreiben. Während ich schrieb, legte sie fast mütterlich die Wurstsemmeln sowie die Fantaflasche, die wir im Supermarkt eingekauft hatten neben mir hin. Sie aß und trank auch etwas und streckte sich wieder auf den Boden hin und schaute mir zu. „Was schreiben Sie da alles“, fragte sie mich neugierig und ungeduldig. Fast unhöflich und nervös antwortete ich ihr, „Ina, Bitte. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Du kannst es dann lesen!“. Mehrmals zerriss ich eine begonnene Seite und begann es vom neuen. Ich hatte zwar gute Ideen, wie ich es am besten schreiben sollte, um ihr zu helfen, aber ich hatte große Probleme mit der Konzentration. Es schwamm mir fast alles vor die Augen. Als ich dann endlich fertig war, gab ich es ihr zum lesen. Schon nach der ersten Seite schrie sie aufgeregt auf. "Nein, so war es nicht! Das haben Sie mir nicht angetan. Das geht unmöglich. Das kann ich niemals sagen“ und streckte mir das Schreiben entgegen (07.). Ich unterbrach sie. "Bitte lies zunächst das schreiben fertig durch. Bitte“, bat und forderte ich sie fast energisch auf. Sie las es und ich sah, wie ihr plötzlich Tränen über die Augen liefen. "Aber nicht so, dass Sie mich gestochen und gemein vergewaltigt haben. Das stimmt so nicht", sagte sie geradezu protestierend. "Pass auf, Ina! Regt dich nicht so auf. Ich wiederhole mich. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder habe ich dich entführt oder du bist freiwillig mitgegangen! Willst du letztere dir und deiner Familie antun! Es gibt keine andere Lösung. Ich war und bin gemein zu dir gewesen, denn wie sonst konntest du mir nicht weglaufen. Du sagst ja selbst, das du mir weglaufen hättest können. „Was Sie da schreiben…“, sagte sie in Tränen, „…ist ein Drama. So stimmt es nicht, das wissen Sie ganz genau. Sie liefern sich völlig aus“. „Das ist unwichtig, ob es stimmt oder nicht. Wichtig ist jetzt nur, dass dir nichts passiert. Du hast fünf Kinder und ein Mann in guter Position. Denke über die furchtbaren Folgen für deine Familie nach, also nicht nur an dich. Außerdem…“, ich stockte ein Moment, „…außerdem klingt es schön dramatisch und erfüllt mein Zweck damit ordentlich aufzurütteln“ „Können wir es nicht anders schreiben“, fragte sie mich fast flehend. „Wir könnten, aber dann müsste ich dir wehtun“. „Wie bitte! Warum wehtun?“. „Ganz einfach. Ich vergewaltige dich jetzt. Ich fange gleich an dir die Kleider vom Leib zu reißen, gebe dir ein Stich und vergewaltige dich …“, sagte ich ihr absichtlich drohend und mit ernster Miene und stand dabei auf. „Sind Sie verrückt geworden. Sie machen mir Angst“. „Wenn ich das tue, dann bleibt dir dann sicher nichts anderes übrig, als eben die Wahrheit zu sagen, dass ich dich vergewaltig und gestochen habe“. „Sie wollen mich nur erpressen und dazu zwingen!“. Ich forderte sie auf aufzustehen. Ängstlich, fast zittrig stand sie nun vor mir. Ich nahm sie beim Kinn und fixierte ihre Augen, während ich zu ihr sprach. „Ina! Ich weiß, das Ganze ist schrecklich, aber es gibt keinen anderen weg. Du bist eine unglaublich Gute, starke und intelligente Frau. Denke bitte mal nach, was du dir und deiner Familie antust, wenn du mein Schreiben zurückweist. Ich bitte dich. Ich bekomme allein schon wegen der Entführung bei Graz zwanzig Jahre. Mehr kann ich ohnehin nicht bekommen. Deswegen ist vollkommen egal, ob der eine oder andere Delikt hinzukommt, wenn es nur darum geht, das nicht der geringsten Verdacht gegen dich aufkommt…“ Sie hörte mir zu, wie unter Hypnose, fast Atemlos und wie erstarrt mit weit aufgerissenen Augen. „Bitte denke nach. Außerdem ist das, was ich jetzt auf mich nehme, um dich zu schützen, gar nichts gegen die herrliche Liebe und Leidenschaft, die Du mir geschenkt hast…“ Plötzlich umarmte sie mich und drückte sich ganz fest an mich. Ich flüsterte ihr. „Was Du mir geschenkt hast, Ina, ist die Ewigkeit und für die Ewigkeit. Nichts Schöneres gibt es auf dieser Welt. Denke an unseren Sterne. Das andere ist vergänglich“. Ich spürte, wie sie an meiner Brust aufweinte und hielt sie fest. Dann schaute sie plötzlich zu mir auf und drückte überraschend ihre Lippen kurz an die meinen. „Sie sind ein unglaublicher Mann“ In Erinnerung meines schlechten Mundgeruchs, hätte ich beinahe zurückgezuckt. „Und Du eine unglaubliche Frau“, und gab ihr mit der Hand schnell ein paar Klatscher auf den Hintern und drückte meine Hand fest zwischen ihr Gesäß, absichtlich um sie aufzulockern und aufzumuntern. „Oooh!“, quietschte Sie auf und lachte. Im selben Moment spürten wir leichte Regentropfen. Wir beeilten uns, packten schnell die Sachen vom Boden und verstauten es im Rucksack. Ich zog mir einen Pullover an und hängte ihr meine Sportjacke um. „Ina! Falte das Schreiben zusammen und stecke es bitte ein, sonst wird es durch das Regenwasser verwischt und kaputt“, forderte ich sie auf. Sie tat es und steckte es in der Plastikhülle ihres Führerscheinetuis (08./5). Wir hatten nicht bemerkt, dass sich zwischendurch und relativ schnell schwere Wolken zusammenzogen. Wir folgten durch Felder der Landstraße entlang, da wir anhand der Straßenkarte wussten, dass sowohl die Bahnlinie als auch die Landstraße beim Ort Bleiburg wieder zusammentrafen, so dass wir uns gewiss waren nun den richtigen Weg Richtung Grenze zu gehen. Der Regen wurde mittlerweile stärker. Wir strebten ein an der Landstraße angrenzendes kleines Dorf an, um dort irgendwo Schutz vor den Regen zu suchen. „Bei dem Regen fallen wir sicher nicht auf, Ina, wenn wir uns irgendwo unter einen Vordach stellen“, sagte ich ihr. „Ja, gehen wir hin, denn das Wetter scheint noch schlimmer zu werden“, erwiderte sie. Im kleinen Ort angekommen, fanden wir dummerweise kein Haus mit einen Vordach noch eine überdachte Bushaltestelle oder sonst ähnliches, wo wir Schutz finden hätte können. Dann sah sie ein Wirtshausschild und schlug spontan vor, dort ein Kaffee zu trinken und abzuwarten, bis sich das Wetter besserte. Ich schaute nach, ob das Geld dazu reichte. „Warten Sie einen Moment. Ich sehe in meine Taschen und Führerschein genauer nach. Vielleicht habe ich noch etwas Geld einstecken. Oft stecke ich mir Geld ein und vergesse dann wo“. Tatsächlich fand sie ca. 150 Schillingen teilweise in ihren Jeanshosentaschen und kleingefaltet zwischen zusätzlich aufbewahrten Zetteln in ihren Führerschein. „Na, jetzt sind wir reich“, scherzte ich. Dass sie noch Geld bei ihr gefunden hat, kam mir irgendwie komisch vor. Ich glaubte ihr nicht, dass sie es nicht wusste. Mitunter ist ihr Mann knausrig und sie versteckt vor ihn ein paar Scheine als Notgroschen, dachte ich mir. Das sie aber vergaß wo, glaubte ich ihr nicht. Dazu war sie geistig zu hellwach, war meine volle Überzeugung. Wir betraten das Wirtshaus (08./5). Es saß oder standen zirka sechs, sieben Gäste herum. Der Wirt kam zu uns und begrüßte uns freundlich und fragte uns, was wir wünschten. Wir grüßten freundlich zurück und bevor ich weiteres sagen konnte, bestellte sie einen großen Kaffee mit Milch für sie und fragte mich, „Und was trinkst Du?“ „Na ja, eine Coca Cola“, sagte ich und versuchte meine Verlegenheit zu verbergen. „Bei dem Wetter wäre es besser etwas warmes zu trinken“, widersprach sie mir. Ich schaute zum Wirt auf und er nickte ihr zustimmend zu. „Seid ihr beim Wandern vom Regen erwischt worden, gelt“, meinte der Wirt. Wir nickten ihn zu. „Gut, bringen Sie mir bitte auch einen großen Kaffee mit Milch“. Als der Wirt sich wieder entfernte, schaute ich sie an. „Du hast mich das erste Mal geduzt und auch in Verlegenheit gebracht. Normal bestellt der Mann!“. Sie lachte: „Sehen Sie. Auch ich kann kaltschnäuzig sein“. Wir lachten beide auf. Ich beugte mich über den Tisch und sagte ihr: „Weißt Du! Du bist eine unglaubliche Frau“, worauf sie wieder lachte. Der Wirt brachte uns die Kaffees. Wir tranken gemütlich und beobachteten durch das Fenster das Wetter. Aus dem Nachbartisch hörten wir zwei älteren Herren, wie sie sich lautstark über den Zweiten Weltkrieg unterhielten. Sie lächelte mich an und flüsterte mir zu: „Die sind zwei Ewiggestrige“. Ich musste lachen und nickte ihr zustimmend zu. Das Wetter besserte sich nicht. Wir bestellten noch zwei, diesmal kleinen Kaffees. Gleichzeitig fragte ich den Wirt, ob er Gulaschsuppe hätte. „Nein, heute nicht. Eine gute Bohnensuppe kann ich Ihnen anbieten“. „Auch gut. Bringen Sie uns bitte zwei und Semmeln dazu“. „Nein, nein. Ich habe keinen Appetit. Bringen Sie nur eine Suppe“, widersprach sie mir. Der Wirt entfernte sich wieder. „Ina, Du hast seit gestern, bis auf ein Glas Milch, nichts Warmes gegessen!“ „Ich mag Bohnensuppe nicht…“, Rechtfertigtete sie sich, „…Außerdem bin ich heute Nacht wieder zu Hause und kann dort Essen“. Ich schaute besorgt beim Fenster raus. Der Regen hatte sich nur wenig gebessert. Ich aß die Suppe auf. Dann kam der Wirt und servierte ab: „Hat Ihnen geschmeckt“. „Ja, danke, war sehr gut“, lobte ich ihn freundlich. Die Gäste waren auf uns etwas neugierig, aber nicht aufdringlich. Sie waren mit Sicherheit Einheimische und sicher nicht gewohnt, das in ihrer Gegend Fremde oft einkehrten. Als der Regen fast zur Gänze aufgehört hatte, es fielen nur mehr Tropfen, bezahlte sie den Wirt und verließen das Wirtshaus. „Also, mir war schon peinlich…“, sagte ich ihr während des rausgehen, „…das Du bestellt und bezahlt hast. Was sollen sich der Wirt und die Leute denken!“. „Ich glaube, Sie sind auch ein Ewiggestriger oder Sie haben die Zeit im Gefängnis verschlafen. Wir Frauen sind mittlerweile viel emanzipierter als sie denken“. Wie gingen nun auf einen Bauernweg neben der Straße Richtung Bleiburg. Die Landstraße und die Bahnlinie folgend. „Ina. Sag bitte aber nicht bei der Polizei, dass wir auch im Wirtshaus waren, weil das peinlich für dich wäre. Wenn die Polizei es ermittelt und den Wirt und die Gäste befragt, wäre es nicht gut“. „Nein, sage ich nicht. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Wenn es mir doch rausrutscht, da sage ich ganz einfach, das ich gar nicht sagen kann, in welchen Ort und in welchen Wirtshaus, weil ich in der Gegend noch nie war und durch die Aufregung ich auch gar nicht danach geschaut habe“. „Na gut, wie Du meinst. Am besten ist jedenfalls nichts zu sagen“. „Wenn ich aber nichts sage und der Wirt oder ein Gast sich von selbst meldet, wäre erst recht nicht gut“, ergänzte sie. „Oh, da hast Du wirklich recht. Daran habe ich nicht gedacht sowie du zuvor auch nicht, dass du mitunter vom Amtsarzt untersucht werden könntest. Andererseits könntest Du in so einen Fall, das sich jemand vom Wirtshaus meldet, jedenfalls glaubhaft vorbringen, dass du die Gegend nicht gekannt hast und durch die Aufregung nicht daran gedacht hast, während kaum glaubhaft wäre, das du dich nicht mehr erinnern kannst, das wir miteinander Sex hatten“. „Machen Sie sich nicht so viele Sorgen um mich. Sie haben mir ja die Anzeige für die Polizei gegeben und damit haben sie mir viel geholfen. Wichtig ist jetzt, dass Sie über die Grenze kommen“, sagte sie nun selbstsicherer und offensichtlich von der Selbstanzeige, die ich ihr übergeben hatte kaum mehr verängstigt, was sie ihren Mann und der Polizei sagen sollte. Natürlich war mir klar, dass sie nun auch größtes Interesse haben musste, da ich über die Staatsgrenze komme und dass mir die Flucht bis Uruguay gelingen sollte. Vor allem sie musste nun das Geheimnis unserer Affäre hüten. Nach zirka eine Stunde kamen wir in Bleiburg an. Das Wetter war uns nicht Gnädig, denn unmittelbar vor Bleiburg fing es wieder an stärker zu Regen. Der Regen hatte zufolge, das wir nur wenige Passanten am Gehsteig begegneten, nur vereinzelte, die sich eilenden Schritte fortbewegten, Dabei erreichten wir nahe dem Ortsausgang eine überdachte Bahnstation, besser Bahnwartehäuschen. Wir setzten uns hin und schauten auf der Straßenkarte nach. Nun war es klar, dass es zur Grenze nur mehr zwei, drei Kilometer sein konnten. Es war zirka sechs Uhr nachmittags. Wir schätzten spätestens in eine Stunde bei der Grenze zu sein, so dass wir uns eine kleine Pause gönnten. Eigenartigerweise wurde ich innerlich zunehmend nervöser. Vielleicht wegen der nahestehenden Trennung, versuchte ich mich selbst zu trösten. Vis a vis der Bahnwartehäuschen war ein Caféhaus. Plötzlich bekam ich den Drang nach einer Zigarette. Ich war Raucher und hatte schon seit Tagen nicht geraucht, ohne das es mir eigentlich abging. Nun aber konnte ich es kaum mehr erwarten. „Ina. Gibst mir 20 Schilling. Ich gehe ins Caféhaus vis a vis und kaufe mir Zigaretten“. „Ich habe nicht gewusst, dass Sie Raucher sind. Ja, ich gebe es Ihnen gerne, aber ich gehe mit. Warum haben Sie es nicht gleich vorher im Wirtshaus gekauft?“, sagte sie forsch und gab mir zwanzig Schilling. „Wenn Du mich so fragst, weiß ich es auch nicht. Ich dachte nicht daran. Es kam jetzt von einen Moment auf den anderen“, versuchte ich mich zu rechtfertigen. Wir betraten das Caféhaus. Ich war überrascht und erschrak etwas, dass es bersten voll war. Laute Musik dröhnte aus einem Nebenraum. Ich schaute durch die Zwischentür und sah Paare tanzen. Ich bestellte auf der Schanktheke Streichhölzer und ein Päckchen Marlboro, dann verließen wir das Caféhaus wieder. Ich war froh, denn ich fühlte mich durch die vielen Gästen plötzlich unsicher. Als wir das Caféhaus verließen, sah ich auf einmal eine Telefonzelle neben die Bahnwartehäuschen. Ich zündete mir eine Zigarette an und saugte den Rauch gierig ein. „Ina, willst du telefonieren und deinen Mann verständigen. Aber bitte sage ihn natürlich nicht, wo wir uns gerade befinden, sonst ruft er gleich die Polizei an“, bat ich sie. „Nein, das sage ich ihn, wenn ich zu Hause bin“, antwortete sie prompt. Ich verstand, dass man über so einen Drama nicht unbedingt über eine Telefonleitung sprechen will, sondern Aug im Aug gegenüber den Angehörigen und Vertrauenspersonen. Trotzdem forderte ich sie erneut auf und erklärte ihr, dass es für ihr Mann und ihren Kinder beruhigend sein würde, wenn sie anruft. „Na gut, was soll ich ihn aber sagen?“ „Sag ihn, dass du entführt wurdest und dass du in ein paar Stunden wieder freigelassen wirst und das dir den Umständen nach gut geht sowie das du ihn näheres sagen wirst, sobald du wieder zu Hause bist““. Sie rief an (08./5 unten). Ich hörte nicht zu, sondern entfernte mich ein paar Schritte und rauchte mir wieder eine Zigarette an. „Und? Was sagte dein Mann?“, fragte ich danach. „Das die Polizei schon nach mir sucht und das den Kindern gut geht“. „Na ja, wenn er dich noch ein bisschen liebt, so muss er jetzt schockiert sein und große Angst um dich haben. Vielleicht gehen bei ihm jetzt die Augen auf, was für eine wunderbare Frau er eigentlich hat“. Danach rief ich meinen Bruder an und erzählte ihn ohne Details, das ich ein riesenblödsinn gemacht hätte und das ich nun ins Ausland unterwegs sei. Der Regen hatte mittlerweile wieder nachgelassen und es tröpfelte nur gelegentlich. Wir machten uns auf den Weg zur nahen Staatsgrenze. Wir mussten jetzt unmittelbar am Rande der asphaltierten Landstraße marschieren, denn durch den Regen war der Boden so aufgeweicht und glitschig, das es kaum mehr begehbar war, wollte man nicht ausrutschen und sich mitunter Verletzungen zuziehen. Nach zirka einer viertel Stunde Marsch entlang der Landstraße Richtung Grenze, verdunkelten sich der Himmel plötzlich innerhalb von Minuten. Von der Grenze her dröhnte der Himmel vor Blitze und man sah alle paar Sekunden Blitze aufblitzen. „Bist Du närrisch...“, rutschte aus mir heraus, „…Wie soll ich da die Grenze überschreiten können. Auf der Straße unmöglich und durch den Wald würde ich nur im Katsch steckenbleiben und um jeden Schritt kämpfen müssen. Selbst über uns droht jeden Moment ein Gewitter loszubrechen“, rief ich aus mir heraus. „Ja, es schaut nicht gut aus. Das Gewitter kommt direkt von der Grenze herauf…“, erwiderte sie, „…Was sollen wir machen. Der Regen wird jetzt auch noch stärker“, fragte sie ratlos. Ich schaute mich um. Auf der einen Seite Felder und Ackerland in düsteren Licht des mit Dunkelgrauen Wolken belegten Himmel und auf der anderen Seite ein fast angsteinflößender dichter und durch die schwarzen Gewitterwolken verdunkelter Wald. Weit und breit kein Schutz. Ohne viel zu überlegen, rein Instinktiv fasste ich einen Entschluss. Ich muss diesem Drama ein Ende setzen, sonst endet es in eine Katastrophe. Vorwiegend vom Beschützer Instinkt geleitet, das ihr nichts mehr passieren dürfe, als die Strapazen, die sie ohnehin schon auf sich genommen hat. Als ich ein PKW kommen sah, faste ich einen Entschluss und winkte automatisch. Sie hatte sich noch nicht gefasst, da blieb der PKW schon neben uns stehen (08./6). Durch das offene Autofenster bat ich den mittelälteren Autofahrer, ob er uns nach Bleiburg mitnehmen könnte. Er bejahte freundlich und wir nahmen auf den hinteren Sitz Platz. Sie schaute mich fragen an, aber ich konnte es ihr nicht im Auto erklären und deutete ihr mit der Hand um Geduld. Im nu waren wir in Bleiburg zurück und wir stiegen vor den Bahnwartehäuschen aus und bedankten uns beim Autofahrer. In Bleiburg regnete es auch, aber nicht so stark Wir nahmen im Bahnwartehäuschen wieder Platz. Ich rauchte mir eine Zigarette an und erklärte ihr nun, was ich mir überlegt hatte. „Schau, Ina. Bei dem Wetter ist unmöglich die Grenze zu überschreiten. Gehen wir weiter, gefährdest nur du dich, ohne dass ich ein Schritt weiterkomme…“ „Wieso gefährden?“, fragte sie in Unverständnis nach. „Ganz einfach. Wir würden bei dem Gewitter nur durch und durch Watschelnass werden und Du könntest sogar eine ordentliche Verkühlung oder sogar eine Lungenentzündung bekommen, denn wo sollen wir ein Schutzunterschlupft finden. Wir würden nur unnötig ein Risiko eingehen“. „Und was denken sie jetzt, was wir machen sollen?“ „Ich kann es nicht mehr verantworten, Ina. Du musst wieder nach Hause. Ich sehe es dir an, dass Du schon erschöpft bist. Eine weitere Gefährdung könnte dir gesundheitlich sehr schaden. Wenn Du willst, gehe jetzt. Lasse mir bitte aber so viel Zeit bevor Du zur Polizei gehst, damit ich den dichten Wald erreichen kann“, und deutete ihr mit der Hand Richtung Wald. „Nein, das kommt nicht in Frage! Es muss eine andere Lösung geben!“, antwortete sie schnell und entschieden. „Anders wäre es, wenn wir in eine größere Stadt wären. Da könnte ich leichter Flüchten und Unterschlupft finden. Die Hauptstadt Klagenfurt wäre natürlich ideal“. „Und wie könnten wir hinkommen?“, fragte sie nach. „Eigentlich nur mit dem Zug oder per Autostopp, sonst sehe ich keine Möglichkeit“, antwortete ich ihr. „Schauen wir nach auf den Zeitplan der Bahn“. Wir schauten uns den Zeitplan an, der auf den Bahnwartehäuschen in eine Glasvitrine aufgehängt hing, mussten aber feststellen, dass heute kein Zug mehr nach Klagenfurt fuhr. „Es bleibt uns also nur übrig per Autostopp hinzukommen! Wenn wir ein Auto stoppen könnten, das direkt nach Klagenfurt fährt wäre es ideal, denn dann wären wir in eine bis eineinhalb Stunden dort“. „Anders geht es wohl nicht, aber um die Zeit und bei dem Regen wird es schwer sein ein Auto zu stoppen“, stellte sie fest. „Wir können jetzt nur abwarten bis der Regen aufhört, denn das Gewitter scheint Momentan um die Staatsgrenze herum steckengeblieben zu sein und kommt nicht näher zu uns rauf. Wenn wir Glück haben hört der Regen da bald auf und wenn wir gleich ein Auto erwischen, könnten wir es dann schaffen. So wäre mir geholfen und in Klagenfurt bist Du dann in Sicherheit, sobald du zur Polizei gehst“. „Ja, in der Stadt wären auch für Sie sicherer. Da gibt es sicher mehr Möglichkeiten. Aber hier wäre es für sie fürchterlich. Hier haben Sie gar nichts, wo Sie Schutz finden könnten“. Vom Gefühl der Dankbarkeit und Bewunderung überwältigt, umarmte ich sie und drückte sie fest an mich. Ich merkte, dass sie offenbar vor Kälte zitterte. „Siehst Ina! Das meinte ich. Du frierst jetzt schon. Deine Kleider sind auch schon feucht“. Wir könnten ins Caféhaus gehen. Dort ist es warm und wir könnten etwas warmes trinken“, schlug sie vor (08./5). „Ja, gehen wir bis der Regen aufhört. Das ist eine gute Idee. Es ist wirklich ziemlich kalt geworden“. Wir sprinteten fast kindisch über die Straße, um den regen zu entkommen. Das Caféhaus war nicht minder bersten voll, wie zuvor als wir Zigaretten einkauften. Mich störte es aber nicht mehr, denn wichtig war mir nur mehr, sie irgendwo in eine warme Stube unterzubringen. Und eine andere Möglichkeit bot sich nicht. Ich sah, wie sie erleichtert wirkte den warmen Raum des Caféhauses betreten zu haben. Im Ausschankraum war nur mehr ein Tisch frei, der wir gleich für uns vereinnahmten. Den Rucksack schob ich unter der Sitzbank. Der Tisch war glücklicherweise gleich neben einen Fenster, so dass wir das Wetter draußen beobachten konnten. Die Serviererin kam sogleich zu uns, grüßte uns freundlich und fragte nach unseren wünsche. „Bei so einem Wetter würde ich gerne einen heißen Zitronentee trinken. Haben Sie sowas, bitte?“, fragte ich sie. „Ja, das können Sie haben“. „Und was trinkst du, Ina?“, fragte ich sie. „Bringen Sie mir bitte auch ein Zitronentee“. „Und bringen Sie uns bitte auch jeweils zwei Kuchenstücke, wie ich auf der Theke sehe“, bestellte ich dazu. Ich wendete mich ihr zu: „Mein Gott ist es hier schön warm. Geht es dir besser, Ina?“. „Ja. Mir war tatsächlich schon kalt. Hoffen wir jetzt, dass sich das Wetter schnell bessert. Ich sage Ihnen gleich jetzt, damit Sie nicht nervös werden, dass ich dann auf die Toilette gehe“. „Ja, selbstverständlich“, antwortete ich ihr sogleich und scherzte, „Und mach dich schön für mich. Ich will dich dann haben“. Sie lachte und erwiderte, „Sie werden mich nicht bekommen“. Ich sah sie an und gab ihr kontra: „Ich werde um dich kämpfen, wie ein Löwe und dich erbarmungslos bezwingen und dann schleppe ich dich als Beute mit“. Sie grinste über das ganze Gesicht und ich erwärmte mich innerlich daran, dass wir uns so schön necken konnten und dass sie sich nun wohler fühlte. Ich ertappte meine Gefühle dabei, dass ich für sie unglaublich viel Respekt und Bewunderung empfand, immer wieder von neuen. Die Serviererin näherte sich und brachte uns die gewünschte Bestellung. Der heiße Tee und die Kuchenstücke waren eine Wonne. Wir bestellten gleich darauf zwei große Kaffees mit Milch. Ich schaute mich um, merkte aber nicht, dass sich jemand für uns auffällig interessieren würde. Ich sah nur einen dicklichen Mann, der offenbar auf einen Stammtisch in der Nähe der Ausgangtür saß und der gelegentlich zu uns rüber sah, fand aber nichts Auffälliges dabei. Das Caféhaus mit Tanzfläche im Nebenraum war nahezu bersten voll. Wo wir saßen waren nur vier, fünf Tische und alle mit Gästen besetz. Der Tanzraum war eher dunkel beleuchtet, sodass ich nicht viel sehen konnte, außer durch die Tür zum Tanzraum schemenhaft paare bei lauter Musik tanzen. Bersten voll wahrscheinlich, überlegte ich, weil es draußen regnete. Mir war es nur unangenehm, weil ich so viel Rege mit lauten Musik nicht mehr gewohnt war. Dann ging sie zur Toilette, fragte zuvor aber bei der Serviererin nach, die ihr den Weg zur WC wies. Sie musste durch den Tanzraum, wo Paare bei lauter Musik tanzten. Ich wusste und war mir schon sicher, dass sie nichts tun würde. Wir beide hatten nun Geheimnisse und Interessen, die wir gewahrt wissen wollten. Ich beobachtete währenddessen das Wetter draußen, das besser zu werden schien. Der Regen schien fast aufgehört zu haben. Dann kam sie von der Toilette zurück und bezahlte gleich bei der Theke die Unkosten. Wir blieben noch ein paar Minuten sitzen, tranken den Kaffee zu Ende und verließen das Caféhaus. Der Regen hatte zwischendurch komplett aufgehört. Es fiel nur gelegentlich einzelnen tropfen herab. Nachdem wir die Straße überquert hatten und ich kurz zurückblickte, war ich augenblicklich schockiert. Oberhalb der Tür des Cafehauses hing eine Gendarmarie Hinweistafel mit aufgeblendetem Licht. Also war im ersten Stock des zweistöckigen Gebäudes ein Gendarmerie-Posten. Da wurde mir recht bewusst, wie fertig ich schon sein musste, sowas übersehen zu haben. Natürlich, durch den schlechten, trüben Wetter war es zuvor schwerer zu sehen, mit aufgeleuchtetem Licht wirkte sie nun äußerst bedrohlich für mich. Als ich Ina darauf aufmerksam machte meinte sie, dass sie es zuvor auch nicht gesehen hätte und dass wir es erst jetzt sehen, weil das Licht des Schildes nun eingeschaltet ist. Nach durchqueren des Ortes Bleiburg Richtung Völkermarkt, machten wir wieder Autostopp in der Hoffnung, bald in Klagenfurt zu sein. Wir hatten Glück, das schon das erste Wagen stehenblieb. Ein älterer Mann fragte uns, wohin wir wollten. „Wir wollen nach Klagenfurt, bitte…“, sagte ich ihn, „Sie können uns aber ein Stück mitnehmen, wenn Sie Richtung Klagenfurt oder Völkermarkt fahren, bitte, sonst sind wir dem Wetter ausgeliefert“. „Steigen Sie ein. Eine Strecke lang kann ich euch mitnehmen“ (08./6). „Oh, herzlichsten Dank. Das Wetter ist Momentan schlimm“, bedankte ich mich und nahmen im Hintersitz Platz. „Im Radio ist durchgegeben worden, das noch schlimmerer Regen kommen sollte“, informierte er uns. Auf seinen Zielort in einen kleinen Ort, angrenzend an der Landstraße ließ er uns dann aussteigen und wir bedankten uns. Wir versuchten wieder Autostopp zu machen, aber wie verflucht wollte keiner mehr stehenbleiben. Der Regen wurde stärker und wir suchten Schutz unter einen dicken Baum. Ich nahm einen Pullover vom Rucksack und legte es schützend vor den Regen über ihren Kopf. Es blieb uns nichts anderes übrig, als erneut zu versuchen ein Auto zu stoppen. Nach endlosen Minuten blieb dann endlich ein Auto stehen, worin eine frau und ein Mann mittleren Alters saß, offenbar ein Ehepaar. Sie nahmen uns bis nach Völkermarkt mit (08./6). Wir nahmen am hinteren Sitz Platz und vor lauter Freude, dass endlich ein Auto stehenblieb und uns mitnahm, griff ich ihr dabei frech zwischen den Beinen. Sie stieß meine Hand weg und warnte mich mit den Fingerzeichen. Ich schaute sie an und lachte leise. Als wir in Völkermarkt ankamen, gegen acht Uhr abends, war es bereits Stockdunkel und es regnete mittelmäßig. „Was erlaubten sie sich im Auto! Sind Sie verrückt! Wenn die Personen das gesehen hätten?“, fuhr sie mich ernst an. „Vor lauter Freude habe ich mir einen Spaß erlaubt. Entschuldigung! Ich habe schon aufgepasst, das sie es nicht sehen“. „Sie sind nicht ganz normal. Das tut man nicht“. Sie war wirklich verärgert. „Ja, ich weiß, Ina. Du hast recht. Es war nicht böse gemeint“. „Das weiß ich auch, aber das tut man nicht“. „Oh ja! Für dich würde ich alles tun“, neckte ich sie. „Hören Sie auf damit. Was machen wir jetzt?“, fragte sie mich. Wir standen mittlerweile vor dem Regen Schutzsuchend auf einen Hauseingang. Die Straßenlichter, gedämpft durch das neblige Nieselregen beleuchtete nur Schemenhaft die Straße. Nur wenige Passanten eilten durch die Straßen, ebenso vereinzelten Autos. „Bei dem Regen und Dunkelheit weiter Autostopp zu machen, wäre ein Wahnsinn. Gehen wir einmal ums Eck auf die Hauptstraße und schauen wir weiter“, antwortete ich ratlos. Ich war so Ratlos und Planlos, wie man es nur sein kann. Und das war mir schmerzlich bewusst. Mein einziges Ziel war, dass sie unversehrt und schnellsten wieder zu ihrer Familie zurückkehrt und dass ich dabei eine kleine Chance bewahre, um meine Flucht fortsetzen zu können. Von Hauseingang zu Hauseingang schutzsuchend bewegten wir uns vorwärts. Dann sahen wir eine überdachte Bushaltestelle und ich sagte zu ihr, „Vielleicht haben wir Glück und es fährt noch ein Autobus bis Klagenfurt“. Wir wurden aber schnell enttäuscht. Der letzte Bus war schon abgefahren. Wir gingen noch ein Stück weiter. Meine Augen suchten verzweifelt nach einen unterschlupft, wo wir uns vor den Nieselregen und Kälte schützen konnten, fand aber nichts. Die verschlossenen Hauseingänge mit kleinem Überdach boten nahezu keinen Schutz. Wir gingen weiter der Landstraße entlang und sahen eine Tankstelle. Dort hofften wir uns unter den Überdach ein wenig schützen zu können. Ums näher wir dann kamen, sahen wir auf der Tankstelle auch einen kleinen Caféhaus. Wir überlegten nicht lange und betraten das Caféhaus, denn es war weit und breit der einzige Schutz, der sich anbot. Es hatte wenige Gästetische, dafür aber eine lange Ausschanktheke. Wir nahmen auf eine leeren Tisch Platz. Auf der Ausschanktheke standen nur drei, vier Männer. Hinter den Ausschank war eine Bedienerin, die zu uns kam und unsere Bestellung von zwei Kaffen entgegennahm. Nach zirka eine halbe Stunde, verließen wir das Caféhaus wieder. Draußen regnete es noch, wenn auch nicht so stark wie zuvor, dafür aber blähte ein sehr frischer Wind. Wie vieles andere, haben sie und ich der Polizei und dem Gericht von dem Cafehausbesuch in Völkermarkt keine Aussage gemacht. Das ging umso leichter unter, weil weder die Polizei noch das Gericht weder Ermittlungen zur Sache aufgenommen haben noch Beweise gesichert. Offenbar haben sie sehr schnell erkannt, wie brisant die Angelegenheit ist zudem es sich bei der geschädigten Person um die Ehefrau eines hohen steiermärkischen Politikers handelte. Wir gingen die Straße entlang und ich schaute mich verzweifelt um nach einen unterschlupft, wo wir uns unterstellen hätten können. Ich erblickte eine leer stehende Baustelle mit einem Bagger. „Komm, Ina. Steigen wir auf die Kabine des Baggers. Ich sehe sonst weit und breit keinen besseren Schutz“. Sie nickte. Man sah ihr deutlich an, dass sie schon ziemlich erschöpft war und an Kälte litt. Ich half ihr raufzusteigen. Oben verschlossen wir die Schiebefenstern des Baggers, sodass wir nun auch vor den kalten Wind geschützt waren. Es war nahezu stockdunkel. Wir konnten uns nur Schemen- und Schattenhaft sehen. Ich setzte mich auf den Baggersitz, zog sie auf meinen Schoss, wobei mir die Oberschenkel vor stechenden und brennenden Schmerzen beinahe aufschreien ließen, drückte ihr Oberkörper an meine Brust, umarmte sie und rieb ihr den Rücken, um ihr schnell Wärme einzuflößen. „Ist dir besser, Ina?“, fragte ich sie nach Minuten. „Ja. Sie sind sehr lieb zu mir, obwohl es Ihnen auch nicht gut geht“. „Neben dir und dich in meinen Armen geht es mir immer gut, Du schöne Frau“, flüsterte ich ihr ins Ohr. Sie lehnte ihren Kopf fester an meine Schulter und schien einschlafen zu wollen. Ich hielt sie fest umarmt und atmete nur leise, um sie nicht zu stören. Der Blick durch die Baggerscheiben in die dunkle Nacht hinaus war bedrohlich, begleitet von fernen und dumpfen dröhnen des Gewitters, das offenbar in diesem Gebiet herum hin und her wanderte. Mir kreisten die Gedanken. Gleichzeitig fühlte ich mich in der Stille der Nacht durch die körperlichen Schmerzen, infolge der tagelangen Schinderei auf der Flucht, wie gepeinigt. Ihr Gewicht lastete auf meinen Beinen wie Tonnen. Wie gerufen, schaltete sich mein Geist schützend ein. Es trat von meinem Körper weg. Die schmerzen waren im nu wie verflogen. So als wenn ich vom mein Körper losgelöst worden wäre. Eine Fähigkeit von mir, die ich auch früher in verzweifelten Situationen mehrmals erlebte. Mein geistiger Blick, ich erschrak Momentan, sah durch die Baggerscheiben in die Kabine hinein. Ich sah mich selbst, die Frau beschützend in den Armen haltend. Ich sah in meinen eigenen Augen und erschrak. Zutiefst verzweifelte und gepeinigte Augen schauten mich fragend an. Ich erschauerte. Der Blick wanderte weiter über den Körper der Frau entlang bis zu ihr Gesicht. Sie schien zu schlafen oder eingeschlummert zu sein. Ihre Gesichtszüge wirkten Müde, aber entspannt. Ihr Körper strömte plötzlich eine übergreifende Wärme auf mich aus. Mein geistiger Blick wanderte zurück zu mir. Ein gemartertes, aber nun vor Glück aufblitzenden Augen war zu sehen. Nicht aus Liebe oder ähnliches, sondern aus Bewunderung und Respekt gegenüber der Frau, die nun auf meinen Schoss saß und die seit geraumer Zeit freiwillig die Strapazen auf sich nahm, um mir zu helfen. Eine Göttin. Im nu verschwand der geistige Blick wieder. Augenblicklich fürchtete ich mich, dass der innerliche Streitkonflikt wieder aufflammt, war aber nicht der Fall. Andererseits wusste ich, dass ich nicht halluzinierte, sondern dass es Reaktionen eines Körpers sind, die übermüdet und überstrapaziert ist. Ähnlich eines Drogensüchtigen, allerdings ohne halogenen Substanzen. Andererseits war es paradox, überlegte ich mir schon zuvor mehrmals, dass ich trotz der körperlichen Strapazen, Müdigkeit und Schlaflosigkeit eine derartige Begehrlichkeit für sie empfand. Ich konnte es mir kaum erklären. Einerseits war mir klar geworden, das sie offensichtlich schon lange nicht mehr mit einen Mann geschlafen hatte und das ich mich gerade deswegen bemühen und beweisen musste ihr die ersehnte körperliche Befriedigung zu verschaffen, um sie gleichzeitig auch für mich zu gewinnen, andererseits war es gleichzeitig wie ein anklammern aus innerliche Verzweiflung, die mich antrieb. Denn die Situation war höchstemotional und höchstdramatisch, dementsprechend nach oben frisiert waren die Emotionen und der Antrieb auf höherer Leistung. Ich spürte ihr Gewicht auf meinen Schoss, wie Tonnenlast und der Schmerz fühlte sich an, als wenn mir jemand mit einem Hammer dutzende Nägel gleichzeitig in den Schenkeln einschlagen würde, nichtsdestotrotz spürte ich ihr Hintern auf meinen Schoss erotisierend. Verrückt dachte ich mir. Bin ich etwa ein Masochist! Die Schmerzen weckten mich wieder in die Gegenwart. Ich stöhnte auf vor Schmerzen, als sie aus dem Schlaf oder aus dem schlummern aufwachte und sich bewegte. „Oh! Habe ich Ihnen wehgetan“, fragte sie mich erschreckt. „Nein, nein. Du kannst nichts dafür. Nur in den Moment, in der Du dich unerwartet aufgesessen hast, glaubte ich, das mir jemand die Oberschenkeln aufschneidet“. „Warten Sie! Ich stehe langsam auf. Ich kann mir vorstellen, dass Sie geschunden sind. Ich muss mir sowieso die Füße ein bisschen verdrehen. Wie lange bin ich bei ihnen gelegen? Ich fühle mich jetzt gut und kalt ist mir auch nicht mehr sowie vorher“. „Ich weiß nicht, wie lange. Ich habe dich einfach liegen lassen. Du hast es gebraucht“. „Danke jedenfalls. Das war sehr nett von Ihnen. Sie sind sehr Rücksichtsvoll“. Ich zündete ein Streichholz an und sie schaute auf die Uhr. Es war einstweilend 23 Uhr geworden. Draußen regnete es nicht mehr, aber bei dieser Zeit war an Autostopp nicht mehr zu denken. „Da können wir nur bis in der Früh warten!“, stellte sie fest. „Ja! In die frühen Morgenstunden können wir leichter mit Pendlern weiterkommen. Damit sind wir dann schnell in Klagenfurt. Willst du dich wieder hersetzen?“. „Nein, nein, bleiben Sie nur ruhig sitzen. Es tut mir gut, ein bisschen zu stehen“. Die Kabine am Hochstand des Baggers war nicht so beengt. Es hätten noch zwei-drei Personen um den Sitz herum stehen können. „Wollen Sie ein Wurstbrot? Semmeln haben wir keine mehr. Ich habe etwas Appetit bekommen“. „Ja, gerne. Warte ich mache dir mit Streichhölzer Licht“. „Nein, das brauchen Sie nicht. Das wenige Licht reicht schon“. Tatsächlich sickerte mittlerweile etwas Mondlicht in die Kabine. Die Wolken hatten sich etwas außerander geteilt und Teile des Himmels frei gemacht. Sie hob den Rucksack auf eine Ablage des Baggers und richtete uns Brötchen an. Ich führte meine Hand zu ihr Gesäß und streichelte sie. Nicht aus Verlangen, sondern nur um die Liebkosung wegen. „Lassen Sie das. Sehen Sie nicht, was ich in der Hand halte“, und fuchtelte mit dem Messer. „Ja, das sehe ich. Jetzt bin ich in deiner Gewalt und ich erhebe keinen Protest dagegen“. Sie lachte laut auf. „Sie waren ganz schön leichtsinnig. Ich habe bemerkt, das Sie das Messer nach St. Michael zumeist nicht mehr griffbereit im Rucksack verstaut hatten“. „Hätte ich es im Wirtshaus und in den Cafehäuser im Hosenbund belassen, hätte man mitunter die Wölbung hinten bemerkt und jemand hätte mitunter geglaubt, dass es sich um eine Pistole handelt und die Gendarmerie verständigt. Außerdem, ich brauchte kein Messer mehr. Ich weiß, dass Du mich liebst“. „Nein, das tue ich nicht. Aber ich bin von Ihnen zugegebenermaßen etwas fasziniert. Sie sind ein erstaunlicher Mann mit unglaublich vielen Facetten“. „Danke für das Kompliment. Und Du bist eine unglaublich anziehende Frau. Wunderschön und unglaublich begehrenswert, leidenschaftlich und zum reinbeißen. Nur schade, dass unsere Schicksale und Wege so verschieden sind. Ich wäre ein Leben lang Glücklich an deiner Seite“. Sie beugte sich vor und gab mir ein Kuss auf die Wange. „Sie sind unglaublich lieb“. „Warte ich will dir auch ein Kuss geben“, forderte ich. Sie beugte sich vor und hielt mir die Wange hin. Stattdessen biss ich ihr schnell, aber zärtlich am Hals. „Und verrückt sind Sie auch“ ergänzte Sie lachend. „Ina, ist dir was aufgefallen!“ „Was?“ „Seit wir bei Graz die Autobahn erreicht haben, reden wir ständig miteinander und so, als wenn zwischen uns nie was vorgefallen wäre“. „Ja! Sie haben recht. Ich habe mich noch nie mit einem Mann, nicht einmal mit meinen Eigenen Ehemann in so kurzer Zeit so viel unterhaltet, als mich mit Ihnen. Erstaunlich“. Sie reichte mir ein Brötchen und die halbvolle Fantaflasche. Ich verzerrte die Brötchen. „Wollen Sie noch eine Brötchen. Es ist genug da!“ „Nein, danke. Ich habe keine Zeit mehr“. „Wieso keine Zeit mehr?“, fragte sie neugierig. „Weil ich dich lieben möchte“. „Das können sie sich jetzt aus dem Kopf schlagen. Wir sind da auf einen Bagger“. „Na und! Trotzdem will ich dich lieben“ und griff ihr nach dem Gesäß. Sie wich mir aus. Ich stand auf und bedrängte sie. Die Begehrlichkeit, die sie in mir weckte, ließ mir die Schmerzen vergessen. Sie kehrte mir den Rücken zu. Ich drückte meinen Schoss gegen ihr Gesäß, gleichzeitig drückte ich ihren Oberkörper über den Baggersitz. „Nein, lassen Sie das“. „Wie kann ich es lassen, Du süße Göttin. Schon die Berührung mit dir ist so heiß und stark, das ich glaube zu verglühen“. „Sie sind gemein. Das hätte ich nicht geglaubt“ „Ja, ich bin gemein. Ich nehme mir die Göttin, die mich so heiß macht“. Ich zog ihr die Hose runter und sie wehrte sich nur zaghaft. Ihr schön geformter Hintern ließ mich auf die Knie gehen. Ich küsste und liebkoste jeden Zentimeter ihrer Spaltung und ihres Gesäßes… Trotz der Atemlosigkeit fühlte ich eine unendliche Erfüllung und Befreiung in mir, abgehoben als würde ich auf Wolken schweben, obwohl mir kein Orgasmus kam. Allein schon mein Kopf zwischen ihren Gesäßbacken zu drängen und sie oral mit der Zunge zu genießen, war ein wunderschönes und heißes Erlebnis. Sie roch und schmeckte nach vollendeter Erotik. In voller Dankbarkeit für das himmlische Geschenk stieß ich noch atemlos heraus: „Oh, Du herrliche Frau. Wie glücklich Du mich machst. Es war unendlich schön“, brach ich die Stille. Sie beugte sich auf, umarmte mich und legte ihren Kopf auf meinen Schulter. „Auch ich werde Sie nie vergessen. Es war wunderschön. Noch nie hat mir ein Mann so schöne Worte gesagt, wie sie“. „Und Du hast mir das Paradies gezeigt, Ina. Noch nie erlebte ich die Liebe so tief, so heiß, so schön und so süß als mit dir. Du hast mein Leben unermesslich bereichert. Deine Hingabe ist für mich ein göttliches Geschenk. Auch deine selbstlose Güte mir zu helfen. Was auch kommen mag, diese Momente sind für mich die Ewigkeit für die Ewigkeit“. Nachdem ich eine Zigarette geraucht habe, forderte ich sie wieder auf, sich auf meinen Schenkeln zu sitzen, damit sie bis am Morgengrauen geschützt vor Kälte ist. „Nein, ich setze mich auf den Boden. Ihnen müssen die Beine und Füße ganz schön weh tun“. „Weh tut mir nur, wenn Du dich nicht hersetzt“. Vorsichtig setzte sie sich auf mich und lehnte sie sich auf meine Brust und Schultern. Am frühen Morgengrauen wurden wir wach. Ich saß noch lange wach und schlummerte nur gelegentlich. Die Nervenanspannung hielt mich ständig auf, erlaubte mir nur gelegentlich die Augen zuzudrücken. „Wir müssen von der Baustelle schnell weg…“, sagte sie, „…weil jeden Moment die Bauarbeiter kommen können. Es ist schon nach 06.00 Uhr Die fangen oft ziemlich früh an“. „Ja, das stimmt, du hast recht“, erwiderte ich. Wir packten schnell, was von uns herumlag und stiegen vom Bagger runter und begaben uns zur nahen Landstraße. Dort angekommen, hatten wir Glück, das wir sogleich ein Auto stoppen konnten (08./6). Der Fahrer war ein junger freundlicher Mann, der zwar nicht ganz bis Klagenfurt fuhr, der uns aber ein Stück näher mitnahm. Von dort versuchten wir das nächste Auto zu stoppen. Nach geraumer Zeit blieb wieder ein Auto stehen. Diesmal ein Werksauto mit drei Arbeitern. Sie fuhren bis Klagenfurt, wir mussten aber im Laderaum hinten Platz nehmen, da die sitze vorne nicht ausreichten (08./6). Am hinteren Eingang des Klagenfurter Hauptbahnhofs stiegen wir wieder aus. Um keinen größeren Umweg machen zu müssen, durchquerten wir die Räume des Bahnhofs. An der Bahnhofuhr sah ich, dass es 06.50 Uhr war. Im Vergleich zu gestern, ging mir durch den Kopf, waren wir nun blitzschnell im Klagenfurt. Wir verließen den Bahnhof auf der Vorderseite und traten auf den Gehsteig. „Ich war schon lange nicht mehr in einer Stadt“ und schaute sie an. „Gehen wir bitte ein bisschen herumspazieren, damit ich mich orientieren kann“. „Ja, ja. Elf Jahre ist das schon her“, erwiderte sie mir und fragte mir gleichzeitig, „Wollen sie noch etwas trinken oder Frühtücken. Etwa 30 Schilling haben wir noch?“ „Ja. Dort vis-a-vis ist ein Stehtisch-Caféhaus. Ich trinke eine Coca Cola“. Wir kauften jeweils eine kleine Flasche Cola auf der Theke und unterhielten uns über den weiteren Verlauf der Flucht. Ich erklärte ihr nie zuvor in Klagenfurt gewesen zu sein, was auch stimmte, und das ich mich zuerst der Richtungen zur weiteren Flucht erkundigen müsste. „Na, dann schauen wir uns in der Stadt um“, sagte sie, als wenn es das selbstverständlichste der Welt wäre. Nach dem sie bezahlt hatte, gab sie mir den Rest des Geldes. „Das werden Sie brauchen. Mehr habe ich nicht“. „Danke, Ina. Ich habe aber noch eine bitte an dich. Kannst du mir die Straßenkarte, die Armbanduhr und die Sonnenbrille geben. Sie würden mir bei der zeitlichen und örtlichen Orientierung und zur Verdeckung sehr helfen. Vielleicht kann ich mich eines Tages aus Uruguay bei dir über meine Frau Silvia erkenntlich zeigen, ohne dass ich es Versprechen kann“. Gleichzeitig wusste ich, dass ich es nur aus Verlegenheit versprach, sie anschnorren zu müssen. „Ja, ja. Damit kann ich ihnen gerne helfen, weil es keine besondere oder wertvolle Gegenstände für mich sind, die ihnen aber sehr helfen“ (11./1). „Danke Ina. Damit ist mir wirklich sehr geholfen“. Wir verließen die Stehschenke und spazierten zirka eine oder eine Stunden in der Innenstadt Klagenfurt herum (08./6). Gänsehaut bekam ich stets, als Polizeiautos an uns vorbeifuhren. An den vielen Passanten und Autos auf die Gehsteige und auf der Straße gewöhnte ich mich wiederum relativ schnell. Als ich mich ausreichend erkundet hatte, betrat ich eine Telefonkabine und rief die die Kronen Zeitung an und erklärte dort eine Frau in Geiselhaft zu haben, die ich nun freilassen werde (42.). Dann setzten wir uns zur letzten Aussprache auf einen Parkbank nahe einer Bushaltestelle hin. „Ja, Ina! Jetzt ist es soweit. Gleich werden wir uns trennen“, wobei mir fast der klotz im Hals steckenblieb. Mein Herz schien zu zerreißen. Ich blickte sie an und sah Tränen in ihren Augen. Ich nahm sie bei der Hand. „Ina, allerersten bitte ich dich nochmals um Entschuldigung für das, was ich dir angetan habe…es tut mir aufrichtig leid“, mir stockte vor innerliche Bewegung der Atem, „…Wie soll ich mir jemals bei dir bedanken, das du trotz allem so gut zu mir warst! Ich wünsche dir für dein weiteres Leben das schönste und das glücklichste dieser Welt…“ „Ich habe Ihnen schon verziehen…“, erwiderte sie weinend. Tröstend legte ich meinen Arm um ihre Schulter. „Ich werde jetzt in den nächsten Autobus einsteigen und wegfahren. Es wäre schön, wenn du nicht sogleich zur Polizei gehst, damit ich auch entwischen kann“ „Ja, das werde ich machen. Das verspreche ich Ihnen. Ich gehe vorher zur Kirche und bete auch für Sie“. „Danke, Ina“, wobei mir selbst die Tränen aus den Augen flossen. Ich wischte mir die Augen mit dem Ärmel des Pullovers, um nicht bei Passanten aufzufallen. „Mein Schreiben für die Polizei hast Du. Bitte, gebe sie unbedingt der Polizei. Denke an dich und deiner Familie. Soweit wie möglich berufe dich darauf, dass Du sehr Müde bist. So werden die Kripobeamten darauf Rücksicht nehmen müssen und dir weniger Fragen stellen, so dass du bald wieder zuhause bist“. „Ja, das werde ich mir merken“. „Und vermeide bitte Journalisten. Die sind hartnäckig und gefährlich. Sag ganz einfach, das du völlig erschöpft bist“. „Ja, das werde ich tun. Und wohin gehen Sie jetzt?“. „Ich nehme dort ein Bus und fahre weg. Dann verstecke ich mich bis in der Nacht. Und meinen Weg kennst Du ja. Ich werde nun nochmals versuchen über die Grenze zu kommen, wann, wo und wie auch immer. Und von Italien aus hoffe ich nach Uruguay zu kommen. Wenn ich dort bin, kann ich dann nicht mehr nach Österreich ausgeliefert werden“. „Ich wünsche ihnen vom Herzen, das es Ihnen gelingt“ „Danke, Ina. Zum Abschied will ich dir noch sagen, dass ich jeden Tag zu den Sternen am Himmel raufschauen und dich über die Sterne täglich grüße ausrichten werde sowie unendliche Dankbarkeit. Du bist eine Göttin von einer Frau“. Sie weinte leise. Ich zwang mich aufzustehen und bewegte mich schweren Schritte zur Bushaltestelle hin, ohne dass ich zurückschaute, weil es mir das Herz zerrissen hätte. An der Bushaltestelle kam sogleich ein Autobus. Ich stieg ein, sagte den Busfahrer mein Zielort und wollte die Fahrkarte kaufen. Der Chauffeur schaute mich an und sagte, „Da sind sie aber in den falschen Bus eingestiegen. Sie müssen gegenüber einsteigen“ Ich stieg wieder aus und war überrascht sie auf den Gehsteig zu sehen (11./4). Wir kamen uns entgegen. „Was ist passiert?“, rief sie mir entgegen. „Ich bin in den falschen Bus eingestiegen. Ich muss gegenüber der Straße einsteigen“ Wir gingen gemeinsam über die Straße und sie wartete mit mir auf den Bus. Dabei sprachen wir kaum. Wir schauten uns nur traurig an. Ich nahm kurz ihre Hand und drückte sie zärtlich. Dann war der Bus schon da. Ich stieg ein und winkte ihr zum letzten Mal zu und sie winkte kurz zurück. Es war für mich so herzzerreißend, das mir schwarz vor die Augen wurde und ich mich auf den Haltegriff festklammern musste, um nicht in die Knie zu gehen. 48 Stunden der Ewigkeit für die Ewigkeit Es folgten fünf Tage der massiven Verfolgung durch sämtliche Exekutivdienste. Hubschrauber des Innenministerium und des Bundesheer ebenso mit dabei. In den Gerichtakten liegt auch ein Befehl vor, der mich zum Abschuss durch die Exekutive freigegeben hat. Zum Todesschuss ist letztlich nicht gekommen. Aktualisiert April 2020 Da meine ersten selbstverfassten Memoiren speziell der Flucht aus dem Gefängnis wider mein Einverständnis teilweise falsch und teilweise verfälscht im Internet wiedergegeben wurden, habe ich es komplett überarbeitet und aktualisiert und mit einen Passwort vor Änderungen geschützt. Daher ist diese Datei Passwortgeschützt, das Passwort nur ich, ein Rechtsanwalt und eine verlässliche Vertrauensperson kennen. Und die Unterschrift ist ebenso original von mir. In meiner obigen Memoiren habe mich bewusst mit juristischen Erklärungen zur Sache nicht auseinandergesetzt oder mit der Unterdrückung der Ermittlungen und der Beweissicherung durch die Polizei und Gerichte sowie mit dem Komplott-Prozess, sondern hauptsächlich nur darauf Augenmerk geworfen, was auf meiner Flucht tatsächlich passiert ist, insbesondere die 48 Stunden mit der Politiker-Ehefrau. Mit dem juristischen setzt sich Hr. Johann S. Pieber auseinander und ich kann seine Ausführungen ausdrücklich zustimmen, wobei Hr. Pieber einige Aspekte zur Sache unberücksichtigt ließ, die durchaus auch von Bedeutung sind, die werde ich aber nachholen. Und haben sie Verständnis für die grammatikalischen Fehler. Ich absolvierte nur drei Volksschulklassen in Uruguay. Wie ich jetzt deutsch schreibe habe ich aus eigenem Antrieb in der Zelle gelernt. Juan Carlos CHMELIR, 8020 Graz/Österreich Seite 1 von 60 Autor: Strafgefangener/Österreich Juan Carlos Chmelir, geb. Bresofsky Rekordhäftling Österreichs Jenseits der Vorstellungskraft Illustrierte Lebensgeschichte Integration der Gewalt Über 5 ½ Jahrzehnte im Kerker der Republik Österreich Ein Leben der Verfolgung und Gewalt, der Gewalt und Verfolgung @Copyright_JCC_2020 Seite 2 von 60 Vorwort: In mein bisheriges Leben konnte ich nur drei Volksschulklassen besuchen. Erwarten sie daher Kein grammatisches und schriftstellerisches Kunstwerk von mir. Hier zählt die Wahrheit und nicht Schreibfehler und Schönschreiberei. Dafür können Sie sicher sein eine von mir persönlich in der Gefängniszelle geschriebene Autobiografie zu lesen, deren Authentizität in wesentlich allein schon durch die letzten Gerichtsgutachten bestätigt wird, darunter das Gutachten des renommiertesten Forensiker Europas, Prof. Dr. Norbert Nedopil: https://Dr Franz Schautzer-Gutachten https://Prof. Dr. Norbert Nedopil-Gutachten https://Mag. Sigrid-Krisper-Gutachten Zum Beleg meiner fatalen Lebensgeschichte stelle ich weiteres die relevantesten Polizei- und Gerichtsprotokolle sowie Unterlagen aus den Heimakten und sonstige Urkunden im Anhang zur Verfügung, um manipulative und suggestive Argumentationen Dritter entgegenzuwirken, die nur darauf abzielt eine Mauer der Voreingenommenheit gegen meine Person aufzubauen, um von der Wahrheit abzulenken bzw. zu verfälschen , um die Glaubwürdigkeit meiner Person in Frage zu stellen damit „spezielle“ Tatsachen“ und „Ereignisse“ im Dunkel bleiben. Aus diesem Grund ist diese Datei gegen unerlaubte Änderungen Passwortgeschützt. Darüber hinaus war ein Passwortschutz auch deswegen notwendig, weil – laut meinen Vertrauenspersonen - im Internet Schriftstücke von mir kursieren sollten, die durch fremde Personen verfälscht wurden. Schließlich stellt der Passwortschutz auch einem Beweis dar, denn das Passwort kenne nur ich und bestimmte Vertrauenspersonen. Mit einen klick auf die Nummern öffnen die Unterlagen der Anhänge in einen eigenen Fenster. Und die Links verweisen zur Sache auf seriöse Publikationen und Dokumente im Internet hin, die die Glaubwürdigkeit meiner Ausführungen untermauert, ohne dass ich es erneut und detailliert ausführen muss und ohne das sie es als rein plakativ und pauschal in Abrede stellen können. Wenn man die Jahre in staatlichen Heimen in den 1960er Jahren miteinrechnet sind es genaugenommen schon 55 Jahre, die ich bisher in vergitterten Kellerräumen der Republik Österreich verbringe. Die letzten 42 Jahre durchgehend. Heute bin ich in das 71. Lebensjahr und lebte bisher nur 16 Jahre in Freiheit. 13 Jahre in Uruguay in Kindesalter und 3 Jahre in Österreich, letztere summiert aus kurzen Unterbrechungen aus den staatlichen Heimen und Gefängnissen. Es begann 1962 als meine Familie von Uruguay nach Österreich immigrierte und ich wenigen Wochen darauf unverschuldet in staatlichen Heimen landete, wo ich erstmals in meinen Leben in halbwüchsigen Alter mit Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, täglichem Terror, Menschenverachtung sowie mit Misshandlungen, Erniedrigungen und sexueller Missbrauch und mit vielen anderen Inhumanitäten konfrontiert und traktiert wurde. Siehe mickrige Entschädigung und lahme Entschuldigungsschreiben der Stadt Wien und der Landesregierung NÖ im Anhang (03.). http://wien.orf.at/Schockbericht zu Gewalt in Heimen http://kurier.at/erziehungsheime-methoden-wie-in-konzentrationslagern http://kurier.at/heimskandal-der-lange-schatten-der-nazis Meine fatale Lebensstory, wie gesagt begann 1962. Zu einer Zeit, die durch das Erziehungs- und Seite 3 von 60 Gefängnispersonal in den staatlichen Heimen und (Jugend-)Gefängnisse Nazi-Praktiken weiterhin enthemmt ausgeübt wurden. Ein Strafvollzugsgesetz wurde erst 1970 vom Gesetzgeber verabschiedet. Bis dahin nannte man die Gefängnisse „Zuchthaus“. Als Strafverschärfung gab es noch Hartlager, Fasttag und Dunkelhaft. Und per Zuchthausverordnung war sogar das Masturbieren im Bett verboten, angeblich um Spermaflecken in den Leintücher zu unterbinden. Ebenso per Zuchthausverordnung musste die Tagesverpflegung so rationiert sein, das der Häftling, ob als jugendlicher oder als erwachsener als Strafverschärfung tagtäglich ein leichtes Hungergefühl zu verspüren hatte. Eine fatale Lebensstory als Heimopferkind sowie als Folge der Entweichungen vor den Horror in den staatlichen Heimen in den 1960er Jahren im Underground am Straßenmilieu am Straßenstrich homosexueller sowie mit kleinen Diebstähle zum überleben bis hin der Eskalation der bewaffneten Überfalle an Geldboten, in Postämter und Bankinstituten und der Tötung eines Postbeamten bei einen Überfall auf einen Postamt. Fazit: Lebenslanger Haft, begleitet von aufsehenerregenden Protestaktionen und Gefängnisrevolten und Amtshaftungsklagen gegen die Republik während der Strafhaft sowie von Gefängnisausbrüche samt der Kaperung einer Politikerehefrau nach der Flucht vom 2.8.1989 aus der Strafanstalt Karlau https://de.wikipedia.org/wiki/Justizanstalt_Graz-Karlau#Besondere_Ereignisse 1983 beging ich eine spektakuläre zweitätige Protestaktion am hohen Dach der Garstner Wallfahrtskirche gegen Missstände in der Justizanstalt (05.), die die Justiz zu Reformen des Vollzugssystems veranlasstete. Auch wenn das Justizministerium bis heute in Abrede zu stellen versucht, dass es sich 1983 um eine Protestaktion gehandelt hat, sondern nur um einen Ausbruchsversuch, so kann ich heute Rückblickend nur bestätigen, wie sehr ich damals von den Vollzugsbehörden unterschätzt wurde. Das beweist schon mein nachfolgender politisch motivierter Gefängnisausbruch 1989 und die Revolte in Stein, die ich 1992 selbst aus der Hochsicherheitsabteilung heraus organisierte. http://www.noen.at/Ex-Haeftlingsfuehrer http://kurier.at/staatsfeind-nr-1-will-die-freiheit Seite 4 von 60 http://steiermark.orf.at/Häftling verklagt die Republik (06. Profil-Magazin 1992) Die Justizwache und Vollzugsbehörden haben nicht im Geringsten erkannt, dass ich mir aus tiefster Überzeugung infolge negativster persönlicher Erfahrung in staatlichen Heimen und Gefängnisse eine Mission im Kopf gesetzt hatte, nämlich die breite Öffentlichkeit mit spektakulären Aktionen auf gravierendste Missstände und Praktiken im Vollzugssystem aufmerksam zu machen – und dass ich hierzu meine ganze Intelligenz einsetzte. Nur deswegen war mir möglich mitten aus dem Gefängnis heraus über x-Jahre erfolgreich zu agieren. Nach der Revolte in die Strafanstalt Stein 1992 beendete ich dann mein Protest-Aktionismus endgültig. Näheres dazu folgt unten. Der absolut tragischste und dramatischte Höhepunkt allen Ereignisse in meinen Leben war allerdings das unvorstellbare zweitätigen Erlebnis mit der Politikerehefrau nach meinen Gefängnisausbruch vom 02. August 1989 aus der Justizanstalt Graz-Karlau und der bezügliche Geschwornen-Prozess beim Landesgericht Graz 1991, GZ: 6 Vr 1998/89, Hv 5/90, der Prozess und Urteil nachweislich ein Justizkomplott war, der der NS-Richter Roland Freisler nicht besser hätte inszenieren können. Als Beleg stehen ihnen hierzu ebenfalls die relevantesten Polizei- und Gerichtsprotokolle zur Verfügung, u.a. auch bei https://der Prozess 1989 Gefängnisausbruch und die Kaperung der Politiker-Ehefrau Seite 5 von 60 Allerdings kann ich durchaus bestätigen, dass aus Sicht der Justiz das Komplott zur Unterdrückung der Ermittlungen und die Beweissicherung zur Sache sowie zur Unterdrückung meiner Verfahrensund Prozessrechte notwendig war, um einen handfesten Staatsskandal zu verhindern, anderenfalls wäre das Ansehen der Politiker, der Justiz und des Staates als solchen mit Sicherheit schwer geschädigt worden. Das ist auch der wahre Grund warum ich nach 42 Jahren durchgehender Strafhaft noch immer hinter Gittern einsitze. Ich soll für immer einen Maulkorb verpasst bekommen und totgeschwiegen werden, weil sich die Elite des Landes, inbegriffen die Medien vor der Wahrheit geniert und fürchtet. Die Rechnung ist aber ohne meine Person gemacht worden. Die Wahrheit findet immer seine Schlupflöcher. In diesem Fall, indem ich meine Lebensgeschichte wahrheitsgemäß niederschreibe und mit Fakten belege und diese dann über Vertrauenspersonen im Internet absichere und unter anderem in Plattformen hochladen lasse. Dazu brauche ich keinen Lektor oder Verleger. Ein Teil meiner Lebensstory, nämlich die speziellen Ereignisse im Zusammenhang meiner Flucht aus der Strafanstalt Graz-Karlau und der Politikerehefrau ist schon vorausgegangen. Seien Sie jedenfalls gewarnt, denn es werden viele Passagen vorkommen der menschlichen Grausamkeiten und Brutalität sowie des abstoßendes und des unvorstellbaren, die Sie geistig und psychisch belasten könnten. Andererseits mussten wir Heimopferkinder in staatlichen Horrorheimen und im jugendlichen Alter in rigorosem Jugendgefängnisse unter größter psychischer Belastung über Jahrzehnten ohne psychologische und therapeutische Unterstützung auskommen, so dass sie als Erwachsener es schon aushalten werden. Ebenso meine Schreibfehler. Familiäre Abstammung und Kindheit Geboren wurde ich am 8. Juni 1949 in der Stadt Rocha in Uruguay. Mein Vater, der 1909 als unehelichem Kind in Wien geboren wurde sowie mein Großvater väterlicherseits mussten in den späten 1930er Jahren wegen der Nazis aus Österreich flüchten. Mein echter Großvater entstammte einer gutsituierten jüdischen Familie aus Fohnsdorf/Steiermark, darüber ich nicht näheres sagen möchte, um Spekulationen zu vermeiden. Seite 6 von 60 Meine Großmutter, Antonia Buchbauer, entstammte ebenfalls einer Familie aus Fohnsdorf, allerdings ohne jüdische Wurzeln. Gegen die 1930 Jahre erwarb sie im 18. Bezirk, Theresiengasse 2/1 das Hotel „Währingerhof“ (57.) Siehe hierzu unterste Kästchen u. (58. S. 2.). 1935 heiratete sie einen Landsmann namens „Bresofsky“, dessen Namen sie und mein späterer Vater übernahmen, zumal unser Stiefgroßvater „Bresofsky“ meinen Vater adoptierte. Ob die Heirat meiner Großmutter mit meinen Stiefgroßvater als Tarnung zum Schutz meines Vaters vor den Nazis oder aus liebe stattfand, habe ich nie rausbekommen. Trotzdem, aus Angst vor Entdeckung, dass mein Vater väterlicherseits jüdischer Abstammung ist, riet sie meinen Vater 1937 zur Flucht nach Amerika. Mein Großvater jüdischer Abstammung flüchtete ebenfalls nach Nordamerika, wo er in Illinois in Chicago eine Papierfabrik gegründet haben sollte. Er verstarb 1954. Mein Vater landete in Südamerika, wo er in verschiedenen Ländern in Hotels und Botschaften als Koch tätig war. 1943 lernte er in der Hauptstadt Montevideo meine Mutter kennen und lieben. 1945 heirateten sie in Montevideo. Meine Mutter ist 1925 in Rocha in Uruguay geboren. Meine Großeltern mütterlicherseits stammten aus Spanien, die in den 1920 Jahren nach Uruguay ausgewandert waren. Sowohl meine Mutter als auch meine Großeltern mütterlicherseits sind stets der Religion röm.-kath. zugehörig gewesen. Meine Mutter gebar in Uruguay sieben Kinder, zwei Buben und fünf Mädchen. Ich bin der drittälteste davon. Das achte Kind, ein Bub, kam 1963 in Österreich zur Welt. Auch wir Kinder sind Elternlicherseits röm.-kath. erzogen worden. Anhand des Familienfotos, aufgenommen Juni 1962 auf der Schiffsüberfahrt von Montevideo nach Genua wird kaum für jemand möglich sein behaupten zu können, dass damit eine primitive und verwahrlose Familie in Österreich eingewandert ist, wie später vom Euthanasie-Arzt Prim. Heinrich Gross 1978 in einem Gutachten behauptet wurde. Ein Nazi-Arzt der trotz seiner Euthanasie-Morde an dutzende Kinder für die Justiz in Österreich weiterhin als Gerichtsgutachter fungieren durfte, sodass sich wohl erübrigt zu erläutern, wer tatsächlich verwahrlos und primitiv ist. Seite 7 von 60 Von links: Juan Carlos, Ana Maria, Christina, Martha, Leopold, Isabella, Teresita, Mutter Wir wurden von den Eltern sehr wohl gut erzogen, allerdings ohne Gewalt und Menschenverachtung, wie wir Kinder im Gegensatz dazu später in Österreich auf grausamer Weise in Heimen erleben mussten. Von Geburt an waren wir Kinder uruguayische und österreichische Doppelstaatsbürger. Das war damals so die Gesetzgebung, dass Kinder automatisch auch die Staatsbürgerschaft des Vaters anerkannt bekamen. Wir Kinder waren von Geburt an auch klassische Auslandösterreicher. Trauriger weise ist unser Mutter 1978 in Wien im Alter von 54 Jahren an Unterleibskrebs gestorben. Unser Vater verstarb 1979 im Alter von 70 Jahren an Herzversagen, ebenso in Wien. Wir wuchsen in Uruguay unter sehr bescheidenen Verhältnisse auf. Strom, Flieswasser oder Fernsehen kannten wir nicht. Beleuchtet wurde mit Petroleumlampen, gekocht mit Spirituskocher oder im Freien mit Brennholz. Wasser gab uns ein Regenbrunnen und die Toilette bestand aus ein Loch in der Erde mit Holzbrettern verbaut. Unser einziger Luxus war ein Batterieradio das oft schwieg, weil die Batterien leer waren. Nichtsdestotrotz der bescheidenen Verhältnisse erlebte ich in Uruguay eine glückliche Kindheit in voller Liebe meiner Eltern und in voller Natur und Freiheit. Das kann ich auch für meine sechs weiteren Geschwister bestätigen. Wir wohnten die überwiegende Zeit in eine endlos scheinende flache Grassteppe-Landschaft, fast vereinsamt abgelegen mit wenigen verstreuten Nachbarn. Unser kleines Haus war aus mörtelnziegeln gebaut ohne Außen- und Innenverputz. Das Haus besaß und nur zwei Räume, Schlafzimmer und Küchenraum, letztere gleichzeitig als Speise- und Aufenthaltsraum diente. Das Schlafzimmer war so klein, das wir in einen Bett zu zweit schlafen mussten. Ich gemeinsam mit meinen größeren Seite 8 von 60 Bruder. Das störte uns aber nie. Zum Spielen hatten wir außer Haus rund herum mehr als genug Platz. Erstaunlicherweise gab es unter uns Kinder kaum eine ernsthafte Erkrankung oder Verletzung, gelegentlich Fieberanfälle, aber das war es schon. Wir waren von Natur aus kerngesund. Die Begriffe arm oder reich war uns fremd. Kälte oder hunger litten wir jedenfalls nie. Wir bekamen von unserer Mutter nur Hausgemachte Mahlzeiten und Süßigkeiten, wie Kuchen und Kekse die uns immer schmeckte. In eine kleine Ackerfläche bepflanzte unsere Mutter Salate, Tomaten, Süßkartoffeln etc. und wir Kinder halfen ihr dabei. Zudem hielten wir Hendel, Hasen und ein paar Schweine in kleineren umzäunten käfigen. Rindfleisch und Milch bekamen wir je nach Gebrauch sehr günstig von Nachbarn, so dass wir ausreichend versorgt waren. Das gemäßigte subtropische Klima ermöglichte es, das wir uns Kinder zumeist ganztätig im Freien aufhalten konnten, wo wir außer Shorts und Sandalen keine andere Bekleidung brauchten, wobei ich und mein Bruder die meiste Zeit gerne bloßfüßig herumliefen. Unser Spielzeug bestand in der Hauptsache aus Fetzenlaibchen zum Fußballspielen oder aus Püppchen für die Schwestern, die unserer Mutter aus Stoffreste zusammenflickte. Unser liebstes gemeinsames Geschwisterspiel war jedoch Drachen zu basteln und steigen zu lassen. Fast jedes Wochenende fuhren wir mit Nachbarn und deren Kinder mit Pferdekarren ans Meer und trollten am Strand herum. Langweilig wurden uns Kinder eigentlich nie. Auch gab es unter uns Kinder kaum nennenswerten Streitereien oder Unstimmigkeiten. Im Gegenteil, wir wuchsen familiär sehr liebevoll und harmonisch auf sowie in guter und freundlicher Beziehung zu den Nachbarn. Aus Sicht der Natur habe ich heute noch stark bleibenden eindrucke und Gefühle der wunderschönen Strände mit der weißen und feinen Sand sowie der geradezu magischen Sonnenaufgänge am Morgengrauen oder an den Sonnenuntergänge, die durch das flachen Land am Horizont riesig wirkten sowie an die vielfältigen Flora verschiedenster glänzender Farben und Düfte, aber auch an die zauberhaften Lichtermeere der Leuchtkäfer mit Beginn der Dunkelheit. Und aus familiärer Sicht sehr stark bleibenden eindrucke der liebevollen Sorgfalt und Zuneigung unserer Mutter sowie der Harmonie zwischen uns Geschwister, die auch durch gelegentlichen kleinen Zwistigkeiten untereinander nie nachhaltig gestört wurde. Mutter im Alter von 20 Jahren Seite 9 von 60 Ich kann nur jedes Kind wünschen so eine schöne Kindheit zu haben oder gehabt zu haben, wie ich und meine Geschwister es in Uruguay in voller Natur und Freiheit hatten, begleitet und versorgt von einer liebevollen und gütigen Mutter, wie unsere wunderschöne Mutter es war. Unser Vater war leider aus beruflichen Gründen sehr oft für Monate der Familie abwesend. Er war von Beruf Koch und Konditor und machte Saisonarbeiten in Hotels und Botschaften in verschiedenen Ländern in Südamerika. Wir Kinder gewöhnten uns aber daran und freuten uns jedes Mal, wenn er plötzlich wieder auftauchte, zumal er stets einem Koffer mit Geschenke mitbrachte. Die Highlights des Jahres waren natürlich Weihnachten und das Karneval sowie die Osterfeiertage und die Geburtstage, die in Uruguay mit Herz und Seele gefeiert werden. Wir lebten in bescheidenen Verhältnisse, so dass uns Kinder schon kleinste Geschenke große Freude bereiteten. Unser Leben in Uruguay war – im Gegensatz industrialisierten Länder - nicht an materiellen Werten zu messen, sondern an kleinen Zuwendungen und an menschlichen Werten der Zuneigung und Liebe. Der Schulgang gestaltete sich allerdings schwierig, weil der uralte und stets fürchterlich ratternde Schulbus immer wieder reparaturbedürftig war. Ich spreche hier von den 1950er Jahren in einen technisch seinerzeit sehr rückständiges Land. Die Haupttransportmittel waren damals Pferde- und Eselkarren. In der Schule brachte ich es nur bis zur dritte Volksschulklasse, weil ich wiederholt sitzen blieb. Meine Interesse zum Lernen hielt sich in Grenzen, deswegen ich von meine Mutter gelegentlich zu Recht den Hintern versohlt bekam, aber nie brutal, eher nur symbolisch. Meine gesunde und schöne Kindheit in Uruguay sehe ich heute eigentlich als die Basis an, die mir die Kraft vermittelte die erschreckenden Erfahrungen der physischen und psychischen Misshandlungen in staatlichen Heimen und in (Jugend-)Gefängnisse in Österreich überhaupt zu überleben - sowie um mich aus dem tiefen und dunklen abstürzen stets wieder aufrichten zu können. Die negative Entwicklung meiner Person als Heimopferkind zur Kriminalität hin war eindeutig die Folge der Gewalteinwirkung und Gewalterfahrung in den staatlichen Heimen und Jugendgefängnisse und der damit verbundenen psychischen Verletzungen und Verwirrtheit als halbwüchsiger, das mir eine gesunde Orientierung und die Möglichkeit eines geregelten Lebens beraubte , ebenso der Vertrauensverlust zu den Mitmenschen und der Gesellschaft war ebenfalls eine nicht vermeidbare Folge davon. Meine Verantwortung für die von mir begangenen strafbaren Handlungen nimmt mir keiner ab und das braucht mir auch keiner abzunehmen, denn für meine Verantwortung Büße ich bereits mit über 54 Jahren hinter Gittern, den viele Abteilungen in den staatlichen Heimen waren genauso vergittert und verschlossen wie Gefängnisse. Eine Mitverantwortung für meine fatale Entwicklung tragen jedenfalls nicht nur sadistische und perverse Heimerzieher, sondern nichtsdestoweniger die staatlichen Ämter und Behörden, die die unmenschlichen Zustände in den Heimen stillschweigen geduldet haben. Eine Tatsache, die durch zahlreiche Universitätsstudien belegt ist, die man aber besser nicht aussprechen sollte, will man nicht sogleich als Staatsfeind oder als Querulant oder als paranoid diskreditiert werden. Solchen destruktiven prägenden Lebensabschnitte der Heimopferkinder, die Delinquent geworden sind finden in Gerichts- und Vollzugsgutachten ebenso keine Berücksichtigung, nicht einmal eine Seite 10 von 60 Erwähnung. Da wollen die Behörden von Ursache und Wirkung auf einmal nichts wissen, obwohl allein schon im Hinblick einer psychologischen und therapeutischen Intervention und Resozialisierung zu berücksichtigen zwingend notwendig gewesen wäre. Stattdessen, um sich von der Mitverantwortung zu stehlen wird es von den Gerichts- und Vollzugsbehörden in Komplizenschaft der österreichischen Sachverständigen aus der Genese des delinquenten weitgehendsten totgeschwiegen. Das kann ich nur zu gut bestätigen. Nicht nur aus den Gutachten betreffend meiner Person, sondern auch aus anderer Gutachten von Mithäftlingen, die ebenso Heimopferkinder waren, die ich während meiner Strafhaft zu dutzenden gelesen habe. Abrupte Verpflanzung nach Österreich Trennung von der Familie Und Heimunterbringung Das unsere Familie Juni 1962 nach Österreich einwanderte, kam für uns Kinder völlig überraschend, eigentlich über Nacht. Den wahren Hintergrund der abrupten Auswanderung nach Österreich erfuhren wir Kinder erst viele Jahre später. Wie es damals so üblich war sind mitten und in den späten 1930er Jahren aus Österreich und Europa unzählige Menschen wegen der Nazis geflüchtet, sei es wegen der jüdischen Abstammung oder weil sie das Unheil vorsahen oder um eine aktive Teilnahme am Krieg zu entgehen. Dabei zerstreuten sich viele Familien in aller winde und verloren sich teilweise aus den Augen. So auch mein Vater. Er verlor in der Wirrnis des zweiten Weltkriegs den Kontakt zu seinen Vater, der in Nordamerika verblieb und zu seiner Mutter, die in Wien geblieben war. Wiederholte versuche meines Vaters nach Ende des zweiten Weltkriegs 1945 im Wirrwarr der unmittelbaren Nachkriegszeit mit ihrer Mutter und Adoptivvater in Wien telefonisch oder postalisch wieder Kontakt aufzunehmen scheiterten. Hinzukam, dass mein Vater 1947 in Buenos Aires zufällig einen österreichischen Pfarrer aus Wien traf, der ihn mitteilte dass das Hotel „Währingerhof“ von zwei Bomben getroffen wurde und das nur Trümmern übriggeblieben sind sowie dass seine Mutter und Adoptivvater verschüttet und mit höchster Wahrscheinlichkeit nach dabei ums Leben gekommen sind. Deswegen gab mein Vater jedwedem weiterem Kontaktversuche auf. 1961, wiederum zufällig traf mein Vater während Saisonarbeiten in Buenos Aires erneut einen Pfarrer aus Wien, der ihn erzählte, dass seine Mutter und sein Adoptivvater sehr wohl noch lebten und dass sie das zerbombte Hotel „Währingerhof“ wieder aufgebaut hätten. Über denselben Pfarrer gelang es meinen Vater mit ihren Eltern in Wien wieder Kontakt aufzunehmen. Da sie sehr betagt waren, äußerten sie ihn gegenüber dem Wunsch, dass er mit der Familie nach Österreich im Hinblick der Erbschaft zurückkehren sollte. Mai 1962 fuhr unser Vater mit dem Flugzeug voraus. Juni 1962 folgten meine Mutter und wir Geschwister in eine dreiwöchigen Reise auf mit einem Passagierschiff von Montevideo bis Genua nach. In Genua holte uns unser Vater ab und wir fuhren mit dem Zug nach Wien. Ich weiß nicht mehr genau welcher Ankunftstag es war, jedenfalls war es ein unschöner regnerischer Seite 11 von 60 und kalter Tag. Fast ein Omen für das, was folgen sollte. Unser Stiefgroßvater holte uns vom Südbahnhof mit einem Taxi-Kombiwagen ab. Er sah furchterregend aus. Auf beiden Beinen hatte er Prothesen und ging hinkend gestützt auf Krücken. Im Hotel angekommen machten wir dieselbe Erfahrung mit unserer Großmutter. Auch sie hatte auf einen Bein Prothese und bewegte sich hinkend auf einen Stock gestützt. Beide wurden durch Bombeneinschläge verschüttet und Lebensgefährlich verletzt. So gesehen war es kein schöner empfang. Auch meine Geschwister hatten vor den Anblick Angst. Noch nie zuvor haben wir derart verkrüppelte Menschen gesehen. Indirekt wurden wir mit den fürchterlichen Folgen des zweiten Weltkriegs konfrontiert, ohne zunächst näheres darüber gewusst oder erfahren zu haben. Von Anfang an herrschten chaotischen Zustände im engsten raum einer kleinen Wohnung in der Parterreebene des Hotels, das eigentlich der Portierwohnung war. Erst nach Tagen erhielten ich und mein Bruder gemeinsam ein Zimmer im zweiten Stock des Hotels. Drei Schwestern gemeinsam ein Zimmer im ersten Stock. Die zwei kleineren Schwestern blieben bei meinen Eltern in der Parterrewohnung. Im nu waren wir teilweise voneinander getrennt und fühlten uns wie gefangen, da wir um die Betriebsamkeit des Hotels nicht zu stören zumeist in den Hotelzimmer verbleiben mussten. Nur zum Frühstücken, zur Mittagessen oder zum Abendmahl konnten wir zu unseren Eltern in die Parterrewohnung gehen. Gelegentlich nahm uns unsere Mutter auf die Straße hinaus mit zum spazieren. Wir durften aber nur um den Häuserblock herumgehen, weil unser Mutter Angst vor den Straßenverkehr hatte. Aus welchen Gründen auch immer litten wir Kinder, aber auch unsere Mutter wiederholt hintereinander an starke Fieberanfälle, sei es Mangel an frischer Luft oder an Bewegung wegen der im Vergleich zu Uruguay - ungewohnten neuen Lebensrhythmen und Gewohnheiten oder sei es allgemein wegen des klimatischen Wechsels oder wegen der Nahrungsumstellung. Erst Jahre später erfuhr ich, dass sich zu dieser Zeit ein Streit zwischen meinen Vater und der Großeltern anbahnte. Mein Vater bekam nämlich Kenntnis davon, dass das Hotel von seiner Erbschaft wiederaufgebaut wurde, die ihn sein echter Vater hinterlassen hatte nachdem er 1954 in Amerika in Illinois in Chicago verstorben war. Die Erbschaft empfing unsere Großmutter, weil unser Vater zu dieser Zeit für unseren echten Großvater nicht auffindbar war. Mein Vater, offenbar undiplomatisch und ungeduldig wollte das Hotel von den Großeltern sogleich überschrieben bekommen. Die Großeltern wehrten sich dagegen, weil sie das Hotel bis zur ihr Ableben führen wollten. Offenbar aus trotz gegen unseren Vater, setzen unsere Großeltern unser Vater mit uns Kinder unter Druck. Sie verlangten, dass wir Kinder das Hotel verlassen müssten, weil wir durch das ständige hin und her im Hotel die Betriebsamkeit stören würden. Und da mein Vater der finanziellen Mittel für eine größere Familienwohnung als auch für teuerere Privatheime ermangelte, erbat er beim Bezirksmagistrat um Heimunterbringung für uns Kinder. So kam es, dass ich im Alter von 13 Jahren und drei Schwestern im Alter von 8, 10 und 12 Jahren nach wenigen Wochen Aufenthalt in Österr. über Nacht in das Schlossheim für Fremdenkinder in Judenau bei Tulln in Niederösterreich landeten. Seite 12 von 60 Schlossheim für Fremdenkinder in Judenau bei Tulln/NÖ Zurzeit Franz Joseph der Erste wurde es zeitweise als Waisenhaus verwendet. Und zurzeit des ungarischen Aufstandes 1954 wurde es als Schlossheim für Fremdenkinder ungetauft und für die Unterbringung der aus Ungarn mit-geflüchtete Kinder verwendet. In der Folge blieb es dann bis 1965 als Unterbringungsort für allfällige Fremdenkinder. Nachdem ich sogleich von meinen Schwestern getrennt wurde, wurde ich in einen kahlen und finster beleuchteten Raum geführt, wo ich mich vor mehreren Personen nackt ausziehen musste, die mich fast feindlich und mit durchdringlichen Blicken anstarrten. Als ich nackt war, wurde ich mit einem weißen Pulver bestreut. Danach musste ich mich wieder anziehen und wurde anschließend in die Knabengruppenabteilung geführt. Ein angsteinflößender Empfang. Ein bedrückendes und angsteinflößendes Empfangsszenario, das durch den Anblick des desolaten Zustandes der Knabenabteilung verstärkt wurde. Die grauen Wände waren von dreckigen Flecken bedeckt und die Einrichtungen glichen diese des Mittelalters, grobe Holzkasten, Holztische und Sesseln. Der Betonboden war Dunkelgrau. Der Gesamtzustand war heruntergekommen. Nirgends ein Bild oder ein Blumenstock oder Farben zu erblicken, außer Grau und Dunkelgrau. Der Schlafzimmer war klein und fasste zwischen 25 bis 30 Kinder. Zwischen den Stockbetten war maximal ein Abstand von 30 cm. Die Matratzen und Bettwäsche teilweise verschmutzt und löchrig. Die Stockbetten aus Metall knarrten und quietschten die Nacht über. Der Tagraum, gleichzeitig Speiseraum war etwas größer, aber viel zu klein für so viele Kinder. Der Waschraum mit einer Dusche und Waschbecken aus Blech diente ohne Trennwände gleichzeitig als WC. Während sich das eine Kind wusch, kackte oder urinierte der andere vor seinen Augen. Da war nicht einmal ein Vorhang dazwischen. Duschen sah man kaum ein Kind, weil nur kaltes Wasser floss. Viel schlimmer war aber der Anblick des Zusammenseins der vielen Kinder im engsten Raum im Tagraum eingepfercht. Der Durchschnittsalter war zwischen 7 und 14 Jahren. Ich selbst war 13 Jahre alt. Sie wirkten verwahrlos mit teils schmutzigen und geflickten Kleider. In ihre Gesichter war Angst und Schrecken, Verzweiflung und Traurigkeit geprägt. Einige davon schienen leise vor sich hin zu weinen oder hatten Tränen in den Augen. Seite 13 von 60 Vom ersten Tag an musste ich mit ansehen, wie die Kinder vom Pflegepersonal brutal behandelt wurden und wie sie mit ihnen regelmäßig herumschrien. Diese Umgangsweise war dem Pflegepersonal offenbar schon zur Gewohnheit und zur Selbstverständlichkeit geworden. Die Regeln der Disziplin lauteten auf den zugewiesenen Platz sitzen oder liegen zu bleiben und wer sich rührte bekam die volle Härte zu spüren. Wer zur Toilette musste war angewiesen die Hand zu heben. Es verging kaum ein Tag ohne dass ein Kind allein schon wegen Geringfügigkeiten, sei es durch Ohrfeigen oder durch bei den Haaren reißen misshandelt wurde. Manche Kinder lief das Blut durch die Nase oder von aufgeplatzten Lippen. Ein Pflegebetreuer war besonders gefürchtet. Er ging mit einen sehr großen Holzlineal im Tagraum fast ständig zwischen den Kindern hin und her und schlug die Kinder damit willkürlich auf den Kopf oder auf die Oberarme. Fast jedes Kind wies Beulen oder blaue Flecken auf. Heute oder morgen kam jeder dran. Die Intoleranz, Brutalität und die spürbare menschliche Kälte und Feindschaft des Pflegepersonals waren unglaublich und unvorstellbar. Menschlichkeit war ihnen mit Sicherheit ein Fremdwort. Die Gewalt und Menschenverachtung des Pflegepersonals, so unvorstellbar sie auch war gehörte wohl zur Natur und Praktikum der totalen menschlichen Enthemmung und Entgleisung, wie Teile der österreichischen Bevölkerung durch industrialisierte Massentötungen in den NS-Konzentrations- und Arbeitslager und in den Euthanasieanstalten zu eigen geworden ist, die in den Nachkriegsjahren - bis auf Massentötungen - in Form von physischer und psychischer Gewalt und den damit verbundenen Sadismus und Perversion in den staatlichen Heimen fortgesetzt ausgeübt hat. Diesen Zusammenhang der österreichischen NS-Vergangenheit zu den fatalen Verhältnisse in den Kinder- und Erziehungsheimen in den 1960er Jahren war mir damals allerdings nicht bewusst. Diese wurde mir erst verständlich, als ich mich viele Jahre später für die Geschichte Österreichs umfassend interessierte und zahlreiche Fachliteratur darüber las, einschließlich die aussagekräftigen Bücher des Psychiaters Friedrich Hacker „Die Brutalisierung der modernen Welt“ sowie des Psychiaters Erwin Ringel „Die Österreichische Seele“. Die Fachliteratur, insbesondere die oben erwähnten Bücher der Psychiater habe ich es eigentlich zu verdanken, das mir allmählich ein Knopf aufging und ich mich aus der Umklammerung der psychischen und geistigen Zwangsjacke zu befreien begann, in der ich, bedingt der innerlichen Verletzungen über sehr vielen Jahren ähnlich einer Schockstarre qualvoll gefangen war. Ich war vom Paradies in Uruguay in Österreich im wahrsten Sinne des Wortes in die Hölle geraten, nicht minder auch meine Schwestern. Verstandsmäßig waren für mich diese unmenschlichen Zustände nicht zu fassen, geschweige denn zu begreifen, emotional wohl aber niederschmetternd. Paradoxerweise war die Fach- und Sachliteratur die wirkliche Ursache dafür, dass ich in späteren Jahren eine Protesthaltung entwickelte, die zu spektakulären Protestaktionen, Gefängnisrevolten und Gefängnisausbrüche gegen Missstände im Vollzug führten. Die Literatur hat mich politisiert und rebellisch beeinflusst, indem ich Eigeninteressen hintanstellte und stattdessen das System des Vollzuges als Ganzes im Blick nahm und durchzuschauen begann. Aber dazu später näheres. Nicht genug der Verwirrung der Kulturschock bedingt der abrupten Auswanderung aus unseren geliebten Kindesort in voller Natur und Freiheit in Uruguay und der darauffolgenden schlechten Seite 14 von 60 Lebensumstände im Hotel unserer Großeltern in Wien sowie der schmerzlichen Trennung aus den gewohnten zusammenleben in der Familie durch Unterbringung in einen Heim, kam dazu die Traumatisierung in eine völlig fremden Welt der Menschenverachtung und Gewaltexzessen gelandet zu sein, ohne jegliche sprachliche Verständigungsmöglichkeit, da weder ich noch meine Geschwister Deutschkenntnisse besaßen. Nur hie und da gab es eine Person des Pflegepersonals, der etwas tolerant war und den Zöglingen etwas Bewegungsraum innerhalb der Gruppenabteilung erlaubte. Ich war von solchen Zuständen in dem Kinderheim in Judenau bei Tulln so verängstigt, das ich schon nach wenigen Tagen Bettnässer wurde. Als Strafe dafür wurde ich gelegentlich angeschrien, geohrfeigt, bei den Haaren gerissen oder es wurden mir durch zwicken am Oberarm sowie durch festes drehen an der Ohrmuscheln Schmerzen zugefügt. Die Folgen waren tagelang Angst und Schrecken bis zu Übelkeit und starken Kopfschmerzen hin. Bei solchen Vorfällen des bettnässen erlebte ich auch wiederholte male, das mich ein weibliches Pflegepersonal in den leer stehenden Schlafraum reinholte und mir dort jedes Mal die genässten Leintücher vor der Nase hielt oder im Gesicht rieb und mich dabei aggressiv anschrie und in die Hose griff und mein Penis und Hoden knetete und schmerzlich drückte, bis ich vor Schmerz aufschrie. Ich war stets vor Angst wie gelähmt und konnte mich nicht wehren, zumal sie mich mit der freien Hand beim Oberarm umklammert festhielt. Ob hier ein sexueller Missbrauch stattfand oder ein sadistischer Übergriff wegen des Bettnässens, weiß ich bis heute nicht zuzuordnen. Viel schlimmer erging es einigen Kinder im Alter etwa zwischen 8 und 11 Jahren, jedenfalls waren sie kleiner und jünger als ich, die sich sowohl in der Nacht im Bett oder bei Tag im Tagesraum voll in die Hose machten. Offenbar versagte ihnen der Anal-Schließmuskel, sei es aus Schwäche oder aus Angst. Im Tagraum konnte man es riechen oder es an die befleckte Hose sehen. Der Gestank war aber das geringste Übel im Vergleich der Szenen, die sich dann abspielten. Sie wurden mit äußerster Brutalität, Geschrei und Beschimpfungen vom Pflegepersonal aus dem Schlafoder aus dem Tagesraum gezerrt. Minutenlang hörte man dann aus dem Gang der Abteilung und aus dem Waschraum fürchterliches Geschrei infolge der Misshandlungen. Manche solchen Kinder sah ich danach nie wieder. Entweder wurden sie in andere Räume des Heimes untergebracht oder im Hospital oder in ein anderes Heim verlegt. Manchmal hörten die Schmerzens- und Verzweiflungsschrei derart abrupt auf, das ich heute den Verdacht hege, das die Kinder Bewusstlos geworden sind oder infolge des Schocks der Misshandlungen gestorben. Und die, die im Tagraum zurückkehrten stand der Schmerz und Schreck im Gesicht geschrieben oder sie wirkten wie lebenden toten, wie gebrochen und völlig apathisch. Heute noch sehe ich im Geiste glasklar die Gesichter der angsterfüllten Kinder und höre auch ihr Geschrei. Erinnerungen, die ich nach Belieben wie ein Videoband vor- und zurückspülen kann. Heute Gott sei Dank distanzierter und mit beherrschten Emotionen. Ich war in meiner Kindheit in Uruguay noch nie mit Gewalt und Brutalität konfrontiert gewesen, weder persönlich noch durch Wahrnehmung an anderen Kinder oder Erwachsenen. Höchstens nur mit Kinderstreitereien in der Schule oder ein festes Wort der Eltern wegen ungebührlichen Benehmens eines Kindes, jedenfalls aber nie mit einer derartigen Unmenschlichkeit, Gewalt und Seite 15 von 60 Brutalität, wie sich mir nun im Heim offenbarte. In anderen Heimen erfuhr ich später von anderen Heimkindern, die zu anderen Zeiten auch im Kinderheim Judenau bei Tulln waren, das von Seiten des weiblichen und männlichen Pflegepersonals auch zu sexuellen Missbrauchs von Buben gekommen ist. Einen sexuellen Missbrauch in Judenau bei Tulln habe ich persönlich nicht gesehen oder sonst wie wahrgenommen, andererseits ist kaum zu erwarten, dass das Personal sowas vor den Augen anderer Kinder durchführt hat. Möglicherweise sind manche Kinder sogar aus diesem Grunde in der Nacht vom Personal aus dem Schlafzimmer geholt worden, um eben auch sexuell missbraucht zu werden. Dass könnte auch das Versagen der Schließmuskel mancher Kinder erklären. Für mich war es jedenfalls glaubhaft, denn ich erlebte selbst ähnliche übergriffe im Genitalbereich, die ich damals nicht konkret zu deuten verstand, ob es als Strafe wegen meines bettnässen geschah oder als sexuellen Gründen. Außerdem liegt es auf der Hand, das Erwachsene, die gegenüber Kindern eine derartige Brutalität auszuüben imstande sind, das solche grundsätzlich zu allen fähig sind. Sowohl in der Nacht als auch bei Tag war es im Schlaf- und Tagraum sehr kalt, zudem der Wintereinbruch kam, sodass wir Kinder auch stark an Kälte litten, weil die Decken sehr dünn waren und weil in der Abteilung weder eine Heizung noch einen offen gab. Stundenlang lagen wir Kinder jede Nacht zittrig im Bett, wachgehalten vom Schmerz der Kälte, um dann punkt um sechs Uhr früh völlig verschlafen aus den Betten vom Pflegepersonal rausgeschrien zu werden. Eine Tortur, die niemanden zu wünschen ist. Untertags mussten wir uns Kinder ganztätig im Tagraum aufhalten. Bewegung im Freien durch Spaziergänge irgendwo in einen Hof oder auf der Straße oder auf einer Wiese oder im Wald erlebte ich nie. Wir blieben den ganzen Tag in der Abteilung eingeschlossen, in der Nacht im Schlafzimmer. Spielzeuge oder sonstige Unterhaltung gab es keine. Ebenso keine Feierlichkeiten zu Feiertagen, wie etwa Weihnachten. Jeder Tag war genauso eintönig und von Menschenverachtung geprägt, wie die Vortage. Im Grunde wurden wir Kinder in der Gruppenabteilung wie Gefangene angehalten. Wir wurden nur wie ein Gegenstand räumlich abgestellt bzw. abgelagert. Die Kinder Unterhielten sich nur leise unter sich. Man hörte kaum ein Lachen oder den Anblick eines lächelnden Kindes. Da meine Muttersprache spanisch ist und ich weder die deutsche noch eine andere Sprache mächtig war, saß ich Tag ein Tag aus verstummt dar. Über die Monate, die ich dort war hatte ich nie einen Gesprächspartner. Jeder Tag über die Monate hin schien endlos. Eine Tortur der Langweile und des Schweigens. Ganz besonders als grausam und gewalttätig erlebte ich auch die Zwangsernährung, die ich gelegentlich unterzogen wurde. Offenbar wegen meiner schlechten psychischen Verfassung, bedingt der Trennung von der Familie und den Missständen in dem Kinderheim verspürte ich keinen Hunger und wollte nichts Essen. Das Pflegepersonal griff zur Zwangsernährung. Sie vollzogen es, indem ich manchmal mit Ohrfeigen dazu gezwungen wurde oder indem man mir den Mund gewaltsam öffnete und das Essen hineinstopfte. Damit ich das Essen dann nicht erneut ausspucken oder rauswürgen konnte wurde mir der Mund Seite 16 von 60 zugedrückt, indem ich mit den Händen bei der Schädeldecke und untern Kinn gepackt und zusammengedrückt wurde, sodass ich nicht den Mund aufmachen konnte, was gelegentlich zu Erstickungs- und Todesängste führte. Dieselbe Prozedere der gewalttätigen Ernährung wurde auch an einigen anderen Zöglingen unterzogen, die – aus welchen Gründen auch immer – ebenso nichts Essen wollten. Ich lebte ein Tag auf den anderen in ständiger Angst vor weiteren Misshandlungen wegen meines Bettnässens oder wegen der Zwangsernährung sowie wegen der fast täglichen Gewalt des Pflegepersonals gegenüber anderen Kindern, die nicht weniger beängstigend und traumatisierend auf mich einwirkte. Vor innerlicher Belastung und Ermüdung, fühlte ich mich über die Monaten hin immer müde und erschöpft und ich erinnere mich heute noch, dass mich damals fast ständig ein Gefühl der Ohnmacht oder des betäubt-zu-sein begleitete. Die Schädigungen durch die Heimen und (Jugend-)Gefängnisse lernte ich erst Jahrzehnte später 2013-2016 mit therapeutischer Hilfe emotional zu kontrollieren (59.) (03.), die im Zuge einer mickrigen Heimopferentschädigung mitfinanziert wurde. Die Bilder im Kopf kann man aber nicht löschen. Diese bleiben wie ein Videoband im Kopf gespeichert und stets abrufbereit, visuell, akustisch und emotional, sobald man sie abruft. Geht man vom psychologischen Befund und Gutachten von 1964 aus (60.), so erlebte ich die Umstände der abrupten Verpflanzung nach Österreich und die Trennung von der Familie sowie der inhumanen Torturen in dem Heim für Fremdenkinder in Judenau bei Tulln in einem geistigen alters eines ca. 10-jähriges Kindes, dessen Psyche natürlich weit sensibler und verletzlicher ist. Das der Befund und Gutachten den Heimaufenthalt in Judenau bei Tulln und der mir dort zugefügten psychische Verletzungen nicht berücksichtigt, liegt offensichtlich der damaligen schlampigen Dokumentation der Behörden zugrunde. Was Kinder in den Heimen erleiden mussten interessierte niemanden und die Jugendämter bis zur Polizei und Justiz hin vertuschten es bestmöglich. Hier geht es nicht um Mitleid oder ähnliches, was ich ohnehin ablehne, sondern um meine Entwicklung und Werdegang entsprechend zu analysieren und wirklichkeitsnahe darzulegen. Nach einen halben Jahr Aufenthalt im Horrorheim in Judenau bei Tulln wurde ich von meinen Vater, nachdem er meinen schlechten Zustand feststellte, in ein privates Internat im 13. Wiener Bezirk „Diesterweg“ untergebracht. Ein halbes Jahr, 182 Tage schien der Landesregierung Niederösterreich für einen minderjährigen nicht lange der Qualen und seelischen Verletzungen gewesen zu sein. Deshalb setzte sie nur eine erniedrigende Entschädigung in der Höhe von nur € 2.500 aus. Im privaten Internat wurde ich nur wegen meines Bettnässens von Erziehern und Heimkinder gehänselt, was zwar sehr erniedrigend war, ansonsten waren die Heimverhältnisse aber relativ normal, ohne dass ich sonst irgendwelche physischen Misshandlungen erleben oder an anderen Kindern mitansehen musste. Während dieser Monate im Internat besuchte ich eine Volksschule, wo ich etwas Deutsch lernen konnte. In der Schule wurde ich unauffällig behandelt. Zur Schule wurden wir Heimkinder von Erzieherinnen oder Erzieher begleitet. Ebenso an den Wochenenden zu Spaziergängen auf der Straße zur Auslagen schauen oder in Grünanlagen Fußball zu spielen. Seite 17 von 60 Irgendwie schien sich alles wieder zum Guten zu wenden. Im privaten Internat „Diesterweg“ (58. S. 2) verspürte ich erstmals in Österreich eine gewisse Normalität, freien Bewegungsraum und Freiheit, wie ich es in Uruguay gewohnt war. Im Hotel unserer Großmutter waren wir Kinder bewegungsmäßig sehr eingeschränkt und erst recht im Horror-Kinderheim in Judenau bei Tulln. April 1963 nahm mich mein Vater aus dem privaten Internat wieder Nachhause. Da mein Bruder Maximo mittlerweile eine Arbeit als Kellnerlehrling mit Dienstwohnung hatte, war nun in der kleinen Parterrewohnung im Hotel Platz für mich frei geworden. Meine Schwestern Christina, Anna und Martha verblieben zu dieser Zeit weiterhin in den Kinderheim in Judenau bei Tulln, später wurden sie im Klosterheim für Mädchen bei Wr. Neudorf verlegt. Jahre später sollte ich bitter erfahren, das auch ihnen in den Heime sehr schlecht ging sowie das meine Schwester Cristina und Martha wiederholt aus den Heimen flüchteten und auf der Flucht von Männern und Zuhältern aufgefangen und sexuell missbraucht und zur Prostitution gezwungen wurden. Meine Schwester Isabella war ebenfalls in einen Heim, jedoch in einen Klosterheim im 18. Bezirk in Wien. Heute noch geht sie regelmäßig zur Psychotherapie, um die schmerzvollen Erfahrungen im klosterheim aufzuarbeiten, da sie heute noch daran leidet. Meine Schwestern verblieben nicht in den Heimen, weil sie zuhause erzieherischen Schwierigkeiten bereitet hatten, sondern tatsächlich nur weil sie in der kleinen Parterrewohnung des Hotels nicht untergebracht werden konnten. Ich hatte offenbar nur Glück früher vom Heim „Diesterweg“ weggekommen zu sein und wieder zuhause zu landen. Dass mein Vater bei den Jugendämter Erziehungsschwierigkeiten der Kinder behauptete und dessen Heimunterbringung verlangte, behauptete er nur damit wir in billigeren staatlichen Heimen untergebracht werden (58. S. 3), weil er das Geld für eine Unterbringung so vieler Kinder im privaten Internate nicht zu Verfügung hatte. Das gestand und bestätigte er mir und meinen anderen Geschwister 1976 bei einen Familiengespräch, wo er sich weinend bei uns entschuldigte, nachdem wir ihn über unsere fürchterlichen Erlebnisse in den Heimen schilderten. Heute hege ich meinen Vater keinen Groll mehr nach, denn er war in eine finanzielle Notsituation und zudem konnte er nicht wissen, dass wir in den Heimen derart unmenschlich behandelt würden. Er hat unser Heimunterbringung aus der Not heraus bewerkstelligt und nicht, weil er uns loshaben oder böses wollte. Erste Straftat Erste Gefängniserfahrung u. Unterbringung im staatlichen Heim für Schwererziehbaren Wieder Zuhause eingekehrt besuchte ich wenige Wochen eine Volksschule im 18. Bezirk in Wien. Der Lehrer, ein älterer Mann mochte mich offenbar nicht. Möglicherweise fühlte er sich wegen der sprachlichen Barriere zusätzlich belastet. Er schrie des Öfteren mit mir herum, wobei Mitschüler zumeist darauf lauthals auflachten. Bruchweise verstand ich schon etwas, so auch die fremdenfeindlichen Äußerungen „Nix gut, Ausländer“, „Österreich Deutsch, nix Spanisch“ etc. Seite 18 von 60 Das war wahrscheinlich auch ein Freibrief für manche Mitschüler in der Klasse, mich zu hänseln und zu mobben. Ich fühlte mich in der Schule isoliert und vereinsamt und beschwerte mich bei meinen Vater darüber, der mich wieder aus der Schule nahm. Schon damals versuchte er mir zu erklären, dass in Österreich noch viele Nazis und Rassisten frei herumliefen, aber die Bedeutung seiner Worte begriff ich erst viele Jahre später. Damals hatte ich von Politik nicht die leiseste Ahnung. Anschließend des Schulabgangs nahm er mich in das Schlosshotel in Pörtschach am Wörthersee mit, wo er als Chefkoch und Chefkonditor Saisonarbeit verrichtete. Dort war ich als Hilfskraft in der Küche bis zur Saisonsende tätig und wieder in Wien zurückgekehrt begann ich kurz darauf eine Lehre als Bäcker (58. Seite 3), unmittelbar in der Nähe des Hotels unserer Großmutter. Die Bäckerei war ein Familienbetrieb, wo ich gut behandelt wurde. Ich war froh eine Arbeit zu haben, allein schon um aus der kleinen Parterrewohnung etwas rauszukommen, denn meine Mutter verbot mir allein auf die Straße rauszugehen. Sie hatte panische Angst vor den dichten Straßenverkehr. Irgendwie verständlich, da wir in Uruguay stets am Land abgeschieden lebten und sie sich um uns Kinder sorgen machte. Trotzdem habe ich mich ein paarmal unerlaubt fortgeschlichen, um in eine nahe Parkanlage mit anderen Kindern Fußball zu spielen. Jedes Mal regte sie sich darüber sehr auf. Dieselben Unstimmigkeiten gab es auch, wenn ich gelegentlich zu meinen Großeltern im ersten Stock ging. Das wollte sie nicht, weil es unser Vater verboten hatte, da er mit seinen Eltern wegen der Übernahme des Hotels noch in Streit stand. Jahre später erfuhr ich, dass er sie sogar zivilgerichtlich verklagt hatte. Die Arbeit machte mir Spaß und ich erinnere mich heute noch sehr genau, wie ich mich über den ersten Lohn freute und Stolz war. Jedenfalls schien sich das Blatt zum besseren für mich zu wenden, aber es kam leider alles viel schlimmer. Das einzige, was mich bei der Arbeit störte, war die anfänglich aggressive Art des herumkommandieren des Sohnes meines Bäckermeisters. Nach gewisser Zeit wurde aber sein Verhalten freundlicher. Er begann mich zum Kino mitzugehen einzuladen, was meine Mutter im Vertrauen, das er der Sohn meines Lehrmeisters ist auch erlaubte, zumal er mit seinen knapp 17 Jahren älter war als ich. Meine Mutter glaubte mich in guten Händen und in guter Begleitung. Weder sie noch ich ahnten im Geringsten, das er sich um einen Sexualstraftäter handelte. Schon beim ersten Kinobesuch kam ich in einen Konflikt zwischen erschrecken und Belustigung. Das ging die Tatsache voraus, das er schon auf den Weg zum Kino und nach den Kinobesuch Frauen und Mädchen auf der Straße belästigte, indem er sie anzüglich ansprach oder weil er sie auf den Hintern tätschelte oder zwickte. Die Frauen und Mädchen reagierten unterschiedlich. Die einen schimpften lautstark und die anderen lachten wiederum und gingen einfach weiter. Ich kam jedenfalls nicht auf dem Gedanken meinen Eltern darüber zu erzählen. Vielleicht instinktiv aus Angst darüber, dass ich dann nicht mehr mitgehen darf und als Folge nur mehr zu Hause herumsitzen müsste. Andererseits konnte ich das Verhalten des Sohnes meines Lehrmeisters weder als Böses oder Gutes einordnen, da es für mich eine völlig neue Erfahrung war. Eines Tages nahm er zwei Freunde mit. Nach dem Kino machten wir in der Abenddämmerung einen Seite 19 von 60 Spaziergang durch die Straßen. Beide flüsterten mehrmals miteinander. Ich dachte mir nichts Schlimmes dabei. Es fiel mir nur auf, dass sie gelegentlich mit den Finger auf Frauen und Mädchen hinzeigten sowie dass wir stets Frauen und Mädchen hinterhergingen. Es geschah dann sehr schnell, November 1963. Wir gingen hinter eine jüngere Frau her in kurzen Abstand. Ich selbst war gerade 14 Jahre alt. Dann begann sein Freund wie aus dem nichts auf mich energisch einzureden und mir mit Gestik zu verstehen zu geben, das ich das Mädchen bei den Ärmeln halten sollte. Ich bekam Angst, konnte aber mit der plötzlich eintretenden Situation nicht umgehen, weil ich nicht einmal wusste, worum es wirklich ging. Als sie in eine dunkle Gasse einbog und in einen Hauseingang hineinging, folgten wir ihr nach. Auf den Hausflur sah ich, wie sich der eine Freund auf das Mädchen stürzte und ihr mit der Hand den Mund zudrückte. Gleichzeitig wurde ich vom beiden anderen drohend und aggressiv aufgefordert, das Mädchen bei den Ärmeln festzuhalten. Ich näherte mich dem Mädchen wie erstarrt und voller Angst. Ich versuchte sie bei dem Ärmel zu fassen, aber sie schlug wild um sich, so dass es mir nicht gelang. Dem Mädchen gelang es sich von dem zugedrückten Mund zu befreien und begann lauthals um Hilfe zu schreien. Sie stürmten im Nu auf die Straße und rannten davon. Ich hinterher, instinktiv erfassend, dass da was Schlimmes geschehen ist. Nach einiger Zeit hinterherlaufend, blieben beide stehen und begannen mich drohend und aggressiv zu beschimpfen, weil ich das Mädchen nicht bei den Händen gehalten habe. Ich fühlte mich total schuldig, eingeschüchtert, verängstigt und schockiert. Leider war ich damals nicht imstande mit jemanden darüber zu reden, sei es aus Angst oder aus Verschlossenheit oder aus unbewussten Schuldgefühlen heraus. Vielleicht auch, weil es der Sohn meines Lehrmeisters war oder weil ich dann in der Freizeit nicht mehr fortgehen hätte können. Ich weiß es bis heute nicht, was mich tatsächlich davon abhielt, wenngleich im Nachhinein betrachtet wahnsinnig wichtig gewesen wäre, dass ich mich jemanden anvertraut gehabt hätte. Denn damit hätte ich nur meinem zukünftigen Schicksal einen guten Dienst erwiesen, aber wie hätte ich das damals wissen sollen! Am nächsten Tag in der Arbeit tat der Sohn meines Bäckermeisters dann so, als wenn nie was passiert wäre und war äußerst freundlich zu mir. Offensichtlich dürfte er der Auffassung gewesen sein, dass ich ein verlässlicher Komplize sei, weil ich ihn nicht verpfiffen hätte oder das ich es aus Angst vor ihm nicht getan habe. Nach zwei-drei Tagen hatte ich den Vorfall schon verdrängt und als er mich wieder ins Kino mitzugehen einlud, ging ich mit Zustimmung meiner Mutter mit. Vorangegangen war aber ein Streit zwischen meiner Eltern. Es war der 23. Dezember 1963 und mein Vater wollte das ich zuhause bleibe, um beim ausschmücken des Weihnachtsbaumes mitzuhelfen. Meine Mutter widersprach ihn aber und meinte, dass ich nun arbeiten gehe und dass ich daher das Recht auf etwas Freizeit und Unterhaltung hätte. Gut gemeint von meiner Mutter in glauben, dass ich durch eine verlässliche Person begleitet werde. So kam es wieder zu einem Überfall auf ein Mädchen. Obwohl ich schon vorgewarnt hätte sein müssen, kam es für mich trotzdem überraschend, da ich offenbar nicht wahrhaben wollte, das sich so einen schrecklichen Vorfall wiederholen würde. Es geschah genauso, wie beim ersten Mal. Nach dem Kino gingen wir in der Abenddämmerung wie Seite 20 von 60 stets zuvor immer zu Fuß nachhause zurück. Bei dieser Gelegenheit verfolgten sie wieder eine Frau. Sein Freund gestikulierte und redete wieder aufgeregt auf mich ein, dass ich die Frau bei den armen packen sollte. Als die Frau im Hausflur einbog kam es wieder zum Gerangel. Aus Angst vor meinen Mitbegleiter versuchte ich die Frau bei den Händen zu packen, aber ich war wie gelähmt vor Angst und es gelang mir nicht sie festzuhalten. Sein Freund drückte ihr den Mund zu, aber die Frau gelang sich zu befreien und Schrie laut auf. Der Sohn meines Lehrmeisters, der die Frau die Hose hinunterzureißen versuchte ergriff sofort die Flucht. Sein Freund hinterher und ich hinter ihnen her. Nach einigen Straßen blieb der Sohn meines Lehrmeisters plötzlich stehen, stieß mich voller Wut zu Boden und würgte mich. Offensichtlich ist er in Rage geraten, weil mir nicht gelungen war das Mädchen bei den Händen festzuhalten, was dazu führte, so wahrscheinlich seine Überlegung, dass sein Freund das Mädchen nicht länger den Mund zuhalten konnte, weil sie sich mit den freien Händen dagegen wehren konnte, deswegen er nicht zur Befriedigung seines sexuellen Drangs gekommen ist. Die Enttäuschung darüber ließ er dann bei mir aus. Sein Freund zerrte ihn zurück, ansonsten hätte er mich mitunter erwürgt, so wutentbrannt war er. Schockiert kehrte ich nachhause zurück und erzählte meiner Eltern wiederum nichts von dem Vorfall. Dafür waren sie kurz darauf wie vom Blitz getroffen, als wenig später die Polizei erschien und mich mitnahm. Sein Freund wurde auf der Straße von der Polizei aufgegriffen und das Mädchen hat ihn bei einer Gegenüberstellung als Mittäter identifiziert, der wiederum mich und den Sohn des Bäckermeisters als die übrigen Täter angab. Am nächsten Tag wurde ich vom Polizeikommissariat in das Jugendgefängnis in Wien eingeliefert und in U-Haft genommen. Ich persönlich war schockiert und wusste nicht, was mir geschah, denn mein Verstand konnte die Straftaten weder einordnen noch verarbeiten, geschweige denn das ich es bewusst und mit Vorsatz herbeiführen wollte. Da der Sohn meines Bäckermeisters und sein Freund im Vorfeld auch mit anderen Komplizen Straftaten begangen hatten und Geständnisse darüber ablegten, kam es zur Festnahme auch anderen Tätern, die mir völlig unbekannt waren. Am 16.9.1964 kam es dann beim Jugendgerichtshof Wien zu der Hauptverhandlung, wo ich wegen Beihilfe zur sexuellen Nötigung zu vier Monate bedingt und zur Einweisung in eine stattliche Erziehungsanstalt verurteilt wurde. Ich weise hier auf die Anklageschrift vom Juni 1964 (61. S. 1 bis 12) sowie auf die drei mit eingefügten Seiten 13 bis 15 hin des Gerichtsurteils vom 16.9.1964 aus GZ: 9 Vr 861/64, Hv 83/64 des JGH Wien, die die damalige Situation der Straftaten schildert und nachvollziehbar erklärt, das ich und die anderen Beschuldigten vom Sohn meines Bäckermeisters für seine Fantasien der sexuellen Nötigung einer Frau in unseren jugendlichen Leichtsinnigkeit und Beschränktheit missbraucht wurden. Das Gesamte Gerichtsurteil mit 27 Seiten wird demnächst auf der Website Upload, wie sonst allen Gerichtsurteile und Urkunden, die meine Autobiographie objektiviert und konkretisiert. Zu den Gerichtsakten, 4 Vr 861/64, Hv 83/64 des JGH Wien kam ich erst Jahrzehnte später, daraus ich erstmals näheren Kenntnisse der damaligen Attacken auf die Mädchen gewinnen konnte, Seite 21 von 60 insbesondere dass der Sohn meines Bäckermeisters damals schon eine Vorgeschichte des Versuchs der Vergewaltigung hatte (61. S. 14 oben), die gerichtlich anhängig war. Ebenso, das er aus der UHaft auf Bewährung entlassen wurde und das er erneut Rückfällig wurde. Ich war tatsächlich einen Sexualstraftäter in den Händen geraten, der nur dummen Gehilfen brauchte. Bis zu dieser Straftaten hatte ich keine sexuellen Erfahrungen. Ich war sozusagen noch Jungfrau. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich zu dieser Zeit ein drang zur Sexualität verspürt hätte, wenngleich ich schon im Pubertätsalter war. Entweder hatte der Gutachter recht (60.), dass ich in der Entwicklung einige Jahre zurückhinkte oder ich wurde mitunter durch die abrupte Verpflanzung nach Österreich und der Trennung von der Familie sowie infolge der traumatischen Erfahrungen in den Fremdenheim für Kinder in Judenau bei Tulln durch psychische Störungen in der sexuellen Entwicklung und Reife beeinträchtigt. Gravierende Erziehungsschwierigkeiten, wie mit dem Erhebungsberichte behauptet (58.), kann ich keineswegs bestätigen. In den Berichte ist augenfällig, dass von Zeiträumen der Erziehungsschwierigkeiten die Rede ist, in den Zeiträumen ich gar nicht bei meinen Eltern wohnte, sondern wo ich in den Heim für Fremdenkinder in Judenau bei Tulln und im privaten Internat „Diesterweg“ untergebracht war, Juli 1962 bis Mai 1963. Und von Juni 1963 bis zu meiner Festnahme Dezember 1963 war ich zunächst nur ein paar Wochen in eine Schule und danach mit meinen Vater im Schlosshotel in Pörtschach am Wörthersee als Küchengehilfe tätig und anschließend als Bäckerlehrling in Wien, wo ich die Arbeit zufriedenstellend verrichtet hatte (58. S. 3). Da ist daher kein Zeitraum, in der Zeit ich zuhause derartige Erziehungsschwierigkeiten bereitet hätte können, die als Grund zu der Einweisung in eine staatliche Erziehungsanstalt rechtfertigt hätte. Deswegen kritisiere ich die Erhebungsberichte des Jugendmagistrats als schlampig, unvollständig, wahrheitswidrig und teilweise konstruiert. Offenbar nur damit ich sogleich in staatlichen Heimen gesteckt werden konnte, denn dazu hat man nicht einmal die Hauptverhandlung abgewartet, sondern ich wurde schon Monate vor der Verurteilung im September 1964 in das Polizeiheim überstellt (57.) und in Juni 1964 in das Erziehungsheim „Lindenhof“ in Eggenburg (62. S. 2). Ein Tag darauf, 24.12.1963 in Untersuchungshaftgefängnis für jugendliche im 3. Bezirk, Rüdengasse 7-9 eingeliefert, musste ich mich in der Zellenabteilung in einen winzigen Umkleideraum zunächst vor einen Wärter und Mithäftlinge, letztere sogenannte Hausarbeiter komplett nackt ausziehen. Dann wurde ich vom Wärter unter den Achseln und zwischen die Gesäßbacken kontrolliert und anschließend mit Läusepulver bestreut. Als Bekleidung folgte man mir dann ein Gefängnisset mit Körperkleidung und Bettwäsche aus. Danach wurde ich in eine Zweimannzelle allein untergebracht. Sich vor fremden Menschen nackt ausziehen zu müssen ist schon entwürdigend und bedrückend genug. Noch dazu aber vor Mitgefangenen mit neugierige blicken begutachtet zu werden ist sehr beängstigend. Diese Erfahrung im Gefängnis sollte mich aber über Jahrzehnten begleiten, nämlich das die Würde des Menschen hinter Gittern nichts zählt. Da ist man geistig, psychisch und physisch nackt ausgezogen und jeder, ob Wärter oder Mithäftling hat Einblick darauf, der Einblick wiederum für Gesprächsstoff in jeder Art und Weise der Abartigkeit liefert, sei es was die Straftaten angeht oder privates. Die kleine Zweimannzelle, etwa 8 qm groß mit einem Stockbett und herunterklappbaren Wandtisch, zwei Sitzhocker und zwei kleinen Wandregalen und einen kleinen Ofen war spartanisch eingerichtet. Seite 22 von 60 Für den Ofen, der nur in den Morgenstunden von den Beamten angezündet werden durfte gab es nur ein Brikett pro Tag. Untertags musste zum durchlüften zumindest ein Fensterflügel geöffnet bleiben. Es war mitten im Winter und eiskalt. Aufstehen war strickte um sechs Uhr früh und das Bett durfte während des Tages bis zwanzig Uhr abends nicht benützt werden. Ich saß zumeist klappern vor Kälte bei Tisch und harrte die Stunden oft weinend dahin. Die Kälte und Einsamkeit sowie die Stille rund herum - man hörte gelegentlich nur die markanten Stimmen und Rufe oder die Schreie der Beamten sowie das Klirren der Schlüsselbünde, wenn eine Zelle geöffnet und lautstark wieder zugeschlagen wurde, war eine einzige Tortur. Ich begann das Bett wieder zu nässen und wurde deswegen von den Beamten stets angeschrien und verspottet. Die genässten Leintücher musste ich über den Ofen halten oder auf das Bett ausbreiten. Frische Bettwäsche- und Unterwäschetausch gab es nur alle zwei Wochen einmal. Ganz Unangenehm waren mir die Besuche eines Gefängnispfarrers, der jeweils einmal in der Woche in die Zelle kam, während der Wärter die Zellentür zulehnte und wieder wegging, so dass ich mit dem Pfarrer allein war. Er hatte die Gewohnheit, sich unmittelbar neben mir niederzusetzen und mir jedes Mal beim Oberschenkel zu streicheln, wobei er mir auch direkt in den Schritt berührte, während er gleichzeitig auf mich einredete, ohne dass ich ihn verstand. Das verursachte in mir Unbehagen und Unwillen und ich war jedes Mal froh und erleichtert, als er wieder ging. Heute würde ich es eindeutig als sexuelle Belästigung definieren, die er raffiniert ausübte, indem er mir das den Eindruck vermittelte, das die Berührungen in den Schritt versehentlich wären. Trotz klirrender Kälte und der dürftigen Gefängniskleidung durfte man den täglichen Spaziergang in einen sehr kleinen Hof nicht fern bleiben. Die Bewegung im freien gestaltete sich in Zweierreihe, ohne dass man mit die vordere oder hintere Reihe Sprechkontakt aufnehmen durfte. Die strengen Blicke der Wärter verfolgten jeden Schritt der Spaziergänger, wie dressierte Hunde zu jeder Zeit Sprungbereit. Insgesamt kann man von der Ausübung eines strengen militärischen Drill der Wärter sprechen, die im Jugendgerichtshof an jugendlichen Häftlinge praktiziert wurde. Das Essen war zumeist nur lauwarm und schmeckte nach nichts oder grauslich. Das Blechgeschirr war schwerer als der Inhalt. Ich aß gerade so viel, dass ich nicht verhungerte. Zweimal oder dreimal wurde ich aus der U-Haft Justizpersonen vorgeführt. Ich war aber von den ganzen Umständen vor und nach der Festnahme derart introvertiert, das ich kaum ansprechbar war oder imstande zu sprechen. Das Problem war zudem, dass ich es damals verstandsmäßig nicht begriff einem anderen Menschen unrechtes angetan zu haben oder sowas überhaupt bewusst beabsichtigt zu haben. Ich war mir nicht einmal bewusst vom Sohn meines Bäckermeisters für seine sexuellen Gelüste missbraucht worden zu sein. Und wenn man den Befund/Gutachten von 1964 berücksichtigt (60.), so lagen mit der retardierten geistigen Entwicklung durchaus konkrete und objektive Schuldausschließungsgründe vor. Nach zirka eine Woche schmerzlicher Einsamkeit in der Einzelhaft wurde ein zweiter jugendlicher in meinen Haftraum untergebracht. Er war 17 Jahre alt und körperlich größer und fülliger und irgendwie war er mir von Anfang an unsympathisch. Seine Mimik und Ausstrahlung war finster und Seite 23 von 60 irgendwie böse. Und mein Gefühl sollte mich nicht täuschen. Er redete drauflos, aber Ich verstand ihn nur brüchig. Es kam keine Unterhaltung zustande. Mein bisheriges Gefühl der Einsamkeit, wechselte nun in ein Gefühl der Beklemmung. Nach ein paar Tagen wurde ich im schlaf aufgeschreckt, weil ich jemanden in meinen Bett spürte, der sich gegen meinen Rücken und Hinterteil presste und der mir gleichzeitig die Unterhose runterzuziehen versuchte. Es war mein Zellenpartner. Vor Schreck stieß ich ihn von mir weg und er fiel vom Bett auf den Boden. Das ist meine erste Erinnerung überhaupt, mich gegen einen anderen Menschen erstmals gewehrt zu haben und noch dazu Körperkraft angewendet zu haben, wenn auch in Schreck und in Notwehr. In der Folge belästigte er mich mehrmals, indem er mir wiederholt auf den Hintern fasste. In meiner Angst drängte ich ihn jedes Mal von mir weg oder ich wich ihm aus, soweit es in eine kleine Zelle überhaupt möglich war. Ich kam nicht auf den Gedanken einen Beamten darauf anzusprechen, denn instinktiv waren sie für mich nicht Freund und Helfer, sondern Peiniger, die mich unter quälenden Bedingungen festhielten. Umso erleichtert war ich dann, als er eines Tages aus U-Haft entlassen wurde. Das war meine erste konkrete Erfahrung mit Homo- oder Bisexuellen, das mich sehr verängstigte und irritierte. Es war überhaupt eine Phase meines Lebens als halbwüchsiger mit beschränkten Deutschkenntnissen, in der Phase ich - beginnend mit dem Heimaufenthalt in Judenau bei Tulln bis zur Festnahme und der sexuellen Belästigung in der Zelle - mit fürchterlichen Situationen und Erlebnisse konfrontiert wurde, die mich in jeder Hinsicht geistig, physisch und psychisch überforderten. Die Welt und die Kluft zwischen mein glückliches Leben und heranwachsen in Uruguay in Liebe, Frieden und Gewaltlosigkeit, in Gesundheit und in freier Natur und Freiheit im Vergleich zu der Unmenschlichkeit voller Gewalt und Menschenverachtung mit der ich in Österreich konfrontiert wurde und erdulden musste, konnte für einen halbwüchsigen Kind wohl nicht schlimmer sein und nicht schlimmer kommen, letztere sollte ich mich gewaltigste täuschen. Die Besuche meiner Eltern im Jugendgefängnis in Untersuchungshaft verliefen immer sehr traurig. Sie wollten immer wieder erfahren und wissen, was ich mit den Überfallen auf die Mädchen tatsächlich zu tun hatte, aber ich wusste es selbst nicht oder ich war nicht in der Lage darüber zu sprechen, weil ich selbst nicht damit zurechtkam. Nach knapp zwei Monate in Untersuchungshaft wurde ich gegen Mitte Februar 1964 in das Polizeiheim für Mädchen und Knaben im 9. Bezirk überstellt (57.). Der Prozess fand erst im September 1964 statt, wie bereits berichtet. Ich wurde wegen versuchter Beihilfe zur Notzucht zu vier Monaten bedingter Haftstrafe verurteilt mit der Auflage der Einweisung in die Erziehungsanstalt „Lindenhof“ in Eggenburg. Während des Prozesses wurde eindeutig aufgeklärt, dass ich persönlich keine sexuellen Absichten hatte, sondern dass ich zur Beihilfe beeinflusst und angestiftet wurde (61.), 4 Vr 861/64, Hv 83/64 des JGH Wien. Das Polizeiheim war räumlich gut eingerichtet und sauber und in den Abendstunden im Vergleich zu dem Kinderheim in Judenau bei Tulln gut beleuchtet. Die Gruppenabteilung im ersten Stock war maximal mit 20 Zöglingen belegt. Das gemeinsame Schlafzimmer war nicht beengt und der Tagesraum ausreichend Groß, ausgestattet mit Radio, Tischtennis, einen kleinen Billardtisch sowie Seite 24 von 60 mit Brettspielen und ein Bastelraum. Die Toilette und der Waschraum mit Warmwasserdusche waren getrennt und in sauberen Zustand. Das Heim „Diesterweg“ im 13. Bezirk und das Polizeiheim im 9. Bezirk waren eindeutig der totalen Gegenkontrast zu dem Kinderheim in Judenau bei Tulln. Heute gleichzeitig ein Beweis für mich des schizophrenen Zustandes zwischen bösem und gutem der österreichischen Seele. Es soll auch die einzigen zwei Kinderheime bleiben, in die ich eine relativ normale Behandlung der Kinder und Jugendlichen erlebte. Die nachfolgenden waren nicht weniger katastrophal. Offensichtlich wegen der menschlicheren Behandlung im Polizeiheim waren die Zöglinge allgemein in einen weit besseren physischen und psychischen Gesamtzustand und in relativ guter Stimmung. Ich wurde von ihnen zum Tischtennis und anderen Freizeitspiele animiert, wobei die Sprachbarriere keine Rolle spielte. Im Gegenteil, sie waren freundlich und brachten mir viele deutschausdrücke bei. Die Erzieher und Erzieherinnen behandelten die Zöglinge nicht überschwänglich freundlich, aber normal ohne Schreinereien oder körperlichen Misshandlungen. Da ich weiterhin das Bett nässte, bekam ich von den Erzieher schelten, aber diese hielten sich im Rahmen. Als Lösung bekam ich zur Schonung der Matratze eine Gummiunterlage. Der Speiseraum war im zweiten Stock in der Mädchenabteilung, wo wir Knaben nach dem Essen täglich ein bis zwei Stunden unter Aufsicht von ErzieherInnen bleiben durften. Wir durften uns mit den Mädchen gemeinsam unterhalten oder mit Brettspielen die Zeit vergnügen oder zu Radiomusik tanzen. Ich war schüchtern und Kontaktarm, noch konnte ich tanzen. Ich saß mehr oder weniger allein in einer Ecke herum und schaute das treiben zu. Plötzlich kam ein Mädchen zu mir, setzte sich neben mir und versuchte mit mir zu sprechen. Vor Überraschung und Verlegenheit brachte ich kein Wort heraus. Das Mädchen nahm mich einfach bei der Hand, führte mich zu den tanzenden hin und wollte mit mir tanzen. Als sie verstand, das ich nicht tanzen kann, legte sie meinen Armen um ihre Hüpfte und die ihre um meinen Hals und bewegte sich mit mir eng umschlungen im Kreise. Ich hatte zuvor noch nie einen so nahen Kontakt zu einem fremden Mädchen oder jungen Frau, denn deswegen ich verurteilt wurde hatte ja mit Normalität absolut nichts zu tun. Als sie mir dann zum Abschied noch dazu auf die Wange küsste, war ich völlig durcheinander. Jedes Mal nach dem Essen kam sie zu mir und blieb bei mir bis wir wieder in der Knabenabteilung zurückkehren mussten. Wir saßen zusammen oder tanzten miteinander. Und als sie mir eines Tages auf den Mund küsste, war ich zunächst erschreckt und voller innerlicher Aufregung. Sie hieß Renate und war 16 Jahre jung. Sie hatte rotbräunlichen Haare und war sehr schön. Es war offensichtlich, dass sie mich mochte. Ihr Interesse für mich weckte in mir Neugier und Zuneigung, wie ich meinen Leben zuvor noch nie verspürt hatte. Damals verspürte ich auch zum ersten Mal sexuelles Bedürfnis. Mein Penis wurde öfters steif, aber ich konnte zunächst nichts damit anfangen. Erst als ich eines Tages unter der Dusche war und auch mein Penis wusch, hatte ich plötzlich ein Orgasmus. Dieses Erlebnis war so heftig, dass ich unter der Dusche vor schwachen Beinen das Gleichgewicht verlor und auf die Knie fiel. Von da an begann ich gelegentlich in der Nacht im Bett mein Penis durch streicheln zu erregen und hatte dabei manchmal ein Orgasmus. So machte ich erstmals Bekanntschaft mit der Sexualität und Seite 25 von 60 so lernte ich auch das onanieren und meine sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Tiefe Enttäuschung und Traurigkeit verspürte ich dann, als sie Wochen nach ihrem Kennenlernen völlig überraschend in ein anderes Mädchenheim verlegt wurde, ohne dass wir uns zumindest voneinander verabschieden hätte können. Sie war ganz einfach von einem Moment auf den anderen weg. Ich erfuhr nur, dass sie in ein anderes Mädchenheim gekommen ist. Sie war nicht nur das erste Mädchen, das mir das Gefühl der Liebe und Zuneigung zwischen Frau und Mann lehrte und schenkte, sondern sie war auch ein Halt für mich. Ich habe sie nie vergessen. Ihr Gesicht und das schöne Gefühl, das sie mir damals in wenigen Wochen schenkte sind mir bis heute vertraut und in meinen Erinnerungen schmerzlich eingeprägt. Schmerzlich deswegen, weil ich mich von ihr nicht einmal verabschieden konnte und ich sie in meinen Leben nie wiedersah. Enttäuscht und offensichtlich tief deprimiert über ihren Verlust beginn ich unbewusst einen Fehler, das bittere Folgen nach sich zog, gleichzeitig ein Beweis für mich heute, wie labil und leicht beeinflussbar ich damals war. Gelegentlich durften wir uns Heiminsassen auch im Innenhof des Polizeiheimes bewegen. Bei so einer Gelegenheit ließ ich mich in meiner schlechten Stimmung von einem Mitinsassen zur Entweichung überreden. Normalerweise war das Tor zur Straße stets verschlossen, wenn wir gelegentlich zum Spazierhof im Innenhof durften. An diesem Tag war der Erzieher offenbar unaufmerksam. Ich fragte mich durch bei Passanten, die mir den Weg wiesen. Zuhause angekommen, waren meine Eltern nicht da. Nur mein größerer Bruder, der mir sofort einredete in dem Heim zurückzukehren, was ich auch in seiner Begleitung tat. Im Heim wieder zurück, bekam ich ein paar feste Ohrfeigen und wurde tagelang ganztätig in einen Einzelraum eingesperrt. Anschließend wurde ich in das Durchzugsheim „Im Werd“ im 2. Bezirk in Wien verlegt (62. S. 2). Das man so streng vorgegangen ist, obwohl ich freiwillig in den Heim zurückgekehrt war führe ich heute darauf zurück, das ich aus dem U-Haft im Polizeiheim kam und die Gerichtsverhandlung noch anhängig war, sodass man offenbar keinen weiteren Risiko mehr im Kauf nehmen wollte. Die geschlossene Abteilung mit vergittertem Fenster im zweiten Stock des Durchzugsheimes erinnerte mich sofort an den Missstände im Kinderheim Judenau bei Tulln. Es gab einen einzigen Schlafraum mit zirka 25 wackligen und quietschenden Betten, ausgestattet mit löchrigen und verschmutzten Matratzen, Bettdecken und Bettwäsche. Der Tagesraum mit groben Holztische und Bänken eingerichtet war ebenso in einen desolaten Zustand. Der Waschraum mit Dusche und WC, getrennt nur durch Plastikvorhänge diente gleichzeitig als Geschirrwaschraum und befand sich nicht weniger in einen desolaten Zustand. Der Verputz der Wände, sei es am Gang der Abteilung, im Schlafzimmer oder im Tagesraum teils abgebröckelt und schmutzig. Die Kleiderspins als Blech teils verrostet und verbeult. Das Heimgewand veraltet und teils geflickt. Die Verwahrlosung des Heimes und der Insassen war schon mit den ersten Blick nicht zu übersehen erschreckend. Einzig das Dienstzimmer und WC-Raum der Erzieher erhob sich durch besondere Sauberkeit und Ausstattung hervor. Die Erzieher selbst stämmig und furchterregend. Ihre Ausstrahlung streng bis Seite 26 von 60 feindselig. Der Name „Durchzugsheim“ sagt wohl schon alles. Offenbar gingen die Erzieher davon aus, das kein Zögling über längere Zeit da bleibt und das man sich daher um Zöglinge und um sonstiges nicht besonders kümmern muss, so dass es zu einer allgemeinen Vernachlässigung kam. Vom ersten Augenblick an fühlte ich mich in dem Durchzugsheim eingeschüchtert und verängstigt. Die ca. 25 Heiminsassen waren durchgehend älter als ich. Manche davon, wie ich nach Tagen erfuhr, hatten schon mehreren Vorstrafen und Haftstrafen im Gefängnis verbüßt. Nur zwei oder drei Zöglinge waren in etwa in meinem Alter von 14 ½ Jahren. Im Gegensatz zum Polizeiheim, wo es sauberer, ruhiger, freundlicher und disziplinierter zuging, verlief im Durchzugsheim alles viel lauter und teilweise durcheinander. Streitereien standen auf der Tagesordnung und mitten drinnen die Erzieher, die ebenso herumschrien und nicht selten klatschenden Ohrfeigen austeilten oder den Zöglingen fast ständig mit „Arschloch“, „Drecksau“ oder „Verbrecher“ beschimpften. Wörter, die mir geläufig waren, weil diese auch in den vorgehenden Heimen verwendet wurden, wenngleich nicht so oft und aggressiv, wie im Durchzugsheim. Im Schlafraum zu schlafen war schrecklich. Ich konnte oft bis tief in der Nacht nicht einschlafen, sodass ich mich auch Untertags ständig übermüdet fühlte. Die quietschenden Betten, die Wirrwarr von Gespräche und Gelächter der Mitzöglinge, aber auch Gestöhne und Schmerzenslaute hielten mich wach. Stille herrschte nur, wenn die Erzieher zwischendurch mit Taschenlampen Kontrollgänge machten. Im Bild sieht es viel sauberer und geordneter aus, als es in Wirklichkeit war Mit der Zeit bekam ich mit, dass sich manche Zöglinge in einen Bett zusammenlegten und homosexuelle Beziehungen unterhielten, sobald sich die Erzieher von den Kontrollgängen zurückzogen. Manche freiwillig und manche wurden genötigt, wie mir ein Zögling meines Alters erklärte, mit den ich mich nach ein paar Tagen etwas angefreundet hatte. Er war ebenso wie ich zurückgezogen und wir hielten uns eher am Rande anderer Zöglingen. Dasselbe Schicksal des Missbrauchs hätte beinahe auch ihn selbst getroffen, erzählte er mir. Er hatte nur Glück, das ihn andere Zöglinge geholfen hatten. Ich selbst war nach kurzem Aufenthalt im Durchzugsheim auch betroffener. Ich war im Waschraum und wusch mein Geschirr, als mich ein älterer Zögling am Gesäß fasste und nicht loslassen wollte. Ich stieß in mit den Händen von mir weg, worauf er es offensichtlich als Angriff und Beleidigung wertete und mir ein paar Faustschläge am Körper und Gesicht verpasste. Ich schlug nicht zurück, weil er viel Seite 27 von 60 stärker war. Ich trug Rötungen und ein blaues Auge davon. Er drohte mir wieder zu schlagen, falls ich den Erzieher was sagen sollte, was ich nicht tat. Andererseits fragte mich nie ein Erzieher, woher ich das blaue Auge hätte. Das schien ihnen nicht zu interessieren. In der weiteren Folge meines Aufenthaltes im Durchzugsheim war es geläufig, das Zöglinge gelegentlich Verletzungen aufwiesen, aber es kümmerte sich keiner darum. In der Folge wurde ich mehrmals während der Nachtruhe durch Annährungsversuche sexuell belästigt, aber zu meinem Glück kam es nicht zum sexuellen Missbrauch oder zu anderen körperlichen Attacken, wohl aber zu Beschimpfungen und Anfeindungen wegen meiner Abführe. Die Zöglinge fanden sich in Gruppen zusammen, in stärkeren und schwächeren. Die stärkeren beherrschten die Szenerie, indem sie ihre Überlegenheit zur Schau trugen und ihren Launen und Aggressionen bei den schwächeren ausließen sowie ihre gemeinen und schweinerischer Späßchen. So z.B. war eine der häufigsten Praxis der Erniedrigung, dass sich der eine die Hose und Unterhose runterzog und der schwächere musste ihn vor allen anderen auf den Gesäßbacken küssen, worauf diese dann laut auflachten. Oder das bespucken. Vereinzelt kam es auch vor, dass zum Späßchen oder als Strafe auf schwächeren Zöglingen uriniert wurde. Im Tagraum gab es nur ein Tischtennis und es wurde ständig darum gestritten. Die stärkeren setzten sich immer durch, mit Ohrfeigen, durch wegstoßen oder mit Drohungen. Das ganze Durchzugsheim war von den Erzieher und Zöglingen her von Vernachlässigung, Aggressivität und Gewalt geprägt, begleitet von Schikanen sowie von Homosexualität und sexueller Nötigung. Die Erzieher, wenn überhaupt diese Bezeichnung zutreffend sein kann, hielten sich zumeist im Dienstzimmer auf. Wurden sie einmal tätig, so zumeist aggressiv mit Beschimpfungen oder mit klatschenden Ohrfeigen und heftige Fußtritten. Ich nässte weiterhin das Bett und wurde auch im Durchzugsheim deswegen von dem Erzieher öfters erniedrigt und von manchen Zöglingen gehänselt. Die genässten Leintücher musste ich zum Trocknen auf das Bett ausbreiten, wodurch die genässten stellen hervorstachen, was wiederum bei den Zöglinge für Gelächter und Spott sorgte. Bett- und Leibwäsche wurden nur alle vierzehn Tagen getauscht. Besonders erniedrigend und ängstlich machte mich auch die Praxis, die nur ein und derselbe Erzieher unter den Vorwand der Hygienekontrolle durchführte. Er ließ uns Zöglinge vor dem Schlafengehen mit heruntergezogener Unterhose am Gang in Reihe aufstellen und begutachtete jeden einzelnen Zögling. Man musste die Vorhaut des Penis aufziehen und danach musste man sich umdrehen, bücken und die Gesäßbacken auseinander halten. Gelegentlich packte er persönlich zu, falls der Zögling seine Gesäßbacken nicht ordentlich auseinanderhielt. Unter den Zöglingen war der Erzieher als homosexuell verschrien sowie dass er sich während des Nachtdienstes gelegentlich Zöglinge im Dienstzimmer holte und ihre Willigkeit mit Zigaretten quittierte. Bei Unwilligkeit soll er Zöglingen mit Strafmaßnahmen eingeschüchtert haben. Ich sah mehrmals persönlich, wie er das Schlafzimmer nach der Nachtkontrolle manchmal in Begleitung eines Zöglings verließ. Erst bei meinen zweiten Aufenthalt 1965 im Durchzugsheim „Im Werd“ (62. S. 2) versuchte es Seite 28 von 60 derjenige Erzieher auch bei mir. Ich musste ihn kurz nach Beginn der Nachtruhe im Dienstzimmer folgen, die er hinter sich zulehnte. Dort forderte er mich unter den Vorwand der Kontrolle auf, dass ich mein Nachthemd ausziehe und die Unterhose runterziehe. Als ich das getan hatte begann er mein Hintern anzufassen und zu streicheln, gleichzeitig entblößte er sein Penis und begann zu masturbieren. Ich war völlig erschreckt, reagierte aber indem ich meine Unterhose schnell wieder aufzog und aus dem Dienstzimmer rausrannte, die er zu meinem Glück nur zugelehnt, aber nicht verschlossen hatte. In der Folge warf er mir des Öfteren einen bösen Blick zu, aber er versuchte es nicht wieder. Und ich versuchte ihm stets auszuweichen, jedenfalls nicht in seiner greifbaren Nähe zu kommen. Es gab keine Bewegung im Freien. Es war eine geschlossene Abteilung. Man verharrte den ganzen Tag in der Abteilung, am Gang oder im Tagraum oder im Waschraum, letztere wo sich Zöglinge zu Raucherzeit um 09.00 und 15.00 Uhr zum Rauchen drängten, da in allen anderen Räumlichkeiten das Rauchen verboten war. Bei dieser Gelegenheit begann ich das erste Mal zum Rauchen. Das Essen war nicht nur grauslich, sondern auch karg, sodass man immer ein Hungergefühl verspürte. Im Gegensatz zum Polizeiheim gab es keine Teller oder Salatschüssel, sondern Blechnäpfe. Es verging kein Tag der Streitereien und gelegentlich auch Raufhandel, weil sich die Zöglinge gegenseitig Essen zu stehlen oder abzunötigen versuchten. Meine Eltern, die mich so alle zwei Wochen zu Besuch kamen, brachten mir zum Glück stets ein Paket mit Lebensmitteln mit. Ich war eine der sehr wenigen im Durchzugsheim, der ein Paket bekam. Die meisten Zöglinge hatten von niemand Besuch. Ich wurde von vielen Zöglingen angeschnorrt und ich gab was davon ab. Offenbar hat mich das vor schlimmere Erlebnisse durch Mitinsassen gerettet. Am 9. Juni 1964, ein Tag nach meinen 15. Geburtstag musste ich überraschend meine Sachen zusammenpacken und ich wurde in das Erziehungsheim „Lindenhof“ in Eggenburg verlegt, etwa 80 Kilometer von Wien entfernt (62. Seite 2). Erziehungsheim „Lindenhof“ in Eggenburg/NÖ Insgeheim gab ich meinen Eltern die Schuld dafür, dass ich im „Lindenhof“ eingeliefert wurde, zumal sich mein Vater seinerzeit bei den Behörden weit übertrieben negativ über meine Person geäußert hatte. Viele Jahre später entschuldigte er sich bei mir, indem er mir erklärte, dass er damals sehr zornig auf mich war, weil er tatsächlich davon ausging, dass ich ein Mädchen vergewaltigen wollte. Seite 29 von 60 Erst als er in der Verhandlung mitbekam, das ich von den anderen nur zur Beihilfe missbraucht wurde, erfuhr er die Wahrheit, aber es war schon zu spät, erklärte er mir, weil das Wiener Jugendmagistrat meine Einweisung in ein Erziehungsheim schon beschlossen hatte und es trotz seiner Bemühungen nicht widerrufen wollten. Offensichtlich wurde ich vom Jugendmagistrat schon schuldig gesprochen noch bevor die Verhandlung zur Sache stattgefunden hatte. Im Lindenhof angekommen wurde ich in der Zugangsgruppe 10er untergebracht. Die Fenster der gesamten Gruppenabteilung waren vergittert, die Tür der Gruppe war aus Eisen oder Stahl und stets verschlossen. In der Gruppe waren zirka 25 Zöglinge. Die Gruppenabteilung viel zu klein dazu. Im Schlafzimmer waren die Betten so eng aneinander gereiht, das man sich anstrengend musste die Schuhe oder Sandalen an- oder auszuziehen. Im Speiseraum, das gleichzeitig als Unterhaltungsraum diente standen die Tische und Stühle ebenso eng aneinandergereiht. Der kleine Waschraum diente zur Körperpflege, gleichzeitig zum Geschirrwaschen, als WC und Abstellraum für Schuhe und Kleider. Eine Dusche gab es nicht. Es war so eng in der Gruppeabteilung, das sowohl im Waschraum, als auch im Tagesraum geradezu ständig Gedränge herrschte. Man hatte ständig den Geruch der körperschweiß anderer vor der Nase, nicht erst die Rede diesen der Furzerei. Als Neuling wurde ich von den Zöglingen mit unangenehmer Blicke begutachtet oder mit fragen überhäuft. Ein Zögling drückte mir die einheitlich graue Heimbekleidung sowie Leintücher und Decken in die Hand und wies mir mein Bettplatz im Schlafzimmer zu sowie mein Tischplatz im Tagraum. Wie ich mit der Zeit mitbekam und erfuhr, handelten es sich bei solchen Zöglingen um Günstlinge der Gruppenerziehern, die in der Gruppe als sogenannte Gruppenältesten die Tätigkeit eines Hausarbeiters innenhatten, die von den anderen Zöglinge insgeheim als „Kapos“ bezeichnet wurden. Die Kapos hatten die Aufgabe, die Erzieher Arbeit abzunehmen und genossen dafür besondere Freiheiten und Privilegien, bis zur Misshandlung und sexueller Missbrauch von Mitinsassen hin, wie ich bald erfahren und persönlich erleben sollte. Die Erzieher selbst, wie ich im Verlauf meines dortigen Aufenthaltes sah, saßen zumeist in dem Dienstzimmer herum. Sie nahmen auf uns Zöglinge keinen Einfluss. Sie schritten höchstens dann ein, wenn zu lauten Geschrei oder Tumulte mehreren Streithähne ausbrach. Ansonsten ließen sie es unter den Zöglingen so schweifen, wie es halt kam. Ich wurde als Neuzugang von keinem Erzieher angesprochen oder aufgeklärt, was mit mir heute oder morgen geschieht. Diese Ungewissheit, wenn auch unbewusst, weil ich solche Umstände und Situationen damals nicht verstandsmäßig verarbeiten konnte, versetzte mich in Angst, die Angst mich wiederum ständig begleitete. Ich wurde nur von einem Kapo auf meine Plätze im Schlafzimmer, im Tagesraum und auf meinen Ablegeplatz im Waschraum eingewiesen – und das war es. Während des Nachtdienstes waren überhaupt keine Erzieher in der Gruppenabteilung anwesend. Der Zugangsgruppe war schließlich vergittert und verschlossen. Zur Nachtkontrolle kamen gelegentlich Erzieher außerhalb der Abteilung vorbei. Dementsprechend laut und wild ging es zumeist im Schlafzimmer während der Nachtruhe zu. Lautes Reden und Streiten, Gelächter, rattern und quietschen der Betten, begleitet von Stöhnen, wimmern Seite 30 von 60 und gelegentlich auch lauten Schmerzensschreie. Trotz der Dunkelheit der Nacht konnte man durch die Hofbeleuchtung, die durch die Fenster eindrang schemenhaft Zöglingen beobachten, wie sie von einen Bett auf anderen gingen oder krochen. Mäusetill wurde es nur, wenn man das Klirren des Schlüsselbundes der Erzieher und das öffnen der Tür hörte, wenn sie zur Nachtkontrolle kamen. Aufstehen war um sechs Uhr früh und danach wurde das Schlafzimmer verschlossen und um 20.00 Uhr zur Nachtruhe wieder geöffnet. Nur zum Putzen wurde es kurzfristig geöffnet. Als Neuling wurde ich zum Putzen des Schlafzimmers von Kapos der Abteilung eingeteilt. Dabei geschah es, dass ich nach wenigen Tagen in der Gruppenabteilung sexuell missbraucht wurde. Ich war gerade beim zusammenkehren und aufwischen des Schlafzimmers, als ein älterer und fülliger Kapo im Schlafzimmer reinkam und die Tür hinter sich zuklappte. Er kam geradezu auf mich zu und fasste mich mit einer Hand sogleich am Gesäß und mit der anderen packte er mich beim Hals und versuchte mich auf das Bett runter zu drücken. Ich versuchte mich loszureißen, aber er war viel zu stark und zu schwer um ihn wegzustoßen. Er drückte mich ins Bett, riss mir die Hose und Unterhose runter, legte sich mit seinem ganzen Gewicht auf mich und während er mich vergewaltigte drückte er mir den Mund zu. Das ging so schnell, das ich vor Schreck nicht einmal ein Hilfeschrei ausstoßen konnte, dann aber war es zu spät zum schreien, weil er mir schon den Mund zudrückte. Offensichtlich hatte er schon Routine darin Mitinsassen zu vergewaltigen. Es waren fürchterliche Schmerzen. Als er von mir abließ, drohte er mir zu schlagen und mit dem umbringen, wenn ich es in Erzieher erzählen würde. Er erklärte mir auch, dass mich die Erzieher ohnehin nicht glauben würden, weil ich ein Vergewaltiger sei. Wochen später erzählte er mir, dass er es von dem Erzieher erfahren hätte, dass ich ein Vergewaltiger sei und dass man mir demnächst den Prozess machen würde. Wie ich noch lernen sollte, war es selbstverständlich, dass zwischen Erziehern oder Justizwachebeamten mit Kapos regelmäßig ein Informationsaustausch stattfindet, die die Handlangertätigkeit der Kapos offensichtlich fördern sollte. Als Dank und Privileg wird den Kapos dafür ein Freiraum gewährt. Tagelang blutete ich aus dem After und hatte große Schmerzen, vor allem beim Stuhlgang. Der Kapo hatte offenbar bemerkt, dass er mich verletzt hatte und war in der Folge plötzlich freundlich zu mir und gab mir auch neue Unterhosen zum wechseln. Offensichtlich war er froh, dass ich ihn nicht verraten hatte und belästigte oder missbrauchte mich in der Folge nicht mehr. Wie hätte ich ihn schon verraten können! Schon aus Angst und Scham nicht, aber auch Mangel an Vertrauen zu den Erziehern. Als jüngerer und schwächerer Zögling ward man damals solchen Treiben der Homosexualität und sexueller Missbrauch, der Unterdrückung und Gewalt von Seiten älteren und stärkeren Zöglinge einfach wehrlos ausgeliefert. Wie man es auf das Foto des Polizeiausweises aus Uruguay sieht (63.), war ich damals bedauerlicherweise ein junger Bursche und damit in den staatlichen Heimen mit derart menschenverachtenden Praktiken ein klassisches Opfer für solchen Übergriffe. Solchen Gewalt und Erniedrigungen in halbwüchsigem Alter am eigenen Körper zu erleben vergisst Seite 31 von 60 man sein Leben lang nicht. Verarbeiten kann man es nur mit therapeutischer Hilfe, die damals und über Jahrzehnte für Heimopferkinder nicht gab. Man trug die Wut, der Scham und den Schmerz tief vergraben mit sich herum, oft unbewusst im Verlauf des weiteren Leben davon beeinflusst und getrieben. Man unterlag damals ohnmächtig das Gesetz der stärkeren und die Erzieher taten hierzu nichts dagegen, sondern sie förderten dieses Gesetz sogar, indem sie älteren und stärkeren Zöglingen als Kapos einteilten und ständig wegschauten. Ich wurde von den Kapos abwechselnd zum Putzen eingeteilt, davon in der Gruppe drei bis vier waren. Einmal musste ich das Schlafzimmer putzen, andersmal der Tagesraum und Waschraum. Das war meine einzige Beschäftigung während der ersten Monate. Im Tagesraum gab es zwar ein Billardtisch, aber diese wurde ständig von den Kapos und den sonst älteren und stärkeren Zöglinge benutzt. Durch betatschen und Annährungsversuche wurde ich in der Folge wiederholt auch von einigen anderen Zöglingen sexuell belästigt, aber nicht missbraucht. Homosexuelle Handlungen und sexueller Nötigung zwischen andere Zöglinge war in der Zugangsgruppe auch Tagsüber öfters zu beobachten, im Waschraum oder auf der Toilette. Ein zweiter jüngerer Zögling, der ebenfalls ein Neuling war erging es so wie mir. Wir freundeten uns an und er erzählte mir auch sexuell missbraucht worden zu sein. Und zwar das erste Mal schon im Durchzugsheim „Im Werd“ in Wien, wo auch ich einigen Wochen war. Jetzt würde er von einem anderen Kapo in der Gruppe missbraucht. Wir hatten beide großen Ängste und er sprach von Flucht und fragte mir, ob ich mitmachen würde. Ich bejahte und wir sprachen über Möglichkeiten zur Flucht, kamen aber zu keinen Plan. Der 10er Zugangsgruppe war den ganzen Tag geschlossen und nur wenige Zöglinge, die zu einer Arbeit eingeteilt waren durften es verlassen. Nur zum Täglichen Morgenapell im Innenhof des Heimes mussten wir unter Aufsicht von zwei Erziehern täglich gehen. Während dieses Apells wurden alle Gruppenabteilungen des Heimes Gruppenweise versammelt und gezählt. Wir waren zirka 250 bis 300 Zöglinge. Manchmal wurde von einem vorgesetzten Erzieher eine Rede gehalten. Das waren die einzigen Momente, die wir aus der Abteilung rauskamen. Im September 1964 wurde ich nach Wien zur Verhandlung gefahren. Im verhandlungsraum sah ich meine Eltern einmal wieder. Mein Vater war Berufstätig und meine Mutter musste auf die Kleinkinder aufpassen. Daher war es schwer nach Eggenburg zu fahren, um mich zu besuchen. Sie versprachen mir zwar wieder, mich bald wieder Nachhause zu holen, aber ich war hoffnungslos geworden. Ich wurde wegen versuchter Beihilfe zur Notzucht zu 4 Monate bedingt verurteilt, 4 Vr 861/64, Hv 83/64 des Jugendgerichtshof Wien (61.). Über den Verlauf der Verhandlung kann ich mich heute eigenartigerweise an fast nichts erinnern. Vielleich liegt es daran, dass ich das Amtsdeutsch nicht verstand oder weil ich dazu psychisch überfordert war. Meine Eltern erklärten mir am Schluss der Verhandlung nur, dass ich auf Aufforderung des Wiener Magistrats vorläufig im Erziehungsanstalt „Lindenhof“ in Eggenburg bleiben muss, obwohl sie sich beim Richter dagegen ausgesprochen hatten. Im Erziehungsheim zurückgekehrt, wurde ich Tage darauf plötzlich im Dienstzimmer des Erziehers Seite 32 von 60 gerufen. Dort hielt er mir die Verurteilung vor, beschimpfte mich als Scheißausländer und Vergewaltiger und verpasste mir eine fürchterliche Ohrfeige. Ich wurde kurzfristig ohnmächtig und wurde von den Kapos im Schlafzimmer getragen und ins Bett gelegt. Mehreren Tagelang blutete ich leicht aus dem Ohr, begleitet von starken Kopfschmerzen. Seither ist meine Hörfähigkeit am linken Ohr stark beeinträchtigt. Offensichtlich wurde durch die Heftigkeit und durch den Luftdruck der Ohrfeige das Trommelfell verletzt, dazu wahrscheinlich auch eine Gehirnerschütterung. Wegen dieser Misshandlung mit Verletzungsfolgen sah ich weder einen Arzt noch wurde ich in ein Krankenhaus zur Untersuchung und Behandlung vorgeführt. Es wurde schlicht vertuscht. Bei anderen Misshandlungen landete ich zwar mehrmals in das öffentliche Krankenhaus „Eggenburg“, allerdings von den Erziehern als Unfallmeldungen getarnt (62. S. 2, 4 u. 5). Wie ich damals diese Zeit des sexuellen Missbrauchs und Misshandlungen überstanden habe, weiß ich bis heute nicht. Heute kommt es mir vor wie ein Wunder, denn es folgten viel schlimmere und härtere Zeiten. Einige Wochen nach der Verhandlung in Wien wurde ich in den Heimbetrieb „Gärtnerei“ zur Arbeit eingeteilt, musste aber noch in der Zugangsgruppe bleiben. Zufällig wurde einige Zeit später auch mein Freund der Zugangsgruppe in die Gärtnerei eingeteilt. Die Arbeit in der Gärtnerei war sehr schwer. Auch bei Regen mussten wir die Felder und Äcker vom Unkraut befreien, Rechen und umspaten. Gelegentlich wurden wir auch in den privaten Wohnungen der Erzieher oder Nachbarn mit Gartenarbeiten oder zur Räumung oder zum Putzen von Kellerräumen beschäftigt. Es gab keinen Lohn dafür, manchmal nur ein belegtes Brötchen. Im Grunde waren wir Heimkinder damals die Sklaven der Erzieher und der Einwohner von Eggenburg und Umgebung. Mein Freund teilte mir eines Tages mit, dass er den Heimterror nicht mehr aushalte, das er flüchten wird und fragte mir, ob ich mitgehe. Irgendwie hatte ich Angst davor, weil bis Wien ein langer weg war, aber er versicherte mir, dass er wisse, wie wir ohne Probleme nach Wien kommen würden. Ich sagte zu. Tage später, als die anderen Zöglinge in den Rastgehäuse der Gärtnerei gingen, blieben wir auf dem Feld und begannen über die Felder und Äcker zu rennen. Als wir durch einen Acker liefen, wo ein Bauer gerade arbeitete, schrie er uns nach und als ich mich umblickte, sah ich wie der Bauer uns eine Heugabel nachwarf, der uns nur knapp verfehlte. Irgendwie verständlich, dass der Bauer wegen sein Frisch verarbeiteten Acker angefressen war, aber jugendliche wegen sowas einer Heugabel nachzuwerfen zeigt schon von erschreckender Kaltblütigkeit, die uns Heimkinder vor Augen geführt wurde und die uns auf den weiteren Lebensweg negativste beeinflusste und prägte. Als ich und mein Freund eine Landstraße erreichten, begann mein Freund Autostopp zu machen. Kurz darauf blieb ein Lastwagen stehen und wir durften in der freien Ladefläche steigen. Wir hatten Glück, den er fuhr direkt nach Wien. In Wien trennten wir uns und ich ging direkt nachhause im Hotel zu meinen Eltern. Es war nur meine Mutter zuhause und meine kleinen Geschwister. Wir freuten uns, aber meine Seite 33 von 60 Mutter machte sich große Sorgen, als ich ihr sagte, dass ich unerlaubt entwichen sei. Zur weiteren Besprechung wollten wir auf meinen Vater warten, der noch in der Arbeit war. Nach ein paar Stunden klopfte es aber an der Wohnungstür und als meine Mutter öffnete standen Polizisten vor der Tür, die mich mitnahmen. Nach eine Nacht im Polizeirevier, wurde ich mit dem Anstaltsbus wieder nach Eggenburg gebracht. Dort wurde ich den Anstaltsleiter vorgeführt, der seine Finger in meinen Ohrläppchen verkrallte und derart schmerzlich verdrehte, bis ich schreiend auf die Knie rutschte, begleitet von Beschimpfungen „Drecksausländer“, „Hurenkind“, „Verbrecher“ etc. Anschließend kam ich in die Strafgruppe 14, zynischer weise von der Heimleitung als „Besinnungsgruppe“ bezeichnet (64. Meldungen). Wie in meiner Stellungnahme im Anhang beschrieben, war die „Besinnungsgruppe“ nichts anderes als das Gefängnis der Erziehungsanstalt schlechthin, wo erst recht Willkür, Vernachlässigung, Tyrannei und Gewalt gegen halbwüchsigen jugendlichen ausgeübt wurde, gelegentlich auch gegen minderjährigen der Kinderabteilung , darunter erlebte ich auch 9-jährige Kinder, die ebenfalls wegen irgendwelche Verfehlungen oder Entweichungen in der Strafgruppe 14 landeten. Quasi eine Steigerung des bisher erlebten Heimterrors in der ebenfalls gesperrten Zugangsgruppe. In der Stellungnahme habe ich nur zu erwähnen vergessen, dass in der Strafgruppe jeder Zögling automatisch eine Glatze geschnitten bekam und eine spezielle gestreifte Bekleidung, wie früher Häftlinge. Nach ein paar Wochen in der Strafgruppe wurde ich wieder in den Zugangsgruppe verlegt, ohne die Möglichkeit auf eine Arbeit oder sonstige Freizeitgestaltung und Bewegung im Freien, sodass es eine Fortsetzung der Repressalien glich. In der Zugangsgruppe wurden nicht nur Neulinge untergebracht bis entschieden wurde, in welcher anderen Gruppenabteilung und zu welcher Arbeit er eingeteilt wird, sondern eben auch Zöglinge, die durch vermeintlichen Ordnungswidrigkeiten strafweise rückgestellt wurden. Allerdings ohne ein ordentliches Behördenverfahren, sondern willkürlich nach Gutdünken der Erzieher. Wie aus der unmenschlichen Unterdrückung oft resultiert, verabredeten sich mehreren Zöglinge zur Flucht aus der Zugangsgruppe, darunter auch ich. Wir warteten nur auf eine Unaufmerksamkeit der Erzieher, wenn sie für die Lieferung der Nahrungsmittel etc. die Abteilungstür öffnen mussten. Manche Erzieher entfernten sich manchmal kurz von der Tür, um etwas vom Dienstzimmer zu holen oder sonst aus welchen Grund. Bei so einer Gelegenheit flüchteten wir, insgesamt fünf Zöglinge. Wir rannten aus der Gruppenabteilung und über den Hof, kletterten über die Umzäunung des Heimes und rannten in den Wald, verfolgt von Erzieher, die die Flucht beobachtet hatten. Im Wald zerstreuten wir uns in allen Richtungen. Ich blieb mit einen zweiten zusammen und wir versteckten uns im Wald bis zur hereinbrechen der Nacht. Es war gegen Anfang Oktober 1964 und die Nächte schon sehr kalt. Die graue und dünne Heimoberbekleidung bot uns nicht viel Schutz, sodass wir zittern ausharren mussten. Wir marschierten eine Landstraße entlang und hofften auf ein Auto, der uns weiterbringen würde. Wir hatten kein Glück, marschierten aber weiter um uns durch Bewegung warm zu halten. Gegen Morgengrauen drangen wir in eine unbewachte Strohscheune, wo wir uns einigen Stunden Seite 34 von 60 ausrasteten. Dann marschierten wir weiter am Rande der Straße und bogen zu den Gleisen einer Bahnstrecke und gingen diese entlang. Als die Gleisen in einen Wald einbogen sprangen plötzlich hinter Bäumen hervor zwei Gendarmeriebeamten mit gezogener Waffen auf uns zu. Ich habe mir vor Schreck fast in die Hose gemacht. Die Beamten glaubten anhand unserer grauen Heimbekleidung, dass wir aus der Strafanstalt Stein ausgebrochen seien, da Strafgefangene eine identische Bekleidung trugen. Im nu waren wir im Heim zurück und wieder in der Strafgruppe, begleitet von Ohrfeigen und Fußtritte. Die Massenflucht hatten die Erzieher ziemlich erregt und sie reagierten ziemlich aggressiv und brutal. Drei von uns wurden schon am nächsten Tag erwischt, die anderen zwei wurden Wochen später in Wien erwischt. Ich kam wieder in die als „Besinnungsgruppe“ getarnte Strafabteilung 14. Es folgten Wochen der täglichen Misshandlungen durch die Erzieher und den Heimdirektor, letzterer täglich in den Morgenstunden erschien und die Zöglinge in Reihe aufstellen ließ und mit ohrfeigen, haarreißen und mit drehen des Ohrläppchen traktierte, begleiten von Drohungen und Beschimpfungen, um uns Heimkinder gegen Entweichungen einzuschüchtern bzw. mit solchen Methoden von Entweichungen abzuhalten (64.). Durch meine Entweichungen habe ich mich bei den Erziehern und Heimdirektor natürlich nicht beliebt gemacht, aber die Entweichungen waren nur eine Reaktion, um den Terror zu entkommen, ohne daran zu denken, das ich mir damit das leben noch schwerer machte. Es kam damals fast täglich zu Entweichungen von Zöglingen. Ich war keine Ausnahme. Es kam aber nicht nur allein zu Entweichungen, sondern gelegentlich auch zu Selbstbeschädigungen oder zu Selbstmordversuche. In zwei Fällen sogar zu Selbstmorde und In einen Fall 1964 sogar zu einen Mord an einen Zögling durch zwei Zöglingen, die die Leiche des ermordeten Zöglings in der Kanalisation des Heimes versteckten. Ermordet, um das Opfer den Anzug zu berauben. Kurz vor Weihnachten 1964 wurde ich wieder in der Zugangsgruppe verlegt. Wieder nur zur Anhaltung, ohne Arbeit, ohne Freizeitgestaltung und Bewegung im Freien. Ich war aber nicht der einzige Gezeichneter in der Gruppenabteilung. Die Hälfte davon war schon einmal geflüchtet oder wegen anderen Verfehlungen wieder zurückgestellt worden, letztere etwa wegen Raufhandels etc. Das Dasein in der geschlossenen Gruppe war tagtäglich Mangel an Beschäftigung, Freizeitgestaltung und Bewegungsraum eine schwere Belastung. Es war ein dahinvegetieren, während die Zeit stehengeblieben schien. Der einzige Unterschied zur Anfangszeit als Neuling war, dass ich in der Gruppe nicht mehr direkt sexuell belästigt oder schikaniert wurde. Anstatt dessen bekam ich manchmal Liebesbriefe von Zöglingen anderer Gruppen mit Beschwörungen, das ich mich in ihrer Gruppenabteilungen verlegen lassen sollte. Das war schon wahnsinnig, aber nichts Unübliches in einen Heim. Ich fühlte mich etwas geschmeichelt, noch dazu als gelegentlich eine Schokotafel als Geschenk ankam. Die Kapos, die mehr Freiheiten genossen waren die Überbringer. Mittlerweile genoss ich auch bei den Kapos Respekt und Ansehen, insbesondere nach der Massenflucht. März 1965 flüchtete ich wieder, begleitet von einem zweiten Zögling meiner Gruppe. Diesmal während des täglichen Appels im Innenhof. Nach der Massenflucht hatten die Gruppenerzieher auch Seite 35 von 60 beim täglichen Appel stets einem genauen Blick auf mich geworfen. Nach ca. drei Monaten allerding hat die Aufmerksamkeit nachgelassen. Während eines unaufmerksamen Momentes bogen wir um die Ecke hinter den Häuserblock des Heimes, so dass wir nicht mehr sichtbar waren und rannten weg. Es war schon eine Frechheit mitten aus dem Appel von hunderten Zöglingen zu flüchten, aber Mut bringt auch Erfolg. Mittlerweile hatte ich von befreundeten Zöglingen gelernt, dass man sich auf den ersten Tag der Flucht am besten verstecken sollte. So taten wir es auch. Wir versteckten uns im Wald, auch wenn es bitterkalt war harrten wir aus. Ein Stück Brot und eine Tafel Schoko hatten wir als Proviant mitgenommen. Als Wasser ließen wir Schnee im Mund zerrinnen. Am nächsten Tag zu Mittag stoppten wir einen Lastwagen, der uns bis Korneuburg brachte. Anhand der Begleitung erkannte der Fahrer, dass wir vom Heim geflüchtet waren und nahm uns trotzdem mit, ohne uns festzuhalten oder zu verraten. Von Korneuburg aus machten wir stopp bis Wien. In Wien blieben mein Fluchtpartner und ich zusammen. Wir gingen zu mir Nachhause und ich klopfte beim Fenster an. Meine Mutter wusste schon, dass wir geflüchtet waren, weil die Polizei schon vorbeigeschaut hat. Aus Angst von der Polizei erwischt zu werden gingen wir nicht in die Wohnung hinein. Stattdessen gab mir meine Mutter ein paar Schilling und eine Tasche mit essbarem. Wir spazierten durch Wien und suchten eine Schlafmöglichkeit. Nach Einbruch der Abenddämmerung versteckten wir uns in einer Parkanlage neben einen leeren Kindergarten. Da es bitterkalt war, kamen wir auf dem Gedanken ein Fenster des Kindergartens einzuschlagen. In den Räumlichkeiten fanden wir einige Decken und machten uns am Boden ein Bett. Das war überhaupt mein erster Einbruch in ein fremdes Eigentum. Am Morgengrauen machten wir uns wieder auf den weg, eigentlich ziellos. Wir waren nur froh aus dem Heim weg zu sein, ohne uns des weiteren Gedanken zu machen. Tagelang spazierten wir durch Wien herum und suchten stets nach Gelegenheiten, um in der Nacht zu übernachten. Dabei immer in einen Zustand der Angst und Anspannung, Ausschauhaltens nach der Polizei, um nicht erwischt zu werden. Ein Zustand, an den ich mich zukünftig noch gewöhnen sollte. Untertags holte ich extrem Vorsichtig durch das Wohnungsfenster meiner Mutter eine Tasche mit Essbarem und nach ein paar gewechselten Worten mit ihr, verschwand ich wieder so schnell ich gekommen war. Nach zirka eine Woche auf der Flucht, wurden wir von der Polizei in einer Baustelle aufgespürt und festgemacht. Ein Bauarbeiter hatte uns beobachtet und informierte sie. In Eggenburg rückgebracht, kamen wir erneut in die Strafgruppe 14, wo – per Exempel – wieder körperlichen Misshandlungen und Beschimpfungen stattfanden. Ich musste es wohl erdulden, wenngleich ich zwischendurch wegen Verletzungen durch die Misshandlungen im öffentlichen Krankenhaus Eggenburg wiederholt behandelt werden musste (62. S. 2, 4 u. 5). Nach ca. zwei Monate in der Strafgruppe, wurde ich wieder einmal in der Zugangsgruppe verlegt. Erstaunlicherweise war zu dieser Zeit eine siebentätige Reise mit der Zugangsgruppe nach Tirol geplant und ich durfte mitfahren. Ich vermute heute noch, dass die Reise in erster Linie Alibimäßig stattfand, um dem Wiener Jugendamt etwas vorzuweisen. Denn immerhin wurden wir Zöglingen bis Seite 36 von 60 dahin ganztätig in der geschlossenen und vergitterten Zugangsgruppe angehalten. Vielleicht hatten sich auch mehreren Eltern von Zöglingen beschwert. Ich vermute heute eher, dass das Heimpersonal und der Jugendmagistrat eher Angst vor der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit wegen des Raubmords an den Heiminsasse bekam und deswegen die zügeln lockerten. Wie es auch sei, uns Gruppeninsassen kam es wie ein Wunder vor. Ende August 1965 fuhren wir nach Galtür und von Galtür aus machten wir eine Bergwanderung bis Landeck. Dabei übernachteten wir in Berghütten. Jeder hatte einen Rucksack mit Lebensmittel aus Konserven und Brot sowie mit diverser Bekleidung und Unterwäsche. Die Reise und Bergwanderung war wirklich sehr schön. Mit dem Einschränkung aber, das ich und zwei weiteren Zöglingen stets neben der Erzieher verbleiben mussten. Die zwei anderen Zöglinge waren auch schon einmal auf der Flucht gewesen. Die Erzieher wollten uns offenbar ständig im Auge behalten und merkten dabei nicht, dass sie damit Druck auf uns ausübten und dass sie uns allen anderen gegenüber einschränkten und benachteiligten. Gegen mich kam erschwerend hinzu, dass ich einen Zögling wütend eine Faustschlag versetzte, weil dieser mich beim Schlafen in einer Berghütte, wo wir Zöglinge aus Platzmangel auf säcken ähnlichen Matratzen eng aneinander liegen mussten, wiederholt durch betatschen sexuell belästigte und keine Ruhe gab. Er war nicht aggressiv noch versuchte er es mit Körperkraft, sondern er war unglaublich lästig. Er war der weibliche Typ von bi- oder homosexueller, der offenbar einen männlichen Partner suchte. Mir war schon vorher aufgefallen, dass er sich stets Mühe gab weiblich zu wirken und dass er oft nach mir schielte. Zu dieser Zeit genoss ich bereits bei vielen Heimzöglingen wegen meines frechen Flüchtens großes Ansehen und Respekt. Vielleicht fühlte er sich deswegen zu mir hingezogen, nur das ich nicht interessiert war. Wenn ich in den Anfängen meines Aufenthaltes in den Durchzugsheim „Im Werd“ in Wien und in Eggenburg in der Zugangsgruppe einiges an sexueller Missbrauch und Belästigung durch stärkeren Zöglingen erdulden musste und ich dabei höchstens aus Angst Abwehrreaktionen zeigte, so war dieser Faustschlag in der Berghütte der erste überhaupt, der ich gegen einen anderen Menschen ausübte und der ich nicht aus Angst, sondern aus Wut ausgeführt hatte. In meinen Erinnerungen sehe ich darin die Anfänge eines Wendepunktes und Entwicklung meiner Person zum Selbstschutz und zur Selbstverteidigung, nämlich zu der schwellenden Angst, die mich nahezu täglich begleitete, kam allmählich auch Zorn und Wut zum Ausbruch zur Geltung. Nach der Bergwanderung in Landeck angekommen und in einer Herberge untergebracht, von wo uns der Reisebus nach zwei Tagen abholen und wieder ins Heim zurückführen sollte, durften die anderen Zöglinge mit einen Erzieher in Landeck Freigang haben. Ich und zwei weiteren Zöglinge mussten mit den zweiten Erzieher in der Herberge bleiben. Es war paradox, dass wir der Ausflugsreise teilnehmen durften, andererseits derart eingeschränkt wurden, dass uns die Freude und Spaß mehr oder weniger abgewürgt wurde, sei es aus übertriebener Vorsicht oder Vergeltung. Als Betroffener waren wir ziemlich angefressen wegen der Sonderbehandlung und das führte dazu, dass wir uns aus Trotz zur Flucht verabredeten. Wir packten im Rucksack Konservendosen, Brot und etwas Gewand und in den Moment, als der Erzieher auf die Toilette ging rannten wir aus der Seite 37 von 60 Herberge in einen nahegelegenen Wald. In letzter Moment hatte der dritte kalte Füße bekommen und ist doch nicht mitgeflüchtet, sodass wir nun zu zweit waren (65. S. 1). Örtlich und Richtungsmäßig konnte ich mich nur nach meinen Fluchtpartner orientieren, denn ich hatte zu dieser Zeit keinerlei Orientierung und näheren Kenntnisse über Österreich und dessen Landschaft und Vegation, ausgenommen etwas über Wien und Eggenburg. Mir war nicht einmal die volle Tragweite der Entfernung von Landeck/Tirol nach Wien bewusst, höchstens das es weiter ist als von Wien nach Eggenburg. Das ich all der Abenteuer auf der wiederholten Flucht aus den Heimen überhaupt überlebt habe, grenzt für mich heute ebenfalls an ein Wunder. Ich war mir die Gefahren, die damit verbunden waren überhaupt nicht bewusst. In der Nacht stahlen wir ein Fahrrad, das an eine Häuserwand in der Nähe einer Landstraße, die wir in Abstand gefolgt waren unversperrt angelehnt war. Und aus einer Bauernscheune stahlen wir auch Arbeitsgewand, um Kleiderersatz zu haben (65. Gerichtsurteil ab S. 2). Ich war zuvor noch nie mit einen Fahrrad gefahren und saß akrobatisch auf der Mittelstange. Wir verloren wiederholt das Gleichgewicht, stürzten uns holten uns etliche Abschürfungen davon, aber wir kamen km auf km weiter. Gegen Morgengrauen ließen wir das Fahrrad in einen Feld liegen und versuchten Autostopp zu machen, aber es blieb keiner stehen. Nach einigen Stunden Rast eingegraben in Strohballen auf einen Acker, erreichten wir dann zu Fuß mit einbrechen der Abenddämmerung das Bezirk Imst. Wir gingen zu einen Bauernhaus und baten um etwas zum Essen. Wir bekamen Suppe und Brot serviert. Während des Essens zupfte mir mein Partner alarmierend beim Ärmel und wir gingen hinaus. Er hatte bemerkt, dass die Bäuerin die Gendarmerie angerufen hatte. Kaum waren wir im Hof, sahen wir schon ein Gendarmeriewagen näher kommen. Wir rannten los Richtung Wald und zwei Beamten hinter uns her. Nach kurzer Jagd wurde mein Partner geschnappt, während ich den Wald erreichte und hineinrannte. Ein Gendarm knapp hinter mir her. Plötzlich stand ich vor einen stark strömenden Fluss. Ich weiß bis heute nicht, ob es der Inn war oder ein Nebenfluss. Knapp bevor mich der Gendarm packen konnte sprang ich in den Fluss. Die Strömung war so stark, das ich sofort unter Wasser gedrückt und weggezogen wurde. Als mir die Strömung die Jacke aus dem Körper regelrecht weggerissen hatte und ich wieder auftauchen konnte, konnte ich mich nur verzweifelt über Wasser halten und mich luftschnappend mit der Strömung treiben lassen. Wie lange ich im Wasser war und wie ich an das andere Ufer drüber gekommen bin, erinnere ich mich bis heute nicht. Ich erinnere mich nur an Gebüschen, die über das Ufer in dem Fluss ragten geklammert und mich mit letzter Kraft wieder auf festen Boden gestemmt zu haben. Es war unweigerlich eine lebensgefährliche Situation, die ich nur mit höchstem Glück überlebt hatte. Die Gendarmen, wie mir meine Mutter Tage später erzählte, hatten schon gemeldet, dass ich in den Hochwasserführenden Fluss gesprungen bin und wahrscheinlich ertrunken sei. Umso glücklicher waren dann meine Eltern, als ich Tage später bei ihnen anklopfte. Zunächst blieb ich aber bis zum nächsten Tag völlig erschöpft in der Nähe des Ufers zwischen Gebüschen liegen. Mit durchnässten Sachen marschierte ich dann weiter. Ich hatte die Orientierung völlig verloren. Ich marschierte nur durch Wälder und Lichtungen mal Bergauf und mal bergabwärts, Seite 38 von 60 gelegentlich auch durch kreuzende Geröllhalden aus Steinbrocken. Dann endlich sah ich einen Bauernhof. Ich hatte zwar Bedenken, das der Bauer oder Bäuerin wieder die Gendarmerie verständigen konnten, aber ich hatte keine andere Wahl. Auf der Flucht des gestrigen Tages hatte ich den Rucksack liegen lassen und war nun nur mit Turnschuhe, Hose und Leibchen unterwegs und hatte auch nichts Essen. Eine Bäuerin öffnete mir. Ich bat sie um etwas zum Essen. Sie bat mich herein und gab mir volle Teller. Sie war unglaublich freundlich und mütterlich. Als sie mir Fragen stellte, erzählte ich ihr, dass ich sechzehn Jahre alt sei und das ich nach Wien unterwegs bin zu meinen Eltern, gleichzeitig bat ich sie um einen Pullover und um ein Stück Brot zum mitnehmen. Die Bäuerin schaute mich verblüfft an, merkte allerdings dass ich gebrochen Deutsch sprach und fragte nach meiner Nationalität und Sprache. Als ich ihr sagte, dass ich aus Uruguay komme und spanisch spreche, reagierte sie erstaunt und überrascht und sprach mich auf Spanisch an. Wie sie mir erzählte, hatte sie einige Zeit in Spanien gelebt. Ich erzählte ihr wiederum die Wahrheit, dass ich aus einem Heim davongelaufen sei und nun zu meinen Eltern wollte. Zu meiner Überraschung packte sie mir in eine leichte Stofftragtasche eine halbe Stange Wurst und ein halbes Laib Brot und zudem gab sie mir zwei Pullover mit. Bevor ich ging zeigte sie mir den Weg zur Landstraße, die Richtung die Stadt Innsbruck führte, wo ich mich dann weiter erkundigen könnte. Als ich mich verabschiedete, umarmte sie mich und gab mir ein Kuss auf die Wange und wünschte mir alles Gute. Ich war überglücklich über so viel Freundlichkeit und Menschlichkeit, die ich nicht mehr gewohnt war. Nachdem ich über mehreren bewaldeten Berghügeln die Richtung der Bäuerin folgend eine Landstraße erreichte, hatte ich noch vor einbrechen der Nacht Glück per Autostopp in Innsbruck anzukommen. Vorbei am Bahnhof sah ich einen Zug und dachte mir noch, wie schön es wäre, wenn ich mitfahren könnte, hatte aber kein Geld dazu. Mittlerweile Nacht geworden, suchte ich mir in eine Parkanlage mitten in der Stadt eine Schlafstelle hinter Gebüschen. Dabei sah ich mitten in der Parkanlage einen Kiosk, der laut Reklametafeln Süßigkeiten verkaufte. Als es spät in der Nacht wurde und keine Parkgäste mehr unterwegs waren, brach ich dort durch die Dachluke des Kiosks ein. Neben Süßigkeiten, hatte ich das Glück auch etwas Kleingeld zu erwischen. Mit dem Kleingeld kaufte ich mir am nächsten Tag eine Bahnkarte bis Salzburg. Nach Wien reichte das Geld nicht, erklärte mir die Ticketverkäuferin. In Salzburg angekommen spazierte ich bis in den Nachstunden durch die Stadt. Bei einer Baustelle stahl ich eine Eisenstange mit derer ich in einen weiteren Kiosk einbrechen wollte, um mir weiteres Geld für die nächste Bahnkarte zu besorgen. Plötzlich wurde ich auf der Straße von zwei Kriminalbeamten angehalten und mitgenommen, weil ich mich nicht ausweisen konnte. Ich gab zu während eines Heimausfluges entflohen zu sein und wurde in eine geschlossene Herberge untergebracht. Am nächsten Tag holte mich ein Mann, der mich mit dem Zug nach Wien in einen Durchzugsheim bringen sollte, von wo ich dann nach Eggenburg weiter gebracht werden sollte. In Wien angekommen fuhren wir vom Westbahnhof aus mit der Stadtbahn bis zur Haltestelle Roßauerlände. Dort angekommen lief ich davon. Der Mann folgte mir, aber er war zu langsam und Seite 39 von 60 verfolgte mich offenbar deswegen nicht weiter. Nun klopfte ich wieder einmal beim Fenster der Parterrewohnung meiner Eltern. Meine Mutter schrie auf und riss die Augen entsetz auf. Ich erschrak. Nun erzählte sie mir, dass sie mich aufgrund der Angaben von Beamten schon für tot hielt. Diesmal war ich längere Zeit auf der Flucht. Untertags traf ich meine Mutter fast täglich auf eine Sitzbank auf den Wiener Gürtel. Das war unser Treffpunkt. Jedes Mal versorgte sie mich mit Essen und Taschengeld. In der Elternwohnung traute ich mich nicht wegen der Polizei. Ich schlief zumeist in Baustellen oder in dichtem Gebüsche versteckt in Park- und Grünanlagen. Eines Tages saß ich bei Einbruch der Dunkelheit auf einer Bank in einer Grünparkanlage und fror vor Kälte. Plötzlich näherte sich ein großer Mann, setzte sich neben mir und fragte mich, ob ich Hunger hätte und ob ich nirgends zu schlafen hätte. Ich bejahte es. Er redete auf mich ein, mir helfen zu wollen und forderte mich auf mitzugehen. Ahnungslos und unerfahren ging ich mit. In der Wohnung musste ich mich duschen und dann gab er mir was zum essen. Dann führte er mich ins Schlafzimmer mit einem Doppelbett. Ich hatte instinktiv schon ein mulmiges Gefühl und wurde ängstlich, aber es war schon zu spät. Als wir im Bett lagen fiel er über mich her. Ich versuchte mich loszumachen, aber der Mann war bärenstark. Und als ich zu schreien begann, drückte er mir den Mund zu. Dann versuchte er mich anal zu vergewaltigen, rutschte aber zu meinem Glück mit dem Penis nur zwischen meinen vor Angst zusammengepressten Oberschenkeln und Gesäßbacken. Er glaubte wahrscheinlich in meinen After eingedrungen zu sein. Danach musste ich mich wieder anziehen und er schmiss mich aus der Wohnung raus. Schockiert und nun auch vor Parkanlagen verängstigt, verbrachte ich die weiteren Nächte in Hausfluren oder in offener Hauseingänge. Ich ging von dieser Zeit an nie wieder mit einem fremden Mann irgendwohin und erzählte meinen Eltern auch nichts von dem Vorfall, aus Angst dass sie mich ins Heim zurückbringen würden. Tagelang allein unterwegs, traf ich dann zwei bekannte Zöglinge aus Eggenburg zufällig auf der Straße, die ebenfalls auf der Flucht waren. Ich schloss mich ihnen an. Sie führten mich zum Wiener Naschmarkt, wo sie sich an vorbeigehen unverschämt an den offen aufgestellten Obst- und Gemüsestände bedienten. Sie machten es so geschickt und schnell, dass kaum jemand es bemerkte. Bemerke es jemand, so rannten sie weg und ich hinterher. Gegen Mittag gingen wir dann in unmittelbarer Nähe des Naschmarkes in ein heruntergekommenes, aber voll überfülltem Gasthaus. Wir aßen dort Gulasch mit Semmeln und Coca Cola. Als wir fertig waren gingen wir in einen unbeobachteten Moment des Kellners einfach aus dem Gasthaus raus und verschwanden zwischen den Ständen des Naschmarkes. Sie demonstrierten mir, wie sie auf der Flucht überlebten und lernten es mir gleichzeitig. In der Nacht nahmen sie mich zu der Wohnung einer alleinwohnenden Tante eines der Zöglinge mit. Sie wusste, dass wir flüchtige Heimkinder waren. Die Wohnung war sehr klein, so dass wir am Boden schlafen mussten. Wir durften bei ihr nur übernachten. Bei Tag mussten wir aber die Wohnung verlassen, weil sie zur Arbeit ging und uns nicht allein in der Wohnung lassen wollte. Bis auf ein paar belegte Brötchen konnte sie uns auch nicht ernähren, da sie knapp per Kasse war. Untertags wanderten wir zwischen den Naschmarkt und Mariahilferstraße. In der Mariahilferstraße gingen wir in Großkaufhäuser, wo ich von meinen Partner den Ladendiebstahl lernte. Im nu waren Seite 40 von 60 wir mit neuen Jeanshosen, Leibchen und Pullover angekleidet. Ladendiebstahl war damals wesentlich leichter als heute. Damals, 1965 gab es z.B. keine Videoüberwachung oder elektronische Etiketts, die Alarm schlugen, wenn man das Geschäft ohne bezahlen verlies. Es gab nur ein paar Kaufhausdetektive, die so auffällig herumschauten, weswegen man sie leicht ausweichen konnte. Nagelneu bekleidet machte sich meine Mutter sorgen, aber ich log sie an, die Kleider von Freunden geschenkt bekommen zu haben. Unser Treffpunkt war immer am Wiener Gürtel auf Höhe der UBahnstation Alserstraße. Sie erzählte mir, dass die Polizei fast täglich im Hotel vorbeischaute und auch in der Wohnung unter den Betten nachschaute. Als jugendlicher auf der Straße in ständiger Angst vor Verfolgung zu leben und zu überleben ist unstrittig eine immense physische und psychische Belastung, nichtsdestoweniger waren auch meine Eltern davon mitbetroffen. Nach dem Treffen mit meiner Mutter fand ich eines Tages den beiden anderen Zöglingen auf den ausgemachten Treffpunkt nicht wieder. Auch hatte ich mir nicht den Weg zu ihrer Tante eingeprägt, sodass ich wieder allein dastand. Ich schlief wieder in Baustellen oder in Häuserfluren. Bei einer Baustelle traf ich dabei auf eine ältere Frau, die keine Wohnung hatte und die ebenfalls auf Baustellen schlief. Sie hatte mehreren Taschen mit täglichen Gebrauchsgegenständen und Essbarem mit und lud mich ein. Als sie mich fragte, so sagte ich ihr die Wahrheit, dass ich vom Heim entwichen sei. Irgendwie verspürte ich Vertrauen zu ihr. Ich durfte mit ihr unter ihrer Decke schlafen, eng aneinander gedrängt, weil sie nur eine Decke hatte. Am Boden hatte sie zum Schutz der Bekleidung viele Zeitungen ausgebreitet. Untertags blieb ich in der Folge bei und half ihr beim Tragen der Taschen. Die ältere Dame, die Maria hieß und 54 Jahre alt war, war mir eine Hilfe wie eine Mutter. Untertags ging sie zu Kirchen, wo wir immer was Warmes zum Essen bekamen oder etwas Geld. Sie bettelte sich freundlichste durch und hatte Erfolg damit. Überall wo wir hingingen, war sie bekannt und wurde auch freundlich behandelt. Nirgends wurden wir ohne Essbarem oder mit etwas Kleingeld abgewiesen. Man kannte sie auch in mehreren Baustellen, wo wir zumeist schliefen. Wenn wir verschlafen hatten, haben die Bauarbeiter stets freundlich reagiert. Wir packten einfach zusammen und verließen die Baustelle ohne dass die Polizei herbeigeholt wurde. Mitunter nahmen die Bauarbeiter an, dass ich ihr Sohn sei. Die Wäsche wusch sie in Wasserhähne öffentlicher Anlagen und breitete diese in der Sonne auf Wiesen oder auf Bänken aus. Körperpflege betrieben wir ebenfalls auf öffentlichen Anlagen oder auf Wasserhähne der Baustellen. Für die Notdurft benutzen wir öffentliche WC-Anlagen. Wochenlang war ich mit ihr unterwegs, auch in Wien-Umgebung, Leopoldsdorf, Maria-Lanzendorf etc., wo wir in jeder Kirche zum Essen und etwas Kleingeld bekamen. Waren wir außerhalb Wien, so schliefen wir in Stroh- oder Heuscheunen. Zwischendurch ging sie mit zum Treffpunkt meiner Mutter. Meine Mutter war sehr besorgt, aber ich versicherte ihr, dass die ältere Frau mir sehr helfe. In einer Strohscheune bei Leopolsdorf kam es eines Tages auch zum ersten sexuellen Kontakt zwischen mir und ihr. Es war Hochsommer und an diesen Abend ziemlich heiß. Wir zogen uns bis auf die Unterhosen aus. Ihre Brüste waren frei. Der Anblick erregte mich. Wir hatten die Gewohnheit immer eng aneinander zu schlafen. Sie lag mit dem Rücken zu mir. Sie dürfte bemerkt haben, dass Seite 41 von 60 ich einen erregten Penis hatte und fasste mich an. Sie masturbierte bei mir und führte dann mein Penis von hinten in ihre Scheide ein. Ich spürte, wie ich in ihr eindrang und wie mein Körper glühte. Minutenlang zuckte ich in ihr, bekam aber kein Orgasmus. Sie drehte sich auf den Rücken, half mir zu ihr rauf und in ihr einzudringen. Als ich dann einem Orgasmus bekam, war es als wenn ich vor Erregung und Erschöpfung ersticken würde, gleichwohl aber ein wunderschönes Erlebnis. Sie war sozusagen die erste Frau mit der ich überhaupt das erste Mal sexuellen Kontakt und ein Orgasmus hatte. Sie dürfte es bemerkt haben, denn das sagte sie mir auch auf den Kopf zu und ich stimmte ihr zu. Von da an hatten wir öfters Geschlechtsverkehr, jedenfalls jedes Mal wenn sie merkte, dass ich einen erregten Penis hatte. Es war eine rein körperliche Beziehung, worüber wir nie näher darüber sprachen. In der Nacht hatten wir Geschlechtsverkehr, bei Tag war sie Ersatzmutter. Seit ich mit der älteren Frau zusammen war, traf ich meine Mutter seltener beim Treffpunkt am Gürtel, weil wir oft außerhalb Wien waren oder in weitgelegenen Randbezirken. Als ich sie dann wieder einmal aufsuchen wollte, wurde ich auf den Weg dorthin von einem Polizeiauto angehalten und weil ich mich nicht ausweisen konnte, wurde ich zur Polizeirevier mitgenommen. Beim Verhör gab ich dann zu vom Heim entflohen zu sein, als wir in Tirol waren. Den Kontaktverlust zu meiner Mutter und der älteren Dame Maria traf mich besonders schmerzvoll, denn ich begann mich durch ihr Umsorgen wohl er zu fühlen. Ich kam wieder in das Durchzugsheim „Im Werd“ (62. S. 2), wo ich zirka nach zwei Wochen erneut nach Eggenburg überstellt wurde. Während dieser zwei Wochen versuchte mich der homosexuelle Erzieher sexuell zu missbrauchen, aber, wie schon geschildert, konnte ich ihn abwehren. So landete ich wieder in der Strafgruppe 14., von der Anstaltsleitung gerne als „Besinnungsgruppe“ bezeichnet. Sowohl vom Heimleiter als auch von Seiten eines als sehr brutal bekannten Erziehers, der sehr oft in der Strafgruppe Dienst versah, bekam ich eine Sonderbehandlung an körperlichen Misshandlungen. Von Seiten des Heimleiters, der fast täglich die Strafgruppe aufsuchte und der die Zöglinge in einer Reihe aufstellen ließ und gewohnheitsmäßig bei den Haaren riss oder durch kneifen an den oberen Ärmel oder durch Ohrendrehen schmerzen zufügte, begleiten von Beschimpfungen und Drohungen, bekam ich gleich allen Prozeduren auf einmal zu spüren. Und von Seiten des brutalen Erziehers wurde ich wiederholt mit schallenden Ohrfeigen und mit Tritten gezielt an den Beinschienen behandelt. Als zusätzliche Strafverschärfung wurde mir mehrmals die Tagesration halbiert, sodass ich quälenden Hunger hatte. Zwar half mir hie und da ein Mitzögling mit einem Stückchen Brot oder mit ein paar Löffel Suppe, aber die Tagesrationen waren für alle Zöglinge schon karg genug. Für die Heimleitung und Erzieher gab es offensichtlich nur ein Mittel gegen Heimentweichungen oder anderen Verfehlungen. Misshandlungen, Erniedrigungen und sonstige Brutalität als Abschreckung und Abgewöhnung. Und in der Tat wurden auf diese weise damals viele Zöglinge psychisch gebrochen, oft für ihr ganzes leben. Ich wurde schon vorher mehrmals durch Misshandlungen von Erzieher verletzt. Zweimal musste ich deswegen auch in das öffentliche Krankenhaus Eggenburg behandelt und genäht werden. Einmal wegen einer Kopfwunde, als ich nach einer Ohrfeige hinfiel und gegen die Mauer prallte und ein Seite 42 von 60 andersmal wegen einer offenen Rißquetschwunde am Oberschenkel, die mir durch die Stiefelspitze eines Erziehers zugefügt wurde, die als Unfälle kaschiert wurden (62. S. 4,5). Ich war nicht eine Woche in der Strafgruppe, als ich von meinen Vater besuch bekam. Der Besuch fand im Dienstzimmer der Strafgruppe statt. Nachzutragen ist, dass die Strafgruppe an den täglichen Appell im Innenhof des Heimes natürlich nicht teilnehmen durfte. Die Strafgruppe war eben nicht anderes als ein installierten Gefängnis im Heim. In ein Gefängnis gab es zumindest ein Hof, wo Sträflinge Bewegung im Freien verrichten konnten. Wir Heimkinder hatten nicht einmal das. Mein Vater war entsetzt über meinen Zustand. Ich hatte eine volle Glatze und noch sichtbaren Verletzungen und als er mir fragte, woher ich diese hätte, habe ich ihn erzählt mehrmals geschlagen worden zu sein. Mein Vater wurde daraufhin sehr zornig, so zornig habe ich ihn zuvor noch nie gesehen und er stritt mit den Diensthabenden Erzieher, bis er vom Erzieher aus der Strafgruppe rausgedrängt wurde. Wir konnten uns nicht einmal verabschieden. Ein paar Tage nach dem Besuch meines Vaters, wurde ich von einem Erzieher zum Heimleiter vorgeführt. Dort eröffnete mir der Heimleiter, dass ich ein Hurensohn sei, dass meine Familie eine Verbrecherbande sei und dass er angesucht hätte, dass ich im strengsten Erziehungsheim Österreichs nach Kaiser-Ebersdorf überstellt werde. Jahrzehnte später fand ich in den Heim- und Gerichtsakten auch Dokumente darüber, dass mein Vater damals gegen das Heim Beschwerde und Anzeige erstattet hatte. Offensichtlich war der Heimleiter deswegen so aufgebracht und beschimpfte mich. Ich fand auch die scheinheiligen und fingierter Ausreden der Heimleitung. Es war eben so üblich damals, dass sich die Ämter und Behörden gegenseitig schriftliche Anfragen und Stellungnahmen zuschickten ohne effektive Kontrolle, ob die Angaben der jeweiligen Ämter oder Behörden wahr sind. So konnte die Heimleitung mit fingierter Berichte und Stellungnahmen sehr leicht alles bestreiten und vertuschen. Die Akten wurden damit geschlossen und übrig blieb das Betroffene Heimkind. Auf den retourweg in die Strafgruppe 14 lief ich den Erzieher davon (64. S. 1). Ich rannte mitten durch den Appellhof des Heimes bis ich die Drahtumzäunung des Heimes erreichte, überkletterte diese und lief in den Wald. Der Erzieher lief und Schrie wie Wahnsinn hinterher, war aber zu langsam. Ich hatte zudem Glück, das es eine Zeit war, wo der Appellhof nahezu leer war, weil die Zöglinge und Erzieher in den Betrieben waren. Wie ein gehetztes Tier lief ich tief, tief in den Wald. Einen besonderen Nachteil hatte ich diesmal. Ich war nur mit der Bekleidung der Strafgruppe unterwegs. Mit Sandalen, mit Weiß-Dunkelblau gestreifter Oberkleidung und mit einer Glatze. So konnte ich mich natürlich nirgends sehen lassen. In ziemlichen Abstand zur Landstraße Richtung Wien und stets Ausschauhaltend nach Menschen, die mich in so einer Aufmachung nicht sehen durften, ansonsten würden sie unweigerlich die Polizei alarmieren, marschierte ich Untertags dahin, bis ich am Rande von Bauernfelder auf eine Holzhütte traf. Die Türe der Hütte war nur zugelehnt. Ich öffnete es und ging hinein. Zu meinen Erstaunen und Freude fand ich auf einer Holzbank mehreren Arbeitshosen und Blusen sowie Kopfkappen vor. Offensichtlich Arbeitskleidung für Feldarbeiter. Ich suchte mir die halbwegs passenden aus und schon war ich kein entflohener Zögling mehr. Seite 43 von 60 Kurz darauf gelang mir ein Lastwagen zu stoppen, der mich bis Stockerau fuhr. Nach kurzen stoppen in Stockerau erreichte ich Wien. Im Hotel meiner Großmutter angelangt, klopfte ich beim Fenster der Parterrewohnung. Meine Mutter öffnete und wir machten uns aus, dass ich bei der gewohnten Treffstelle am Wiener Gürtel auf sie warten sollte. Kurz darauf kam sie Vollgepackt mit Gewand, Schuhe, Unterwäsche und mit Brot und haltbaren Lebensmittel. Dazu Taschengeld. Meine Mutter weinte fast jedes Mal bei solchen treffen. Ich konnte selten weinen, obwohl mir oft dazu zumute war. Wahrscheinlich war ich psychisch zu erschöpft oder zu abgewürgt dazu. Rückblickend gesehen waren es Jahre des ständigen Leidens und Gehetztseins. Unabhängig davon ob ich durch Fehlreaktionen, in etwa durch die Heimentweichungen meines dazu beigetragen hatte. Ich versuchte in der Folge wieder Maria, die ältere Frau zu finden, die ich mich wieder anschließen wollte, fand sie aber nicht wieder. Erst Jahre später traf ich sie wieder und sie erzählte mir, dass sie krank geworden war und über längere Zeit in Behandlung im Hospital gelegen ist. Dafür traf ich gleichzeitig drei Heimkinder, die ebenso aus verschiedenen Heimen entflohen waren. Einen davon kannte ich bereits vom Heim „Im Werd“ und „Lindenhof“. Ich schloss mich ihnen an. Es folgten dann Ladendiebstähle, Zechprellerei und räuberischen Diebstahl an Homosexuelle am Naschmarkt, bei der Opernpassage sowie am Burgtheaterpark oder auf der Thaliastraße, wo seinerzeit Treffpunkte der Homosexuelle und Strichjungen waren. Ich hatte auf dem Homostrich keine Erfahrung. Zwei meiner nunmehrigen Partner schon und erzählten mir, dass man damit gutes Geld machen konnte, ohne unbedingt auf sexuellen Handlungen einzugehen, gelegentlich nur Masturbieren oder Oralverkehr der Freier. Sie demonstrierten es mir, indem ich mit ihnen am Abend zu den Homostellen ging und sie dort die Freier ansprachen, während ich sie von einem Abstand aus beobachtete. Sie verhandelten mit den Freiern und ließen sich die Brieftasche der Freier zeigen, um sich zu vergewissern, dass sie auch zahlen können. In dem Moment, als die Freier ihre Geldtaschen zogen um das Geld vorzuzeigen, wurde ihnen die Brieftasche entrissen. Die Freier konnten nicht einmal Strafanzeige oder irgendwelchen Wirbel vor Ort machen, weil seinerzeit Homosexualität strafrechtlich verfolgt wurde. Wiederholter male war ich bei solchen räuberischen Diebstählen mit dabei, ohne mich direkt zu beteiligen, wohl aber von der Beute mit profitiert zu haben. Direkt mitdabei war ich nur bei Ladenund Straßendiebstähle und Zechprellerei. Wir schliefen auch öfters in den Wohnungen mancher homosexueller, die meinen Partner kannten. Da wir zu dritt waren, hatte ich keine Angst mitzugehen, zumal die Freier es nicht auf mich abgesehen hatten, sondern auf meine Partner. Zeigte ein Freier für mich Interesse, so habe ich immer abgelehnt und da wir zu dritt waren, hat sich nie ein Freier näher getraut. Trotzdem habe auch ich von Freier gelegentlich ein Geschenk in Form von ein Geldschein oder Bekleidung bekommen. Manche Freier waren gutsituiert und der eine oder andere auch Bezirks- oder Stadtpolitiker, Arzt, Lehrer oder Akademiker, wie mich meinen Partner prallend erzählten. Manche ihrer Wohnung waren sehr Luxuriös eingerichtet, sodass man schon mit einem Blick sah, dass sie wohlhabend waren. So ging es monatelang weiter bis ich wieder einmal meine Partner aus den Augen verlor nachdem Seite 44 von 60 ich meinen Vater und Mutter aufsuchte. Sie waren nicht mehr auf den verabredeten Treffpunkt zu finden. Entweder waren sie von der Polizei erwischt worden oder sie mussten aus irgendwelchen Gründen woanders hingehen oder untertauchen. Nun folgten wieder Übernächtigungen in Baustellen und Hausfluren. Dabei lernte ich einen erwachsenen kennen, etwa 25 Jahre alt, der ebenso Unterstandslos war und ich schloss mich ihn an, nachdem ich ihn mitteilte, dass ich aus dem Heim entflohen sei und er mir seine Hilfe anbot. Dieser ging öfters in Trafiken, Gasthäuser und in Kleidergeschäfte einbrechen, wie er mir erzählte und hatte immer etwas Geld, womit er auch besuche in Wirtshäuser und Cafelokalen finanzierte und mich stets einlud. Er trank gerne Alkohol und ich begann mitzutrinken. In dieser Phase war ich gelegentlich betrunken und vernachlässigte weiteren Kontakt zu meinen Eltern. Bei manchen Einbruchdiebstählen nahm er mich in der Folge als Aufpasser mit, gleichzeitig lehrte er mir den Ehrenkodex, das man einen Komplizen nie verrät, wenn man irgendwann von der Polizei festgenommen wird. Als wir Dezember 1965 von der Gendarmerie in Leopoldsdorf bei Wien verhaftet wurden und bei uns Diebesgut gefunden wurde, habe ich mich genau nach den Ehrenkodex gehalten und beim Verhör das Diebesgut auf mich genommen, ohne ihn zu belasten. Dann wurde ich nach Wien in das Bundespolizeidirektion transportiert. In Wien angekommen versuchte ich beim Aussteigen aus den Polizeiwagen zu flüchten, wurde aber von einem offenbar gut trainierten Beamten eingeholt. Fast genau 2 Jahren nach meiner Festnahme Dezember 1963 kam ich wieder in Untersuchungshaft in das Jugendgefängnis in Wien. Ende Jänner 1966 wurde ich zu 6 Monaten strengen Arrest verurteilt (65. S. 2-8), ohne Auflage auf neuerliche Einweisung in einen Erziehungsanstalt, dagegen sich auch meine Eltern und ich strikt aussprachen (65. S. 7). Als Grund zur unbedingten Strafe wird meine ungehemmte und zügellose Kindheit in Uruguay angegeben, obwohl dem Gericht überhaupt keine Informationen über meine Kindheit in Uruguay vorlagen. Es wurde vom Gericht einfach so argumentiert und behauptet, um der eigenen behördlichen Versäumnisse und verschulden zu verdrängen. Das war damals Selbstverständlichkeit bei Jugendämtern, Polizei und Justiz: Wegsehen, abstreiten und vertuschen, sei es mit gefälschten Berichte und Urkunden. Im Grunde nichts anderes, als die administrative Fortführung der üblichen Nazi- u. Gestapopraktiken . Mit diesen Gerichtsurteil 1966 war für mich der Horrortrip in den staatlichen Heimen in Österreich endgültig beendet. Ein Horrortrip, in der Zeit ich zudem keinen einzigen Mal meinen eigenen Geburtstag feiern oder an den Geburtstage meiner Geschwister und Eltern mit dabei sein konnte, geschweige denn an den Oster- oder Weihnachtsfeiertagen. In den Heimen, sei es im Fremdenheim für Kinder in Judenau bei Tulln, im Polizeiheim oder den Durchzugsheim „Im Werd“ sowie im „Lindenhof“ in Eggenburg habe ich jedenfalls in den Abteilungen und Gruppen, wo ich untergebracht war nie Feiertage erlebt. Von August 1962 bis Dezember 1965 habe ich nur jahrelang Terror und Verfolgung erlebt. Terror in den Heimen und Verfolgung auf der Flucht vor den Heimterror. Eine Zeit voller schrecklicher Erlebnisse und Konflikte, innerlicher Schmerz und leid und nahezu ständig unter innerlicher Anspannung. Seite 45 von 60 Eine Zeit der traumatischen Erlebnisse und innerlichen Konflikte, in der Zeit psychologische oder therapeutische Betreuung für die geschundenen Heimkinder oder von straffällig gewordenen Heimkindern undenkbar war. So trugen wir unseren Traumata und Konflikte in die Gesellschaft hinaus und landeten dutzendweise im Gefängnis, weil wir in diesen schlechten Zustand von selbst nicht in der Lage waren ein geregeltes Leben zu führen, zumal der Großteil der Heimkinder nach der Heimentlassung weder familiäre noch gesellschaftliche Unterstützung erwartete. Das ist keine Ausrede oder Rechtfertigung, sondern die bittere Realität, die damals im Staatsapparat und in der Gesellschaft herrschte und wütete. Wir Heimopferkinder sind damals eindeutig als ausgestoßene behandelt und am Rande der Gesellschaft als wertlos ausgestoßen worden. Die NSHerrenmenschen haben ihr Werk in den Nachkriegsjahren unbeanstandet fortgesetzt. Fatale kriminelle Entwicklung Jahrzehntelange Odyssee des Schreckens im Gefängnis Es blieb nicht allein bei den 6 Monaten strengen Arrest, weil die Verurteilung 1964 zu 4 Monaten bedingter Arreststrafe wegen der versuchten Beihilfe zur Notzucht (4 Vr 861/64, Hv 83/64) widerrufen und in fester Strafhaft umgewandelt wurde (66. Strafregister des Innenministeriums). Hinzukam eine Verurteilung zu mehreren Monaten Arrest während der Strafhaft wegen Körperverletzung an einen Mithäftling, der mich und einen anderen Zelleninsassen in eine Gemeinschaftszelle ständig bestahl und schikanierte, der sich aber bei den Vollzugsbeamten so einzuschmeicheln verstand, das er am Schluss als Opfer dastand, 1 Vr 896/66 des JGH Wien. Die Haftstrafe, Ende Dezember 1965 bis Ende Februar 1967 verbrachte ich in das damaligen Jugendgefängnis im 10. Bezirk in der Hardmuthgasse, heute Justizanstalt „Favoriten“. Als allererster fiel mir ins Auge, als ich aus den Zellenfenster in den Spazierhof im Innenhof des Jugendgefängnisses hinabblickte, das ich viele Häftlinge schon aus den Erziehungsheime her kannte, teils persönlich und teils von den Gesichter her. Die Hafträume waren einheitlich grauweiß ausgemalt, ansonsten mit veralteten Einrichtungen aus Stockbetten, Tische und Hockers sowie mit kleinem Wandregale für Habseligkeiten eingerichtet. Untertags arbeitete man für Privatbetriebe, wie etwa verpacken von Materialien etc. Der Lohn betrug maximal ein paar Schillinge pro Monate, womit man sich höchstens ein halbes Kilo Schweineschmalz oder Margarine kaufen konnte oder 2 bis 3 Bündel des billigsten „Landtabak“. Als Zigarettenpapier war die Bibel beliebt. Als WC-Papier die Kronen Zeitung oder Kurier, den der Arbeitslohn reichte nicht dazu sich WC-Papier zu kaufen. Die Justizbeamten waren distanziert, feindselig und selbst bei Kleinigkeiten reagierten sie sogleich mit Beschimpfungen und sonstigen Beleidigungen, gelegentlich auch mit Ohrfeigen. Erzieherischen Maßnahmen zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft sowie psychologische Betreuung oder therapeutischen Sitzungen zur Vermeidung des Rückfalls, das gab es damals absolut nicht. Nur Absitzen, arbeitsmäßige Ausbeutung sowie billigste ernährt und verwaltet. Die Haftbedingungen waren extrem von Monotonie und Elend geprägt, weil es keinerlei Seite 46 von 60 Freizeitgestaltung gab oder ein entsprechender Arbeitslohn, womit man sich alltägliche Bedürfnisse leisten hätte können. Die Freizeit bestand nur auf eine Stunde Bewegung im Freien in Gänsemarsch, ohne den vorderen oder hinteren Mann ansprechen zu dürfen. Von Fernsehen, Radio, Kocher oder sonstigen Komfort in der Zelle oder des tragen eigener Kleidung wurde nicht einmal geträumt, weil es in den 1960er Jahren unvorstellbar war. Auch Kartenspiele waren verboten. Es gab nur Brettspiele Dame, Mühle oder Schach. Abgesehen davon dass die wenigsten jugendlichen Häftlinge Schach spielen konnten, waren die Brettspiele anzahlmäßig zudem beschränkt, sodass nicht jeder zu diesem Genuss kam. Für Freizeitgestaltung sorgten die Häftlinge selbst untereinander durch Blindekuh-Spiele in der Zelle oder mit gestopften Socken Fußball zu spielen, wobei man sich von Beamten nicht erwischen lassen durfte. Es kam fast täglich zu Streitereien und Raufhandel unter den jugendlichen Häftlingen. Die lauten Streitgespräche und die gegenseitigen Beschimpfungen sowie das Gepolter der Raufhandel konnte man über den Innenhof des Gefängnisses zumeist mit verfolgen. Heftig ging es auch dann zu, wenn ein Häftling einen Haftkollaps bekam. Der eine bekam einen Schreikrampf. Der andere zerschlug das Zelleninventar. Ein anderer wiederum verbarrikadierte sich in der Zelle und wurde dann von dem Wärtern mit Gewalt aus der Zelle geholt. Wie späteren Studien ergaben stritten viele Häftlinge aus purer langweile, indem sie sich gegenseitig schikanierten bis es in Raufhandel mündeten. Haftkollaps und Selbstbeschädigungen waren zum Teil auch eine Folge der Monotonie über längerer Zeit hindurch. Zweimal wurde ich strafweise tagelang in Einzelhaft abgesondert, weil ich mich während der Bewegung im Freien in eine hintere Reihe zu eine anderen Häftling zurückfallen ließ, den ich aus der Erziehungsanstalt Lindenhof in Eggenburg kannte. Ein andersmal wegen Raufhandels in der Zelle, wie oben geschildert. Das hochgestellte Fenster der Absonderungszelle waren mit Spannplatten verdeckt, damit man nicht in den Hof hinausblicken konnte, sodass man mehr oder weniger in Dunkelhaft saß, da in solchen Absonderungszellen noch kein elektrischen Licht installiert war. Man saß entweder am Boden oder man spazierte in der Zelle vier Schritte hin und her mehr oder weniger 24 Stunden am Tag in völliger Dunkelheit. Tageslicht oder ein Lichtschimmer sah man nur, wenn die Absonderungszelle kurzfristig zur Verpflegung oder um den Schlafsack reinzunehmen geöffnet wurde. Dunkelhaft für jugendliche Häftlinge war damals verboten, aber wer kümmerte sich schon darum! Dunkelhaft, Hartlager und Fasttag war seinerzeit nur für erwachsene Häftlinge zulässig. Seinerzeit gab es noch kein Strafvollzugsgesetz. Die Gefängnisse wurden nach Gutdünken der Justizwache verwaltet. Auch mit der Verabschiedung des Strafvollzugsgesetz 1970 sollte ich zukünftig lernen, dass die Herrschaft der Justizwache schaltete und waltete, wie es ihr beliebte, sodass das Strafvollzugsgesetz stets nur Schönfärberei auf Papier blieb. Schlafen konnte man nur am Boden auf einer Matratze. Dazu nur eine dünne Decke ohne Leintuch und Überzug. Es gab auch kein Tisch oder Sessel. Man lebte regelrecht am Boden. Die Matratze und Decke wurde Untertags ab 07.00 Uhr früh aus der Absonderungszelle rausgeholt und man bekam es Seite 47 von 60 wieder um 20.00 Uhr Abends. Für den Notdurft gab es ein Kübel und zum trinken eine Plastikkanne mit Trinkwasser. Geöffnet wurde nur kurz für die Nahrungsmittel, gleichzeitig um den Notdurftkübel auszuleeren oder um frisches Wasser zu bekommen. Die Dunkelheit, absolute Stille und die Einsamkeit sowie die tägliche Kälte ließ mich so verzweifeln, dass ich die Wasserkanne aus Hartplastik zerbrach und ich mich mit den Splittern die Pulsadern aufzuschneiden versuchte. Das war meine erste Selbstbeschädigung überhaupt. Es war kein Suizidversuch, sondern aus der Verzweiflung der Isolation, der Stille und Einsamkeit heraus. In gewisser Weise war es auch eine Reaktion und ein allmählich schleichenden Ausbruch der in mir damals unbewusst schwellenden Borderline-Persönlichkeitsstörung, was ich Jahrzehnte später im Zuge der Aufarbeitung meines Lebens und der Selbstfindung in etwa analysierte. Denn von da an sollte in absehbarer Zeit eine Welle der Selbstbeschädigung folgen durch selbstzugefügten Schnittverletzungen an den Armen, durch schlucken von Metallgegenständen sowie durch Einspritzung von Kot oder Dreck unter der Haut, um sogenannte Phlegmonen zu bekommen sowie auch ernsthaften Suizidversuche. Wegen den Schlucken von Metallgegenständen musste ich 5-mal am Magen operiert werden. Wegen Phlegmonen 7-mal. Und wegen Schnittverletzungen unzählige Male genäht werden. Siehe Fotos der Vernarbungen über den ganzen Körper (67. bei etwas zoomen gut sichtbar). Nach der vernähen der Schnittwunden in ein öffentliches Krankenhaus kam ich gleich wieder in die Absonderung zurück mit dem einzigen Unterschied, dass ich keine Wasserkanne mehr bekam mit der ich mich erneut verletzen hätte können. Bei Durst musste ich anklopfen. Eine soziale oder psychologische oder therapeutische Betreuung und Behandlung für psychisch auffällige jugendliche Häftlinge gab es damals in den 60er und 70er Jahren keines. Es gab zwar Anstaltspsychologen, aber offenbar nur um ein gutes Monatslohn abzukassieren. Die Behandlung bei Selbstbeschädigung oder bei Suizidversuche bestand darin, dass man in Isolation abgesondert wurde oder, falls man sich auch in der Absonderung selbstbeschädigte wurde man selbst in der Absonderung einer strengeren Isolation unterzogen. Dabei kam es nicht selten vor, dass manche Wärter selbstbeschädiger oder Suizidgefährdete mit Beschimpfungen oder mit körperlichen Misshandlungen davon abzubringen versuchten. Die Absonderungszellen der Abteilung waren jedenfalls stets vollbesetzt mit jugendlichen, die einen Haftkollaps bekommen hatten, die sich selbstbeschädigten oder die Suizidversuche unternahmen oder wegen Raufhandel oder wegen sonstiger Ordnungswidrigkeiten. Während die 14 Monate Strafhaft kamen mir meinen Eltern nur einmal zu Besuch. Wie ich später erfuhr, waren sie zerstritten und lebten zu dieser Zeit mal getrennt und mal wieder zusammen. Meine Geschwister lebten ebenso außerhalb der Familie in aller Winde zerstreut, teilweise verheiratet oder liiert mit einem Partner. Zwei Schwestern von mir wurden zu prostituierten nachdem sie vom Heim geflüchtet waren und von Männern und Zuhältern aufgegriffen und vergewaltigt und zur Prostitution gezwungen wurden. Als ich schließlich Februar 1967, knapp unter 18 Jahren entlassen wurde, war ich ein Nervenbündel sowie geistig und psychisch ein Wrack, ohne berufliche Erfahrung, ohne irgendwelchen Zukunftsziele Seite 48 von 60 oder überhaupt in entferntesten der Vorstellung einer Zukunft sowie der menschlichen Bezug zu meinen Eltern und Geschwister durch die lange Trennung und der Zwischenereignisse in den Heimen und Jugendgefängnisse entwurzelt und entfremdet. Passfoto von mir von 1967 im Alter von 18 Jahren Meine Eltern, in Begleitung meines Bruders Leopold und der kleineren Geschwister Teresita und Antonio holten mich am Entlassungstag ab und wir fuhren nach Maria Schutz, gelegen zwischen Schottwien und Semmering, wo mein Vater die Pension „Marienhof“ gepachtet hatte. Aus dem Geld des Pflichtanteils der Erbschaft des Hotels „Währingerhof“, als meine Großmutter 1966 verstorben war. Pension „Marienhof“ in Maria Schutz/NÖ Erst nach meiner Entlassung erfuhr ich vom Tod meiner Großmutter sowie vom Tod meines Stiefgroßvaters, der ein Jahr vor ihr verstorben war. Bis zuletzt blieb mein Vater mit der Großmutter zerstritten, so dass er enterbt wurde und er nur den Pflichtteil von knapp 2 Millionen Schilling ausbezahlt bekam. Mit diesem Geld pachtete er die Pension „Marienhof“ und investierte hunderttausende Schillinge für Renovierungen und eine neue Ausstattung. 1968 ging er pleite damit, weil die Gäste ausblieben. Seite 49 von 60 Wie er mir Jahre später erklärte, wurde er von einem Rechtsanwalt reingelegt, der ihn die große Rentabilität der Pension einredete, die sich schließlich als Flop erwies. Damals erfuhr ich auch zum ersten Mal von meiner Mutter über die Schicksale meiner Schwester Christina und Martha, wie oben schon geschildert. Meine Schwestern Ana und Isabella, die ebenfalls in Heimen waren, waren mittlerweile verheiratet und hatten Kinder und wohnten in den Wohnungen ihrer Ehemänner. Sie hatten das Glück gehabt ordentliche Männer kennengelernt zu haben. Trotzdem sind auch an beiden die psychischen Torturen in den Heimen nicht spurlos vorübergegangen. Besonders meine Schwester Isabella litt auch Jahre danach und ist deswegen heute noch in therapeutischer Behandlung. In der Pension half ich meinen Vater manchmal in der Küche oder meinen Bruder beim kellnern im Speiseraum der Pension aus. Ich war aber weder für das eine oder für das andere tauglich. Zum Kellnern war ich bedingt meiner innerlichen Nervosität und Unsicherheit einfach unfähig. Es fehlte mir jeglichen berufliche Erfahrung und Selbstvertrauen. Ich zitterte bei jede Serviergang der Gäste, so dass mir die Tellern aus der Hand glitten oder so umkippten, das das essen über die Teller lief. Also wurde ich von meinen Vater nur zum Putzen und Geschirrwaschen in der Küche eingeteilt oder zum Saubermachen der Gästezimmer und sonstigen Räumen der Pension und bekam dafür einen bescheidenen Taschengeld. Von Anfang an fühlte ich mich in der Familie und in der Pension nicht wohl und wie ein fremder als Gast. Ich verspürte keinen innerlichen Bezug mehr zu meinen Eltern und Geschwister, obwohl sie sich durchaus um mich kümmerten. Dafür verspürte ich fast ständig ein Druck wie ein Klotz am Hals und auf der Brust sowie eine innerliche Unruhe, die mir auch den Schlaf raubte. Ich war nun wieder in Freiheit, gleichzeitig aber weiter in Isolation als gefangener meiner selbst, ohne es mir bewusst zu sein. Was ich zuvor in Uruguay zwischen meinen Eltern nie erlebte, war die Häufigkeit, die Heftigkeit und Aggressivität wie sie sich nun fast täglich stritten. Die Streitereien gingen vorwiegend von meinen Vater aus, der offensichtlich wegen des schlechtgehenden Geschäfts sehr frustriert war und er sich ständig bei meiner Mutter abreagierte und gelegentlich auch handgreiflich wurde. In solchen Situationen verspürte ich plötzlich wieder kurze Momente meiner Zuneigung zu meiner Mutter, wie ich es als Kind empfand, da sie mir immer näher stand als mein Vater. Als ich eines Tages mit meiner Mutter und den kleineren Geschwister im Lokalzimmer vor den Fernseher saß, kam mein Vater aus der Küche und schimpfte ungehemmt vor Gästen und wutentbrannt auf meine Mutter ein. Er beschimpfte sie als Hure, die nur herumsitzt und nichts tue etc., obwohl meine Mutter ihr Leben lang sehr fleißig war und auch in der Pension arbeitsmäßig sehr engagiert war. Als er zudem meiner Mutter ins Gesicht schlug, sprang ich spontan auf und versetzte meinem Vater einen Fußtritt, der zwischen seinen Beinen abrutschte und auf seinen Schritt landete und schrie ihn an, Mutter in Ruhe zu lassen. Ich konnte es nicht mehr ertragen und nicht mehr zusehen, wie er meine Mutter behandelte, die uns Kinder immer bestens versorgt und umsorgt hatte. Seite 50 von 60 Mein Vater krümmte sich vor Schmerzen zusammen. Er schrie lautstark auf und rief gleichzeitig nach meinen Bruder und beschwerte sich bei ihm, dass ich ihn einen Fußtritt verpasst hätte. Foto 1975: Mein Vater im Alter von 67 Jahre Daraufhin attackierte mich mein Bruder. Ich stieß ihn von mir weg, worauf er stolperte und gegen die Vitrine der Schenke stolperte und sich dabei an der Hand verletzte. Nun zog sich mein Vater und mein Bruder im Büro zurück, von wo sie die Gendarmerie anrief. 10 Minuten später war die Gendarmerie da und ich wurde wegen leichte Körperverletzung und gefährlicher Drohung gegen meinen Vater und Bruder auf freien Fuß angezeigt. Meine Mutter, die noch immer sehr gebrechlich deutsch sprach, weil sie wegen der Kinder fast nie außer Haus kam versuchte den Gendarmen zu erklären, dass ich ihr nur geholfen hätte, weil unser Vater ihr gegenüber Gewalttätig geworden sei , aber die Gendarmen hörten nur auf meinen Vater und Bruder, obwohl mein Bruder zur Zeit des Geschehen nicht einmal im Lokalzimmer war und daher nicht gesehen haben konnte, das ich meine Mutter nur verteidigt hatte. Die Gendarmen nahmen nur die Sachverhalte meines Vaters und Bruder zu Protokoll und ignorierten die Zeugenangaben meiner Mutter, offensichtlich wollten sie keine weiteren Umstände haben, da sie nur gebrochen deutsch sprach. Im Dezember 1967 wurde ich deswegen dann beim LG Wiener Neustadt zu sechs Monate Kerker wegen leichte Körperverletzung, gefährliche Drohung und wegen Angriff auf eine elterlichen Erziehungsperson verurteilt, letztere der Grund zu der hohen Haftstrafe war, GZ: 9 A E Vr 852/67, 9 Hv 376/67 des LG Wiener Neustadt. Vorerst verblieb ich aber trotz des Vorfalls weiterhin in der Pension Wohnhaft und half weiterhin beim Putzen der Gästezimmer und sonstiger Räumlichkeiten. Nach einiger Zeit verstand ich mich wieder mit meinen Vater, den es mittlerweile leid tat mich überhaupt angezeigt zu haben. Jedenfalls hat er meine Mutter nie mehr in meiner Gegenwart beschimpft oder geschlagen. Damals nahm ich nicht bewusst auf, wie spontan, impulsiv und wütig ich reagieren konnte, und zwar nicht aus den Verstand heraus, sondern rein emotional. Eines Tages checkte eine ziemlich dicke ältere Frau für ein paar Tage Urlaub in der Pension ein, die mit meinen Vater geschäftlichen Beziehungen hatte. Sie war Marktfrau und besaß ein Gemüse- und Seite 51 von 60 Obstladen am Naschmarkt in Wien und belieferte meinen Vater mit frischen Gemüse und Obst. Offenbar hatte sie großmütterliche Gefühle für mich übrig, so glaubte ich es zumindest, da sie stets wollte, dass ich ihr bei Tisch Gesellschaft leiste. Eines Tages lud sie mich dann ein mit ihr nach Wien zu fahren, bei ihr zu arbeiten und zu wohnen. Ich sollte ihr nur beim Anziehen und beim Putzen im Haushalt in ihrer Wiener Wohnung helfen. Mein Vater redete es mir auch ein, sodass ich mit ihr nach Wien fuhr. Ich putzte ihr die Wohnung und half ihr auch beim Anziehen. Die ersten Tage verliefen sehr freundlich. Sie war mit Geschenken sehr zuvorkommend. Sie kaufte mir neue Kleider und Schuhe etc. Sie hatte am Naschmarkt mehreren Gemüse- und Obststände, wo sie mich ab und zu mitnahm und war wohlhabend, wie sie mir erzählte. Das einzige komische war, das ich mit ihr in einen Doppelbett schlafen musste, da sie kein anderes Bett in der Wohnung hatte. Als sie nach zirka zwei-drei Wochen eines Abends zu mir unter der Decke griff und sich mit mein Penis herumzuspielen begann, war ich schockiert, traute mir aber nichts zu sagen. Da es ihr nicht gelang mein Penis zu erregen, ließ sie davon ab. Am nächsten Tag packte ich meine Sachen und flüchtete aus der Wohnung. Bis heute weiß ich nicht, wie alt sie tatsächlich war, so etwa zwischen 65-70 schätzte ich. Ich sah sie eher als Ersatzgroßmutter an, aber Sex mit ihr zu haben war für mich unmöglich. Zwar hatte ich meinen ersten sexuellen Kontakt ebenfalls mit einer älteren Frau, wie ich bereits schilderte, aber diese hatte noch eine straffe schöngeformte Figur, während die Naschmarktfrau unschön dick und viel älter war. Nun allein in Wien machte ich mich auf die Suche nach meinen Schwestern, die in Wien als Prostituierte arbeiteten und ich fand sie auch. Christina arbeitete abwechselnd in der Kärtnerstraße und Mariahilferstraße, die damals in bestimmtem Straßenbereiche für die Prostitution frei waren. Und meine Schwester Martha war am Wiener Gürtel als prostituierte tätig. Ihre Schicksal in den staatlichen und katholischen Heime, letztere im Klosterheim Wr. Neudorf in Niederösterreich war nicht weniger von Gewalt, Erniedrigungen und sexueller Missbrauch geprägt, als mein eigenes Schicksal. Eine Zeitlang wohnte ich abwechselnd in ihrer Wohnungen, die sie mit befreundeten prostituierten teilten. Sie halfen mir auch mit etwas Taschengeld und Verpflegung. Auf den Gedanken eine Arbeit anzunehmen und nachzugehen, kam ich nicht. Nach der Entlassung wurde ich mehr oder weniger von meinen Eltern übernommen und in der Pension zu Hilfsarbeiten eingeführt. Ich persönlich hatte nicht einmal eine Ahnung wie, wann und wo man sich zu einer Arbeit vorstellt. Meine Fähigkeiten und meinen Erfahrungen beschränkten sich auf die negative Zeit in den staatlichen Heimen und Jugendgefängnisse, wo ich nichts Vernünftiges erlebt und gelernt hatte, sei es beruflich oder menschlich. Aus eigener Initiative hatte ich nur aus den Heimen zu flüchten und am Straßenmilieu mit Kleinkriminalität zu überleben gelernt. Meine Pubertätszeit und meine ganze Jugend hatte ich nur in Heimen und Jugendgefängnisse verbracht, stets mit unmenschlichen konfrontiert. In Freiheit nun vegetierte ich nur dahin, Seite 52 von 60 beschränkt auf die primitivsten Bedürfnisse des Überlebens. Zu was anderen war ich nicht fähig. Zu dieser Zeit hätte ich eine vernünftige und erfahrene Person an meine Seite gebraucht, der mir einen Weg gezeigt hätte, um einen vernünftigen Weg einschlagen zu können. Denn im Kopf war ich zu dieser Zeit leer, dafür trug ich in der Seele einen Rucksack voller Probleme und Schmerzen. Als ich dann von meiner Mutter August 1967 informiert wurde, dass die Anklageschrift wegen des Vorfalls mit meinen Vater an ihre Adresse zugestellt wurde, bekam ich Angst vor eine Rückkehr ins Gefängnis und fuhr mit einen deutschen Freier nach Deutschland, den meine Schwester Martha gut kannte und mit ihm befreundet war. Mit seinem deutschen Auto fuhren wir über die Grenze Freilassing nach Deutschland. Einen Reisepass hatte ich schon beantragt gehabt und mittlerweile auch schon ausgefolgt erhalten. Wieder einmal war ich auf der Flucht. In München angekommen führte mich der Freier und Freund meiner Schwester im Nachtleben ein, die seinerzeit in den 60er bis 67er Jahren durch die Hippie-Bewegung schillerndsten war. Nach ein paar Tagen hatte er aber offensichtlich keine Lust mehr ständig für mich aufzukommen, sodass ich seine Wohnung verlassen musste und nun auf der Straße stand, ohne Geld und Unterkunft. Nun folgten die Schritte, die ich in Wien auf der Flucht aus den Heimen gelernt hatte. Am Straßenmilieu zu Leben und zu überleben. Der Hauptbahnhof München bot sich damals als Schlafstätte sehr gut an. Es schliefen dort auch viele ausländische Hippies, die kein Geld mehr für einen Unterkunft hatten. Die Münchner Polizei war damals tolerant und ließen uns in den Untergängen des Bahnhofs schlafen. Um Mahlzeiten oder Geld für meine täglichen Bedürfnisse zu beschaffen, begann ich im Nachtleben Münchens in den Homo und Lesben und prostituierten lokale Ausschau zu halten. Da ich noch sehr jung war, hatte ich es nicht schwer von homosexuelle stets eingeladen zu werden. Sie bezahlten mir Mahlzeiten und Getränke. Als sie Gegenleistungen wollten, lief ich einfach davon. Ein paar Mal ließ ich bei mir aber dann doch von älteren Homosexuelle Masturbieren und /oder Oralverkehr machen, weil der Angebot so gut war. Es ergab sich nicht die Situation ihnen nur die Brieftasche zu entreißen und davonzulaufen. Mir grauste, aber ich brauchte das Geld. 100 bis 200 deutsche Marks waren damals viel Geld. Ich kaufte mir damit neue Kleidung und Schuhe. Mit Geld konnte ich genauso nicht umgehen. Das widerlich verdiente Geld war sehr schnell weg. Zwei drei Mal gelang mir dann doch Homosexuelle die Brieftasche zu entreißen und reiß aus zu nehmen, wie ich es in Wien von anderen entflohenen Zöglingen am Naschmarkt oder bei der Opernpassage gelernt hatte. Dann lernte ich aber eine mittelältere prostituierte in einen Nachtlokal kennen, die mich ein paar Wochen bei ihr schliefen ließ und mich finanziell unterstützte und sexuell verwöhnte. Meinerseits waren weder Liebesgefühle noch besondere Leidenschaft dabei, sondern es war einfach praktisch für mich versorgt zu werden. Sie wollte meistens, das ich oral-und Analverkehr bei ihr mache oder sie oral bei mir. Warum sie nur Analverkehr wollte, weiß ich bis heute nicht. Seite 53 von 60 Eines Abends ging ich dann durch die belebten Straßen München herumspazieren und rief eher spontan und übermütig zwei Mädchen auf Spanisch spontan zu „Eh, Bonitas (Hallo, ihr schönen)“, zumal mir eine von ihnen sehr gefiel. Eigentlich war das nie meine Art. Die Mädchen lachten auf und zu meiner Überraschung erwiderten sie mir auf Spanisch „Gracias, Muchacho (Danke Junge)!“. Da sie spanisch sprachen, also meine Muttersprache kamen wie mitten auf der Straße ins Gespräch. Sie waren Tramperinnen aus New Mexiko mit mexikanischen Wurzeln, deswegen sprachen sie auch spanisch. Ich wiederum sagte ihnen, dass ich aus Uruguay komme und nun in Österreich lebe. Wir gingen in einen Caféhaus und unterhielten uns ausgiebig auf Spanisch über unseren Ursprungländern. Wir konnten uns gut miteinander unterhalten, sodass es sehr spät wurde. Nie zuvor konnte ich mich so frei und unbeschwert mit anderen jungen Frauen unterhalten, schon gar nicht auf Spanisch. Als sie mich fragten, wo ich in München schlafen würde, konnte ich ihnen nicht sagen, dass ich in der Wohnung einer Prostituierten schlafe und log sie an, dass ich in München keine Schlafstätte hätte. Daraufhin lud mich zu meiner Überraschung eines der Mädchen dazu ein in ihre Hotelzimmer zu schlafen. Gerade dieses Mädchen lud mich ein, die mir so gefiel. Sie hieß Nadine Maria Bunn und sie war sowie ich 18 Jahre alt. Offenbar beruhte diese Zuneigung auf Gegenseitigkeit, denn kaum in ihr Hotelzimmer angelangt, lagen wir schon im Bett und schliefen miteinander, ungeniert das ihr Freundin im nebenan im Bett lag. So war es in den 67er-Jahren während der Hippie-Zeit. Auch die Mädchen suchten sich ihre Partner aus und taten nicht lange herum. Wir blieben zusammen und ich schlief in der Folge weiter im Hotelzimmer mit ihr. Nadine bezahlte das Hotelbett für mich, denn ich hätte kein Geld für ein Hotelzimmer gehabt. Ihre Freundin nahm sich ein anderes Hotelzimmer gleich nebenan. Trotzdem waren wir tagsüber die meiste Zeit zu dritt zusammen. Noch nie zuvor hatte ich mit einem Mädchen zusammengelebt. Mit Renate in den Polizeiheim 1964 war es eine platonische Beziehung. Mit Nadine lernte ich nunmehr eine bisher nicht gekannte Leidenschaft und Anziehungskraft. Nadine hatte immer ausreichend Geld und sorgte für unseren Unterhalt. Ihre Eltern waren Besitzer von Ölfeldern in New Mexiko und ihre Freundin wiederum war die Tochter eines amerikanischen Botschafters, so jedenfalls ihrer Erzählung nach. Geld hatte sie jedenfalls genug. Es folgten Wochen, die wir mit Sex und auf den Nachtleben verbrachten. Nicht das ich was dagegen gehabt hätte. Im Gegenteil, aber die treibende Kraft zum Nachtleben und ausgiebigen Leben war vor allem Nadine. Heute würde ich sagen, dass Nadine eine durch die Eltern finanziell verwöhnte Göre war, dass einfach das machte, was ihr Spaß und Lust machte. Und davon ließ sie sich nicht abbringen. Was den Sex anging, war sie jedenfalls erfahrener bzw. ungehemmter als ich. Als sie einmal allein zum Friseur ging und ich mit ihr Freundin allein im Hotelzimmer verblieb, zog mich ihr Freundin ins Bett und ich hatte auch mit ihr Sex. Das war für mich schrecklich, vor allem weil sie während des Seite 54 von 60 normalen vaginalen Verkehrs Schmerzensschrie ausstieß, wenngleich ich ihr unmöglich weh getan haben konnte, da ich über kein Monsterpenis verfüge damit ich ihr tatsächlich weh tun könnte. Erschreckt unterbrach ich den Geschlechtsverkehr und fragte ihr, was los sei. Daraufhin begann sie zum Weinen und erzählte mir, dass sie im Alter von acht Jahren von einem Mann vergewaltigt worden sei und dass sie seither – in Erinnerung der Vergewaltigung als Kind und der unvorstellbaren Schmerzen - nicht vermeiden kann beim Geschlechtsverkehr schmervoll zu schreien. In Erinnerung meiner eigenen Vergewaltigung im Heim „Lindenhof“ in Eggenburg, tat sie mir sehr leid, aber ich fand nicht die Worte, um sie zu trösten und hatte danach auch nie mehr sexuellen Kontakt mit ihr. Rückblickend gesehen, vermute ich heute, dass das Mädchen, die zu dieser Zeit ebenfalls 18 Jahr jung war psychisch in den Stand des Traumas der Vergewaltigung steckengeblieben ist und dringend eine psychotherapeutische Behandlung gebraucht hätte. Heute noch denke ich manchmal mit Traurigkeit an sie und frage mir stets, was aus ihr geworden sei, hörte aber nie wieder etwas von ihr. Nach eine kleinen Streit und Handgemenge in einen Caféhaus voller jungen Leute , wo man sich wegen eines Sitzplatzes herum schubste, ohne sich verletzt zu haben, wurde ich und zwei weiteren Personen von der Münchner Polizei vorläufig festgenommen. Und da ich meinen Reisepass nicht mithatte und ich angab aus Österreich eingereist zu sein, ergab die deutsche behördenanfrage in Österreich, das ich wegen des Straffalles im Zusammenhang meines Vaters und Bruders auf der Fahndungsliste stand. Ich kam in Schubhaft der Fremdenpolizei und wurde Tage später nach Österreich überstellt, wo ich an der Staatsgrenze Freilassing von der Salzburger Polizei übernommen und weiter nach Wiener Neustadt überstellt wurde. Meine Freundin Nadine fuhr mir nach und mietete in Wien eine kleine Wohnung, besuchte mich regelmäßig und unterstützte mich auch finanziell während der Haft. ihren Angaben nach war sie von mir Schwanger geworden. Wegen des Straffalles in Maria Schutz wurde ich beim Landesgericht Wiener Neustadt Dezember 1967 zu sechs Monate Freiheitsstrafe verurteilt, GZ: 9 A E Vr 852/67, die ich zur Gänze in Gefangenenhaus für erwachsenen in Wiener Neustadt absaß, da ich im Juni 1967 18 Jahre alt geworden war. Meine Mutter, die mich erheblich entlasten hätte können, da ich sie nur vor der häuslichen Gewalt meines Vaters schützen wollte, wurde als Zeugin nicht vorgeladen, da die Gendarmerie Schottwien keine Zeugenaussage von ihr aufgenommen hatte. Normalerweise hätte auch mein Vater wegen häuslicher Gewalt vor Gericht stehen müssen und ich höchstens wegen Übertretung der Notwehr im Zuge der Verteidigung meiner Mutter. Aber so ist es einmal, wenn man über seine rechte nicht in Kenntnis ist und sich selbst nicht verteidigen kann, bleibt man halt über. Die Haftbedingungen im Gefangenenhaus Wiener Neustadt waren ähnlich diese des Jugendgefangenenhauses in der Hardtmuthgasse im 10. Wiener Bezirk. Absitzen, arbeitsmäßige Ausbeutung sowie billigste ernährt und verwaltet sowie keine Freizeitgestaltung oder Resozialisierungsmaßnahmen. Der wesentliche Unterschied bestand nur Seite 55 von 60 darin, dass ich nun auch unter vollerwachsenen und weit älteren Häftlingen mit zahlreichen Vorstrafen und Knasterfahrung einsitzen musste. Aber auch in das Wiener Neustädter Gefangenenhaus traf ich erstaunlicherweise auf zahlreichen ExHeimkinder, die ich aus den Durchzugsheim „Im Werd“ in Wien und „Lindenhof“ in Eggenburg her kannte. Nach einigen Wochen hatte ich mit einem mittelälteren Häftling mit zahlreichen schweren Vorstrafen, wie sich später bei der Gerichtsverhandlung herausstellte, unter der Dusche eine körperliche Auseinandersetzung. Er arbeitete als Kapo-Hausarbeiter in der Abteilung und war für die Ausgabe der Mahlzeiten und Reinigungsmaterial etc. zuständig. Er kontrollierte auch, dass die Insassen zügig aus der Dusche rauskamen. Duschen war nur einmal in der Woche erlaubt und die Duschzeit betrug höchstens zehn Minuten, inbegriffen aus- und anziehe Zeit. An diesen Tag war ich noch beim Trocknen, als alle anderen schon fertig waren. Er kam in den Duschraum, schrie mit mir herum und wollte mich aus dem Duschraum raus zerren. Als ich mich dagegen stemmte fing er an auf mich einzuschlagen. Ich schlug panisch zurück. Er ließ mich los und rannte zum Abteilungsbeamten, der mich ohne zu befragen, was wirklich passiert ist, strafweise in eine Absonderungskellerzelle verlegte. Obwohl ich selbst sichtbar am Auge leicht verletzt war, wurde ich keinen Anstaltsarzt vorgeführt, wohl aber der Kapo-Hausarbeiter, sodass es nur gegen mich zu einer Strafanzeige wegen leichter Körperverletzung kam, wofür ich letztlich 8 Tage Arrest Zusatzhaftstrafe bekam, GZ: 5 U 1581/68 des LG Wiener Neustadt. Ich hatte mittlerweile gelernt, dass man sich von Mitgefangenen, noch dazu von Kapos nicht unterdrücken oder sonst was gefallen lassen darf, sonst geriet man in die Teufelsküche. Entweder wird man dann sexuell missbraucht, unterdrückt und schikaniert und/oder finanziell genötigt oder vor die eigenen Augen bestohlen, ohne dass man sich dagegen wehren kann. Gleichzeitig machte ich aber auch die Erfahrung, dass das Kapo-System an Hausarbeiter in den Zellenabteilungen und an Vorarbeiter in den Betrieben genau genommen ein Sklaven-System der Justizwache war, den sie nahmen der Justizbeamten die Arbeit ab, während die Beamte im Dienstzimmer die Zeitungen lasen oder Kreuzworträtsel auflösten, heute bei Handy- oder Computer. Als verlängerten Arm der Justizwache genießt das Kapo-System im österreichischen Strafvollzug heute noch höchste Beliebtheit bei der Justizwache sowie freien Hand mit Mitgefangenen herumzuschreien und herumzukommandieren, gleichzeitig mit allen Intrigen und Verleumdungen zu agieren, um ihre Machtstellung zu demonstrieren und ihren Vorteilen der Vollzugslockerungen bis zur bedingter Entlassung hin durchzusetzen. Wehe den Häftling, der sich im österr. Strafvollzug über Missstände beschwert, denn er hetzt sich gleichzeitig dem Kapo-System auf den Hals. Im Grunde genommen, wie ich Jahre später in Dokumentationsliteratur über die österreichische Geschichte las und mich hinein studierte, insbesondere über die Nazivergangenheit Österreichs, war es nichts anderes als die Fortsetzung des Kapo- Systems wie in die KZs praktiziert wurde, nur in sanfterer Form. Seite 56 von 60 Man wird als Strafgefangener oder als Untersuchungshäftling nackt ausgezogen und dann zählt nur mehr völlige Unterwerfung und sich die Willkür des Gefängnispersonals kritiklos anzupassen. Wer als Häftling auf Rechtsstaatlichkeit, Menschenwürde oder Menschenrechte pocht, der kommt hinter Gittern sehr schnell unter die Räder. Ein allgemein schwerer Missstand im österr. Strafvollzugssystem, der bis zur Gegenwart praktiziert und bis zum Justizministerium hinauf toleriert wird – da herrscht Chorgeist bis zu den höchsten Behördeninstanzen und Politiker des Staates. Das ist meine Erfahrung, die ich in den staatlichen Heimen und Gefängnisse über Jahrzehnten eingesammelt habe, darüber mich zu äußern ich mir von niemand einen Maulkorb verpassen lasse. Nach der strafweisen Absonderung in eine nackte Zelle in der Kellerabteilung wurde ich in eine leere Zweimannzelle in eine andere Abteilung verlegt und in einen Betrieb zur Arbeit eingeteilt, wo man für eine Privatfirma Griffe auf Plastiktaschen schweißten. Für den ersten Moment war ich erschreckt und irritiert, als die Zellentüre aufging und ich meinen neuen Zellenpartner eintreten sah. Nicht nur, dass ich ihn aus der Erziehungsanstalt in Eggenburg her persönlich kannte, war er zudem Homosexuell. In derart homosexuell, als das er mit Schulterlangen Haaren und femininen Gehabe offen das Weibchen demonstrierte. Er war nur ein halbes Jahr älter als ich und an sich ein ruhiger und friedlicher Typ, nur halt gerne ein Weibchen. Ob ich wollte oder nicht, musste ich mit ihm auskommen, denn seinerzeit gab es keine Wunschverlegungen. Und ich kam auch aus mit ihm, denn er war ein friedlicher Typ und mit ihm konnte man sich auch unterhalten. Das Niveau der Unterhaltung beschränkte sich allerding auf Gespräche unserer Erlebnisse vor der Zeit in den Heimen und über die Heimzeiten und der strafbaren Handlungen, weshalb wir eingekerkert wurden - das war halt unser geistiger Horizont Nach zirka eine Woche ließ ich mich dazu hinreißen und ließ mich von ihm Oral befriedigen, während ich die Augen zudrückte und an meine Freundin Nadine dachte. Mit seinen langen Haare und weiblichen Gehabe konnte man ihm beim ersten Blick tatsächlich für ein Mädchen verwechseln. Zudem konnte er sehr gut und leidenschaftlich beim Penis lutschen und saugen, jedenfalls empfand ich es besser und bequemer als selbst zu onanieren. Tage später verkehrte ich ihn auch Anal. Er wollte es unbedingt und ich probierte es aus. Eine Gegenleistung verlangte er nie. Er war schon zufrieden und glücklich sich als Weib hinzugeben. So kam ich erstmals aus freien Willen zu bisexueller Handlungen. In der Folge ließ ich mich dann öfters von ihm befriedigen, wobei wir ständig darauf achten mussten nicht erwischt zu werden, weil Homosexualität seinerzeit strafrechtlich geahndet wurde. Aus heutiger Sicht gesehen war diese sexuelle Beziehung auch eine Art von Zeitvertreib und Nervenkitzel, denn sonst gab e nichts, womit man seine Freizeit gestalten hätte können. Im Verlauf unserer Unterhaltungen erzählte er mir, dass er schon als Kind die starke Neigung verspürte ein Mädchen zu sein und dass er sich als halbwüchsiger nur zu Jungen hingezogen gefühlt hatte. Von da an begegnete ich Homosexuelle nicht mehr Voreingenommen oder Feindselig, sei es das sie zu lästig und aufdringlich wurden. Seite 57 von 60 An Werktagen arbeiteten wir ein paar Stunden, die übrige Tageszeit, Sam- und Sonntage waren wir ansonsten in der Zweimannzelle auf uns ganztätig allein gestellt. Nach meiner Entlassung Mitte 1968 aus den Wiener Neustädter Gefangenenhaus, wurde ich von meiner Freundin Nadine und meiner Mutter abgeholt. Mein Vater ist mittlerweile mit der Pension „Marienhof“ in Maria Schutz pleite gegangen und arbeitete nunmehr als Chefkoch in der Lungenheilanstalt in Aland bei Baden bei Wien und bewohnte dort auch eine Dienstwohnung. Nun bewohnte ich mit Nadine eine Kleinwohnung im 16. Bezirk in Wien, die sie angemietet hatte und auch bezahlte. Die ersten Wochen verliefen zwischen mir und meine Freundin schön und ruhig. Verändert hat sich aber, da sie nicht nur Schwanger war, sondern das sie gesamtkörperlich auch ziemlich dick geworden war und das sie mir dick nicht mehr reizte und gefiel. Ich empfand kaum mehr Gefühle und Leidenschaft für sie, obwohl ich weiterhin sexuellen Verkehr mit ihr hatte, aber es war nicht mehr so, wie es einmal war. Es klingt hart, aber ich hatte auch keine Gefühle oder Verständnis dafür Vater zu werden oder Vater zu sein. Das überstieg meine emotionale Empfindungsfähigkeit und übersprang bei weitem meine Vorstellungskraft, deswegen machte ich mir und konnte ich mir auch keine Gedanken und Überlegungen darüber machen. Zudem kam der Druck, dass wir von heute auf morgen nicht einmal mehr das Geld für die Miete hatten. Das kam daher, weil ihre Eltern sie damit zwingen wollten nach Amerika zurückzukehren. Sie hatten ihr ein Flugticket gekauft, die sie von der amerikanischen Botschaft abholen konnte und ansonsten schickten sie ihr kein Geld mehr. Ich begann allein fortzugehen. Ich konnte ihr nicht sagen, dass ich allein sein wollte, weil ich mit Ladendiebstählen und kleineren Einbrüche Nahrungsmittel und alltäglichen Gebrauchsmitteln sowie Geld für die Miete beschaffen wollte. Sie machte mir aus Eifersucht ständig Szenen, weil sie glaubte, dass ich eine andere Freundin hätte und deswegen öfters allein fortgehe. Nun wollte sie unbedingt auch, dass ich mit ihr nach New Mexiko in Nordamerika fahre, weshalb sie von den Eltern ein zweites Flugticket erzwingen wollte. Auch die Eventualität mit ihr nach Nordamerika zu fahren reizte in mir keine Gedanken. Ich wusste zwar, dass ihre Eltern wohlhabend sein sollten, aber ich konnte mir darunter kaum was vorstellen. Ich war nur auf Reize und Bedürfnisse programmiert von einen Tag auf den anderen zu überleben und darüber hinaus gab es keinen vorausschauenden Horizont oder vorausschauenden Überlegungen. Als mir ihren Szenen zu viel wurden, packte ich meine Habseligkeiten und verließ sie für immer. Ihre Szenen deprimierten mich derart, bis ich mich schließlich gänzlich zurückzog und versperrte, umso leichter weil sie mir ohnehin nicht mehr gefiel und weil ich mich trotz ihrer Gegenwart zunehmend isoliert und vereinsamt fühlte. Sie versuchte mich eine Zeitlang überall zu finden und als ihr das nicht gelang fuhr sie schließlich allein nach Amerika zurück. Monate später erfuhr ich, dass sie meiner Mutter geschrieben hat Zwillinge geboren zu haben, zwei Buben. Wenn sie meine Kinder sind, so können sie froh sein so Seite 58 von 60 einen Vater wie mich nie kennengelernt zu haben, so traurig und schmerzvoll es auch für mich und den Kindern ist. Mittlerweile war ich in Juni 1968 neunzehn Jahre alt geworden und, wie per Beschluss des Landesgericht Graz bestätigt (68.), waren es keine schwerwiegenden Jugendstraftaten (bitte zu berücksichtigen, dass es sich bei manchen Urkunden um Jahrzehnten alten Unterlagen handelt). Nun zog es mich automatisch zum Teufelskreis zurück. Zu bekannten Orten hin in Wien, wo ich als flüchtigem Heimkind am Straßenmilieu zu überleben lernen musste. In der Hoffnung dort auf Bezugspersonen zu treffen, die natürlich nur Ex-Heimkinder, entflohenen Heimkinder oder entlassenen jugendliche Ex-Häftlinge sein konnten mit denen ich manche Stunde der Not geteilt hatte und zu denen ich eine gewissen Bezug empfand. Und tatsächlich traf ich auf bekannte Gesichter aus den Heimen und Gefängnisse. Unter ihnen fühlte ich mich plötzlich wohl und anerkannt. Durch meine mutigen Entweichungen aus den Heimen genoss ich bei den meisten alten Bekannten viel Sympathie und Anerkennung, sodass sie mir gerne mit Unterkunft zu übernächtigen halfen. Mal schlief ich in deren Elternwohnungen oder in den Wohnungen der Freundinnen. Untertags schloss ich mich ihnen an und wir begingen mal Ladendiebstähle oder in der Nacht Einbruchsdiebstähle oder entrissen hie und da einen Homosexuellen die Brieftasche. Wir lebten nur von heute auf morgen. Wir dachten über keine Konsequenzen nach. Die strafbaren Handlungen waren von der Rentabilität her äußerst primitiv, was für unsere Verkapselung in niedriger geistigem Niveau in der wir steckten bezeichnend war. Es ging uns nicht darum reich zu werden oder aus Habgier, sondern um den täglich notwendigen Bedarf an Bedürfnisse zu decken. Anfang Dezember 1968 war es dann vorbei. Ich und zwei Komplizen wurden wegen erpresserischer Nötigung an einen homosexuellen Volksschuldirektor verhaftet. Eines der Komplizen beging eine Lebensbeichte, die zu weiteren Verhaftungen führte, sodass wir schließlich wegen zahlreichen Vergehen und Verbrechen und Bandenbildung angeklagt wurden. Bei keinen der mir und meinen Komplizen angelasteten Straftaten haben wir irgendwelchen Tatopfern physische Verletzungen zugefügt. Abscheulich allerdings war, dass ein Komplize von mir auf die Idee kam eine ältere Frau an den Füßen zu fesseln, damit sie nicht sogleich die Polizei verständigen kann. Diese war die Mutter eines Versicherungsangestellten, den ich von der homosexuellen Szene und Jugendstrichmilieu her kannte, der für Oralverkehr oder für Masturbation an Jungen stets gut zahlte. Ich war auch einmal in seiner Wohnung. Deswegen schlug ich meinen zwei Komplizen vor, dass wir dort vorbeischauen um ihn um Geld zu bitten oder um ihn Geld abzunötigen, falls er kein Geld herausgibt. In den meisten Fällen haben die Homosexuellen Geld freiwillig hergegeben, weil sie Angst vor einer Anzeige hatten, da seinerzeit Homosexualität strafrechtlich geahndet wurde. In diesen Fall ließ uns die ältere Mutter des Versicherungsangestellten in die Wohnung rein, weil sie mich bereits kannte und wir in der Wohnung auf ihn warten wollten, weil er noch nicht von der Arbeit zurückgekehrt war. Im Zuge dessen gingen wir in das Zimmer des Homosexuellen und durchsuchten diese nach Geld. Seite 59 von 60 Die ältere Frau regte sich deswegen auf und drohte die Polizei anzurufen. Daraufhin schob ein Komplize die ältere Frau in das Wohnzimmer und nahm von irgendwoher in der Wohnung strickschnurr und fesselte sie bei den Füßen. Ich wollte das nicht, zumal die ältere Frau nunmehr versprach die Polizei nicht anzurufen, aber mein Komplize tat es trotzdem. Danach verließen wir die Wohnung. Zuvor hatte ich eine Brieftasche, die auf eine Kommode lag eingesteckt. Somit wurde aus eine beabsichtigte Nötigung, falls der Versicherungsangestellte nicht freiwillig Geld hergegeben hätte, ein schweres Raubdelikt an der ich natürlich mitschuldig war, denn ich brachte die Komplizen in die Wohnung, steckte die Brieftasche ein und schritt auch dann nicht ein, als die ältere Frau an den Füßen gefesselt wurde. In der Brieftasche waren läppische 80 Schillinge, was für unsere primitive kriminelle Niveau spricht, in der wir uns bewegt hatten. März 1970 wurde ich wegen dieses Raubdelikts beim LG für Strafsachen Wien zu 8 Jahren schweren Kerker verurteilt, 20 Vr 2266/69, Hv 14/69. Zuvor wurde ich beim selben Gericht in Februar 1969 zu sechs Monate schweren Kerker wegen Einbruchsdiebstähle verurteilt, 8 B E Vr 8500/68, sowie in April 1970 zu weiteren 2 Jahren schweren Kerker wegen erpresserischen Nötigung an Homosexuelle, 6 D VR 305/69, Hv 124/69, und schließlich zu weiteren 8 Monate wegen wiederstand gegen die Amtsgewalt im Zuge eines Suizidversuchs, 8 A E Vr 2514/69. Das sind insgesamt 11 Jahre und 2 Monate schweren Kerker, teilweise verschärft durch ein hartes Lager und Fasttag monatlich, die in eine Kellerzelle auf Holzbretter mit Entzug der täglichen Nahrung zu vollziehen war. Keine der Tatopfer erlitt die kleinste physische Verletzung und der materielle Gesamtschaden aller Delikten überstieg nicht einmal die 5.000,—Schilling Grenze. Zu Veranschaulichung: wenn sie heute festgenommen werden und ihnen zehn verschiedenen Delikte nachgewiesen wird, so werden die Delikte in eine einzige Verhandlung prozessiert und dann ist die Gesamtfreiheitsstrafe weit geringer und zudem zählt es nur als eine einzige Vorstrafe. Früher sind die unterschiedlichen Delikte (Raub, Diebstahl oder Nötigung etc.) in den meisten Fällen jeweils getrennt verhandelt worden, weswegen es zu mehreren Prozesse kam, deswegen kam ich zu so einer drakonischen Gesamtzuchthaushaftstrafe von 11 Jahren und 2 Monate und zu der vermehrten Eintragungen in die Strafregister (früher nannte man die heutigen Justizanstalten „Zuchthaus“). Anfang Dezember 1968 kam ich aber zunächst in Untersuchungshaft in das Gefangenenhaus Josefstadt in Wien und sollte in der Folge wegen der obigen Verurteilungen das Gefängnis knapp acht jahrelang nicht mehr verlassen. Nachdem ich nach zahlreichen Einvernahmen durch den Untersuchungsrichter über die strafrechtlichen Konsequenzen belehrt wurde, nämlich in Strafrahmen von einen bis zu fünfzehn Jahren Freiheitsstrafe angeklagt zu werden, verfiel ich in ein Schockzustand und in eine tiefe Depression mit Folgen der massiven Selbstdestruktivität durch Suizidversuche und der massiven Selbstbeschädigung Natürlich war ich nicht unschuldig, aber wenn man schon vorher so primitiv war die Konsequenzen des handeln in seiner Tragweite zu überlegen und zu erfassen, dann ist man umso schockierter von die strafrechtlichen Folgen zu erfahren. Seite 60 von 60 Die acht Jahren Haftstrafe verbrachte ich bis 1973 in der Strafanstalt Stein und anschließend in der Strafanstalt Graz-Karlau, von wo ich Mai 1976 bedingt entlassen wurde. Acht Jahre voller Probleme, geprägt von Selbstbeschädigung und Auflehnung gegen inhumane Haftbedienungen, die meinen psychischen Verletzungen infolge der negativen Heimerlebnisse und diese am Straßenmilieu noch mehr anheizten. Von psychologischer oder therapeutischer Betreuung oder Behandlung war der Vollzug zu dieser Zeit noch meilenweit entfernt. Das ist - bis auf die wunderschöne Kindesjahren in Uruguay - meine in Österreich von Gewalterfahrung und Gewalteinwirkung fatal geprägter Lebensabschnitt bis zu meinen 19 ½ Lebensjahr. Zuletzt April 2020 aktualisiert. Vor Änderungen Passwortgeschützt. Die Fortsetzung ist in Bearbeitung und wird demnächst beigefügt Juan Carlos CHMELIR 8020 Graz/Österreich