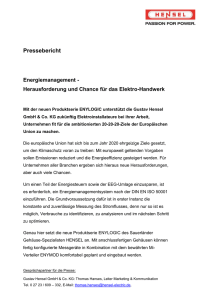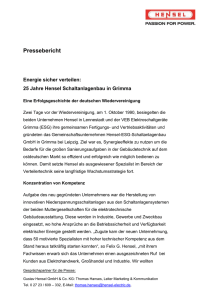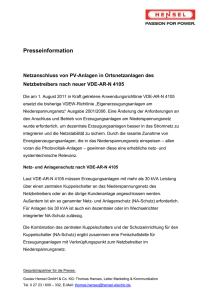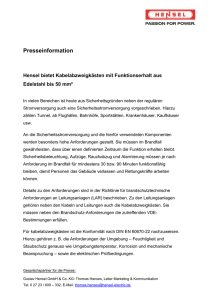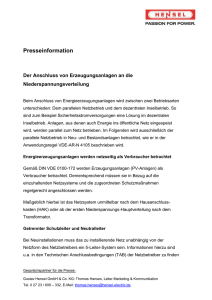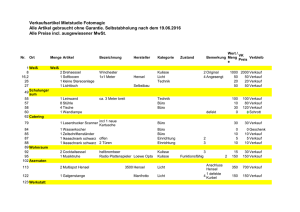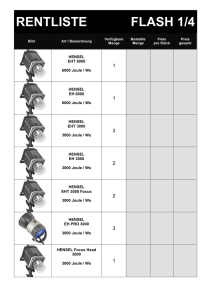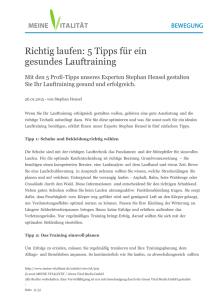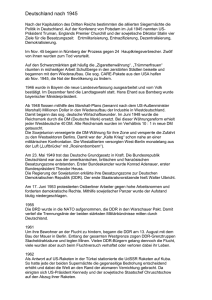Frank Schulze
Werbung

1 „Zwittrige Ostwestkinder“ und „Jammerlappen“ – Identität in Jana Hensels Zonenkinder und Thomas Rosenlöchers Ostgezeter FRANK SCHULZE (Universidad del País Vasco, UPV-EHU) Abstract: Die gebürtige Leipzigerin Jana Hensel hat in ihrem literarischen Debüt Zonenkinder (2002) den Ausdruck „zwittrige Ostwestkinder“ geprägt. Hensel versucht in ihrem Bestseller, das Lebensgefühl einer Generation auszudrücken, die etwa die eine Hälfte des Lebens in der DDR und die andere im vereinten Deutschland verbracht hat. Textanalytisch sollen Abgrenzungen zu anderen Generationen fokussiert werden. Kontrastiert wird der Blick Hensels mit der Perspektive des Dresdeners Thomas Rosenlöcher auf den Vereinigungsprozess. Anhand des Textes Ostgezeter sollen Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu Hensels Perspektive herausgearbeitet werden. Anhand der Texte beider Autoren wird in diesem Beitrag versucht, Fragen ost- und westdeutscher Identität zu erörtern, indem die Fremd- und Eigenbilder, insofern sie überhaupt als solche klar zu trennen sind, sichtbar gemacht werden. Schlüsselwörter: Identität, Wende, Generation, Ostdeutschland, Gegenwartsliteratur Jana Hensel hat 2002 als 26jährige mit dem Buch Zonenkinder ein viel beachtetes Debüt gefeiert. Aus der bis dato unbekannten Studentin wurde über Nacht eine populäre Autorin, die es – die Gesetze der Mediengesellschaft fest im Blick – sogar bis zu einem Auftritt in die Harald-Schmidt-Show schaffte. Selbst Angela Merkel fühlte sich berufen, das Buch des neuen Shootingstars aus Leipzig, Wohnsitz Prenzlauer Berg, zu kommentieren.1 Insbesondere die umstrittene „Wir“-Perspektive Hensels und die unübersehbare Parallelität zu Florian Illies Generation Golf hatten nach dem Erscheinen zu einer breiten Debatte nicht nur im Feuilleton geführt2. Unabhängig von der literarischen oder argumentativen Qualität des Buches kann man daher, die Rezeption betreffend, durchaus von einem „Phänomen“3 sprechen. Dieser Beitrag möchte sich dem Text jedoch weniger über die Rezeptionsseite4, sondern vielmehr über die Textanalyse nähern, um Konzepte der Identität, speziell der Generationenidentität zu beleuchten. Bezüglich dieser Aspekte soll der Text Hensels später mit Thomas Rosenlöchers Ostgezeter verglichen werden. 1. JANA HENSELS ZONENKINDER Hensel schreibt über ihre Generation der knapp dreißigjährigen Ostdeutschen, eine Generation, die jeweils die Hälfte ihrer Lebenszeit in der DDR, die andere Hälfte in einem neuen Staat, im vereinten Deutschland verbracht hat. 1989, im Wendejahr5, war sie gerade 13 Jahre alt, sodass sie die politischen Veränderungen noch nicht reflektieren konnte. Daher kann sie den Lesern vor allem deskriptiv Kindheitserinnerungen vermitteln, z.B. an die Zeit 2 bei den Jungen Pionieren oder an das Altpapiersammeln für den Weltfrieden. Letztlich bleibt es aber bei der reinen Beschreibung der Erinnerungen6. Reflexionen über das Leben in der DDR selbst gibt es weniger, was daran liegt, dass die DDR schon nicht mehr existierte, als sie die ersten wichtigen Entscheidungen in ihrem Leben treffen musste. Geboren in Leipzig, absolvierte sie dort ihr Studium und lebte ein Jahr als Austauschstudentin in Marseille. Im Gegensatz zu älteren Generationen von Ostdeutschen sind für sie Reisen durch die ganze Welt bereits zur Selbstverständlichkeit geworden. Und die Beziehungen zu Westdeutschen sind für sie – anders als für die Älteren – unkompliziert, betont sie doch mehrfach und stellenweise penetrant, dass das Verlieben in Westkommilitonen für sie längst „normal“ ist. Deutlich spürbar ist Jana Hensels Wunsch, in Anlehnung an Florian Illies Kultbuch über die Jugenderinnerungen der Parallelgeneration West ein Generationenbuch zu schreiben.7 Über weite Strecken verwendet sie die „Wir“-Form. Dieser Kollektivierungswunsch, der nicht wenigen Ostdeutschen wie eine gewagte Vereinnahmung erschienen ist, wird stellenweise überdeutlich. Doch so problematisch diese Erzählperspektive denjenigen Ostdeutschen, denen es um eine vielschichtigere Erinnerung geht, auch ist – als Erfolgskatalysator hat dieses „Wir“ bestens gedient8. Alexander Cammann hat diesen Schachzug Hensels in seiner treffenden Analyse „genial“ genannt und hat sehr genau beschrieben, warum dieses Buch zur „Integrationsliteratur“ wurde: Der Erfolg misst sich hier nicht mehr an der Stimmigkeit oder Authentizität der Erinnerung, sondern an der medialen Resonanz. […] Es geht um Integration in den Westen: östlich angehauchte Geschichtchen werden in die Formen und Farben des Westens übersetzt. Ihre Leistung besteht eben nicht in der Erinnerungsarbeit. (vgl. Cammann 2004: 67) Das Konstruieren einer Generationenidentität oder die Inszenierung eines bestimmten Lebensgefühls funktioniert einerseits über die Beschreibung gemeinsamer Erfahrungen und Erinnerungen und andererseits über die Abgrenzung zum jeweils Anderen. So werde ich im Folgenden von Eigen- und Fremdbildern schreiben, um die Identität der „Zonenkinder“ deutlicher skizzieren zu können. Zunächst sollen die Abgrenzungsstrategien zu den jeweils anderen Generationen schärfer in den Blick gerückt werden. Hensel grenzt sich insgesamt von drei verschiedenen Generationen ab: der Elterngeneration im Osten, der Generation der 3 gleichaltrigen Westdeutschen und der nur wenige Jahre älteren Ostdeutschen, ab jetzt kurz „Brüdergeneration“ genannt. 1.1. ABGRENZUNG VON DER BRÜDERGENERATION Die älteren Geschwister nennt sie „die letzte ‚echte’ DDR-Generation“ (Hensel 2004: 158)9, sie selbst, die Zonenkinder sind „die ersten Wessis aus Ostdeutschland“ (166) oder „zwittrige Ostwestkinder“ (74). Nur fünf bis zehn Jahre sind sie älter, aber die Brüdergeneration wird von Hensel mehrmals als Fremdbild angesprochen, um ein eigenes Generationenprofil zu entwerfen. Der wichtigste, bereits in der Einleitung angesprochene Unterschied, besteht darin, dass die Brüdergeneration (die etwa zwischen 1966 und 1971 Geborenen) noch in der DDR Schlüsselentscheidungen zu treffen hatte, sodass die Verbundenheit mit dem Staat – ob nun kritisch oder affirmativ – wesentlich enger war. Im Gegensatz zur jüngeren Generation sind die heutigen Erinnerungen an den Staat nicht nur „private“, sondern haben einen stärker „politisch-öffentlichen“ Charakter. Aus ihren Worten spricht vor allem die Erleichterung, dass sie nicht die Verantwortung ihrer Vorgänger tragen musste: „Manche traten in die Partei ein. Andere stellten Ausreiseanträge oder flohen über die Botschaften von Prag und Budapest. Um all das sind wir herumgekommen und haben an das Land unserer Kindheit nur, oder fast nur, private Erinnerungen. Pubertät und Volljährigkeit erlebten wir in jenem geografischen Raum, der danach kam.“ (159) Die Brüdergeneration wird als sesshafter charakterisiert, insgesamt sei sie eher traditionellen Werten wie „Familie, Beruf und Freundeskreis“ (157) verhaftet. Die Männer, so Hensel, trügen heute „helle Leinenanzüge und geflochtene Slipper und die Kleider der Frauen sehen immer ein bisschen nach ‚Frieden’ aus, und so erscheinen uns die großen Brüder und Schwestern mitunter bieder“ (157). Die Klamotten der jungen Generation fänden die älteren Geschwister originell und neidisch seien sie auf die Auslandsstudien und die vielen Reisen der Jüngeren. Politisch sind sie engagierter und interessierter als die Zonenkinder, Einstellungen, die Hensel verdächtig sind. Statt zum Beispiel 1991 gegen den Irak-Krieg zu demonstrieren, „[…] verdienten wir lieber Geld“ (98), konstatiert sie trocken. Politisches Engagement scheint für sie eher mit Verbissenheit als mit Verantwortung konnotiert zu sein, wie sich anhand der kurzen Anekdote über ihre etwa 10 Jahre ältere Freundin Silvia belegen lässt. Silvia kommt aus Halle und streitet gern mit ihren westdeutschen Freund Hartmut über Ideale des Kommunismus und Vorteile der sozialen Marktwirtschaft. Hensel langweilen solche Diskussionen, sie hält sie für überflüssig und 4 gefährlich, denn oft genug habe sie erlebt, dass sich die Beteiligten bei solchen Diskussionen „[…] um Kopf und Kragen“ redeten.“ (131) Ein Schlüsselwort, das die Zonenkinder von der Brüdergeneration scheidet, ist das Wort „Karriere“, das in wenigen Jahren gewissermaßen einen Bedeutungswandel durchlaufen hat. Während die Brüdergeneration aufgrund ihrer Erfahrungen in der DDR eine Art „Aufsteigermentalität“ bis heute eher mit Misstrauen betrachtet, scheinen die Zonenkinder in der Regel sehr pragmatisch zu sein und messen dem sozialen Aufstieg große Bedeutung bei. Die älteren Geschwister haben durch ihre Sozialisierung ein distanziertes Verhältnis zum politischen System entwickelt, ein „Karrierist“ musste staatsnah sein und stand damit für Unmoral. Die Jüngeren dagegen haben ein unbefangenes, sicher auch weniger kritisches Verhältnis zum Staat und damit auch zum „Karrieremachen“. Einen großen Unterschied zu den großen Brüdern und Schwestern stellt Hensel auch im Umgang mit Westdeutschen fest. Die Älteren blieben häufig unter sich blieben, pflegten Vorurteile gegen Westdeutsche und würden einen Wessi nur dann mögen, „[…] wenn er nicht so schlimm wie die anderen ist und seine Individualität zaghaft […] artikuliert“ (158). 1.2. ABGRENZUNG VON DER ELTERNGENERATION Die Distanz zur Generation der Eltern wird im Text am deutlichsten herausgearbeitet. Generell werden die Eltern als Generation der Verlierer charakterisiert, die mit der Wende große Hoffnungen verbanden, die aber hochgradig enttäuscht wurden. Sie sind geprägt von Frustration und Orientierungslosigkeit, angekommen im Nachwendealltag sind sie im Gegensatz zur Generation der Zonenkinder nie (74). Hensel begründet die Unterschiede auch mit Hilfe einer ökonomischen Argumentation: die Eltern kommen ihr wie „Hamster in Laufrädern“ (79) vor, unfähig zum Genuss, da sie – obwohl schon kurz vor der Pensionierung – wie Dreißigjährige gerade so viel Geld verdienen, um „[…] das Geld für ihre monatlichen Ausgaben zu verdienen. Sie sind um mehr als zwanzig Jahre zurückgeworfen.“ (79) Fremdheit, Mitleid, aber auch Scham sind die bestimmenden Gefühle, die das Verhältnis zu den Eltern charakterisiert. Signifikant ist der Unterschied zum engen Verhältnis der westdeutschen Freunde zu ihren Eltern. Sie erzählen ihnen nachts am Telefon von ihrem Liebeskummer, und schleppen die Eltern, wenn sie im Osten zu Besuch kommen, überall mithin (66). 5 So wie Hensel ihr Lebensgefühl beschreibt, könnte man es auf die einfache Formel bringen: die einen sind Kinder der Gewinner, die anderen Kinder der Verlierer der Geschichte, und dies färbt auf die Mentalität der Kinder ab. Während die einen stolz auf ihre Eltern sind, verstecken die Zonenkinder sie vor ihrem wirklichen Leben, da ihre Welten zu unterschiedlich sind, und „[…] nachts um vier riefen wir auch lieber andere Leute an“ (67). Die Eltern sind von ihrer Generation schon so weit weg, dass ein Besuch bei ihnen so sei, „[…] als holten wir sie aus einem Altersheim ab“ (79). Auch in puncto Stil distanziert sie sich deutlich von den Eltern, deren geschmackliche Entwicklung nach 1989 sie erschreckt. Anders als die westdeutschen Freunde diskutieren und streiten die Zonenkinder nicht mit ihren Eltern, sie verzichten auf Rebellion. Hensel geht der Vergleich mit ´68 im Westen durch den Kopf, und ihr fällt auf, dass sie oft die Generation die Eltern eher aus Mitleid in Schutz nimmt: […] sie lagen ja schon am Boden, inmitten einer Depression einer ganzen Generation, und wir [….] wollten die am Boden Liegenden nicht noch mit Füßen treten. Die Geschichte der Wende hatte die Illusionen und Selbstbilder unserer Eltern zerstört und weggefegt. Ihnen war nichts mehr zu entreißen, das sie noch in Besitz gehabt hätten. (75f.) So steht am Ende das triste Resümee, dass es „ […] gerade einmal für Verständnis, Rührung und eine ziemliche Portion Mitleid“ (77) ausgereicht habe. Und ähnlich wie bei der Abgrenzung zur Brüdergeneration spielt auch das andere, bessere Verhältnis zu Westdeutschen eine wesentliche Rolle, um die Distanz zur eigenen Generation zu markieren. Jana Hensel bringt dies – wie an einigen Textstellen zu beobachten – gewollt betont und arg plakativ auf den Punkt: „Sie schimpften über ihre westdeutschen Chefs, wir knutschten in den Hörsälen mit Friedrich aus Lübeck und Julia aus Ingolstadt. Da gab es keine Gemeinsamkeiten.“ (77) 1.3. DIE WESTDEUTSCHE PARALLELGENERATION Am deutlichsten werden die Unterschiede zur Parallelgeneration West immer dann, wenn die Rede auf die durch 1968 geprägten Eltern westdeutscher Freunde kommt. Das sehr enge, freundschaftliche Verhältnis zu den Eltern hatte Hensel immer etwas irritiert. Auch wundert sie sich darüber, dass ihre westdeutschen Kommilitonen mit den Eltern „konstruktiv über den 6 Inhalt ihres Studiums“ (74) diskutieren und kommentiert die zur Schau gestellte Tendenz zur Debatte äußerst ironisch: Sicherlich lösten sie abends am Esstisch erst alle zusammen Tratschke fragt: Wer war’s?, bevor es etwas zu essen gab, besprachen danach die Probleme der Dritten Welt, die jüngsten Haushaltsbeschlüsse im Bundestag und klärten demokratisch, wer am Wochenende zum Bauern aufs Land fuhr und den Nachschub an Rohmilchkäse besorgte. (75) Auch das Bewusstsein der Wessis, häufig Enkel von Nazis zu sein, unterscheidet sie von den Zonenkindern. Im Geschichtsunterricht ihrer Kindheit hatten sie gelernt, dass alle DDR-Bürger Antifaschisten seien: „Unsere Großeltern, unsere Eltern, die Nachbarn – alle waren Antifaschisten. […] Der Krieg hatte in unserem Land nicht stattgefunden. Die Welt um mich herum hatte im Jahre 1945 begonnen.“ Die Geschichtslosigkeit der eigenen Identität findet ein jähes Ende, als sie von ihrem westdeutschen Freund Moritz erfährt, dass sein Opa ein ranghoher Nazi war. Alle am Tisch Anwesenden erzählen darauf entsprechende Episoden aus der Familiengeschichte, und in diesem Moment bemerkt sie, dass sie und ihre Leipziger Freunde nie über die Vergangenheit der Familie sprachen und auch nicht wussten, […] was unsere Großeltern gemacht, ob sie kollaboriert oder Widerstand geleistet hatten; wir wurden als Gegenwartsgeneration in einen Vergangenheitsstaat hineingeboren, der uns Fragen und unschöne Geschichten abgenommen hatte. […] Meine Freunde wussten bereits, dass sie Enkel des Dritten Reiches waren. Ich war eine von ihnen. Doch erst jetzt wusste ich es auch. (112) Der sicherlich signifikanteste Unterschied ist aber, dass die westdeutsche Parallelgeneration keine vergleichbare Erfahrung von Brüchen in der eigenen Biografie machen musste. „Postmodern langweilig und letztlich ereignislos“ nennt sie die Kindheit der Kommilitonen, die nun anscheinend durch politischen Aktivismus an der Uni „[…] die Leere ihrer Kindheit zwischen Einschulung, Konfirmation und Führerschein“ (128) füllen. Andererseits sehnt sich die Erzählerin, die so viele Brüche und Neuerungen miterleben musste, nach dem „Stillstand“ im anderen Teil des Landes 1.4. DAS SELBSTBILD DER ZONENKINDER 7 Hensels Bild von den Zonenkindern zeigt in erster Linie eine sehr pragmatische, Karriere bewusste und geschichtslose Generation, die aufgrund der verlangten Anpassung an die neuen Verhältnisse und die Beschleunigung des Lebensrhythmus „immer nur nach vorn blicken konnte“. Das Verarbeiten der ständigen Umbrüche und neuen Situationen sei zwar Kraft raubend gewesen, aber letztlich sei ihre Generation gestärkt aus dem höchst anspruchsvollen Anpassungsprozess hervorgegangen. Wer die Brüchigkeit seiner Gegenwart so erfahren hat, der reagiert souveräner und flexibler auf mögliche neue Krisen und Hensel drückt dies am Ende des Buches in einem heroischen Ton aus, es finden sich sogar Anklänge an das Auferstehungsmotiv der DDR-Nationalhymne: Wir fühlten uns wie Könige. Auf den Trümmern begründeten wir unseren Staat. […] In unserem Leben schien uns alles möglich, denn wir waren die einzigen, die im Zusammenbruch die Nerven behielten, die verstanden und keine Angst vor dem Neuen hatten. (165) Hensels Wortschöpfung „zwittrige Ostwestkinder“ bringt ihre doppelte Identität auf den Punkt. „Zwittrig“ zu sein bedeutet in diesem Kontext eine Bereicherung: zwei kulturelle Zeichensysteme wie zwei Sprachen zu beherrschen. Nur, dass es keine bewusste Entscheidung war, sich interkulturelle Kompetenz zu erwerben, sondern dass diese Kompetenz aus Überlebensgründen erarbeitet werden musste. Viele Jahre haben die Zonenkinder damit verbracht, mit aller Macht die Spielregeln im Kapitalismus zu beherrschen. Sie bezeichnet ihre Generation als „Aufstiegskinder“, die ihren Ehrgeiz auch damit begründet, dass sie nicht länger die „Söhne und Töchter der Verlierer“ (73) bleiben wollten. Wenn man sich das Bild vom Eigenen, das Hensels Text transportiert, wie ein Mosaik vorstellt, dann steht in seinem Zentrum der Begriff der „Zone“. Dieser provokative Begriff spielt ironisch auf den abschätzig gebrauchten Terminus „Zone“ an, wie er während des Kalten Krieges vor allem in antikommunistischen Kreisen in Westdeutschland gebraucht wurde. Hensel wertet den Begriff um, und setzt ihn in ein neues, selbstbewusstes Licht. Als „Zone“ beschreibt sie den Raum, in dem sie erwachsen geworden ist: nicht DDR, nicht Bundesrepublik, ein Raum, in dem die DDR offiziell aufgehört hatte zu existieren, in dessen Innerem Ideen und Stimmungen der DDR aber weiterlebten: 8 Sie [die DDR] hatte sich nur verwandelt und war von einer Idee zu einem Raum geworden, einem kontaminierten Raum, in den freiwillig nur der einen Fuß setzte, der mit Verseuchungen Geld verdienen oder sie studieren wollte. Wir aber sind hier erwachsen geworden. Wir nennen diesen Raum, fast liebevoll, die Zone. Wir wissen, dass unsere Zone von einem Versuch übrig geblieben ist, den wir, ihre Kinder, fast nur aus Erzählungen kennen und der gescheitert sein soll. Es gibt hier heute nur noch sehr wenig, was so aussieht, wie es einst ausgesehen hat. Es gibt nichts, was so ist, wie es sein soll. Doch langsam fühlen wir uns darin wie zu Hause. (155) Ein weiterer Mosaikstein der Identität dieser Generation ist die Erfahrung des abrupten Endes der Kindheit und der mit deutlicher Verzögerung geäußerte Wunsch nach der Spurensuche dieser „verlorenen Kindheit“. Erst jetzt, im Moment des „Ankommens“ in der neuen Republik, nehmen sich die Zonenkinder Zeit, zurückzublicken auf Kindheit und den alten Staat, denn seit der Wende hat sie immer nur nach vorn geschaut und jetzt will sie wieder wissen, wo ihre Generation herkommt (14). Zeit zum langsamen Erwachsenwerden blieb den Zonenkindern kaum, als letzte „Tage unserer Kindheit“ (13) bezeichnet sie den Beginn der Montagsdemonstrationen. Diese Tage sind wie „Türen in eine andere Zeit, die den Geruch eines Märchens hat“ (13), das heißt, sie sind Ausgangspunkt ihres Erinnerungsversuchs, der damit zu kämpfen hat, dass das Bild der DDR vage bleibt. Das Erzählen der Kindheit ist der Rettungsversuch dieses Teils ihrer Geschichte, denn sie ist sich bewusst, dass die Erinnerungen mit jedem Jahr immer undeutlicher werden, denn von nun an wird „[…] die DDR für uns, als schauten wir in den Rückspiegel eines Autos, noch ferner, kleiner und immer märchenhafter werden“ (167). Nur noch verschwommen erinnert sie die Montagsdemonstrationen in Leipzig als dreizehnjähriges Mädchen, zu denen ihre Mutter sie mitnahm. Aus der Kindheit in der DDR erinnert sie vor allem die frühe Erziehung zu Ordnung, Disziplin, Verantwortung und Solidarität. Sie erzählt von Spendenaktionen für die Kinder in Vietnam, vom gemeinschaftlichen samstäglichen Streichen der Fensterbänke in der Schule. Und sie erzählt von der Betonung des Militärischen und der Kriegsgefahr: „In meiner Kindheit, so kommt es mir heute vor, herrschte Krieg. Überall auf der Erde. Alle kämpften. […] Nur die DDR blieb dank der sozialistischen Bruderstaaten, der sowjetischen Streitkräfte und der Freunde der NVA vorerst verschont.“ (87) Sie erinnert sich an einen extrem voll 9 gepackten Terminkalender in der Schule und den inflationären Gebrauch des Wortes „Verantwortung“: Wir waren immer bereit ein Amt zu übernehmen. [...] Für alles trugen wir Verantwortung. Wenn die Kinder in Afrika nichts zu essen hatten, nahm ich mein Spielzeug mit in die Schule und gab es in der Turnhalle an alte Frauen von der Volkssolidarität […] Mich aber interessierte eigentlich nur, wo die alten Frauen mein Spielzeug wohl hinbringen würden und wo man es wieder zurückkaufen könnte. […] Ich war auch verantwortlich für das Sternenkriegsprogramm von Ronald Reagan, zumindest dann, wenn ich mich nicht glaubhaft und zu jeder Zeit zum Sozialismus bekannte [...]. (84-87) DDR-Produkte und das Spiel mit Markennamen nehmen in Hensels Erinnerungen, ähnlich wie dies in der Popliteratur der Fall ist, eine zentrale Stellung ein. Schon früh entwickelten die Kinder in der DDR ein Gespür für Marken: Wir wurden in einem materialistischen Staat geboren, obwohl heute oft das Gegenteil behauptet wird. […] Ein Germina-Skateboard blieb für uns immer eine schlechte Kopie des berühmten Adidasbruders. […] und leere Pelikan-Tintenpatronen, deren kleine Verschlusskügelchen im Inneren so schön klapperten, hätten wir nie im Leben gegen einen LKW mit Heiko-Patronen eingetauscht. (51) Hensel generiert Hensel durch eine Aneinanderreihung von generationsspezifischen Schlüsselworten wie typischen Produkten, Medien-, und Trickfilmprotagonisten eine Art Erinnerungskatalog. Moritz Baßler hat in seinem Standardwerk zur Popliteratur darauf hingewiesen, dass die Rekonstruktion von kulturellen Paradigmen ein Grundprinzip der Popliteratur ist (vgl. Baßler 2002: 102). Dazu werden Serien ähnlicher Ausdrücke oder Schlüsselwörter, zusammengestellt. Durch dieses Archivierungsverfahren kann im Kopf des Lesers ein Wiedererkennungseffekt entstehen, der eine Erinnerung bei Angehörigen ihrer Altersgruppe auslösen kann. Hensels starker Hang zu einer Warenästhetik ist nicht zu übersehen. So wie die Literatur der westdeutschen Popliteraten versuchen Hensels Wort-Kataloge der Waren- und Medienwelt den Zeitgeist einer Generation zu widerzuspiegeln. Ob West-Marken wie Coca-Cola, Hanuta, 10 H&M, Benetton, Pimkie, Young-Fashion, Karstadt, Rudis Restrampe und Schlecker oder alte Ost-Produkte wie Germina-Skateboard, Lada, Heiko-Tintenpatronen und die Limonade Leninschweiß – das Buch ist gespickt mit Produktnamen, mit deren Konnotationen der Text spielt und ein Identifikationspotential nicht nur bei Gleichaltrigen abruft, die sich auch als „zwittrige Ostwestkinder“ sehen würden. Hensel beschreibt, wie sie sich das westliche Koordinatensystem des Stils und seiner diversen Konnotationen aneignet. Sie will Peinlichkeiten, wie sie sie bei ihren Eltern feststellt, vermeiden und ist heute, so scheint es, stolz auf ihren individuellen Stil, obwohl sie noch immer die Stilsicherheit ihrer westdeutschen Kommilitoninnen bewundert. Abschließend bleibt festzuhalten, dass bei Hensel die versöhnlichen Töne deutlich überwiegen. Sie sollen beweisen, wie gut den Zonenkindern der Anpassungsprozess an den Westen geglückt ist. Anders als Eltern- und Brüdergeneration sind sie im Westen angekommen. Hensel drückt dieses Ankommen am Ende pathetisch-sentimental aus. Sie hört im Auto immer häufiger eine Kassette ihres westdeutschen Freundes Jonathan: „Go west, Life is peaceful there“ von den Pet Shop Boys. Natürlich ist sie gerade auf dem Weg nach Kreuzberg, zu einem Freund ins alte Westberlin – mit offenem Fenster und Zigarette rauchend kostet sie für uns Leser überdeutlich und metaphorisch das neue Gefühl von unbegrenzter Freiheit und Individualität aus. 2. THOMAS ROSENLÖCHER UND DER AMBIVALENTE BLICK Der Dresdener Autor Thomas Rosenlöcher, Jahrgang 1947, könnte der Vater des „zwittrigen Ostwestkindes“ Jana Hensel sein. Er gehört zu jener Generation, die Hensel in ihrem Text als Fremdbild der Zonenkinder beschrieben hat. In Rosenlöchers Essayband Ostgezeter von 1997 lassen sich drei wesentliche Reflexionen ausmachen, die seine Identität definieren. Zunächst wäre seine Kritik am Jasagertum und Opportunismus zu nennen. Er nennt den Menschen „das nickende Wesen schlechthin“ (vgl. Rosenlöcher 1997: 105)10. Immer wieder kommt er auf das mechanistische „Nicken in Richtung Übermacht“ (130) zu sprechen. Klassifiziert werden verschiedene Formen menschlichen Nickens: Feigheitsnicken, Gewohnheitsnicken, Gleichgültigkeitsnicken, Einnicken und Abnicken. Er selbst läuft noch heute mit dem Komplex und Selbstvorwurf durch die Welt, zu DDR-Zeiten nicht klar genug „nein“ gesagt 11 zu haben. Dieser Schuldkomplex taucht immer wieder auf, auch im Zusammenhang mit seinem Parteieintritt (später trat er aus der SED wieder aus). Gerade deshalb will er im neuen Staat nicht den gleichen Fehler begehen, hält kritischen Abstand zum System und will sich nicht vereinnahmen lassen. Er beklagt die Unterwerfungsgesten gegenüber den jeweils Regierenden und fordert das „Neinsagen“ als Unterrichtsfach (111). Rosenlöcher präsentiert sich als Prototyp des Unangepassten in beiden Gesellschaften und reklamiert Glaubwürdigkeit, indem er Systemferne als entscheidenden Teil seiner Identität definiert. Im Gegensatz zu den Zonenkindern bedeutet das für ihn auch Skepsis gegenüber denjenigen, die sich von der Masse abheben wollen oder denjenigen, die Karriere machen wollten: Wenigstens meiner Generation fällt es immer noch schwer zu sagen: ‚Herr Lehrer, ich weiß was.’ Sich zurückzuhalten und vorsichtshalber fast gar nichts zu wissen, ist tief verinnerlicht. Selbstlob bis vor kurzem noch mental unmöglich gewesen. Denn wer früher ‚ich weiß was’ rief, hatte schnell eine geplättete FDJ-Bluse an und gehörte zu denen da anstatt zu uns. […] ’Du sollst nicht Karriere machen’, hieß das elfte Gebot“ (104).11 Als zweite wesentliche Reflexion, die als identitätsstiftend gelten kann, sei das Beklagen eines Utopieverlusts in der Gesellschaft angeführt. Utopisches Denken hält er für eine wichtige Dimension des Menschen, im Moment dominiere jedoch der pragmatische, reine „Gegenwartsmensch“, sodass Utopisten wie er allmählich „unter Naturschutz gestellt werden“ müssten (120). Der Verlust der Utopie hat mit dem Grad der Sattheit zu tun, wie Rosenlöcher in der Anekdote „Das Leuchtbild der Banane“ in dialektischer Argumentation zeigt. Die Banane beschreibt er als Leuchtbild, lange Zeit Symbol für die Überlegenheit des Westens, Symbol der Mangelwirtschaft der DDR, aber auch des Wunschsdenkens der Ostdeutschen. Doch je mehr Bananen man im Osten aß, je mehr man also von der Realität des Westens erfuhr, desto mehr verflog das Leuchtbild, die Utopie, für die die Banane stand: „Die Banane hat die Banane beseitigt. Der Mangel an Mangelwaren den Traum vom Überfluss.“ (32), konstatiert Rosenlöcher. Das Ankommen in der Realität, die Übersättigung an Materiellem scheint bei vielen Ostdeutschen die Hoffnung auf die freiheitlichen und emanzipatorischen Werte, die man mit der Wende verband, ausgelöscht zu haben. An die Opposition Mangel- vs. Überflussgesellschaft ließe sich ein weitere Komponente seiner Identität anschließen. Übersättigung steht utopischem Denken diametral gegenüber, sodass Rosenlöcher in einigen Passagen deutliche Konsumkritik an den Ostdeutschen übt. Diese Kritik findet sich aber deutlicher in dem Band Die verkauften 12 Pflastersteine aus dem Jahr 1990, in dem er das unreflektierte, oberflächliche Konsumverhalten seiner Mitbürger an vielen Stellen karikiert. Er scheint sich für die wie entfesselt konsumierenden Ostdeutschen zu schämen und beschreibt die „Fettflecke“ (Rosenlöcher 1990: 56) der platt gedrückten Nasen an den Scheiben der Autohäuser. Doch in seinem Band Ostgezeter geht es in erster Linie um Identität und Erinnerung, die dritte tragende Reflexion bei Rosenlöcher. Der ironische Untertitel „Beiträge zur Schimpfkultur“ zeigt, dass es um die problematische Debattenkultur über das Thema der Vereinigung geht. Im Titel gebenden Essay „Ostgezeter“ präzisiert er dieses Unwohlsein mit dieser medialen Debatte im vereinten Deutschland schelmisch, aber auch selbstironisch. Da er sich den Vorwurf macht, im Osten nicht wirklich „Nein“ gesagt zu haben, möchte er nun nicht schon wieder nur „Ja, aber“ sagen. Zum intellektuellen „Larmoyanz-Vorwurf“ der West- gegenüber den Ostdeutschen meint er: „Da hätte man mich also gleich einen Jammerlappen nennen können. […] Was hatte ich denn nun schon wieder falsch gemacht? Wollte ich mich erinnern, hieß es Nostalgie. Wollte ich kritisieren, heiß es Larmoyanz.“ (33) Hinter dem Wort Larmoyanz versteckt sich natürlich eines der bösen Klischees der Ost-WestDebatte, nämlich das vom „undankbaren Ossi“. Der Westen verlangt Dankbarkeit vom Osten, aber Rosenlöcher schwenkt den Blick wieder zurück in die DDR-Vergangenheit und erklärt auch historisch, warum erwartete Dankbarkeit ein Paradoxon ist, und warum er dahinter einen Maulkorb vermutet: Immerzu positiv, der großen Sache wegen: ‚Keine Fehlerdiskussion’ – die Funktionärsvariante des Larmoyanzvorwurfs. Und unentwegt dankbar, nicht wahr, vom ersten Schultag an. Für die Pausenmilch und die Brüderlichkeit der großen Sowjetunion. […] Ach, konnte man nicht endlich einmal ungestört undankbar sein? (34) In der für Rosenlöcher typischen ambivalenten Argumentationsweise dreht er den Larmoyanz-Vorwurf ironisch gegen seine westdeutsche Tante, die darüber jammert, „was ihr uns kostet“ (34). Rosenlöcher wundert sich: „Früher hatte sie niemals gejammert. Färbte der Osten nun doch auf den Westen ab?“ (34f.) Das Schimpfen und Jammern wird bei Rosenlöcher humoristisch zu einer der ersten Pflichten eines mündigen Bürgers stilisiert. Jammern sei im Osten geradezu Sinn gebend gewesen, habe eine kulturell-historische Bedeutung gehabt. Es half die Verhältnisse auszuhalten und man vergewisserte sich auf diese Weise auch der eigenen Identität. Das war 13 subtiler Widerstand gegen die Obrigkeit, im Band Die verkauften Pflastersteine auch immer wieder mit dem Wort „Renitenz“ tituliert. Aus Mangel an Zeit und Widerstandsgeist, vermutet der Autor in Ostgezeter, gebe es nur noch einige letzte „Schimpfinseln“, vielleicht „im Brandenburgischen“ (42). Enttäuscht konstatiert Rosenlöcher, dass die Schimpfkultur Ost im Westen nur als banales Meckern empfunden wird. Rosenlöcher schreibt wesentlich analytischer und reflexiver, er argumentiert kritischer als Hensel und zwar in beide Richtungen. Er thematisiert viel deutlicher das Schockhafte der Wende. Bezüglich des Erinnerungsdiskurses argumentiert er wie Hensel, wenn sie von der Erinnerungslücke – der verlorenen Kindheit – spricht, er ist nur in der Formulierung drastischer: „[…] der plötzliche Zeitenwechsel kam einer Gehirnwäsche gleich“ (19). Durch den plötzlichen und gründlichen Wandel habe man Leben gewonnen, aber auch „ein Stück Leben verloren“ (20). Die „Dominanz der Gegenwart löscht das Erinnern aus […]“. Deshalb fragt er sich, ob der „[…] DDR-Nostalgievorwurf nicht auch etwas Pharisäerhaftes“ (25) habe und wünscht sich ein Erinnern, das „[…] heute weder das Damals beschönigt noch mit dem Damals das Heute zu beschönigen sucht […].“ (26) Große Unterschiede zwischen beiden Texten finden sich hinsichtlich des Freiheitsbegriffes. Hensel betont am Ende die Vorzüge des neuen Systems, genießt das freie Bewegen zwischen Ost und West und findet Gefallen am neuen Lebensgefühl, das viel mit Spontaneität zu tun hat. Die Identifikation mit dem neuen Lebensraum scheint aber weniger analytisch-rational, sondern vielmehr über eine emotionale Ebene zu funktionieren. Rosenlöcher dagegen analysiert die neue Situation akribisch und ist skeptisch, ob er jetzt wirklich freiheitlicher denkt als vorher. Denn der Trend zur Vereinheitlichung ist auch heute wieder unverkennbar und betrifft auch das Denken: „Was aber ist mit der Freiheit, wenn kaum wer noch anders denkt?“ (40) Immer wieder wird im Text offensichtlich, dass Intellektuelle wie Rosenlöcher durch das autoritäre Regime DDR bestimmte Habita ausgebildet haben, die sie auch nach der Wende nicht einfach ablegen können. Der alte Komplex, nicht genügend Widerstand, nicht kritisch genug gewesen zu sein, führt dazu, dass man im neuen System erst recht versucht, nicht erneut in den Verdacht der Systemnähe zu geraten. Für Rosenlöcher ist es eine Frage der Ethik und der Würde, sich dem neuen System nicht anzubiedern, d.h. seine dezidiert politische Sicht auf die Dinge mündet in einem notwendigerweise distanzierten Verhältnis 14 zum politischen und medialen System. Identität wird bei ihm über kritische, analytische und systemferne Haltung gebildet, die ohne ein utopisches Denken eigentlich undenkbar ist. Im Gegensatz zu Rosenlöcher interessieren Hensel Utopien und Politik wenig, sie zeichnet sich durch den Willen zur Anpassung und Pragmatik aus. Statt auf intellektuelle Reflexion setzt Jana Hensel dagegen viel stärker auf Emotionen. Sie versucht dies durch die Beschreibung eines Lebensgefühls auszudrücken. Dieses Gefühl ist anschlussfähig an das westliche Koordinatensystem, in erster Linie ist es geprägt von einem freiheitlichen Gefühl der Grenzenlosigkeit des Handelns. Durch das Meistern schwieriger Umbruchsituationen entsteht ein neues Selbstbewusstsein, das ein Gefühl von Stärke und Zukunftsoptimismus vermittelt. Auch wird dadurch eine Aufbruchsstimmung erzeugt, was der realen Situation in den neuen Bundesländern nicht entspricht. Doch es ist eine Aufbruchstimmung und ein Selbstbewusstsein, das im Ost-West-Diskurs gerade im Westen von vielen seit langem ersehnt wurde, auch wenn es nach wie vor mehr Wunschdenken ist. Genau das ist auch der Grund dafür, warum der Text für Ostdeutsche, die im Osten geblieben sind, wenig authentisch und eher konstruiert wirkt. Interessant wäre in diesem Kontext, genauer zu beleuchten, warum die begeisterten Leserstimmen gerade diejenigen Ostdeutschen sind, die schon seit längerer Zeit in den alten Bundesländern leben, ja teilweise solche sind, die schon kurz nach der Wende in den Westen gingen.12 Es kann daher auch nicht wirklich überraschen, dass die schärfste Kritik an Hensel aus Ostdeutschland kam, während westdeutsche Medien das Buch überwiegend wohlwollend und interessiert aufnahmen. (vgl. Kraushaar 2004b: 95) BENUTZTE BIBLIOGRAFIE PRIMÄRLITERATUR Hensel, Jana, 2004 [Erstausgabe 2002]. Zonenkinder. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. Rosenlöcher, Thomas, 1997. Ostgezeter. Beiträge zur Schimpfkultur. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Rosenlöcher, Thomas, 1990. Die verkauften Pflastersteine. Frankfurt/M.: Suhrkamp. 15 SEKUNDÄRLITERATUR Arend, Ingo, 2004. „Der Setzkasten der Erinnerung“. In: Kraushaar 2004a. 36-41. Baßler, Moritz, 2002. Der deutsche Pop-Roman. Die neuen Archivisten. München: Beck. Baßler, Moritz, 2004. „Die ‚Zonenkinder’ und das ‚Wir’. Ein Nachwort“. In: Kraushaar 2004a. 111119. Cammann, Alexander, 2004: „Auf der Suche nach dem DDR-Gefühl“. In: Kraushaar 2004a. 61-73. [Kraushaar 2004a=] Kraushaar, Tom, Hg., 2004. Die Zonenkinder und wir. Die Geschichte eines Phänomens. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. Klein, Olaf Georg, 2001. Ihr könnt uns einfach nicht verstehen! Warum Ost- und Westdeutsche aneinander vorbeireden. Frankfurt/M.: Eichborn. Kraushaar, Tom, 2004b. „Die Normalität des Ausnahmezustands. Ein Gespräch mit Jana Hensel“. In: Kraushaar 2004. 94-110. Merkel, Angela, 2004. „Unser Selbstbewusstsein“. In: Kraushaar 2004a. 75-76. 1. Merkel kritisiert ihr Selbstbewusstsein zwar als „etwas überhöht“, zeigt sich ansonsten aber sehr angetan von Hensels Beobachtungen und Beschreibungen. Vgl. Merkel 2004: 76. 2. Für Anregungen zum Thema dieses Beitrags möchte ich Carl Wege (Universität Bremen) herzlich danken. 3. So der Untertitel von Tom Kraushaar, der verschiedene Rezensionen und Stimmen in einem Band versammelt hat. Vgl. Kraushaar 2004. 4. Vgl. auch den Beitrag von Sonja Hilzinger: Zonenkinder von Jana Hensel. Erinnerung an eine Kindheit in diesen Kongressakten. Ihr Beitrag ergänzt den vorliegenden, da sie sich stärker der Rezeptionsseite und der Schreibmotivation widmet. 5. Streng genommen ist der Terminus „Wende“ verharmlosend, der Begriff „Umbruch“ wäre präziser und eher angebracht. In diesem Beitrag wird jedoch aus Gründen der Geläufigkeit der Begriff „Wende“ verwendet. Vgl. zu dieser Problematik den aufschlussreichen Beitrag von Bernd Westermann in diesem Band. 6. Vgl. auch Arend 2004: 38. Ingo Arend kritisiert, dass Hensel sich „einen erstaunlichen Verzicht auf Analyse“ erlaube. 7. Auf die Ähnlichkeit mit Florian Illies Generation Golf haben nicht nur viele Rezensenten hingewiesen. Hensel selbst hat in einem Interview erklärt, dass sie sich an Illies orientiert und ihr Buch „in diese Lücke“ hineingeschrieben habe, da die Ostdeutschen bei Illies keine Rolle spielten. Vgl. Kraushaar 2004b: 94. 8. Baßler hält das „Wir“ für ein Erbe der Popliteratur. Vgl. Baßler 2004: 116. 9. Im Folgenden wird bei Zitaten aus dem Primärtext die Seitenangabe in Klammern gesetzt. 10. Im Folgenden wird bei Zitaten aus dem Primärtext die Seitenangabe in Klammern gesetzt. 16 10. Zur Thematik der Karriereorientierung und der Außerdarstellung Ost- und Westdeutscher vgl. Klein 2001. 12. Auch Hensel räumt im Interview ein, dass sie „am ehesten für die geschrieben habe, die den Osten irgendwann, sei es vor 89 oder danach, verlassen haben.“ Vgl. Kraushaar 2004b: 102.