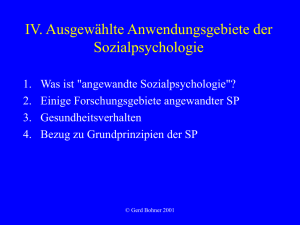Der Killer aus Marseille
Werbung
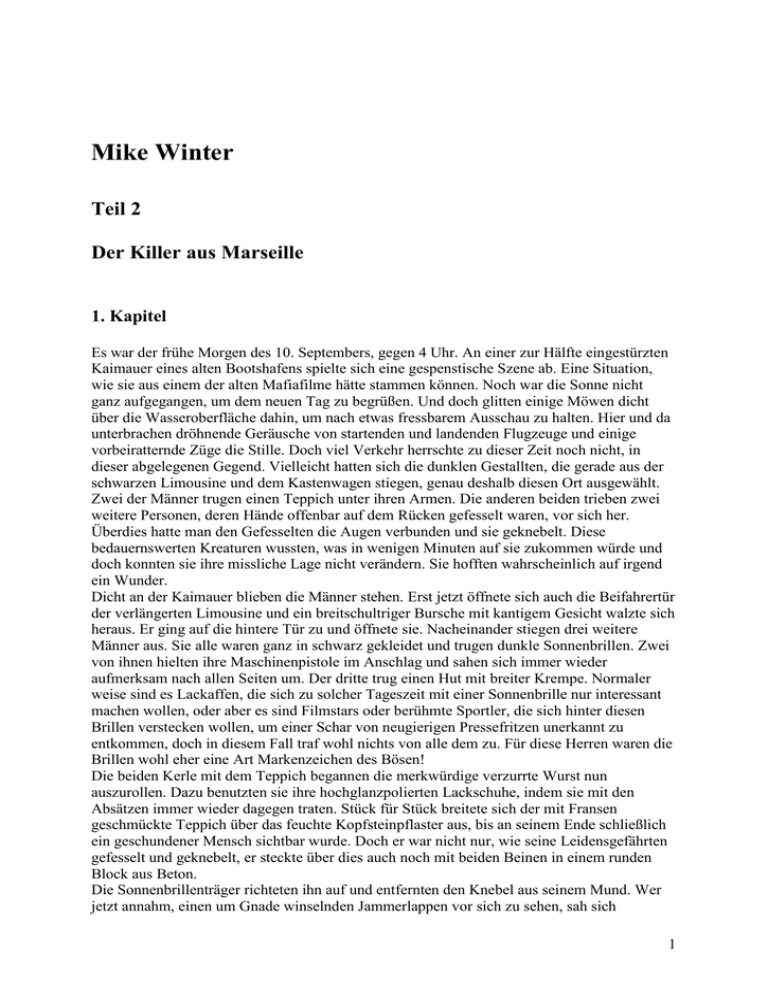
Mike Winter Teil 2 Der Killer aus Marseille 1. Kapitel Es war der frühe Morgen des 10. Septembers, gegen 4 Uhr. An einer zur Hälfte eingestürzten Kaimauer eines alten Bootshafens spielte sich eine gespenstische Szene ab. Eine Situation, wie sie aus einem der alten Mafiafilme hätte stammen können. Noch war die Sonne nicht ganz aufgegangen, um dem neuen Tag zu begrüßen. Und doch glitten einige Möwen dicht über die Wasseroberfläche dahin, um nach etwas fressbarem Ausschau zu halten. Hier und da unterbrachen dröhnende Geräusche von startenden und landenden Flugzeuge und einige vorbeiratternde Züge die Stille. Doch viel Verkehr herrschte zu dieser Zeit noch nicht, in dieser abgelegenen Gegend. Vielleicht hatten sich die dunklen Gestallten, die gerade aus der schwarzen Limousine und dem Kastenwagen stiegen, genau deshalb diesen Ort ausgewählt. Zwei der Männer trugen einen Teppich unter ihren Armen. Die anderen beiden trieben zwei weitere Personen, deren Hände offenbar auf dem Rücken gefesselt waren, vor sich her. Überdies hatte man den Gefesselten die Augen verbunden und sie geknebelt. Diese bedauernswerten Kreaturen wussten, was in wenigen Minuten auf sie zukommen würde und doch konnten sie ihre missliche Lage nicht verändern. Sie hofften wahrscheinlich auf irgend ein Wunder. Dicht an der Kaimauer blieben die Männer stehen. Erst jetzt öffnete sich auch die Beifahrertür der verlängerten Limousine und ein breitschultriger Bursche mit kantigem Gesicht walzte sich heraus. Er ging auf die hintere Tür zu und öffnete sie. Nacheinander stiegen drei weitere Männer aus. Sie alle waren ganz in schwarz gekleidet und trugen dunkle Sonnenbrillen. Zwei von ihnen hielten ihre Maschinenpistole im Anschlag und sahen sich immer wieder aufmerksam nach allen Seiten um. Der dritte trug einen Hut mit breiter Krempe. Normaler weise sind es Lackaffen, die sich zu solcher Tageszeit mit einer Sonnenbrille nur interessant machen wollen, oder aber es sind Filmstars oder berühmte Sportler, die sich hinter diesen Brillen verstecken wollen, um einer Schar von neugierigen Pressefritzen unerkannt zu entkommen, doch in diesem Fall traf wohl nichts von alle dem zu. Für diese Herren waren die Brillen wohl eher eine Art Markenzeichen des Bösen! Die beiden Kerle mit dem Teppich begannen die merkwürdige verzurrte Wurst nun auszurollen. Dazu benutzten sie ihre hochglanzpolierten Lackschuhe, indem sie mit den Absätzen immer wieder dagegen traten. Stück für Stück breitete sich der mit Fransen geschmückte Teppich über das feuchte Kopfsteinpflaster aus, bis an seinem Ende schließlich ein geschundener Mensch sichtbar wurde. Doch er war nicht nur, wie seine Leidensgefährten gefesselt und geknebelt, er steckte über dies auch noch mit beiden Beinen in einem runden Block aus Beton. Die Sonnenbrillenträger richteten ihn auf und entfernten den Knebel aus seinem Mund. Wer jetzt annahm, einen um Gnade winselnden Jammerlappen vor sich zu sehen, sah sich 1 getäuscht. Dieser Mann zeigte wahre Größe und den Stolz eines Sizilianers. Als der Mann mit dem Hut vor ihm stand, um ihm noch einige Worte auf seine letzte Reise mit auf den Weg zu geben, spuckte er ihm mitten ins Gesicht. Der mit dem Hut zog in aller Ruhe ein Taschentuch hervor und säuberte sich. Dann wies er seine Leibwächter an, ihr menschliches Opfer über den Rand der Kaimauer zu stürzen. Die Männer aus dem Kastenwagen hakten das Opfer unter, nahmen zwei, drei mal Schwung und warfen den zum Tode verurteilten, ohne das der sich auch nur ein einziges mal gewunden oder gegen sein Schicksal gewehrt hätte, einige Meter weit entfernt in die Weser. Und auch nun, da er in Sekundenschnelle versank, gab er nicht einen einzigen Schrei von sich. Von wilder Panik gepackt, das, was um sie herum geschah, nur erahnend, suchten die verbliebenen Opfer ihr Heil in orientierungsloser Flucht. Ihre Peiniger fanden selbst an diesem makaberen Spiel noch Gefallen und hetzten die Gefesselten wie Wild auf der Hatz in dem sie die Männer hin und her schupsten. Sie stürzten zu Boden, rappelten sich wieder auf und stürzten wieder zu Boden. Sie schlugen sich die Köpfe an den scharfen Kanten der Straßensteine blutig und einer von ihnen stolperte schließlich ebenfalls über die Kaimauer in die Tiefe des Hafenbeckens. Einige male wand er sich noch wie eine Schlange und versuchte sich, in dem er mit seinen Beinen wild strampelte, über Wasser zu halten. Aber all dies nutzte ihm nichts. Nachdem er es noch zwei mal zurück an die Oberfläche geschafft hatte, verließen ihn auch die letzten Kräfte und sein Todeskampf war verloren. Das letzte, noch verbliebene Opfer lag immer noch, geschunden und in sich gebrochen, mit seinen Beinen in einer Pfütze und wimmerte leise vor sich hin. Der Mann mit dem Hut ging nun auf ihn zu und sprach mit ihm. Dann wandte er sich ab und ging zurück zu seiner Limousine. Dabei sah er zu einem seiner Gorillas und besiegelte mit einer schlichten Handbewegung den Tod jener erbärmlichen Kreatur. Der Killer schraubte geradezu genussvoll einen Schalldämpfer auf seine Waffe, ging auf den todgeweihten zu und drückte zwei mal ab. Dieser brach zusammen und blieb leblos liegen. Ohne sich weiter um sein Opfer zu kümmern, stieg dann auch er in die schwarze Limousine. So unerwartet sie in ihren Autos gekommen waren, so verschwanden sie nun auch wieder. In der Art hatte uns der Zeuge die Situation die er an jenem Morgen beobachtet hatte geschildert. Da sich sein Hilferuf in der Leitzentrale der Schutzpolizei recht merkwürdig anhörte, hatten die Kollegen nur einen Streifenwagen zum Hafen geschickt. Schon zu oft hatte man sie vergeblich ausrücken lassen. Als die Kollegen schließlich eintrafen und den Zeugen tatsächlich neben dem Schwerverletzten antrafen, handelten sie unverzüglich. Während einer der Beamten Rettungswagen und die Mordkommission allarmierte, begann der zweite sofort die lebensrettenden Maßnahmen einzuleiten. Da die Mordkommission 2 in dieser Nacht zur Stallwache verurteilt war, wurde uns der Fall übertragen. „Glauben Sie mir, Herr Kommissar Winter, ich habe Blut und Wasser geschwitzt!“ „Ist Ihnen denn sonst nichts weiter aufgefallen? Haben Sie wirklich nichts, von dem was besprochen wurde hören können?“, wollte ich von dem Zeugen wissen. „Nein, dort oben hört man wirklich nichts!“ „Warum haben Sie zu dieser Stunde überhaupt in den Führerhaus des alten Krans gesessen?“, fragte ich ihn neugierig. „Meine Alte hatte mich gestern Abend mal wieder ausgesperrt! Sie wissen doch wie das ist.“ „Nein!“ Der Mann sah mich verständnislos an, etwa so, als käme ich von einem anderen Stern. „Na ja, ich hatte mit den Jungs einen über den Durst getrunken und kam ein bisschen später nach Hause. Da hat mich meine Ollsche eben nicht mehr rein gelassen.“ „Und da haben Sie ausgerechnet dort oben übernachtet?“ „Sie müssen wissen, dass ich damals, als hier noch alles in Betrieb war, dort oben als Kranführer gearbeitet habe. Damals, da war so wie so noch alles viel besser als heute!“ „Hm.“ Ich versuchte mir die Situation bildlich vorzustellen. „Und dann haben Sie von der Telefonzelle aus die Polizei angerufen?“ „Ich bin erst noch zu dem am Boden liegenden und habe geschaut, ob er nicht doch noch lebte. Er war zwar nicht bei Bewusstsein, aber er atmete 2 noch. Da bin ich dann so schnell ich konnte...“ Er hatte zwar immer noch eine beträchtliche Fahne, war aber durch die Vorkommnisse schlagartig nüchtern geworden. Eine gewisse Angst stand ihm in die braunen Augen geschrieben. Er war alles andere als ein Gewinnertyp, dem so etwas nichts anhaben konnte. Wohl eher das Gegenteil! Klein, untersetzt, nicht gerade sehr intelligent und ein wenig schmuddelig. Aber ein guter Staatsbürger, wie Kriminalrat Werner wieder sagen würde. Die Gangster hatten den Platz für die Hinrichtung gut ausgewählt. Wer weiß wie oft dieses alte Hafenbecken an der Ritzenbüttler Straße in der Vergangenheit schon diesem Zwecke gedient haben mochte. Und hätte es dieses mal keinen Zeugen gegeben, wären die Leichen soweit abgetrieben worden, dass niemand in der Lange gewesen wäre diesen Ort als Tatort zu ermitteln. Auf dem Platz vor dem Kran herrschte ein scheinbar wahrloses Durcheinander. Dort wo die schwarz gekleideten Herren, einige Stunden zuvor ihr halbtotes Opfer einfach zurückgelassen hatten, war nun die Spurensicherung damit beschäftigt, jeden, auch noch so kleinen Hinweis auf die Täter sicher zu stellen. Der Verletzte war längst in das nächste Krankenhaus nach Lemwerder abtransportiert worden. Vorsichtshalber hatte Gerd Kretzer vor die Tür zu seinem Krankenzimmer einen Polizeibeamten postieren lassen. Aron Baltus war bereits damit beschäftigt, die Identität festzustellen. Da der Mann keine Papiere bei sich trug, hofften wir über seine Fingerabdrücke weiter zu kommen. Wegen der Strömung hatte die Wasserschutzpolizei das alte Hafenbecken mit mehreren Netzen abgesperrt und tauchte nun nach den angeblichen Leichen. Neumann hatte uns die Stellen vorher deutlich gezeigt. „Möchten Sie einen Kaffee, Herr Neumann?“ „Ein Klarer wäre mir jetzt lieber!“ „Damit kann ich leider nicht dienen. Warten Sie bitte hier im Auto, bis ich wieder komme.“ Ich stieg aus, um das Geschehen aus derselben Perspektive, wie unser Zeuge, einige Stunden zuvor, zu beobachten. Es interessierte mich, ob er dort oben wirklich nichts hatte hören können. Die 10 Meter über die Eisenleiter machten mir nichts aus. Einsätze in dieser Höhe gehörten zwar nicht zu meinem täglichen Brot, waren aber dennoch keine Seltenheit. Die Bodenklappe aus Metall kreischte, als ich sie nach oben aufstieß. Ich zwängte mich hindurch und schloss sie wieder. Der Kran schwankte leicht, bot aber mit seinen Fenstern, die bis auf den Fußboden hinunterreichten, eine prima Rundumsicht. Neumann konnte von Glück reden, dass ihn die Gangster nicht entdeckt hatten. Ich setzte mich auf den zerschlissenen Ledersitz und beobachtete das Treiben meiner Kollegen tief unter mir. Auf dem Wasser wurde es jetzt geschäftiger. Neumann hatte nicht gesponnen. Der Mann mit den Fußgewichten wurde gerade mit der Seilwinde des Polizeibootes aus dem Wasser gezogen. Obwohl sich die Männer die Kommandos zuriefen, verstand ich hier oben nur einige Wortfetzen. Es war doch höher, als es von unten den Anschein hatte. Ein lauschiges Plätzchen war dies nicht gerade. Wie man hier oben freiwillig eine ganze Nacht ausharren konnte, wollte mir nicht in den Schädel. Es schepperte. Ich war an einige leere Flachmänner gestoßen und hatte sie dabei umgeworfen. Also so hielt man es aus! Nur mühsam gelang es den Kollegen der Wasserschutzpolizei die Leiche an Bord zu hieven. Das schwere Gewicht an den Füssen schien den Leichnam förmlich auseinander zu reißen. Nur einen Tauchgang später holten sie auch die zweite Leiche an die Wasseroberfläche. Sie konnte in das Schlauchboot gezogen und gleich ans Ufer gebracht werden. Einige helfende Hände zogen sie die Kaimauer hinauf und legten sie sofort in den vorgesehenen Blechsarg. Ich stieg von meinem Ausguck herunter und ging zu Gerd Kretzer hinüber. Er stand an der offenen Blechmulde und sah zu, wie ein Mitarbeiter der Spurensicherung vorsichtig die Taschen des Toten nach Papieren oder dergleichen durchsuchte. „Kennst du den?“, fragte er als er mich bemerkte. „Ich glaube nicht.“ „Leider, Herr Hauptkommissar, da ist nichts außer diesem Streichholzbriefchen.“ Er reichte es Kretzer und machte Platz für den 3 Polizeifotographen. „Sind Sie so gut, und machen mir bitte von den Toten auch ein Polaroid.“ Dann trat auch ich bei Seite. „Restaurant Romano“, las Gerd vor. „Das ist doch der Gourmettempel am Wardamm!“ „Ach dieser Edelschuppen für die oberen Zehntausend.“ „Genau! Unser Freund schien zu Lebzeiten einen auserlesenen Geschmack gehabt zu haben. Wird Zeit, dass wir uns den Laden mal etwas genauer ansehen.“ „Wenn es über das Spesenkonto geht, bin ich dabei, Gerd!“ „Kann ich dann nach Hause gehen?“, fragte eine längst vergessene Stimme hinter mir. Ich drehte mich um und fragte, obwohl es eigentlich klar war, ob es sich bei dem Toten um einen der beiden Ermordeten handelte. Er nickte stumm. „Also gut, Herr Neumann, das wäre es dann für den Augenblick. Falls sich noch weitere Fragen ergeben sollten, können wir Sie in der Georg Gleisstein Straße 26 erreichen?“ „Jau, oder in meiner Stammkneipe, dem alten Seebär!“ „Vergessen Sie nicht, in den nächsten Tagen im Präsidium vorbeizukommen! Wir brauchen noch Ihre Unterschrift für das Protokoll. Falls Ihnen noch etwas einfallen sollte,“ ich reichte ihm meine Visitenkarte, „dann können Sie mich zu jeder Tages und Nachtzeit unter einer der angegebenen Nummern erreichen.“ „Schön.“ „Dann werde ich Sie jetzt nach Hause fahren lassen!“ „Um Gottes Willen, nur das nicht, meine Ollsche kriegt sich nicht wieder ein!“ „Also gut, dann aber wenigstens bis in die Nähe Ihrer Wohnung. Und bitte, kein Wort zur Presse! Ich will Ihnen nicht verheimlichen, dass sie sich sonst selber gefährden würden. Noch weiß niemand, dass Sie Zeuge waren. Sie sollten es dabei belassen!“ „Geht klar, Chef!“ Er nahm meine Karte entgegen, steckte sie sich lose in die Tasche und watschelte von dannen. Inzwischen hatte der Fotograph die gewünschten Sofortbilder fertig und reichte sie mir herüber. Wie immer, wenn es um die Bilder von Ertrunkenen handelte, waren sie nichts für sensible Augen. Aber darum ging es ja letztendlich auch gar nicht. Kurz nachdem Aron mit dem Zeugen das Hafengelände verlassen hatte, rückten auch schon die ersten Pressefotographen an. Gott weiß woher diese Geier schon wieder wussten, dass es hier etwas für sie zu holen gab. „Solange das Opfer nicht vernehmungsfähig ist, sollten wir uns das Restaurant Romano ansehen,“ schlug Gerd vor. „Hier können wir im Moment eh nichts mehr tun. Stockmeier wird schon dafür sorgen, dass uns keine Spuren verloren gehen.“ Stocki, wie wir ihn auch nannten, war der Leiter der Spurensicherung. Er war ein stattlicher Mittfünfziger, braungebrannt und mit schneeweißem Haar. Ein ebenso weißer, akkurat in Form gehaltener Schnurrbart verlieh ihm endgültig die Ausstrahlung eines Schlossherrn in Old England. Seinem geschulten Auge und der langjährigen Erfahrung konnten wir blind vertrauen. „Ich schätze, du hast recht, Gerd. Möglicherweise ist der Mann ja dort bekannt.“ „Ich hoffe nur, dass sich die Sache am Ende nicht noch zu einem Bandenkrieg entwickelt. Die Tatumstände deuten eigentlich sehr stark in diese Richtung.“ Das Romano befand sich fast in Stadtmitte auf dem Wardamm. Ich parkte den Wagen direkt gegenüber des Restaurants. Gerade als wir aussteigen wollten, schoss ein dunkelblauer Camaro mit quietschenden Reifen vom Parkplatz. In dem Fahrzeug saßen vier dunkle Gestalten, die zu allem entschlossen schienen. Ich zögerte einen Moment. Aussteigen oder hinterher? Doch noch ehe ich mich für das eine oder andere entschieden hatte, knallte Gerd seine Tür wieder zu. „Los Mike, hinterher! Wollen wir doch mal sehen, wohin die Herren so eilig unterwegs sind!“ Ich ließ den Wagen wieder an und gab Gas. Wenigstens standen wir in Fahrtrichtung. Der Camaro hatte bereits einen beträchtlichen Vorsprung. Ich hatte zu tun, um an ihm dran zu bleiben. Die Fahrt ging Stadteinwärts über die Friedrich Ebert Straße und schließlich mitten durch die City. Ausgerechnet in dem Moment, in dem ich ihn sicher in meiner Reichweite glaubte, setzte ein riesiger Lieferwagen eines Drogeriediscounters rückwärts auf die Straße und rammte dabei ein an der Straßenseite parkendes Auto so unglücklich, dass uns ein Umfahren der Unfallstelle nicht möglich war. Wutentbrannt hämmerte ich auf der Hupe herum. Zwecklos! Ich sprang aus dem Wagen, rannte zum LKW hinüber, riss die Fahrertür auf und hielt dem 4 Kerl meinen Dienstausweis unter die Nase. „Polizei!“, brüllte ich. „Sieh zu, dass du deine Karre aus dem Weg fährst!“ „Tut mir Leid,“ stammelte der Fahrer und nahm seine Schirmmütze ab. Langes, blondes Haar fiel ihm über die Schultern. Der Kerl war eine Frau, und was für eine! „Ist ja schon gut,“ beruhigte ich sie. „Aber fahren Sie jetzt bitte den Laster aus dem Weg.“ Inzwischen hatte sich der Verkehr in beide Fahrtrichtungen gestaut. Somit konnte ich den Wagen auch nicht mehr wenden. Als ich wieder einstieg, war Gerd gerade mit einer Halterfeststellung beschäftigt. „Der Wagen gehört einem gewissen Salvatore Baresi, wohnhaft Wardamm 38.“ „Also dem Besitzer des Romano,“ schlussfolgerte ich. „Kann sein, muss aber nicht!“ Endlich hatte der LKW soweit zurückgesetzt, dass wir uns mit dem Dienstwagen durch die entstandene Lücke hindurchdrängeln konnten. Wie nicht anders zu erwarten, war von dem Camaro nichts mehr zu sehen. „Das war`s dann wohl,“ stellte ich verärgert fest. „Wohin nun?“ Gerd zuckte mit den Schultern. „Am besten zurück zum Romano.“ Gerade als ich in die Hochstraße einbiegen wollte, kam über Funk die Nachricht über eine Schießerei auf der Bürgermeister Spitta Allee. Uns war sofort klar, dass die vier finsteren Gestallten aus dem Camaro ihre Finger im Spiel haben mussten. Ein kurzer, gegenseitiger Blick genügte, um unser weiteres Vorgehen mit einander abzustimmen. Gerd öffnete sein Fenster und klatschte das Blaulicht mit dem Sauggummi auf das Wagendach und ich aktivierte das Martinshorn. Mit einem Affenzahn jagten wir durch den Ortsteil Schwachhausen, dem Tatort entgegen. An der panischen Flucht einiger Passanten konnten wir sehen, dass die Schießerei ganz in der Nähe stattfinden musste. Von unserem Camaro war allerdings weit und breit nichts zu sehen. Dafür entdeckten wir ein völlig demoliertes Auto vor der Doppelgarage einer Villa. Wir waren die ersten! Vorsichtig, unsere Waffen im Anschlag und den Wagen als Deckung nutzend, verließen wir das Fahrzeug in gebückter Haltung. Nicht nur die Heckscheibe des Autos war total zerschossen, sondern auch einige der Fensterscheiben in der Villa. So etwas kannte ich bisher nur aus Kriminalfilmen. Hier hatte wahrlich eine Schlacht getobt! Drinnen schien alles ruhig zu sein. „Was machen wir? Wollen wir rein gehen?“, fragte ich meinen Chef. „Damit sie uns für die Angreifer halten und auf uns schießen? Nein, wir warten auf Verstärkung!“ Es dauerte einige, schier unendlich lange Minuten, ehe der erste Streifenwagen eintraf. Die Kollegen der Schutzpolizei hielten mit ihrem Wagen direkt neben unserem. Hauptkommissar Kretzer instruierte die kurz die Kollegen und machte ihnen verständlich, wie wir weiter vorgehen wollten. Dann erst verließen wir die Deckung unseres Dienstwagens und rannten über den Garagenhof zum Haus hinüber. Dabei jede Art von natürlicher Deckung ausnutzend. Bereit, uns immer wieder gegenseitig Feuerschutz zu geben, arbeiteten wir uns durch die große Empfangshalle in die zur Straße hin liegenden Räume der Villa vor. Es bot sich uns ein Bild des Grauens. Auf dem Boden, direkt vor dem Fenster lag eine Person, die stark aus dem Bauchraum blutete. In der dem Fenster gegenüberstehenden Sitzgruppe keuchte ein weiterer Verletzter. Aus einem Nebenraum waren aufgeregte Stimmen und eine Art lautes Fluchen in einer fremden Sprache zu vernehmen. Unweit des am Boden liegenden Verletzten entdeckte ich jetzt eine Waffe. Wahrscheinlich sein Revolver! Ich hob ihn mit meinem Kugelschreiber auf und roch daran. Er musste ihm beim Sturz auf den Boden aus dem Halfter gefallen sein. Denn zum Zurückfeuern war er nicht mehr gekommen. Gerd war bereits im Nebenraum verschwunden. Ich wies die nachrückenden Polizisten an, mindestens zwei Rettungswagen anzufordern und sich dann von der anderen Seite aus durch das Haus vorzuarbeiten. Dann kümmerte ich mich um den Verletzten in der Sitzecke. Er blutete aus dem Mund. Eine Kugel hatte die Polster durchschlagen und war durch seinen Rücken wahrscheinlich in die Lunge eingedrungen. Es war sehr unwahrscheinlich, dass der Mann überleben würde. „Bleiben Sie ruhig, Hilfe ist unterwegs!“; versuchte ich ihn zu beruhigen. Seine Augen zeigten kaum noch eine Reaktion. Die Pupillen blickten starr vor sich hin. Ich war mir nicht sicher, ob er mich überhaupt noch wahr genommen hatte. 5 Dann hörte ich Gerds Stimme aus dem Nebenraum herüberschallen. Ich ging ihr nach. Er beugte sich gerade über einen dicklichen Mann, der mit dem Rücken an eine Wand gelehnt, auf dem Fußboden saß. Er schilderte dem Hauptkommissar in gebrochenem deutsch offenbar gerade, was vorgefallen war. Überall lagen tausende von Glassplittern verstreut, Die Angreifer mussten mit einem Maschinengewehr oder dergleichen gefeuert haben. Gerd hatte offensichtlich recht mit seiner Befürchtung, es könnte sich um einen Bandenkrieg handeln. Und das ausgerechnet in unserem bisher so ruhigen Städtchen. Nach und nach trafen nun weitere Streifenwagen und auch die angeforderten Krankenwagen ein. Sie übernahmen die Verletzten und suchten unter den vielen Gaffern nach Tatzeugen. Die beiden Polizisten, die mit uns die ersten am Ort des Geschehens waren, hatten die Villa inzwischen durchsucht und keine weiteren Personen gefunden. Auf dem Gesicht des Hauptkommissars machte sich Fassungslosigkeit breit. Und wer den armen Teufel auf dem Fußboden vor dem Fenster in seinem eigenen Blut schwimmen sah, ahnte, dass er erleichtert war, dass es nicht noch mehr Opfer gegeben hatte. Nach Sichtung ihrer Ausweise, stellten wir fest, dass es sich bei den Opfern durchweg um französische Staatsbürger handelte. „Geh bitte nach draußen und veranlasse, dass alles großräumig abgesperrt wird. Vielleicht kann Stocki ja noch das eine oder andere sicherstellen.“ Nachdem ich von unserem Dienstwagen aus die Spurensicherung vom ersten Tatort, am Hafen, auf die Bürgermeister Spitta Allee angefordert hatte, rief mich Aron vom Präsidium aus an. Er teilte mir mit, dass der Verletzte aus dem Hafen jetzt vernehmungsfähig sei. Aron selber wollte ins Krankenhaus fahren, um den Mann eine erste Befragung zu unterziehen. Da wir vor Ort noch einige Zeit zu tun hatten, war ich froh, dass er sich der Sache annahm. Während Gerd sich in der Villa um die Sicherung der Spuren bemühte, kümmerte ich mich um die von den Kollegen der Schutzpolizei bereits erfassten Zeugen. Es waren drei. Zwei Jugendliche und eine Radfahrerin. Leider hatten die meisten Passanten aus Angst das Weite gesucht und waren nicht zurückgekehrt. Gott lob war die Neugier dieser drei größer als ihre Angst. Sie waren bereit, das Gesehene zu Protokoll zu geben. Ich bat sie mit mir in den Kleinbus der Verkehrspolizei einzusteigen. Die Jungen waren etwa 15 Jahre alt und trugen beide einer dieser ebenso modernen Baseballcapes. Sie waren hoch aufgeschossen und schlank. Ich hatte den Eindruck, dass die Klamotten, in denen sie steckten, mindestens drei Nummern zu groß waren. Aber auch die waren zur Zeit in. So, wie es zu meiner Jugendzeit einmal cool war seine Haare lang zu tragen, waren ihre Haare kurz geschoren. Eigentlich zwei fetzige Burschen. Sie erzählten mir von einem Amischlitten, der mit quietschenden Reifen vor der Villa gehalten hatte. Die Türfenster auf der Beifahrerseite waren heruntergelassen. Mehrere Waffen ragten daraus hervor und waren auf das Haus gerichtet. Es hatte einen Höllenlärm gegeben. „In dem Auto saßen vier Männer,“ ergänzte die Radfahrerin. „Stimmt!“, pflichteten ihr die Jungs bei. „Welche Farbe hatte das Auto?“, fragte ich, um sicher zu gehen, dass es sich wirklich um das gleiche Fahrzeug handelte, was wir vom Restaurant Romano aus bis in die Innenstadt verfolgt hatten. „Blau, ein ziemlich dunkles blau,“ druckste sie herum. Und ein ziemlich unsicheres „würde ich sagen,“ folgte. Die Frau schien sich bei ihrer Antwort nicht ganz sicher gewesen zu sein. Es wunderte mich so wie so, dass sie mit den dicken Gläsern in ihrer Brille überhaupt noch so gut sehen konnte. Sie war eine kleine, aber kräftige Person, die sicher schon einige schwere Jobs hinter sich hatte. Das Schicksal hatte es sicher nicht immer nur gut mit ihr gemeint. Tiefe Falten durchfurchten ihre Stirn. Das schon angegraute Haar trug sie einfach so, ohne das eine Frisur zu erkennen war, mit einem Zopfband nach hinten. In ihren Augen spiegelte sich immer noch die Angst des Erlebten wieder. „Es könnte aber auch schwarz gewesen sein. Ich bin mir da nicht so sicher.“ Sie schaute verlegen zu Boden. „Ich muss Ihnen leider sagen, dass ich farbenblind bin.“ „Nein, nein,“ sagten die Jungs übereinstimmend. „Die Karre war dunkelblau!“ Ich wagte fast 6 nicht danach zu fragen, aber warum eigentlich sollten wir nicht auch mal Glück haben? „Hat jemand von Ihnen das Kennzeichen sehen können?“ Meine Zeugen sahen sich gegenseitig an und schüttelten nacheinander verneinend mit den Köpfen. Es wäre ja auch zu schön gewesen. Ich klappte meinen Notizblock zu und lächelte sie an.“ Macht nichts, das Kennzeichen kriegen noch raus!“ „Ist Ihnen sonst noch etwas besonderes aufgefallen?“ „Vor uns ging ein Mädchen,“ fiel einem der Jungen ein. „Als die Ballerei anfing lief sie weg. Ich glaube sie konnte das Kennzeichen besser sehen. Sie stand günstiger als wir.“ „Könnt ihr das Mädchen beschreiben?“, erkundigte ich mich. „Sie meinen bei so einem Phantomzeichner?“ Ich nickte zustimmend. „Klar man! Sie hat sich ein paar mal nach uns umgedreht.“ „Wie sieht es mit Ihnen aus, Junge Frau?“ „Das Mädchen nicht, aber zwei von den Kerlen habe ich ganz gut gesehen!“ „Wir auch!“, eiferten die beiden ihr nach. Ich zückte den Stapel Visitenkarten, den ich extra für solche Fälle immer bei mir hatte und gab jedem eine. „Kommen Sie bitte morgen Nachmittag ins Präsidium. Ist Ihnen 15 Uhr recht?“ „Es muss ja wohl sein,“ fügte sich die Radfahrerin. „Bei mir ist das kein Problem!“ „Ich habe auch nichts besseres vor!“, erklärten die Jungs „Fein, dann sehen wir uns also um 15 Uhr! Die Zimmernummer steht auf der Karte und bringt bitte jeder mindestens einen eurer Eltern mit.“ Auch an der Absperrung wurde es jetzt lauter. Pressefotographen versuchten ihren Standort zu verbessern, um ein brauchbares Foto für ihre Zeitung zu schießen. Schaulustige drängten nach vorn. Ich hasste diese Art der Sensationsgier! Es behinderte unsere Arbeit nicht nur, diese Gaffer zerstörten nicht selten sogar wichtige Tatortspuren. Als nächstes kümmerte ich mich um die Leute aus der Nachbarschaft. Zur rechten wohnte eine Familie Mainhof. Ihr Name stand auf einem goldenen Schild, das über dem Lautsprecher einer Sprechanlage angeschraubt war. Beides befand sich an einem mit Feldsteinen gemauerten Portal. Ich hatte das Gefühl, dass man meinen Besuch bereits hinter den Gardinen erwartet hatte. Sofort nachdem ich den Klingelknopf betätigte, ertönte der Summer, der mich die Metallpforte öffnen ließ. Der Weg zum Haus führte durch einen geschmackvoll angelegten Garten, vorbei an einigen Ziergehölzen und einem kleinen Springbrunnen. „Kommen Sie herein!“, schlug mir die Stimme eines älteren Herrn entgegen, der bereits in seiner Haustür stehend auf mich wartete. „Bitte, zeigen Sie mir doch, der Ordnung halber, Ihren Dienstausweis, junger Mann.“ Während seiner Worte war ich unmittelbar an der Haustür angelangt und fingerte in der rechten Innentasche meines Jacketts nach dem Ausweis. „Guten Tag, mein Name ist Winter. Kommissar Winter, Mordkommission 2!“ „Noch so jung und schon Kommissar?“, fragte er ungläubig. Dann nahm er mir den Ausweis aus der Hand und sah ihn sich akribisch genau an. „Kommen Sie herein, Herr Kommissar.“ Er ging voraus und ich folgte ihm bis wir an einem Fenster im Souterrain stoppten. „Von hier aus habe ich alles genau beobachten können!“ Ich zeigte mich beeindruckt. „Sie sind doch wegen meiner Zeugenaussage gekommen, - oder?“, fragte er plötzlich verunsichert. Der alte Herr machte einen eher introvertierten Eindruck auf mich. Trotzdem war er bemüht seiner staatsbürgerlichen Pflicht genüge zu tun. „Ja, natürlich! Dann erzählen Sie mal was Sie gesehen haben.“ „Also, ich hatte gerade nach unserer Morle gesucht, das ist die Katze meiner Frau, na jedenfalls habe ich draußen quietschende Autoreifen gehört. Ich dachte zunächst an einen Unfall, aber dann fielen ja die Schüsse. Ich erkannte vier Männer in einem Camaro.“ Nun war ich wirklich beeindruckt. „Sie sind sich sicher, dass das Auto ein Camaro war?“, unterbrach ich ihn. „Meine Clara und ich waren schon ein paar mal in den Staaten, da interessiert man sich für solche Autos. Er war dunkelblau! Ich weiß nicht, wie viele Schüsse fielen, aber es waren eine Unmenge! Der Spuk dauerte nur wenige Minuten. Von dem Kennzeichen des Wagens konnte ich leider nichts erkennen. Haben Sie die Männer sehen können?“, fragte ich ihn hoffnungsfroh. „Für so ein Bild, was Sie bei solchen Fällen anfertigen, wird es wohl nicht reichen. Meine Augen sind leider nicht mehr die besten, aber 7 ich würde es natürlich gern versuchen.“ Ich reichte auch ihm eine meiner Karten und bat ihn für den Nachmittag des kommenden Tages ins Polizeipräsidiums. Der Nachbar zur linken hieß von Stempel. Schon an der Zaunpforte merkte ich, das die Besitzer dieses Anwesens einen erhöhten Wert auf ihre Sicherheit legten. Da war das Schild mit der Warnung vor dem bissigen Hund noch das harmloseste. Überall in dem scheinbar mit einem Lineal angelegten Garten standen Pfähle auf denen sich Kameras in alle Richtungen drehten. Leider standen zwischen diesem und dem Grundstück Gorgons eine Reihe hoher Tannen, die den optischen Suchern wahrscheinlich die Sicht auf den Überfall genommen hatten. Aber das wäre halt noch zu überprüfen. Das elektronische Auge an der Pforte sondierte argwöhnisch mein Gesicht. Eine mechanisch klingende Stimme fragte nach meinem Namen. Bevor ich endlich hineingelassen wurde, musste ich den Dienstausweis in die Kamera halten. Sicherheit ist eine prima Sache, man sollte sie nur nicht übertreiben! Herr von Stempel stellte sich mir noch an der Haustür als General a.D. vor, womit mir schlagartig einiges klar wurde. Ich sah mich demonstrativ um. „Erwarten Sie eine größere militärische Bedrohung?“, fragte ich ihn. „Wenn Sie wegen der Sicherheitsmaßnahmen innerhalb meines Sperrgebiets fragen, gibt mir der heimtückische Überfall auf meinen Nachbarn wohl mehr als recht!“ „Aber kommen Sie, ich zeige Ihnen das Herzstück der Anlage.“ Seinen Worten zufolge war das, was ich bisher zu Gesicht bekam wohl nur ein kleiner Teil des Ganzen. Auf dem Weg in die Kommandozentrale, im ersten Stock, passierten wir mindestens drei Lichtschranken und zwei Bewegungsmelder. „Die Fenster sind mit einer unzerstörbaren Folie versehen,“ erzählte er mit unüberhörbarem Stolz. „Wir haben dieses Material bereits auf dem Schießstand der Polizeischule getestet. Aber ich habe nicht gewusst, dass es auch schon in Privathäuser eingebaut wird.“ „Es war auch nicht billig!“ Ich nickte anerkennend mit dem Kopf. „Das kann ich mir vorstellen.“ Aber was ich dann zu sehen bekam, sprengte fast meine Vorstellungskraft. Der Raum, den er seine Kommandozentrale nannte, sah aus, wie die Steuerzentrale eines Kernkraftwerkes. Die Fläche einer ganzen Wand war mit Monitoren verdeckt. Darunter standen mehrere Videoaufzeichnungsgeräte. Auf einer anderen Wand hingen die Grundrisse des Hauses und die Pläne der einzelnen Stockwerke. In ihnen waren kleine Lämpchen integriert, die jedes für sich den Standort einer Alarmanlage darstellte. Der Mann musste ein Vermögen in sein Hobby investiert haben! „Und nun möchten Sie sicherlich wissen, ob meine Kameras etwas von dem Überfall aufgezeichnet haben?“ „Richtig!“, kommentierte ich knapp. „Viel Hoffnung kann ich Ihnen da nicht machen. Wie Sie sicher bemerkt haben, sind die Tannen auf dieser Seite meines Grundstückes schon etwas zu hoch gewachsen, aber vielleicht haben wir ja Glück und es ist trotzdem etwas auf dem Band.“ Da jede seiner Kameras an einem eigenen Aufzeichnungsgerät angeschlossen war, reichte ein Knopfdruck und das gewünschte Band lief. Nun suchte er mit dem Suchlauf nur noch die Stelle heraus, an der das Tatfahrzeug vor den Garagen des Nachbarn hielt. Die wichtigsten Szenen waren leider durch die Baumwipfel der Tannen verdeckt. Dennoch konnte ich eindeutig einen dunkelblauen Camaro erkennen. „Kann man den Bildausschnitt vergrößern?“, fragte ich. „Nein, leider nicht!“ „Es wäre nett, wenn Sie mir die Kassette mitgeben könnten. Sie bekommen Sie selbstverständlich wieder zurück!“ „Sie können Sie gern behalten.“ Auf dem Monitor war nun zu sehen, wie ein Passant von der anderen Straßenseite aus, das Geschehen beobachtete. Diesen Mann hatten wir bislang nicht unter unseren Zeugen. Vielleicht hatte er das Kennzeichen gesehen, welches auch aus der Kameraperspektive nicht zu erkennen war. Jetzt war, nur für einen winzigen Augenblick ein junges Mädchen durch die Bäume hindurch zu sehen. Gleich darauf, ebenfalls nur ganz kurz, die beiden Jugendlichen. So schnell, wie ein Geist huschte dann die Fahrradfahrerin vorbei. Ab und an, immer dann, wenn sich die Baumwipfel etwas im Winde bogen, wurde die Sicht auf den Camaro etwas frei gegeben. Sicher würde es den Jungs im technischen Labor gelingen, genau diese Momentaufnahmen herauszufiltern und soweit zu vergrößern, dass wir darauf etwas mehr erkennen konnten. 8 „Ich hoffe das Band wird Ihnen etwas behilflich sein können,“ brüllte er plötzlich, ähnlich laut, wie Kriminalrat Werner. „Haben Sie selber auch etwas beobachten können?“, fragte ich ihn in der Hoffnung auf weitere Beobachtungen. „War gerade hinter dem Haus, auf meinem Übungsplatz, als die Ballerei losging!“ „Übungsplatz?“, fragte ich verblüfft. „Na so ein Drillplatz, Sie wissen schon!“ Ich wusste nicht, aber ich ahnte! Begeisterung stand in seinen Augen „Kann ich Ihnen gern zeigen,“ erbot er sich. „Leider, ich muss weiter,“ wiegelte ich ab. „Aber vielleicht ein andres mal!“ „Sie sind immer willkommen!“ Als ich das Anwesen mit der Videokassette verlassen hatte, atmete ich erst einmal tief durch. 2. Kapitel „Es ist alles gut gegangen, Salvatore. Wir haben den Franzmännern gehörig eingeheizt. Die werden sich in Zukunft sicher zwei mal überlegen, ob sie Stress mit uns anfangen wollen.“ „Ach was bist du doch einfältig, Adriano. Das war mit Sicherheit erst der Anfang!“ „Und wenn schon, sollen nur kommen, diese verfluchten Franzosen!“ Adriano und Salvatore Baresi hatten die Geschäfte in der Hansestadt von ihrem Vater, dem ehrenwerten Giuseppe Baresi, vor einigen Jahren übernommen und sie zusammen mit dem nun ermordeten Schwager Giuliano in seinem Sinne weitergeführt. Salvatore, der Herzensbrecher, leitete die kaufmännischen Geschicke. Er war Mitte 30, hatte volles, rabenschwarzes Haar und einen ebenso schwarzen Oberlippenbart. Seine Anzüge waren stets aus edelstem Zwirn. Um die Ausstrahlung, die er auf Frauen hatte, wurde er von seinem Bruder beneidet. Adriano, das Raubein, war für das Grobe zuständig. Auch er war eine stattliche Erscheinung, hatte aber nicht dieses gewisse Etwas. Auch er hatte schwarzes Haar und einen Schnauzer. Quer über seine linke Wange zog sich eine breite Narbe. Bei einer Strafaktion hatte ihm ein Zuhälter mit dem Messer die Konturen seines Gesicht nachgezogen. Man fand den Schlitzer am nächsten Morgen auf der städtischen Müllkippe! Giuliano, auch das Schlitzohr genannt, kontrollierte ein Heer von kleinen Drogendealern. Er hatte sich in Palermo hochgearbeitet und war auf Empfehlung einer befreundeten Familie nach Bremen gekommen. Bereits kurze Zeit später hatten er, ihre Schwester, Giuletta Baresi geheiratet und gehörte somit zum Stamm der Familie. Er war ein gut aussehender, sehr stolzer Mann, von etwa 33 Jahren. Ihm hatte Giuseppe also die Verteilung der Drogen anvertraut. Das oberste Wort hatte sich allerdings Giuseppe, als Familienoberhaupt vorbehalten. Trotz seines hohen Alters und seines schlechten Gesundheitszustandes schreckte der Alte, wie er ehrfurchtsvoll genannt wurde, auch nicht vor solch einem Gegenschlag zurück Schließlich hatte man ihm mit dem Mord an dem Schwiegersohn, den Dolch mitten ins sein sizilianisches Herz gerammt. Hatte seine Ehre herausgefordert, und mit ihm natürlich die ganze ehrenwerte Gesellschaft. Gerade das war es, was die Familie so stark und bisher auch unangreifbar machte. „Haben wir eigene Verluste?“, fragte Salvatore seinen Bruder. „Diese Stümper würden doch nicht mal ein Scheunentor treffen, wenn sie direkt davor stünden!“, machte er sich lustig. „Du solltest die Sache ernster nehmen, Adriano! Sie werden zurückschlagen. Es wäre gut, wenn wir darauf gefasst wären!“ „Keine Angst, wir werden sie gebührend empfangen!“ „Hast du wenigstens darauf geachtet, dass es keine Zeugen bei eurem Überfall gab?“, fragte Salvatore seinen jüngeren Bruder. „Für wie dumm hältst du mich? Es gab keine Zeugen!“ „Was ist mit den Nachbarn?“ Die bohrenden Fragen seines Bruders gingen Adriano auf die Nerven. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit musste er sich aufspielen. „Und wenn schon, wir waren die ganze Zeit im Auto. Da hätten sie unsere Gesichter so wie so nicht erkennen können!“ „Ich hoffe ihr wart wenigstens so schlau und habt ein geklautes Auto für diese bescheuerte Aktion verwendet.“ Adrianos Blick verlor sich auf dem gefliesten Fußboden. Salvatore schwante nichts gutes. „Rede schon!“, fuhr er seinen Bruder an. „Mit welchem Wagen wart ihr dort?“ „Mit dem Camaro,“ musste er kleinlaut zugeben. „bist du total verrückt geworden? Du lässt 9 die Karre sofort verschwinden! Am besten du versenkst sie irgendwo. Dann meldest du ihn sofort als gestohlen! Falls sich ein Zeuge an das Kennzeichen erinnert, kann man es dir nicht anlasten.“ Offenbar hatte man im Lager der Franzosen nicht mit einer so prompten Antwort auf die Herausforderung am Hafen gerechnet. Als der Mann mit dem schwarzen Hut vor seiner Villa in der Bürgermeister Spitta Allee vorfuhr, glaubte er seinen Augen nicht zu trauen. Gerade noch hatte er mit seinen Leuten die gute Arbeit im Hafen mit einem erlesenen Essen gefeiert und nun dieser derbe Rückschlag. Woher nur hatte der Gegner so schnell von der Sache Wind bekommen? Das hatte sich Pierre Gorgon ganz anders vorgestellt. Der Mann aus Frankreich war noch nicht lange in Bremen. Schritt für Schritt war es ihm gelungen, einige Nischenplätze der Bremer Unterwelt zu erobern und mit seinen Leuten zu besetzen. Die Geschäfte liefen anfangs gut, doch schon bald war er der italienischen Familie ein Dorn im Auge. Den großen Krach aber hatten beide Seiten bisher wohlweißlich vermieden. Bis jetzt! Es war Herrn Gorgon bisher gelungen seinen Namen aus all seinen Aktivitäten herauszuhalten und somit für uns, als ein noch völlig unbeschriebenes Blatt zu gelten. Seine schwarze Limousine hatte er inzwischen am Hauptsitz seiner Firma gegen ein Mercedes Sport Coupe eingetauscht. „Hier können Sie nicht weiter!“, versperrte ihm einer der Polizeibeamten den Zugang. „Ich wohne hier!“, entgegnete der Franzose ärgerlich und ging einfach weiter, ohne eine Reaktion des Polizisten abzuwarten. Pierre Gorgon war ein Mann von etwa 40 Jahren, ungewöhnlich groß für einen Franzosen und sehr schlank. Sein tiefschwarzes Haar hatte er mit einer Menge Pomade an seinen schmalen Schädel geklebt. Er trug einen schwarzen Seidenanzug und unter seinem Hut eine Brille mit Spiegelgläsern, die ihm einen Seelenlosen, fast roboterhaften Ausdruck verliehen. Ich war inzwischen von meiner Tour durch die Nachbarschaft zurückgekehrt. Die Videokassette hatte ich per Boten zur Auswertung ins Labor geschickt und berichtete Gerd gerade von den Aussagen der Zeugen. „Was ist hier geschehen?“, fragte der Franzose an Gerd Kretzer gewandt, als er in den Raum hineinstürmte und seine Angestellten betreut von Notärzten und Sanitätern vorfand. „Wer sind Sie, bitte?“, stellte Gerd ihm zunächst eine Gegenfrage. „Pierre Gorgon, der Besitzer des Hauses!“ Gerd reichte ihm die Hand. „Hauptkommissar Kretzer und mein Kollege, Mike Winter von der Mordkommission 2.“ Im selben Moment erhob sich einer der Ärzte kopfschüttelnd aus der Sitzecke. „Dieser Mann hier hat es leider nicht geschafft. Lungensteckschuss! Eine Reanimation war nicht mehr möglich!“ Ich sah zu Gorgon hinüber, konnte auf seinem Gesicht aber nicht einmal den kleinsten Anflug einer Reaktion, geschweige denn Betroffenheit feststellen. „Gibt es hier einen Raum, in dem wir uns unterhalten können? Wir wollen es den Rettungskräften nicht noch schwerer machen, indem wir ihnen den Weg versperren.“ „Folgen Sie mir bitte.“ Hinter dem Nebenraum war ein weiteres Zimmer, das dem Hausherren offensichtlich als Büro diente. „Es hat offensichtlich einen Überfall gegeben,“ fuhr Gerd in seiner Befragung fort. „Sind die Verletzten Angestellte oder Familienmitglieder?“ „Sie arbeiten für mich.“ „Darf ich fragen, womit Sie ihr Geld verdienen?“ „Meine Firma arbeitet im Import Exportgeschäft.“ „Dann sind diese Herren sicherlich kaufmännische Angestellte,“ warf ich ironisch, bissig dazwischen. „Können Sie sich vorstellen, warum sie jemand derart massiv bedroht?“, hakte Gerd nach, ohne seine Antwort auf meine Frage abzuwarten. „Oder ist es in ihrer Branche allgemein üblich die Konkurrenz auf diese Weise aus dem Weg zu räumen?“ „Natürlich nicht, Herr Hauptkommissar. Mir ist das Ganze selber unerklärlich!“ „Dann haben wir es nun, also auch hier mit einem Mordfall zu tun,“ stellte Gerd Kretzer nüchtern fest. Der Hausherr ging an die Bar und bediente sich. „Auch etwas zum Hinunterspülen, meine Herren? Vielleicht einen Pernod?“ „ Danke nein, wir sind im Dienst!“, 10 lehnte der Hauptkommissar ab. „Oh ja, natürlich, ich vergaß.“ Wieder meldete sich der Mann aus dem Nebenraum. Die Sanitäter hatten ihn anscheinend soweit versorgt, dass er nach seinem Boss rufen konnte. Pierre Gorgon leerte sein Glas mit einem einzigen Schluck und stellte es zurück auf die Bar. „Sie entschuldigen mich bitte für einen Moment!“ Als er den Raum verlassen hatte, ging ich ebenfalls an die Bar, nahm mir ein Glas und kippte einen Schluck Pernod hinein. Gerd sah mir verständnislos zu. Ich trank den Schluck und stellte das leere Glas an die Stelle, an die Gorgon zuvor sein Glas abgestellt hatte. Das des Hausherrn tütete ich ein und ließ es in meinem Jackett verschwinden. Monsieur Gorgon würde sicher nicht bemerken, dass eines seiner Gläser fehlte. Gerd zwinkerte mir anerkennend zu. Wer weiß, wozu wir die Fingerabdrücke des Herrn noch brauchen würden. Es dauerte nur wenige Minuten, bis der elegante Mann mit der Brille wieder zu uns in den Raum zurück kam. „Kann ich Ihnen noch in irgend einer Weise behilflich sein, meine Herren?“, fragte er in bemerkenswert akzentfreien Deutsch. „Sie sprechen unsere Sprache außerordentlich gut, Herr Gorgon. Gibt es dafür einen besonderen Grund?“, fragte ihn Gerd beeindruckt. „Meine Mutter stammt aus Saarlouis.“ „War das auch der Grund dafür, dass Sie sich in Deutschland eine Existenz aufgebaut haben?“ „Ich weiß zwar nicht, was Ihre Fragen mit diesem Überfall zu tun haben, aber wenn es Ihnen weiterhilft... Ja, ich wollte das Land von dem ich als junger Mann soviel hörte, kennen lernen. Wenn ich allerdings geahnt hätte, dass Mord und Totschlag hier an der Tagesordnung sind, wäre ich sicher in Frankreich geblieben. Immerhin habe ich nicht nur einen Mitarbeiter, sondern auch einen guten Freund verloren!“ „Seien Sie versichert, dass wir alles daran setzen werden, um die Schuldigen hinter Schloss und Riegel zu bringen!“ Mit diesen Worten beendete ich für meinen Teil das Gespräch und verließ das Haus um nach Stocki Ausschau zu halten. Gleich nach mir verließen auch die Sanitäter mit den Verletzten das Haus. Sie wurden auf die Krankenwagen verteilt und sofort ins Klinikum gefahren. Auf den freiwerdenden Parkplatz stellte sich sofort ein Leichenwagen. Zwei schwarz gekleidete Herren luden die Zinkwanne aus und verschwanden in der Villa. Der Kerl war mir mit seinem ganzen Getue und seiner mechanisch aufgesetzten Freundlichkeit einfach zuwider. Mein Handy klingelte. Aron war am anderen Ende. Er erzählte mir, dass der Verletzte vom Hafen bereits eine ganze Zeit vor Arons Eintreffen im Krankenhaus, bei Besinnung war und mit letzter Kraft ein Telefonat geführt hatte. Leider war es dem Pflegepersonal erst aufgefallen, als sie den Mann am Telefon im Schwesternzimmer erwischten. Somit war also klar, wie die Familie Baresi von der Sache so schnell erfahren konnte. Während unseres Gespräches war Hans Stockmeier mit seinen Leuten eingetroffen. „So langsam habe ich das Gefühl, dass wir nur noch für die M 2 arbeiten. Was habt Ihr denn hier schon wieder?“ Ich schilderte ihm kurz den vermutlichen Tathergang und erklärte, dass wahrscheinlich beide Fälle zusammenhingen. „Was die Sache am Hafen angeht, konnten wir leider kaum verwertbare Spuren finden. Ein paar Reifenabdrucke und der Teppich sind alles!“ „Habt ihr ihn schon im Labor?“ „Natürlich!“ „Ich glaube auch nicht, dass ihr hier mehr Glück haben werdet. Außer etlichen Patronenhülsen und Geschossen, die in den Wänden einschlugen, werdet ihr sicher nichts finden. Das heißt, ich habe eine Videokassette eines der Nachbarn ins technische Labor bringen lassen. Vielleicht bringt uns die ja ein wenig weiter. Auf jeden Fall haben wir es mit eiskalten Profis zu tun!“ „Sicher, aber du weißt ja, irgendwann machen sie alle einen Fehler. Und um den zu finden, sind wir eben da!“ Stocki war eben ein echter Profi. Je schwieriger die Fälle waren, um so mehr reizte es ihn, sie zu knacken. Ohne ihn säßen heute sicher einige Verbrecher weniger hinter Schloss und Riegel. Überdies gehörte er aber auch rein menschlich zu den Sympathieträgern des Präsidiums. Gerd hatte sich inzwischen von Gordon verabschiedet und kam zu uns heraus. „Ich nehme an, Mike hat dir bereits erklärt worum es hier geht?“ „Ich weiß Bescheid!“ „Ach, ehe ich es vergesse, ich habe da ja noch etwas für dich.“ Ich griff in die etwas ausgebeulte Tasche 11 meines Jacketts und zog vorsichtig die Tüte mit dem Glas heraus. „Ich habe es von der Bar im Haus. Darauf sind Gordons Fingerabdrücke. Bitte nimm sie ab und stell das Glas möglichst so wieder zurück, dass niemand es bemerkt.“ „Geht klar!“ „Wenn etwas sein sollte, kannst du Mike und mich im Restaurant Romano erreichen.“ Stocki nickte und ging an seine Arbeit. Gerd und ich machten uns auf den Weg zum Wardamm. Diesmal fuhr ich direkt auf den Parkplatz des Restaurant. „Eigentlich könnten wir hier gleich einen Happen essen,“ schlug Gerd vor. „Die Küche soll ja sehr gut sein.“ „Die Preise auch!“, gab ich zu bedenken. „Du bist natürlich eingeladen!“ „Läuft das unter Spesen?“ Gerd grinste und öffnete mir mit einer einladenden Handbewegung die Tür. Das Romano war bekannt für guten Service und eine gediegene Atmosphäre. Ich war zum ersten mal in diesem Restaurant und, wie ich bemerkte, Gerd ebenso. Der Eingang mündete in einem kleinen Foyer mit Garderobe. Überall mehrere dicke übereinander gelegte Teppiche. An den Wänden hingen stillvoll angestrahlte, große Meister. Darunter ein mit rotem Samt bezogenes Kanapee. Viel zu schade, um sich darauf niederzulassen. „Guten Tag, die Herrschaften, willkommen im Romano,“ begrüßte uns ein junger Mann in schwarzer Livree. „Darf ich Ihnen einen Tisch zeigen?“ „Äh, gern,“ stotterte ich und sah ungläubig zu Gerd hinüber. So vornehm hatte ich es hier nicht erwartet. Unsicher, dem Ort entsprechend richtig gekleidet zu sein, folgte ich Gerd und dem Ober. Wir wurden in einen riesigen Raum geführt, der durch zahllose Pflanzen und etliche Trennwände unterbrochen wurde. Kunstvolle Figuren und Gefäße vermittelten ein gediegenes Ambiente. Der Mann führte uns an einen Zweiertisch am Fenster. „Ist Ihnen dieser Tisch genehm?“, fragte er in perfektem Deutsch, mit einer Spur italienischem Akzent. „Ja danke, sehr schön,“ lobte Gerd und setzte sich. Ich tat ihm gleich. Der Ober holte unterdessen eine Pappschachtel aus seiner Jacke, entnahm ihr einen riesigen Streichholz und zündete damit die auf dem Tisch stehende Kerze an. Dann reichte er uns die in Bordeauxfarbenem Leder gebundene Speisekarte. „Die Filetti d` Romano wären sehr zu empfehlen.“ Schließlich machte er eine leichte Verbeugung und zog sich diskret zurück. Eigentlich hatte ich plötzlich gar keinen Hunger mehr, aber das lag wohl weniger an meinem Magen, als an der ungewohnten Umgebung. Gerd schien sich mit den Italienischen Speisen und Getränken auf der Karte bestens auszukennen. „Wollen wir doch mal sehen, ob die Bistecca hier besser sind, als bei Antonio. Er klappte die Karte zusammen und legte sie auf den Tisch. Ich sah ihn fragend an. „Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, dann solltest du mir die Bestellung überlassen. Es sei denn, du magst kein Rumpsteak.“ „Oh doch, ich vertraue dir!“ Nachdem auch ich meine Karte nieder gelegt hatte, trat der Ober wieder an unseren Tisch. Gerd bestellte einige Speisen, deren Name ich nicht einmal aussprechen konnte. Während des Essens unterhielten wir uns über die Familie Baresi. Das Restaurant Romano war eines von vielen ganz legalen Geschäften, die von der Familie Baresi unterhalten wurde. Natürlich wussten wir, dass der Clan große Teile der Bremer Unterwelt kontrollierte, nur von etwas zu wissen, ist eine Sache, es aber nachweisen zu können, ist eine ganz andere. Offiziell galt die Familie in der Stadt als seriös. In ihrer Villa, im Stadtteil Horn, gingen selbst Senatoren ein und aus. Der Alte spendete oft und gern für wohltätige Zwecke. Man sah seinem Geld schließlich nicht an, woher es kam. Einige male hatten die Kollegen von der Sitte Anhaltspunkte für eine Beteiligung des Hitzkopfes Adriano, an organisierter Zuhälterei. Aber jedes mal gelang es den ausgebufften Winkeladvokaten der Familie, ihn vor einer Verurteilung zu bewahren. Aber wirklich schaden konnte das den Baresis auch nicht. Irgendwann hatten wir auch mit dem letzten Gang, eines köstlichen Menüs, unsere Gaumen verwöhnt. Während der Ober die Teller abräumte, fragte ihn Gerd nach seinem Chef. „Waren die Herrschaften mit dem Essen oder dem Service nicht zufrieden?“, fragte er fast ängstlich. 12 „Nein, nein!“, beruhigte ihn der Hauptkommissar und übergab ihm eine seiner Visitenkarten. „Wir haben nur ein paar Fragen an ihn.“ Kurz darauf trat Salvatore Baresi an unseren Tisch. „Sie hatten einige Fragen an mich?“ „Es geht um einen Ihrer Mitarbeiter. Wir haben ihn heute Morgen tot im alten Hafen gefunden.“ „Das ist ja schrecklich. Aber bitte, meine Herren, folgen Sie mir ins Büro. Dies ist wohl nicht der richtige Ort für ein solches Gespräch.“ Erst auf unserem Weg, quer durch das Speiselokal, konnten wir all die Kostbarkeiten sehen, die hier zusammengetragen waren. Die überall im Restaurant aufgestellten Figuren waren mit Sicherheit keine billigen Gipsabdrücke. Gleiches galt wahrscheinlich auch für die vielen echt und teuer wirkenden Gemälde. Das Romano gehörte zu den Renommierobjekten der Familie. Gleich neben der Küche lag das Arbeitszimmer. Einem der gerade an uns vorbeilaufenden Kellner warf er einige italienische Wörter entgegen. Fast gleichzeitig wies er uns, mit einer freundlichen Handbewegung an, durch die, bereits von ihm geöffnete Tür, hindurchzugehen. „Darf ich Ihnen etwas anbieten, meine Herren?“ „Danke nein!“, antworteten Gerd und ich, wie aus einem Mund. „Wenn ich Sie eben richtig verstanden habe, haben Sie einen Toten gefunden und meinen nun, es könnte sich um einen meiner Mitarbeiter handeln.“ „Eigentlich sind es sogar zwei Tote. Aber nur bei einem von ihnen haben wir ein Streichholzheftchen Ihres Restaurant gefunden.“ Er zeigte uns sein tadellos, falsches Gebiss. „Bislang sind all meine Mitarbeiter zur Arbeit erschienen. Diese Heftchen liegen in einem Körbchen im Foyer, für jeden meiner Gäste zum mitnehmen bereit.“ Ich zog die beiden Polaroid aus der Innentasche meines Jacketts und hielt sie ihm entgegen. „Vielleicht waren die Herren ja auch nur Gäste Ihres Hauses?“ Er warf einen beinah gleichgültigen Blick auf die Bilder und gab sie mir wieder zurück. „Bedaure, ich kenne die Herren nicht.“ „Sie haben sicher nichts dagegen, wenn wir die Fotos auch Ihren Angestellten zeigen.“ „Selbstverständlich nicht! Ich darf Sie jedoch bitten, Ihre Befragung hier durchzuführen. Ich möchte nicht, dass meine Gäste dadurch gestört werden!“ Ich nickte. „Das ist kein Problem.“ Salvatore Baresi verließ den Raum. „Ich schicke Ihnen mein Personal so herein, wie ich sie im Speisesaal entbehren kann.“ Dann verließ er den Raum. „Was meinst du?“, fragte ich Gerd. „Nicht hier,“ wehrte er ab. Kurz darauf betrat der erste der Ober den Raum. Ich zeigte ihm die Fotos und wir stellten die üblichen Fragen. Doch der Mann behauptete ebenfalls keinen der Toten je gesehen zu haben. Nach und nach mussten wir uns so die Aussagen von sage und schreibe 16 Kellnern, Köchen und sonstigen Angestellten anhören. Während der Befragungen war ich aufgestanden und durch das Büro gegangen, um unauffällig etwas herumzuschnüffeln. Auf dem Schreibtisch fand ich einen Zettelblock, auf dem der oberste deutliche Druckspuren aufwies. Ich riss ihn ab und steckte ihn ein. Im, auf den heutigen Tag, aufgeschlagenen Terminplaner las ich den für 18 Uhr eingetragenen Namen, Giuseppe. Wenn am Ende der Befragung auch nichts herausgekommen war, so war doch deutlich geworden, dass sie alle miteinander gelogen hatten. Etwas Gutes hatte unser Besuch im Romano überdies aber doch noch. Salvatore Baresi bestand darauf, uns zum Essen eingeladen zu haben. „Aber besser als bei Antonio war das Rumpsteak hier auch nicht!“, resümierte Gerd beim Einsteigen in den Dienstwagen. „Dafür aber teurer,“ lachte ich. Als hätte er nur darauf gelauert, dass wir mit unserem Wagen auf den Hof der Dienststelle fuhren, erwartete uns Kriminalrat Werner schon, als wir aus dem Paternoster stiegen. „Wie ich höre, waren Sie heute Vormittag schon recht aktiv, meine Herren,“ brüllte er uns sogleich, in altbekannter Manier, entgegen. „Ich hätte gern ein wenig über den Fall erfahren! Was halten Sie von einem gemeinsamen Mittagessen in der Kantine?“ Wir sahen uns gegenseitig an und machten dicke Backen. „Vielen Dank, aber wir haben gerade eine Kleinigkeit zu uns genommen.“ „Ich bitte Sie, meine Herren, eine Tasse unseres leckeren Kantinenkaffees werden Sie mir doch wohl nicht abschlagen.“ Notgedrungen begleiteten wir ihn also, um ihn, wie er sagte, auf den neusten Stand zu bringen. 13 Bis zum Abend war es der Spurensicherung und uns gelungen, die Fingerabdrücke sämtlicher zum Fall zuzurechnender Personen zu bestimmen. Demnach war unsere menschliche Boje ein gewisser Giuliano Cecon, der Schwiegersohn von Giuseppe Baresi! Welchen Grund konnte sein Sohn Salvatore haben, seinen Schwager uns gegenüber zu verleugnen? Ich nahm mir vor, auf eigene Faust etwas Licht in die Sache zu bringen. Der andere Tote aus dem Hafen hieß aller Wahrscheinlichkeit nach Roberto Aporie. Beide waren zwar erkennungsdienstlich behandelt worden, bisher aber nicht vorbestraft. Anders der Verletzte. Bei seiner Vernehmung, hatte er Aron seinen richtigen Namen genannt und eingeräumt bereits wegen eines Drogendeliktes zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden zu sein. Eine Verbindung zur Familie Baresi stritt er jedoch vehement ab. Die von Stockmeiers Leuten an der Villa Gorgon gefundenen Projektile und Patronenhülsen, waren aus einer 45 mm Magnum und einer MP 5, wahrscheinlich von Heckler und Koch, abgegeben worden. Beides Waffen, wie sie, wegen ihrer hohen Durchschlagskraft, gern von organisierten Banden verwendet wurden. Sogar die Fingerabdrücke von Gorgons getötetem Mitarbeiter hatte Stocki bereits abgenommen und zusammen mit denen von Gorgons Pernodglas an Europool gefaxt. Die eingegangene Rückmeldung haute uns glatt aus den Socken. Bei dem Toten handelte es sich um den, mit internationalen Haftbefehl gesuchten Jean Mompelier. Es wurde wegen des dringenden Verdachts des Totschlages nach ihm gefahndet. Seine uns vorliegenden Papiere lauteten auf den Namen, Jerome Papon und waren genauso echt, wie die Firma, für die er arbeitete. Wie Aron am Computer herausfand, existierte die Import-Exportfirma Gorgons nur auf dem Papier. Gorgon selbst hieß eigentlich Gystaff und war noch bis vor kurzem in Marseille eine schillernde Figur der Unterwelt. Die französische Polizei war ihm dicht auf dem Fersen, konnte ihm aber nichts nachweisen. Als ihm der Boden in Frankreich zu heiß wurde, brach er bei Nacht und Nebel seine Zelte dort ab und verschwand. Auf dem Zettel, den ich von Schreibtisch im Romano mitgenommen hatte, konnte die Spurensicherung die Worte, Russen, Braake, die Kombination L875 und die Uhrzeit 23:30, sichtbar machen. Offensichtlich war hier ein Treffpunkt notiert worden. „Aron, das ist dein Part! Du wirst gleich als erstes Morgen früh dort hin fahren und nach dem Treffpunkt suchen. Vielleicht fällt dir ja irgend etwas auf.“ „Okay, Chef!“ Das Telefon läutete. Es waren die Kollegen vom technischen Labor. Sie waren nun mit der Videokassette des General a.D. von Stempel so weit und baten uns zu ihnen in den Vorführraum herunterzukommen. Hier unten ließen wir auch Phantombilder anfertigen, wenn wir mehrere Zeugen zur Verfügung hatte. Die technischen Vorraussetzungen und der Platz für die Zeugen waren hier optimal. Auf dem übergroßen Bildschirm konnte man wirklich jede Kleinigkeit erkennen. Es war sogar möglich den Film anzuhalten, Standbilder einzeln zu betrachten und sogar Teile des Bildes separat zu vergrößern und in Fotoqualität auszudrucken. Genau das ließen wir von dem Mädchen, welches vor den Jugendlichen ging und von dem Mann auf der anderen Straßenseite anfertigen. Ihre Fotos kamen mit in die Fahndung und wurden an sämtliche Dienststellen der Stadt gefaxt. Mit dem Kennzeichen des Camaro hatten wir weniger Glück. Somit mussten wir nach anderen Beweisen für die Täterschaft der Italiener suchen. Denn auch die Gesichter der Todesschützen, waren auf dem Band nicht zu erkennen. Blieb uns vorerst also nur auf die Zeugen und das Phantombild zu vertrauen. „Machen wir Schluss für heute, war ein anstrengender Tag!“ „Warum hast du der Polizei verschwiegen, dass der Mann auf dem Foto dein Schwager Giuliano ist?“, wollte Giuseppe Baresi von seinem Sohn wissen. „Ich wollte nicht, dass sie uns mit dem Überfall auf die Franzosen in Zusammenhang bringen. Außerdem war das Foto von Giuliano so schlecht, dass ich tatsächlich Schwierigkeiten hatte ihn darauf wieder zu erkennen.“ „Sie werden bald die Wahrheit herausfinden! Und dann wirft es einen Schatten auf unser Gesicht.“ „Aber es bringt uns etwas Zeit, um in Ruhe zu überlegen.“ „Du wirst gleich morgen früh diesen Kommissar aufsuchen und ihm sagen, dass du das Foto noch einmal 14 sehen möchtest. Dann wirst du deinen Schwager darauf erkennen!“ „Wie du meinst, Vater.“ „Wie kam es überhaupt dazu, dass die Franzosen unseren Deal mit den Russen zum platzen bringen konnten?“, krähte der Alte vorwurfsvoll und regte sich dabei derart auf, dass ihn seine über die Maßen gut bestückte Krankenschwester liebevoll beruhigen musste. „Ich schätze, wir haben einen Verräter unter uns. Ich verspreche dir, Vater ich kriege heraus, welches Schwein uns das angetan hat!“ „Aber achte darauf, dass du nicht noch einen Fehler machst!“ „Hallo, ich bin zu Hause!“ Seit einigen Wochen herrschte wieder Leben im Haus von Hauptkommissar Kretzer. Nach Jahren der Trauer um seine verstorbene Frau, hatte sich Gerd Kretzer durchgerungen wieder eine Frau in sein Haus zu nehmen. Aus dem, was anfänglich nur als Hilfe in einer Notlage gedacht war, der Ehemann von Frau Knieber war das Opfer einer seiner vorangegangenen Fälle, entwickelte sich schnell eine große Sympathie. Aus seiner Haushälterin und ihrer Tochter wurde der Inbegriff seines neuen Lebens. Vor allem die vierjährige Anna hatte er sehr in sein Herz geschlossen. So waren die beiden kurzerhand vor drei Wochen zu ihm gezogen. „Bitte setz dich gleich an den Tisch. Es gibt Borschtsch!“ > Polnisches Nationalgericht < „Wenn du mich weiterhin so verwöhnst, müssen mich Mike und Aron noch aus dem Dienstwagen ziehen, damit ich einen Tatort besichtigen kann.“ „Ich immer viel Angst haben, das du nicht wiederkommen.“ „Es heißt wieder kommst.“ „Ist doch egal, du weißt wie ich meine!“ „Was ich meine!“ „Anna würde es nicht verkraften, wenn sie auch dich noch verlieren würde.“ „Du brauchst keine Angst um mich zu haben, Mike und Aron lassen mich seit der Geschichte mit deinem verstorbenen Mann nicht mehr aus den Augen. Außerdem spüre ich selbst allmählich den Rost in meinen Gelenken.“ „Du kamst so spät, hast du wieder einen neuen Fall?“ „Nichts besonderes, mach dir keine Gedanken.“ Dann stand er auf und schlich leise durch die Tür zum Kinderzimmer. Die kleine Anna lag ganz freigestrampelt in ihrem Bettchen und schlief wie ein Engel. Gerd Kretzer strahlte über das ganze Gesicht. Das war es, was er sich immer schon gewünscht hatte, was ihm aber während der Ehe mit seiner Emmi versagt geblieben war. Seine anfängliche Angst, er könne schon zu alt sein, war schnell verflogen. In die Vaterrolle wollte er sich nicht drängen, aber ein guter Freund, das wollte er der Kleinen sein. Er ging an ihr Bett und zog die leichte Daunendecke ganz vorsichtig wieder nach oben. Dann streichelte er ihr zärtlich durch das blonde, lockige Haar und küsste sie behutsam auf die Stirn, und eine wohlige Wärme durchströmte seinen Körper. Auf mich wartete zu Hause leider niemand mehr. Mit Gabi war es inzwischen ganz aus. Während unserer vorläufigen Trennung, die sie ja so unbedingt brauchte um ein wenig Abstand von mir und meinem Job zu bekommen, lief ihr die Liebe ihres Lebens über den steinigen Weg der Besinnung. Der Besitzer eines Bestattungsinstituts aus Ostfriesland. Ich muss zugeben, dass ich Anfangs daran zu knabbern hatte. Aber wohl weniger aus verschmähter Liebe, als aus gekränkter Eitelkeit. So hatte ich in den vergangenen Wochen bereits die Annehmlichkeiten eines Singledaseins für mich entdeckt. Vor allem aber ist es ein gutes Stück Freiheit, sich nicht immer wieder für die Dauer seiner Arbeit entschuldigen zu müssen. Heute war wieder so ein Abend. Ich hatte beschlossen, mich vor der Villa des alten Baresi zu postieren. Ich war neugierig auf das, was sich dort noch abspielen würde. Also parkte ich meinen Wagen so unauffällig wie möglich, gegenüber der Einfahrt. Zunächst verließ ein Mercedes Sport Coupe das Anwesen. Im hellen Licht der Torbeleuchtung erkannte ich Salvatore Baresi. Er hatte also den Termin, wie er auf seinem Terminplaner notiert, wahrgenommen und seinen Vater besucht. Einmal hatte ich den Alten gesehen. Es war vor fünf oder sechs Jahren auf der Siegesfeier unseres Bürgermeisters. Ich war damals noch Hauptwachtmeister und zur Objektsicherung des Rathauses abkommandiert. 15 Seine hübsche Tochter war mir damals aufgefallen. Danach hatte ich beruflich nichts mehr mit der Familie zu tun. Wieder verließ ein Fahrzeug das Grundstück. Es war ein weißer VW Bully mit Bremer Kennzeichen. Ich notierte es mir und schrieb die Uhrzeit dazu. Da der Lieferwagen ringsherum geschlossen war, konnte ich nur durch die Windschutzscheibe sehen. Ich erkannte zwei männliche Personen. Ich hätte zwar zu gern gewusst, welchen Auftrag die beiden Männer hatten, entschloss mich dann aber doch an Ort und Stelle zu bleiben. Doch außer das Adriano Baresi, der jüngere Sohn des Alten, auf das Gelände fuhr geschah zunächst nichts, was meine Observierung hätte rechtfertigen können. Gerade, als ich die Entscheidung, dem Lieferwagen nicht hinterher gefahren zu sein, bedauerte, kehrte der Bully zurück. Ich verließ den Wagen und überquerte die Straße um zu sehen, was auf dem Anwesen vor sich ging. Vom Tor aus konnte ich leider nichts sehen. Also suchte ich mir eine Stelle, an der einer der Straßenbäume dicht genug stand, um von ihm aus auf die sicherlich drei Meter hohe Mauer zu gelangen. Aber auch von meinem jetzigen Standort, oben auf der Mauer, konnte ich nicht sehen, was sich nahe der Villa abspielte. Ich sprang also hinunter in den Garten und schlich mich näher heran. Mit viel Mühe gelang es mir dem Blickfeld der Kameras, die sich in alle Richtungen drehten auszuweichen. Endlich konnte ich sehen, wie ein gefesselter und geknebelter Mann in die Villa getrieben wurde. Die Gorillas verschwanden alle samt im Haus. Vorsichtig schlich ich ihnen nach. Die Gedanken, was geschehen könnte, wenn man mich hier erwischte, verdrängte ich. In einem der hell erleuchteten Räume des Erdgeschosses sah ich schließlich durch die zugezogenen Vorhänge die Konturen mehrerer Personen. Durch die einen Spalt breit geöffnete Terrassentür erkannte ich die Stimme von Salvatore Baresi. „Hier hast du das Schwein, das uns an die Franzosen verkauft hat!“ „Ist das wahr, Francesco? Bist du es wirklich, der unsere Familie verraten hat?“ „Si Patrone, si!” Der Mann kniete vor dem Alten und flehte um Gnade. Doch alles Wimmern half ihm nichts. Einer der Männer richtete etwas auf ihn und Sekunden später fiel er wie ein Sack Zement auf die Seite. Ich hatte genug gesehen. Wenn man mich jetzt erwischte, wäre mein Leben keinen Pfifferling mehr wert. Also machte ich mich vorsichtig auf den Rückweg. Immer in gebückter Haltung lief ich, die Büsche und Bäume als Deckung nutzend, in die Richtung aus der ich gekommen war. Meine Augen tasteten, so gut es eben in der Dunkelheit möglich war, die Mauer nach einer geeigneten Überstiegshilfe ab. Dabei muss ich wohl für eine Sekunde unachtsam gewesen sein und eine der Kameras übersehen haben. Plötzlich schalteten sich etliche Scheinwerfern ein und tauchten das ganze Gelände in grelles Licht. Ich hechtete in den nächstgelegenen Busch und versuchte mich zu verstecken. Doch plötzlich verspürte ich etwas kaltes in meinem Nacken. Es war der harte Lauf einer 9mm Carabella! Ganz langsam wandte ich meinen Kopf nach hinten und erkannte zwei weniger freundliche Herren, die mich nicht gerade höflich begrüßten. „Steh auf du Arsch! Was treibst du hier?“ „Wonach sieht es denn aus? Wenn ich euch sagen würde, dass ich hier nach Pilzen suche, würdet ihr es mir ja doch nicht glauben, - oder?“ „Jetzt wird der Kerl auch noch frech.“ Ehe ich mich versah, spürte ich die harte Spitze seiner italienischen Designerstiefel in meiner Seite. Ich zuckte zusammen, schluckte den Schmerz aber trocken hinunter. „Mitkommen!“, forderte mich der andere auf und half mir etwas unsanft auf die Beine, um im nächsten Moment mein Gesicht gegen einen Baum zu pressen. Während er mich erfolgreich nach Waffen durchsuchte, wurde ich von dem mit der Carabella in Schach gehalten. Schließlich kramte er auch in der Innentasche meines Jacketts und fand meinen Dienstausweis. „Ja wen haben wir denn hier? Da hat sich doch tatsächlich ein Bulle zu uns verlaufen!“ Ich taxierte die beiden und befand, dass ich wohl keine Chance gegen sie hatte. Peinlich war die ganze Sache so wie so schon über alle Maßen. Einer der Burschen plärrte einige italienische Wörter in sein Funkgerät und wartete auf Antwort. Außer dem Wort 16 Carabinieri verstand ich nichts. Schließlich plärrte eine ebenso ätzende Stimme irgend etwas zurück und meine Begleiter schubsten mich voran. Das Gehschubse endete in einem Arbeitszimmer. Ich durfte mich auf einen mit braunem Leder bezogenen Stuhl setzen. Der Raum glich fast einer Bibliothek. Überall standen Bücher. Tausende von alten und neuen, dünnen und dicken Wälzern, die sicher nicht alle von ihrem Besitzer gelesen worden waren. Ich hatte nur eine Hand voll, aber die hatte ich wenigstens auch gelesen! Der Schreibtisch füllte einen weiteren, großen Platz aus. Er war so groß wie mein französisches Bett. Ich tat genau das, was die Baresis wohl auch gerade machten, ich überlegte! Sie wussten nicht, wie viel ich gesehen hatte. Ferner wussten sie nicht, ob ich allein war und wer von meinem Besuch bei ihnen informiert war. Sicher hätten sie mich am liebsten im Fundament eines Neubaues verschwinden lassen, aber das würde mit Sicherheit einen ganzen Haufen Wirbel verursachen. Einen Wirbel, den sie gerade jetzt überhaupt nicht gebrauchen konnten. Wie ich es erwartet hatte, betrat nicht der Alte selber, sondern sein Sohn Salvatore das Arbeitszimmer. „Ach, der Herr Kommissar Winter, wenn ich mich recht entsinne. Ich dachte, ich hätte all Ihre Fragen zu Ihrer Zufriedenheit beantwortet?“ „Nun ja, leider haben Sie uns aber nicht die Wahrheit gesagt!“ „Wie soll ich das verstehen?“ „Wir haben inzwischen herausgefunden, dass einer der im Hafen Verstorbenen ihr Schwager war.“ „Ich muss gestehen, dass meine Aussage nicht korrekt war. Ich wollte meine Schwester vor all den lästigen Fragen schützen, die Sie jetzt an sie richten werden. Das ist ja wohl nicht strafbar, oder? Meine Schwester hat den Tod ihres Mannes sehr schmerzlich aufgenommen. Der Arzt der Familie ist ständig bei ihr.“ „Sehen Sie, hätten Sie mir das gleich gesagt, hätte ich mich nicht durch Ihren Garten schleichen müssen um zu erfahren, weshalb Sie mir den Schwager unterschlagen.“ „Wie es aussieht,“ verehrter Kommissar, „sind wir damit quitt!“ Er reichte mir seine Hand und klopfte mir freundschaftlich auf die Schulter. Der Mann war mit allen Wassern gewaschen. „Wenn ich Ihnen bei der weiteren Suche nach dem Mörder meines Schwagers irgend wie behilflich sein kann, dann lassen Sie es mich bitte wissen.“ „Ich kann Ihnen nur raten, uns allein diese Arbeit zu überlassen. Wir sind hier nicht in Sizilien!“ „Wobei ich Ihre Ermittlungsmethoden auch etwas merkwürdig finde.“ Dieser Abend war gelaufen. Meine Privatobservation war gründlich in die Hose gegangen. Hatte ich wirklich gesehen, wie ein Mensch vor meinen Augen, nur durch einen dünnen Vorhang hindurch erschossen wurde, oder war er gar nicht umgebracht worden? Hatte ich keinen Schuss gehört, weil der vermeintliche Mörder einen Schalldämpfer benutzt hatte, oder weil er den Mann nur niedergeschlagen hatte. Alles Fragen, auf die ich keine eindeutigen Antworten hatte. Doch wenn diese bedauernswerte Kreatur tatsächlich erschossen wurde, warum hatte ich dann nicht eingegriffen und wenigstens versucht es zu verhindern? Ich suchte eine Antwort auf all die quälenden Fragen und fand sie schließlich bei Kalle im Holsteneck. Wenn Ihnen das erste Drittel des Romans gefallen hat und Sie gern wissen möchten wie er zu Ende geht, dann schicken Sie mir Ihre Bestellung. Für 2,99 € Bearbeitungsgebühr sende ich Ihnen gern den Rest zu. Alles weitere per E-Mail. [email protected] Mit freundlichen Grüßen U.Brackmann 17
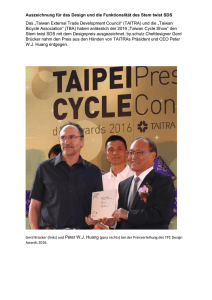
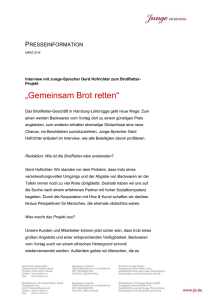
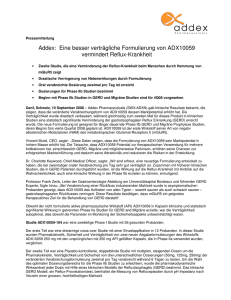

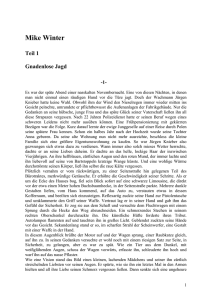
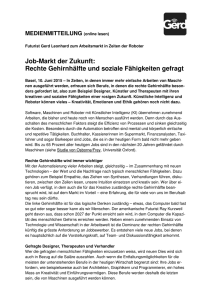

![Word [ 5.578 kB]](http://s1.studylibde.com/store/data/002067891_1-e16f7033a35331c48486242957bd06b5-300x300.png)