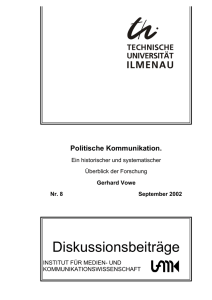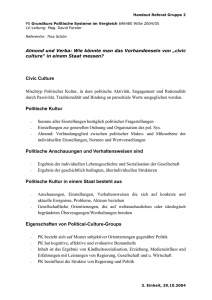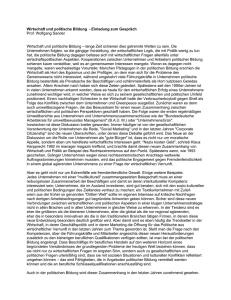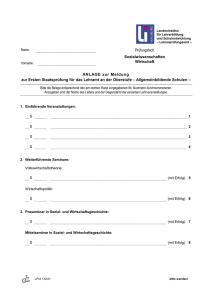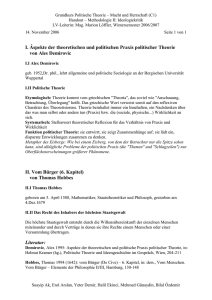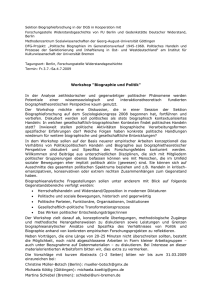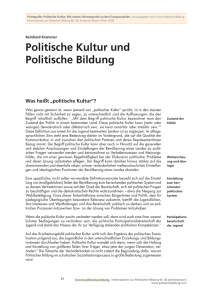Meer, Dorothee Gesprächssorten in der Politik
Werbung

Dorothee Meer Gesprächssorten in der Politik 1. Einleitung Im Mittelpunkt dieses Kapitels zu „Gesprächssorten in der Politik“ stehen in Abgrenzung zum vorherigen Kapitel zu „Textsorten in der Politik“ mündlichdialogische Formen der Interaktion in politischen Kontexten. Betrachtet man diesen Gegenstand zunächst einmal jenseits der für diesen Überblicksartikel nicht unproblematischen Trennung schriftlich-monologischer Textsorten und mündlich-dialogische Gesprächssorten, so können in einem ersten Zugriff drei Dimensionen unterschieden werden, die die Grundlage der weiteren Ausführungen bilden: ‒ Dimension des interaktiven Austauschs: Nicht nur die Benennung „Gesprächssorte“, sondern auch unser alltagsweltliches Wissen sagt uns, dass das politische Leben in entscheidender Weise von Gesprächen geprägt wird. Egal ob es sich um Parlamentsdebatten (Beitrag 4.8.1), politische Interviews (Beitrag 4.8.2.), Kanzlerduelle, Talkshows (Beitrag 4.8.3) oder um weniger medienöffentliche Formate wie Ausschussgespräche, Wahlkampfveranstaltungen oder Parteitreffen vor Ort handelt, stellen „Gespräche“ (unterschiedlicher Art) entscheidende Interaktionsformen dar, in denen politische Gegenstände und Sachverhalte entwickelt, ausgetragen bzw. (schrittweise) entschieden werden. Allerdings kommt trotz der banalen Evidenz dieser Feststellung in kaum einem anderen gesellschaftlichen Praxisbereich so schnell wie in politischen Zusammenhängen in den Blick, dass die Betrachtung interaktiver Aspekte politischer Gespräche nicht ausreicht, um Gesprächssorten aus diesem Bereich angemessen zu erfassen. Eine Beschränkung auf den interaktiven Kernbereich eines dialogischen Austauschs im Rahmen zentrierter Interaktion erscheint schon vor dem Hintergrund alltagsweltlichen Erfahrungswissens als unzureichend. Zu offensichtlich ist, dass politische Interaktion anderen Bedingungen unterliegt als das Gespräch am Gartenzaun, aber auch anderen Bedingungen als das Gespräch vor Gericht oder auf dem schulischen Elternsprechtag (siehe dazu Burkhardt 2003, 337ff.; Klein 2000, 1589). Ein entscheidender Unterschied politischer Gesprächsformate besteht darin, dass diese zwar auch als Formen zentrierter Interaktion beschrieben werden können, eine Vielzahl von ihnen aber auf elementare Weise gleichzeitig massenmedial eingebunden sind. Diese Feststellung leitet über zur medialen Dimension der Bestimmung politischer Gesprächssorten. ‒ Mediale Dimension: Nicht erst im sogenannten „Medienzeitalter“ der Gegenwart fällt der Blick auf die (massen-)mediale Konstitution des Politischen, die dazu führt, dass Aspekte politischer Interaktion vor Gesprächssorten in der Politik allem massenmedial vermittelt in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit gelangen. Damit soll keineswegs ignoriert werden, dass es politische Gespräche „unter Ausschluss der (medialen) Öffentlichkeit“ gibt (seien es nun Zweiergespräche auf dem Flur eines deutschen Landtags oder in Gruppen wie Parlamentsausschüssen, Stadträten oder anderen politischen Zusammenhängen). Dennoch bleibt diese Tatsache für die Forschung folgenlos, da die gesellschaftliche Öffentlichkeit entweder aufgrund von juristischen Regelungen oder der dominant massenmedialen Vermittlung des politischen Diskurses vielfach keinen Zugang zu diesen Gesprächen hat. In der Folge (allerdings nicht immer zwingend) hat sich die empirische Forschung im Bereich der politischen Kommunikation bisher auf leichter zugängliche Aspekte medial gespeicherter Daten (der Presse, des Fernsehens u. Ä.) konzentriert, was zu Schwerpunktsetzungen im Bereich schriftlicher und/oder für die Öffentlichkeit produzierter mündlicher Daten geführt hat (vgl. dazu auch die Beiträge in Abschnitt 4.7 dieses Handbuchs). Besonders deutlich werden die Folgen der Forschungsdesiderate im Bereich der mündlichen Kommunikation in dem Überblicksartikel von Klein zu „Gespräche[n] in politischen Institutionen“, in dem der Verfasser zwar 18 verschiedene politische „Interaktionstypen“ unterscheidet (2000, 1592), darunter auch Typen wie „informelle Kollegengespräche“ und „Koalitionsverhandlungen“, bei der Behandlung der jeweiligen Formate dann jedoch aufgrund 2 fehlender empirischer Daten auf erlebtes oder referiertes TeilnehmerInnenwissen und deduktive Annahmen über die erwartbaren sprechhandlungstheoretisch fundierten kommunikativen Muster zurückgreifen muss (siehe ebd., 1591). Vor diesem Hintergrund sollen im Rahmen dieses Beitrags vor allem solche Gesprächsformate genauer betrachtet werden, die auf der Grundlage linguistischer Korpora empirisch untersucht wurden. Hier bieten sich vor dem Hintergrund der zunehmenden Relevanz internetbasierter Kommunikationsformen gerade für den Bereich des Politischen Korpusanalysen an, die sich dezidiert auf die interaktiven Möglichkeiten subversiver Interventionen beziehen (Fraas 2004, 89ff.). ‒ Dimension des Diskurses: In der jüngeren Forschung vor allem zu schriftlichen Textsorten aus dem Bereich der Politik kommt als dritte Dimension des politischen Praxisbereichs der an Foucault anschließende Begriff des Diskurses in den Blick (Spitzmüller/Warnke 2011; siehe dazu auch Abschnitt 3.6 dieses Handbuchs zur Diskursanalyse). Im Rahmen dieses Beitrags sollen die Potenziale eines solchen Zugangs auch für mündliche Politikformate in den Blick genommen werden, da hier bisher erhebliche analytische und empirische Möglichkeiten unberücksichtigt bleiben. Der Begriff „Diskurs“ wird an dieser Stelle weder normativ (im Habermas´schen Sinne) als Form eines gleichberechtigten, rationalen Austauschs von Argumenten, noch Gesprächssorten in der Politik im gesprächsanalytischen Sinne als Synonym für die Bezeichnung „Gespräch“ gebraucht. Vielmehr soll mit Diskurs das erfasst werden, was zu einem bestimmten Zeitpunkt von einer konkreten (institutionellen) Position aus gesagt, gefragt oder bestritten werden kann (Foucault 1977). Foucault selber definiert Diskurs u.a. als „Menge von Aussagen, die einem gleichen Formationssystem angehören“ (Foucault 1988, 156). Diese Überlegungen paraphrasiert Auer, indem er den Begriff des Diskurses als „aufeinander bezogene[n], oft auch institutionell zusammenhängende[n] Menge von Texten/Äußerungen und der in ihnen erscheinenden und durch sie produzierten gesellschaftlichen Wissensbestände“ definiert (Auer 1999, 233). Aus einer solchen Perspektive können Diskurse als mehr oder weniger offene Felder diskursiver Möglichkeiten (Foucault 1994, 255) beschrieben werden, in denen Individuen bestimmte diskursive Positionen vertreten können, die wiederum von anderen geteilt oder auch bestritten werden (Foucault 1977; Link 1984, 12). Hierbei ist das Konzept der diskursiven Position gekoppelt an die Existenz unterschiedlicher institutioneller Hierarchien. Auf diese Annahmen aufbauend kann der Bereich des Politischen im Anschluss an Foucaults Konzept der Gouvernementalität als Ensemble diskursiver Führungstechniken (im Gegensatz zu rein repressiven Herrschaftstechniken) begriffen werden, die unterschiedliche gesellschaftlichen Praxisbereiche durchziehen (1994). Im Hinblick auf 3 den vorliegenden Gegenstand ist hierbei über Foucault hinaus entscheidend, dass diese Annahmen nicht nur für schriftlichmonologische, sondern gerade auch mündlich-dialogische Gesprächssorten gelten. Insoweit geht es im Hinblick auf die Analyse von Gesprächssorten darum, diskursive Verflechtungen auch in mündlich-interaktiven Situationen über die Analyse von diskursiven Parzellen (Link 1983, 12ff.) oder Diskursfragmenten (Fraas 2013, 11; Jäger 1993, 179) als lexikalische Einheiten (siehe dazu Böke 1996b; c; Böke/Jung/Niehr/Wengeler 2000, 18ff.), als Kollektivsymbole (Link 1977, 1992; 1984) und Metaphern (Burkhardt 2003, 369ff.; Böke 1996a), als Frames (Fraas 1996; Ziem 2013), Topoi (Wengeler 2000; 2007) und als Argumentationsmuster (Wengeler 1997; 2003) zu erfassen. Aus diskurstheoretischer Sicht kommen solche Diskursfragmente (unterschiedlicher Qualität) als Mittel der kommunikativen Auseinandersetzung im Bereich politischer Gespräche in den Blick, indem sie zwangsläufig Subjekteffekte nach sich ziehen (Foucault 1988, 138), d.h. bereits auf semiotischer Ebene konkrete Anschlusshandlungen motivieren. So eröffnet beispielsweise die Abbildung riesiger Flüchtlingsmengen vor deutschen Ämtern schon aufgrund der bildlichen Inszenierung das Gefühl der Bedrohung (deutscher Sozialkassen) und provoziert somit die daran anschließende politische Forderung, den Zugang zu diesen Ressourcen zu begrenzen (siehe dazu Böke/Jung/Niehr/Wengeler 2000, 30ff.). Mit Blick auf vorliegende Gesprächssorten in der Politik Forschungsbeiträge muss allerdings festgehalten werden, dass diskurstheoretisch basierte Untersuchungen diskursiver Parzellen bisher nahezu ausschließlich im Zusammenhang mit schriftlichen Textsorten in der Politik zu finden sind. Die systematische Betrachtung der Wirkung diskursiver Mechanismen im Rahmen von politischen Gesprächssorten stehen somit noch aus. Schaut man sich die genannten drei Dimensionen nun im Zusammenhang an, so stellen sie für die folgenden Überlegungen ein Metainstrumentarium dar, das es erlaubt, vorliegende Untersuchungen bzw. ausstehende Forschungsprojekte in den Forschungskontext einzuordnen, unterschiedliche Dominantsetzungen herauszuarbeiten und damit potenzielle Desiderate systematisch zu benennen. Bevor dies jedoch schrittweise geschehen soll, sind drei Ergänzungen zum Bisherigen notwendig: Erstens blieben bisher Aspekte der Institutionalisierung unerwähnt: ob es die formale Regelung des Rederechts oder der Redezeit in Parlamentsdebatten (Klein 2000, 1590) oder moderatorenzentrierte Formen der Diskussion in Talkshows (Holly 1993; Weidner 2007) sind, immer wieder kommen Formen politischer Interaktion aus institutionsspezifisch geregelter und teils formalisierter Sicht in den Blick. Wenn hier im Bisherigen dennoch darauf verzichtet wurde, den Aspekt der Institutionalisierung als vierte Dimension einzuführen, so liegt dies nicht etwa daran, dass der Einfluss institutionalisierter Regelungen bestritten werden soll. Vielmehr werden die unterschiedlichen Formen der 4 Institutionalisierung im Sinne Foucaults als permanent wirksame Form der Modularisierung aller drei genannten Dimensionen politischer Interaktion betrachtet (Foucault 1976, 105-123). Zweitens wurde in den vorangehenden Überlegungen die Trennung zwischen mündlichen und schriftlichen Formen politischen Handelns lediglich terminologisch in der Unterscheidung zwischen „Text-“ und „Gesprächssorten“ aufgegriffen, aber noch nicht problematisiert. Nun ist aber nicht nur die Oppositionsbildung zwischen „Text-“ und „Gesprächssorte“ theoretisch umstritten, sondern es stellen auch die Zuordnung medial schriftlicher, netzbasierter Formate wie politischer Chats oder Blogs zum Bereich der „Gesprächssorten“ ein Problem dar. Zwar ist diese Entscheidung vor dem Hintergrund der dialogischen Beschaffenheit der genannten Formate möglich (Beiswenger 2008, 48; Fraas 2004, 101), aber dennoch handelt sich bei Formaten wie Politikerchats (Diekmannshenke 2005), Wahlkampfblogs (Domke 2007) oder (subkulturellen) politischen Weblogs/Blogs zur Organisation von (Protest-)Veranstaltungen (siehe Fraas 2004, 90ff.) aus interaktioneller Perspektive vor dem Hintergrund der (medialen) Schriftlichkeit und der technischen Vermitteltheit der Interaktion eher um Randphänomene. Sowohl die interaktive als auch die mediale Dimension von Formaten im Rahmen von Chats, Weblogs (Blogs) oder Foren unterscheiden sich (teils) deutlich von anderen Praktiken der faceto-face-Kommunikation. Auch wenn netzbasierte Formen der politischen Interaktion möglicherweise als Formate eigener Qualität (jenseits der Gegensätze zwischen Mündlichkeit und 5 Gesprächssorten in der Politik Schriftlichkeit) begriffen werden können, ist die in diesem Handbuch praktizierte (vorläufige) Einordnung als Gesprächssorten aufgrund ihrer interaktiven Komponente zu rechtfertigen (siehe hierzu Fraas 2004, 101). Drittens – und das leitet über zum nächsten Abschnitt – erschwert die bereits erwähnte Vielzahl empirisch blinder Flecken im Bereich mündlicher Formate politischer Kommunikation Versuche einer Typologisierung. Die mit den folgenden vier Teilbeiträgen (4.8.14.8.4) angestrebten Untersuchungen konkreter politischer Gesprächssorten löst dieses Problem, indem sie auf alltagsweltlich mehr oder weniger eindeutig differenzierte Benennungen zurückgreift, die jedoch – wie dies für den Bereichen alltagsweltlichen Wissens durchaus typisch ist – zwischen sehr unterschiedlichen Kriterien changiert: Während der Begriff der „Plenardebatte“ in erster Linie auf der Basis eines juristisch-funktional bestimmten Settings definiert ist, handelt es sich bei politischen Interviews oder Formen des TV-Talks in erster Linie um Formatbenennungen, die ihren Ursprung auf der Ebene der gewählten Interaktionsform haben (Zweiergespräch vs. Gesprächsrunde mit Moderator), deren politische Funktion jedoch nahezu ausschließlich in der medialen Beteiligung an Prozessen öffentlicher Meinungsbildung aufgeht. Im Gegensatz dazu nimmt die Benennung „technisch-mediale Interaktion“ überhaupt keine funktionalen Zuschreibungen vor, sondern ist auf die Art der technischen Übermittlung kommunikativer Daten gegründet. Vor diesem Hintergrund handelt es sich bei diesen Gesprächssorten nicht um das Ergebnis einer linguistisch-empirisch fundierten Typologisierung politischer Gespräche, sondern um die Übernahme alltagsweltlich verbreiteter Ethnokategorien. Eine linguistische Typologie politischer Gesprächssorten muss somit als Desiderat der bisherigen Forschung betrachtet werden. Vor diesem Hintergrund geht es im Weiteren unter anderem auch darum, vorliegende empirische Untersuchungen auf Anhaltspunkte abzusuchen, die perspektivisch die Grundlage linguistischer Gesprächssortentypologien darstellen könnten. 2. Zum Begriff der „Gesprächssorte“ Sowohl der vorhergehende Kommentar zu den Folgen der gegenwärtigen empirischen Desiderate als auch die Gliederung dieses Handbuchs machen deutlich, dass die vorliegenden linguistischen Untersuchungen zu Fragen des Zusammenhangs zwischen mündlicher Kommunikation und Politik nicht anhand eines einheitlichen linguistischen Instrumentariums erfolgt sind (siehe dazu die Darstellung unterschiedlicher methodischer Ansätze in Kapitel 3 dieses Handbuchs). Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass die angesprochenen methodischen Differenzen auch in der genutzten Terminologie und den Begrifflichkeiten ihren Niederschlag finden. Dies gilt u.a. für den Begriff der „Gesprächssorte“, der eine Analogiebildung zum Begriff der Textsorte darstellt (Heinemann 2000, 514f.; Sager 2000, 1464). Im Anschluss an Heinemann hebt die aus der Textlinguistik stammende Begriffsbildung bewusst auf eine Differenzierung zwischen (schriftlichen) Gesprächssorten in der Politik Text(sort)en und (mündlichen) Gespräch(sort)en ab. Auch wenn diese Differenzierung in der vorliegenden textlinguistischen Literatur keineswegs unumstritten ist (siehe Adamzik 2004, 41), so handelt es sich vor dem Hintergrund der interaktionellen Differenzen z.B. zwischen einem Zeitungsartikel und eine Parlamentsdebatte in keinem Fall um eine abwegige Unterscheidung, zumal aus der terminologischen Differenzierung nicht geschlossen werden muss, dass Testsorten und Gesprächssorten nicht auch eine Vielzahl von Gemeinsamkeiten haben (siehe Stein 2011, 17f.). Letzteres gilt vor allem dann, wenn beide Formate dem gleichen gesellschaftlichen Praxisbereich, wie z.B. der Politik, angehören. Schaut man sich nun vorliegende Untersuchungen aus dem Bereich der Politik an, so fällt allerdings auf, dass die konkrete Klassifikation von Gesprächssorten weniger unter Bezug auf linguistische Untersuchungen erfolgt, sondern vorrangig anhand alltagsweltlich üblicher Unterscheidungen: Auch die in diesem Handbuch gewählten Differenzierungen in „Bundestagsdebatte“, „Talkshow“, „TV-Interview“ und „Formate technisch-medialer Interaktion“ folgen zunächst einem alltagsweltlich verankerten, institutionell-medialen Wissen. Dass solche Benennungen jedoch nicht zwingend mit linguistisch begründeten Typologisierungen deckungsgleich sein müssen, unterstreichen zum einen Gesprächssortenzuschreibungen wie „Diskussion“, „Interview“ und „Streitgespräch“, die sich häufig im Zusammenhang mit politischen Gesprächen finden, faktisch aber 6 gesprächssortenübergreifende Formen der Kategorisierung darstellen. So zeigen Holly, Püschel und Kühn (1985) am Beispiel der TV-Diskussion, dass diese keineswegs angemessen anhand alltagsweltlicher Muster der Gesprächssorte `Diskussion´ beschrieben werden kann. Über diese Ungenauigkeiten hinaus stellt Sager heraus, dass auch genuin linguistisch orientierte Ansätze der Typologisierung von Gesprächssorten auf verschiedenen Komplexitätsebenen ansetzen und in der Folge Phänomene sehr unterschiedlicher Art erfassen (2000, 1464). Hinsichtlich des Bereichs der politischen Kommunikation sind im Anschluss an diese Differenzierung auf der Makroebene vor allem Versuche der Typologisierung ganzer Gespräche als „Gesprächssorte“ relevant, auf der mittleren Ebene das Konzept der „kommunikativen Gattung“ (Günthner 1995; Luckmann1986) und des Gesprächs- bzw. Handlungsmusters (Ehlich/Rehbein 1972; Rehbein 1977; Klein 2000) und auf der Mikroebene die Kategorie des „Gesprächsaktes“ bzw. der einzelnen „Gesprächshandlung“ (Burkhardt 2003, 283ff.; Sager 1981). Zu ergänzen wären hier zum einen auf der Makroebene medienspezifischer Aspekte wie die technische Organisation von Interaktivität beispielsweise im Chat (Fraas 2004, 101) und zum anderen auf der Mikroebene diskursiver Fragmente wie Kollektivsymbole, Topoi und Metaphern. Aus semiotischer Sicht müssten unter Einbezug von Weblogs und anderen netzbasierten Formaten hieran anschließend auf der untersten Ebene bildliche Elemente systematisch berücksichtigt werden (Fraas 2004, 101; Meier 2004; Runkehl 2005) Jenseits der aus dieser Vielschichtigkeit resultierenden Gesprächssorten in der Politik Schwierigkeiten der Definition von Gesprächssorten im Rahmen eines kohärenten Zugangs, kann im Hinblick auf vorliegende Untersuchungen zu Gesprächssorten in der Politik festgehalten werden, dass Versuche der Klassifikation politischer Gespräche bisher schon deshalb ein Desiderat bleiben müssen, weil die bestehenden empirischen Grundlagen kaum ausreichen, um eine empirisch fundierte Typologie zu entwickeln. Insoweit muss es perspektivisch unter Ausweitung der empirischen Gegenstände um die Frage gehen, anhand welcher sprachlichkommunikativen Kriterien eine linguistisch basierte Typologie politischer Gespräche sinnvoll möglich ist. In der Mehrzahl vorliegender Untersuchungen wird der Begriff der Gesprächssorte zwar a priori gesetzt, die konkreten Analysen beziehen sich jedoch auf rekurrente Einheiten auf der mittleren und untersten Ebene, seien es nun Gattungen, Gesprächsakte oder diskursive Fragmente. Die Erfassung aller drei Komplexitätsebenen im Rahmen kohärenter Zugänge steht bisher also noch aus. Aus methodischer Sicht bietet der Begriff der „Gesprächssorte“ hier prinzipiell zwei unterschiedliche Ansatzpunkte, indem das Grundwort „Sorte“ auf textlinguistisch-typologische Aspekte verweist, das Bestimmungswort „Gespräch“ auf gesprächsund konversationsanalytische Zugänge. So markiert die Benennung „Gesprächssorte“ in Analogie zum Begriff „Textsorte“ einen eher typologisch-funktionalen Zugang. Hier könnte es sich anbieten, auf Fix´ Überlegungen zum Zusammenhang zwischen den Begriffen „Textsorte“ und „Textmuster“ zurückzugreifen, zwei Begriffe, die für Fix zwei Seiten der 7 gleichen Sache definieren. So geht Fix davon aus, dass der Begriff der „Textsorte“ aus quantitativer Perspektive eine homogene Textgruppe erfasst, die auf qualitativer Ebene ein gleiches Textmuster aufweist (2008, 71). Übertragen auf Gesprächssorten könnten Gesprächssorten dann als quantitative Einheit betrachtet werden, die auf eine relevante Menge ähnlicher Gespräche verweist, die aus qualitativer Perspektive Gemeinsamkeiten auf unterschiedlichen Ebenen besitzen. Diese qualitativen Gemeinsamkeiten könnten im Anschluss an Fix´ Verständnis von Textmustern als Gesprächsmuster bezeichnet werden, die Auskunft über thematische, funktionale und formale Gebrauchsbedingungen konkreter Gesprächssorten geben (Fix 2008, 71). Aus einem solchen Verständnis ergäben sich vielfältige Anschlussmöglichkeiten zu vorliegenden Klassifikationen einzelner Gesprächsakte (vgl. Burkhardt im vorliegenden Handbuch), aber auch von Handlungsmustern (vgl. Düring im vorliegenden Handbuch). Nun ist im Anschluss an den in diesem Beitrag dominant gesetzten Aspekt des „Gesprächs“ jedoch festzuhalten, dass der erwähnte gesprächstypologische Zugang zwar die Erfassung verfestigter Muster erlaubt, jedoch noch kein genuin interaktionelles oder sequenzanalytisches Instrumentarium enthält. Aus diesem Grund soll im Weiteren vorrangig auf das konversationsanalytische Konzept der kommunikativen Gattung im Anschluss an Thomas Luckmann und Susanne Günthner zurückgegriffen werden. Luckmann und Günthner verstehen unter kommunikativen Gattungen kulturspezifisch „verfestigte kommunikative Muster“ Gesprächssorten in der Politik unterschiedlicher Komplexität (Günthner 1995, 199), „auf die die Interagierenden in kommunikativen Vorgängen zurückgreifen“ (ebd., 193). Entscheidend für die Erfassung der interaktiven Dimension politischer Formate ist nun im Weiteren die von Günthner eingeführte Differenzierung von drei analytisch relevanten Strukturebenen (kommunikativer Gattungen): So unterscheidet Günthner kommunikative Gattungen anhand ihrer Binnenstruktur, zu der verbale, paraverbale und non-verbale Elemente gehören, der situativen Realisierungsebene, die sich aus den interaktiven bzw. dialogischen Aktivitäten der Beteiligten ergeben (Sprecherwechsel, Höreraktivitäten, Sequenzabfolgen u.v.m.) und der Außenstruktur, die die Verbindung zu institutionellen und medialen Handlungszusammenhängen herstellt (Günthner 1995, Günthner/Knoblauch 1994). Im Hinblick auf die vorliegende Fragestellung ist diese Differenzierung deshalb nützlich, weil sie es ermöglicht, interaktive, mediale und diskursive Aspekte im kommunikativen Vollzug sequenzanalytisch zu erfassen und zu verbinden (Meer 2009). Nun weist Sager darauf hin, dass Günthners Konzept „eher auf kommunikative Einheiten bezogen werden kann, die unterhalb der Gesprächsebene anzusiedeln“ sind und macht dies an Günthners Unterscheidung zwischen Gattungen unterschiedlicher Komplexität fest (2000, 1465). Der Annahme Sagers, dass die Differenzierung von Gattungen unterschiedlicher Komplexität ein Votum für die Beschränkung auf empirische Fragmente sei, kann mit Günthner und unter Bezug auf das hier relevante empirische Material 8 entgegengehalten werden, dass die Stärke des Gattungsbegriffs gerade darin besteht, dass er es erlaubt, sprachliche Phänomene unterschiedlicher Komplexität und zwar sowohl in (prototypischer) Reinform als aber auch Hybrid vermischt mit Versatzstücken anderer Gattungen zu analysieren. Letzteres ist gerade im Hinblick auf aktuelle Medienformate, die schon aus der Perspektive des Entertainments auf Mischformen unterschiedlicher Gattungen zurückgreifen müssen, von entscheidender Bedeutung. Insoweit erlaubt es das Gattungskonzept neben seiner gesprächsanalytischen Orientierung die konstitutive Heterogenität bzw. Hybridität kommunikativer Großgattungen in der Politik zu beschreiben (siehe dazu exemplarisch Abschnitt 4.1, in dem die Funktion der Minimalgattung „Zwischenruf“ im Rahmen der komplexeren Gattung der Parlamentsdebatte genauer untersucht wird). An diese Überlegungen anschließend soll im Weiteren zusätzlich auf die Idee der Gattungsfamilie zurückgegriffen werden, die sowohl von Günthner (1995, 200) als auch von Holly (1993, 194) im Rückgriff auf Bergmann und Luckmann (1995) angesprochen wird und zusätzlich in ähnlicher Form von Ilie unter Bezug auf Faircloughs „Genre“Begriff aufgegriffen wird (Ilie 2010, 8f.). So erlaubt es der Begriff der Gattungsfamilie unterschiedliche (mehr oder weniger) komplexe Gattungen anhand eines oder mehrerer Merkmale zu subsumieren, ohne bestehende Unterschiede zwischen den einzelnen „Sub-Gattungen“ (ebd.) zu ignorieren. Aus einer solchen Perspektive kann beispielsweise der große Bereich parlamentarischer Gattungen als 9 Gesprächssorten in der Politik Gattungsfamilie begriffen werden, innerhalb dessen dann unterschiedliche Teilgattungen empirisch untersucht werden können (siehe Abschnitt 4.1). Ähnliches gilt für die Gattungsfamilie der politischen Talkformate, in deren Rahmen nach spezifischen Formaten wie Interviews, Diskussionsshows oder Rededuellen differenziert werden kann (siehe Abschnitt 4.2). Dabei ermöglicht es die Annahme von Gattungsfamilien vor allem in empirisch noch weniger erschlossenen Bereichen (wie den hier vorliegenden), einen hypothetischen Zugang mit der Perspektive auf schrittweise Ausdifferenzierung (siehe dazu Abschnitt 4. dieses Beitrags). Insgesamt müssen somit unter dem hier verhandelten Bereich der „politischen Gesprächssorte“ heterogene Aspekte unterschiedlicher theoretischmethodischer Herkunft subsumiert werden, die es erlauben, interaktive Dialogformaten aus dem Praxisbereich politischer Kommunikation anhand sequenzieller und funktionaler, medialer und diskursiver Kriterien typologisch zu bestimmen. Interessant scheint von den genannten Konzepten aus der Perspektive ganzer Gespräche vor allem der Gattungsbegriff zu sein, da er es erlaubt, konkrete Gesprächsphasen typologisch zu erfassen, ohne sich damit festzulegen, ob das gesamte Gespräch beispielsweise als „Diskussion“ oder als „Expertenreferat“ oder als „Streitgespräch“ bezeichnet werden kann. Dies ist vor dem Hintergrund der angesprochenen empirischen Desiderate von entscheidender Bedeutung, um nicht vorschnell den differenzierten Formaten eine bestimmte Funktionen zuzusprechen, die aus empirischer Sicht nur für Teilpassagen gelten. 3. Zur interaktive Konstitution des „Politischen“ Zunächst soll hier auf einige allgemeine Tendenzen eingegangen werden, die ausgehend von den vorliegenden empirischen Untersuchungen zu politischen Gesprächen als konstitutiv für die interaktive Konstitution des Politischen angesehen werden können. Fehlende Dialogizität: Immer wieder wird im Zusammenhang mit politischen Gesprächssorten aus unterschiedlichen Perspektiven auf die fehlende bzw. unzureichende Dialogizität politischer Formen der Interaktion verwiesen. Während im Zusammenhang mit Bundestagsdebatten hierfür vor allem institutionelle Regelungen wie die Zuteilung des Rederechts, die Festlegung der Themenabfolge und die Zulässigkeit konkreter Sprechhandlungen verantwortlich gemacht werden (vgl. Burkhardt 2003, 283ff; 2005, 87ff.; Klein 1991, 246; 2000, 1590), werden im Kontext von Wahlkampfduellen und Talkshows vorrangig strategische Überlegungen hinsichtlich des Wahlerfolgs (Bucher 2007, 19ff.) bzw. der eigenen Position innerhalb der Partei genannt (Niehr 2000, 242ff.). Unter Bezug auf Talkshows dominieren an dieser Stelle Hinweise auf mediale Aspekte, die sich aus der trialogischen Gesprächssituation zwischen den Gästen, dem Moderator/der Moderatorin und dem Fernsehpublikum ergeben (Diekmann 1981, 218ff.; Habscheid/Klemm 2007, 1f.; Weidner 2009, 39ff.). In diesem Zusammenhang findet sich auch die Einschätzung, es könne nicht von „echten“ Gesprächen im Sinne eines dialogischen Meinungsaustausch oder einer Sachdiskussion gesprochen werden, sondern es handele sich bei Gesprächssorten in der Politik Bundestagsdebatten um Aktivitäten eines „Schaufensterparlaments“ (Burkhardt 2003, 6) und im Zusammenhang mit Formaten des politischen Talks um „Debattenshows“ (Grewenig 2005, 243). Grewenig verweist an dieser Stelle im Anschluss an Meyer/Schischa (2002) einerseits auf die Tendenz des „Entertainment(s) in der Politikvermittlung“, andererseits auf den Inszenierungsdruck, der auf PolitikerInnen lastet, indem es darum geht, die Positionierung zu Sachfragen immer mit Formen der Imagepflege zu verbinden (Diekmannshenke 2005, 266.; Grewenig 2005, 242f.). Eher selten finden sich an dieser Stelle konkrete Hinweise wie bei Buri (1992, 115ff.) und Zima (2013, 87), die am Beispiel von Bundestagsdebatten darauf herausarbeiten, dass sich trotz allem „tatsächlich dialogische Sequenzen“ finden. Konkret nennen Buri und Zima spontane Turnwechsel zwischen einem Redner und dem Parlamentspräsidenten bzw. Zwischenrufbzw. Zwischenfragesequenzen (siehe dazu in diesem Beitrag Abschnitt 4). Darüber hinaus gibt Zima zu bedenken, dass die generelle Diagnose fehlender Dialogizität den Austausch von Argumenten auf inhaltlicher Ebene verfehlt (dies., 86). Eine insgesamt gegenläufige Tendenz, eher die Steigerungsmöglichkeiten von Formen der Interaktion und des Dialogs zu unterstreichen, zeigt sich in Veröffentlichungen zu Formen politischer Kommunikation im Rahmen von media-watch-Portalen und filterstyle Weblogs. Hier betont Fraas (2004) als Folge der netzbedingten Globalisierung eher die (tendenziell subversiven) politischen Möglichkeiten der direkten politischen Reaktion vor allem im Rahmen politischer 10 Großereignisse (ebd. 88-97). Allerdings deuten in anderen Untersuchungen zu Politikerchats (Diekmannshenke 2005) oder Wahlkampfblogs (Domke 2007) auch entgegengesetzte Befunde darauf hin, dass die ursprüngliche Tendenz dieser Text-/Gesprächssorten zu einem gleichberechtigten „Streitgespräch“ zwischen „Politiker(inne)n und mündigen Bürger(inne)n“ (ebd. 258) in der Praxis z. B. von den Parteien schrittweise zurückgenommen wird (zur Ambivalenz dieser neuen Kommunikationsformen siehe auch Meinhof 2007). Politainment und Confrontainment: Seit der Privatisierung von Rundfunk und Fernsehen Anfang der 90er Jahre sind Fragen der Medialisierung von Politik bzw. politischer Kommunikation kontinuierlich unter den Begriffen des Politainments (Dörner 2001) bzw. Confrontainments (Holly 1993, 192-194) gefasst worden. Immer wieder wurden diese Aspekte als Antwort auf die Frage der spezifischen „Inszeniertheit“ von Politik diskutiert, eine Frage, die allerdings im Zusammenhang anderer politischer Settings (beispielsweise von Bundestagsdebatten) bereits lange vor der Einführung von Privatsendern gestellt wurde (Diekmann 1981, 255ff.; Edelmann 1990). Verstanden werden unter den Begriffen „Politainment“ und „Confrontainment“ Verfahren der `Personalisierung´, `Emotionalisierung´, `Dramatisierung´, `Skandalisierung´, `Simplifizierung´“ (Grewenig 2005, 247; Habscheid/ Klemm 2007, 1f.), aber auch Verfahren der Inszenierung von Konfrontation zum Nutzen aller Beteiligter (Holly 1993, 194). Beide Tendenzen zielen darauf ab, politische Sachverhalte auf eine für ZuschauerInnen möglichst Gesprächssorten in der Politik unterhaltsame Art und Weise in der Tradition amerikanischer „CombatShows“ zu präsentieren. Nicht selten ist diese Diagnose mehr oder weniger explizit geknüpft an die idealtypische Vorstellung, dass der jetzige medial überformte Zustand politischer Gespräche zu unterscheiden sei von einer idealen, am Sachargument demokratischer Meinungsbildung orientierten ursprünglichen Art politischer Kommunikation (siehe dazu Burkhardt 2003, 86 f.; Effing 2005, 226f.). Hier wäre im Anschluss an die angesprochenen diskurstheoretischen Überlegungen Foucaults allerdings deutlicher herauszuarbeiten, dass die beobachtbaren Tendenzen des Politainments als historisch spezifische, medial und institutionell hergestellte Diskursmechanismen zu verstehen sind. Dieser Aspekt kommt vor allem in konversationsanalytischen Studien dort zum Tragen, wo im kommunikativen Detail untersucht wird, wie genau die Beteiligten mit ihren Möglichkeiten umgehen und welche Spielräume hierbei innerhalb des Korpus deutlich werden. In einem solchen Zusammenhang verweist Holly (1993) am Beispiel des politischen Interviews darauf, dass diese Gattung zwar im Sinne Wittgensteins anhand von „Familienähnlichkeiten“ beschrieben werden kann, es sich aber dennoch um ein „sehr variable(s) Muster“ handelt, das interaktionell realisiert werden muss (ebd., 165). Dieser Ansatz liegt sehr nahe bei der oben referierten diskursanalytischen Annahme, konkrete kommunikative Verhaltensweise als Teil eines diskursiven Möglichkeitsfeldes zu begreifen (siehe dazu Brock/Meer 2004, 200. Diskursive Fragmente/Strukturen des Politischen: Wie bereits erwähnt kommt 11 die Relevanz diskursiver Mechanismen hinsichtlich der Konstitution mündlicher Kommunikation in der Politik im Rahmen vorliegender Untersuchungen nur am Rande bzw. indirekt in den Blick. Zu nennen wäre hier beispielsweise eine Untersuchung von Zima zu Zwischenrufen in österreichischen Parlamentsdebatten (2013). Zima untersucht ein Korpus gesprächsanalytisch transkribierter Zwischenrufsequenzen aus 29 Parlamentsdebatten (der Jahre 20032009). Auch wenn es der Verfasserin nicht primär um Aspekte des politischen Diskurses geht, sondern um die Integration kognitionstheoretischer und interaktioneller Analyseansätze am Beispiel dialogischer Resonanz (ebd., 3), so gelingt es ihr doch, in ihrer konstruktionsgrammatischen argumentierenden Arbeit im Detail nachzuweisen, wie auf unterschiedlichen sprachlichen Ebenen (morphologisch, syntaktisch, semantisch und pragmatisch) Resonanz im politischen Dialog interaktiv erzeugt wird. Insoweit liefern ihre Detailbeobachtungen eine Vielzahl von empirischen Ansatzpunkten, die diskursanalytisch genutzt werden könnten (siehe dazu im Detail Abschnitt 4.1 dieses Beitrags). Jenseits der konkreten Fragestellung Zimas ist an ihren Beobachtungen bezogen auf den Gegenstand dialogischer politischer Interaktion entscheidend, dass die Verfasserin den Blick konversationsanalytisch geschärft weg von den Begrenzungen des Diskurses hin zu den interaktionellen Möglichkeiten innerhalb eines diskursiven Feldes lenkt. Einen anderen Ansatzpunkt bilden die Beobachtungen Burkhardts zur Gesprächssorten in der Politik Relevanz von Methapern im politischen Diskurs von Bundestagsdebatten (2003, 369ff.). Ohne explizierte methodische Anbindung listet Burkhardt grundlegende Metaphernfelder des politischen Diskurses der Bundesrepublik Deutschland. Konkret nennt er die Metapher des „Gebäudes“, des „Schiffs“, „der „Krankheit“ und des „Kampfes“, so wie weitere spezialdiskursive Bildspendebereiche wie den des „Körpers“, des „Theaters“ oder den des „Sports“, die ebenfalls entscheidende Funktionen im politischen Diskurs erfüllen (ebd. 380 ff.). Auch diese empirischen Beobachtungen aus dem Bereich der mündlichen Kommunikation lassen sich diskurstheoretisch fundiert mit Überlegungen Links zur Funktion von Kollektivsymbolen im politischen Diskurs der Bundesrepublik Deutschland verbinden. Unter der Begrifflichkeit der Kollektivsymbolik subsumiert Link „die Gesamtheit der sogenannte `Bildlichkeit´ einer Kultur, die Gesamtheit ihrer am weitesten verbreiteten Allegorien und Embleme, Metaphern, Exempelfälle, anschaulichen Modelle und orientierenden Topiken, Vergleiche und Analogien“ (1997, 25). Ausgehend von dieser Grundannahme fasst Link Kollektivsymbole als komplexe Vereinigungen von einem oder mehreren bildlichen Elementen, der Pictura (P), mit einem oder mehreren Sinnelementen, der Subscriptio (S) (Link 1984, 7; 1985, 168ff.; Link/Paar 1990, 115). Ausgehend von dieser Definition gelingt es ihm beispielsweise, Kollektivsymbole wie das des Schiffs/Boots im Bereich des politischen Diskurses systematisch zu analysieren: So wird das metaphorische Symbol des Schiffs/Boots (als Pictura) vielfach genutzt, um (auf der Ebene der 12 Subscriptio) Europa zu symbolisieren, und hieran unterschiedliche politische Botschaften (Subscriptiones) anzuschließen: Europa kann bildlich als hermetisch abgeschotteter Hochseetanker (P1) dargestellt werden (WAZ, 9.7.2013, 2), dessen Kapitän (P2) vor Lampedusa (P3) zuschaut, wie ein Flüchtling im Meer ertrinken (P4), während der Papst (P5) als Rettungsringe getarnte Beerdigungskränze (P6) ins Meer wirft. Jeder Pictura sind ein oder mehrere Subscriptiones zugeordnet. Häufig werden die Subscriptiones im Kontext des jeweiligen Symbols explizit benannt, teils sind sie aber auch politisch so eindeutig kodiert, dass sie nicht mehr in jedem Fall explizit benannt werden müssen. Die Funktion von Kollektivsymbolen sieht Link aus diskursanalytischer Perspektive darin, dass Kollektivsymbole aufgrund ihrer doppelten semiotischen (bildlichen und sprachlichen) Kodierung zum einen für RezipientInnen unmittelbar evident sind, zum anderen besonders geeignet sind, unterschiedlichste Aspekte moderner (arbeitsteiliger) Gesellschaften diskursiv zu integrieren (Link 1983, 924). Darüber hinaus sind Kollektivsymbole anschlussfähig an Topoi wie „die Gefahr des Untergangs“ oder Argumentationsstrukturen wie „das Boot ist voll“ oder „humanitäre Hilfe für die Flüchtlinge vor Ort“ oder (theoretisch) „die Öffnung europäischer Grenzen“, alles diskursive Fragmente, die ihrerseits wieder Kollektivsymbole sind. Der Ansatz Links lässt sich somit nicht nur mit vorliegenden Beobachtungen der linguistischen Diskursanalyse zu schriftlichen Textsorten verbinden, sondern ist ausgehend von Foucaults Annahme der Gesprächssorten in der Politik diskursiven Position mit der Idee des „Besetzens kontroverser Begriffe“ (Stötzel/Wengeler 1995; Wengeler 2005) interaktionell operationalisierbar, indem danach gefragt werden kann, wie Kollektivsymbole politisch im Rahmen mündlicher Gesprächssorten argumentativ eingesetzt werden. Die Ausweitung solcher vereinzelten Hinweise auf die Relevanz diskursiver Parzellen für den Bereich der mündlichen Kommunikation und deren Bedeutung für die kommunikative Gestaltung politischer „Streits“ um unterschiedliche diskursive Positionen steht empirisch bisher noch aus. Hier würde es sich aus konversations- bzw. gesprächsanalytischer Sicht anbieten, Hochwertwörter (Burkhard 2003, 352ff.; Wengeler 2005), Kollektivsymbole (Link 1985, 168ff.) und Metaphern (Burkhardt 2003, 369; Niehr/Böke 2003, Böke 1996a) systematisch im konkreten interaktiven Vollzug ihrer Realisierung unterschiedlicher diskursiver Position und deren Funktion für die jeweilige Auseinandersetzung zu betrachten. Ob sich hierbei allerdings eine genuine Verbindung zwischen einzelnen Textsorten und den genannten diskursiven Strukturen belegen lassen wird, wie Knobloch dies für den Zusammenhang zwischen dem PolitTalk und der Mitte-Extreme-Topik behauptet (2005, 129), muss vorläufig offen bleiben. Auch wenn ein solcher Zusammenhang nicht abwegig ist, so deutet aus diskurstheoretischer Sicht jedoch alles darauf hin, dass die MitteExtreme-Topik beispielsweise den gesamten politischen Diskurs der Bundesrepublik Deutschland dominiert und somit in allen politischen Gesprächssorten nachweisbar sein müsste. Dennoch hat Knobloch natürlich Recht, wenn er herausstellt, dass der 13 Proporz in Talkshows das politische Spektrum interaktiv re-inszeniert und insoweit als Gattung der „Mitte“ verstanden werden kann (ebd., 129). Dies gilt aber ebenso für Bundestagsdebatten, die die genannten Topiken über die proporzionale Sitzverteilung- und Anordnung im Parlament zwar institutionell anders absichern, interaktionell aber den gleichen Effekt erzielen dürften. Parainteraktive Kommunikation/Relevanz der Zuschauer: Vor dem Hintergrund der starken medientheoretischen Überlegungen der letzten Jahre ebenfalls überraschend ist die Feststellung, dass die Position der ZuschauerInnen im Zusammenhang mit politischen TVFormaten zwar immer wieder genannt wird (Schütte 1996, 102; Weidner 2009; 46), im Zusammenhang mit politischen Formaten interaktionell bisher jedoch kaum umfassender empirisch untersucht worden ist. Zwar erwähnt Bucher in seiner Analyse der KanzlerkandidatInnen-Duelle von 2002 und 2005 die durch Befragungen ermittelte Zuschauerkritik der fehlenden Dialogizität des ersten Duells, aber über unmittelbarer Zuschauerreaktionen auf die vielfältigen parainteraktiven Angebote politischer TV-Formate kann bisher nur spekuliert werden. Dabei hätte sich dies vor dem Hintergrund des DFG-Projekts „Über Fernsehen sprechen“ beinahe zwingend angeboten (Holly/Püschel 1993; Holly/Püschel/Bergmann 2001). Die Untersuchungen Meers zu Formen der Anschlusskommunikation unter TVRezipientInnen in nicht-politischen Daily-Talk-Formaten, die ebenfalls wie Knobloch (2005) dies für politische Formate herausarbeitet, über die metaphorische Mitte-Extreme-Topik organisiert ist, legen in diesem Gesprächssorten in der Politik Zusammenhang zumindest die Vermutung nahe, dass auch die Kommunikation von FernsehzuschauerInnen Anschlusspositionierungen unter Nutzung dieser Topik erwarten lässt (Meer 2003, 255-261). Ähnliche Vermutungen könnten sich themenabhängig hinsichtlich der Vertikaltopik „oben“ vs. „unten“ in Positionierungen wie „die da oben“ und „wir hier unten“ bestätigen. 4. Exemplarische Analysen Da die am besten untersuchten Bereiche dialoglisch-interaktiver Kommunikation im politischen Praxisbereich in den Beiträgen 4.7.1 - 4.7.4 umfassend betrachtet werden, sollen im Folgenden vor allem die angesprochenen Probleme einer Typologisierung dialogischer Politikformate im Mittelpunkt stehen. Leitend ist hierbei die Idee der Gattungsfamilie, mit der auf der Grundlage vorliegender empirischer Untersuchungen versucht werden soll, typische Phänomene politischer Gespräche zu bündeln und sich somit schrittweise auf eine typologische Diagnose konkreter Gattungen hin zu bewegen. 4.1 Parlamentarische Gattungen Obgleich parlamentarische Gespräche bezogen auf Parlamentsdebatten zu den am besten untersuchten dialogischen Formaten des politischen Praxisbereichs gehören, lassen sich die angesprochenen methodologischen und typologischen Probleme der Untersuchung politischer Gespräche auch hier wiederfinden: Heterogene methodische Ansätze, empirisch strittige Datengrundlagen und eine Vielzahl von Gesprächen, die sich dem empirischen Zugang entzieht 14 (Klein 2000, 1592). Gleichzeitig stellen gerade diese Hinweise eine Begründung für die Annahme einer Gattungsfamilie „parlamentarische Gespräche“ dar, da eine solche Sammelkategorie den Blick zunächst einmal auf die Frage der Gemeinsamkeiten unterschiedlicher parlamentarischer Gattungen lenkt. Bisher wird die Untersuchung parlamentarischer Gattungen in der vorliegenden Literatur eindeutig dominiert durch die Untersuchung von Plenardebatten, die aufgrund ihrer vergleichsweise leichten Zugänglichkeit zumindest in linguistischen Analysen zum Prototypen parlamentarischer Kommunikation avancieren, eine Annahme, die allerdings mit einigen Problemen verknüpft ist. Zunächst einmal muss vor dem Hintergrund der vorliegenden Erkenntnisse zu Parlamentsdebatten davon ausgegangen werden, dass es sich bei Parlamentsdebatten nicht um eine Gattung bzw. Gesprächssorte im linguistisch-typologischen Sinn handelt. So sind `Parlamentsdebatten´ in erster Line ein juristisch und politisch definiertes Format, das jenseits jeglicher linguistischer Analyse als mündliche Form der legislativen (und teils, beispielsweise in der Schweiz, exekutiven) Entscheidungsfindung juristisch bindend festgeschrieben ist. Hierbei ist zumindest für die aktuellen Formen der Parlamentsdebatten zu konstatieren, dass die in Parlamentsdebatten diskutierten Fragen im Regelfall bereits entschieden sind, wenn sie öffentlich verhandelt werden (siehe dazu u.a. Buri 1992, 25; Burkhard 2003, 248 (Zima 20013, 86); Klein 2000, 1594). Die juristisch und politisch definierte Funktion der Debatten besteht also in der Mehrzahl der Fälle nicht im (entscheidungsoffenen) dialogischen Gesprächssorten in der Politik Austausch von Argumenten, sondern erfüllt trialogische Funktionen, indem zum einen der formelle Akt der juristischen Entscheidungsfindung durch die Debatte öffentlich (und damit justiziabel) vollzogen wird und innerhalb dieses legislativen Rituals (Buri 1992, 25; Edelmann 1990) die Öffentlichkeit über die relevanten Argumente und Positionierungen informiert wird. Allerdings stellt die dritte, kommunikativ relevante Dimension dieses `Trialogs´ (Parlament vs. Öffentlichkeit) aufgrund ihrer Unidirektionalität keine Form des dialogischen Austauschs dar. Insoweit hat die weiter oben angesprochene Diagnose der fehlenden Dialogizität politischer Kommunikation bezogen auf Parlamentsdebatten hier einige ihrer Ursachen: Die dominant juristisch definierte Kommunikationssituation führt dazu, dass vorformulierte (konzeptionell schriftliche) Reden abgelesen werden, den RednerInnen bekannte Argumente ausgetauscht werden und eine Reaktion hierauf dialogisch mit deutlicher Verzögerung erst in den späteren Reden des politischen Gegners erfolgt. Insoweit ist die Frage, ob es sich bei dieser Art der Debatte tatsächlich um „Gespräche“ handelt (Burkhardt 2003, 117ff.; Klein 2000, 1589), durchaus berechtigt. Aus der Sicht der empirischen Gesprächs- und Konversationsanalyse muss es vor dem skizzierten Hintergrund vor allem darum gehen, unterhalb des „Großkomplexes“ Parlamentsdebatte danach zu fragen, ob sich eingelagerte kleinere oder größere Gattungen (wie z.B. Zwischenrufe oder Zwischenfragen) sowie Fragestunden/aktuelle Stunden) finden, die die Kriterien eines Dialogs (im Sinne eines mehr oder weniger moderierten 15 interaktionellen Austauschs zwischen GesprächspartnerInnen) erfüllen und darüber hinaus empirisch zugänglich sind (siehe Buri 1992, 116ff.). Aus einer solchen Perspektive bleiben im Umfeld von Parlamentsdebatten vergleichsweise wenige Ansatzpunkte. Vorliegende Untersuchungen unterstreichen die angesprochenen Probleme häufig insoweit, als sie vor allem typische Sprechhandlungsmuster bzw. eingelagerte kommunikative Muster wie „Diskussionen“, „Debatten“, „Verhandlungen“, aber auch kleiner Einheiten wie „Frage-AntwortSequenzen“, „Vorwürfe“ oder „Rechtfertigungen“ diagnostizieren (Burkhardt 2003, 283ff.; zusammenfassend siehe Klein 2000). Jenseits der teils begründeten Zweifel am analysierten Material einiger Untersuchungen zu Bundestagsdebatten, das in der Regel aus den offiziellen Protokollen des Bundestags besteht und wie Zima überzeugend zeigen kann, nicht den Anforderungen eines gesprächsanalytischen Zugangs entspricht (2013, 109-114), lassen die Ergebnisse vielfach keine empirisch hinreichend abgesicherten Schlüsse hinsichtlich eines im linguistischen Sinne kohärenten Gesprächsmusters (und damit der Annahme einer Textsorte oder Gattung) zu. Vor dem Hintergrund dieser Probleme ist es nicht verwunderlich, dass ausgerechnet die Untersuchung von Zwischenrufen in Plenardebatten mit den Arbeiten von Burkhardt zu Zwischenrufen im deutschen Bundestag (2004) und von Zima (2013) zu Zwischenrufen im Österreichischen Nationalrat sich zu einem kleineren Forschungsschwerpunkt innerhalb der Gattungsfamilie entwickelt hat: Gesprächssorten in der Politik Zwischenrufe durchbrechen die konstatierte fehlende Dialogizität von Parlamentsdebatten, sie sind ein nicht im Detail planbares Element direkter Interaktion und darüber hinaus nicht nur über die (schriftsprachlich geglätteten) Protokolle der Parlamente zugängig, sondern anhand vorliegender Videodaten – wie Zima im Detail verdeutlicht – auch als gesprächsanalytisch rekonstruiertes Transkript nutzbar (ebd., 109-114). Zwischenrufe können mit Buri (1992, 116) aus gesprächsanalytischer Sicht als Zwischenrufsequenzen definiert werden, in denen ein Zwischenruf zu einer erneuten Reaktion durch die PlenarrednerInnen führen kann. Burkhardt (2004: 602ff.) spricht hier von „Minidialogen“, die er auf der Grundlage von Bundestagsprotokollen anhand von 5 Kategorien typologisiert, Zima (2013) untersucht Zwischenrufe auf der Grundlage gesprächsanalytisch transkribierter Sitzungen österreichischer Parlamentsdebatten aus der Perspektive der kreativen Resonanz. Obgleich dies nicht der Ort ist, um beide Ansätze ausführlich vorzustellen (siehe dazu auch Burkhardt in anschließenden Kapitel 4.7.1) und zu diskutieren, so sei doch auf einige grundsätzliche Aspekte hingewiesen. Burkhardt (2004, 166-387) typologisiert Zwischenrufsequenzen aus der Perspektive der verwendeten Techniken, aus syntaktischer und semantischer Perspektive (Kohärenz), aus der Perspektive der „Provokation“ und unter Bezug auf die genutzten Sprechhandlungen. Bereits die Auflistung der einzelnen Kategorien verdeutlicht die Heterogenität des analytischen Zugangs. Insoweit ist es nicht verwunderlich, dass Zima im Rahmen ihrer detaillierten Diskussion 16 der Befunde Burkhardts auf eine Vielzahl von Unklarheiten, Mehrfachklassifikationen und Widersprüchen stößt (2013, 91-109). Zima geht diesen Problemen aus zweifacher Perspektive dem Weg: Zum einen beschränkt sie sich darauf, Zwischenrufsequenzen aus kognitionstheoretischer und interaktioneller Perspektive auf die Frage hin zu untersuchen, wie Parlamentsmitglieder explizit oder implizit mit ihren Möglichkeiten der Resonanz umgehen bzw. wie sie diese erzeugen. Zum anderen nutzt sie die die konstruktionsgrammatische Annahme, dass kommunikative Phänomene komplexe Form-Inhalt-Einheiten darstellen (ebd., 37ff.). In der Folge kann sie auf eine kohärentes Analyseinstrumentarium zurückgreifen, dass es ihre erlaubt, formale (phonologische, morphologische, syntaktische) und inhaltliche (semantisch-lexikalische, pragmatische und kulturspezifische) Aspekte bereits integriert zu erfassen (ebd., 123f.). Konkret untersucht die Verfasserin, wie Zwischenrufer Teilaspekte der Äußerungen von PlenarrednerInnen in Form von syntaktischen, lexikalischen, morphologischen Parallelismen aufgreifen und sie entweder zum Zweck der Zustimmung oder der Kritik in den eigenen Zwischenruf integrieren. Diese Formen der kreativen Resonanz lösen in vielen Fällen erneut Anschlussreaktionen bei den adressierten RednerInnen aus (ebd., 119ff.). Insgesamt gelingt Zima auf diesem Weg, im Rahmen ihrer Untersuchung nicht nur die Entwicklung einer kohärenten Typologie von Zwischenrufsequenzen, sondern auch die gesprächsanalytische Verdeutlichung genuin dialogischer Gesprächssorten in der Politik Elemente im Rahmen von Parlamentsdebatten. Jenseits des interaktionellen Mehrwerts der skizzierten Studie ergibt sich hinsichtlich der Spezifik des politischen Diskurses im Rahmen von Zwischenrufsequenzen jedoch eine interessante Anschlussperspektive: In Abgrenzung zu Burkhardt weist Zima darauf hin, dass Zwischenrufe (bezogen auf ihre Daten) nicht – wie Burkhardt herausstellt (2004, 277) – bevorzugt im Anschluss an Hochwert-, Schlag- oder Fahnenwörter auftreten (Zima 2013, 97). Was sie im Weiteren jedoch nicht thematisiert, ist die Tatsache, dass im Rahmen des in ihrer Arbeit präsentierten empirischen Materials Zwischenrufsequenzen deutlich überproportional häufig im Anschluss an den Gebrauch von Kollektivsymbolen zu beobachten sind. Interaktionell ergibt sich eine Vielzahl kurzer Sequenzen des Disputs, die wechselseitig auf das jeweilige Kollektivsymbol aufbauen. Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass Kollektivsymbole im weiter oben eingeführten Sinn tatsächlich ein überproportional hohes Potenzial besitzen, auf bildlicher oder semantischer Ebene Reaktionen auszulösen. Würde sich dies im Rahmen einer empirischen Untersuchung bestätigen, so wäre weiter zu prüfen, ob die von Burkhardt behauptete hohe Frequenz von Hochwertwörtern sich nicht doch tatsächlich auf der Bedeutungsebene der Symbole als Subscriptio finden lässt. Dieser von Zima nicht kommentierte Zusammenhang könnte im Anschluss an Links These, dass sich mit Kollektivsymbolen aufgrund ihrer doppelten (bildlichen und sprachlichen) Verankerung (politisch) besonders gut 17 streiten lässt (Link 1983, 11), gesprächsanalytisch weiterverfolgt werden. Hierbei müsste zum einen aus semiotischer Sicht die Relevanz bildlicher Elemente auf der Binnenstrukturebene der Gattung „Zwischenruf“ zusätzlich berücksichtigt werden, und zum anderen könnte die Relevanz von Kollektivsymbolen für die interaktionelle Realisierung politischer Streitgespräche im Rahmen von Parlamentsdebatten systematischer ausgewertet werden. Hinsichtlich der Frage der Typologisierung ganzer Gesprächssorten bzw. Gattungen ist unter Bezug auf beide Arbeiten festzuhalten, dass Zwischenrufsequenzen, da sie immer in Debatten integriert auftreten, nicht sinnvoll der Status einer Gesprächssorte zugesprochen werden kann. Dennoch stellen sie im Sinne Günthners eine Minimalgattung dar, die sowohl anhand ihrer sprachlichen Binnenstruktur (vgl. Zima 2013, 120), als auch in ihrem interaktionellen Ablauf und ihrer institutionellen und situationalen Verortung als Muster beschrieben werden können. Insgesamt lässt sich im Hinblick auf die Klassifikation kommunikativer Gattungen zur Gattungsfamilie „Parlamentsgespräche“ bisher nur Heterogenes festhalten. Wären weitere Formate wie Ausschusssitzungen oder Fraktionsdebatten zugänglich, so würde einiges dafür sprechen, das Geflecht dieser aufeinander bezogenen Formate als Teile einer Gattungsfamilie zu untersuchen. Da aber der gesamte Bereich dieser Gattungsfamilie auch in Zukunft empirisch kaum zugänglich sein wird, lässt sich die Hypothese eines Gattungsverbunds nur in Teilen linguistisch überprüfen. Im Hinblick auf Gesprächssorten in der Politik die vorliegenden Untersuchungen scheint es allerdings wahrscheinlich zu sein, dass Plenardebatten als eine rahmende Gattung oder auch Textsorte gefasst werden können, innerhalb derer Zwischenrufe, Zwischenfragen, aber auch aktuelle Stunden als eingelagerte (kleinere) Gattung vor allem auf der interaktionellen Zwischenebene eine entscheidende, dialog-verstärkende Funktion hinsichtlich der Großgattung zukommt. Diese Überlegungen könnten im Weiteren in zwei Richtungen ausgeweitet werden: Zum einen sollten Parlamentsdebatten im Anschluss an Zimas Kritik im Zusammenhang mit Zwischenrufen (Zima 2013, 109-114) nicht nur anhand der stark bearbeiteten Protokolle der Parlamente analysiert werden, sondern unter Nutzung vorhandener Videoaufnahmen in transkribierter Form gesprächsanalytisch detailliert untersucht werden. Zum andern verspricht die Analyse empirisch zugängliche Formate wie der „aktuellen Stunden“ oder Fragestunden in unterschiedlichen Parlamenten weitere empirische Befunde, die die vorliegenden Diagnosen ausdifferenzieren könnten. 4.2 (Politische) Talkformate Im Hinblick auf die Gattungsfamilie der (politischen) Talkformate ist aus empirischer Sicht zunächst einmal festzuhalten, dass der linguistischen Untersuchung von Talkformaten aufgrund der dominant medialen Ausrichtung moderner Politik kaum Grenzen gesetzt sind. TV und Radio bieten hier ganztägig empirisches Material, das problemlos zugängig ist und sich somit zur Analyse des 18 politischen Diskurses geradezu aufdrängt. Schaut man sich vorliegende Typologien zu Medieninterviews oder Talkshows – den beiden Formaten, um die es hier im Weiteren gehen soll - an, so finden sich unterschiedliche Einteilungen, die teils mediale, teils thematische oder auch gesprächsorganisatorische Aspekte dominant setzen (siehe u.a. Burger 1984, 57ff.; Plake 199, 32ff.; Schwitalla 1979, 178ff.), ohne diese Einteilungen jedoch auf den unterschiedlichen, linguistisch relevanten Ebenen zu begründen. Wenn hier also im Weiteren zwischen „Talkshows“ und „Interviews“ unterschieden wird, so ergibt sich dies aus der offensichtlich unterschiedlichen Interaktionsstruktur beider Gattungen: Während es sich hinsichtlich der Außenstruktur bei beiden Formaten um medientypische Formen triadischer Kommunikation handelt, unterscheiden sich die Gattungen im interaktiven Detail jedoch deutlich hinsichtlich der jeweiligen Personenkonstellation. Während in Interviews ModeratorInnen nur jeweils eine/einen (in der Regel prominenten) GesprächspartnerIn interviewen, müssen die ModeratorInnen von Talkshows das Gespräch zwischen mehreren Gästen koordinieren. Insoweit scheint es vor dem Hintergrund der sich hieraus ergebenen gesprächsorganisatorischen Unterschiede einleuchtend, zunächst einmal von zwei unterschiedlichen Gattungen auszugehen. Allerdings wird im Weiteren zu beleuchten sein, wie sich diese gesprächsorganisatorischen Unterschiede auf die sprachliche Binnenund die Außenstruktur auswirken. Trotz der angesprochenen Differenzierung von zwei Gesprächssorten in der Politik unterschiedlichen Gattungen sollen Interviews und Talkshows zunächst einmal als Vertreter einer Gattungsfamilie betrachtet und anhand der folgenden Gemeinsamkeiten charakterisiert werden: a. Zwang zur Positionierung: Im Anschluss an die skizzierten diskursanalytischen Überlegungen kann bezogen auf beide Gattungen festgehalten werden, dass es in beiden hinsichtlich ihrer Außenstruktur darum geht, das Feld dessen, was zum gegenwärtigen Zeitpunkt politisch vertretbar ist, auszuhandeln. Dies wirkt sich sowohl auf interaktioneller Ebene als auch auf die Ebene der sprachlichen Binnenstruktur aus: Interaktionell werden beide Gattungen dominiert vom Zwang der Gäste, sich redend im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu präsentieren sowie von der Verpflichtung der ModeratorInnen bzw. InterviewerInnen, diesen Prozess zu unterstützen (siehe dazu die folgenden Abschnitte b. und c.). Dies geschieht u.a. unter Nutzung von Kollektivsymbolen und Topiken, die das Raster für mögliche Positionierungen abgeben. Dass der/die Interviewte oder die Talkshowgäste diese Möglichkeit der diskursiven Positionierung im Rahmen der unterschiedlichen Talkformate nutzen, scheint dabei eine Selbstverständlichkeit zu sein (siehe dazu Darschin/Zubayr 2002; Holly 1993; Weidner 2009, 47f.). Dass aber auch MedienrezipientInnen von der Möglichkeit der diskursiven Positionierung Gebrauch machen, kann Baldauf-Quilliatre am Beispiel öffentlicher Meinungsäußerungen von AnruferInnen einer französischen Radiosendung zeigen. Im Anschluss an die Anthropologin Strauss beschreibt Baldauf-Quilliatre Formen der 19 öffentlichen Positionierung von RadiozuhörerInnen als „cultural standing“ und versteht hierunter die Positionierung der eigenen Ansicht im Rahmen eines oder mehrerer (kulturspezifischen) thematischer Felder (ebd. 2007, 245). Damit deutet sich sowohl aus der Perspektive der MedienagentInnen als auch aus der Sicht der RezipientInnen an, dass es im Rahmen von Talkformaten um die interaktiv ausgehandelte Besetzung diskursiver Positionen geht (siehe dazu auch Meer 2003, die die gleichen Mechanismen am Beispiel von Täglichen Talkshows verdeutlicht). b. Mechanismus des „Sprechen-Machens“: Vor dem Hintergrund des Zwangs zur Positionierung muss es im Rahmen von Talkformaten darum gehen, die am Gespräch Beteiligten dazu anzuhalten, sich redend zu bestimmten thematischen Aspekten zu verhalten (Holly 1993, Brock/Meer 2004, Weidner 2009). Damit wird hier in kommunikativer Hinsicht der Mechanismus des „Reden-Machens“ und „Reden-Müssens“ wirksam, bei dem es sich Foucault folgend um einen der stärksten Machtmechanismen moderner Gesellschaften handelt (Foucault 1983, 27-50, 84). Dieser besteht in dem Recht, andere in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stellen, sie dazu zu veranlassen, sich selbst, ihr Wissen oder ihre Überzeugungen der überprüfenden Kontrolle anderer frei zu geben (Foucault 1989, 241; Meer 1998, 50-54; Weidner 2009, 105f). Diese Annahme wird in den Untersuchungen von Talkformaten vor allem dadurch unterstrichen, dass es im Rahmen des Talks immer auch um die Frage der Durchsetzung der eigenen Position und damit Aspekte der kommunikativen Hierarchie geht (Holly 1993, Weidner 2009). Gesprächssorten in der Politik c. Konfrontation und Imagearbeit: An den angesprochenen Zwang zur Positionierung anschließend unterstreichen vorliegende Untersuchungen im Zusammenhang mit dem politischen und kommunikativen Kampf um die Besetzung konkreter Positionen die bereits erwähnte Tendenz zu Verfahren des Confrontainments (Brock/Meer 2004, 194; Grewenig 2005; Holly 1993; Klemm/Habscheid 2007). Neu scheint hierbei im Gegensatz zu früheren Formen des Talks zu sein, dass die Konfrontation im Zusammenhang mit der Selbstpositionierung das interaktionell dominierende Mittel der Wahl ist. Politische Unterhaltungen sind für die Beteiligten mit der Verpflichtung verbunden, sich selbst in der konfrontativen Präsentation der eigenen Position durchzusetzen, und dabei die ZuschauerInnen zu unterhalten, gerade indem die Gesprächsbeteiligten das eigene Image erfolgreich präsentieren (Eisenberg 2007, 34; Grewenig 2005, 246; Holly/Püschel/Kühn 1986, 32; Klemm/Habscheid 2007, 2; Weidner 2011, 51). Vor dem Hintergrund dieser allgemeinen Aspekte soll nun im Weiteren die spezifische Realisierung einzelner Gattungen an den Beispielen von „TV-Interview“ und „TVTalkshow“ betrachtet werden. 4.2.1 TV-Interviews Die angesprochene institutionelle Verpflichtung der Interviewten, sich selbst mit den eigenen Redebeiträge im Rahmen der Interviews in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stellen, wird in der Untersuchung von Holly (1993) zur Rolle der Konfrontation im Rahmen von Fernsehinterviews deutlich (ebd., 167). Nicht zufällig 20 stellen hierbei Hollys Überlegungen zur Relevanz von Fragenstrategien (als der einfachsten Möglichkeit, jemanden „reden zu machen“) einen Schwerpunkt der Untersuchung dar. So unterstreicht Hollys materialgestützte Charakteristik der Interviewfragen nicht nur eine erhebliche Variationsbreite in der Fragestrategie des Interviewers (ebd., 171ff.), sondern sie verdeutlicht zusätzlich, dass der Mechanismus des „Reden-Machens“ auch anhand von Vorwürfen (ebd., 181), Behauptungen oder Widerspruch (ebd., 179) des Fragenden kommunikativ realisiert wird. Entscheidend ist hierbei, dass die genannten Sprechhandlungen interaktionell in Teilen die gleiche Funktion erfüllen wie Fragen: Sie werden von den Interviewten als Aufforderung begriffen, die eigene Position in der Konfrontation zu explizieren. Dass der Interviewer hierbei ebenfalls durch eine Vielzahl interaktioneller und institutioneller Abhängigkeiten eingeschränkt wird, kann Holly nicht nur anhand des Vergleichs von zwei unterschiedlichen Interviews des gleichen Moderators verdeutlichen (ebd. 184ff.), sondern es gelingt ihm zusätzlich, die interaktionellen Gegenabhängigkeiten der Gesprächspartner herauszuarbeiten. So kann er bis ins sprachliche Detail (z.B. im Gebrauch spezifischer Abtönungspartikel) nachweisen (ebd., 173), dass der Erfolg beider Gesprächsbeteiligten unmittelbar an den kommunikativen Erfolg des Gegenübers gekoppelt ist. Diese Beobachtung, die Brock und Meer (2004, 200) als typische Formen des Doublebind bezeichnen, unterstreichen damit Foucaults Annahme, dass die Wirkungen moderner Machtmechanismen als Gesprächssorten in der Politik polymorph beschrieben werden müssen, dass Machtwirkungen „nie ganz auf einer Seite sind“ (Foucault 1976, 114f.; Brock/Meer 2004, 201). Nichtsdestotrotz lässt sich im Hinblick auf die Position des Interviewers festhalten, dass dieser aufgrund seines institutionell abgesicherten Fragerechts trotz lokaler Asymmetrien insgesamt in einer bevorrechtigten Position ist. Dass dies unter den Bedingungen des Confrontainment für die ModeratorInnen unter Umständen bedeuten kann, sich selbst als ein in der Sache unterlegener Gegner, aber dennoch als Medienstar zu präsentieren, liegt vor diesem Hintergrund in der Logik modernen Confrontainments begründet (Holly 1993, 193). 4.2.2 TV-Talk In erster Annäherung unterstreichen die vorliegenden Untersuchungen zu TVTalkshows ähnliche Tendenzen, wie dies bereits für Interviews gezeigt wurde. So verdeutlich auch die Arbeit von Weidner (2009) den Aspekten der kommunikativen Ungleichheit zwischen ModeratorInnen und Gästen im Rahmen von Talkshows. Ähnlich wie in Hollys Untersuchung zu Interviews kann Weidner anhand des empirischen Transkriptmaterials der Sendung „hart aber fair“ zeigen, dass dem Moderator politischer Talkshows die Aufgabe zukommt, seine Gäste zum konfrontativen Austausch miteinander anzuhalten (ebd., 48) und diesen zu moderieren (siehe dazu auch Holly/Kühn/Püschel 1986, 53). Anhand der Organisation und Verteilung des Rederechts, der Themensteuerung und des Einsatzes von Frage-AntwortMechanismen verdeutlicht Weidner einerseits, dass der Moderator aufgrund 21 seines institutionellen Auftrags, die Gesprächssituation steuert, dass er selbst aber andererseits nur erfolgreich sein kann, wenn er sich seinen Gästen punktuell unterordnet (Weidner 209, 73f.). Im Anschluss an Foucault macht Weidner deutlich, dass der Moderator (wie der Interviewer) der gesellschaftlichen Überwachung ausgesetzt ist (ebd., 109). Diese Formen der Überwachung durch eine fernsehende Öffentlichkeit und die eigene Sendeanstalt führen dazu, dass der Erfolg des Moderatoren von der erfolgreichen Erfüllung seines institutionellen Auftrags abhängig ist, das Publikum durch die Präsentation von Kontroversen zu unterhalten (ebd., 112). Diesen Aspekt abschließend stellt Weidner unter Verweis auf Meer/Brock heraus, dass dem Moderator innerhalb des kontroversen Feldes „zwar Handelungsalternativen“ bleiben, das diskursive Feld aber „auch die Grenzen des in der institutionellen Situation Möglichen“ vorgibt (ebd., 113). Trotz dieser strukturellen Gemeinsamkeiten mit dem Format des Interviews zeigen die Datenanalysen Weidners deutlich, dass die Tatsache, dass der Moderator nicht nur mit einem Gesprächspartner konfrontiert ist, interaktionell nicht folgenlos bleibt. So finden sich in den Analysen Weidners immer wieder Hinweise, dass die gleichzeitige Anwesenheit mehrer Gäste selbst bereits redeaktivierende Funktionen erfüllt: Durch die Notwendigkeit, die Redebeiträge mehrerer Gäste zu koordinieren, wird die kommunikative Position des Moderator tendenziell gestärkt (ebd., 61), was vor allem an Stellen deutlich wird, an denen der Moderator auf die Nutzung seines Turnzuteilungsrecht verzichtet und damit bei den 22 Gesprächssorten in der Politik Gesprächsbeteiligten Formen der Selbstdisziplinierung in Gang setzt (ebd., 64ff.). Diese Selbstdisziplinierung ist vor allem vor dem Hintergrund der bereits angesprochenen Notwendigkeit der positiven Selbstdarstellung relevant, ein Aspekt, der Holly, Kühn und Püschel (1985) dazu veranlasst hat, die Funktion von Fernsehdiskussionen auf den Aspekt der politischen Wahlwerbung zuzuspitzen (ebd., 254) In jedem Fall provoziert die gleichzeitige Anwesenheit politischer Gegner und die Verpflichtung zur positiven Imagearbeit Formen der Selbstdarstellung mit dem Mittel des politischen Widerspruchs (Weidner 2009, 51ff.). Diese Annahmen bestätigen sich nicht nur im Zusammenhang mit den Rederechtszuteilungen des Moderators, sondern auch hinsichtlich der Möglichkeit der Gäste, sich gegenseitig zu unterbrechen (ebd., 66ff.) oder auch umgekehrt eigene Turns zu expandieren und damit Einfluss auf die Themensteuerung zu nehmen (ebd., 86f.). Hier kann im Anschluss an Holly, Kühn und Püschel (1985, 24; 1986, 6568) festgehalten werden, dass diese gesprächsorganisatorischen Aspekte deutlich durch die Raumaufteilung, die Kameraperspektive und die Sitzordnung der Beteiligten verstärkt und gezielt auf Konfrontation hin gelenkt wird, Feststellungen, die aus heutiger Sicht nur bestätigt werden können. Insoweit lassen sich ausgehend von diesen Befunden deutliche interaktionelle Unterschiede zwischen Interviews und Talkshows ausmachen. Ob und inwieweit die interaktionellen Unterschiede Folgen für die sprachliche Binnenstruktur haben, bleibt ein empirisch zu prüfendes Desiderat. Hinsichtlich der Außenstruktur lässt sich ausgehend von den vorliegenden Erkenntnissen jedoch festhalten, dass die gezielte Verteilung der Redebeiträge auf markierte politische Gegner und deren gezielte Konfrontation im Rahmen von Talkshows ein deutlich pointierteres Mittel darstellt, Formen der konfrontativen Aushandlung politischer Fragen medial zu inszenieren, als dies für Interviews zutrifft. Diese Annahme fügt sich letztendlich bruchlos zur Feststellung Grewenigs (2005), dass politische Talkshows kontinuierlich mit dem Mitteln der gesellschaftlichen Beunruhigung bei anschließender Tendenz zur Beruhigung arbeiten (ebd., 250). Diese Feststellung passt gut zu Weidners empirischen Beobachtung: So ist die Beunruhigung nicht selten eine Folge des gezielt provozierten und nicht zu behebenden politischen Dissens zwischen den Gästen, was die Position der ModeratorInnen als konsens- und lösungsorientierte Instanz im Sendungsverlauf und der Schlussphase erheblich stützt. 5. Ausblick Insgesamt verdeutlicht der vorliegende Überblicksartikel, dass der politische Diskurs sowohl aus medialer Perspektive (Mündlichkeit vs. Schriftlichkeit) als auch aus gattungsspezifischer Sicht in einem Schnittbereich zwischen methodologischen und empirischen Grundsatzfragen angesiedelt ist, die in Teilen erst am Anfang ihrer Bearbeitung stehen. Auch wenn sich in diesem Zusammenhang an vielen Stellen eher Desiderate bzw. weiterführende Fragestellungen abgezeichnet haben, so ist doch deutlich geworden, dass der Bereich der mündlichen Interaktion Gesprächssorten in der Politik nicht nur einen hoch relevanten eigenen Gegenstand im Zusammenhang mit der Analyse politischer Kommunikation darstellt, sondern dass vorhandene methodologische Ansätze durchaus geeignet sind, sich diesem Gegenstand verstärkt empirisch zu nähern. Von besonderem Interesse scheint hierbei eine Annäherung diskursanalytischer und konversationsanalytischer Zugänge zu sein, deren Kompatibilität in der Vergangenheit lange grundsätzlich bezweifelt wurde. Jenseits des erwartbaren Nutzens für die Analyse politischer Gesprächssorten könnten sich gerade im Hinblick auf die zunehmende Relevanz politischer Kommunikation in den neuen Medien hieraus sinnvolle Synergieeffekte für zukünftige empirische Untersuchungen ergeben. Literatur Auer, Peter (1999): Sprachliche Interaktion. Eine Einführung anhand von 22 Klassikern. Tübingen: Niemeyer. Adamzik, Kirsten (2004): Textlinguistik. Eine einführende Darstellung. Tübingen: Niemeyer. Dies. (2010): Sprache: Wege zum Verstehen Tübingen/Basel: Francke. Baldauf-Quilliatre, Heike (2007): Politische Meinungsäußerung im Radio. Oder: Das Problem mit den imaginären Rezipienten. In: Habscheid, Stephan/ Klemm, Michael (Hgg.): Sprachhandeln und Medienstrukturen in der politischen Kommunikation. Tübingen: Niemeyer, 239-254. Beiswenger, Michael (2008): Empirische Untersuchungen zur Produktion von Chat-Beiträgen. In: Sutter, Tilmann/Mehler, Alexander (Hrsg.): Medienwandel als Wandel von Interaktionsformen. Wiesbaden, 47-81. Bergmann, Jörg/Luckmann, Thomas (1995): Reconstructive genres of everyday communication. IN: Quasthoff, Uta M. (Hg.): Aspects of Oral Communication. Berlin: de Gruyter, 289-304. Böke, Karin (1996a): Überlegungen zu einer Metaphernanalyse im Dienst einer parzellierten Sprachgeschichtsschreibung. In: Dies/Jung, Matthias/Wengeler, Martin (Hgg.): Öffentlicher Sprachgebrauch. Praktische, theoretische und 23 historische Perspektiven. Opladen: Westdeutscher Verlag, 431-452. Dies. (1996b): Politische Leitvokabeln in der Adenauerära. In: Dies./Liedke, Frank/Wengeler, Martin (Hgg.): Politische Leitvokabeln in der Adenauer-Ära. Berlin/New York: de Gruyter, 19-50. Dies (1996c): „Flüchtlinge“ und „Vertriebene“ zwischen dem „Recht auf alte Heimat“ und die „Eingliederung in die neue Heimat. Leitvokabeln der Flüchtlingspolitik. In: Dies./Liedke, Frank/Wengeler, Martin (Hgg.): Politische Leitvokabeln in der Adenauer-Ära. Berlin/New York: de Gruyter, 131210. Dies./Jung, Matthias/Niehr, Thomas/Wengeler, Martin (2000): Vergleichende Diskursanalyse. Überlegungen zur Analyse national heterogener Textkorpora. In: Böke, Karin/Niehr, Thomas (Hgg.): Einwanderungsdiskurse. Vergleichende diskursanalytische Studien. Opladen: Westdeutscher Verlag, 11-36. Brock, Alexander/Meer, Dorothee (2004): Macht – Hierarchie – Dominanz – A-/Symmetrie: Begriffliche Überlegungen zur kommunikativen Ungleichheit in institutionellen Gesprächen. In: Gesprächsforschung 5, 184-209. (www.gespraechsforschung-ozs.de). Bucher, Hans-Jürgen (2007): Logik der Politik. Logik der Medien. Zur interaktionalen Rhetorik der politischen Kommunikation in den TV-Duellen der Bundestagswahlkämpfe 2002 und 2005. In: Habscheid, Stephan/ Klemm, Michael (Hgg.) (2007): Sprachhandeln und Medienstrukturen in der politischen Kommunikation. Tübingen, S. 13-44. Buri, Heinz (1992): Argument und Parlament: Versuch der Ermittlung einer Methodologie zur Analyse dialogischer Sequenzen am Beispiel der Nachrüstungsdebatte. München: tuduv. Burkhardt, Armin (2003): Das Parlament und seine Sprache. Studien zu Theorie und Geschichte parlamentarischer Kommunikation. Tübingen: Niemeyer. Ders. (2004): Zwischen Monolog und Dialog. Zur Theorie, Typologie und Geschichte des Zwischenrufs im deutschen Parlamentarismus. Tübingen: Niemeyer. Ders. (2005): Deutsch im Demokratischen Parlament. Formen imd Funktionen der öffentlichen parlamentarischen Kommunikation. In: Kilian, Jörg (Hg.): Sprache und Politik. Deutsch im demokratischen Staat. Mannheim: Duden, 85-98. Darschin, Wofgang/Zubayr, Camille (2002): Politische Diskussionssendungen und Magazine im Urteil der Zuschauer. In: Media Perspektiven 5, 210-220. Dieckmann, Walther (1981): Politische Sprache – Politische Kommunikation. Heidelberg: Winter. Diekmannshenke, Hajo (2005): Mitwirken von allen? Demokratische Kommunikation im Chat. In: Kilian, Jörg (Hg.): Sprache und Politik. Deutsch im demokratischen Staat. Mannheim: Duden, 258-277. Domke, Christine (200/): Werbung, Wahlkampf, Weblogs. Zur Etablierung einer neuen Gesprächssorten in der Politik Kommunikationsform. In: Habscheid, Stephan/ Klemm, Michael (Hgg.) (2007): Sprachhandeln und Medienstrukturen in der politischen Kommunikation. Tübingen, 335-353. Dörner, Andreas (2001): Politainment. Politik in der medialen Erlebnisgesellschaft. Frankfurt a.M: Suhrkamp. Edelmann, Murray (1990): Politik als Ritual. Die symbolische Funktion staatlicher Institutionen und politischen Handelns. Frankfurt/New York: Campus. Eisentraut, Steffen (2007): Polit-Talk als Form demokratischer Öffentlichkeit? „Sabine Christiansen“ und „Hart aber fair“ im Vergleich. Marburg: Tectum Verlag. Ehlich, Konrad/Rehbein, Jochen (1972): Zur Konstitution pragmatischer Einheiten in einer Institution: das Speiserestaurant. In: Wunderlich, Dieter (Hg.) Linguistische Pragmatik. Frankfurt/M.: Athenäum, 209-254. Fix, Ulla (2008): Texte und Textsorten – sprachliche, kommunikative und kulturelle Phänomene. Berlin: Frank&Timme. Foucault, Michel (1976): Mikrophysik der Macht. Über Strafjustiz, Psychiatrie und Medizin. Berlin: Merve Verlag. Ders. (1977): Die Ordnung des Diskurses. Frankfurt a.M.: Ullstein. Ders. (1983): Sexualität und Wahrheit. Der Wille zum Wissen. Frankfurt a.M: Suhrkamp. Ders. (1988): Archäologie des Wissens. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. Ders. (1989): Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Ders. (1994): Das Subjekt und die Macht. In: Dreyfus, Hubert L./Rabinow, Paul (Hgg.): Michel Foucault. Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik. Weinheim: Belz, 243-261. Fraas, Claudia (1996): Gebrauchswandel und Bedeutungsvarianz in Textnetzen. Die Konzepte Identität und Deutsche im Diskurs zur deutschen Einheit. Tübingen: Narr. Dies, (2004): Diskurse on- und off-line. In: Fraas, Claudia/Klemm, Michael (Hgg.): Mediendiskurse. Bestandsaufnahme und Perspektiven. Frankfurt/New York: Lang, 83-103. Dies./Meier, Stefan/Petzold, Christian (2013): OnlineDiskurse. Theorien und Methoden transmedialer Online-Diskursforschung. Köln: Herbert von Halem Verlag. Günthner, Susanne (1995): Gattungen in der sozialen Praxis. Die Analyse „Kommunikativer Gattungen“ als Textsorten mündlicher Kommunikation . In: Deutsche Sprache, 193-218. Dies./Knoblauch, Hubert (1994): `Forms are the Food of Faith´. Gattungen als Muster kommunikativen Handelns. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 4, 693-723. Grewenig, Adi (2005): Politische Talkshows Ersatzparlament und Medienlogik eines inszenierten 24 Weltbildes. In: Kilian, Jörg (Hg.): Sprache und Politik. Deutsch im demokratischen Staat. Mannheim: Duden, 241-257. Habscheid, Stephan/ Klemm, Michael (Hgg.) (2007): Sprachhandeln und Medienstrukturen in der politischen Kommunikation. Tübingen. Hausendorf, Heiko (2007): Politikersprache. Zur Politisierung von Kommunikation am Beispiel der Auseinandersetzung um gentechnikrechtliche Genehmigungsverfahren. In: Habscheid, Stephan/ Klemm, Michael (Hgg.): Sprachhandeln und Medienstrukturen in der politischen Kommunikation. Tübingen), S. 45-62. Heinemann, Wolfgang (2000): Gesprächssorte – Gesprächsmuster – Gesprächstyp. In: Brinker, Klaus et al. (Hgg.): Text- und Gesprächslinguistik: Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. Band 1. Berlin: de Gruyter, 507-523. Holly, Werner (1993): Zur Inszenierung von Konfrontation in politischen Fernsehinterviews. In: Grewenig, Adi (Hg.): Inszenierte Information. Politik und strategische Kommunikation in den Medien. Opladen: Westdeutsche Verlag, 164-197. Ders./Kühn, Peter/Püschel, Ulrich (1985): Nur Bilder von Diskussionen? Zur visuellen Inszenierung politischer Werbung als Fernsehdiskussion. In: Bentele, Günter/Hess-Lüttich, Ernest W.B. (Hgg.): Zeichengebrauch in Massenmedien. Zum Verhältnis von sprachlicher und nicht-sprachlicher Information in Hörfunk, Film und Fernsehen. Tübingen: Niemeyer, 240-264. Ders./Kühn, Peter/Püschel, Ulrich (1986): Politische Fernsehdiskussionen. Zur medienspezifischen Inszenierung von Propaganda als Diskussion. Tübingen: Niemeyer. Ders./Püschel, Ulrich (1993): Medienrezeption als Aneignung. Methoden und Perspektiven qualitativer Medienforschung. Opladen: Westdeutscher Verlag. Ders./Püschel, Ulrich/Bergmann, Jörg (2001): Der sprechende Zuschauer. Wie wir uns Fernsehen kommunikativ aneignen. Opladen: Westdeutscher Verlag. Ilie, Cornelia (2010): Introduction. In: Dies.(Hg.): European Parliaments under srutinity. Discourse strategies and interaction practices. Jäger, Siegfried (1993): Kritische Diskursanalyse. Eine Einführung. Duisburg: Institut für Sprach- und Sozialforschung. Klein, Josef (1991): Politische Textsorten. In Brinker, Klaus (Hg.); Aspekte der Textlinguistik. Hildesheim: Olms, 245-278. Klein, Josef (1991a): Zur Rhetorik politischer Fernsehdiskussionen. In: Gert Ueding (Hg.): Rhetorik zwischen den Wissenschaften. Geschichte, System, Praxis als Probleme des „Historischen Wörterbuchs der Rhetorik“. Tübingen, 353-362 Knobloch, Clemens (2007): Einige Beobachtungen über den Gebrauch des Stigmawortes “Populismus“. In: In: Habscheid/Klemm (Hgg.) (2007), S. 113-132. Gesprächssorten in der Politik Link, Jürgen (1983): Elementare Literatur und generative Diskursanalyse. München: Wilhelm Fink. Ders. (1984): kollektivsymbolik und mediendiskurse. Zur aktuellen frage, wie subjektive aufrüstung funktioniert. In kultuRRevolution. Heft 1, 6-20. Ders. (1985): Literaturwissenschaftliche Grundbegriffe. München: Wilhelm Fink. Ders. (1992): Die Analyse symbolischer Komponenten realer Ereignisse. Ein Beitrag der Diskurstheorie zur Analyse neorassistischer Äußerungen. In: OBST, Heft 46, 37-52. Ders./Parr, Rolf (1990): Semiotische Diskursanalyse. In: Bogdal, Klaus-Michael (Hg.): Neue Literaturtheorien. Eine Einführung. Opladen: Westdeutscher Verlag, 107-130. Luckmann, Thomas (1986): Grundformen der gesellschaftlichen Vermittlung des Wissens: Kommunikative Gattungen. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 27, 191-211. Meer, Dorothee (1998): „Der Prüfer ist nicht der König“. Mündliche Abschlußprüfungen in der Hochschule. Tübingen: Niemeyer. Dies. (2003): “Wie die da grade stand oder" – Normalisierung und Positionierung in und im Anschluss an Talkshows: Zur Funktion medialer Formen der Subjektivierung und Identitätsbildung. In: Hepp, Andreas/Thomas, Tanja/Winter, Carsten (Hrsg.): Medienidentitäten – Identität im Kontext von Globalisierung und Medienkultur. Köln: Halem, 244263 Dies. (2009): „eh- meine erste frage IST, eh- (1)“ – Plenumsgespräche in hochschulischen Lehrveranstaltungen. In: Lévy-Tödter, Magdalène/Meer, Dorothee (Hrsg.): Hochschulkommunikation in der Diskussion. Frankfurt a. M.: Peter Lang In: Lévy-Tödter, Magdalène/Meer, Dorothee (Hgg.): Hochschulkommunikation in der Diskussion. Frankfurt/New York: Lang, 16-25. (www.verlaggespraechsforschung.de). Meier, Stefan (2004): Zeichenlesen und Netzdiskurs – Überlegungen zu einer semiotischen Diskursanalyse multimodaler Kommunikation. In: Fraas, Claudia/Klemm, Michael (Hgg.): Mediendiskurse. Bestandsaufnahme und Perspektiven. Frankfurt/New York: Lang, 123-141. Meyer, Thomas/Schicha, Christian (2002): Medieninszenierungen zwischen Informationsauftrag und Infotainment. Kriterien einer angemessenen Politikvermittlung. In: Schicha, Christian/Brosda, Carsten (Hgg.): Politikvermittlung in Unterhaltungsformaten: Medieninszenierungen zwischen Popularität und Populismus. Münster: LIT, 53-60. Meinhof, Ulrike Hanna (2007): Globaler Diskurs im Internet? Eine Fallstudie zu Projekten der Website World Music von BBC Radio 3. In: Habscheid, Stephan/ Klemm, Michael (Hgg.): Sprachhandeln und 25 Medienstrukturen in der politischen Kommunikation. Tübingen: Niemeyer, 291-308. Niehr, Thomas (2000): Die Asyldebatte im Deutschen Bundestag – eine „Sternstunde“ des Parlaments? Untersuchung zur Debattenkultur im Deutschen Bundestag. In: Burkhardt, Armin/Pape, Cornelia (Hgg.): Sprache des deutschen Parlamentarismus. Studien zu 150 Jahren parlamentarischer Kommunikation. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 241-260. Ders./Böke, Karin (2003): Diskursanalyse unter linguistischer Perspektive – am Beispiel des Migrationsdiskurses. In: Keller, Reiner et al. (Hgg.): Handbuch sozialwissenschaftliche Doskursanalyse. Band II: Forschungspraxis. Opladen: Leske und Budrich, 325-351. Rehbein, Jochen (1977): Komplexes Handeln. Elemente zur Handlungstheorie der Sprache. Stuttgart: Metzler. Sager, Sven F. (1981): Sprache und Beziehung. Linguistische Untersuchungen zum Zusammenhang von sprachlicher Kommunikation und zwischenmenschlicher Beziehung. Tübingen: Niemeyer. Ders. (2000): Gesprächssorte – Gesprächstyp – Gesprächsmuster – Gesprächsakt. In: Brinker, Klaus et al. (Hgg.): Text- und Gesprächslinguistik: Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. Band 2. Berlin: de Gruyter, 1464-1471. Runkehl, Jens (2005): Text-Bild-Konstellationen. In: Siever, Torsten/Schlobinski, Peter/Runkehl, Jens (Hgg.): Websprache.net. Sprache und Kommunikation im Internet. Berlin/New York: de Gruyter, 202-218. Schütte, Winfried (1996): Boulevardisierung von Information: Streitgespräche und Streitkultur im Fernsehen. In: Biere, Bernd U./Hoberg, Rudolf (Hgg.): Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Fernsehen. Tübingen: Narr, 101-134. Stein, Stephan (2011): Kommunikative Praktiken, kommunikative Gattungen und Textsorten. Konzepte und Methoden für die Untersuchung mündlicher und schriftlicher Kommunikation im Vergleich. In: Birkner, Karin/Meer, Dorothee (Hgg.): Institutionalisierter Alltag: Mündlichkeit und Schriftlichkeit in unterschiedlichen Praxisfeldern. Mannheim: Verlag für Gesprächsforschung, 8-27. (www.verlaggespraechsforschung.de/2011/birkner.htm.). Stötzel, Georg/Wengeler, Martin (Hgg.)(1995): Kontroverse Begriffe. Geschichte des öffentlichen Sprachgebrauchs in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin/New York: de Gruyter. Wengeler, Martin (1997): Argumentation im Einwanderungsdiskurs. Ein Vergleich der Zeiträume 1970-1973 und 1980-1983. In: Jung, Matthias/Wengeler, Martin/ Böke, Karin (Hgg.): Die Sprache des Migrationsdiskurses. Das Reden über „Ausländer“ in Medien, Politik und Alltag. Opladen: Westdeutscher Verlag, 212-149. Gesprächssorten in der Politik Ders. (2000): Argumentationsmuster im Bundestag. Ein diachroner Vergleich zweier Debatten zum Thema Asylrecht. In: Burkhardt, Armin/Pape, Cornelia (Hgg.): Sprache des deutschen Parlamentarismus. Studien zu 150 Jahren parlamentarischer Kommunikation, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 221-240. Ders. (2003): Topos und Diskurs. Begründung einer argumentationsanalytischen Methode und ihrer Anwendung auf den Migrationsdiskurs (1960-1985). Tübingen: Niemeyer. Ders. (2005):“Streit um Worte“ und „Begriffe besetzen“ als Indizien demokratischer Streitkultur. In: Kilian, Jörg (Hg.): Sprache und Politik. Deutsch im demokratischen Staat. Mannheim: Duden, 177-194. Ders. (2007): Topos und Diskurs. Möglichkeiten nd Grenzen der topologischen Analyse gesellschaftlicher Debatten. In: Warnke; Inge (Hg.): Diskurslinguistik nach Foucault. Theorie und Gegenstände, Berlin/New York: de Gruyter, 165-186. Ziem, Alexander (2013): Fames und sprachliches Wissen. Kognitive Aspekte der semantischen Kompetenz. Berlin/New York: de Gruyter. Zima, Elisabeth (2013): Kognition in der Interaktion. Ein kognitiv-linguistische und gesprächsanalytische Studie dialogischer Resonanz in österreichischen Parlamentsdebatten. Heidelberg: Winter. 26