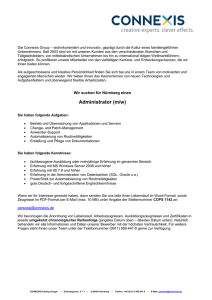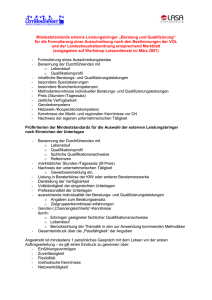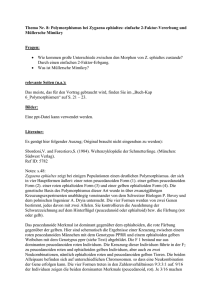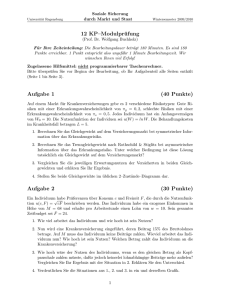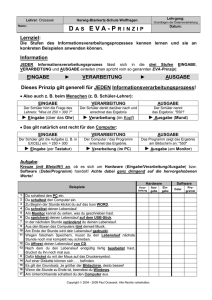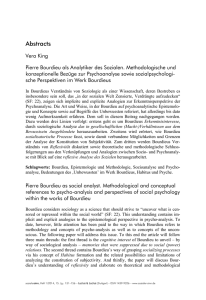3.6 Reproduktion sozialer Ungleichheit
Werbung

Inhalt 3 Theoretische Überlegungen .................................. 1 3.1 Mikro- und Makrolevelanalyse des Lebenslaufs ........... 2 3.1.1 Soziale Konstruktion und individuelle Organisation des Lebenslaufs ........................................................... 3 3.1.2 Wechselwirkungen zwischen der sozialen Mikro- und Makroebene .... 5 3.2 Die Institutionalisierung des Lebenslaufs in der modernen Gesellschaft ............................................... 8 3.2.1 Stabilisierung der Lebenszeit .................................. 10 3.2.2 Staatliche Regulierung des Lebenslaufs ......................... 14 3.2.3 Prekäre Balance ................................................ 17 3.3 Destandardisierung institutionalisierter Ablaufmuster . 20 3.4 Individuen als Handlungszentrum der Risikogesellschaft 25 3.4.1 Individualisierungsschub im Modernisierungsprozess ............. 25 3.4.2 Entscheidungen in der Multioptionsgesellschaft ................. 29 3.5 Soziale Ungleichheit und soziale Lage ................. 31 3.5.1 Das mehrdimensionale Statusmodell .............................. 32 3.5.2 Ungleichheit der sozialen Lage ................................. 33 3.5.3 Die (anhaltende) Bedeutung traditioneller Dimensionen sozialer Ungleichheit ......................................................... 37 3.6 Reproduktion sozialer Ungleichheit .................... 42 3.6.1 Chancenungleichheiten und Bildungsexpansion .................... 44 3.6.2 Der Einfluss der sozialen Herkunft ............................. 48 3.6.3 Kulturelles, ökonomisches und soziales Kapital ................. 50 3.6.4 Habituskonzept und Lebensstil .................................. 56 3.6.5 Reproduzierende Funktion der Bildungsinstitutionen ............. 61 3.7 Biographische Orientierungen und Handlungsstrategien .. 67 3.7.1 Handlungsentwurf und biographische Erfahrungen ................. 70 3.7.2 Biographische Sozialisation und Identität ...................... 74 3.7.3 Übergänge als Lebensereignisse ................................. 78 3.8 Biographische Entscheidungen .......................... 81 1 3 Theoretische Überlegungen Im folgenden werden diejenigen Theorien vorgestellt, welche sich zur Verankerung der Interviewanalyse innerhalb des aktuellen soziologischen Diskurses eignen. Es mag erstaunen, bei einer an qualitativen Methoden orientierten Arbeit die etablierten Theorien an so prominenter Stelle diskutiert zu sehen, geht es doch nicht um die empirische Überprüfung deduktiv gewonnener Hypothesen, sondern vorerst um das induktiv oder gar abduktiv heraus gearbeitete Verständnis der Phänomene von Innen heraus. Der Textaufbau gibt denn auch nicht den For- schungsablauf wieder; die tatsächliche Arbeit mit den Theorien erfolgt je nach der verwendeten Methode erst im Laufe der ersten Auswertungsschritte. Die frühzeitige Offenlegung der Theorie dient der Leserlichkeit und ermöglicht zudem ein besseres Verständnis der verwendeten Konzepte und Schlussfolgerungen. Der theoretische Fokus der Lebenslauf- und Biographieforschung liegt meist auf den Individuen und deren unmittelbaren sozialen Umgebung, der Einfluss makrosoziologischer Aspekte wird häufig vernachlässigt (Levy, 1996). Strukturelle Gegebenheiten und kulturelle Vorstellungen beeinflussen jedoch massgeblich den Lebenslauf des einzelnen Individuums. Die Untersuchung, welche Wirkung diese gesellschaftlichen Kontextbedingungen ausüben, stellt einen makrosoziologischen Zugang zur Analyse des Lebenslaufs dar. Die alleinige Berücksichtigung dieser Sichtweise reicht ebensowenig aus, um zu verstehen, wie Individuen ihr Leben erfahren und ihre Lebenspläne umsetzen. Der Blick auf den Lebenslauf als Ganzes bietet „die Chance, individuelle Betroffenheit, die Wirkungsweise von Institutionen und gesellschaftlichen Wandel simultan in einem gesamtgesellschaftlichen Rahmen zu untersuchen“ (Mayer 1987, S. 53). Der Lebenslauf kann insofern als eine Brücke zwischen Mikro- und Makrosoziologie gesehen werden und „die aufmerksame Betrachtung von Lebensläufen 1 einige der Verbindungen deutlich machen“ (Berger 2000, S. 26). 3.1 Mikro- und Makrolevelanalyse des Lebenslaufs Die kulturellen und strukturellen Vorgaben der Gesellschaft organisieren und konstruieren den Lebenslauf (Buchmann 1989b, Levy 1996), sie bieten dem Individuum Optionen und auferlegen Pflichten in der ökonomischen, politischen und sozialen Sphäre (Buchmann 1989a). Um zu verstehen, wie diese gehandhabt werden ist es wesentlich, auch das Konzept des Individuums als biographischer Akteur in die Analyse des modernen Lebenslaufs miteinzubeziehen (Heinz 1996, 2000). Nötig sind Konzeptionen und theoretische Überlegungen, welche die dynamischen Wechselwirkungen zwischen mikrosozialen und makrosozialen Strukturen berücksichtigen (Allmendinger 1989, Geulen 2000, Heinz 1996, Levy 1996). „Der Lebensverlauf eines Individuums ist Teil und Produkt eines gesellschaftlichen, historisch angelegten Mehrebenenprozesses“ (Mayer 1998, S. 439). Die Beziehung zwischen der makrosozialen Ebene von Struktur und Kultur und der mikrosozialen Handlungsebene stellt eines der fundamentalsten Probleme der soziologischen Theorie dar (Buchmann 1989b). Individuelle Handlungen sind keine isolierten Ereignisse ohne Bezug zum gesellschaftlichen Kontext, in dem sie eingebettet sind. Sie stehen nicht ausschliesslich mit situativen Erfahrungen in Beziehung. Andererseits sind Handlungen auch nicht ausschliesslich durch strukturelle und kulturelle Gegebenheiten bestimmt und dem Einfluss des Handelnden entzogen (Buchmann 1989b). Die Ergebnisse im Lebenslauf erweisen sich als ein dynamisches Wechselspiel zwischen strukturellen und kulturellen Einflüssen und individuellen Orientierungen und Handlungsstrategien. Das Individuum bewegt sich in einer komplexen, sowohl horizontal wie auch vertikal differenzierten Gesellschaft, innerhalb derer es Mitglied verschiedener Subsysteme oder Teilbereichen ist, plaziert auf spezifischen Positionen entsprechend den Strukturen der jeweiligen gesellschaft- 2 lichen Bereiche. Neben dem strukturellen Aspekt der individuellen Statusbiographie sind die Teilhabe an gesellschaftlichen Teilsystemen gleichzeitig Gegenstand von individuellen Wertungen, Erwartungen und Interpretationen (Levy 1996). 3.1.1 Soziale Konstruktion und individuelle Organisation des Lebenslaufs Strukturelle Gegebenheiten regulieren den Lauf des Lebens mittels institutionalisierter Regeln. Im gesellschaftlichen Modernisierungsprozess übernahm der Staat in zunehmenden Masse die Verantwortung für die Organisation des Lebenslaufs, er transformierte das individuelle Leben in eine rationalisierte und standardisierte Form und konstruierte in dieser Weise einen öffentlichen Lebenslauf (Buchmann 1989b), der sich vom privaten Lebenslauf abhebt. „Die gesellschaftliche Prägung des Lebensverlaufs erfolgt primär durch die Abbildung gesellschaftlicher Differenzierung innerhalb und zwischen Institutionen auf den Lebensverlauf“ (Mayer 1987, S. 60). Besonders die Ausgestaltung des Bildungssystems leistete einen wesentlichen Beitrag zur Rationalisierung und Individualisierung des Lebenslaufs (Lenhardt 1992). Daneben bestehen kulturelle Vorstellungen über den Ablauf des Lebens. Die kollektiven Sinnangebote machen die einzelnen Regeln plausibel und legitimieren sie. Pfau-Effinger weist darauf hin, dass „die Entscheidungsfindung von Individuen ein komplexer Prozeß ist, in dem kulturelle Normen und Werte eine wichtige Rolle spielen“ (Pfau-Effinger 1997, S. 516). Kultur umfasst Ideen, Bedeutungen und Werte, die gesellschaftlich als gültige Weltdeutungen betrachtet werden und für das soziale Handeln den Rahmen kollektiver Daseinsverständnisse liefern (Pfau Effinger 1997). Kulturelle Leitbilder bestimmen den angemessenen Ablauf einzelner Lebensphasen. So existieren beispielsweise kollektive Vorstellungen darüber, zu welchen Tätigkeiten ein Kind je nach Alter befähigt sein sollte. Über solche Vorstellungen besteht häufig ein hoher Konsens inner3 halb einer Gesellschaft, die jeweilige Ausgestaltung der kulturellen Leitbilder kann allerdings über die Zeit und international in wesentlichen Aspekten unterschiedlich sein. Die „Naturbedingungen setzen einen Rahmen, innerhalb dessen zwischen Gesellschaften eine hohe Variabilität möglich und empirisch vorfindbar ist“ (Kohli 1980). Auf der mikrosoziologischen Ebene können Lebensläufe als Statusbiographie, als Sequenzen von Positionen und Rollen aufgefasst werden (Levy 1996). Institutionalisierte Konfigurationen von Status1 und Rollen repräsentieren normative Verknüpfungen zwischen sozialen Positionen an bestimmten Punkten im Lebenslauf. Sequenzen solcher Konfigurationen widerspiegeln das Voranschreiten im sozialen Raum (Levy 1996) und der sozialen Zeit. Strukturelle Rahmenbedingungen und kulturelle Leitbilder setzen den Rahmen, in dem Individuen ihre biographischen Perspektiven und Handlungsstrategien entwickeln (Buchmann 1989a). Diese beinhalten die Erwartungen, Aspirationen und Handlungsorientierungen bezüglich verschiedener Bereiche des Lebens, bilden in ihrer Summe also den eigentlichen Lebensplan der Individuen (Buchmann 1989b). In dieser Weise verstanden ist der Lebenslauf kein sozial isoliertes oder rein kulturelles Phänomen, der Lebenslauf ist sowohl durch die Struktur determiniert, wie auch Struktur generierend. Diese Sichtweise integriert sowohl objektivistische wie auch subjektivistische Perspektiven2, deren häufige Gegensätzlichkeit Levy (1996) kriti1 Unter Status wird „ein sozial definierter Platz in einem Positionsgefüge gemeint (...) mit dem bestimmte Handlungschancen und Einschränkungen verbunden sind“ (Bornschier 1991, S. 39). 2 Die objektivistische Sichtweise wird häufig als Lebensverlaufsforschung etikettiert, welcher Untersuchungen zugeordnet werden, die quantitative Forschungsmethoden verwenden. Die biographische Analyse ist mit der Verwendung von qualitativen Methoden verbunden. Die in dieser Arbeit vertretene Sichtweise folgt Levys (1996) Anliegen, eine solche Trennung nicht nachzuvollziehen. Ein umfassendes Verständnis des Lebenslaufs wird erst ermöglicht, wenn beide Perspektiven angemessen in der Analyse berücksichtigt 4 siert. 3.1.2 Wechselwirkungen zwischen der sozialen Mikro- und Makroebene Wie in Abbildung 3.1 veranschaulicht bestehen zwischen den strukturellen und kulturellen Aspekten des Lebenslaufs vielfältige Wechselbeziehungen. Änderungen in den kulturellen Vorstellung bezüglich einer Lebensphase können zu Anpassungen in der strukturellen Ausgestaltung eines Gesellschaftsbereiches führen. Änderungen in den strukturellen Gegebenheiten führen mit der Zeit zu einer Änderung kultureller Leitbilder bezüglich des Lebenslaufs, diese können Änderungen in der Umsetzung des individuellen Lebenslaufs bewirken (Levy 1996). Beispielsweise können kulturelle Vorstellungen über die Aufgaben und Leistungen der wohlfahrtsstaatlichen Einrichtungen deren Ausgestaltung mitbestimmen. Allerdings verläuft der Wandel in den strukturellen und kulturellen Komponenten selten zeitgleich. Es kann zu einem kulturellen Umdenken innerhalb der Gesellschaft kommen bevor dieses sich in einer Modifikation der strukturellen Vorgaben der Gesellschaft ausdrückt. So kann die Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt als sinnvoll und notwendig eingeschätzt werden, und doch bleibt während geraumer ein Mangel an gesellschaftlichen Einrichtungen fortbestehen, die eine weibliche Erwerbsbeteiligung unterstützen. Solche zeitlichen Verschiebungen können zu Spannungen in der sozialen Organisation des individuellen Lebenslaufs führen. Makroprozesse schaffen die Bedingungen für Interaktionen, „die interpersonale Ereignisse beeinflussen“ (Berger 2000, S. 27). Im Aggregat können individuelle Handlungen zu Änderungen in der sozialen Organisation und den kulturellen Vorstellungen bezüglich des Lebenslaufs einer Gesellschaft führen. Hand- werden (Buchmann 1989b). Als Konsequenz werden Techniken der Qualitativen Sozialforschung wie auch quantitative Forschungsmethoden in die Untersuchung des interessierenden Gegenstandsbereichs integriert. 5 Abb. 3.1: Wechselwirkung zwischen der soziologischen Makround Mikroebene Strukturelle Kulturelle Rahmenbedingungen Leitbilder Strukturelle und Aggregation in- kulturelle Chan- dividueller Ori- cen entierungen und und Restriktio- Handlungen nen Biographische Orientierungen und individuelle Handlungsstrategien Quelle: Buchmann 1989b lungsmuster können sich unabhängig von strukturellen oder kulturellen Vorgaben ändern und diese mit der Zeit wandeln (Buchmann 1989b, Levy 1996). Beispielsweise kann eine fortgesetzte verstärkte Erwerbsbeteiligung von Frauen eine allmähliche Änderung in den Auffassungen bezüglich der Geschlechterrollen bewirken. Der Lebenslauf in der modernen Gesellschaft weist eine bemerkenswerte Dynamik zwischen Prozessen der Institutionalisierung und solchen der Individualisierung oder Destandardisierung auf. Dies widerspiegelt sich in einer Anzahl recht unterschiedlicher soziologischen Theorien. In den folgenden Abschnitten erfolgt eine Zusammenstellung der wichtigsten dieser Theorien, die einesteils die Analyse des Lebenslaufs aus der makrosoziologischen andernteils aus der mikrosoziologischen Perspektive betreiben. Als erstes wird die Institutionalisierung des Lebenslaufs diskutiert, die sich im Prozess der gesellschaftlichen Modernisierung beobachten liess (Buchmann 1989b, Kohli 1985, Mayer 1998). Nach einer ausgedehnten Phase der Auskristallisierung eines institutionalisierten Lebenslaufregimes lassen sich in den letzten Jahren Anzeichen für eine zunehmende Pluralisierung und Destandardisierung des Lebenslaufs ausmachen (Kohli 1985). Diese Beobachtungen sind Verbunden mit der Diskussion einer Individualisierung von Lebenslagen innerhalb der Gesell- 6 schaft, welche die Konzepte der Schichtung und Klassen, die während langer Zeit die Ungleichheitsforschung dominierten, als ungeeignet einschätzt (Beck 1983, 1986), da sich „die Sozialstruktur nicht mehr länger auf der Grundlage konventioneller Schichtmodelle beschreiben lasse“ (Stamm und Lamprecht 1996, S. 510). Bourdieu (1982) hält dem entgegen, dass die soziale Schichtung noch immer einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis der individuellen Handlungsmuster leistet. Die Funktion des Bildungssystems ist zentral im Verständnis der Reproduktion gesellschaftlicher Ungleichheit (Bourdieu und Passeron 1971, Bourdieu 1982, Graf und Lamprecht 1991, Krais 1996, Meyer et al. 1999, Treibel 1997), der Einfluss der sozialen Herkunft noch immer ein wichtiger Erklärfaktor für die Ausbildungsresultate im Lebenslauf von Individuen. Neben dem Beruf gibt es kaum eine andere gesellschaftliche Institution, die den Lebenslauf in ähnlichem Ausmass bestimmt wie das Bildungssystem (Lenhardt 1992). „Das Bildungswesen hat die geheime Funktion, die Gesellschaftsordnung zugleich zu perpetuieren und zu legitimieren, es perpetuiert sie um so wirksamer gerade dadurch, daß seine konservative Funktion unter einem ideologischen Selbstverständnis verborgen ist“ (Bourdieu und Passeron 1971, S. 16). Nachkommen aus oberen Schichten bringen, wie sich noch zeigen wird, mehr Startkapital beim Eintritt in das Schulsystem mit, in Form von sozialem, ökonomischem und kulturellem Kapital (Bourdieu 1983). Sie verfügen damit über entscheidende Vorteile gegenüber den Kindern aus den unteren Schichten, die sich im Verlauf ihrer Bildungskarriere kumulieren (Leemann 2002). Der Habitus, „in dem sich die symbolische Ordnung und kulturellen Konstruktion gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse einnisten“ (Leemann 2002, S. 29), trägt dazu bei, dass sich die Individuen als Teil ihrer sozialen Gruppe in die für sie bestimmten gesellschaftlichen Felder einordnen und dadurch die gesellschaftlichen Ungleichheitsverhältnisse re- 7 produzieren. 3.2 Die Institutionalisierung des Lebenslaufs in der modernen Gesellschaft In seiner Arbeit von 1981 über die „Prozessstrukturen des Lebensablaufs“ präsentiert Fritz Schütze Ergebnisse aus der Analyse narrativer Interviews. Zu den Phänomenen von Lebensläufen zählen unter anderem die institutionalisierten Ablaufmuster. Diese zeigen sich stark im Lebens- und Familienzyklus aber auch in Bildungs- und Berufskarrieren: „Sämtliche Phasen und Einschnitte des Lebenszyklus sind durch grundlegende gesellschaftliche Institutionen (...) auf Dauer gestellt, organisiert und kontrolliert“ (Schütze 1981, S. 68). Akteure, signifikante InteraktionspartnerInnen und Aussenstehende haben stabile Vorstellungen über Stufen und Übergänge im Lebenszyklus: „Ich erwarte; ich erwarte, dass die Interaktionspartner erwarten; ich erwarte, die Interaktionspartner werden erwarten ich werde erwarten“ (ebd.). Die damit verbundenen moralischen Ansprüche - beispielsweise sollte die Heirat nicht vor dem Ende der Ausbildung erfolgen - werden von gesellschaftlichen Institutionen wie der Schule, der Kirche oder der Familie weitergegeben. Schütze geht grob gesagt davon aus, dass es in verschiedenen Lebensbereichen Idealbilder über den Vollzug des Lebenszyklus gibt. Martin Kohlis Ausführungen über den Lebenslauf als Institution „im Sinne eines Regelsystems, das einen zentralen Bereich oder eine zentrale Dimension des Lebens ordnet“ (Kohli 1985, S. 1) gehen weiter. Die von Schütze aufgezeigten Zeitprogramme der einzelnen Lebensbereiche wie Familie oder Arbeitsmarkt werden in einer Gesamtstruktur - dem institutionalisierten Lebenslauf - gebündelt. Diese Struktur dient Kohli als Kontext für die Diskussion des Individualisierungsschubes der Moderne. Er kann zeigen, dass mit der Standardisierung der Lebenszeit 8 mehr als die von Schütze eingeführte, pur chronologische Regelung des Lebensablaufs erreicht wird: Durch die Institutionalisierung auf der Zeitachse wird auch für das Leben der Individualität eine feste, gesellschaftlich anerkannte und überindividuell bestimmte Form geschaffen: „Beide Momente, Standardisierung und Offenheit, Verhaltenseinschränkung und Expansion sind institutionalisiert, und dies erzeugt die besondere Dynamik des modernen Lebenslaufregimes, die nicht auf Dauer, sondern nur in einer immer prekären Balance stillgestellt werden kann“ (Kohli 1988, S. 39). Durch den Lebenslauf werden die lebensweltlichen Horizonte und Wissensbestände strukturiert, innerhalb derer sich Individuen orientieren und ihre Handlungen planen (Kohli 1985). Die Möglichkeit eines geplanten Lebenslaufs, auf den retrospektiv zurückgeblickt werden kann, ist jedoch kein natürliches Phänomen (Geissler und Krüger 1992): Im Verlauf des gesellschaftlichen Modernisierungsprozesses hat die Bedeutung des Lebenslaufs als soziale Institution stark zugenommen, es fand ein Wandel von einem unkalkulierbaren Muster zufälliger Lebensereignisse zu einem vorhersehbaren Lebenslauf statt (Kohli 1985). Dieser weist eine ausgeprägte zeitliche Strukturierung auf (Geissler und Krüger 1992). Durch diesen Aspekt wurde der Lebenslauf selbst zu einer Institution (Kohli 1985). Frühere Gesellschaften zeigten einen hohen Integrationsgrad, der in der Regel religiöser Natur war (Berger et al. 1975). Der Übergang zur Moderne ging mit einer starken Mobilisierung und Pluralisierung des Lebens einher. In der modernen Gesellschaft sind makrosoziale Strukturen in weit komplizierterem Masse mit mikrosozialen Prozessen verbunden als früher (Heinz 1996). Der Individualisierungsprozess bewirkte, dass die Vergesellschaftung in zunehmendem Masse auf der Ebene des Individuums ansetzen musste als auf derjenigen von stabilen lokalen Gemeinschaften (Buchmann 1989a). Ein wesentlicher Teil dieser neuen Vergesellschaftungsform ist die Institutionalisierung 9 des Lebenslaufs als Ablaufprogramm und als langfristige Orientierung für die Lebensführung. Insofern stellt die Institutionalisierung des Lebenslaufs ein unerlässliches Korrelat zur Freisetzung der Individuen dar, sie ist das funktionale Äquivalent zur früheren äusseren sozialen Kontrolle (Kohli 1985). Die Institutionalisierung des Lebenslaufs bewirkt somit eine Entlastung: sie verleiht der Lebensführung ein festes Gerüst und setzt Kriterien dafür, was erreichbar ist und was nicht. Zusätzlich entstand durch die politische Regelung einer zunehmenden Zahl von wichtigen Lebensbereiche ein Druck nach der Rationalisierung von staatlichen Leistungssystemen. Die Ausrichtung am chronologischen Alter der Individuen eignet sich in besonderer Weise für diese Art von Rationalisierung (Kohli 1985). Der Blick auf den Lebenslauf bedingt in der Folge die Berücksichtigung der zeitlichen Dimension. Das Lebensalter muss als eigenständige gesellschaftliche Strukturdimension aufgefasst werden. Dadurch kann der Lebenslauf als soziale Institution aufgefasst werden, die zentrale Bereiche des Lebens ordnet (Kohli 1985). 3.2.1 Stabilisierung der Lebenszeit Das menschliche Leben in der vormodernen Gesellschaft ist durch Zufälligkeit der Lebensereignisse geprägt. Der Tod eines Menschen kann jederzeit eintreten. Langfristige, insbesondere auf den Einzelnen bezogene Planung, macht keinen Sinn: „Was in der vormodernen Lebensform an ‚Langsicht‘ gegeben war, bezog sich nicht auf das Einzelleben, sondern auf die Familie und ihre materielle Grundlage“ (Kohli 1985, S. 11). Dauerhaften Halt erfahren die Menschen somit durch Zugehörigkeit zur lokalen Lebenswelt. Dieses Erleben von Beständigkeit aufgrund von Kontinuität durch das Eingebundensein in ständische und lokale Bindungen ging mit dem Prozess der Modernisierung aus der Agrargesellschaft und der damit verbundenen Abkehr von der Tradition verloren. Menschen haben dadurch die Grundlage für fokussiertes 10 Handeln verloren: „Wo diese Kontinuitätsidealisierung nicht durch die fraglose Zugehörigkeit zu einem stabilen Milieu verbürgt ist, sind andere Institutionen gefordert“ (Kohli 1986, S. 190). Als neue Institution und somit als neues Orientierungsschema kann die Lebensdauer dienen. Die mittlere Lebensdauer hat nämlich zugenommen und der Tod ist zumindest für wohlhabende Industrienationen fast vollständig aus dem frühen und mittleren Erwachsenenalter verschwunden. Somit ist es zu einer relativ einheitlichen Lebenserwartung für weitgehende Teile der Bevölkerung gekommen. Der Lebenslauf wird zum verlässlichen Zeithorizont. Kohli spricht von Kontinuität „im Sinn einer verlässlichen, auch materiell gesicherten Lebensspanne“ (Kohli 1988, S. 37). Die Stabilisierung der Lebenszeit bedeutet zweierlei. Auf der einen Seite erscheint individuelle Planung, die einzig und allein auf das eigene Leben bezogen ist, erstmals Sinn zu machen. Ausgehend von der realistischen Annahme, dass noch gut 50 Jahre zur freien Verfügung stehen, können junge Erwachsene ihr persönliches Leben als eigenes Projekt entwerfen und organisieren. Ansprüche auf individuelle Entfaltung können erhoben werden. Individuen konstituieren ihr eigenständiges Ablaufund Entwicklungsprogramm. Auf der anderen Seite werden die traditionellen kollektiven Ordnungen und die stabile Lebenslage der vormodernen Lebensformen durch den Ablauf der Lebenszeit als zentrales Strukturprinzip abgelöst. Wesentliche Lebensereignisse werden in einem geordneten und chronologisch festgelegten Ablauf bewältigt dies zeigt sich beispielsweise bei den Sozialversicherungen, die an fixe Altersgrenzen geknüpft sind oder anhand der zeitlichen Ballung von Ereignissen, die dem Übertritt ins Erwachsenenalter zugerechnet werden. Die Struktur der Lebenszeit wird folglich vorgegeben und erwartbar. Als Folge der weitgehend am chronologischen Alter ausgerichte11 ten Verzeitlichung des Lebenslaufs entwickelte sich ein standardisierter „Normallebenslauf“ (Fischer und Kohli 1987, S. 41). Dieser ist um das Erwerbsleben herum organisiert. Neben dem „Geschlecht, zertifikatisiertem Bildungsstand, in einigen Fällen ethnische Herkunft und Religion, hat das kalendarische Alter eine gesellschaftliche Ordnungs-, Organisations- und Selektionsfunktion und damit erreicht das kalendarische Alter die Bedeutung einer Strukturvariablen“ (Hoerning 1987, S. 241). Die Freisetzung der Individuen aus Bindungen an Stand und lokalen Vergesellschaftungsformen wie der Familie, das Verständnis des Individuums als eigenständige und wesentliche soziale Einheit ist mit dieser Chronologisierung des Lebenslaufs verknüpft. Die evidenteste zeitliche Gliederung ist die Dreiteilung in ein Vorbereitungsphase, eine Aktivitäts- und eine Ruhephase (Fischer und Kohli 1987, Kohli 1985). Dabei umfasst die Vorbereitungsphase die Kindheit und Jugend eines Individuums. Die Aktivitätsphase entspricht dem Erwachsenenleben und die Ruhephase lässt sich dem Alter zuordnen. In der Entwicklung der modernen Gesellschaft vergrösserte sich die Anzahl der Lebensphasen und diese grenzten sich in Beziehung zum chronologischen Alter immer stärker voneinander ab. Institutionelle Standards bezüglich des Zeitpunkts und der Dauer von Übergängen legen die sozialen Rahmenbedingungen für die Konstruktion der individuellen Biographie fest (Heinz 1996). Der Lebenslauf als Institution bedeutet die Bestimmung des sequentiellen Ablaufs der einzelnen Lebensstadien durch ein Set von formalen Regeln. Formelle Altersregeln, die am chronologischen Alter orientiert sind, strukturieren das Leben als eine Sequenz von Lebensphasen und bestimmen die Übergänge dazwischen. Der Zugang zu den institutionalisierten Bereichen der Gesellschaft in Form von Rollen und Positionen ist offiziell geregelt, dies erfolgt insbesondere durch Bildungszertifikate und berufliche Titel (Lenhardt 1992). Altersnormen bestimmen das Aufeinanderfolgen, die Sequenz der einzelnen Le- 12 bensstadien (Levy 1996) und schreiben dem Individuum Rechte und Pflichten zu (Buchmann 1989b). Sie sagen beispielsweise etwas darüber aus, welches das angemessene Alter für eine Heirat oder das erste Kind ist. „Professionelle Altersnormen (...) begründen sich aus kulturell - normativen Zeitvorstellungen für den Lebensvollzug, aus statistisch ermittelten Durchschnittsvorstellungen, die häufig als ‚Normalverläufe‘ deklariert werden oder aus spezifischen Erfahrungen derer, die evaluieren“ (Hoerning 1989, S. 161). Altersnormen können in unterschiedlichem Masse formell ausgestaltet sein: Es gibt gesellschaftliche Bereiche, die durch den Staat in Form von Gesetzen exakt geregelt werden, andere Altersnormen widerspiegeln in stärkerem Masse kulturelle Vorstellungen, die einen Einfluss auf individuelle Handlungen ausüben, ohne gesetzlich strikt geregelt zu sein. Alterskategorien definieren Qualitäten, Kompetenzen, Bedürfnisse und Motive sowie Rechte und Pflichten, die den Mitgliedern einer bestimmten Altersgruppe zugeordnet werden können. Sie legitimieren altersspezifische Verhaltensnormen, welche die Erwartungen der Mitglieder bestimmter Altersgruppen gegenüber dem eigenen Alter wie auch die Erwartungen gegenüber anderen ihrer Altersgruppen organisieren (Buchmann 1989b). Die Chronologisierung des Lebenslaufs wird durch die altersgeschichteten Systeme öffentlicher Rechte und Pflichten vorangetrieben. Die Einführung von Zugangskriterien, die an das chronologische Alter gebunden sind, hängt damit zusammen (Kohli 1985). Diese Einteilung des Lebens widerspiegelt einen besonders gut sichtbaren Aspekt des standardisierten Lebenslaufs: Alle Institutionen der modernen Gesellschaft sind zumindest teilweise bezüglich Altersnormen organisiert. Für das Bildungssystem gilt dies in ausgeprägter Weise (Buchmann 1989b). Basierend auf normalen ausbildungsbezogenen und beruflichen Fahrplänen, wie sie eine Normalbiographie enthalten sollte, legen Institutionen die Dauer von Lebensphasen und Statuspas13 sagen im Lebenslauf fest (Geissler und Krüger 1992). Übergänge wurden im Rahmen dieser Institutionalisierungsprozesse kürzer, es kam zu einer verstärkten Segmentierung und Standardisierung des Lebens entlang des Alterskontinuums (Kohli 1985). Statuspassagen verknüpften Institutionen und biographische Akteure indem sie biographische Abläufe festlegen sowie Eintrittswie auch Austrittspunkte von Übergängen zwischen sozialen Statuskonfigurationen (Heinz 1996). Für das Individuum ist es wesentlich, ob es einen Übergang zu einer der jeweiligen Altersnorm entsprechenden Zeit vollzieht, oder ob dies zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt geschieht und somit das „Timing“ (Kohli 1980) einer Statuspassage nicht stimmt. 3.2.2 Staatliche Regulierung des Lebenslaufs Die zunehmende Beteiligung des Staates an der Definition und Durchsetzung altersnormierter Regeln im Rahmen des gesellschaftlichen Modernisierungsprozesses führte zu einer immer ausgeprägteren Strukturierung des Lebenslaufs. Die Logik staatlicher Interventionen beruht auf kulturellen Vorstellungen der Normalität (Geissler und Krüger 1992). Sie folgt im wesentlichen universalistischen und rationalen Prinzipien des formalen Rechts. In der Folge erhielt der Lebenslauf eine stärker formalisierte, standardisierte und bürokratisierte Struktur (Buchmann 1989a): die politische Regelung des Lebenslaufs wandelt immer mehr Aspekte des Lebens in institutionell festgelegte Lebensereignisse und institutionell definierte Lebensphasen. Das institutionalisierte Lebenslaufregime (Geissler und Krüger 1992) beinhaltet festgelegte Sequenzen von Statuskonfigurationen und Rollenkonfigurationen. Alter ist ein wichtiges Kriterium für den Zugang zu bestimmten Rollen (Kohli 1980). Diese Sequenzen von Rollen und Positionen liessen Laufbahnen entstehen (Buchmann 1989b), sogenannte ‚trajectoires‘ (Bourdieu 1985, Hoerning 1989), entlang derer sich Individuen während ihres Lebenslaufs durch den sozialen Raum und die soziale Zeit bewegen. „Die Altersgebundenheit von Positionen und 14 Rollen verfestigt sich in ‚sozialen Fahrplänen‘, die zeitliche Erwartungen bezüglich eines breiten Spektrums an nichtinstitutionalisierten Lebensereignissen und -übergängen strukturieren. Demgegenüber legen die institutionalisierten Mechanismen der Statusallokation und -verknüpfung die Austauschbeziehungen unter aufeinanderfolgenden Positionen und Rollen innerhalb und zwischen institutionellen Bereichen (z.B. Bildung, Beruf, Pensionierung) fest“ (Buchmann 1989a, S. 91). Es entstand eine Trennung zwischen dem privaten Lebenslauf, der die nicht-institutionalisierten Elemente des Lebens umfasst, und dem öffentlich geregelten Lebenslauf (Buchmann 1989a). Im Lauf der historischen Entwicklung haben sich die zentralen Leistungssysteme wie das Bildungssystem und das System der Altersleistungen stark ausgedehnt und zu einer Homogenisierung der individuellen Lebensläufe geführt (Kohli 1985). Durch die Einführung der allgemeinen Schulpflicht ist es zu einer einheitlichen Lebensphase gekommen. Die Schule wurde in den vergangenen zwei Jahrhunderten zu einer der wichtigsten Sozialisationsinstanzen, viele Aufgaben, die früher überwiegend von der Familie wahrgenommen wurden, sind heute der Schule überlassen (Lamprecht 1991). Regeln bestimmen die Austauschverhältnisse zwischen aufeinanderfolgenden Positionen und Rollen und zwischen institutionellen Bereichen wie beim Übergang vom Bildungssystem in das System der beruflichen Ausbildung (Buchmann 1989b). Bildungszertifikate repräsentieren die soziale Anerkennung kultureller und beruflicher Kompetenzen. Ihre Funktion besteht darin, die Individuen in unterschiedliche institutionalisierte Laufbahnen zu weisen, sie bilden damit ein Klassifizierungssystem (Buchmann 1989a). Das Bildungssystem erfüllt zentrale Funktionen bei diesem Statuszuweisungsprozess (Lamprecht 1991), es leistet eine Allokations- und Selektionsfunktion innerhalb der gesellschaftlichen Strukturen. „Soziale Unterschied erscheinen innerhalb des Bildungssystems nur als individuelle, meist von Begabungen und Leistungswille gepräg15 te. Nur so werden sie von den Teilnehmern in der Regel wahrgenommen und erfahren“ (Graf und Lamprecht 1991, S. 81). Der Umfang, in dem askriptive Merkmale wie das Geschlecht, die Nationalität oder die soziale Herkunft neben den individuellen Leistungen die ungleiche Statusverteilung mitbestimmen, ist ein Mass für die meritokratische Ausrichtung einer Gesellschaft (Leemann 2002). Gemäss Bourdieu (1982) produzieren und verstärken die offiziellen Unterschiede verursacht durch akademische Klassifikationen real vorliegende Unterschieden, indem sie im klassifizierten Individuum einen kollektiv anerkannten und geförderten Glauben in das Bestehen von Unterschieden bewirken und so ein Verhalten erzeugen, welches das wirkliche Sein mit dem öffentlichen Sein in Übereinstimmung bringen. Das Bildungssystem und das Rentensystem sind die Träger der Ausdifferenzierung wichtiger Lebensphasen, auf ihrer Grundlage basiert das Modell des dreigeteilten Lebenslaufs (Kohli 1985). Es strukturiert verschiedene Lebensstadien, unterscheidet diese voneinander und regelt deren Verknüpfung. Formale Bildung leistet zudem einen wesentlichen Beitrag zur Vererbung der gesellschaftlichen Position von einer Generation zur nächsten, der Bildungsstatus der Eltern ist von Bedeutung für den Lebenslauf ihrer Kinder (Lenhardt 1992). Durch formale Bildungszertifikate erlangt der Arbeitsmarkt Bedeutung für Kinder, jeder weiss, schlechte Schulleistungen bewirken einen negativen Einfluss auf spätere Chancen im Lebenslauf (Lenhardt 1992): „Durch die Verknüpfung der Vergabe von gesellschaftlich knappen und hoch bewerteten Gütern an die Berufsarbeit, entscheidet Schulerfolg nicht nur über den Zugang zu sozialen Positionen, sondern bis zu einem bestimmten Maß über zukünftige Lebenschancen“ (Lamprecht 1991, S. 131). Neben dem Bildungssystem führte die Ausgestaltung des Wohlfahrtsstaates zu einer Institutionalisierung beruflicher Kontinuität im Zentrum der modernen Normalbiographie (Geissler 16 und Krüger 1992). Die Standardisierung des Lebenslaufs wird weiter gefördert durch „die industrielle Arbeitsgesellschaft, durch die koordinierten Strategien von Gewerkschaften, Staat und Unternehmern und die daraus resultierende Arbeitsplatzsicherheit und die steigenden Realeinkommen“ (Mayer 1998, S. 442). 3.2.3 Prekäre Balance Die Institutionalisierung des Lebenslaufs stellt einen sozialen Mechanismus zur Organisation und Regelung der individuellen Lebenszeit dar. Dadurch werden die Anforderungen der Gesellschaft mit den Bedürfnissen des Individuums als biographischem Akteur vereinbart. Die Standardisierung und Individualisierung des Lebenslaufs begleiten in dieser Weise die zunehmende Institutionalisierung und Rationalisierung der Gesellschaft (Buchmann 1989b). Das Leben in der modernen Gesellschaft ist weniger bestimmt durch Traditionen und Bräuche. Es ist zugänglicher für individuelle Handlungsorientierungen, denn die Folge des veränderten Zusammenwirkens zwischen Familie, Bildung und Arbeit ist eine zunehmende Offenheit von Bildungswegen und Karriereverläufen. Dies bringt „erhöhte Handlungs- und Entscheidungszwänge, erhöhte Anpassungs- und Gestaltungsleistungen“ (Mayer 1987, S. 52) mit sich, denn einhergehend mit der Pluralisierung des Lebenslaufs muss dieser in stimmiger Weise an hochgradig standardisierte und bürokratisierte Lebenslaufmuster angepasst werden. Individuen können und müssen lebenslaufbezogene Entscheide treffen, sie müssen der eigenen Bastelbiographie eine geeignete Form verleihen. Gleichzeitig müssen sie aber auch den Erfordernissen des standardisierten Lebenslaufs entsprechen, sie müssen eine lückenlose Normalbiographie (Levy 1996) aufweisen, gerade wenn sie sich ohne Nachteile auf dem Arbeitsmarkt bewegen wollen. Insofern weist der institutionalisierte Lebenslauf zwei Seiten auf. Er bietet einerseits Sicherheit bezüglich wichtiger Lebensereignisse, macht das Leben planbar und verleiht der indi17 viduellen Position im sozialen Raum Kontinuität und Stabilität. Die Kenntnis des Einzelnen von üblichen Lebensläufen liefert die Horizonte für seine eigene Planung. „Der Lebensplan ist der grundlegende Kontext, in dem das Wissen um die Gesellschaft im Bewusstsein des Individuums organisiert ist“ (Berger et al. 1975, S. 67). Der Umstand, dass institutionelle Ansprüche antizipiert werden können, verursacht die Notwendigkeit, individuelle Biographien entsprechend anzupassen (Geissler und Krüger 1992). Der Lebenslauf beinhaltet jedoch auch die Möglichkeit von sozialen Spannungen in Form von negativen Sanktionen, Diskriminierungen und Rollenstress, falls Individuen gezwungen sind, Lebenswege zu verfolgen, die nicht den akzeptierten kulturellen Vorstellungen der Gesellschaft entsprechen (Levy 1996). Ein unvollständiger Lebenslauf, der die Teilnahme bestimmter gesellschaftlicher Bereiche vermissen lässt, kann Gegenstand von Spannungen sowohl struktureller wie auch kultureller Art sein, mit denen das Individuum fertig werden muss, möglicherweise in dem es biographische ‚Normalität‘ neu für sich definiert (Levy 1996). Individuen haben einerseits mehr Wahlmöglichkeiten ihren Lebenslauf zu organisieren, gleichzeitig tragen sie aber auch eine verstärkte Verantwortung für die Ergebnisse ihrer Entscheidungen (Heinz 1996). Die Generierung biographischer Kontinuität ist sowohl zu einer sozialen Notwendigkeit wie auch einem subjektiven Bedarf geworden (Geissler und Krüger 1992). Im historischen Prozess der Modernisierung laufen zwei gegenläufige Entwicklungen ab: Handeln, das individuell geplant, durchgeführt und bewertet werden kann wird in einem allgemeinen, auf einer zeitlichen Struktur aufbauenden, institutionellen Muster gebunden. Individualisierung der Moderne bedeutet so gesehen mehr als nur Freisetzung der Individuen, Erweiterung der Möglichkeiten und Verschiedenheit im Vergleich mit 18 anderen: „Der historische Prozess der Individualisierung bedeutet in dieser Perspektive, dass die Person sich nicht mehr über die Zugehörigkeit zu einer sozialen Position bzw. die Mitgliedschaft in einem sozialen Aggregat konstituiert, sondern über ein eigenständiges Lebensprogramm“ (Kohli 1988, S. 35). Kohli spricht von einem neuen Modus, der die Vergesellschaftung, die in der Vormoderne auf der Familie, der Lokalgesellschaft oder dem Stand beruht, auf die Ebene des Individuums transferiert. Individuen werden innerhalb zu Trägern, zur neuen Struktur, des sozialen Lebens erhoben. Neben dem Lebenslauf wird auch Individualität zum Programm; als zentrale Aspekte des modernen Lebens sind sie institutionalisiert. Für das Subjekt bedeutet diese doppelte Institutionalisierung, dass es als Handlungszentrum Handlungsfreiheit besitzt, da ihm eine eigenständige Lebensorientierung sozial ermöglicht wird. Da diese Lebensorientierung aber auch verlangt wird, steht es gleichzeitig unter Entscheidungszwang. Menschen der Moderne haben sich zwischen dem Anspruch und dem Zwang zur individuellen Entfaltung und dem Massstab des Lebens als Normalprogramm zu verwirklichen - ohne Wertung kann davon ausgegangen werden, dass dies eine problematische Aufgabe ist, der höchstens in Form eines vorübergehenden Gleichgewichts begegnet werden kann. Der enge Bezug zwischen Lebenslauf und Altersnormen birgt die Möglichkeit zeitlicher Unstimmigkeiten im Rahmen von Übergängen in sich. Das Verlassen einer Rolle muss nicht zwangsläufig mit der Übernahme neuer Rollen zusammen fallen (Buchmann 1989b). Der Übergang vom schulischen Bildungssystem in das System der beruflichen Ausbildung ist ein massgeblicher Zeitpunkt, um die Verknüpfung zwischen dem Einfluss der sozialen Struktur auf den Lebenslauf und der individuellen Organisation der eigenen Biographie aufzuzeigen. Hier ist die Notwendigkeit ersichtlich, den Lebenslauf sowohl von der makrosoziologischen Perspektive her zu betrachten, wie auch die Sichtweise der bi19 ographischen Akteure in die Analyse miteinzubeziehen. Das Verständnis einzelner Lebensphasen und Übergänge im Lebenslauf setzt voraus, dass diese als ganzes betrachtet (Buchmann 1989b) und mit Bedingungen und Verläufen ausserhalb des jeweiligen Lebensbereichs in Beziehung gesetzt werden (Mayer 1987). Statuspassagen sind Wendepunkte im Leben, in denen Institutionen einerseits Handlungsoptionen anbieten, aber vom Individuum auch verlangen, eigene Lebenspläne zu entwickeln und eine Bilanz des bisherigen Lebens anzufertigen (Geissler und Krüger 1992). Handeln ist nie nur Vollzug sozial tradierter Wissensbestände, sondern hat immer auch den Charakter des offenen Entwurfs (Fischer und Kohli 1987). Heute ist die Sozialisation3 nicht mehr abgeschlossen, sobald sich ein gefestigtes Ich gebildet hat, sondern bildet einen lebenslangen Prozess. Der Blick auf den als Ganzes Lebenslauf ermöglicht es, statt einzelne Lebensphasen isoliert zu thematisieren, die unterschiedlichen Lebensphasen miteinander zu vergleichen (Kohli 1980). 3.3 Destandardisierung institutionalisierter Ablaufmuster Die Biographisierung der Lebensführung meint die Aufweichung sozial institutionalisierter Biographieverläufe und eine damit einhergehende Vergrösserung der persönlichen Handlungsspielräume (Kohli 1985). Gemeint ist die Notwendigkeit der „Selbstthematisierung im Hinblick auf die eigene Lebensplanung“ (Fi3 Gemäss dem ursprünglichen Konzept von Sozialisation wurde darunter die Herstellung und Sicherung sozialer Integration in Form von verinnerlichter sozialer Kontrolle verstanden. Die Vorstellung des Individuums als passives Objekt der Sozialisation ist jedoch nicht zutreffend, bereits Kinder entwickeln sich in einer aktiven Auseinandersetzung mit ihrer sozialen und materiellen Umwelt. Bei Erwachsenen trifft dies noch ausgeprägter zu (Kohli 1980). Eine Alternative bildet ein Konzept der Sozialisation, das Entwicklung als Wachstum versteht, d.h. als „das Erreichen eines Zieles oder die Entfaltung von Subjektivität“ (ebd., S. 314). 20 scher und Kohli 1987, S. 40-41) als Folge der Zunahme von verfügbaren Orientierungs- und Handlungsalternativen. „In den letzten zwanzig Jahren läßt sich ein Wandel von hochstandardisierten und stabilen Lebensverläufen zu flexibleren, diskontinuierlicheren und in stärkerem Maße individualisierten Lebenslaufmustern beobachten. Dieser Trend kann als partielle Destandardisierung des Lebenslaufs begriffen werden, bedingt durch den hohen Grad an gesellschaftlicher Rationalisierung und Individualisierung und die daraus resultierende Dynamik“ (Buchmann 1989a, S. 91). Kohli zeigt auf, dass die von ihm beschriebene Institutionalisierung des Lebenslaufs als „Normalbiographie“ lediglich bis in die 60er Jahre wirkte: „Seither mehren sich jedoch die Hinweise darauf, dass der Prozess sich - vor allem was die sequentielle Ordnung des Lebenslaufs betrifft - umgekehrt hat, dass wir es also mit einer Tendenz zur DeInstitutionalisierung zu tun haben.“ (Kohli 1988, S. 43). Dies zeigt sich beispielsweise daran, dass verschiedenste Familienkonstellationen für Menschen auf allen Altersstufen möglich sind oder Teilzeitarbeit und Langzeiturlaub für Flexibilisierung im Arbeitssektor sorgen. Diese gesellschaftliche Tendenz, zurück zu vermehrt unstabileren, weniger voraussehbaren Mustern des Lebenslaufs kann zwei strukturelle Gründe haben. Einerseits Zwang, als „Folge davon, dass die Kontinuitätsgarantien des Arbeitsmarkts und des wohlfahrtsstaatlichen Sicherungssystems teilweise ausser Kraft gesetzt sind“ (Kohli 1986, S. 202). Andererseits Wahl, die entweder als neue Form von Situationsgebundenheit, in der Individuen zu Marionetten von Systemen werden, oder als Weiterführung des Individualisierungsprozesses verstanden werden muss. Aus dieser letztgenannten Perspektive führt die partielle Auflösung der zeitlichen Lebensstruktur dazu, dass nicht mehr bestimmte Verlaufsmuster zur „Normalbiographie“ gehören. Von den Individuen wird vermehrt eine eigenständige biographische Ori- 21 entierung verlangt. Der Zwang zu einer subjektiven Lebensführung nimmt zu. Institutionen, die eine Entlastung für die Inhalte und Konsequenzen der Entscheidungen liefern könnten, nehmen demgegenüber ab. Die Subjekte werden somit noch stärker auf sich selbst verwiesen. Die Prozesse der Destandardisierung des Lebenslaufs (Kohli 1985, Mayer 1998) führten unter anderem dazu, dass der Übergang in die Phase des Erwachsenseins, die sich bis vor wenigen Jahren als kurzer Abschnitt mit mehreren kurzen Änderungen in der Status- und Rollenkonfiguration gestaltete, zu einer ausgedehnten, diversifizierten und hoch individualisierten Zwischenperiode entwickelte (Buchmann 1989a, 1989b). Die Übernahme einer neuen Rolle erzeugt einen gesellschaftlichen Sozialisationsbedarf, da das Individuum an die neuen Verhältnisse angepasst werden muss. Sozialisation beschränkt sich in der Folge nicht nur auf die Jugendzeit, sie findet entlang des gesamten Lebenslaufs immer wieder von neuem statt. Je mehr die Kontrolle von Statuspassagen Individuen überlassen wird, desto verstärkt haben sie die Möglichkeit, selber über die Wahlalternativen zu entscheiden, das Tempo des Ablaufs eines Rollenwechsels zu bestimmen oder einen einmal gewählten Lebenspfad ganz zu verlassen und den Lebenslauf in einer anderen Richtung zu verfolgen. Insofern folgt der Lebenslauf keiner linearen Entwicklung mehr (Heinz 1996). Charakteristisch für den Ablauf biographischer Übergänge sind heute individuelle Entscheidungen zwischen alternativen Lebenspfaden. Die Vorstellung von biographischen Übergängen als klar definierte Statuspassagen ist in fortgeschrittenen Industriegesellschaften nicht mehr angemessen (Buchmann 1989a). „Berufsbiographien zeichnen sich in vermehrtem Maß durch Diskontinuitäten aus, welche die bislang mehr oder weniger gültige lebenslange Stabilität der Status- und Qualifikationszuschreibungen über die Abschlüsse der schulischen und beruflichen Bildung bedrohen“ (Buchmann 1991, S. 218). Durch zuneh22 mende Diversifikation von Übergangsschritten entsteht das Problem, die individuelle Zeit mit den institutionalisierten Anforderungen bezüglich des Lebenslaufs in Übereinstimmung zu bringen. Statusübergänge sind klarer getrennt von der unmittelbaren sozialen Umgebung des Individuums (Levy 1996). Anstelle der Befolgung traditioneller Rituale ist es heute nötig, dass die Individuen im Rahmen von biographischen Übergängen aktiv bei der Aushandlung ihrer Biographie mit sozialen Netzwerken und institutionalisierte Gatekeepern4 beteiligt sind (Heinz 1996). Dieser Wandel in der sozialen Handhabung von Statuspassagen erzeugt verstärkt biographische Synchronisationsprobleme. „Mit dieser sozial strukturierten Diskontinuität korrespondiert die Verlängerung von Übergängen, die zu ausgedehnten und riskanten Statuspassagen werden“ (Heinz 2000, S. 179). Der Ablauf der Übergänge wird immer inkohärenter und stärker beeinflusst durch äussere, administrative Aspekte, die von Individuen eher als problematisch empfunden werden, denn als eine willkommene Vielfalt von Wahlmöglichkeiten (Levy 1996). Die damit verbun- dene zunehmende Konfliktivität dieser Übergangsphasen bietet verstärkt Raum zu Friktionen innerhalb des individuellen Lebensraums. Entsprechend ist der Übergang vom Bildungssystem in den Arbeitsmarkt unsteter geworden. „Der Beginn mehrerer Ausbildungen ist häufig mit einem Abbruch einer vorangegangenen verbunden. Man kann von einer Vervielfältigung der Übergänge vom Ausbildungssystem in das Erwerbssystem sprechen“ (Lauterbach und Sacher 2001, S. 265). „In den Zeitbegriffen, die hier zugrundegelegt werden, kann man sagen, daß es sich um eine verzeitlichte Individualität 4 Die wachsende Bedeutung von Gatekeepern und sozialem Kapital (Bourdieu 1983) im Prozess der gesellschaftlichen Modernisierung beschreibt Beck (1983, S. 61. Hervorh. im Original): Das Beziehungsnetz wird „zur Schaltstelle für die Vermittlung von Kontakten, (...) der ‚gute Name‘ zum Schlüssel, der die ‚Türen zu den Türen‘ öffnet.“ 23 mit entwicklungsgeschichtlicher Dynamik handelt, die gerade durch diese Dynamik gegen das chronologische Korsett drückt, in das sie durch das institutionelle Programm des modernen Lebenslaufs eingebunden ist“ (Kohli 1985, S. 21. Hervorh. im Original). Die frühere Standardisierung des Lebenslaufs wird im wesentlichen in drei Punkten beeinträchtigt. Einmal wurde die strikte Dreiteilung des Lebenslaufs in klar voneinander getrennte Lebensphasen der Ausbildung, der Erwerbstätigkeit und des Ruhestandes aufgelöst (Kohli 1985). Besonders die Passagen zwischen Ausbildung und Beruf sind „differenzierter, ausgedehnter und prekärer“ (Mayer 1998, S. 444) geworden. Es kam zu atypischen Beschäftigungsverhältnissen als Folge einer Flexibilisierung, Deregulierung und Individualisierung der Arbeitsverhältnisse (Lauterbach und Sacher 2001), und zu einer flexibleren Lebensplanung durch die Erhöhung individueller Wahlmöglichkeiten (Kohli 1985). Weiter verlor die frühere Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern „als Norm und Realität an Gewicht und Verbreitung“ (Mayer 1998, S. 445). Im Rahmen des gesellschaftlichen Modernisierungsprozesses kam es zu einer Modernisierung des Geschlechterverhältnisses (Pfau-Effinger 1996). Und die Strukturiertheit des Lebenslaufs anhand von Altersnormen wurde weniger einheitlich (Kohli 1985, Mayer 1998). Diese Phänome der Destandardisierung des Lebenslaufs werden erklärt „durch gestiegene Einkommen, die größere Handlungsoptionen eröffnen; durch Wertewandel und veränderte alternative Lebensentwürfe; durch die Zwänge eines hypostasierten Individualisierungsprozesses; durch die unbeabsichtigten Folgen der Bildungsexpansion; durch rascheren und radikalen technologisch-beruflichen Strukturwandel; durch die Folgen der Frauenemanzipation sowie durch demographische Diskontinuitäten in der absoluten Anzahl von Geburten“ (Mayer 1998, S. 445. Hervorh. im Original). Kohli (1985) vermutet, dass der neue Individualisierungsschub die Destandardisierung des Lebenslaufs 24 verstärkt. „Damit spitzt sich die Spannung zwischen Lebenslauf als institutionellem Programm und als subjektiver Konstruktion zu. Man kann sagen, daß es gerade die Dynamik des Institutionalisierungsprozess selber ist, die zu einer Unterminierung der strikten Chronologie des Lebenslaufs führt“ (Kohli 1985, S. 24). Allerdings konstatiert Mayer (1998) einige Unsicherheiten bezüglich der empirischen Gültigkeit der obigen Zusammenhänge: Es scheint „weder eine Unterstützung für die These einer zunehmenden Standardisierung des Lebensverlaufs bis in die 70er Jahre zu geben, noch hinreichende Evidenz für eine globale De-Institutionalisierung in den Jahrzehnten danach“ (Mayer 1998, S. 447). 3.4 Individuen als Handlungszentrum der Risikogesellschaft Den Vorgang, den Kohli mit der Institutionalisierung der Individualität und des Lebenslaufs und der schleichenden DeStandardisierung umschreibt, kann mit Ulrich Becks (1996) Konzept der Risikogesellschaft, der reflexiven oder zweiten Moderne verglichen werden. Für die vorliegende Arbeit ist von der umfangreichen Theorie die Beschreibung des eigendynamisch verlaufenden Prozesses von Interesse, der die Menschen einem gesellschaftlichen Individualisierungsschub bei relativ gleich bleibenden Abständen in der Einkommenshierarchie aussetzt. 3.4.1 Individualisierungsschub im Modernisierungsprozess In seinem populären Hauptwerk „Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne“ (1986) schreibt Beck, dass „wir Augenzeugen eines Gesellschaftswandels innerhalb der Moderne sind, in dessen Verlauf die Menschen aus den Sozialformen der industriellen Gesellschaft - Klasse, Schicht, Familie, Geschlechtslagen von Männern und Frauen - freigesetzt werden“ (Beck 1986, S. 115). Möglich wird der Wandel durch den „‚Fahrstuhl-Effekt‘: die Klassengesellschaft wird insgesamt eine Etage höher gefahren“ (ebd., S. 122. Hervorh. im Original). 25 Zwar bleiben die Abstände in der Einkommenshierarchie und die asymmetrische Verteilung des Reichtums unverändert doch partizipieren erstmals alle Soziallagen von den verbesserten Lebensbedingungen. Verteilungskonflikte ebben ab und damit verlieren soziale Klassen und Schichten ihre Funktion. Im Zuge der Mobilität, der Verbesserungen des Lebensstandards und der Bildungschancen gehen die herkömmlichen Orientierungspunkte für das Handeln der Menschen verloren. Individualisierung wird „als ein historisch spezifischer, widersprüchlicher Prozeß der Vergesellschaftung gefaßt: Individualisierung vollzieht sich unter den Bedingungen des wohlfahrtsstaatlich organisierten Arbeitsmarktes, ist in diesem Sinne also Produkt gesellschaftlicher Verhältnisse und führt ihrerseits hinein in einen bestimmten konfliktreichen Modus der Vergesellschaftung, nämlich in eine kollektiv individualisierte Existenzweise, die sich allerdings der Kollektivität und Standardisierung ihrer Existenzweise nicht ohne weiteres bewußt werden kann“ (Beck 1983, S. 42. Hervorh. im Original). Beck bezieht die Individualisierung also nicht auf die Herauslösung aus ständischen oder religiösen Bindungen der vormodernen Gesellschaften, sondern auf die Erodierung der sozialen Strukturen wie Klasse, Familie und Geschlechterrollen. Im Wegfallen dieser Bezugsrahmen wird ein neuer Modus der Vergesellschaftung gesehen: „Der oder die einzelne selbst wird zur lebensweltlichen Reproduktionseinheit des Sozialen (...) die Individuen werden innerhalb und ausserhalb der Familie zum Akteur ihrer marktvermittelten Existenzsicherung und ihrer Biographieplanung und -organisation“ (Beck 1986, S. 209. Hervorh. im Original). Um Überleben zu können, müssen sich die Einzelnen somit zum Zentrum ihres eigenen Lebens machen - dies allerdings immer in Bezug auf die Anforderungen und Bedürfnisse des Arbeitsmarktes, der ein Überleben erst möglich macht: „Der Schlüssel der Lebenssicherung liegt im Arbeitsmarkt. Arbeitsmarkttauglichkeit erzwingt Bildung. Wem das eine oder andere 26 vorenthalten wird, der steht gesellschaftlich vor dem materiellen Nichts“ (ebd., S. 214). Neben der Arbeitsmarkt- und der damit zusammenhängenden Bildungsabhängigkeit werden Individuen zudem konsumabhängig, abhängig von sozialrechtlichen Regelungen und Versorgungen, von Verkehrsplanungen, Konsumangeboten, Möglichkeiten und Moden in der medizinischen, psychologischen und pädagogischen Beratung und Betreuung. Entscheidungszwang In dieser Institutionenabhängigkeit der Moderne zeigt sich ein Widerspruch: Der Verfall der traditionalen Bindungen und Sozialformen ermöglicht eine neue Bewusstseinsform, die den Lebenslauf als frei gestaltbar und zur individuellen Verfügung stehend auffasst. Gegenläufig tauchen mit den Zwängen des Arbeitsmarktes und der Konsumexistenz sekundäre Instanzen und Institutionen als neue Kontrollmechanismen auf. Sicherheit in Form von Orientierungsvorgaben oder in bezug auf soziale Bindungen können die Institutionen der zweiten Moderne jedoch nicht mehr bieten. Sie orientieren sich nämlich noch an den „Normalbiographien“, basierend auf dem NormalArbeitsverhältnis und den vollständigen Familien. In der von Massenarbeitslosigkeit und verschiedensten Familienvarianten geprägten Wirklichkeit ist allerdings die selbstreflexive, „selbst hergestellte und herzustellende Biographie“ der Normalfall. Das heisst: Menschen aller Lebenslagen sind weniger in überindividuell festgehaltenen Arrangements gefangen, haben Wahlmöglichkeiten, können sich entscheiden und somit Chancen nutzen - einzig und allein die Wahl sich nicht zu entscheiden entfällt. Der Zwang zur Autonomie herrscht auch in den Bereichen, die aufgrund von mangelndem Bewusstsein oder fehlenden Alternativen eine Entscheidung eigentlich nicht zulassen. Als Entscheidungsträger, die - ob gewollt oder nicht - für oder gegen etwas stimmen, haben Individuen für die Folgen ihres Tuns die Verantwortung zu tragen: „Für den einzelnen sind die 27 ihn determinierenden institutionellen Lagen nicht mehr nur Ereignisse und Verhältnisse, die über ihn hereinbrechen, sondern mindestens auch Konsequenzen der von ihm selbst getroffenen Entscheidungen, die er als solche sehen und verarbeiten muss“ (ebd., S. 218). Dieser Aspekt wird verstärkt durch die Beschaffenheit der Ereignisse, die als einschneidend erlebt werden: Früher wurde ein Leben von kaum beeinflussbaren Zwischenfällen wie Naturkatastrophen oder Todesfällen in neue Bahnen gelenkt, heute sind es „eher Ereignisse, die als ‚persönliches Versagen‘ gelten, vom Nicht-Bestehen eines Examens bis zu Arbeitslosigkeit oder Scheidung“ (ebd.). Diese Eigenverantwortlichkeit der Subjekte erfordert eine konsequente Selbstbezogenheit im Hinblick auf die gesamte Lebensführung, die Beck als „Zwänge zur Selbstverarbeitung, Selbstplanung und Selbstherstellung von Biographie“ (ebd.) bezeichnet. Die Bereiche nehmen ab, „in denen gemeinsam verfaßtes Handeln das eigene Leben affiziert, und es nehmen die Zwänge zu, den eigenen Lebensverlauf selbst zu gestalten, und zwar auch und gerade dort, wo er das Produkt der Verhältnisse ist“ (Beck 1983, S. 58). Die Biographie der Menschen wird aus vorgegebenen Fixierungen gelöst und als Aufgabe in das individuelle Handeln gelegt (Beck 1983). Die „Anteile der entscheidungsoffenen, selbst herzustellenden Biographie nehmen zu. Individualisierung von Lebensläufen heißt also hier, daß Biographien ‚selbstreflexiv‘ werden: sozial vorgegebene Biographie wird in selbst hergestellte und herzustellende transformiert und zwar so, daß der einzelne selbst zum ‚Gestalter seines eigenen Lebens‘ wird, und damit auch zum ‚Auslöffler der Suppe, die er sich selbst eingebrockt hat‘“ (Beck 1983, S. 58. Hervorh. im Original). Der Einzelne musste im Individualisierungsprozess zunehmend lernen, „sich selbst als Handlungszentrum, als Planungsbüro in bezug auf seinen eigenen Lebenslauf, seine Fähigkeiten, Orientierungen, Partnerschaften usw. zu begreifen“ (Beck 1983, S. 28 59. Hervorh. im Original). Die biographischen Ereignisse gestalten sich nicht mehr als schicksalhafte Vorkommnisse, verursacht durch die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen er lebt. Mindestens teilweise sind sie nun Konsequenzen der eigenen Entscheidungen, die Individuen als solche erkennen und verarbeiten müssen und selbst zu verantworten haben (Beck 1983). Der Anstieg von Wahlmöglichkeiten zwingt die Individuen, „sich auf die eine oder andere Weise zu den gleichzeitig wirksamen Vorgaben in Bezug zu setzen, sich mithin selbst zu definieren“ (Meyer et al. 1999, S. 44). Es kommt zu einer wachsenden „Sensibilität für gesellschaftliche Zusammenhänge und Alternativen des Lebensplanung“ (Hradil 1983, S. 108). Mit der Ausbreitung formaler Bildung in den industriellen Gesellschaften sind „Individualisierungsprozesse in einem mehrfachen Sinne verbunden. Mit der Verlängerung schulischer Bildung wird die Herauslösung aus dem Herkunftsmilieu zum selbstverständlichen Massenschicksal. Zugleich werden traditionale Orientierungen, Denkweisen und Lebensstile durch universalistische Lehr- und Lernbedingungen, Wissensinhalte und Sprachformen umgeschmolzen oder kollektiv verdrängt. Bildung ermöglicht - unterschiedlich je Länge und Inhalt - ein Minimum an Selbstfindung- und Reflexionsprozessen. Das Durchlaufen des Bildungssystems ist darüber hinaus auch mit Selektionsprozessen verbunden und erweckt bzw. erfordert insofern individuelle Aufstiegsorientierungen, die selbst dort noch wirksam bleiben, wo ‚Aufstieg durch Bildung illusionär und Bildung in ein notwendiges Mittel gegen den Abstieg verwandelt und abgewertet wird“ (Beck 1983, S. 45. Hervorh. im Original). 3.4.2 Entscheidungen in der Multioptionsgesellschaft Auch Peter Gross sieht das Subjekt der Moderne als Bezugspunkt des eigenen Tun und Unterlassens. In seinem Hauptwerk „Die Multioptionsgesellschaft“ (1994) schreibt er: „Angesichts der multiplen Optionen einerseits und der verblassten Selbstverständlichkeiten andererseits, also weder mehr wissend, was er 29 eigentlich will, noch glaubend, was er soll, tut sich in der Tat eine Leere auf, die den Menschen von heute immer wieder auf sich selbst zurückwirft, zurückverweist“ (Gross 1984, S. 109, zitiert aus Abels 2000, S. 98). Das heisst: Gross sieht die Orientierung am eigenen Ich als eine Konsequenz des Orientierungsverlustes, resultierend aus dem Schwinden des ungeprüft Erwarteten. Er erkennt darin aber auch die Auswirkungen einer Gesellschaft, deren oberstes Kredo der Wille zur Steigerung, zum Vorwärts und zum Mehr ist. Da dieser zweite Punkt als Ergänzung zu dem bisher Dargestellten verstanden wird, soll er kurz erläutert werden. Die sich ständig vorwärtsdrängende Gesellschaft basiert nach Gross auf dem reflektierenden Bewusstsein, das sich im Kontext der Aufklärung bildete. Mut sich des eigenen Verstandes zu bedienen - wie es Kant formuliert - und logisch klares und richtiges Denken führen zur Entzauberung der Welt in dem Sinne, dass alles so oder aber auch anders sein kann als es scheint. Dadurch gibt es nichts Festes mehr, alles wird möglich; tradierte Arten von Bindungen, alle Verbindlichkeiten werden aufgelöst und durch Optionen, also Wahlmöglichkeiten, ersetzt. Die heutige Welt verspricht nun - vermittelt beispielsweise durch Fernsehen und Werbung - dass jede dieser Optionen, zu jeder Zeit und für jedes Individuum offensteht und realisierbar ist. Die Überforderung, die in dieser Vorgabe liegt, zeigt sich als „Realisierungsdruck“, ausgelöst durch die Angst, den Anschluss ans Leben, das Nützen der Möglichkeiten, zu verpassen. Um in der Gesellschaft mithalten zu können, müssen sich Individuen für eine Option entscheiden. Nach der Entscheidung fallen die nicht gewählten Möglichkeiten nicht weg, sondern bleiben als Möglichkeitshorizont erhalten und werden durch neu hinzukommende Anschlussmöglichkeiten ergänzt. Somit wird eine weitere Entscheidung notwendig, die am Horizont wiederum neue Optionen erscheinen lässt. Gross spricht in diesem Zusammenhang von einer Optionssteigerung, die sich immer stärker der 30 Kontrolle der Individuen entzieht. Die Optionen werden nämlich nicht geschaffen - sie schaffen sich selbst: Eine getroffene Entscheidung gebiert sozusagen neue Optionen, so dass der Gedanke daran was morgen oder übermorgen für Möglichkeiten offen stehen überwältigend wirkt. Das Lebens-Puzzle Die Menschen der Multioptionsgesellschaft stehen unter dem Druck, ihr individuelles „Lebens-Puzzle“ zusammenzusetzen, so dass durch das Verfolgen verschiedenster Möglichkeiten ein Mehr, Besser oder noch Mehr daraus resultiert. Vermeintlich frei und individualisiert, haben sie dem standardisierten Vorwärts-Zwang zu gehorchen - und die Konsequenzen daraus zu tragen. Abschliessbar ist das Puzzle nicht, da das Ansetzen eines Stücks mittels Wahl einer Option ja bereits wieder neue Anschlusspunkte offenlegt. Auf die Frage, ob sie ihr Puzzle bestmöglich arrangieren, rechtzeitig am richtigen Ort sind oder wieder einmal zu spät kommen, gibt es keine schlüssige und sicherlich keine kollektive Antwort. Orientierungshilfen könnten Regelungen bieten, die, vermittelt von Institutionen und Organisationen, den aktuellen Stand vernünftigen Handelns suggerieren. Da sie jedoch selbst Ergebnis von Wahlen sind, präsentieren sie sich bereits im nächsten Moment wieder in anderer Konstellation; ebenfalls ständigem Wandel unterworfen, bieten sie keine Hilfe. Gross sagt denn auch, dass „das wirklich Angstmachende in der modernen Gesellschaft (...) das Irreguläre und Unberechenbare“ sei (ebd., S. 100, zit. aus Abels 2000, S. 97). 3.5 Soziale Ungleichheit und soziale Lage Unter sozialer Ungleichheit werden „vorteilhafte und nachteilige Lebensbedingungen von Menschen, die ihnen aufgrund ihrer Positionen in gesellschaftlichen Beziehungsgefügen zukommen“ (Hradil 1995, S. 147) verstanden. Wird die Struktur sozialer 31 Ungleichheit in industriellen Gesellschaften betrachtet, untersucht man in der Regel die Verteilungen von Einkommen und Vermögen, beschäftigt sich mit Bildungsstrukturen, Machtverhältnissen und Prestigedifferenzierungen (Hradil 1983). Es lässt sich jedoch kaum übersehen, dass der schichtungssoziologische Zugang nicht alle Erscheinungen sozialer Ungleichheit zu umfassen vermag. Der Begriff der sozialen Ungleichheit schliesst eine Reihe von Phänomenen mit ein, die von den traditionellen Ansätzen für gewöhnlich übergangen werden (Hradil 1983). 3.5.1 Das mehrdimensionale Statusmodell Frühe Modelle der Schichtungssoziologie setzten soziale Ungleichheit häufig in Beziehung zum Prestige eines Individuums. Eine Alternative hierzu stellt das mehrdimensionale Statusmodell dar, dass weitere Dimensionen sozialer Ungleichheit umfasst (Hradil 1983). Soziale Ungleichheit wird dabei anhand mehrerer unabhängiger Dimensionen untersucht: Es sind dies ökonomische Faktoren, gemessen am Einkommen und Vermögen einer Person, das Wissen, gemessen in Form des höchsten erreichten Bildungsabschlusses, sowie Macht und Prestige (Dietz 1997, Hradil 1983, 1996). Diese Dimensionen stellen begehrte Güter (Hradil 1996) dar, die den Individuen als relativ stabile Merkmale eigen sind. „Der Besitz dieser Güter bedeutet für den einzelnen eine prinzipiell jederzeit wirksame Bedingung seiner Lebenschancen und eine vielfältig einsetzbare Ressource seiner Handlungsfähigkeit“ (Hradil 1983 S. 104. Hervorh. im Original). Die Ausprägungen dieser Ressourcen ergeben innerhalb der betrachteten Dimensionen vielfach abgestufte Statuslagen (Hradil 1983). „Wenn hieraus - eindimensionale oder mehrdimensionale - ‚Schichten‘ zusammengefaßt werden, so stellen diese Kollektive nominal abgegrenzte Personenkategorien mit gemeinsamer äußerer Lage dar“ (Hradil 1983, S. 104-105). Ein vorliegendes Gefüge sozialer Ungleichheit lässt sich durch die Ausgestaltung der Strukturebenen charakterisieren, die durch die32 se Ungleichheitsdimensionen festgelegt werden (Hradil 1996). Mit dem statusbezogenen Modell sozialer Ungleichheit besteht die Möglichkeit, „ein übersichtliches Abbild des Gefüges sozialer Ungleichheit zu schaffen, die Gesamtheit der Bevölkerungsmitglieder hierin einzuordnen und alle Individuen mit anderen vergleichen zu können“ (Hradil 1983, S. 106). Am Schichtbegriff wird kritisiert, er sei zu breit angelegt und unspezifisch, dadurch mangle es ihm an theoretischer Erklärungskraft; gleichzeitig wird dem Schichtbegriff vorgeworfen, er sei zu eng, da er nur die traditionellen, vertikal angeordneten Dimensionen sozialer Ungleichheit berücksichtige und zentrale Ungleichheitsdimensionen wie Geschlecht, Religion, Alter und Ethnie unbeachtet lasse (Lamprecht und Graf 1991). Ein Verschwinden der klassischen Konzepte von Stand und Klasse aus dem wissenschaftlichen Feld der Aufmerksamkeit stellt Beck wie im vorausgehenden Kapitel erläutert in Aussicht: „Bei möglicherweise konstant bleibenden oder sich sogar verschärfenden Ungleichheiten in Einkommen, Bildung und Macht werden die klassischen Themen und Konflikte sozialer Ungleichheit zunehmend verdrängt durch die Themen und immanenten Widersprüche eines gesellschaftlichen Individualisierungsprozesses, der die Menschen immer nachdrücklicher mit sich selbst und den Fragen der Entfaltung ihrer Individualität, ihres persönlichen Wohin und Wozu konfrontiert, sie aber zugleich einbindet in die Enge und Zwänge standardisierter und gegeneinander isolierter Lebenslagen“ (1983, S. 68). 3.5.2 Ungleichheit der sozialen Lage Die Forderung nach einer Veränderung der Ungleichheitsforschung wird damit begründet, dass die Wandlungen in der sozialen Struktur der Gesellschaft, die seit Ende der sechziger Jahre zu beobachten sind, durch die Vorstellung von übereinander liegenden Schichten nicht mehr in geeigneter Weise erfasst werden können (Buchmann 1991, Dietz 1997, Geißler 1996, Lamprecht und Graf 1991). Die neuen Ungleichheitskonstellatio33 nen könnten besser mit dem Begriff des Milieus5 erfasst werden, da einzelne Milieus einander nicht in einer vertikalen Relation zugeordnet werden müssen, sondern ein komplexes Neben- und Übereinander ermöglichen (Buchmann 1991). In den letzten Jahrzehnten rückten weitere Erscheinungen sozialer Ungleichheit ins Blickfeld, die nicht unter den Dimensionen des Statusmodells zu finden sind: „Dies trifft z.B. für die Ungleichheit der Arbeitsbedingungen zu, aber auch für regionale und sektorale Dispariäten der Infrastrukturversorgung, für Ungleichheiten auf dem Gebiet der Freizeitbedingungen und der sozialen Sicherheit (Sicherheit des Arbeitsplatzes, der Gesundheitsund Altersversorgung), sowie für ungleiche Kontaktmöglichkeiten und die Betroffenheit von Vorurteilen“ (Hradil 1983, S. 106-107). Es wird dahingehend argumentiert, dass soziale Ungleichheiten grundsätzlich an Bedeutung verloren hätten, oder dass sich die Ungleichheitsstrukturen soweit kompliziert hätten, dass konventionelle Schichtvorstellungen der vorfindlichen gesellschaftlichen Organisation nicht mehr gerecht werden können (Stamm und Lamprecht 1996, S. 510). Die zusätzlichen Aspekte der Lebenslage sind nicht neu, doch sie scheinen im Rahmen des gesellschaftlichen Modernisierungsprozesses an Bedeutung gewonnen zu haben. Diese neuen Aspekte stellen eine Differenzierung der Struktur sozialer Ungleichheit dar, weil sie mit den bisher betrachteten Dimensionen immer weniger stark korrelieren, mit ihnen rücken neue Qualitäten der Ungleichheit nach vorn. Die Ausprägungen dieser Kriterien treten vermehrt in bestimmten Kombinationen auf, die sich spezifischen Problemlagen für einzelne Gruppen zuordnen lassen (Hradil 1983). Die Betrachtung divergierender milieuspezifi- 5 Unter einem Milieu versteht Hradil (1995, S. 161) „die bei einer bestimm- ten Personengruppe typischerweise zusammentreffenden Grundwerte, Grundeinstellungen und Verhaltensmuster (...) Das Leben in solchen Milieus prägt Menschen und läßt sie ihre jeweilige Um- und Mitwelt (...) in bestimmter Weise wahrnehmen und nutzen.“ 34 scher Lebensumstände und Orientierungen verdeutlicht, dass sich vergleichbare strukturelle Bedingungen beispielsweise bezüglich Einkommen, sozialer Sicherheit oder Arbeitsbedingungen nicht für alle Betroffenen gleich auszuwirken brauchen. Der Einfluss struktureller Bedingungen sozialer Ungleichheit auf den Lebenslauf des Einzelnen wird durch die Funktionalität und die Interpretation dieser Bedingungen im Rahmen spezifischer Milieus mitbestimmt (Hradil 1983). „Soziale Milieus bilden sich unter den Bedingungen des gewachsenen Möglichkeitsraums nun nicht mehr durch ‚Beziehungsvorgabe‘, deren dominierende Bedeutungsebene in geschichtlichen oder Klassengesellschaften die ‚Distinktion‘ war. Vielmehr entstehen sie in der Erlebnisgesellschaft durch ‚Beziehungswahl‘, in der die gegenseitige soziale Wahrnehmung, ‚subjektive Milieumodelle‘, leicht entschlüsselbare Symbole und auch im flüchtigen Kontakt gut verständliche Zeichen eine immer größere Rolle spielen“ (Berger 1994, S. 257. Hervorh. im Original). Als wichtige Ursachen für diese Änderungen werden insbesondere die Bildungsexpansion genannt, durch welche die Bildungschancen breiter Bevölkerungskreise gestiegen seien (Krais 1996), sowie der Ausbau des Wohlfahrtsstaates, der zu einer kollektiven Erhöhung des materiellen Lebensstandards geführt hat (Buchmann 1991, Lamprecht und Graf 1991). Individualisierungsprozesse „greifen erst dann und genau in dem Maße, in dem die Bedingungen der Klassenformierung durch materielle Verelendung, wie sie Marx vorhergesagt hat, überwunden werden“ (Beck 1983, S. 48. Hervorh. im Original). Bei vergleichbaren Ungleichheitsrelationen hat sich das Niveau in den letzten Jahrzehnten verschoben. Diese Niveauveschiebung kann für die Lebensumstände der Menschen viel bedeutsamer sein, als die auf dem neuen Niveau fortbestehenden Abstände. Besonders stark ist die Auswirkung solcher Verschiebungen wo die Lage am schlechtesten war, in den am meisten benachteiligten Regionen sozialer Ungleichheit (Beck 1983). 35 Es ist ein rascher, anhaltender Wandel „in den materiellen und soziokulturellen Lebensbedingungen und -perspektiven der Menschen unterhalb der Aufmerksamkeitsschwelle der Ungleichheitsforschung“ zu beobachten“ (Beck 1983, S. 40. Hervorh. im Original). Diese Entwicklung steht in Zusammenhang mit dem beobachteten „Individualisierungsschub, in dessen Verlauf auf dem Hintergrund eines relativ hohen materiellen Lebensstandards und weit vorangetriebener sozialer Sicherheiten durch die Erweiterung von Bildungschancen, durch Mobilitätsprozesse, Ausdehnung von Konkurrenzbeziehungen, Verrechtlichung der Arbeitsbeziehungen, Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit und vielen anderen mehr die Menschen in einem historischen Kontinuitätsbruch aus traditionellen Bindungen und Versorgungsbezügen herausgelöst und auf sich selbst und ihr individuelles ‚(Arbeitsmarkt-)Schicksal‘ mit allen Risiken, Chancen und Widersprüchen verwiesen wurden und werden“ (Beck 1983, S. 41. Hervorh. im Original). Als Konsequenz wurde die Nützlichkeit der traditionellen Begriffe von Schichten und Klassen in Frage gestellt: Durch die gestiegenen Konsumchancen und die vertiefte soziale Sicherheit sind die Grenzen zwischen Oben und Unten zwar nicht aufgehoben worden, doch sie wurden überlagert und aufgeweicht. Das führte dazu, dass sich keine klar abgegrenzten Schichten oder Klassen mehr festmachen lassen (Lamprecht und Graf 1991). Es wird immer schwieriger, benachteiligte Bevölkerungsgruppen in einem vertikalen System sozialer Ungleichheit zu klassifizieren, da die Muster von Privilegien und Benachteiligungen über alle Lebensbereiche hinweg uneinheitlich sind (Buchmann 1991). Die Ungleichheit hat zwar nicht einer umfassenden Gleichheit Platz gemacht, doch durch das Anheben des Wohlstandes verlor die Auseinandersetzung um knappe Güter ihre dominierende gesellschaftliche Rolle (Lamprecht und Graf 1991). Wo alle in gleichem Masse ihre Stellung verbessern, verlieren die Unterschiede innerhalb des „Fahrstuhls“ (Beck 1986) ihre 36 Bedeutung, auch wenn sie nicht verschwinden. Horizontal ausgeprägte Differenzierungen gewannen vermehrt Bedeutung für die Ausprägung der Lebenschancen und Lebensbedingungen der Individuen (Lamprecht und Graf 1991). Hradil (1983) schlägt deshalb mit dem Konzept der sozialen Lage ein neues Modell zur Untersuchung sozialer Ungleichheit vor, das drei Ebenen umfasst. Erstens die Ebene der strukturellen Lebensbedingungen, sodann die Ebene milieuspezifischer Lebenswelten und schliesslich die Ebene individueller Lebenslagen. Es erscheint angebracht, „in einer ‚zeitgemäßen‘ Konzeption des Gefüges sozialer Ungleichheit zwischen der Struktur- und der Individualebene eine ‚mittlere Ebene‘ vorzusehen, wo milieuspezifische Prozesse anzusiedeln sind, die möglicherweise als ‚Filter‘ oder ‚Verstärker für strukturelle Ausgangslagen wirken, und so die individuelle Relevanz von Strukturbedingungen erst prägen“ (Hradil 1983, S. 114. Hervorh. im Original). In modernen Industriegesellschaften besteht ein komplexes Zusammenwirken von klassenspezifischen, milieuspezifischen und atomisierten Erscheinungsformen sozialer Ungleichheit (Berger 1994). Anzeichen für eine Nivellierung oder gar ein Auflösen sozialer Unterschiede können allerdings Lamprecht und Graf (1991) in den ihnen vorliegenden Daten für die siebziger und achtziger Jahre empirisch nicht beobachten. Hradil sieht die Konzepte der sozialen Lage „eher als Ergänzung denn als Ersatz schichtungssoziologischer Modelle“ (Hradil 1983, S. 117), wobei die Ermittlung der sozialen Lage eines Individuums als beträchtlicher Informationsgewinn angesehen wird. 3.5.3 Die (anhaltende) Bedeutung traditioneller Dimensionen sozialer Ungleichheit Die Thesen bezüglich der Differenzierung, Pluralisierung oder Individualisierung herkömmlicher Ungleichheitsstrukturen in industriellen Gesellschaften sind umstritten. Mayer und Blossfeld stellen fest, dass „die These der Individualisierung nicht den Status einer Theorie besitzt, die empirisch über37 prüfbar wäre“ (1990, S. 297). Die Thesen zu Individualisierung und den Konzepten der sozialen Lage können „wegen ihrer mangelnden empirischen Evidenz und ihres theoretischen Status allenfalls als der Beginn, nicht aber als das Ergebnis der Debatte akzeptiert werden (...) Bei der Lektüre von Beck fühlt man sich wie Alice im Wunderland, als sie ‚Jabberwocky‘ las: ‚Somehow it seems to fill my head with ideas - only I don’t exactly know what they are.‘“ (Mayer und Blossfeld 1990, 312313). Vielfältig wird die Kritik geäussert, dass die traditionellen Dimensionen sozialer Ungleichheit noch immer eine ungebrochene Bedeutung besässen oder sogar an Einfluss zugelegt hätten. In verschiedenen Untersuchungen hat sich gemäss Krais (1996) gezeigt, dass zwischen den untersten und obersten Klassen beziehungsweise Schichten die Abstände angewachsen sind. Um Becks (1996) Metapher vom Fahrstuhl zu verwenden, der die Mitglieder aller Gesellschaftsschichten aufwärts und manchmal auch abwärts transportiert, liegen nun zwischen den Kindern aus privilegierten und jenen aus benachteiligten Schichten mehr Stockwerke als früher (Krais 1996). Die „Kinder aus den benachteiligten Schichten haben den Fahrstuhl nach oben in der Regel nicht erwischt. Nach oben gelangten insbes. Kinder aus der Mitte mit der Folge, daß sich die Gefahr sozialer Ausgrenzung für die Zurückgebliebenen, die in eine Minderheitenposition geraten sind, verschärft (...) Die Fahrstuhlmetapher verschleiert, daß die Armutskluft, der Abstand im Lebensstandard zwischen den Sozialhilfeempfängern und dem Bevölkerungsdurchschnitt, kontinuierlich größer geworden ist“ (Geißler 1996, S. 327). Lamprecht und Graf (1991) bemerken, „daß gewisse theoretische Positionen entsprechend dem konjunkturellen Verlauf der Gesellschaft einen eigenen Konjunkturzyklus durchlaufen. In Phase wirtschaftlicher Rezession scheint ein Hang dazusein, eher die Kultur ins Zentrum der Überlegungen zu stellen, in Phasen 38 des Aufschwunges eher die Struktur“ (S. 193). Insofern müssen sich die als Alternative zur Schichtungssoziologie gedachten Ansätze möglicherweise den Vorwurf gefallen lassen, die Verallgemeinerung ihrer Theorien auf der „Grundlage zu kurzer Zeitspannen“ (Giddens 1983, S. 15) betrieben zu haben. Beck (1983) erkennt selbst die Labilität des Individualisierungsschubs, sobald Gruppen, die dies nicht erwartet hätten, von Arbeitslosigkeit betroffen werden und aufgrund der stattgefundenen Individualisierung trotz sozialstaatlicher Sicherungen radikale Einbrüche in ihrer Lebensführung hinnehmen oder befürchten müssen. Sobald existenzielle Grundlagen bedroht werden, gewinnen die alten Dimensionen sozialer Ungleichheit schlagartig wieder grosse Bedeutung für die Handlungs- und Entscheidungsmuster im Lebenslauf. Trotz der zunehmenden Heterogenität von sozialen Lagen bleiben grundlegende Ungleichheitsrelationen erhalten, so ist geht die Entwicklung fortgeschrittener Industriegesellschaften in die Richtung einer Verfestigung sozialer Ungleichheiten (Buchmann 1991, S. 215). In den letzten Jahrzehnten lassen sich einige Aufstiegsbewegungen und auch kollektive Abstiege beobachten, doch insgesamt „weist die Struktur sozialer Ungleichheit in den entwickelten Ländern alle Attribute einer historischpolitisch genau betrachtet eigentlich überraschenden Stabilität auf“ (Beck 1983, S. 35. Hervorh. im Original). Buchmann findet für die Schweiz 1991 in ihrer empirischen Analyse des Wandels sozialer Schichtung, „daß sich soziale Lebenslagen nach wie vor auf der vertikalen Dimension sozialer Ungleichheit relativ eindeutig abbilden lassen“ (Buchmann 1991, S. 223-225). Geißler (1996) stellt fest, dass sich in den letzten Jahren ohne Zweifel die Struktur der modernen Gesellschaft differenziert, pluralisiert und individualisiert hat. Er wirft vor diesem Hintergrund die Frage auf, ob diese zunehmende Vielfalt gleichbedeutend mit einem Verschwinden vertikaler Strukturen 39 sei. Der „main stream“ suggeriert diese Vorstellung (Geißler 1996, S. 312-322): „Er hat sich von der Entdeckung der neuen Vielfalt offensichtlich so faszinieren lassen, daß er die fortbestehenden vertikalen Strukturen und deren Bedeutung nicht mehr angemessen wahrnehmen und einschätzen kann und daß er daher auch die ursprüngliche Fragestellung der Sozialstrukturanalyse als Ungleichheitsforschung - nämlich soziale Ungleichheiten in sozialkritischer Absicht aufzuspüren, um sie zu mildern - z.T. aus den Augen verloren habe“. Geißler (1996) fügt kritisch an, dass die traditionelle Sozialstrukturanalyse sich zumindest teilweise zu exklusiv auf objektive Ressourcen wie das Einkommen fokussierte und dabei die Akteure selbst aus dem Blickfeld geraten seien. Aber er bemängelt an der Abkehr von den traditonellen Dimensionen sozialer Ungleichheit, dass sich dadurch die Ungleichheitsforschung zur Vielfaltforschung wandelt, Lebenschancenforschung sich zu Lebensstilforschung einengt und schliesslich die „Kritik an sozialen Ungerechtigkeiten (...) der Freude über die bunte Vielfalt“ (Geißler 1996, S. 322. Hervorh. im Original) von Soziallagen, Milieus und Lebensstilen weicht. Die neuen Ansätze zeigen auf, dass zwar das Alltagshandeln tatsächlich komplizierter ist als von den konventionellen Ansätzen zur sozialen Ungleichheit angenommen wird. Und doch verweisen diese zumindest implizit häufig auf die alten Erklärungsmuster (Stamm und Lamprecht 1996). Buchmann (1991) vertritt die Auffassung, „daß traditionelle Dimensionen sozialer Ungleichheit wie Bildung, berufliche Position und Einkommen auch heute noch die Kernstruktur von sozialen Lagen ausmachen und die Mobilitätschancen von Gesellschaftsmitgliedern weitgehend prägen. Soziale Lebenslagen sind jedoch in vermehrtem Maße durch feingliedrige bildungsmäßige Abstufungen, hohe berufliche Spezialisierungen und differenzierte einkommensmäßige Unterschiede charakterisiert, so daß sich die Komplexität der Schichtungsstruktur insgesamt stark erhöht hat. Die zunehmend 40 komplexere Struktur sozialer Ungleichheit spiegelt sich in den schwächeren Verknüpfungen zwischen formaler Qualifikation, beruflicher Position und Einkommen. Insgesamt nimmt daher die Kristallisation der gesamtgesellschaftlichen Schichtungsstruktur ab: Individuelle Statuskonfigurationen sind häufiger durch Statusinkonsistenzen gekennzeichnet“ (Buchmann 1991, S. 217). 41 3.6 Reproduktion sozialer Ungleichheit Wissenschaftliche Studien zeigen, dass sich „das schweizerische Bildungssystem gegenüber den sozialen Herkunftsmerkmalen der Schülerinnen und Schüler nicht neutral verhält“ (Lamprecht und Stamm 1997, S. 40). Anders herum formuliert: Die Möglichkeit einen universitären Abschluss zu erlangen wird auch in der heutigen Zeit noch von Gesellschaftsstrukturen wie dem Herkunftsmilieu beeinflusst. Zentral ist insbesondere das Bildungsniveau der Eltern, das Merkmale wie Nationalität, Wohnort und auch Geschlecht zurücktreten lässt: „Grundsätzlich gilt: Die Chance, an den höheren Bildungsgängen zu partizipieren, ist um so grösser, je höher die Bildung der Eltern ist“ (ebd. S. 41). Für VertreterInnen der „Wandlungstheorien“ werden diese Herkunftseffekte durch die Bildungsentwicklung und den Ausbau des Bildungsangebotes immer stärker verblassen. Empirische Daten weisen jedoch in eine andere Richtung: „Trotz des Ausbau des Bildungssystems konnte relativ gesehen keine Erhöhung der Bildungschancen für Kinder aus unteren sozialen Lagen festgestellt werden“ (ebd. S. 42). Dies spricht für die „Reproduktionstheorien“, die davon ausgehen, dass die asymmetrische Verteilung von Ressourcen und Gütern innerhalb einer Gesellschaft, der Logik des herrschenden Systems entspricht. Besondere Beachtung fanden Bourdieus (1982, 1985) Überlegungen bezüglich der ausserordentlich geschickt cachierten Zusammenhänge zwischen dem Bildungssystem und der Vererbung von sozialen Privilegien. „Bildung ist in modernen, industrialisierten Gesellschaften zu einem wichtigen Kriterium der sozialen Differenzierung geworden“ (Krais 1983, S. 199). Ungleichheiten werden von einer Generation auf eine andere übertragen, die Schichtungsstruktur reproduziert sich intergenerationell. Dies bedeutet, „daß Ressourcen der Herkunftsfamilie während des eigenen Lebens erst in sichere Statuspositionen und Klassenlagen 42 umgesetzt werden müssen (Mayer und Blossfeld 1990, 297). Beck (1983) stellt fest, dass heue eine Verschiebung von der klassischen Frage nach den Gründen sozialer Ungleichheit zur Frage nach der Erklärung der Reproduktion sozialer Ungleichheit angebracht sei. Die Struktur des Bildungssystems drängt die Auszubildenden dazu, ihre Karriere als ein Produkt der eigenen Interessen und Fähigkeiten aufzufassen. Dies veranlasst das Individuum zu einem Selbstbild, das um die Konzepte der eigenen Interessen und Fähigkeiten zentriert ist. In dieser Weise wird die Einsicht erschwert, dass das Schicksal eines Individuums durch die Zugehörigkeit zu einer Statusgruppe wesentlich mitbestimmt wird (Lenhardt 1992). Eine Aufgabe des Bildungssystems besteht darin, den Individuen basierend auf ihren Leistungen gesellschaftliche Positionen zuzuweisen. Somit ist ein gewisses Mass an Ungleichheit für die Erhaltung des Gesellschaftssystems funktional und nicht beliebig reduzierbar. Dies stellt eine funktionalistische Rechtfertigung bestehender Ungleichheiten dar (Lamprecht 1991, S. 129): „Da die Menschen von Natur aus ungleich sind, erreichen sie im Wettlauf der Leistungsgesellschaft verschiedene Stellungen, die je nach ihrer Wichtigkeit für die Gesellschaft unterschiedlich belohnt werden. Ein Zurückbinden der Leistungsbereiten und ein Zurückstufen der sie motivierenden Belohnungen hätte ein spürbares Nachlassen der Produktivität in allen Lebensbereichen und dadurch einschneidende Nachteile für sämtliche Gesellschaftsmitglieder zur Folge.“ Eine rein funktionalistische Sichtweise greift allerdings zu kurz: Die unterschiedlichen Funktionen des Bildungssystems lassen sich nicht losgelöst von ihrem historischen und gesellschaftlichen Kontext bestimmen, aufgrund der Widersprüchlichkeit der Gesellschaft selbst sind sie untereinander widersprüchlich (Graf und Lamprecht 1991). Indem das Bildungssystem dazu beiträgt, askriptive Kategorien in einer modernen Form zu 43 reproduzieren, liegt es im Widerspruch zu den Prinzipien der Chancengleichheit und der Erlangung von Status basierend auf persönlicher Leistung (Lenhardt 1992), denen es sich vordergründig verschrieben hat. „Beauftragt, Werte zu schaffen, die sich unmittelbar auf die der Gesellschaft beziehen, für die es produziert, hat ein reales Bildungssystem unweigerlich vielfältige und inkommensurable Funktionen“ (Bourdieu und Passeron 1971, S. 81). 3.6.1 Chancenungleichheiten und Bildungsexpansion Die Individualisierung der letzten Jahrzehnte hatte nicht zur Folge, dass die Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht ihre Bedeutung für die Strukturierung des Lebenslaufs gänzlich verlor. Im Gegenteil: Die soziale Stellung beeinflusst noch immer in ausgeprägter Weise die strukturellen Chancen im Bildungssystem und im Beruf. Im Verlauf des gesellschaftlichen Modernisierungsprozesses ist die soziale Ungleichheit nicht zurückgegangen, sie hat lediglich andere Formen angenommen (Buchmann 1989a). „Im Gesellschaftsmodell der Nachkriegszeit wird der Gleichheitsanspruch auf zwei Arten einzulösen versucht: Durch den Ausbau des umverteilenden Wohlfahrtsstaates und durch die Institutionalisierung des Prinzips der Chancengleichheit“ (Lamprecht 1991). Das Prinzip der Chancengleichheit basiert auf der Vorstellung einer basalen formalen Gleichheit der Gesellschaftsmitglieder (Graf und Lamprecht 1991). Chancengleichheit ist von fundamentaler Bedeutung für die Verschleierung der Reproduktion sozialer Ungleichheiten durch das Bildungssystem, denn jede Reproduktionsstrategie ist „unausweichlich auch eine Legitimationsstrategie, die darauf abzielt, sowohl die exklusive Aneignung wie auch ihre Reproduktion sakrosankt zu machen“ (Bourdieu 1983, S. 198). Die Ideologie der Chancengleichheit dient der Gesellschaftsordnung, da sie die sozial konservative Funktion des Bildungssystem verschleiert: Dieses ist das geeignetste Instrument zur Vererbung kulturel44 len Kapitals und zur Legitimierung dieses Reproduktionsprozesses (Bourdieu und Passeron 1971). Bildungssysteme sind an den Regeln der Verteilung sozial wichtiger Güter ausgerichtet. Sie begründen und legitimieren das System ungleicher Verteilung indem sie soziale Unterschiede auf ein Modell individueller Fähigkeiten und der Konkurrenz zurückführen (Graf und Lamprecht 1991). Leistungsgerechtigkeit und Chancengleichheit sind zentrale Aspekte, um Selektionsprozesse innerhalb des Bildungssystems zu rechtfertigen. Chancengleichheit6 bezieht sich auf die Vorstellung, dass zum Zeitpunkt des Schuleintritts alle über die gleichen Voraussetzungen verfügen, um sich dem Wettlauf um die besten Positionen auszusetzen (Bornschier 1998, Lamprecht 1991). Ausgehend von dieser Situation sollten nicht askriptive Merkmale wie die soziale Herkunft oder das Geschlecht entscheidend für den Erfolg im Bildungssystem und die spätere Zuweisung auf gesellschaftliche Statuspositionen sein, sondern ausschliesslich individuelle Fähigkeiten und Leistungen sollten den persönlichen Erfolg bestimmen (Bornschier 1998). In diesen Vorstellungen bezüglich Chancengleichheit und Leistungsgerechtigkeit liegt die Ursache, dass die ausgeprägten Differenzierungen und Hierarchien im Bildungssystem weitgehend hingenommen werden. Über die Verbindung von schulischer Struktur und Gesellschaftsstruktur rechtfertigt Chancengleichheit nicht nur Abstufungen im Bildungssystem, es bewirkt auch eine weitgehende Legitimation des gesellschaftlichen Macht- und Ungleichheitsgefüges (Lamprecht und Stamm 1996). „Chancengleichheit als formales Wettbewerbsprinzip findet ihre Umsetzung im Prinzip der Gleichbehandlung. Niemand darf wegen seiner sozialen Herkunft, 6 „Chancengleichheit im statistischen Sinn ist dann gegeben, wenn tatsäch- lich verschiedene Bevölkerungsgruppen proportional zu ihrer Größe in den einzelnen Schulstufen vorkommen, wenn also beispielsweise zwischen sozialer Herkunft und Schulerfolg eine Zufallsbeziehung bestünde“ (Lamprecht 1991, S. 134). 45 seines Geschlechts, seines Wohnortes, seiner Sprache oder seiner religiösen oder ethnischen Zugehörigkeit im Bildungssystem benachteiligt werden. Allein schulische Leistungen - objektivierbar gemacht in einem transparenten Prüfungs- und Berechtigungswesen (z.B. Zugang zur Universität) - haben über schulischen Auf- oder Abstieg zu entscheiden“ (Lamprecht und Stamm 1996, S. 16-17). Es hat sich jedoch gezeigt, dass die Ergebnisse im Bildungsbereich nicht unabhängig von askriptiven Merkmalen wie Geschlecht und soziale Herkunft sind (Lamprecht und Graf 1991, Lamprecht und Stamm 1996). Ein unterschiedliches Erziehungsverhalten und Bildungsklima in der Familie bewirken, dass vor allem Kinder aus tieferen Herkunftsschichten in höheren Bildungsgängen nicht ihrem Anteil der jeweiligen Altersgruppen entsprechend vertreten sind (Lamprecht und Stamm 1996). Die Bildungsentwicklung der letzten fünfzig Jahre war durch ein kontinuierliches Wachstum des Bildungssystems geprägt. Der Zugang zu den mittleren und höheren Bildungsgängen öffnete sich dabei auch für Kinder aus den unteren sozialen Lagen. Von der Öffnung des Bildungsbereichs konnten in besonderem Ausmass Frauen profitieren. Deren massive Benachteiligung bei den mittleren Bildungsteilen wurde weitgehend beseitigt, allerdings sind Frauen auf den obersten Bildungsstufen noch immer nicht angemessen repräsentiert (Lamprecht und Stamm 1996). Die Bildungsexpansion führte zu einer massenhaften Vermehrung von Bildungszertifikaten. Nach den Marktgesetzen bewirkte dies eine Abwertung der Bildungstitel, eine eigentliche Bildungsinflation (Bornschier 1991), denn „für die Umsetzung von formaler Bildung in Privilegien ist nicht der eigentliche Bildungsinhalt entscheidend, sondern der relative Vorsprung eines Bildungsabschlusses zu anderen Abschlussmöglichkeiten“ (Lamprecht 1991, S. 148). Je mehr Leute die höchsten formalen Bildungsabschlüsse erlangen, desto geringer ist der damit verbundene Ertrag an Prestige (Allmendinger 1989). Anstelle der angestreb46 ten Reduktion herkunftsspezifischer Benachteiligungen wurde die Selektion auf eine höhere Stufe verschoben (Bornschier 1998, Lamprecht und Stamm 1996), was zu einer Inflation des Wertes der im Lebenslauf erzielten Bildungsresultate führte. In der Folge verwandelte sich Bildung von einem Mittel des sozialen Aufstiegs zunehmend zu einem notwendigen Mittel gegen den Abstieg (Bornschier 1998). Dadurch wuchs die Bildungsabhängigkeit, „immer weitere Gruppen geraten in den Sog von Bildungsaspirationen“ (Beck 1983, S. 50). Der erreichte Bildungsabschluss leistet keine Gewähr mehr für eine angemessene berufliche Position, sondern er bildet die notwendige Voraussetzung dafür, dass ein Individuum überhaupt noch ohne massive Benachteiligungen in den Arbeitsmarkt eintreten kann (Lamprecht und Stamm 1996). Um die soziale Position zu bewahren, müssen immer grössere Bildungsansprüche erfüllt werden. Die „Spirale von mehr und mehr Bildung, um die Position der Kinder zu verbessern, und mehr und mehr Bildung, um die Position der Kinder zu bewahren, ist zweifellos ein Kern der Bildungsexpansion in unserem Jahrhundert“ (Bornschier 1998, S. 245). „Drei Jahrzehnte Bildungsreformen und Bildungsexpansion - u.a. mit dem Ziel höherer Bildungsgerechtigkeit und besserer Chancengleichheit - haben an der schichtspezifischen Chancenungleichheit nur wenig verändert, im Bereich der höheren Bildungsabschlüsse haben schichtspezifische Ungleichheiten sogar zugenommen“ (Geißler 1996, S. 325). Ob soziale Ungleichheiten als gerecht empfunden werden, hängt wesentlich davon ab, ob man darin entsprechend den erbrachten Leistungen auf- und absteigen kann. Geschichtete Gesellschaften erheben den Anspruch, offene Gesellschaften zu sein. Soziale Mobilität7 sollte auf Grund meritokratischer Aspekte erfol7 Zum Begriff der Mobilität schreibt Hradil (1996, S. 157-158): „Bewegun- gen von einer Position zur anderen (...) werden in der Soziologie als ‚soziale Mobilität‘ bezeichnet. Bewegungen zwischen ungleich gut ausgestatteten Positionen, also Statusveränderungen, heißen ‚vertikale Mobilität‘ 47 gen. Die Untersuchung der vertikalen Mobilität liefert somit Aufschluss über die Legitimität eines Ungleichheitsgefüges (Hradil 1996). Ein „starker Herkunftseffekt beim Bildungserwerb gilt aber als wenig legitim. Mit der Expansion der Bildungschancen wurde in den letzten Jahrzehnten diese unerwünschte Konsequenz zu mildern versucht“ (Bornschier 1991, S. 39). Da das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit (Graf und Lamprecht 1991, Hradil 1996) innerhalb des Bildungssystems „vor allem auf Blindheit gegenüber der sozialen Ungleichheit der Bildungschancen beruht, hat die einfache Beschreibung der Relation zwischen Studienerfolg und sozialer Herkunft bereits kritische Sprengkraft“ (Bourdieu und Passeron 1971, S. 86). 3.6.2 Der Einfluss der sozialen Herkunft Die gesellschaftliche Modernisierung und die damit verbundene Expansion des Bildungswesens brachte bestehende gesellschaftliche Ungleichheitsstrukturen nicht automatisch zum Verschwinden (Hradil 1996, Lamprecht 1991, Lamprecht und Stamm 1996, Lenhardt 1992, Mayer und Blossfeld 1990, Meyer et al. 1999), denn die Bildungschancen haben sich für benachteiligte Kinder nicht verbessert. So konnten diese zwar vermehrt höhere Bildungsstufen erreichen, doch da ihre Aufstiegschancen nicht überproportional verglichen mit Kindern aus der Mittel- und Oberschicht anstiegen, blieben die früheren sozialen Ungleichheiten weitgehend bestehen (Hradil 1996, Lamprecht und Stamm 1996). Für Kinder von Akademikern und höheren Kaderleuten sind die Chancen, eine Mittelschule zu besuchen und ein Studium zu beginnen, 1990 rund achtmal höher als für Kinder von unqualifizierten Arbeitern und Angestellten (Lamprecht und Stamm 1996). Trotz Bildungsexpansion und den wohlfahrtsstaatlichen Entwicklungen wurden die Relationen zwischen gesellschaftli- (...) Was die Bestimmungsgründe vertikaler Mobilität betrifft, so trennt man zwischen strukturell ‚erzwungenen‘ Auf- und Abstiegen und individuell ‚geleisteten‘.“ 48 chen Ungleichheitslagen nicht zum Verschwinden gebracht: „Nach wie vor ist die Wahrscheinlichkeit, daß Kinder von Industriearbeitern Ärzte und Architekten werden, sehr gering“ (Beck 1983, S. 52). „Es findet sowohl eine Eliminierung beim Hochschulzugang wie während des Studienverlaufs statt. Untere Schichten sind an der Hochschule klar unterrepräsentiert“ (Leemann 2002, S. 27). Das Schulsystem nimmt „objektiv eine um so totalere Eliminierung vor“ (Bourdieu und Passeron 1971, S. 20), je benachteiligter die soziale Klasse ist. „Die Reproduktionsfunktion macht Bildung in einem verzweigten, auf Prüfung und Berechtigung aufbauenden System zu einem knappen Gut. Erst durch sie gewinnt die hierarchische Gliederung des Bildungssystems ihren Sinn“ (Lamprecht 1991). Die Rechtfertigung der schulischen Auslese gelingt nur, wenn diese auf der Basis von formalen Gleichheitsprinzipien erfolgt. Formale Gleichheit drückt sich aus in der Forderung nach Gleichbehandlung der Individuen, also dem Wunsch nach Chancengleichheit zum Zeitpunkt des Beginns der schulischen Laufbahn. Lamprecht und Stamm (1996) finden wie in Abbildung 3.2 angegeben für die Schweiz 1990 bei 20-23jährigen Personen eine durch askriptiven Merkmale erklärte Varianz der Bildungsunterschiede von 16,8%. Dabei ergibt die Bildung des Vaters den wesentlichsten Einfluss neben der Bildung der Mutter. Der sozioprofessionelle Status der Eltern ist von geringerer Bedeutung, was darauf schliessen lässt, dass die Bildung der Eltern von grösserer Wichtigkeit für den Schulerfolg der Kinder ist, als die berufliche Tätigkeit und Stellung der Eltern. Der Einfluss von Wohnort, Geschlecht und Nationalität ist demgegenüber gering (Lamprecht und Stamm 1996). Die Bedeutung der sozialen Herkunft für den Bildungserwerb ist empirisch klar ersichtlich. Für Deutschland finden Mayer und Blossfeld „starke Einflüsse der Bildung von Vater und Mutter auf die Bildungschancen der Kinder“ (1990, S. 305). Leu et al. (1997) stellen eine anhaltende Wirkung der sozialen Herkunft auf den Bildungsab- 49 Abb. 3.2: Determinanten des Schulerfolges (1990) Bildung Vater 0,22 Bildung Mutter 0,15 Sozioprofessioneller Wohnort (Stadt / Status Land) Geschlecht R2 = 0,168 0,10 -0,06 Schulerfolg -0,03 -0,01 Nationalität Hinweis: Der Einfluss der unabhängigen Variablen auf den Schulerfolg wurde mittels dem statistischen Verfahren der Multiplen Regression gemessen. Angegeben sind die standardisierten Regressionskoeffizienten sowie der Determinationskoeffizient (R2). Quelle: Lamprecht und Stamm 1996 schluss für die Schweiz fest: „Je höher die Befragten ihr Elternhaus in der Oben-Unten-Skala einordnen, desto höher ist ihr Bildungsabschluss“ (Leu et al. 1997, S. 430). Die Aufgabe des Bildungssystems beschränkt sich nicht auf die Weitergabe von Kenntnissen und Fähigkeiten. Über die Zuteilungsfunktion erfolgen im Bildungssystem zentrale Weichenstellungen für die spätere Berufskarriere und zukünftige Lebenschancen (Lamprecht und Stamm 1996). Bourdieu (1982) sieht hinter den Chancenungleichheiten immer die gegenseitigen Machtkämpfe der verschiedenen sozialen Klassen, die Angehörigen der privilegierten Schichten sind darum bemüht, die soziale Position ihrer Gruppe zu bewahren oder zu verbessern, um keine Macht zu verlieren. „Schulreformen, die eine stärkere Verankerung des Wertes der Chancengleichheit erstreben, zielen einmal auf eine Lockerung der schulischen Chancen von der Herkunft und dann auf eine größere Durchlässigkeit der Schulstufen“ (Bornschier 1998, S. 232). Ein Instrument um die Nachteile von Kindern aus den unteren sozialen Schichten zu mindern stellt die Förderung kompensatorischer Erziehung (Lamprecht 1991) dar. Allerdings ist das Bestreben, bestehende Chancenungleichheiten zu mindern in den letzten Jahren aus dem Blickwinkel der Politik geraten (Lamprecht und Stamm 1996). 3.6.3 Kulturelles, ökonomisches und soziales Kapital 50 Unter Kapital versteht Bourdieu (1983) „akkumulierte Arbeit, entweder in Form von Materie oder in verinnerlichter, ‚inkorporierter‘ Form“ (S. 183). Unbeachtet aller Unterschiede fin- den sich Parallelen zur Humankapitaltheorie: Sowohl beim Konzept des Humankapitals als auch beim Konzept des kulturellen Kapitals gilt Bildung „als eine symbolische Form der Aneignung des gesellschaftlichen Reichtums; Bildung wird auf diese Weise gleichrangig behandelt mit der Verfügung über materielle Produktionsmittel, über ökonomisches Kapital“ (Krais 1983, S. 200). Unterschiedlicher Besitz von kulturellem, sozialem und ökonomischem Kapital ist verantwortlich für die Reproduktionsprozesse der gesellschaftlichen Klassen (Bourdieu 1983, Krais 1983). Das Kapital besitzt eine Überlebenstendenz, „es kann ebenso Profite produzieren wie sich selbst reproduzieren oder auch wachsen“ (ebd.). Die Kapitalformen werden in der Familie weitergegeben und können ineinander transformiert werden. Dabei wird das System der familiären Übertragung und Transformation des Kapitals weitgehend verschleiert. Der Mechanismus der Verschleierung bewirkt, dass soziale Privilegien in eigene Leistung umgedeutet werden und unterschiedliche Ergebnisse im Bildungssystem als natürliche Differenzen in den Begabungen angesehen werden (Leemann 2002). Die „ständige diffuse Übertragung von Kulturkapital in der Familie entzieht sich dem Bewußtsein ebenso wie aller Kontrolle. Um seine volle Wirksamkeit, zumindest auf dem Arbeitsmarkt, ausspielen zu können, bedarf das kulturelle Kapital deshalb in zunehmendem Maße der Bestätigung durch das Unterrichtssystem, also die Umwandlung in schulische Titel“ (Bourdieu 1983, S. 198). Unterschiedliches kulturelles Kapital in der Familie bewirkt Unterschiede zu Beginn des Prozesses der Übertragung und Akkumulation von Kapital. Später führt es zu ungleichen Fähigkeiten, die kulturellen Anforderungen des Aneignungsprozesses zu erfüllen, denn die Akkumulation von kulturellem Kapital erfordert Zeit (Bourdieu 1983). Die Erträge der Bildungsinvestitio- 51 nen beschränken sich nicht auf finanzielle Erträge, die bei der Humankapitaltheorie im Zentrum stehen: Diese ist so angelegt, dass sie sich auf die Erklärung von Unterschieden im Einkommen beschränkt (Krais 1983). Der Nutzen der Bildungsinvestitionen entspricht weiterreichenden Aspekten: Es handelt sich um symbolische Erträge „wie die Befriedigung, die die kulturelle Konsumtion zu verschaffen vermag, die gesellschaftliche Wertschätzung, die mit bestimmten Bildungszertifikaten verbunden ist, die Möglichkeit und die daran geknüpfte Fähigkeit, erfolgversprechende, weit in die Zukunft reichende Strategien der sozialen Selbstbehauptung bzw. des sozialen Aufstiegs zu entwickeln, die Definitionsmacht in den Beziehungen zwischen Individuen und Klassen“ (Krais 1983, S. 213). Kulturelles Kapital „Bildung ist einerseits eine Ressource, die die Möglichkeit, Erwerbseinkommen zu erzielen, wesentlich mitbestimmt, andererseits stellt sie auch einen Lebensbereich dar, der auf die gesamte Lebenslage massgeblich einwirkt“ (Leu et al. 1997, S. 430). Bildungsentscheide bestimmen das Möglichkeiten der gesellschaftlichen und kulturellen Teilnahme. Von besonderer Bedeutung für die Resultate im Bildungssystem ist die Ausrüstung mit kulturellem Kapital. Bourdieu (1983) führt den Schulerfolg von Kindern aus verschiedenen sozialen Klassen auf die unterschiedliche Ausstattung mit kulturellem Kapital zurück. Diese Sichtweise „impliziert einen Bruch mit den Prämissen, die sowohl der landläufigen Betrachtungsweise, derzufolge schulischer Erfolg oder Mißerfolg auf die Wirkung natürlicher ‚Fähigkeiten‘ zurückgeführt wird, als auch den Theorien vom ‚Humankapital‘ zugrundeliegen“ (Bourdieu 1983, S. 185). Der Humankapitaltheorie hält Bourdieu (1983) vor, dass die Theorie eine der wirksamsten Investitionen in die Bildung unberücksichtigt lässt, nämlich die Übertragung von kulturellem Kapital innerhalb der Familie. Die ungleiche Verteilung von Kapi- 52 tal beeinflusst die Fähigkeiten zur Aneignung von Profiten und zur Realisierung von Spielregeln, die für die Reproduktion des Kapitals möglichst vorteilhaft sind (Bourdieu 1983). Das Kulturkapital setzt sich aus drei verschiedenen Formen zusammen: Es gibt institutionalisiertes, inkorporiertes und objektiviertes kulturelles Kapital (Leemann 2002). Das inkorporierte kulturelle Kapital „umfasst die in familiären und schulischen Sozialisations- und Bildungsprozessen verinnerlichten Wissensbeständen, Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale“ (Leemann 2002, 28). „Die Akkumulation von Kultur in inkorporiertem Zustand - also in der Form, die man auf französisch ‚culture‘, auf deutsch ‚Bildung‘, auf englisch ‚cultivation‘ nennt - setzt einen Verinnerlichungsprozeß voraus, der in dem Maße wie er Unterrichts- und Lernzeit erfordert, Zeit kostet (Bourdieu 1983, S. 186. Hervorh. im Original). Diese Zeit muss persönlich investiert werden. Insofern lässt sich der Besitzt von kulturellem Kapital am treffendsten daran messen, welche Dauer der Bildungserwerb einer Person beanspruchte, wobei man sich nicht auf die schlichte Dauer des Schulbesuchs beschränken darf, sondern auch die Primärerziehung in der Familie berücksichtigt werden muss (Bourdieu 1983). Inkorporiertes Ka- pital ist ein fester Bestandteil einer Person, es ist ein Besitztum, das „zum Habitus geworden ist; aus ‚Haben‘ ist ‚Sein‘ geworden“ (Bourdieu 1983, S. 187). Die Aneignung des Kulturkapitals kann sich in unterschiedlichem Masse bewusst vollziehen, verkörperlichtes kulturelles Kapital bleibt jedoch stets geprägt von den Umständen der ursprünglichen Aneignung (Bourdieu 1983). Das objektivierte Kulturkapital besitzt die Form von Büchern, Kunstsammlungen und Musikinstrumenten (Leemann 2002). Es ist über diese Objekte materiell übertragbar, hingegen ist das Merkmal, das die eigentliche Aneignung ermöglicht nicht übertragbar. Zur Aneignung ist der Besitz von kulturellen Fähigkeiten vonnöten. „Kulturelle Güter können somit entweder zum 53 Gegenstand materieller Aneignung werden, dies setzt ökonomisches Kapital voraus. Oder sie können symbolisch angeeignet werden, was inkorporiertes Kulturkapital voraussetzt“ (Bourdieu 1983, S. 189). Das institutionalisierte Kulturkapital widerspiegelt die in Form von Zertifikaten, Zeugnissen und Diplomen anerkannten Investitionen in die Bildung (Leemann 2002). „Inkorporiertes Kulturkapital ist den gleichen biologischen Gesetzen unterworfen wie sein jeweiligen Inhaber. Die Objektivierung von inkorporiertem Kulturkapital in Form von Titeln ist ein Verfahren, mit dem dieser Mangel ausgeglichen wird“ (Bourdieu 1983, S. 189. Hervorh. im Original). Durch einen akademischen Titel wird dem Besitz von Kulturkapital institutionelle Anerkennung verliehen (Bourdieu 1983). Zur Erlangung von Bildungstiteln muss Zeit aufgewendet werden. An dem Umfang der für ein Bildungszertifikat notwendigen Lebenszeit lässt sich somit das vererbte Kulturkapital messen (Leemann 2002). Soziales Kapital Das soziale Kapital entspricht den Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften sozialen Netzes oder der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe verbunden sind (Bourdieu 1983, Leemann 2002). Kinder von Eltern mit akademischer Bildung sind insofern privilegiert, als ihre Eltern häufig bereits über ein breites Netz von sozialen Beziehungen zu weiteren Akademikern verfügen. Dies erleichtert die Reproduktion von akademischen Laufbahnen (Leemann 2002). Der Umfang des Sozialkapitals hängt von der Ausdehnung des Netzes sozialer Beziehungen ab und dem Kapital, dass die jeweiligen Bezugspersonen besitzen (Bourdieu 1983). „Die Profite, die sich aus der Zugehörigkeit zu einer Gruppe ergeben, sind zugleich die Grundlage für die Solidarität, die diese Profite ermöglicht“ (Bourdieu 1983, S. 192). Für die Produktion und Reproduktion dauerhafter nützlicher Verbindungen ist es notwendig, die eingegangenen sozialen Be- 54 ziehungen zu festigen. Dabei werden Zufallsbeziehungen in auserwählte Beziehungen umgewandelt, die mit dauerhaften Verpflichtungen verbunden sind. Die Reproduktion von Sozialkapital erfordert eine ununterbrochene Beziehungsarbeit in Form von Austauschakten, damit die gegenseitige Anerkennung immer wieder von Neuem bestätigt wird (Bourdieu 1983). Ökonomisches Kapital Das ökonomische Kapital liegt allen anderen Kapitalformen zugrunde (Bourdieu 1983). Ausreichender Besitz von ökonomischem Material ermöglicht einen späteren Eintritt in die Berufswelt und bietet dadurch zeitlichen Raum, um einen höheren Bildungsabschluss zu realisieren (Leemann 2002). Kinder aus nichtakademischen Familien müssen damit rechnen, dass die Aufnahme eines Hochschulstudiums mit einem „Doppelleben“ (Leemann 2002) verbunden ist, sie sind zu einer Berufstätigkeit neben der Ausbildung gezwungen, um sich den Lebensunterhalt zu verdienen. In Antizipation der zusätzlichen Hindernisse entscheiden sie sich eher für solche Berufswege, die ein geringeres Risiko aufweisen (Leemann 2002). Wer nur über wenig Kapital verfügt ist weniger risikofreudig bei einer Investition in die Bildung als jene, die damit rechnen müssen, bei einem allfälligen Fehlschlag den erlittenen Verlust nicht durch andere Ressourcen kompensieren zu können (Krais 1983). Ökonomisches Kapital verhilft zur Erwerbsmöglichkeit anderer Kapitalsorten, doch die Übertragung erfordert einen beträchtlichen Aufwand an Transformationsarbeit (Bourdieu 1983). Das ökonomische Kapital liegt einerseits allen anderen Kapitalformen zugrunde, die transformierten Formen des ökonomischen Kapitals können allerdings nie vollständig auf dieses zurückgeführt werden, „weil sie ihre spezifischen Wirkungen überhaupt nur in dem Maße hervorbringen können, wie sie verbergen (und zwar zu allererst vor ihrem eigenen Inhaber), daß das ökonomische Kapital ihnen zugrundeliegt und insofern, wenn auch nur in letzter Instanz, 55 ihre Wirkungen bestimmt“ (Bourdieu 1983, S. 196). 3.6.4 Habituskonzept und Lebensstil Modernisierungstheorien gehen davon aus, dass die soziale Herkunft des Akteurs, verstanden als auf der vertikalen Ungleichheitsstruktur abgebildete Position eines Individuums, im Prozess der Individualisierung in den Hintergrund tritt. Nach Bourdieu8 gibt es jedoch einen sozialen Raum, definiert als „ein Raum von Unterschieden, in denen die Klassen gewissermassen virtuell existieren, unterschwellig, nicht als gegebene, sondern als herzustellende“ (Bourdieu 1985, S. 26). Die Stellung, die ein Individuum in diesem sozialen Raum einnimmt, prägt seine kulturellen Gewohnheiten und Verhaltensweisen und vice versa. Sie gibt damit die Perspektive vor, aus der das gesamte Leben - das eigene und das von anderen - gesehen, geplant und evaluiert wird. Deshalb müssen Kontext und Situation eines Akteurs, kurz seine Lokalisierung im sozialen Raum, immer miteinbezogen werden, um seine Handlungen beschreiben und erklären zu können. An welcher Stelle des Raumes ein Subjekt steht, konstituiert sich aufgrund seines ererbten oder erworbenen Anteils an den zentralen Ressourcen einer Gesellschaft. Diese sind stark vereinfacht das ökonomische (Geld, Einkommen, Vermögen), das soziale (die Fähigkeit, soziale Beziehungen für eigene Zwecke zu mobilisieren) und das kulturelle (Bildung, Ausbildung, Sprache) Kapital. Das folgende klischeehafte Beispiel zeigt auf, dass nicht nur 8 Bourdieus Untersuchungen richten sich an französischen Verhältnissen aus, so beispielsweise an dem hohen Stellenwert der Kultur oder den ausgeprägteren Klassenunterschieden im Bildungswesen. Bourdieu meint jedoch, dass das „Modell der Wechselbeziehungen zweier Räume - dem der ökonomisch-sozialen Bedingungen und dem der Lebensstile“ für alle geschichteten Gesellschaften Geltung besitzt, „selbst wenn das System der Unterscheidungsmerkmale, durch die sich soziale Unterschiede äussern oder verraten, ein je nach Epoche und Gesellschaft anderes ist“ (Bourdieu 1982, S. 12). 56 die Gesamtmenge des Kapitals entscheidend ist, sondern auch die Zusammensetzung der Kapitalsorten: Ein Mädchen aus ländlicher Gegend mit abgeschlossener Berufsausbildung sieht die Welt von ihrer Position aus anders, als eine gleichaltrige Lehrerstochter aus der Stadt, die das Gymnasium besucht. Die erste liest die Biographien ihrer Idole und wird eine erfolgreiche Schauspielerin. Die zweite liest die „Geschichte des Fräuleins von Sternheim“, schliesst erfolgreich ein Hochschulstudium ab und arbeitet als Assistentin an der Universität. Eine durch Unterhaltungsfilme reich gewordene Schauspielerin mit durchschnittlicher Schulbildung verfügt über ein ähnliches Kapitalvolumen wie eine wissenschaftliche Assistentin mit geringem Einkommen. Da die erste Frau in erster Linie über viel erworbenes ökonomisches Kapital verfügt, nimmt sie jedoch eine andere Position ein als die Assistentin, deren Kapital sich aus vielfältigen Beziehungen im akademischen Milieu und aus einer umfassenden Bildung als ererbtes Startkapital zusammensetzt. Den Positionen im sozialen Raum entspricht ein System klassenspezifischer Dispositionen, das als Habitus bezeichnet wird. Es umfasst Schemata der Wahrnehmung, des Denkens und des Handelns. Der Habitus kann als erworbenes System von Dispositionen, Fähigkeiten, Kenntnissen, Gewohnheiten und Weltanschauungen angesehen werden (Bourdieu 1985, 1987, Buchmann 1989b). Der Habitus widerspiegelt nicht die individuellen Besonderheiten einer Person. Er ist vielmehr „die Verinnerlichung und die Konzentration der Erfahrungen, die ein Individuum als Mitglied einer sozialen Gruppierung und den mit ihr verbundenen Lebenschancen macht. Die sozialen Strukturen und die mit ihnen verknüpften Möglichkeiten und Beschränkungen werden über das ererbte ökonomische, kulturelle und soziale Kapital (...) vermittelt und verinnerlichen sich im Verlaufe der familiären Sozialisation im Körper, in der Psyche und in den Kognitionen 57 der Individuen“ (Leemann 2002, S. 29). Das bedeutet nichts anderes, als dass die jeweilige Position im sozialen Feld (die soziale Struktur) das alltägliche Handeln, die Praxisform, den Lebensstil eines Individuums prägt. Der Lebensstil trägt seinerseits aber wiederum zur Reproduktion der Stellung im sozialen Raum bei. Der Habitus ist somit nicht nur ein Produkt der sozialen Struktur; er ist auch Produzent von Vorlieben, Besitztümern und Meinungsäusserungen, die laufend seine eigenen Entstehungsbedingungen - die durch die Raumlage konstituierten Dispositionen - reproduzieren. Mit der Annahme, dass der jeweilige Lebensstil nicht der persönliche Charakter des Individuums sondern der Ausdruck der verinnerlichten gesellschaftlichen Struktur ist, verknüpft Bourdieu das kollektive Geschehen mit der individuellen Geschichte. Um auf das einfache Beispiel zurückzukommen: Die Schauspielerin hat andere Denk- und Verhaltensmuster als die Assistentin ererbt und erworben. Diese zeigen sich beispielsweise in ihrer politischen Einstellung, ihrer Freizeitgestaltung und ihrem Konsumverhalten, kurz ihrem gesamten Lebensstil. Der Lebensstil ist es jedoch gerade, der zur Disposition ihres jeweiligen Kapitalvolumens und dadurch zur Festigung ihrer Position beiträgt. So wird eventuell das ökonomische Kapital der Schauspielerin wachsen, da sie durch ihren konsum- und öffentlichkeitsorientierten Lebensstil als ideale Werbeträgerin gilt. Es ist nun aber evident, dass nicht aus allen Lehrerstöchtern Professorinnen werden – auch wenn sie über ein ähnliches Startkapital verfügen. Bourdieu schreibt denn auch: „Sind die Angehörigen einer Klasse mit einem bestimmten ökonomischen und kulturellen Anfangskapital mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zu einer sozialen und schulischen Laufbahn verurteilt, die zu einer gegebenen Position führt, so bedeutet dies gleichzeitig, dass eine Fraktion der Klasse (...) eine von der statistisch häufigsten Laufbahn der Gesamtklasse abweichende, entweder höhere oder niedere (...) Laufbahn einschlagen“ 58 (Bourdieu 1982, S. 190). Er schliesst daraus, dass es einen Laufbahn-Effekt gibt. Dieser besagt, dass der durch die Familie oder die ursprünglichen Lebensbedingungen ausgeübte Einfluss auf die Handlungspraxis eines Menschen durch die Wirkung ergänzt wird, den die biographische Erfahrung auf die Einstellungen und Meinungen ausübt. Insbesondere die Erfahrung mit sozialem Auf- oder Abstieg prägt die Vorstellung von der eigenen Position in der Sozialwelt. Der Habitus als strukturiertes und strukturierendes Prinzip der Handlung und Entscheidung von Individuen repräsentiert Bourdieus (1982, 1985, 1987) Hauptkonzept, um Struktur und Handlung miteinander zu verknüpfen. Der Habitus vermittelt zwischen Sozialstruktur und dem Handeln von Individuen, er vermag zu erklären, weshalb soziale Gruppen die gleichen Gewohnheiten, Interessen und Praktiken aufweisen (Leemann 2002). „Die ‚Subjekte‘ sind in Wirklichkeit handelnde und erkennende Akteure, die über Praxissinn verfügen (...), über ein erworbenes Präferenzensystem, ein System von Wahrnehmungs- und Gliederungsprinzipien (das, was man gewöhnlich den Geschmack nennt), von dauerhaften kognitiven Strukturen (die im wesentlichen das Produkt der Inkorporierung der objektiven Strukturen sind) und von Handlungsschemata, von denen sich die Wahrnehmung der Situation und die darauf abgestimmte Reaktion leiten läßt. Der Habitus ist jener Praxissinn, der einem sagt, was in einer bestimmten Situation zu tun ist“ (Bourdieu 1985, S. 41-42. Hervorh. im Original). Die Strukturen des Habitus werden „wiederum zur Grundlage der Wahrnehmung und Beurteilung aller späteren Erfahrung“ (Bourdieu 1987, S. 101). Das Individuum wird mit vorgegebenen sozialen Rahmenbedingungen konfrontiert. Gleichzeitig ist es mit Kompetenzen ausgerüstet, die es zum Handeln befähigen. Der Habitus ist kein zufällig entstandenes System. Er stellt die Internalisierung und Verkörperlichung der individuellen Position im sozialen Gefüge dar, er verweist auf „internalisierte, subjektive Wahrneh59 mungsmuster und Handlungsdispositionen“ (Stamm und Lamprecht 1996, S. 516. Hervorh. im Original), die relativ stabil und langfristig sind. Er widerspiegelt die biographische Geschichte der sozialen Positionen eines Individuums, also seinen Pfad im Lebenslauf. Damit repräsentiert er die objektiven Bedingungen der individuellen Position in der sozialen Struktur. Er verkörpert die biographischen Erfahrungen in der sozialen Welt des Individuums. In der Folge besteht eine Affinität zwischen den Wahrnehmungsschemata, dem Geschmack und den Handlungsorientierungen jener Individuen, die eine vergleichbare Geschichte sozialer Positionen oder Verläufe (‚trajectoires‘) aufweisen (Bourdieu 1982, 1985, Buchmann 1989b). Obwohl der Habitus eine individuelle Eigenschaft darstellt, ist er nicht ein persönliches sondern ein sozial strukturiertes Phänomen. Insofern stellt der Habitus ein Klassenphänomen dar, denn die materiellen Gegebenheiten der individuellen Existenz hängen weitgehend von der Position in der Klassenstruktur ab. Die Unterschiede im Klassenhabitus erlauben es dem Individuum jene Handelnden zu erkennen und sich mit diesen zu identifizieren, die vergleichbare Praktiken an den Tag legen (Buchmann 1989b). Der Habitus beinhaltet Erwartungen an die Zukunft basierend auf den Erfahrungen der Vergangenheit. Subkulturelle Milieus vermitteln, indem sie die biographischen Aspirationen ihrer Mitglieder formen, zugleich strukturelle Chancen. Diese objektiv gegebenen Chancen führen zu subjektiven Erwartungen hinsichtlich der eigenen Zukunft (Buchmann 1989a), diese bezeichnet Bourdieu (1985?) als probabilistische Logik des Handelns. Durch die Verinnerlichung der Trajektoren der sozialen Position weiss der Handelnde um die objektiven Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen und erkennt die Möglichkeiten, die seine aktuelle Position für die Zukunft bereitstellt (Buchmann 1989b). Die objektiven Chancen seiner Position werden transformiert in subjektive Erwartungen bezüglich der Zukunft. Individuen aspirieren solche zukünftige Entwicklungen, die hohe 60 objektive Chancen haben, sich zu erfüllen. Es besteht ein Gefühl für die eigene Situation, ein Gefühl für das, was angemessen ist und das, was jenseits aller persönlichen Möglichkeiten liegt. „Der soziale Raum ist so konstruiert, daß die Verteilung der Akteure oder Gruppen in ihm der Position entspricht, die sich aus ihrer statistischen Verteilung nach zwei Unterscheidungsprinzipien ergibt, (...) nämlich das ökonomische Kapital und das kulturelle Kapital. Daraus folgt, daß die Akteure um so mehr Gemeinsamkeiten aufweisen, je näher sie einander diesen beiden Dimensionen nach sind, und um so weniger Gemeinsamkeiten, je ferner sie sich in dieser Hinsicht stehen“ (Bourdieu 1985, S. 18. Hervorh. im Original). Die Schulbildung orientiert sich „so stark an der Elitekultur, daß ein Kind aus kleinbürgerlichem und mehr noch aus bäuerlichem oder Arbeitermilieu mühsam erwerben muß, was Kinder der gebildeten Klasse mitbekommen: Stil, Geschmack, Esprit, kurz, die Leichtigkeit und Lebensart, die dieser Klasse, da es ihre eigene Kultur ist, natürlich sind“ (Bourdieu und Passeron 1971, S. 42). Deshalb reicht es nicht aus, das nötige ökonomische Kapital zur Verfügung zu stellen, um gleiche Chancen für den Aufstieg in der Bildungshierarchie zu schaffen. Denn es sollte nicht übersehen werden, dass die anhand von Prüfungskriterien gemessenen Fähigkeiten weniger mit natürlichen Begabungen zusammenhängen als mit der variierenden Affinität zwischen den kulturellen Gewohnheiten einer bestimmten Klasse und den Anforderungen und Erfolgskriterien des Bildungssystems (Bourdieu und Passeron 1971). 3.6.5 Reproduzierende Funktion der Bildungsinstitutionen Die Vertreter der Reproduktionstheorie betonen die Selektionsfunktion des Bildungssystems. Unterschiede der sozialen Herkunft werden verstärkt und verschleiert, indem soziale Vorteile eigenen Leistungen zugeschrieben werden (Bourdieu und Passeron 1971, Bourdieu 1982, 1985). Die massgebliche Funktion des Bildungssystems besteht nicht darin, tatsächliche Bil61 dungschancen entsprechend unterschiedlicher Leistungen zu verteilen, die zentrale Funktion liegt in der Rechtfertigung und Reproduktion bestehender Ungleichheit (Lamprecht und Stamm 1996). Ungleichheiten lassen sich nicht beliebig reduzieren, da ihre Ursachen ausserhalb des Schulsystems liegen. Die Vorstellung von Chancengleichheit innerhalb des Bildungssystems basiert nicht auf dem Wunsch einer Verminderung der gesellschaftlichen Unterschiede, sondern sie dient dazu, diese zu verschleiern, indem ungleiche soziale Privilegien in persönliche Verdienste umgedeutet werden (Lamprecht 1991). Wer sich in ein soziales Feld begibt, für das er nicht vorgesehen ist, dessen Habitus umfasst nicht die Einstellungen, Kenntnisse und Verhaltensweisen, die notwendig sind, um sich in der jeweiligen Umgebung ohne Schwierigkeiten zu bewegen. Es entsteht das Gefühl, fehl am Platz zu sein. „So können Selbstselektion, das unmerkliche ‚freiwillige‘ sich Zurückziehen, und soziale Selektion, das subtile ‚Platzanweisen‘, in der sozialen Praxis gemeinsam ihre Wirkung entfalten“ (Leemann 2002, S. 30). Für Kinder der unteren sozialen Schichten bedeutet die Wahl einer höheren Bildung immer auch „Akkulturation“ (Bourdieu und Passeron 1971, Leemann 2002) an eine unvertraute, akademische Welt, während Kinder mit akademischer Herkunft sich in der Mittelschule und an Hochschulen mit gewohnter Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit bewegen können. „Insbesondere in der mündlichen Kommunikation setzen Wissenschaftler Sprache als Distanzierungsinstrument ein. Professoren zielen in den Seminaren und Vorlesungen beispielsweise weniger auf Verständlichkeit, indem sie kontinuierlich erklärende Ausführungen abgeben würden, sondern bedienen sich einer ‚charismatischen, auf Missverständnissen beruhenden‘ Sprache“ (Leemann 2002, S. 32). Arbeiterkinder leiden im Studium häufiger als andere Studierende unter einem Gefühl der Entfremdung, was Identitätskonflikte nach sich zieht. Sie empfinden die Universität als Massenbetrieb und fühlen sich einsam. Sie fühlen 62 sich fremd, weil sie die Werte und Normen der Hochschulwelt nicht verinnerlicht haben und diese erst erlernen müssen. Dadurch verfügen sie in geringerem Masse über Handlungsstrategien, die für eine erfolgreiche Hochschullaufbahn vonnöten sind (Leemann 2002). „Die Chancen für den Hochschulbesuch sind das Ergebnis einer Auslese, die die gesamte Schulzeit hindurch mit einer je nach der sozialen Herkunft der Schüler unterschiedlichen Strenge gehandhabt wird; bei den unterprivilegierten Klassen führt dies ganz einfach zu Eliminierung“ (Bourdieu und Passeron 1971, S. 20. Hervorh. im Original). Die Bildungsaspirationen sind entsprechend dem sozialen Milieu unterschiedlich stark ausgebildet (Bourdieu und Passeron 1971, Leemann 2002). „Für Arbeiterkinder sind bildungsfördernde Mütter und/oder Väter, weil sie beispielsweise selbst auf Bildung verzichten mussten oder weil in der Familie Statusinkonsistenzen bezüglich der elterlichen Bildung herrschen, aus diesen Gründen eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung von Bildungsmotivation (...) Vielfach erfolgt ein Anstoss zur weiterführenden Bildung auch von einer Person ausserhalb der Familie, z.B. der Lehrperson“ (Leemann 2002, S. 33). Kinder aus Akademikerfamilien verfügen über das notwendige Kapital und den Habitus, um sich in der universitären Welt zurechtzufinden und entwickeln hohe Bildungsaspirationen, für sie ist die Wahl eines Hochschulstudiums etwas selbstverständliches (Bourdieu und Passeron 1971, Leemann 2002). Der Habitus eines Menschen, insbesondere sein ererbtes kulturelles Kapital, beeinflusst die Bildungskarriere und berufliche Laufbahn eines Menschen. Als Praxissinn sagt er dem sich entscheidenden Akteur, was zu tun ist - „im Sport nennt man das ein Gespür für das Spiel, nämlich die Kunst, den zukünftigen Verlauf des Spiels, der sich im gegenwärtigen Stand des Spiels bereits abzeichnet, zu antizipieren“ (Bourdieu 1985, S. 42). Auch in Bezug auf seine Ausbildung oder Berufswahl ist es wichtig, die Kunst des Antizipierens zu beherrschen; der schu- 63 lische Erfolg und damit der aktuelle und potentielle Profit aus dem kulturellen Kapital hängt davon ab. Um ein realistisches und damit gewinnbringendes Zukunftsbild entwerfen zu können, werden möglichst viele Informationen über die denkbaren Bildungsentscheide benötigt. Wer die relevanten Informationen von seiner Familie, seinen Eltern oder Geschwistern und deren Beziehungen erhält, ist im Vorteil. Das benötigte Gespür hängt also im wesentlichen von der sozialen Herkunft ab. Somit kann der Soziologe zeigen, wie der Schulerfolg - in einer modernen Gesellschaft eine der Schlüsselqualifikationen - an die soziale Herkunft gebunden ist. Zudem trägt das Bildungssystem als Institution dazu bei, seine eigene Struktur über die Disposition des kulturellen Kapitals zu reproduzieren. Individuelle Fähigkeiten sind gegenüber ererbten Privilegien im Nachteil, da zwischen der Bildungsfähigkeit und dem kulturellen Erbe ein verborgener Zusammenhang besteht. Ohne Bourdieus umfassenden empirischen Belege wiedergeben zu können, sei gesagt, dass „die Unterschiede der Befähigung von den durch das ererbte Kapital bedingten sozialen Unterschieden nicht zu trennen sind“ (Bourdieu 1985, S. 36). Anders gesagt haben Individuen mit grossem kulturellem Startkapital grössere Chancen, den Aufnahme- und Realisierungsbedingungen der Bildungssysteme zu entsprechen. Die Institutionen trennen also die Besitzer von ererbtem Kapital von den Nichtbesitzern und ermöglichen lediglich den einen die Akkumulation ihrer kulturellen Ressourcen. Die sozialen Unterschiede werden somit aufrechterhalten. „Je mehr die offizielle Übertragung von ökonomischem Kapital verhindert oder gebremst wird, desto stärker bestimmt deshalb die geheime Zirkulation von Kapital in Gestalt der verschiedenen Formen des Kulturkapitals die Reproduktion der gesellschaftlichen Struktur. Das Unterrichtssystem - ein Reproduktionsinstrument mit besonderen Fähigkeiten zur Verschleierung der eigenen Funktion - gewinnt dabei an Bedeutung, und der 64 Markt für soziale Titel, die zum Eintritt in begehrte Positionen“ (Bourdieu 1983, S. 198) berechtigen, vereinheitlicht sich. Die Verlagerung des sozialen Wettbewerbs auf den scheinbar allen gleichermassen zugänglichen Markt symbolischer Güter lässt nur scheinbar eine Öffnung der Gesellschaft vermuten, stattdessen erfolgt eine Verschärfung der Konkurrenzsituation zwischen den Individuen (Krais 1983). Die Einnahme unterschiedlicher Personen ist eng mit dem privilegierten Zugang zu Ressourcen verknüpft. Diese Verbindung verursacht viele der Machtkämpfe in der Gesellschaft. Das Bildungssystem übt hier eine vermittelnde und eine legitimierende Funktion, weshalb es häufig in Diskussionen um soziale Gerechtigkeit eingebunden wird. Der Zugang zu Prestige und Status und der damit verbundenen Privilegien wird immer exklusiver durch das Bildungssystem geregelt und die gesellschaftlichen Konflikte dadurch zum Teil entschärft (Graf und Lamprecht 1991). „So führt auch die gestiegene Bedeutung des Bildungskapitals für den Zugang zu den attraktiven Positionen nicht etwa zur Enteignung - und sei sie allmählich oder nur partiell - der besitzenden Klasse und damit zu einem Aufbrechen der Herrschaftsstrukturen. Trotz gewisser Verschiebungen innerhalb der herrschenden Klasse gestatten ihr die neuen, stärker über kulturelles Kapital vermittelten Modi der Aneignung des gesellschaftlichen Mehrprodukts, ihren Besitz und ihre Macht zu behaupten - in einer diskreteren, verdeckteren Form“ (Krais 1983, S. 214-215). Unermüdliches Lernen auf allen Schulstufen bleibt für die Angehörigen unterprivilegierten Klassen der einzige mögliche Zugang zu einer Steigerung des kulturellen Kapitals. Das Erziehungswesen könnte eine Demokratisierung der Bildung bewirken, wenn es die ursprünglichen Unterschiede im Bildungsniveau nicht ignorieren - und deren Aufrechterhaltung dadurch sogar noch fördern - würde (Bourdieu und Passeron 1971). Die Forderung nach immer mehr Bildungskapital setzt schliesslich auch die aus privilegierten Klassen stammenden Heranwach- 65 senden unter einen zunehmenden Druck. Zur Wahrung der ihrer Herkunft angemessenen Privilegien müssen sie immer mehr Anstrengungen unternehmen. Die Folgen beschreibt Bourdieu drastisch (1985, S. 44): „Entnervte Eltern, kaputte Jugendliche, von den Produkten eines für unzureichend erklärten Bildungssystems enttäuschte Arbeitgeber sind (...) ohnmächtige Opfer eines Mechanismus, der nichts anderes ist als die kumulierte Wirkung ihrer eigenen, aus der Logik der Konkurrenz aller gegen alle geborenen und von ihr mitgerissenen Strategien.“ 66 3.7 Biographische Orientierungen und Handlungsstrategien „Die (überwiegend) qualitative Biographieforschung geht davon aus, daß durch die historische Plazierung des Lebenslaufs, die Generationsprägung und dass Durchlaufen von Statuspassagen der Mensch nicht nur einen gesellschaftlichen Ort zugewiesen bekommt, sondern Erfahrungen macht, die sich in einer biographischen Wissensstruktur aufschichten. Die Aufschichtung ist aber keine Addition von Erfahrungen, sondern im Prozeß der Erfahrungsbildung werden oder können frühere Erfahrungen - aus unterschiedlichen Gründen - neu interpretiert oder obsolet werden (...) Erfahrungen steuern den Verlauf der Lebensgeschichte, aber sie sind gleichzeitig auch Handlungsressourcen, um neue Handlungssituationen zu strukturieren und zu bewältigen“ (Hoerning 2000, S. 6). „Die besten Mikrosoziologien geben Einsicht in die erlebten Erfahrungen derjenigen, die in den großen Strukturen stecken, indem sie zeigen, wie diese mit dem ‚in den großen Strukturen stecken‘ zurecht kommen (...) indem Mikrosoziologen betrachten, wie Makro-Zwänge interpretiert werden (und wie mit ihnen umgegangen wird), geben sie uns die seltene Gelegenheit, etwas darüber zu lernen, wie sozial verortete Personen mit den ‚Bedingungen‘ kämpfen, in die sie durch Geschichte und Sozialstruktur gestellt wurden (Berger 2000, S. 27). Die Notwendigkeit der Analyse des Lebenslaufs in seiner Gänze wurde bereits hervorgehoben: denn „verstehende Ansätze stehen bei der Handlungsanalyse in der Gefahr, nichtintentionale und vorgegebene Bedingungen des Handelns zu vernachlässigen“ (Fischer und Kohli 1987, S. 35). Die Ausblendung des Handlungsbegriffs durch die Systemtheoretiker führt andererseits dazu, dass „die Bedeutung der primären Erfahrung in der Sozialwelt ebenso ausgeschaltet wird wie die Frage nach der Möglichkeit von Erfahrung und davon abhängigen Handlungen“ (Fischer und 67 Kohli 1987, S. 35). Die Lebenslaufanalyse gestaltet sich immer als Mehrebenenanalyse. In dieser Weise „kann die soziologische Biographieanalyse sowohl dem Anliegen ‚subjektiver‘ wie ‚objektiver‘ Analyse gerecht werden, sofern sie Erfahrung und Intention im Handlungsbegriff als auch das der Handlung vorintentional zugrundeliegende Schema enthüllen kann“ (Fischer und Kohli 1987, S. 35). Lebenserfahrungen stellen die Verbindung her zwischen Vergangenheit und Zukunft des Lebenslaufs (Hoerning 1989). Sie steuern zukünftige Handlungen und können „individuell für die Ausgestaltung zukünftiger biographischer Projekte verwendet werden (...) Biographische „Verlaufsmuster oder lebensgeschichtliche Sequenzen sind immer von der eigenen Vorgeschichte abhängig“ (Hoerning 1989, S. 148). Gesellschaftliche Handlungsangebote werden so genutzt, dass sie sich im Einklang mit der eigenen Vorgeschichte befinden (Hoerning 1989). Das chronologische Alter, Bildungszertifikate und Titel dienen als „Landmarken“ für subjektive biographische Orientierungen und Strategien (Buchmann 1989). Individuen tendieren dazu, die ihnen durch ihren Status zugeordneten Attribute auch wirklich zu entwickeln (Bourdieu 1982, S. 52): „Die durch die schulischen Klassifikationen und rangspezifischen Gliederungen erzeugten offiziellen Unterschiede schaffen (oder verstärken) tendenziell reale Unterschiede in dem Sinne, daß sie bei den derart klassifizierten Individuen den - kollektiv anerkannten und gestützten - Glauben an diese Unterschiede und damit die Verhaltensmuster erzeugen, die offizielles und reales Sein zur Deckung bringen sollen.“ Insofern strukturieren Klassifikationen sowohl die eigenen Erwartungen und Aspirationen wie auch das, was andere von den Individuen erwarten. Die Berufslaufbahnen schaffen den Rahmen für die individuelle Berufsbiographie. Sie definieren, was angemessen und was jenseits der persönlichen Reichweite im beruflichen Leben ist (Buchmann 1989). Individuen richten den eigenen Lebensplan und ihre Handlungen 68 an den Sequenzen solcher Berufslaufbahnen aus und reorientieren sich jedesmal neu, wenn ein solcher Schritt vollzogen ist. Je mehr solche Berufskarrieren geregelt sind, desto eher können solche beruflichen Schritte im Lebenslauf vorausgesehen und vorausgeplant werden (Buchmann 1989). In dieser Weise gelangen die Individuen zu klar definierten Handlungsalternativen, zwischen denen sie auswählen können wobei sie bei der Wahl von vergangenen Erfahrungen und ihren gegenwärtigen Interessen und Bedürfnissen geleitet werden. Sozial konstruierte berufliche Laufbahnmuster formen in dieser Weise die beruflichen Erwartungen und Aspirationen der Individuen und produzieren dadurch biographische Identitäten (Buchmann 1989). Die Verzeitlichung des beruflichen Lebens in hoch institutionalisierten Laufbahnen produziert präzis definierte Fahrpläne, die als Entwürfe für die Abfolge von Ereignissen im individuellen Lebenslauf dienen (Buchmann 1989). „Laufbahnen im sozialen Raum oder ‚trajectoires‘, die Individuen verfolgen können, sind nicht ausschließlich das Produkt aktueller sozialer und/oder ökonomischer Lebenslagen sondern gleichzeitig das Ergebnis der Reproduktion von Klassenverhältnissen“ (Hoerning 1989, S. 157). Bourdieu (1982) sieht den Menschen daran interessiert, aus den ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen einen maximalen Ertrag zu erwirtschaften. Um das vorhandene Kapital zu vermehren „müssen Chancen wahrgenommen werden, die den vorhandenen Neigungen und Fähigkeiten entgegenkommen, und gleichzeitig muß dabei in Rechnung gestellt werden, daß die Aktivitäten vergangener Generationen den Platz in der Gesellschaftsstruktur festlegen, das heißt, die Ressourcen an kulturellem, sozialem und ökonomischem Ausgangskapital festgelegt sind. So gesehen ist es nicht unwichtig, in welche Familie man hineingeboren wird, das heißt welchen Standort man per Erbe in der Gesellschaft hat“ Hoerning 1989, S. 157). Die soziale Welt bietet nicht ein Universum von Möglichkeiten, die allen in gleicher Weise offen stehen. „Lebens- 69 wege bewegen sich über ein Feld, das schon strukturiert ist“ (Hoerning 1989, S. 158). Das Leben stellt ein Ganzes dar, „eine kohärente und gerichtete Gesamtheit, die als einheitlicher Ausdruck einer subjektiven und objektiven ‚Intention‘, eines ‚Entwurfs‘ aufgefaßt werden kann und muß“ (Bourdieu 1985, S. 75). 3.7.1 Handlungsentwurf und biographische Erfahrungen Straub (2000) spricht von „Erfahrungen (...) als von symbolisierten und demzufolge transformierten Erlebnissen und Ereignissen, die nunmehr eine Gestalt sui generis besitzen“ (S. 144. Hervorh. im Original). Die Bezeichnung Erlebnis reserviert er für „das noch nicht (reflexiv) begriffene Leben in seiner Leiblichkeit“ (ebd.). Der Lebensplan ist eine Quelle der Identität. Die „moderne Identität ist besonders reflexiv. Wenn man in einer integrierten und intakten Welt lebt, kann man mit einem Minimum an Reflexionen auskommen“ (Berger et al. 1975, S. 71. Hervorh. im Original). Lebenspläne oder biographische Projekte sind das Ergebnisse von zwei verknüpften Aspekten: Individuen entwerfen ihre Lebenspläne vor dem Hintergrund sozial definierter Berufskarrieren. Die Schritte und Sequenzen solcher Karrieren setzen den Rahmen für die Konstruktion der eigenen Zukunft, sowohl in beruflicher wie auch privater Hinsicht. Sodann sind biographische Projekte stets durch vergangene Erfahrungen strukturiert, die mitentscheidend bei der Bestimmung der zukünftigen Entwicklung sind (Buchmann 1989). Biographische Erfahrungen werden als Wissen und Kenntnisse verstanden, das aus der Beziehung des Individuums zu der gesellschaftlichen Umwelt in der gesellschaftlichen Praxis angeeignet wird (Hoerning 1989). Dieses Wissen wird nicht induktiv gewonnen sondern „exemplarisch, daß heißt, aus unendlich vielen Beispielen wird ein intersubjektiv überprüfbares Wissen erzeugt“ (Hoerning 1989, S. 153. Hervorh. im Original). 70 Biographische Erfahrungen bestimmen den Ablauf des Lebens mit: „Es ist eine soziale Tatsache, daß Lebenserfahrungen eine Biographie prägen. Erfahrungen, die für die Biographie bedeutend sind und zu biographischen Wissensbeständen werden, strukturieren den (weiteren Verlauf der Lebensgeschichte“ (Hoerning 1989, S. 148. Hervorh. im Original). Lebenserfahrungen prägen die Biographie im selben Masse wie „soziale Herkunft, Schulbildung, Geschlecht, Hautfarbe und nationale Herkunft. Lebenserfahrungen werden im Laufe einer Lebensgeschichte erworben, sie lagern sich als biographisches Wissen ab“ (Hoerning 2000, S. 4). Erfahrungen haben und Erfahrungen machen ist nicht dasselbe. Erfahrungen machen verweist auf Erlebnisse, die einem zustossen (Alheit und Hoerning 1989). „Dennoch ‚haben wir natürlich nur Erfahrungen, weil wir unablässig Erfahrungen ‚machen‘ (...) Unser je aktueller Erfahrungs- und Wissensvorrat ist nicht ein- für allemal gegeben. Er ist - um einen Terminus der verstehenden Soziologie zu verwenden - ‚biographisch artikuliert‘“ (Alheit und Hoerning 1989, S. 8). Das Aneignen von biographischen Erfahrungen ist ein kumulativer Vorgang, der seine Zeit braucht. Er stellt nicht nur ein schlichtes Anhäufen isolierter erinnerter Ereignisse dar, sondern besitzt eine synthetische Eigenschaft. „Der Wissenserwerb - wenn schon ‚Sedimentierung von Erfahrungen‘ - ist kein mechanischer Vorgang. Er findet in je konkreten, biographisch artikulierten Situationen statt. Sowohl die Situationen, in welchen Erfahrungen ‚gemacht‘ werden, als auch die Erfahrungen selbst haben eine Vorgeschichte“ (Alheit und Hoerning 1989, S. 9. Hervorh. im Original). Für das Handeln in späteren Positionen einer Sequenz des Lebenslaufs sind immer auch die Ergebnisse aus früheren Positionen von Bedeutung (Kohli 1980). „Die Verweisebenen des Handelns sind durch einen prozeßhaften Charakter gekenntzeichnet, den wir ‚Sequenzialität‘ nennen wollen. Handlungsanalyse ist daher, soweit sie diesem Prozeßcharakter gerecht werden wird, immer Sequenzanalyse“ (Fischer und 71 Kohli 1987, S. 43). Erfahrungen sind unterschiedlich konfliktiv: „Erlebnisse, die die Situationen, in welchen sie gemacht werden, ‚problematisch‘ erscheinen lassen, verlangen eine Neugestaltung des Wissensvorrats - sei es, daß ihm neue Wissenselemente hinzugefügt, sei es, daß vorhandene Wissenselemente verändert werden“ (Alheit und Hoerning 1989, S. 9-10). Erfahrungen sind nicht nur biographisch, sie werden mitbestimmt durch den sozialen Kontext, in dem sich ein Individuum bewegt. Das bedeutet, dass nicht alle dieselben Erfahrungsmöglichkeiten besitzen (Alheit und Hoerning 1989). „Bourdieus Idee von den Laufbahnen im sozialen Raum (‚trajectoires‘) konkretisiert überzeugend die Beobachtung, daß Lebenswege sich in einem sozialen Feld bewegen, das bereits strukturiert ist. Biographien sind auch Ergebnis der Reproduktion von Klassenverhältnissen. Das wird gerade an sozialen Aufstiegsprozessen besonders deutlich“ (Alheit und Hoerning 1989, S. 13. Hervorh. im Original). „Lebensgeschichtliche Erfahrung läßt sich also nur verstehen, wenn wir beides berücksichtigen: die biographische Perspektive von Angehörigen einer Lebenswelt - gleichsam die ‚natürliche Einstellung‘, in der neue Erfahrungen zu biographisch vertrauten Erfahrungen werden, und die Faktoren, die ‚hinter dem Rücken‘ der Teilnehmer von Lebenswelten wirksam sind und bestimmte Erfahrungshorizonte überhaupt erst konstituieren“ (Alheit und Hoerning 1989, S. 15. Hervorh. im Original). Die Erfahrungen der Vergangenheit „hinterlassen in der Biographie Prägungen und Muster, die das zukünftige biographische Projekt ‚vorstrukturieren‘. Gleichzeitig sind biographische Erfahrungen als biographisches Wissen Handlungsressourcen, die zur ‚Konstruktion‘ des zukünftigen biographischen Projekte verwendet werden“ (Hoerning 1989, S. 153). Biographische Erfahrungen sind an einen lebensgeschichtlichen Kontext gebunden (Hoerning 1989), was die Eingangs formulierte Forderung nach 72 einer Analyse des Lebenslaufs in seiner Gänze ein weiteres Mal bekräftigt. Im Erfahrungbegriff ist ein doppelter Zeithorizont der Vergangenheit und der Zukunft enthalten (Fischer und Kohli 1987, S. 31): „‚Erfahrung‘ steht also für den gleichzeitig ‚Altes‘ aufnehmenden und variierenden wie ‚Neues‘ schaffenden Umgang mit Wirklichkeit (...) ‚Erfahrung‘ eröffnet den Erwartungshorizont einer gelingenden künftigen Orientierung auf der Basis gültiger Folgerungen aus vergangenen Handlungs- oder Wahrnehmnungssituationen.“ Die Sichtweise, dass Handlung mit einem Entwurf verbunden ist, erzeugt diesen doppelten Zeitbezug und „verweist damit über die Gegenwart des Handlungsvollzuges hinaus“ (Fischer und Kohli 1987, S. 36). Lebenserfahrungen bilden eine „Brücke zwischen biographischer Vergangenheit, biographischer Gegenwart und biographischer Zukunft“ (Hoerning 2000, S. 4). Dadurch wird biographisches Wissen zu „Kapital, welches für die aktuellen und zukünftigen Konstruktionen der Biographie verwertet wird“ (Hoerning 2000, S. 4). Der Handlungsentwurf nimmt die vollendete Handlung voraus und stützt sich auf Handlungstypen, die in der Erfahrung gebildet wurden (Fischer und Kohli 1987, Schütz 1971). „Die im künftigen Erwartungshorizont sich auslegende Dimension der Intention bestimmt Schütz final (‚Um-zu-Motiv‘), die durch die Vergangenheit bestimmte Dimension der Intention kausal (‚WeilMotiv‘). Die Wahl der Mittel, sozusagen der inhaltliche Entwurf des Handelns, erfolgt aufgrund der gemachten Erfahrung, während der Zweck das für die Handlung notwendige ‚voluntative fiat‘ auslöst“ (Fischer und Kohli, 1987, S. 36). Biographische Erfahrungen werden im Lebenslauf fortwährend weiter bearbeitet: Reaktionen auf identische Lebensereignisse unterscheiden sich nicht nur interindividuell, sondern die eigenen Einschätzungen dazu verändern sich im Lauf des Lebens (Hoerning 1987). Biographische Erfahrungen und das daraus gewonnene biographische Wissen stellt nicht nur die Ablagerung 73 des Erfahrenen dar, es repräsentiert die fortlaufende Überarbeitung des Erfahrenen (Hoerning 1989, 2000). Zielsetzungen und Erwartungen sind im wesentlichen zu erklären aus Bedingungen, Entscheidungen, Ressourcen und Erfahrungen der bisherigen Lebensgeschichte (Mayer 1987). Handlungspotentiale werden in stärkerem Masse durch die eigene Lebensgeschichte geprägt als durch die schlichte Mitgliedschaft in einer Altersgruppe (Mayer 1987). Erfahrungen werden immer interpretiert „im Lichte vorher erworbener Erfahrungstypen (Fischer und Kohli 1987, S. 32). Biographische Übergänge beispielsweise verursacht durch soziale Mobilität, dem Übergang zwischen Gesellschaftsschichten, zwingen zur Aufrechterhalten der sozialen Identität zu lebensgeschichtlicher Umdeutung (Hoerning 1987). „Es wird nicht nur die eigene Biographie unter dem Einfluß lebensverändernder Ereignisse umgedeutet, sondern auch diejenigen interpersonalen Beziehungen, die mit dem biographischen Projekt verstrickt sind“ (Hoerning 1987, S. 233). Biographische Erfahrungen bündeln sich zu Wissensbeständen, die aus Rollenkonfigurationen, also den sozialen Positionen und Teilnahmegebieten der Individuen, gespeist werden (Heinz 2000, S. 176). 3.7.2 Biographische Sozialisation und Identität „Sozialisationsforschung hat es immer mit dem Lebenslauf zu tun und Biographieforschung ist notwendig immer auch Sozialisationsforschung“ (Geulen 2000, S. 187). Bausteine für die Selbstsozialisation im Lebenslauf sind „die reflektierten Erfahrungen mit signifikanten Anderen und institutionellen gatekeepern“ Heinz 2000, S. 176. Hervorh. im Original). „Sich dabei aus der Perspektive signifikanter Anderer zu sehen, heißt die eigenen Handlungen vor dem Hintergrund sozialer Inszenierungen durchzuspielen beziehungsweise in ihrer potentiellen Wirkung für das Selbstkonzept in sozialen Beziehungsnetzen zu überdenken. Sich aus der Perspektive von Institutionen und deren gatekeepern zu sehen (...) bedeutet demgegenüber, 74 die bisherige Biographie in bezug zu den Mitgliedschafts- und Selektionskriterien von Organisationen zu setzen“ (Heinz 2000, S. 177. Hervorh. im Original „Eine Biographie oder Lebensgeschichte kann (...) als (situations- und kontextabhängiges Produkt einer retrospektiven und reflexiven Selbstkonstitution von Subjekten betrachtet werden, die im Laufe ihrer Sozialisation gelernt haben, ihr eigenes Selbst als gewordenes und temporal strukturiertes aufzufassen. Begriffe wie Lebensgeschichte und Biographie stehen nicht bloß für den empirischen Prozeß der Genese subjektiver Strukturen und qualitativer Bestimmungsmerkmale menschlicher Subjektivität in einem soziokulturellen und historischen Kontext. Diese Begriffe stehen auch und unabdingbar für die Thematisierung dieses ‚Prozesses‘, für dessen symbolische, insbesondere sprachliche Repräsentation und Reflexion. Lebensgeschichten sind Reflexions- und Kommunikationsprodukte, die Subjekte selbst und anderen Personen zuschreiben“ (Straub 2000, S. 118). „Sozialisation im Lebenslauf heißt (...) nicht nur, daß das Individuum in die Gesellschaft von entsprechenden Sozialisationsagenten (Eltern, Lehrer, Ausbilder, Vorgesetzte, Richter, Ärzte und anderen) einsozialisiert wird, sondern Sozialisation im Lebenslauf heißt dann, daß die eigene Lebensgeschichte bei allen Sozialisationsprozessen quasi als ‚Sozialisationsagent‘ mit in Erscheinung tritt“ (Hoerning 1989, S. 161). Die Berücksichtigung biographischer Erfahrungen „als biographisches Wissen im Sozialisationsprozess heißt demnach, Prozesse der biographischen Anschlussfähigkeit zu untersuchen“ (Hoerning 1989, S. 162). „Die am Lebensalter orientierte Übernahme von gesellschaftlichen Rollen, deren Beginn und Ende als Lebensereignisse markiert werden, sichern nicht nur dem gesellschaftlichen System seinen Fortbestand, sondern garantieren dem Individuum, wenn es an diesem Prozeß teilnimmt, eine Vergleichbarkeit der eige- 75 nen mit anderen Biographien durch Rollenabfolgen (...) machen es dem Individuum möglich, sich auf die Einnahme zukünftiger Rollen in einem antizipatorischen Sozialisationsprozess vorzubereiten. Ob antizipatorische Sozialisationsprozesse möglich sind, wird davon abhängig sein, inwieweit die Übernahme von gesellschaftlichen Rollen institutionalisiert ist“ (Hoerning 1987, S. 241). Die subjektive Konstruktion von biographischen Projekten vor dem Hintergrund struktureller Chancen und biographischer Erfahrungen kann als individuelle Wahl zwischen strukturell gegebenen Handlungsalternativen interpretiert werden (Buchmann 1989). Die theoretische Konzeption der biographischen Orientierungen und Strategien ermöglicht die Integration von strukturellen und subjektiven Aspekten in die Analyse des Lebenslaufs, und in dieser Weise die Verknüpfung von Struktur und Handlung (Buchmann 1989), also der makro- und der mikrosoziologischen Ebene der Lebenslaufanalyse. „Für die Betrachtung des Verzahnungsprozesses gesellschaftlicher und biographischer Verläufe sind neben den strukturellen Ressourcen und den sich historisch aktualisierenden Sozialdaten der Person (zum Beispiel historische und lebensgeschichtliche Bewertungen von Bildungszertifikaten) (...) zwei Dimensionen von Bedeutung. Diese Dimensionen bilden den Hintergrund für die Konzeptualisierung des Begriffs der Lebenserfahrung als biographische Ressource. (...) Biographische Ereignisverkettungen bilden den strukturellen Hintergrund der miteinander verbundenen Lebenslaufdimensionen ab, die durch das Ereignis berührt werden. Bei der Rekonstruktion der Biographie zeigt sich, welche Dimensionen von dem Ereignis in Mitleidenschaft gezogen werden (Verkettungen) und gleichzeitig zeigt sich, welche neuen Verkettungen aufgrund des Einbruchs des Ereignisses sich herausbilden. Biographische Commitments beziehen sich auf lebensgeschichtlich frühere Handlungen, die weitere Handlungsmöglichkeiten einengen, beziehungsweise vorschreiben“ 76 (Hoerning 1987, S. 254. Hervorh. im Original) „Erfahrungen als biographische Ressource objektivieren die Lebensgeschichte als Geschichte, und sie zeigen den individuellen Habitus als Produkt der sozialen Strukturen. Sozialisation in diesem Sinne bedeutet nicht, etwas Defizitäres zu beseitigen, sondern Sozialisation ist ein (Interaktions-) Prozeß, in dem Individuen mit unterschiedlichen interpretativen Kompetenzen ihre jeweiligen Identitäten und biographischen Perspektiven aushandeln, was gleichzeitig bedeutet, daß Sozialisationsprozesse zu keinem Zeitpunkt abgeschlossen sind“ (Hoerning 2000, S. 6-7). „Biographische Sozialisationsforschung fragt nach der Bedeutung von Lebenserfahrungen für biographische Transformationsprozesse, denn die Entwicklung und Entfaltung der Biographie vollzieht sich nicht nur dadurch, daß der Lebenslauf durch zentrale Instanzen der Sozialisation prozessiert wird (Familie, Schule, peers, Beruf, Betrieb, Massenmedien und andere), und daß sich Kognition, Sprache, Emotionen, kulturelle Identität, Moral und anderes entwickeln (...) sondern Entwicklungsabfolgen im Lebenslauf enthalten individuelle Entscheidungen, in denen Erfahrungen gedeutet, eingeordnet oder verworfen werden, um aus der subjektiven Perspektive die Anschlußfähigkeit der Biographie zu sichern“ (Hoerning 2000, S. 8). „Durch die Anforderung, zwischen verschiedenen Institutionen und Netzwerken durch eigene Handlungen tragfähige Verbindungen und Koordinationsmuster herzustellen, erwerben die Individuen in unterschiedlich ausgeprägtem Maße die Kompetenz zur Reflexion und Innovation ihres Lebenslaufs im Spannungsfeld von Biographie, Lebensentwürfen und sozialen Handlungskontexten. Dies bedeutet, den Lebenslauf als Institution zu betrachten, die Individuen in Sozialisations- und Selektionsprozesse, insbesondere in Statuspassagen und Übergängen zwischen Lebensbereichen einbindet“ (Heinz 2000, S. 166). Heinz (2000) spricht von Selbstsozialisation, da in Verbindung 77 mit der zunehmenden Individualisierung (Beck 1986) in einer Gesellschaft mit riskanten Lebenslaufoptionen die Notwendigkeit der Selbstreflexion stark zugenommen hat. Dadurch „wird aus der Frage: Wie wirken soziale Herkunft, Geschlecht, Bildung und Familienstatus einerseits und die gesellschaftlichen Gelegenheitsstrukturen und Institutionen andererseits auf die Verlaufsform des Lebenslaufs ein, die Frage danach, wie sich die Individuen mit ihren Erfahrungen, Ansprüchen und Ressourcen auf die ungleich verteilten Optionen und Handlungsspielräume im Lebenslauf beziehen. Wenn beispielsweise im Übergangssystem zwischen Schule und Arbeitsmarkt in Abhängigkeit vom Bildungsabschluß eine begrenzte Anzahl von Wegen ‚zur Wahl‘ stehen, dann müssen die Individuen in mehr oder weniger planvoller Weise ihre beruflichen Aspirationen auf dieses institutionalisierte Wegenetz abstimmen“ (Heinz 2000, S. 166). Das Selbstbild ist das Ergebnis von kontingenten gesellschaftlichen Bedingungen (Begegnungen mit andere, Sprache usf.), wie dies Mead (....) und der symbolische Interaktionismus gezeigt haben (Geulen 2000). 3.7.3 Übergänge als Lebensereignisse Straub (2000) bezeichnet Zeiten von Ruhe und Beständigkeit im Lebenslauf als „biographische Auszeiten“ (S. 150. Hervorh. im Original). „Jede Biographie operiert mit ‚Zeiten des Wandels‘ und mit ‚Auszeiten‘. Jede Lebensgeschichte kennt bewegende und bewegte Zeiten so gut wie beruhigte und beruhigende Zeiten, Zeiten des Stillstands. Auszeiten sind Zeiten ohne Spannung, Phasen, die von biographischer Kontingenz verschont bleiben (...) Jede Biographie ist im Grunde genommen an lebensgeschichtliche Transformationen gebunden. Biographisches Denken ist im Kern ein Denken und gedankliches Bearbeiten lebensgeschichtlicher Kontingenz und Veränderung“ (Straub 2000, S. 151). Von „Zeit zu Zeit werden Individuen mit Anforderungen konfrontiert, die den Lebensplan irritieren und bei denen gerade 78 nicht auf bereits Abgelagertes oder antizipatorisch Erworbenes zurückgegriffen werden kann, um sich mit der neuen Situation umstandslos zu arrangieren“ (Hoerning 2000, S. 6). Die Bewältigung solcher Lebensereignisse bedeutet, „die Fakten des Lebens neu zu ordnen und zu verorten, die Biographie neu zu verankern“ (Hoerning 2000, S. 6). Strukturelle Übergänge von einem Lebensalter in ein anderes stellen einen wichtigen Gegenstand der Biographie- und Lebenslaufforschung dar (Hoerning 1987). Die „Schnittstellen der Übergänge - die wiederum als Transformationsprozesse zu verstehen sind - werden Lebensereignisse genannt“ (Hoerning 1987, S. 243). Besonders im Rahmen von Übergängen im Lebenslauf richten Individuen ihre Aufmerksamkeit auf diese Aspekte und beschäftigen sich mit ihren Lebensplänen (Buchmann 1989). Die bisherige Lebensgeschichte wirkt nicht nur auf die jeweiligen Zugangschance, sondern sie beeinflusst auch spätere Übergänge (Mayer 1987). Dabei werden die „biographischen Wissensbestände wiederbelebt und ‚überarbeitet‘ als Unterstützung und/oder Behinderung in aktuellen Handlungssituationen beziehungsweise in die Planungen von Lebensperspektiven einbezogen“ (Hoerning 1989, S. 148). Übergänge sind Schlüsselereignisse für eine Reflexion biographischer Erfahrungen (Hoerning 1989) und zukünftige Erwartungen, damit Individuen ihre biographischen Projekte und Lebenspläne ausarbeiten und entwickeln können, die als Leitschienen für ihre Handlungen dienen (Buchmann 1989). Dabei werden „die lebensgeschichtlichen Erfahrungen und die sich verändernden historisch-gesellschaftlichen Bedingungen so zusammengeführt, daß bisher verdeckte Möglichkeiten eines biographisch ‚neuen‘ Weges sich eröffnen können“ (Hoerning 1987, S. 238). Das biographische Projekt wird in einer Verlaufskurve gestört. Diese Irritation sowie die damit einhergehenden Konsequenzen können andere biographische Verlaufskurven beeinflussen (Hoerning 1987, Schütze 1981). Die Problematik einer Statustransition wird nicht durch den Übergang an sich bestimmt, sondern durch 79 dessen Bedeutung für das betroffene Individuum (Hoerning 1987). Durch die Einwirkungen von Lebensereignissen muss das biographische Projekt umstrukturiert werden, das Individuum muss sich „mit dem Lebensereignis arrangieren. Die Wirkung eines Lebensereignisses wird dadurch deutlich, daß bisherige Erfahrungsregeln ihre Anwendungskraft verlieren, einbüßen oder überflüssig werden, daß aber gleichzeitig die bereits gemachten biographischen Erfahrungen und auch Erfahrungen im Umgang mit ähnlichen oder anderen Lebensereignissen als Ablagerungen in der biographischen Erinnerung vorhanden sind beziehungsweise sein können, die revitalisiert und aktualisiert als Handlungsmittel auftreten“ (Hoerning 1987, S. 240). Heinz entwickelte das Konzept des Übergangshandelns (2000, S. 179): „Damit sind Entscheidungen und Aktivitäten gemeint, die junge Leute entwickeln, um ihre Interessen und Berufsziele im Rahmen gesellschaftlicher Anforderungen, Bildungswege und Gelegenheitsstrukturen zu realisieren.“ Er unterscheidet vier Formen des Übergangshandelns: Strategische Übergangshandeln, Schritt-für-Schritt-Übergangshandeln, risikobereites Übergangshandeln und ‚Mal-seh’n, was-kommt‘-Übergangshandeln (Heinz 2000). Die Statuspassage von der Schule in den Beruf wird durch das Handeln von Jugendlichen und von institutionellen gatekeepern gestaltet: „Dieser Prozess ist ein Prototypus von Selbstsozialisation, in dem sich Biographiegestaltung und Fremdselektion, Chancenwahrnehmung und Risikoverminderung ergänzen“ (Heinz 2000, S. 181). Durch Prozesse der Selbstsozialisation bündeln „biographische Akteure ihr Erfahrungswissen zu Handlungsmodi (...), um die mit den Übergängen im Lebenslauf verbundenen Anforderungen ihren Interessen entsprechend zu meistern“ (Heinz 2000, S. 183). Es scheint, „daß berufliche Mobilität und biographische Umorientierungen weniger durch direkte Arbeitsmarktprobleme als vielmehr durch die Erfahrung bedingt sind, die junge Fachar80 beiter und Angestellte in ihrem Berufsfeld und im Betrieb gemacht haben“ (Heinz 2000, S. 182) GT Analyse / Quant. Teil 3.8 Biographische Entscheidungen Die objektiv vorgegebenen biographischen Handlungshorizonte haben sich im gesellschaftlichen Modernisierungsprozess vervielfacht. „Damit hat sich auch der Entscheidungs- und insbesondere der Begründungszwang für die Vernünftigkeit von getroffenen Entscheidungen erhöht. Die biographischen Konzepte, die der einzelne im Laufe seines Lebens realisieren kann, haben sich derartig vervielfältigt, daß selbst in grundlegenden Bereichen permanent eine Wahl getroffen werden muß. Elementare Fragen der sozialen Lebenspraxis sind immer weniger institutionell zwingend geregelt und werden somit immer weniger selbstverständlich im Lebensvollzug ‚gelöst‘, sondern sind durch entscheidungsfähige und entscheidungsnotwendige Handlungsalternativen gekennzeichnet (Fischer und Kohli 1987, S. 40. Hervorh. im Original). Rationale Entscheidungen Gemäss der Rational Choice Theorie wählen Individuen Entscheidungen, die ihre Präferenzen und Investitionen optimieren (Heinz 2000). Es gibt um eine Maximierung des persönlich erwarteten Ertrags. Handlende sind entsprechend dem Modell des ökonomischen Menschen verstanden, der auf jedem Markt einen maximalen Ertrag herauszuschlagen versucht, unwesentlich, ob es sich um den Bildungs-, den Arbeits- oder den Heiratsmarkt handelt. Für das Verständnis von biographischen Entscheidungen entlang des Lebenslaufs ist die Rational Choice Theorie nur von begrenztem Nutzen, Individuen sind bei solchen Entscheiden gezwungen in Situationen zu handeln und Entscheide zu treffen, in denen sie nur in begrenztem Masse über alle möglichen Wahlalternativen und Lebenslaufergebnisse informiert sind (Heinz 1996). Würden sich Individuen in solchen Situationen aus- 81 schliesslich um eine Maximierung des voraussichtlichen Nutzens kümmern, während sie nicht vernünftige Akteure sondern rationale Narren (Heinz 1996). Bei der Wahl zwischen Handlungsalternativen findet ein innerer Dialog statt, im Rahmen dessen über die eigene Situation und die wahrscheinlichen Konsequenzen einer Optimierung der eigenen Präferenzen stattfindet. Sobald eine solche Selbstreflexion stattfindet, müssen zum Verständnis der biographischen Handlungsentscheide neben der Berücksichtigung der zu erwartenden Ergebnisse auch situative Gegebenheiten, biographische Erfahrungen und individuelle Lebenslauferwartungen berücksichtigt werden (Heinz 1996). „Gesellschaftliche Bedingungsgefüge strukturieren individuelle Handlungsspielräume, die die autonomen Wahlentscheidungen einschränken. Und Sozialisationsprozesse definieren die subjektive Relevanz von Handlungsoptionen. Aus der Lebenslaufperspektive liegt es nahe, individuelle Präferenzen als variabel und nicht als fixiert zu betrachten, nämlich als Ergebnis von sozialen Austauschprozessen und Sozialisationserfahrungen. Daher können Präferenzen nicht als Ursache, sondern allenfalls als Begleiterscheinungen von biographischen Entscheidungen gelten“ (Heinz 2000, S. 168). Entscheidungen im Lebenslauf werden meist unter der Bedingung von Ungewissheit über die Konsequenzen der gewählten Alternativen getroffen. Wenn nicht alle Optionen verglichen werden können, gibt es keine optimale Entscheidung (Heinz 2000). Damit das Problem entscheidbar wird, muss es umformuliert werden. „Dies geschieht durch Rückgriffe auf frühere Interessen, Anregungen, Umstände - also auf dem Weg einer biographischen Konstruktion“ (Heinz 2000, S. 169). Da die Rational Choice Theorie „annimmt, daß Menschen allenfalls etwas nach vorne und nicht zurückschauen, wenn sie ihre Erwartungen bilden und Entscheidungen treffen, kann sie die Frage nicht beantworten, welche Gründe dazu führen, daß Menschen in der Regel suboptimale, aber dennoch vernünftige Entscheidungen treffen können. Die Antwort liegt darin, daß sie 82 durch biographische Bilanzen und kreatives Handlungslernen (...) vernünftig mit kurz- und langfristigen Erwartungskonflikten und Ungewißheiten umgehen, anstatt der Illusion einer rational kalkulierbaren, hieb- und stichfesten Entscheidung für die subjektiv nützlichste Alternative zu erliegen. Im Horizont von Lebensentscheidungen oder Übergangsoptionen sind die biographische Stimmigkeit und die soziale Einbettung des ‚gewählten‘ Wegs vernünftiger als die nüchterne Ertragskalkulation“ (Heinz 2000, S. 169). Aus der Sicht der Lebenslauf- und Biographieforschung ist die Rational Choice Theorie nur auf den Sonderfall zweckrationalen Handelns anwendbar, sie vernachlässigt die „Dynamik der Präferenzen und Handlungsfolgen im Zeitablauf (...) Lebensentscheidungen werden nicht ad hoc, sondern in einem biographischen Horizont getroffen“ (Heinz 2000, S. 170). Die sozialen Akteure sind jedoch keine Subjekte, die sich von Gründen leiten lassen und in vollem Bewusstsein aller vorliegenden Möglichkeiten handeln, denn es existiert keine „vollkommene Existenz der Ordnung der Dinge und der Ursachen“ (Bourdieu 1985, S. 41). Wäre die Wahl vollkommen rational und logisch, so wäre sie keine Wahl mehr im eigentlichen Sinne (Bourdieu 1985). ( Hier noch Bourdieu (1987) zur RCT S. 94/95 einbringen) Entscheidungen im Lebenslauf „Übergänge im Lebenslauf fordern und ermöglichen biographische Entscheidungen, die von Akteuren unter Berücksichtigung von sozialen Normen und institutionellen Möglichkeiten beschleunigt, verlangsamt oder on time getroffen werden. Das timing und die Verbindlichkeit der Entscheidung hängen wiederum von der subjektiven Beurteilung der Handlungsoptionen vor dem Hintergrund der biographischen Ressourcen (...) und der erwünschten oder befürchteten längerfristigen Folgen ab“ (Heinz 2000, S. 170). Spontane Entschlüsse können „vernünftig sein, wenn 83 die Vor- und Nachteile einer Auswahl zwischen Optionen langfristig nicht abzusehen sind. Im Kontext der Biographie ist jedoch auch ein spontaner Entschluß eingebunden in die vom Individuum entwickelten Sinnstrukturen; dabei ist nicht das Nutzenkalküle Richtschnur, sondern die Selbstsozialisation als Kriterium für biographisch vernünftiges Handeln“ (Heinz 2000, S. 171). In einer Entscheidungssituation findet beim Akteur „ein intra-personaler Dialog statt, bei dem es etwa um die Erhaltung des guten Rufs oder die persönliche Gleichung geht (Heinz 2000, S. 171). So kann „Selbstverpflichtung zu Entscheidungs- und Handlungskonsistenz über die Zeit führen (Heinz 2000, S. 171). „Um sowohl den individuellen als auch den sozialen Bedeutungsgehalt von Selbstsozialisation im Lebenslauf transparent zu machen, ist der Begriff des biographischen Akteurs von Nutzen. Dieses Konzept verbindet die Lebensgeschichte und Lebensperspektive eines Individuums mit den wahrgenommen Optionen und Handlungskontexten. Das Individuum als biographischer Akteur setzt sich mit den Handlungsoptionen im Lebenslauf nicht allein auf der Grundlage subjektiver Nützlichkeitserwägungen und sozialer Normen auseinander, sondern bezieht diese vielmehr auf seine biographischen Wissensbestände und Selbstverpflichtungen. Damit wird die biographische Gestaltungspraxis und kompetenz (agency) als Kern von Lebenslaufentscheidungen, des timing und Verlaufs von Übergangsprozessen angesprochen. Optionen im Lebensverlauf werden nicht nach kurzfristigen KostenNutzen-Kalkulationen, sondern nach biographischen Relevanzkriterien geordnet“ (Heinz 2000, S. 177. Hervorh. im Original). 84