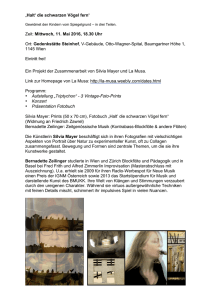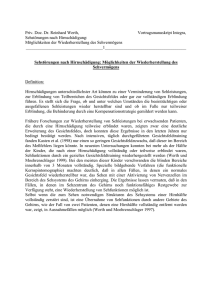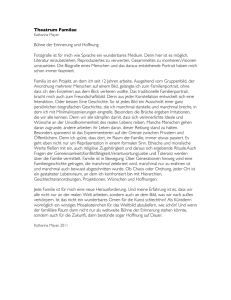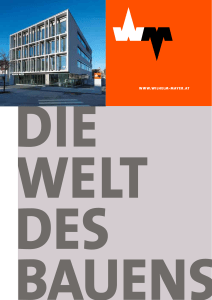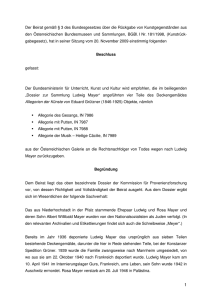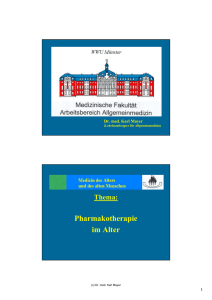heuristiken - socialcognition
Werbung

Einführung Heuristiken und „Biases“ Wir leben in einer Welt voller Unsicherheiten, trotzdem müssen Entscheidungen und Urteile ständig getroffen und Alternativen gewählt werden. Menschliche Denkprozesse sind aber in ihrer Kapazität begrenzt, weshalb häufig sogenannte „mentale Abkürzungen“, also Heuristiken als kognitive Strategie dienen, um schnelle Lösungen zu liefern und die Komplexität der Urteilsfindung zu reduzieren (Kahneman et al., 1982; in Mayer & Werth, 2008). Es handelt sich dabei um automatische und absichtslose Denkprozesse. Wichtig ist, dass durch Heuristiken in den meisten Fällen effiziente und akzeptable Urteile resultieren (Gigerenzer & Goldstein, 1996; in Mayer & Werth, 2008). Trotzdem kann es unter bestimmten Bedingungen durch Heuristiken zu systematischen Fehleinschätzungen kommen, den „biases“. Vor diesen Verzerrungen schützt auch hohe Intelligenz nicht, es sind aber Trainings zur Verbesserung möglich (Gerrig & Zimbardo, 2008). Zusammenfassend lassen sich Heuristiken als Regeln definieren, die Problemlöseprozesse beschreiben. Sie sind simpel und dadurch schnell sowie robust anwendbar, das heißt auch auf neue Situationen generalisierbar. Außerdem sind Heuristiken ökologisch valide, was bedeutet, dass ihre Zuverlässigkeit von den Bedingungen der Umwelt abhängen (Gigerenzer, 2004; in Harvey & Koehler (Hrsg.), 2004). „Biases“ als fehlerhafte Outcomes aus den kognitiven Prozessen können, müssen aber nicht, resultieren (Keren & Teigen, 2004; in Harvey & Koehler (Hrsg.), 2004). Die drei populärsten Heuristiken werden im Folgenden näher erläutert. 1) Verfügbarkeitsheuristik Die Verfügbarkeitsheuristik wird angewandt bei Urteilen zu Häufigkeiten oder Wahrscheinlichkeiten. Sie beinhaltet, dass wir anstehende Urteile aus Gedächtnisinhalten ableiten, die uns spontan einfallen, „ease of retrieval“ genannt von Kahneman & Tversky (1973; in Mayer & Werth, 2008), oder die wir uns leicht vorstellen können, „ease of imaginability“ genannt (Sherman et al., 2002; in Mayer & Werth, 2008). Es geht also grundsätzlich eher um die Zugänglichkeit als um das, was uns kognitiv tatsächlich zur Verfügung steht. Die Rückschlüsse, die aus der Anwendung der Verfügbarkeitsheuristik gezogen werden, können nur dann korrekt sein, wenn die Zugänglichkeit auf der objektiven Auftretenshäufigkeit beruht. Die Zugänglichkeit kann aber auch durch andere Faktoren beeinflusst werden. „Frequency“ kann durch Medienberichte manipuliert sein, „Recency“, also gerade Erlebtes oder Gehörtes kann zu Überschätzen der Häufigkeit führen und auch die Salienz oder „Vividness“ eines beispielsweise selbst erlebten Ereignisses können zu Fehlentscheidungen führen. Auch die Ereignisverknüpfung, in der das gemeinsame Auftreten durch besonders starke Assoziation zwischen zwei Ereignissen überschätzt wird, kann zu einer Ergebnisverzerrung führen. Worauf basiert die Wirkung der Verfügbarkeitsheuristik, geht es um die aktivierten Inhalte oder um das „Leichtigkeitsgefühl“ bei der kognitiven Operation des Abrufens? Um dies zu erschließen führten Bless, Schwarz & Strack et al. (1991; in Mayer & Werth, 2008) folgende Studie durch: Versuchspersonen wurden in einem ersten Schritt dazu aufgefordert, 6 beziehungsweise 12 Beispiele für selbstsicheres Verhalten zu generieren, je nach Bedingung. Im Anschluss sollte die eigene Selbstsicherheit im Allgemeinen eingeschätzt werden. Es zeigte sich, dass Personen in der 6er Bedingung signifikant mehr Selbstsicherheit berichteten, was damit erklärt wurde, dass ihnen die erste Aufgabe leichter gefallen sein musste. Somit scheint die „Leichtigkeit“ bedeutsamer als der Inhalt zu sein. In einem nachfolgenden Experiment von Haddcock et al. (1999; in Mayer & Werth, 2008) wurde ein sehr ähnliches Design verwendet wie eben beschrieben, mit dem Unterschied, dass die Versuchspersonen während der ersten Aufgabe Musik ausgesetzt waren. Den Teilnehmern wurde erzählt, dass diese Musik den Abruf selbstsicheren Verhaltens erleichtere. Somit schwand der diagnostische Wert des „Leichtigkeitsgefühls“ bei der 6er Bedingung. Tatsächlich zeigte sich durch diesen Verlust, dass der Inhalt wieder bedeutsamer wurde, da Versuchspersonen in der schwereren, also der 12er Bedingung, signifikant mehr selbstsicheres Verhalten berichteten. 2) Repräsentativitätsheuristik Die Repräsentativitätsheuristik wird angewendet bei Kategorisierung und Wahrscheinlichkeitsurteilen. Typikalität wird in dieser verkürzten kognitiven Operation als entscheidendes Kriterium für Urteile verwendet, das heißt Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen wenden danach bewertet, wie genau sie bestimmten Stereotypen entsprechen. Meist erreichen wir so eine hohe ökologische Validität, weil in den meisten Verteilungen der mittlere Wert auch der Modalwert, also der häufigste Wert ist. Die Repräsentativitätsheuristik unterliegt aber im Wesentlichen zwei Fehlern. Zum ersten werden bei Urteilsprozessen häufig grundlegende Wahrscheinlichkeitstheoretische Regeln vernachlässigt, zum anderen wird die Basisrate vernachlässigt. Zu letzterem kann ein klassisches Experiment von Kahneman & Tversky (1997; in Mayer & Werth, 2008) angeführt werden, das so genannte „Engineer-Lawyer problem“. Teilnehmer dieser Studie bekamen eine Instruktion, in der zu lesen war, dass ein Psychologenteam mit 100 Menschen Persönlichkeitstests durchgeführt hat, von denen 30 Ingenieure und 70 Juristen waren. Anschließend bekamen die Teilnehmer in einer ersten Bedingung eine kurze Persönlichkeitsbeschreibung einer Person, die allerdings keine Implikationen für die Berufswahl beinhaltete und die Frage, wie wahrscheinlich diese Person namens „Dick“ ein Ingenieur sei. Anschließend bekamen sie dieselbe Fragestellung, allerdings ohne eine konkrete Personenbeschreibung. Die Ergebnisse, die für das Vernachlässigen der Basisrate sprechen offenbarten, dass Teilnehmer in der Bedingung mit Personenbeschreibung die Wahrscheinlichkeit auf 50% einschätzten, Teilnehmer der zweiten Bedingung aber korrekt mit 30% antworteten. Sobald also Informationen zur Verfügung stehen, über die sich vermeintlich ein Eindruck bilden lässt, wird nur noch die Repräsentativität, nicht aber die Basisrate genutzt. Zur Repräsentativitätsheuristik zugehörige „Biases“ können zum Beispiel zufällige Ereignisse sein, die nicht als solche erscheinen (Lottoziehung: 1,2,3,4,5,6) und die sogenannte Konjunktionstäuschung beim populären „Lindaproblem“, in dem zwei gemeinsam auftretende Ereignisse fälschlicherweise als typischer angesehen werden als ein einzelnes daraus. Mögliche Moderatoren, die die Anwendung der Repräsentativitätsheuristik unwahrscheinlicher machen sind Veränderung des Häufigkeitsformates in relative Häufigkeiten (Cosmides & Toobey, 1996; in Mayer & Werth, 2008) und Aufmerksamkeitslenkung (Gigerenzer et al., 1988; in Mayer & Werth, 2008). Werden Basisraten erst nach der Persönlichkeitsbeschreibung genannt beim „Engineer-Lawyer problem“ ergibt sich ein „recency“ Effekt und Basisraten werden genutzt. Ebenso verschwinden die Vernachlässigungseffekte durch Umbenennung der Aufgabenstellung von „psychologischem Problem“ zu „statistischem Problem“. 3) Ankerheuristik Die Ankerheuristik kommt zur Anwendung bei quantitativen Schätzungen. Ein vorgegebener oder selbstgenerierter Ausgangswert, der informativ oder irrelevant sein kann, bewirkt, dass ein Urteil in Richtung des Ausgangswerts (=Anker) angepasst wird. Dies kann in vielen Bereichen stattfinden, in Schätzaufgaben in denen Längen, Größen, Gewichte etc. angegeben werden sollen, in Verhandlungsergebnissen, in denen eine Urteilsverzerrung in Richtung des ersten Angebots stattfinden kann und in Gerichtsurteilen. Hierzu gibt es Studien mit erfahrenen Richtern in simulierten Verfahren von Englich et al. (2006; in Mayer & Werth, 2008) die zeigen, dass Ankereffekte unabhängig von der Berufserfahrung der Teilnehmer nachweisbar sind. Ebenso wenig spielt es eine Rolle, ob der Anker von einem Experten oder Novizen vorgegeben wird. Ankereffekte gibt es bei Leistungsbeurteilungen, wobei der Anker meist aus früheren Leistungen besteht, sowie bei Selbsteinschätzungen (vgl. Studie von Cervone & Peake, 1986; in Mayer & Werth, 2008). Es werden zwei Mechanismen der Ankerheuristik angenommen. Das „selective accessibility model“ kommt besonders bei vorgegebenen Ankern zum Tragen (Mussweiler & Strack, 1999; in Mayer & Werth, 2008). Es besagt, dass durch selektives, positives Hypothesentesten inhaltlich relevante Gedächtnisstrukturen aktiviert werden durch semantisches Priming. Dadurch erhöht sich die Verfügbarkeit und es findet eine Assimilation des Urteils an den Ankerwert statt. Ein zweiter Prozess findet vor allem bei selbstgenerierten Ankern statt. Wenn man als erste Annahme von einem Ankerwert ausgeht, von dem man sicher weiß, dass er falsch ist, passt man das Urteil nachfolgend an. Man spricht von „anchoring“ und anschließendem „adjusting“ (Epley & Gilovich, 2001; in Mayer & Werth, 2008). Hierfür sind stärker kognitive Ressourcen notwendig, wodurch der Prozess aber auch stärker beeinflusst werden kann, zum Beispiel durch Anstrengung und Motivation. Literatur: Gerrig, R. J. & Zimbardo, P. G. (2008). Psychologie. München: Pearson Studium. Gigerenzer, G. (2004). Fast and Frugal Heuristics: The Tools of Bounded Rationality. In N. Harvey & D. J. Koehler (Hrsg.), Blackwell Handbook of Judgment and Decision Making (S. 62-88). London: Blackwell. Keren, G. & Teigen, K. H. (2004). Yet Another Look at the Heuristics and Biases Approach. In N. Harvey & D. J. Koehler (Hrsg.), Blackwell Handbook of Judgment and Decision Making (S. 62-88). London: Blackwell. Mayer J. & Werth, L. (2008). Sozialpsychologie. Berlin/Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.