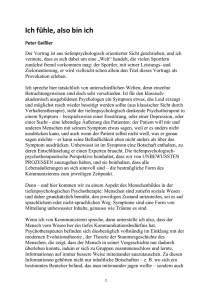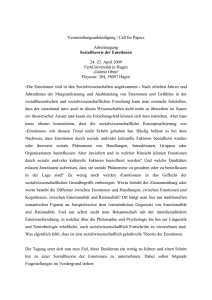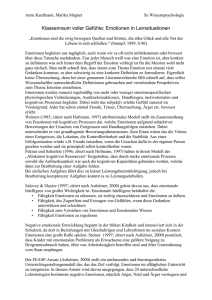- Max Fuchs
Werbung
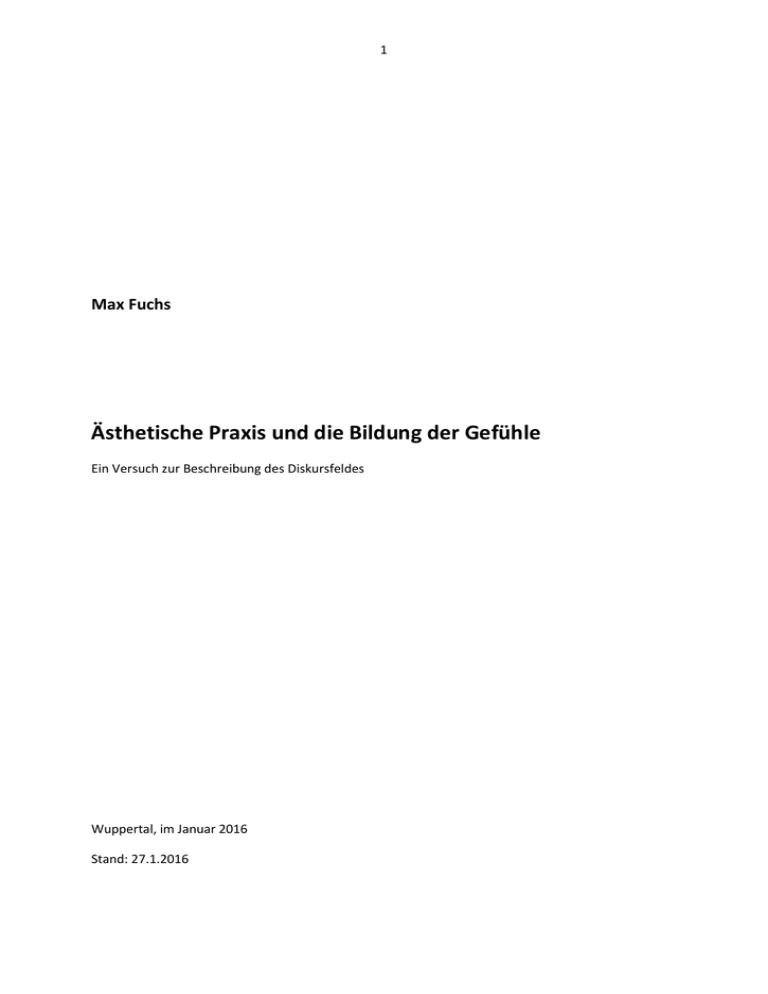
1 Max Fuchs Ästhetische Praxis und die Bildung der Gefühle Ein Versuch zur Beschreibung des Diskursfeldes Wuppertal, im Januar 2016 Stand: 27.1.2016 2 Inhaltsverzeichnis 1.Vorwort 3 2. Einleitung 5 3. Theorien der Emotionen 12 3.1 Philosophische Emotionstheorien 13 3.2 Soziologische Emotionstheorien 3.3 Psychologische Emotionstheorien 21 3.4 Emotionen und Geschichte 25 4. Emotionen und Kunst 28 5. Emotionen und Pädagogik 44 6. Ästhetische Praxis und Emotionen –Schlussfolgerungen für die Theorie und Praxis der kulturellen Bildung 54 7. Anhang: Emotionen und andere Dimensionen der Persönlichkeit – Notizen 61 8. Literatur 65 3 1. Vorwort Gefühle begleiten uns ständig im Alltag. Gleichgültig ob wir uns langweilen oder eine interessante Tätigkeit ausüben, ob wir Menschen treffen oder uns alleine mit Problemen auseinandersetzen, ob wir arbeiten oder uns entspannen: Stets signalisieren Gefühle uns nicht nur, wie es uns in der jeweiligen Situation geht, sie teilen uns auch mit, was wir von den Dingen, Prozessen oder Menschen, mit denen wir es gerade zu tun haben, zu halten haben. Gefühle sind es, die uns dazu veranlassen, etwas zu tun oder zu lassen. Gefühle haben etwas damit zu tun, in welcher Stimmung wir uns befinden und wie wir unser Leben insgesamt beurteilen. Gefühle haben etwas mit Erinnerungen zu tun und sie entscheiden zugleich, wie wir die Zukunft sehen. Insbesondere ist es das Feld der ästhetischen Praxis, ist es unsere Auseinandersetzung mit den Künsten, die bestimmte Gefühle hervorrufen. Selbst überaus rationale Konstruktionen wie etwa die Ästhetik Kants basieren auf dem Gefühl der Lust oder Unlust. Vor dem Hintergrund dieser Allgegenwart von Gefühlen, positiven oder negativen, ermutigenden oder frustrierenden, aufbauenden oder zerstörerischen, sollte man erwarten, dass es eine hinreichende Klarheit sowohl über die Begrifflichkeiten als auch über die Genese und die Zusammenhänge der verschiedenen Gefühle als auch wissenschaftlich belastbare Theorien gibt, auf die man im Interesse einer pädagogisch-ästhetischen Praxis aufbauen kann. Doch so alltäglich und selbstverständlich Gefühle in unserem individuellen und sozialen Leben auch sind: Sobald man sich intensiver auf die Suche nach relevanten Theorien begibt, muss man mit einer ständig wachsenden Irritation und Verwirrung rechnen. So gibt es zwar in den verschiedenen Disziplinen veritable Handbücher und Einführungstexte, doch muss man feststellen, dass es – wie in kaum einem anderen Feld – erhebliche Kontroversen über Begrifflichkeiten, ihre Anwendungsbereiche und ihre Zusammenhänge gibt. Dies beginnt schon damit, dass man zwar im Alltag die Begriffe der Gefühle, Emotionen, Affekte und in früheren Zeiten auch der Leidenschaften praktisch synonym verwendet, wobei man zu den genannten Begriffen auch noch das griechische Ursprungswort Pathos hinzufügen kann, dass es aber zwischen den Disziplinen und auch innerhalb derselben Disziplin gravierende Meinungsunterschiede gibt. Man wird zudem feststellen, dass es erhebliche Konjunkturen bei der Thematisierung der Gefühle in der Geschichte gegeben hat, was bis hin zu der überraschenden These reicht, dass es so etwas wie Emotionen gar nicht gibt. Etwas plausibler ist es, dass man sich mit der Streitfrage über den Zusammenhang von Kognition und Emotion auseinandersetzen muss. Auch im Kontext der Künste gibt es Konjunkturen einer Thematisierung von Gefühlen. So bestand bis ins 18. Jahrhundert überhaupt kein Zweifel daran, dass Weckung und Artikulation von Gefühlen primäre Aufgaben der Künste sind. Doch werden anschließend Konzeptionen und Theorien der Künste entwickelt, die diese Aufgabe weit von sich weisen. 4 Solche Konjunkturen einer Thematisierung der Gefühle gibt es auch in der Pädagogik. So spricht man zwar heute häufig von Selbstwertgefühlen oder von dem Erleben von Selbstwirksamkeit gerade im Bereich der kulturellen Bildung, doch wird man feststellen, dass es im Gegensatz zur Philosophie, zur Psychologie oder Soziologie kaum systematische Auseinandersetzungen mit der Rolle der Gefühle insgesamt in pädagogischen Prozessen gibt. Dies ist umso verwunderlicher, als die Frage des Kognitiven – also quasi einer Nachbardisposition der Persönlichkeit – sehr umfänglich der Pädagogik bearbeitet wird. Es scheint daher nützlich zu sein, einen ersten Überblick über relevante Diskurse in den verschiedenen Disziplinen zu geben und zu versuchen, diese Diskurse im Hinblick auf die hier interessierende Fragestellung der Rolle der ästhetischen Praxis im Umgang mit Gefühlen zu ordnen. Der unmittelbare Bezug zu pädagogischen Fragen und insbesondere zu Fragen der Bildung stellt sich dadurch her, dass Emotionen ein zentraler Teil der Welt- und Selbstverhältnisse des Menschen sind. 5 2. Einführung Man kann den Eindruck gewinnen, dass – zumindest in der westlichen Kultur – die Rationalität das bestimmende Merkmal des Menschen ist. Mit René Descartes beginnt einer verbreiteten Einsicht zufolge die neuzeitliche Philosophie. Der Kernsatz dieser Philosophie ist die berühmte Feststellung „Ich denke, also bin ich!“. Diese These scheint in der langen Tradition der abendländischen Philosophie zu stehen, denn auch bei dem Orakel von Delphi findet man die Aufforderung „Erkenne dich selbst“. Diese Favorisierung des Rationalen wird in der Neuzeit unterstützt durch die gesellschaftliche Entwicklung. Zwar gibt es bereits in der Scholastik einen Streit zwischen Glauben und Wissen. So setzt sich Thomas von Aquin auf rationale Weise dafür ein, dem Glauben die Priorität vor dem Wissen zu geben. Doch endet sein Versuch damit, dass seine Werke auf den Index gesetzt werden: Eine rationale Begründung des Glaubens, selbst wenn diese den Vorrang des Glaubens stärkte, schien der Kirche zu gefährlich zu sein. Später schreibt dann der schottische Moralphilosoph Adam Smith im 18. Jahrhundert eine Theorie der Gefühle, in seinem Hauptwerk zeigt er jedoch, dass es im Interesse der Volkswirtschaft und daher rational ist, ein wohlverstandenes Eigeninteresse zu verfolgen. Die großen Soziologen der Jahrhundertwende 1900 und an erster Stelle Max Weber analysieren, wie sehr der Siegeszug der kapitalistischen Wirtschaftsordnung und der damit verbundenen bürgerlichen Gesellschaft aufs engste verknüpft ist mit einer Durchsetzung des Prinzips der Rationalität in allen Feldern der Gesellschaft: „Rechenhaftigkeit“ wird zum Leitprinzip einer erfolgreichen Lebensführung. Diese Konzentration auf die rationale Durchdringung zunächst der Welt- und später dann auch der Selbstverhältnisse zeigt enorme Erfolge. So gelingt es mit Beginn der Neuzeit nicht nur, die Geheimnisse der Natur so weit zu entschlüsseln, dass man ihre Gesetze in einer mathematischen Form fassen kann. Der Erfolg dieser neuen Naturwissenschaft – man nennt sie experimentelle Philosophie – wird auch von Nicht-Naturwissenschaftlern anerkannt, so dass man von einer umfassenden „Mechanisierung des Weltbildes“ (Dijksterhuis) spricht: Auch alle anderen Wissensgebiete wie etwa die Philosophie, die entstehenden Disziplinen der Erziehungswissenschaft und der Psychologie, die Staats- und die Rechtslehre versucht man, nach dem Muster dieser neuen Naturwissenschaft als mathematisch fundierte und zu einem großen Teil experimentell und empirisch vorgehenden Wissenschaften zu entwickeln. Man spricht von einem mos geometricus und einer mathesis universalis als umfassenden erfolgreichen Methoden für alle Wissensdisziplinen. Natürlich thematisiert man auch Gefühle. Doch haben diese angesichts der Dominanz des Rationalen einen schlechten Stand, denn man macht sie – man spricht von Leidenschaften – für alles Übel in der Welt verantwortlich. Daher ist es Ziel vieler Denkanstrengungen, diese Leidenschaften zu domestizieren (König 1992). Verständlich wird dies vor dem Hintergrund der Annahme, dass die Leidenschaften die Ursache der zahlreichen Kriege waren, die – wie etwa der 30-jährige Krieg – 6 unendliches Leid über die Menschen bringen und die weite Teile Europas erfassen. Auch die theoretischen Überlegungen des oben genannten Adam Smith zur Gestaltung des wirtschaftlichen Lebens in der Gesellschaft haben letztlich die Förderung der Moral und die Zivilisierung der Gewalt zum Ziel. Vor diesem Hintergrund mag es überraschen, dass es überhaupt noch Fürsprecher für eine Beschäftigung mit Gefühlen gibt, die diese nicht bloß als Ursache für alles Böse in der Welt betrachten. Bei aller bislang angesprochenen Dominanz des Rationalen gibt es daher in der Entwicklung des westlichen Denkens auch eine ständige Auseinandersetzung mit Gefühlen. Wenn (unter anderen) Herder später sagt: „Ich fühle, also bin ich“, so spricht er eine Überzeugung aus, für die es ebenfalls eine lange Traditionslinie gibt. So ist es geradezu selbstverständlich, dass man bis zum Ende des 18. Jahrhunderts die Künste unter der Perspektive ihrer (emotionalen) Wirkungen auf die Menschen diskutiert. Dies gilt selbst für Platons Forderung, das Theater aus der Polis zu vertreiben, denn er unterstellt dem Theater eine negative Wirkung auf die Mentalität der Menschen. Das Theater und mit ihm auch die anderen Künste wirken also, und sie wirken insbesondere im Hinblick auf die Weckung von Gefühlen, die der Polis zu- oder abträglich sein können. Es ist daher nicht verwunderlich, dass es bis ins 18. Jahrhundert eine enge Verbindung zwischen theoretischen Überlegungen zu den Künsten und der Rhetorik gibt (Ueding 2005, 2009). Bei der Rhetorik geht es keineswegs bloß um Tricks, andere Menschen zu manipulieren. Rhetorik ist vielmehr in einem umfassenden Verständnis ein globales Bildungsprojekt, bei dem allerdings von Anfang an die politische Dimension eine wichtige Rolle spielt. Man braucht sie, um andere in politischen Kontexten und vor Gericht von der eigenen Ansicht zu überzeugen. Dies hat zwar auch sehr viel damit zu tun, dass man auf die Gefühle anderer Menschen Einfluss nehmen will, man will dies allerdings mit guten Argumenten, einem ausgefeilten Aufbau der Rede und einem elaborierten Stil erreichen. Dieser hier nur kurz angedeutete Gedanke zeigt bereits, dass eine zu rigide Trennung zwischen Emotionalität und Rationalität kaum aufrecht zu erhalten ist, da man mit einer rationalen Argumentation Einfluss auf die Gefühlswelt anderer nehmen will. Vor diesem Hintergrund ist es daher nicht mehr so überraschend, wenn einschlägige Bestseller der letzten Jahrzehnte von einer „Rationalität des Gefühls“ (de Sousa 1997) oder von einer „emotionalen Intelligenz“ (Goleman 1997) sprechen und damit bereits im Buchtitel einen engen Zusammenhang beider Seiten des Menschen suggerieren. Der oben zitierte Johann Gottfried Herder steht daher in einer langen Traditionslinie, die möglicherweise durch die Dominanz der Rationalität in den philosophischen und einzelwissenschaftlichen Debatten in den Hintergrund gedrängt wurde, die aber niemals ganz in Vergessenheit geraten ist und die mit dem Zeitalter der Empfindsamkeit und der späteren Romantik erheblich an Einfluss gewinnt. Möglicherweise hat die Vernachlässigung des Gefühls damit zu tun, dass eine sorgfältige Bearbeitung dieses Bereichs erheblich schwieriger ist als eine Beschäftigung mit dem Rationalen. Trotzdem hat man die Gefühle als essenziellen Teil des Menschseins immer berücksichtigt. In aktuellen anthropologischen Entwürfen spielen sie eine zentrale Rolle bei der Beschreibung der conditio humana. Spätestens mit der Phänomenologie erhalten sie einen prominenten Platz in der Philosophie, nachdem die Kunsttheorien und Ästhetiken ohnehin nicht ohne eine Thematisierung auskommen. In den prominent werdenden lebensphilosophischen Ansätzen im späten 19. 7 Jahrhundert und schließlich in der Leibanthropologie eines Helmuth Plessner stehen sie sogar im Mittelpunkt philosophischer Erwägungen. Als ein aktuelles Beispiel greife ich auf den Capability Approach von Martha Nussbaum und Amartya Sen zurück. Emotionen können quasi als roter Faden bei der Beschreibung dessen gelten, was die beiden Philosophen als wesentlich für die menschliche Lebensform halten: die Angst vor dem Tod, Kummer und Sorgen, Trauer bei dem Tod eines geliebten Menschen, die Fähigkeit zur Anerkennung, Körpererfahrungen, die Fähigkeit zur Lust und die Abneigung gegen Schmerz, sexuelles Begehren, Liebe und Zorn, das Gefühl der Zugehörigkeit und der sozialen Bindung, das Gefühl der Anteilnahme, Achtung und Anteilnahme gegenüber anderen Spezies und der Natur, Lachen, die Empfindung von Schmerz (Nussbaum in Brumlik/Brunkhorst 1993, 334 ff.). Vor diesem Hintergrund formuliert Wulf (in seinem Artikel „Emotion“ in Wulf/Zirfas 2014, 113 ff.): „Emotionen sind konstitutiv für die Menschen aller Kulturen und aller Zeiten. Wer lebt, fühlt; wer nicht fühlt, ist tot. Nicht einzelne Emotionen, wohl aber Emotionen zu haben ist für Menschen charakteristisch. Wir haben Emotionen, doch zugleich konstituieren uns die Emotionen, so dass wir Subjekt und Objekt unserer Emotionen sind. Emotionen ergreifen uns. Zwar können wir sie anregen, künstlich erzeugen oder unterdrücken; doch wir können nicht entscheiden, keine Emotionen mehr zu haben.“ Doch was sind eigentlich Emotionen? Einen ersten Katalog möglicher Emotionen habe ich oben am Beispiel der Anthropologie von Nussbaum/Sen angegeben. Betrachten wir einige weitere Auflistungen: Demmerling/Landweer (2007) listen die folgenden auf: Achtung und Anerkennung im Kontext von Moral; Angst zusammen mit Schrecken, Grauen, Panik, Furcht und Hoffnung; Ekel in Verbindung mit Wut, Hass, Zorn, Verachtung und Scham; Glück und Freude in Verbindung mit Vergnügen, Zufriedenheit, Dankbarkeit; Liebe in Verbindung mit Freundschaft und Verliebtheit; Mitgefühl in Verbindung mit Mitleid, Schadenfreude, Neid, Verachtung und Liebe; Neid und Eifersucht; Scham und Schuldgefühle in Verbindung mit Peinlichkeit, Ehre, Empörung, Schüchternheit; Stolz in Verbindung zu Eitelkeit, Scham und Neid; Traurigkeit und Melancholie in Verbindung mit Depression, Aggression und Schuld; Zorn in Verbindung mit Ärger, Hass, Gereiztheit und Aggression, Empörung, Wut, Neid und Eifersucht. Dieser umfangreiche Katalog menschlicher Lebensäußerungen überrascht möglicherweise, weil man vielleicht nicht all diese genannten Erscheinungsformen psychischer Bewegungen unter der Rubrik Gefühl einsortiert hätte. Immerhin liegt mit diesem Vorschlag bereits eine Systematisierung vor, sofern man die Fülle möglicher emotionaler Äußerungen in eine begrenzte Zahl von Clustern eingeordnet hat. Es zeigt sich aber bereits bei dieser Ansammlung, dass man weitere Unterscheidungen treffen muss. So gibt es eine Reihe von Grundgefühlen, die eher etwas mit anhaltenden Stimmungen zu tun haben (etwa Melancholie, Depression) und es gibt Gefühle, die spontan aus einer bestimmten Situation entstehen und gerichtet sind auf eine bestimmte Person oder einen Sachverhalt (etwa Wut, 8 Aggression, Empörung). Es gibt offenbar Gefühle, die sofort Handlungen nach sich ziehen, die also eine Bewegung zur Folge haben (also als Motivation gelten können: movere= bewegen), und es gibt Gefühle, die eher etwas mit einem passiven Erleiden zu tun haben (etwa Trauer oder Angst). Es gibt Gefühle, die man unmittelbar an dem Verhalten des Körpers ablesen kann (zum Beispiel Ekel, Aggression oder Scham), und es gibt Gefühle, die der Mensch zwar spürt, die aber eher im Verborgenen bleiben (zum Beispiel Schuldgefühle oder Eifersucht). Offensichtlich ist es notwendig, einige weitere Unterscheidungen zu treffen. Doch betrachten wir zunächst nach dem obigen Katalog zweier Philosophen eine ähnliche Unternehmung aus dem Bereich der Psychologie bzw. Psychotherapie. In der Tat liegt es nahe, diese Disziplinen zu konsultieren, denn über die Jahrhunderte hinweg hat man den Bereich der Gefühle mit verschiedenen Begriffen bezeichnet: Es ging um das Seelenleben, das Gemüt, es ging um einen wichtigen Bereich des Charakters, es ging – wie erwähnt – um das Feld der Emotionen, des Pathos, der Affekte und Leidenschaften und es ging um das Feld der Psyche. Die Begriffe des Pathos und des Affektes gehören dabei in das Wortfeld des Erleidens, der Widerfahrnisse, denen der Einzelne ausgesetzt ist. Der Begriff der Emotion enthält das lateinische Wort des Bewegens (movere), das Gefühl wiederum wurde erst mit der Ästhetik von Alexander Baumgarten Mitte des 18. Jahrhunderts von der ursprünglichen Bedeutung als Tastsinn ausgedehnt auf die gesamte niedere sinnliche Erkenntnis (Schmitz in Petzold 1995, 47ff.). Obwohl man nunmehr der Psychologie und der insbesondere der Psychotherapie eine besondere Kompetenz im Umgang mit Gefühlen zusprechen muss, kommt Hilarion Petzold (ebd., 9) zu der überraschenden Feststellung: „Obgleich es in der Mehrzahl der psychotherapeutischen Schulen, schaut man auf ihre Praxis, um den Umgang mit Gefühlen geht, ist das Wissen um die Rolle der Gefühle im therapeutischen Geschehen, über den Umgang mit Emotionen in der therapeutischen Beziehung, über die Wirkung emotionsaktivierender Interventionen, über die Verbindung von Kognition und Emotion in Therapieprozesse noch nicht sehr breit.“ In der Darstellung des seinerzeit aktuellen Forschungsstandes spricht er zudem von einer „verwirrende(n) Vielzahl von emotionstheoretischen Ansätzen“ (207) und er zitiert eine Studie (von Kleinginna/Kleinginna), die nach einer Auswertung von 92 Emotionsdefinitionen zur folgenden Definition kam: „Emotion ist ein komplexes, von neurohumoralen Systemen vermitteltes Interaktionsmuster von subjektiven und objektiven Faktoren, welches (a) affektive Erfahrung, zum Beispiel ein Empfinden der eigenen Angeregtheit oder Lust/Unlust entstehen lassen kann, (b) kognitive Prozesse und emotional bedeutungsvolle Wahrnehmungseffekte hervorbringen kann, (c) auf erregungsauslösende Bedingungen physiologische Anpassungsleistungen zu aktivieren vermag und (d) zu Verhalten führt, das oft - wenn auch nicht immer - expressiv, zielgerichtet und adaptiv ist.“(208) 9 Der Begriff der Emotion gilt hier als Oberbegriff, der weiter ausdifferenziert werden kann: Affekt: situationsabhängiges, kurzzeitiges, bewusstes, emotionales Erleben… Gefühl: Situationsspezifisches, länger dauerndes, unbewusstes bis bewusstes emotionales Erleben, auf der Grundlage von eigenleiblich wahrgenommenen, gespürten Überlegungen und Empfindungen Leidenschaft: situationsübergreifende, aber für Situationsimpulse sensible, länger andauernde, bewusste bis unbewusste, intensive Gefühlslage, die an Gegenstände der Leidenschaft fixiert ist Stimmung: situationsübergreifende, mittelfristige, relativ überdauernde, unbewusste bis bewusste emotionale Lage, die durch äußere, atmosphärische Einstellungen aus dem Kontext oder durch das Aufkommen erinnerter Atmosphären und Kontexte sich in einer Person ausbreitet Grundstimmung: Situationsunabhängige, langfristig überdauernde, unbewusste bis bewusste persönlichkeitsspezifische emotionale Lage Lebensgefühl: Situationsunabhängige, Temperament bestimmte und persönlichkeitsspezifische, von verschiedenen Grundstimmungen und individualistischem Ton geprägte emotionale Dauertönung, die unbewusst bis bewusst als Hintergrund den gesamten Lebensvollzug unterfängt und in seiner Qualität bestimmt, und deren Wurzeln an das Grundvertrauen und das auf ihm aufruhende Selbstgefühl anschließen. (alles in Anlehnung an die Ausführungen von Petzold a.a.O., 224f.). Das von Petzold beklagte wissenschaftliche Defizit in der Erforschung von Emotionen wird man 20 Jahre später nicht mehr aufrechterhalten können. Man spricht vielmehr inzwischen von einem Hype, einem emotional turn, der unterschiedliche Disziplinen erfasst hat (s.u.). Große Zeitschriften (Spiegel, Focus, ZEIT) haben umfassende Titelgeschichten publiziert, es gab ganze Sendereihen im Fernsehen und der einschlägige Büchermarkt boomt. Etwas hämisch kommentiert man sogar das neue Interesse der Philosophie an diesem Thema: Endlich habe sie etwas gefunden, das auch Menschen außerhalb der engen Fachszene interessiert. Der Philosoph Heiner Hastedt (2005) befasst sich zwar im Grunde mit denselben Gefühlsausdrücken wie den oben aufgelisteten, er kommt aber zu einer anderen Systematik. Er wählt „Gefühl“ als Oberbegriff und bildet acht Untergruppen: Leidenschaften als "starke Gefühle, die uns antreiben und die Welt in ein neues Licht tauchen" (zum Beispiel Begeisterung, Eifersucht, Enthusiasmus, Hass, Liebe/Erotik, Zorn), Emotionen als „langwellige Grundtönungen der Existenz und der Weltwahrnehmung, die sich punktuell in Leidenschaften äußern können, ohne dass dies zwingend ist“ (zum Beispiel Angst, Freude, Liebe, Melancholie, Trauer, Vertrauen), Stimmungen, die ebenfalls den Charakter von Tönungen haben, sich allerdings auf einzelne Situationen beziehen (zum Beispiel Fröhlichkeit, Stimmung bei einer bestimmten Gelegenheit) Empfindungen als Körpergefühle ("feeling") (zum Beispiel Ekel, Depression, Scham, Schmerz, Sexualität, Wohligkeit), 10 sinnliche Wahrnehmungen, „wobei es unsicher ist, ob die Wahrnehmungen unserer fünf Sinne – Tastsinn, Geruchssinn, Schmecken, Hören, Sehen – selbst als Gefühle zu bezeichnen sind“, Wünsche (zum Beispiel Bedürfnisse, Interessen, Lust, Neigungen) (ebd., 12ff.). Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen gelangt Hastedt zu folgender Definition: „Der Begriff des Gefühls steht für vielfältige Formen des leiblich-seelischen Involviertseins, das Besonderheit qualitativ erfahrbar macht und so Wichtigkeitsbesetzung ermöglicht.“ (21). Diese drei vorgestellten Beispiele einer Konzeptionalisierung von Gefühlen zeigen, dass man kaum mit einer Einheitlichkeit im Hinblick auf die Begriffe und ihre systematische Anordnung rechnen kann. Ich werde daher im nächsten Kapitel auf einzelne disziplinäre Zugriffe näher eingehen. Doch lassen sich bereits an dieser Stelle einige Dimensionen hervorheben, die mit Gefühlen/Emotionen verbunden sind: Emotionen und das Menschenbild: Offenbar hat der Rationalismus als zunächst dominante Philosophie der Neuzeit dazu geführt, dass die leibliche Seite der menschlichen Existenz zusammen mit der Relevanz der sinnlichen Wahrnehmung vernachlässigt wurde. Emotionen können jedoch nicht gedacht werden, ohne den Leib als Basis menschlicher Existenz zu berücksichtigen. Emotionen und Wahrnehmung: Offensichtlich ist die Trennung zwischen Emotionalität, Wahrnehmung und Kognition eine künstliche. Emotionen haben sehr viel mit den Welt- und Selbstverhältnissen der Menschen zu tun. Sie steuern nicht bloß die Erkenntnisprozesse von Welt und Selbst, sie sind zudem für die Bewertung der Erkenntnisse verantwortlich. Emotionen und Wertungen: Sofern die Emotionalität des Menschen verantwortlich dafür ist, wie er sich selbst und seine soziale und gegenständliche Umwelt bewertet, gibt es eine enge Verbindung zwischen der Emotionalität und der Moral. Es ist also kein Zufall, dass es starke Überschneidungen zwischen der Auflistung von Emotionen, so wie sie oben beispielhaft vorgestellt wurden, und bestimmten Tugendkatalogen gibt. In diesen Kontext gehört auch die Thematisierung des Gewissens. Emotionen und das Handeln: Weil Emotionen etwas damit zu tun haben, wie der Mensch sich selbst und die Welt sieht und bewertet, gibt es eine enge Verbindung zwischen der Emotionalität des Menschen in seiner Motivation zum Handeln. Emotionalität zwischen dem Innen und dem Außen: Es gibt Emotionen, die auf die Außenwelt des Menschen gerichtet sind und die durch äußere Einflüsse entstehen; es gibt andere Emotionen, die auf das Innenleben des Menschen bezogen sind. In diesem Fall sind Emotionen oft mit der Artikulation von Bedürfnissen verbunden. In beiden Fällen kann es zu spürbaren Erregungen des Körpers kommen. Emotionen und das Soziale: Emotionen können als wichtiges Bindemittel in sozialen Zusammenhängen gelten. Dies kann man bereits daran erkennen, dass eine Vielzahl der oben genannten Emotionen nur innerhalb sozialer Kontexte verstanden werden können: Mitleid mit anderen, Empathie und Sympathie, Vertrauen, Anerkennung und Wertschätzung, Diskriminierung 11 etc. Auch nach innen gerichtete Emotionen wie etwa das Selbstwertgefühl sind aufs engste verbunden mit sozialen Interaktionsprozessen. Emotionen zwischen Biologie und Kultur: Dass die Artikulation von Emotionen in den verschiedenen Weltregionen sehr unterschiedlich sein kann, weiß jeder, der einmal eine Reise unternommen hat. Insofern kann man von einer kulturellen Konstruktion von Emotionen sprechen. Auf der anderen Seite gibt es Versuche, kultur- und zeitübergreifende „basale Gefühle“ zu identifizieren (Trauer, Angst, Ekel, Freude, Wut etc.), wobei die jeweils auslösenden Ereignisse und die Artikulationsformen unterschiedlich sein können. Ein Grund für diese These wird darin gesehen, dass die biologische Grundausstattung des Menschen über die Zeiten und Regionen hinweg gleich geblieben ist. Emotionen zwischen Gefühlen und Empfindungen: Empfindungen (feelings) sind das, was wir – etwa bei Schmerzen – spüren. Gefühle (emotions) haben zwar auch eine Empfindungsseite, gehen aber über diese hinaus (Hastedt 2010, 31). Der Philosoph Martin Hartmann (2010) kommt auf der Basis ähnlicher Überlegungen zu dem folgenden Schluss: „Unschwer zu erkennen ist, dass es sich an diesem Punkt anbietet, Gefühle aus verschiedenen Elementen zusammen zu setzen. Wie sich zeigen wird, sind dabei im Laufe der Zeit fünf Elemente wichtig geworden: (1) ein kognitives Element (Überzeugungen, Urteile, Bewertungen); (2) das Element des Körpers; (3) ein phänomenales Element (wie ist es, ein Gefühl zu haben); (4) ein voluntatives Element (Wünsche) und (5) das Element der Wahrnehmung, dessen Status im Vergleich zu den anderen Elementen allerdings etwas undeutlich ist. Damit ist nicht gesagt, dass man sich darauf geeinigt hätte, alle Gefühle seien aus diesen fünf Elementen zusammengesetzt; im Gegenteil, fast alle der hier zu behandelnden Autoren neigen dazu, einzelne dieser Elemente in ihren Definitionen hervorzuheben. Genau dieser Sachverhalt führt zu den zahlreichen Definitionsbeispielen…“ (25) Im Vorgriff auf spätere Ausführungen will ich die Forschungsperspektiven erwähnen, die Christoph Wulf (in Wulf/Zirfas 2014, 120ff.) im Hinblick auf eine pädagogische Anthropologie formuliert: 1. Performativität und Körperlichkeit: Hierbei geht es darum, wie Menschen ihre Emotionen ausdrücken, darstellen, modifizieren und kontrollieren. 2. Emotionen als kulturelle Praktiken: „Emotionen lassen sich insofern als Handlungen begreifen, als sie Wirkungen auf andere Menschen ausüben. Wie dies geschieht, ist von den jeweiligen kulturellen Werten, Normen, Sprach- und Handlungsspielen (Wittgenstein) abhängig.“ 3. Emotionale Komponenten in mimetischen Prozessen: „In kulturellem Lernen, das zu einem erheblichen Teil mimetisches Lernen ist, sind emotionale Komponenten für das Gelingen von Erziehungs- und Bildungsprozessen von zentraler Bedeutung.“ In dem Kontext dieses Textes geht es um eine Präzisierung eines Verständnisses von Bildung als Entwicklung und Transformation von Welt- und Selbstverhältnissen. Das Emotionale als wesentliche Facette der Persönlichkeit spielt also eine wichtige Rolle, wenn es um die Konstitution von Identität, Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl geht. Die Künste und die damit verbundenen ästhetischen 12 Praktiken sind aufs engste verbunden mit der Emotionalität des Menschen. Man wird daher kaum ein Konzept von kultureller oder ästhetischer Bildung entwickeln können, ohne die hohe Relevanz des Emotionalen zu berücksichtigen. 13 3. Theorien der Emotionen Emotionen gehören zu dem Menschsein dazu, manche sagen sogar, dass es letztlich die Emotionen sind, die den Menschen zum Menschen machen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass man nicht bloß Emotionen in jeder der derzeitigen Kulturen in der Welt findet, man kann auch davon ausgehen, dass früheste Artefakte als Zeugen einer bewussten Gestaltung der Welt durch den Menschen mit Emotionen verbunden waren. Viele anthropologische Theorien unterstellen dies zumindest. So bringt man etwa die Entstehung einer ästhetischen Praxis damit in Verbindung, dass diese notwendig wurde, um Gefühle der Angst und des Ausgeliefertseins an die Naturgewalten zum Ausdruck zu bringen, sie auf diese Weise im sozialen Kontext kommunizierbar machen und damit auch einen wichtigen Schritt zur Bewältigung dieser Gefühle der Bedrohung zu gehen. Offenbar war diese Bedeutsamkeit der Emotionen den Menschen bereits zu einem frühen Zeitpunkt in der Geschichte bewusst. Wenn man die Mythen der unterschiedlichen Kulturen betrachtet, so stellt man fest, dass diese zu einem großen Teil von Emotionen handeln. Es geht um Mut und Feigheit, es geht um die Bewältigung von Herausforderungen. Auch die frühesten Epen aus der griechischen Antike setzen sich mit den Leidenschaften der Götter und Menschen auseinander. Später sind es die Philosophen, die in einen Konkurrenzkampf um das Deutungsrecht zu den Dichtern treten und sich gezielt mit Emotionen auseinandersetzen. Diese Auseinandersetzungen waren oft aufs engste verbunden mit moralischen Fragen, mit der Frage von richtig und falsch, also mit Problemen der Orientierung im alltäglichen Handeln. Bei aller Heterogenität der inzwischen ausufernden Diskurse über Fragen der Emotionalität und der Gefühlswelt in den unterschiedlichsten Disziplinen haben daher philosophische Erwägungen immer noch eine gewisse Priorität und bilden einen allgemeinen Bezugspunkt für die spartenspezifischen Debatten. Allerdings kann man feststellen, dass diese prioritäre Position der Philosophie inzwischen eine harte Konkurrenz durch Ergebnisse der Neurowissenschaften bekommen hat. So werden als wichtige Referenzpublikationen für alle Disziplinen die Autoren Antonio Damasio, Joseph LeDoux oder Daniel Goldman genannt, von denen der letztere klinischer Psychologe ist, die beiden erstgenannten jedoch prominente Neurowissenschaftler sind. Im Folgenden soll in knapper Form darüber berichtet werden, womit sich die einzelnen Disziplinen im Hinblick auf Emotionen und Gefühle befassen. 14 3.1 Philosophische Theorien Auch systematisch angelegte Darstellungen philosophischer Emotionstheorien (etwa Hartmann 2010, Hastedt 2005 oder Merker 2009) verzichten nicht darauf, zumindest einen kurzen Hinweis auf griechische Ursprünge einer theoretischen Auseinandersetzung mit Emotionen zu geben. Es werden dabei die Sophisten erwähnt, gegen die Platon und Aristoteles ankämpften, weil diese – gegen Geld – philosophisches Wissen für pragmatische Zwecke vermittelten. Diese pragmatischen Zwecke betrafen im Wesentlichen den Umgang mit Gefühlen. Die Stoa, deren Attraktivität man daran erkennen kann, dass sie immer wieder eine Renaissance erfährt, war in ihrer Lehre ganz darauf angelegt, die Leidenschaften und Affekte zu disziplinieren. Ein Grundgedanke bei all diesen Theorien bestand darin, dass man eine enge Verbindung zwischen Ethik und Moral auf der einen Seite und dem Umgang mit den Affekten auf der anderen Seite sah: „Von Platon und Aristoteles über die hellenistischen Ethiken der Stoiker und Epikuräer bis hin zu Descartes, Spinoza, Hobbes, Hume und partiell noch Hegel sind die sogenannten „Affektenlehren“ integraler Bestandteil der Ethik gewesen. Denn ein angemessener Umgang mit den Affekten – sei es als bloße Mäßigung, als partielle Reduktion oder gar als totale Eliminierung – galt als Bedingung eines glücklichen Lebens und die Frage nach dem glücklichen, guten Leben als die zentrale Frage der Ethik. Die Affektenlehren waren zugleich Anleitung zur ethischen und moralischen Erziehung. Dank dieser Erziehung nämlich, für die auch die Politik zuständig war, sollte gelernt werden, auf angemessene, rechte Weise Emotionen, Affekte, allgemein: Lust und Unlust zu haben. Entsprechend bestehen ethische Tugenden, die notwendig und konstitutiv für das menschliche Glück und gute Leben sind, zum Teil im richtigen Umgang mit den Affekten. In der Rhetoriktheorie seit Aristoteles hatten Affektenlehren vor allem die praktische Funktion, den Rhetor durch genaue Kenntnis der Erzeugungsbedingungen und Wirkungen von Affekten zu einer Beeinflussung des Publikums, zum Beispiel vor Gericht oder vor der Volksversammlung zu verhelfen. Umgekehrt verhalfen sie freilich auch dazu, solche Beeinflussungen zu erkennen und ihnen nicht unbemerkt ausgeliefert zu sein.“ (Merker 2009, 9) Dieses Zitat ist mehrfacher Hinsicht aufschlussreich. Es unterstreicht den engen Zusammenhang zwischen Emotionalität, Moral, Politik und Erziehung. Es zeigt zudem auf, dass eine emotionale Bildung nicht bloß zur Kultivierung des Polisbürgers gehörte, sondern dass diese auch eine emanzipatorische Wirkung hat, insofern sie dazu verhalf, Manipulationen zu erkennen. Es ist allerdings genau diese alltagspraktische Relevanz antiker Affektenlehren, die die beiden Herausgeberinnen eines Handbuchs über klassische Emotionstheorien (Landweer/Renz 2008) dazu veranlasst, den Begriff der Theorie für solche Überlegungen aus der Dichtkunst, der Rhetorik, dem Gerichtswesen oder der Kunst der Lebensführung nicht zu verwenden, da ein rein theoretisches und wissenschaftliches Interesse an Emotionen erst seit dem 17. Jahrhundert festgestellt werden kann. Auf diese Zeit geht dann auch die rigorose Trennung von Emotionalität und Rationalität zurück. Das Handbuch schlägt dann (trotzdem) einen Bogen von Platon und den antiken Philosophen über die antike medizinische Tradition, die scholastischen Philosophie des Mittelalters, Moralisten wie 15 Montaigne und La Rochefoucauld, die französischen und englischen Philosophen der frühen Neuzeit, über Kant, die Philosophen des 19. Jahrhunderts bis zu Heidegger, Wittgenstein, Sartre und Susanne Langer. In all diesen vorgestellten Emotionstheorien lassen sich die oben angeführten Dimensionen des Emotionsdiskurses wiederfinden: die Beziehungen der Emotionalität zur Moral, zur Erkenntnis von sich und der Welt, zur Handlungsmotivation, zur Wertung bis hin zur Wittgensteinschen Thematisierung und Problematisierung einer sprachlichen Erfassung von Emotionalität (vgl. auch den Artikel "Affekt" von Hengelbrock/Lanz in Ritter u.a. 1971, Bd. 1, 89 ff.). Vor diesem Hintergrund ist der Versuch von Merker (a.a.O.) an einer Begriffsklärung hilfreich, die zudem weitgehend übereinstimmt mit der oben vorgetragenen. Sie unterscheidet Empfindungen (Gefühle) als Sinnesempfindungen visueller, akustischer, taktiler, gustatorischer und olfaktorischer Art, leibliche Gefühle wie Kopf, Herzrasen, Schweißausbrüche, Müdigkeit, Nervosität, Verkrampfungen, Erstarrung, Magenstädten, Gänsehaut, Wangen Hitze bei erröten,-, Durst- und Sättigungsgefühle, Stimmungen wie Depression, Heiterkeit, Euphorie, Angst, Langeweile, Melancholie, Trauer, Emotionen oder Leidenschaften und Affekte: Freude, Trauer, Scham, Eifersucht, Neid, Stolz, Furcht, Mut, Empörung, Ekel. Evaluative Gefühle als Gefühle der Lust und Unlust (11 ff.). Als wichtige Emotionstheorien listet sie auf: Körpertheorien (Hirnforschung, Physiologie) Gefühlstheorien Verhaltenstheorien kognitive Theorien (Intentionalitätstheorien) Komponententheorien (als verschiedene Kombinationen der oben genannten) Narrativitätstheorien (15 ff.). Es gibt inzwischen eine Reihe von Sammelbänden, die zwar aus einem philosophischen Kontext heraus initiiert wurden, die aber die Komplexität dieses Themas insofern respektieren, als Vertreter anderer Disziplinen einbezogen werden (etwa Döhring 2009.) bzw. Erkenntnisse anderer Disziplinen einbeziehen (Demmerling/Landweer 2007). Insbesondere finden sich in aktuellen Publikationen zum 16 Teil ausführliche Auseinandersetzungen mit neurowissenschaftlicher Forschungsergebnissen (etwa Hastedt 2005, 61ff.). Als Beispiel will ich das Fazit von Hastedt (ebd., 71 f.) anführen: „Die Neurobiologie ist wichtig auch zum prinzipiellen Verständnis von Gefühlen, aber es ist illusionär zu glauben, dass sie eine direkte Deutung meiner eigenen Gefühle erleichtert. Neurobiologische Forschungsergebnisse legen sich nicht selbst aus, sondern wir deuten sie. In einem gewissen Sinne sind biologische Ergebnisse Konstruktionen der Realität. Wir können von Geschichten der Determination sprechen: Neben der neurobiologischen Geschichte lassen sich auch andere Determinationsgeschichten der menschlichen Gefühle erzählen. Nach 1968 dominierten die Geschichten der gesellschaftlichen Determination und in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts… die Geschichte der mikrophysikalischen Determination. Diese Vielfalt der Determinationsgeschichten mag verdeutlichen, dass wir es sind, die diese Geschichten erzählen. Die Wirklichkeit selbst schweigt. Wir bringen sie zur Sprache. Deshalb können alle naturwissenschaftlichen Richtigkeiten über die Biologie der Gefühle nichts daran ändern, dass wir im Medium der Naturwissenschaften über uns reden.“ Man kann sich nun fragen, was man auf der Basis von philosophischen Emotionstheorien zu aktuellen gesellschaftlichen und politischen Problemen sagen kann. In dieser Hinsicht ist das etwas ältere, aber immer noch aktuelle Buch der Philosophin, Psychologin und Feministin Carola MeierSeethaler (2001) interessant. Die Basis bildet ein philosophiegeschichtlicher Exkurs, der von der „Logik des Herzens“ (Blaise Pascal) über den „moralischen Sinn“(Shaftesbury), die Romantik, das Verstehenskonzept von Dilthey, die Ansätze von Freud, Max Weber und Max Scheler bis hin zu dem Konzept der emotionalen Vernunft bei Susanne Langer reicht. Es werden aktuelle Konzeptionen der Ethik vorgestellt, die ganz selbstverständlich in Verbindung mit der Frage der Emotionalität gebracht werden. Es wird ein anthropologisches Konzept vorgestellt, das auf der Basis der Ansätze von Erich Fromm, Agnes Heller, Hans Jonas, Carol Gilligan und anderen vier psychische „Kardinal“-Bedürfnisse unterscheidet: – das Bedürfnis nach Zuwendung und Fürsorge – das Bedürfnis nach Autonomie und das Gefühl für die eigene Würde – das Bedürfnis nach Anerkennung – das Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Der Ausgangspunkt ihrer Auseinandersetzung mit aktuellen politischen Problemen ist eine Polemik gegen die in politischen Kontexten häufig formulierte Forderung: Bitte keine Emotionen – bleiben wir sachlich! Die Autorin sieht genau hierin das entscheidende Problem bei der Entstehung aktueller Probleme: nämlich das zur Seite Schieben von Wertvorstellungen, das Ignorieren vitaler Bedürfnisse und die Ausklammerung der emotionalen Dimension. Und so geht sie kritisch mit bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen und ihren Begründungen ins Gericht im Bereich der Humanmedizin, bei der Frage der Genmanipulation, bei der Frage der Ökologie, der De-Humanisierung von Arbeit und dem Problem der Deregulierung von Gesellschaften. Ihr Plädoyer für eine emotionale Vernunft 17 bedeutet, den „Stellenwert der Gefühle für das ethische Erkennen und Handeln gegenüber einer ausschließlich rationalen Ethik hervorzuheben“ (393). Ihre Forderung: „…die Grenzen zwischen Rationalität und Irrationalität neu zu ziehen. Wie Emotionalität nicht mit Irrationalität und damit letztlich mit Unvernunft gleichzusetzen ist, so ist Intellektualität nicht davor gefeit, dass die Richtung ihrer Denkschritte von irrationalen Motiven geleistet wird. Vernunft und Rationalität in einem nicht verengten Sinn zeichnen sich vor allem durch Bewusstheit aus: durch die bewusste Konfrontation mit den eigenen Gefühlen, Beweggründen und Wertungen ebenso wie durch die bewusste Kontrolle logischer Denkschritte. Dagegen ist von Irrationalität immer dann zu sprechen, wenn psychische Mechanismen unbewusst ablaufen und unerkannt in scheinbar rationale Denkmuster und Handlungen einfließen“ (395) Ebenfalls in einer praktischen Absicht entwickelt der Philosoph Richard Shusterman (2001) den Ansatz einer „Philosophie als Lebenspraxis“. Dieser Ansatz kann eingeordnet werden in die schon länger anhaltende Welle einer „Rückkehr des Körpers“ in den Kultur- und Sozialwissenschaften, in deren Rahmen man gegen die abendländische Tradition einer rigiden Trennung von Körper und Geist und einer Geringschätzung der Bedeutung des Körpers angehen will. Shusterman entwickelt das Konzept einer „Somästhetik" (soma bedeutet im griechischen Körper), in der es um die Entwicklung einer Bewusstheit gegenüber dem eigenen Körper geht. Es geht um Körpergefühle, es geht um Achtsamkeit gegenüber eigenen Empfindungen, es geht um die Aufmerksamkeit gegenüber den Kontexten, in denen sich der Körper befindet. Offensichtlich gibt es einen großen Überschneidungsbereich dieses Ansatzes mit dem Feld der Emotionen. Diese Debatten rund um die These einer Rückkehr des Körpers finden eine Legitimation in einer Kritik an der Leibfeindlichkeit des kontinentaleuropäischen Rationalismus seit Descartes. In der Deutung von Böhme/Böhme 1983 bildet die kritische Philosophie von Kant einen Höhepunkt in dieser Entwicklung. Die beiden Autoren stellen Kant als reinen Vernunfttheoretiker vor, der – auch aufgrund seiner psychoanalytisch gedeuteten Biografie – ständig gegen die Bedürfnisse seines Körpers ankämpfen muss. Dabei versuchen sie zu zeigen, dass „mit der Realisierung der Vernunft… die Unvernunft mit produziert“ wird (10). Und so finden sie trotz aller rationalen Absichten Kants die Macht des Naturwesens Mensch etwa in der Verankerung seiner Philosophie in den Grundvermögen des Begehrens und der Lust und Unlust. Immerhin liefern sie – für Philosophen eher ungewöhnlich – eine Ursache für dieses rationalistische Bestreben von Kant in dem sozialkulturellen Kontext: 18 „Für die Bildung dieses „rationalisierten“ Sozialcharakters hat Norbert Elias die sozialgeschichtlichen Voraussetzungen beschrieben. Es müssen Staaten gebildet sein, die durch ein Monopol körperlicher Gewalt und die Stabilität zentraler Steuerungsinstanzen gesichert sind. Die Zentralisierung der Macht im sog. Königsmechanismus, stehende Heere, funktionierende Verwaltung und die Integration der zuvor dezentral konkurrierenden Adligen und Fürsten in der höfischen Gesellschaft schaffen in Europa erstmals stark Gebilde., die nach außen wie innen weitgehend befriedigte Räume darstellen. Unter diesem Dach bildet sich langsam die bürgerliche Gesellschaft. Sie setzt gesicherte Verkehrsund Handelswege, die Konzentration des Lebens in immer größeren Städten, den ökonomischen Sektor als ersten Relevanzbereich des sozialen Handelns, die Familie als Reproduktionsraum und eine dynamische gewaltfreie Beschleunigung des sozialen Wandels in Richtung auf ein höheres Niveau von Produktivität und Funktionsdifferenzierung voraus. Diesen über Jahrhunderte hin sich bildenden Sozialstrukturen entsprechen die zivilisatorischen Modellierungen der physischen, psychischen, moralischen und interaktiven Kompetenzen der Menschen, zunächst in den weltlichen Oberschichten. Die Befriedung der Räume durch staatliches Gewaltmonopol und die Entstehung differenzierter Handlungsfelder erfordert vom Individuum für eine erfolgreiche soziale Reproduktion die Dämpfung körperlicher Spontaneität und die Kontrolle affektiver Regungen. Realangst nimmt ab. Innere Angst aber, die als Scham, Peinlichkeit, Gewissen, Konkurrenzangst und Angst vor Statusverlust Stützpunkte der sozialen Kontrolle darstellt, nimmt stark zu.“ (328). Diese Deutung Kants blieb nicht unwidersprochen, vgl. den Beitrag von Birgit Recki in Landwehr/Grenz 2008,457 ff.: „Anders als es ein gängiges Vorurteil über die Kantsche Vernunftkritik geltend macht, läuft dessen Theorie der reinen Vernunft keineswegs darauf hinaus, den Menschen als ein reines Vernunftwesen zu begreifen.“ (475) 19 3.2 Soziologische Emotionstheorien Eine der Unterscheidungen, die es im Bereich der Emotionen gibt, betrifft die Unterscheidung von nach innen und nach außen gerichteten Emotionen. Nach außen gerichtete Emotionen sind solche, die von einem Gegenstand oder Prozess außerhalb der Person ausgelöst werden bzw. sich auf einen solchen beziehen (man spricht von Intentionalität). Solche individuellen Reaktionen auf außerpersönliche Gegebenheiten können einen erkennenden und vor allem wertenden Charakter haben. Davon zu unterscheiden sind Emotionen, die sich im Innenleben der Person abspielen. Dies können leibliche Gefühle wie Hunger oder Durst sein, die mit dem Empfinden und Spüren zu tun haben. Es können aber auch generelle, eher unspezifische Stimmungen sein, die nicht durch leibliche Bedürfnisse ausgelöst werden (Depression, Fröhlichkeit, Optimismus etc.). Ist es bei den nach außen gerichteten Emotionen unmittelbar einleuchtend, dass sie nicht bloß auf soziale und gegenständliche Kontexte reagieren, sondern auch auf diese Einfluss nehmen – insbesondere dann, wenn sie eingreifendes Handeln zur Folge haben –, so können auch die nach innen gerichteten Emotionen soziale Wirkungen zeigen, weil sie Einfluss auf das Verhalten der betreffenden Menschen haben. Auch bei einem Bezug auf das Innere des Menschen haben Emotionen also eine soziale Dimension. Trotzdem waren Emotionen lange Zeit kein genuiner Gegenstand der Sozialwissenschaften: „Dennoch hat in der Soziologie eine Theorie der Gefühle keinen festen Platz gefunden, weil man es schließlich als eine Aufgabe der Psychologie sah, innere Zustände zu analysieren, und zu diesen wurden die Gefühle ganz offensichtlich gerechnet.“ (Kahle 1981, 284). Diese Feststellung von Kahle aus dem Jahr 1981 lässt sich 35 Jahre später nicht mehr aufrechterhalten. Auch in den Sozialwissenschaften spricht man inzwischen von einem emotional turn, zu dem die Dissertationen von Kahle 1983 oder Gerhards 1988 oder die Habilitationsschrift von Vester 1991 sicherlich beigetragen haben. Inzwischen hat sich die Forschungslage insoweit gravierend verändert, als es gründliche Einführungen, Darstellungen und Überblicke über die Entwicklung des Forschungsstandes einer Soziologie der Emotionen gibt (zum Beispiel Scherke 2009, Flam 2002). Man findet zudem interessante Spezialuntersuchungen zu einzelnen Begriffen und Fragestellungen. So gab es schon früher Studien zur Rolle des Vertrauens und der Liebe als Konstitutionsprinzipien von Gesellschaftlichkeit von Niklas Luhmann (1989, 1983). Der Soziologe Helmut Schoeck legte bereits 1966 eine maßgebliche Studie über die Rolle des Neides vor. Weitere Themen, die aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive von Bedeutung sind, betreffen das emotionale Klima in der Gesellschaft, setzen sich also etwa mit Wut, Gewalt oder Angst auseinander. Man setzt sich - in Verbindung mit der Ethnologie und der Anthropologie - mit der Frage auseinander, inwieweit Emotionen kulturübergreifend bzw. nur bezogen auf eine bestimmte 20 Kultur sind, man fragt danach, ob Emotionen kulturell konstruiert werden oder ob man eine Universalität auf der Basis der gleichen biologischen Grundausstattung des Menschen finden kann. An dieser Stelle überschneidet sich eine sozialwissenschaftliche Forschung mit einer kulturwissenschaftlichen Forschung, so das auch der generelle cultural turn in den Wissenschaften dazu beigetragen hat, sich mit Fragen der Emotionen und – damit verbunden – mit dem Problem gesellschaftlicher Mentalitäten auseinander zu setzen (Vester 1996). Es gibt zudem eine große Überschneidung mit Forschungen aus dem Bereich der Sozialphilosophie, wenn etwa der Begriff der Anerkennung – und hierbei vor allem auf der Grundlage der Arbeiten des Frankfurter Sozialphilosophen Axel Honneth im Anschluss an Hegel – eine wachsende Popularität (auch in der Erziehungswissenschaft, s. u.) erhalten hat. Auch weitere zeitdiagnostische Analysen der modernen kapitalistischen Gesellschaft verwendeten Begrifflichkeiten, die eine starke emotionale Tönung haben und die aus der Sicht unterschiedlicher Disziplinen (Sozialphilosophie, Anthropologie, Sozialpsychologie etc.) behandelt werden können wie etwa die Konzepte der Entfremdung und Entzweiung seit der Wende zum 19. Jahrhundert (mit Rousseau als wichtigem Vorläufer), die Konzepte der Vereinsamung, der Nervosität als Signatur der Gesellschaft rund um 1900 und aktuell der Befund einer übergreifenden Depression. Hier spielen insbesondere auch die Arbeiten im Überschneidungsbereich von Marxismus und Psychoanalyse eine wichtige Rolle, für die etwa die Psychologen und Philosophen Erich Fromm oder Horst Eberhard Richter stehen. In einem Überblicksband, der von einem weiten Verständnis von Sozialwissenschaften ausgeht, werden unterschiedliche disziplinäre Ansätze aus diesem Feld im Umgang mit Emotionen dargestellt (Schützeichel 2006). So werden Gefühle in ihrem Bezug zu Geschichtswissenschaft, zur Ökonomie, zur Politik, zur Kultursoziologie und zur Psychologie dargestellt. Als Forschungsfelder werden die Bezüge zu Konflikten, die Rolle des emotionalen Klimas, die Rolle von Emotionen in sozialen Bewegungen und der gesellschaftliche Umgang mit Trauer genannt. Es wird diskutiert, inwieweit die unterschiedlichen theoretischen Ansätze (etwa die verbreitete Rational Choice Theorie) überhaupt in der Lage sind, emotionale Fragestellungen aufgrund ihrer Forschungslogik aufzugreifen. Einem historischen Zugriff zu Gefühlen wende ich mich später zu. Dass man im Bereich der Wirtschaftswissenschaften sehr stark mit Gefühlen zu tun hat, wurde bereits oben am Beispiel der schottischen Moralphilosophen des 18. Jahrhunderts verdeutlicht (Adam Smith). Heute ist es unmittelbar einleuchtend, dass sich die Konsumforschung und insbesondere die Werbung nahezu ausschließlich mit der Rolle der Gefühle bei der Förderung von Konsumentscheidungen befassen. Auch in der Politik kann man insofern eine Emotionalisierung feststellen, als – insbesondere aufgrund der enorm gestiegenen Bedeutung der öffentlichen Kommunikation und der Medien – eine geschickte Ansprache der Gefühlswelt der potentiellen Wählerinnen und Wähler offenbar einen stärkeren Einfluss auf die Wahlentscheidungen hat als Parteiprogramme und Lösungsvorschläge für anstehende Probleme. Dies ist natürlich nicht völlig neu, denn bereits die Nationalsozialisten nutzten diese Verbindung von Emotionalität und technischen Medien geschickt für ihre Zwecke. Auch Max Weber sprach in seinen politischen Texten und einer charismatischen Herrschaft aufgrund einer gefühlsmäßigen Bindung an einen Führer (vgl. insgesamt Flam 2002, Teil 3: „Homo sentiens - als Produzent, Konsument, Bürger“ mit den Kapiteln Arbeit und Gefühl, Geld und Gefühl und Politik und Gefühl). 21 Betrachten wir diese Einführung in die Soziologie der Emotionen (Flam 2002) etwas genauer: „In diesem Buch findet man viele unterschiedliche Definitionen von Emotionen. Unter den Klassikern spricht vor allem Max Weber Leidenschaft an. Für ihn hat die Leidenschaft – die für eine intensive, dauerhafte, zwingende, konstruktive Emotion steht – die Fähigkeit, das Individuum aufs Ziel zu richten und ihm dabei zu helfen, bei diesem Ziel zu bleiben, egal welche Hindernisse und Schwierigkeiten es dabei bewältigen muss. Für Weber ist die Leidenschaft die Hebamme der Rationalität. Georg Simmel dagegen interessiert das Subtile an vielen unterschiedlichen Gefühlen – Liebe, Hass, Neid, Eifersucht, Dankbarkeit, Treue usw.... Mehrere moderne Soziologen haben die Freud`sche Sicht der Emotionen übernommen – für sie haben Emotionen eine Signalfunktion. Sie informieren darüber, ob man in Gefahr ist, ob eine Begegnung mit anderen einem schlecht oder gut tut oder ob man durch in die Interaktion Macht und Prestige gewonnen oder verloren hat. Andere moderne Soziologen interessieren sich nicht für die Funktionen der Emotionen, sondern viel mehr für ihre Ursachen, wie die Sozialisationsprozesse und die Massenkultur.… Für noch andere moderne Soziologen sind Gefühle nicht immer sichtbar oder artikulierbar. Die Kulturinstrumente, wie die Sprache, reichen eben nicht immer aus, um sie zum Ausdruck zu bringen. Das Staunen oder stummes Entsetzen sind die besten Beispiele dafür.... Das Spannende an Emotionen ist, dass wir sie konstruieren, kommunizieren und körperlich spüren, aber auch dass sie uns überwältigen, uns preisgeben, uns paralysieren usw. Genauso spannend an Gefühlen aber ist, dass wir ihrer mächtig werden können, wenn wir die ungewünschten Gefühle verbergen, managen oder bewältigen.“ (ebd., 11 f.). Während Flam (2002) in ihrer Darstellung ausführlich auf die soziologischen Klassiker in Europa (Simmel, Weber, Durkheim) und in den USA (Cooley, Sorokin, Parsons) eingeht, stellt Scherke (2009) ausführlich neuro- und biowissenschaftliche Grundlagen einer Soziologie der Emotionen dar. Es ist dabei daran zu erinnern, dass es Soziologie als Einzelwissenschaft erst seit Beginn des 19. Jahrhunderts gibt, sodass man Fragestellungen, die man heute zu einer Soziologie der Emotionen zählen kann, in früheren Zeiten (und auch noch später) in anderen Wissensgebieten findet. So hat es die Moralphilosophie mit den Sitten und Gebräuchen (mores) und dem richtigen Verhalten in bestimmten sozialen Kontexten zu tun, mit denen sich schon die Rhetoriker, die Sophisten und die anderen bedeutenden Philosophen der griechischen und römischen Antike befasst haben. Insofern die Rhetorik und ihre Prinzipien der sozialen Wirksamkeit bis ins 18. Jahrhundert als eine wichtige Quelle der Ästhetik bzw. sogar als ihr Ersatz gelten können, wird man auch dort eine Auseinandersetzung mit Fragen finden, mit denen sich heute auch eine Soziologie der Emotionen befasst. Auch im späten 19. und im 20. Jahrhundert sind aus philosophischer Sicht wichtige Beiträge zum Verständnis der Emotionen in sozialen Kontexten geleistet worden. Man denke etwa an die Arbeiten von Max Scheler zur Rolle der Sympathie, man denke an die Arbeiten von Tönnies zur Gemeinschaft in einem sozialen Zusammenschluss, der nur auf der Basis einer emotionalen Bindung zustande 22 gekommen ist. Man denke an die kritische Auseinandersetzung des Philosophen, Anthropologen und Soziologen Helmuth Plessner in den frühen 1920er Jahren zum Gemeinschaftsbegriff, so dass man ihn als einen Philosophen der Kälte bezeichnete. Aktuell sind die moderne-kritischen Studien des kanadischen Philosophen Charles Taylor zu nennen, der dafür plädiert, die Rationalität der Aufklärung mit der Emotionalität der Romantik zusammen zu führen, damit den Menschen durch das Erleben von „Fülle“ ein Abbau von Entfremdungsgefühlen möglich wird (siehe hierzu auch Illouz 2003). Nicht zuletzt spielen Emotionen eine zentrale Rolle bei dem aktuellen gesellschaftlichen Problem der Integration, der Partizipation und der Teilhabe. In diesem Kontext wird diskutiert, inwieweit man im Interesse an Integration und Partizipation nicht bloß von den Betroffenen fordern kann, dass bestimmte formale Regeln eingehalten werden, sondern dass es darüber hinaus ein gewisses emotionales Bekenntnis zu den Grundprinzipien der Gemeinschaft bzw. Gesellschaft geben müsse. Etwa bei dem Streit über eine Leitkultur, die man entweder als notwendig betrachtet oder die man für überflüssig oder sogar schädlich hält, geht es auch um ein solch emotionales Bekenntnis. Man kann hierbei wiederum eine antike griechische philosophische Idee wiedererkennen, nämlich das Konzept der methexis, bei dem es auch um die Teilhabe des Menschen an universellen Ideen (als Basis für Erkenntnis und Zugehörigkeit) geht. 23 3.3 Psychologische Theorien der Emotionen Die wissenschaftliche Disziplin der Psychologie gehört zu den vielen Disziplinen, deren Fragestellungen man bearbeitet hat, lange bevor es eine solche Einzeldisziplin gab. Es ist dabei immer mit einer gewissen Willkür verbunden, den Beginn einer solchen Disziplin zu identifizieren. Verbreitet ist die These, dass man den Anfang einer wissenschaftlichen Psychologie am Ende des 18. Jahrhundert findet, wobei der Roman „Anton Reiser“ von Karl Philipp Moritz (1756 - 1793), einem Freund von Goethe, Professor für Ästhetik und Begründer eines Magazins zur „Erfahrungsseelenkunde“, eine Schlüsselrolle spielt. Es ist dabei kein Wunder, dass die Entstehung der wissenschaftlichen Disziplin Psychologie in einer Zeit erfolgt, in der sich die bürgerliche Gesellschaft durchsetzt und die Industrialisierung an Fahrt aufnimmt (Jaeger/Staeuble 1978). Es ist eine Zeit, in der auch die Erziehungswissenschaft als Wissenschaft entsteht (so wird eine erste eigenständige Professur für Pädagogik an der Universität Halle in dieser Zeit eingerichtet; siehe Fuchs 1984), weil man verstärkte Anstrengungen glaubt unternehmen zu müssen, die passenden Subjekte für die sich entwickelnde Gesellschaft zu erziehen. Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass man auch mehr über die inneren Prozesse in Menschen wissen wollte. Wie bereits an dem Titel des von Moritz begründeten Magazins erkennbar wird, verwendete man den Begriff der Seele als deutsche Übersetzung des griechischen Begriffs der Psyche. Im 19. Jahrhundert griff man zwar bei der Benennung der neuen Einzelwissenschaft auf den alten Begriff der Psyche zurück, reduzierte aber erheblich deren Verständnis, indem man sich an einem naturwissenschaftlich-positivistischen Bild von Wissenschaft und vom Menschen orientierte. Wilhelm Dilthey sprach daher von einer „Psychologie ohne Seele“ (Wulf in Jüttemann u.a., 2005, 8). Immerhin gehörte die Untersuchung der Emotionen von Anfang an zu dem Kernbereich dieser entstehenden Wissenschaft, wobei die heutige Emotionspsychologie dasselbe Schicksal wie die Philosophie oder die Soziologie der Emotionen erleidet: nämlich mit einer erheblichen Unklarheit in den Grundbegriffen konfrontiert zu sein: „So lässt sich behaupten oder bestreiten, berücksichtigen oder vernachlässigen: – Gefühle sind körperliche oder geistige Erscheinungen in einer Person. – Gefühle haben ihren Ursprung in der betroffenen Person oder bilden Reaktionen auf Reize aus der Umwelt der Person. – Gefühle entfalten sich innerhalb einer Person autonom oder werden von dieser kontrolliert. 24 – Gefühle – seien sie körperliche oder geistige Erscheinungen – sind im Bewusstsein dargestellt oder entgehen dem Bewusstsein. – Gefühle – sofern sie sich im Bewusstsein darstellen – bilden eigene Qualia des Bewusstseins oder sind nur Kognitionen, die sich hinsichtlich ihrer Ich-Bezogenheit auszeichnen. – Gefühlen – sofern geistige Erscheinungen – fehlt es an Intentionalität oder sie sind intentional, d.h. sie beziehen sich auf Personen, Ereignisse und Ähnliches als Gegenstände der Anteilnahme oder als Ziele von Handlungen. – Gefühle wirken konstruktiv oder deduktiv.“ (Schönpflug in Otto u. a. 2000, 19). Ein Handbuch der Emotionspsychologie kann daher nicht anders, als diese Heterogenität unterschiedlicher Begriffe, Theorien und Forschungsansätze darzustellen. So unterscheidet das Handbuch Emotionspsychologie (Otto u.a. 2000) elf etablierte Ansätze der Theorienbildung: evolutionstheoretische Ansätze, psychoanalytische Ansätze, psychophysiologische Ansätze, ausdruckstheoretische Ansätze, kognitionstheoretische Ansätze, attributionstheoretische Ansätze, einschätzungstheoretische Ansätze, sozial-konstruktivistische Ansätze, partikuläre und integrative Ansätze, entwicklungspsychologische Ansätze, künstliche Emotion. Dabei sind diese elf Ansätze wiederum zusammenfassende Cluster, die in einer dreistelligen Zahl unterschiedlicher Theorien gefunden wurden. Das Handbuch stellt weiterhin zehn ausgewählte Emotionen vor: Angst; Ärger; Trauer; Freude und Glück; Erheiterung; Liebe, Verliebtheit und Zuneigung; Überraschung; Peinlichkeit; Scham und Schuld; Neid und Eifersucht; Ekel und Verachtung. In einem weiteren Kapitel werden Emotionen in Verbindung gebracht mit anderen psychischen Dispositionen, nämlich mit Motivation, Stimmung, Gedächtnis, Sprache, Persönlichkeit, Werten, sozialer Interaktion, Empathie und Handlung. Als Anwendungsfelder einer Emotionspsychologie werden das Selbst, der Umgang mit Krankheit und Gesundheit, die Behandlung von Störungen der Emotionalität, Therapie, Organisationen, Sport, schulisches Lernen, Altern, Umwelt und die Ästhetik aufgeführt. Noch weniger als bei den anderen Bereichen lässt sich also in diesem Feld der Psychologie auch nur annähernd in einer verallgemeinernden Weise beschreiben, was in den unterschiedlichen Ansätzen Emotionen charakterisiert. Allerdings kann man feststellen, dass sich die Emotionspsychologie in ihrer Geschichte, in ihrer Theorienbildung, in ihren Grundproblemen und in ihren Forschungsansätzen weitgehend mit den anderen vorgestellten Bereichsdisziplinen überschneidet. So gibt es ein geteiltes Interesse mit der Soziologie der Emotionen im Hinblick auf die soziale Dimension (Scham, Schuld, Neid, Empathie, Sprache, soziale Interaktion etc.), es spielen die philosophischen Emotionstheorien als globale Referenzsysteme eine Rolle, man befasst sich mit der Geschichte der Emotionskonzepte und einzelner Emotionen, man setzt sich mit dem Zusammenhang von Kunst und Emotion auseinander und nicht zuletzt interessiert man sich zusammen mit der Erziehungswissenschaft für die Ontogenese der Emotionalität des Menschen. 25 Ich greife in einem erziehungswissenschaftlichen Interesse einige Aspekte aus diesem breiten Spektrum heraus. So benötigt die theoretische und praktische Pädagogik eine Theorie der Persönlichkeit, in der die unterschiedlichen Dimensionen einer Persönlichkeit (Kognition, Emotion, Fantasie, soziale Kompetenzen etc.) berücksichtigt werden und an denen sich pädagogische Interventionen orientieren können. Insbesondere sind es Konzepte des Selbst, also etwa Begriffe wie Selbstbestimmung, Selbstwertgefühl, Selbstbild (vgl. Gerhardt 1999), für die sich sowohl die Anthropologie, die Sozialisationsforschung, die Entwicklungspsychologie und die Pädagogik interessieren müssen. Im Hinblick auf ästhetische Bildungsprozesse interessiert insbesondere die Frage, inwieweit eine ästhetische Praxis dazu beitragen kann, diese spezifischen Dimensionen von Persönlichkeit zu entwickeln. Vor diesem Hintergrund spielen Persönlichkeitstheorien von Deci/Ryan oder Antonovsky eine wichtige Rolle (vgl. etwa Holodynski 2006). Aufgrund der oben dargestellten Verbindungen der Emotionen mit Fragen der Moral ist auch dieser Aspekt von pädagogischem Interesse. Emotionen spielen zudem eine entscheidende Rolle für eine gelingende Lebensführung, sodass sich aktuelle Ansätze einer „positiven Entwicklung“ (Brandtstätter 2011) umfassend mit der Emotionalität und ihrer Entwicklung befassen müssen: „Durch die naheliegende Beziehung zu Begriffen von Glück und Zufriedenheit rückt das Thema positiver Entwicklung in die Nähe emotionstheoretischer Perspektiven. Gefühle verweisen auf Bedürfnisse, Motive und Werte und signalisieren diesbezügliche Erfüllungs- oder Mangelzustände; was das Leben lebenswert oder beschwerlich macht, hat auch mit Gefühlen, Stimmungen und Emotionen zu tun.“ (ebd., 171). Dieter Ulich entwickelt im Rahmen seiner Einführung in die Emotionspsychologie (1989) zehn Bestimmungsmerkmale von Emotionen: „Gefühlsregungen sind – einzigartige – auf der Grundlage von Selbstbetroffenheit und – meist über nicht-verbale Kanäle vermittelte – innerhalb zwischenmenschlicher Beziehungen erworbene und – bevorzugt über nicht-verbale Kanäle vermittelte – seelische Zustände, die – meist mit einem erhöhten Grad von Erregung erlebt werden – in denen die Person sich als eher passiv erfährt 26 – die dem Bewusstsein Kontinuität und „Identität“ verleihen – die keine primäre Funktion außerhalb ihrer selbst haben.“ (40) Abschließend will ich kurz auf einen Aspekt zurückkommen, der über Jahrhunderte kontrovers diskutiert wurde, bei dem es aber in den letzten Jahren anscheinend zu einer gewissen Annäherung gekommen ist. Es geht dabei um die Überwindung einer zu rigiden Entgegensetzung von Rationalität und Emotionalität. So hat der Philosoph Ronald de Sousa mit einem breit rezipierten Buch einen engen Zusammenhang der scheinbar irrationalen Emotionalität mit der Rationalität aufgezeigt. So heißt es im Klappentext: „Diese Untersuchung über die Rolle des Gefühls im rationalen Leben beschäftigt sich zum einen mit der Rolle, welche das Gefühl bei der Ausübung der traditionell als rational geschriebenen Vermögen spielt oder spielen sollte: beim Erwerben von Überzeugungen und Wünschen, beim Übergang zwischen ihnen und bei ihrer Umformung in Handlungen und Taktiken. Zum anderen bezieht sie sich auf Gefühle, insofern sie als Teil des Lebens und der Erfahrung aufgefasst werden und uns zu der Frage veranlassen, ob sie selbst rationaler Bewertung unterworfen werden können.… Die vorrationale Autonomie der Gefühle ähnelt jener der Wahrnehmungen: Sie erschließt und präsentiert selektiv eine Welt für uns. Emotionale Objektivität bemisst sich an der Bedeutung, die Empfindungen und Reaktionen in lebensgeschichtlichen Schlüsselsituationen haben. In der Biografie jedes Menschen entwickelt sich früh durch die Erfahrung dieser prägenden Schlüsselsituationen die emotionale und moralische Erlebnisfähigkeit.“ Ein damit verbundenes Thema betrifft den Begriff der emotionalen Intelligenz. Hierbei geht es darum, zu einem erweiterten Konzept von Intelligenz zu kommen. Diese Ansätze schließen an das Konzept einer multiplen Intelligenz von Howard Gardner an, der versucht hat, eine Engführung von Intelligenz, so wie sie insbesondere bei verbreiteten Intelligenztests in den Vereinigten Staaten als Grundlage diente, zu überwinden. Er zeigte, dass es nicht nur eine einzige Art von Intelligenz gibt, sondern er identifizierte seit den 1980er Jahren eine größere Anzahl unterschiedlicher Formen von Intelligenz. Hier knüpften amerikanische Psychologen (u.a. Jack Mayer und Peter Salovey) in den 1990er Jahren an. Für eine gewisse Verbreitung sorgte dann der Bestseller des Psychologen und Journalisten Daniel Goleman (1997). Er unterscheidet bei dem Konzept der emotionalen Intelligenz die folgenden Bereiche und Fähigkeiten: – die eigenen Emotionen kennen. – Emotionen handhaben – Emotionen in die Tat umsetzen 27 – Empathie – Umgang mit Beziehungen.(65 f.). Insbesondere im Bereich der Test Psychologie hat dieses Konzept internationalen Anklang gefunden (vgl. Schulze u. a. 2006). 28 3.4 Zur historischen Dimension von Gefühlen Die im Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin tätige Historikerin Ute Frevert, Leiterin der dortigen Arbeitsgruppe „Geschichte der Emotionen“, benennt in ihrem Buch „Vergängliche Gefühle“ (2013) drei mögliche Verständnisweisen ihres Themas: Als erstes spricht sie von der Endlichkeit von Gefühlen, der Tatsache nämlich, dass Gefühle flüchtig und instabil sind, dass sie kommen und gehen. Dies gilt offensichtlich für die biologisch fundierten Gefühle wie Hunger und Durst, also für die Artikulation menschlicher Bedürfnisse. Es gilt für Lachen und Weinen, es gilt für die Freude an Dingen und Ereignissen und es gilt letztlich auch für die Trauer. Bei aller Vergänglichkeit von Gefühlen muss man allerdings konstatieren, dass die Dauer sehr unterschiedlich sein kann. Es gibt kurzzeitige Gefühle, etwa die Freude eines Fußballfans an einem Tor der eigenen Mannschaft, die recht schnell zu Ende gehen kann, wenn die gegnerische Mannschaft sofort ein Gegentor schießt und den Ausgleich erzielt. Es gibt länger andauernde Gefühle wie etwa die Trauer über den Tod eines geliebten Menschen, wobei es zu so zu sein scheint, dass die kulturellen Traditionen so falsch nicht sind, wenn man etwa hierzulande von einem Trauerjahr spricht. Der Volksmund sagt: Die Zeit heilt viele Wunden. Dies gilt letztlich auch für die Trauer. In diesem Zusammenhang erwähnt Frevert einen Beschluss der Amerikanischen Psychiatrischen Vereinigung, die in ihren diesbezüglichen Stellungnahmen zur Länge der Trauerphase im Jahr 1980 noch ein Trauerjahr für richtig befunden hatte, 1994 die Trauerzeit bereits auf zwei Monate verkürzt hat und in ihrer letzten Verlautbarung davon spricht, dass jede Form von nachträglicher Trauer ein Fall für eine therapeutische (und natürlich auch medikamentöse) Behandlung sei. Eine zweite Form von Vergänglichkeit bezieht sich auf die Lebensspanne des Menschen, auf den individuellen Lebensverlauf. In diesem Zusammenhang zitiert Frevert Studien, dass entgegen früheren Annahmen mit dem Älterwerden der Menschen positive Gefühle mehr Raum einnehmen als in jungen Jahren. In jedem Fall verändern sich allerdings die Gefühle. Die dritte zeitliche Dimension einer möglichen Veränderung von Gefühlen ist die historische Zeit. Frevert stellt die These auf, „dass Gefühle historische Konjunkturen, Auf- und Abschwünge kennen. Zu manchen Zeiten und in manchen Gesellschaften sind sie stärker, sichtbarer, kraft- und machtvoller als in anderen. Sie gehen vielleicht nicht völlig verloren und verschwinden gänzlich von der Bildfläche. Aber sie rücken in den Hintergrund, geraten womöglich in Vergessenheit. Dabei verändern sie sich: in ihren Bezügen, ihrer sozialen Wertigkeit, ihrem Ausdruck, ihrer Intensität. Sie fühlen sich anders an.“ (Frevert 2013, 9) Die Frage nach der historischen Entwicklung und damit auch nach der Veränderlichkeit von Gefühlen ist mit mehreren Problemen konfrontiert. Zum einen stellt sich die Frage, ob es bei einer sich nicht verändernden biologischen Grundausstattung des Menschen überhaupt möglich ist, dass sich Gefühle verändern. Zum anderen muss man berücksichtigen, dass es eine gewisse Kulturabhängigkeit von Gefühlen gibt, auch wenn nach wie vor die Position vertreten wird, dass es sich bei Emotionen um biologische Universalien handele (Röttger-Rössler 2004). Zudem stellt sich das Problem sowohl der Erforschung aktueller Emotionen als auch – in stärkerem Maße noch – das Problem der Erforschung von Emotionen verstorbener Menschen. 29 Selbst bei dem erstgenannten Problem, bei dem Verstehen von Emotionen anderer Menschen, mit denen man es unmittelbar zu tun hat, werden erhebliche Zweifel artikuliert, ob dies überhaupt möglich ist. (Vergleiche etwa die Kritik von Solomon an dem Konzept der Empathie in Kahle 1981, 233ff.). Solomon führt gute Gründe für seine Kritik an, etwa die inzwischen bekannte Kritik an den Forschungsmethoden bekannter Ethnologen/innen, etwa den Studien von Margaret Mead zu der angeblichen Friedfertigkeit der von ihr untersuchten Stämme. Ein häufiger praktizierter Weg der Emotionsforschung besteht daher zum einen darin, Kunstwerke (aus der Literatur, dem Theater oder der bildenden Kunst) im Hinblick auf die Darstellung von Gefühlen zu untersuchen. Zum anderen – und diesen Weg verfolgt insbesondere Ute Frevert – untersucht man die Wörter, mit denen Gefühle zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Regionen beschrieben werden. Wichtige Studien stammen aus dem Bereich der Mentalitätsgeschichte. Als ein Beispiel nenne ich hier nur die Studie „Angst im Abendland. Die Geschichte kollektiver Ängste im Europa des 14.-18. Jahrhunderts“ von Jean Delumeau (1985). Es geht - wie der Untertitel sagt - nicht um die Gefühle einzelner Personen, sondern um kollektive Empfindungen. Es geht um die Frage, wie größere Gemeinschaften etwa auf solche Schicksalsschläge wie die Pest reagieren. Zwei tauchten in den vier Jahrhunderten zwischen 1348 und 1720 einige große Seuchen in Europa auf (Typhus, Pocken, Lungenpest, Ruhr), doch raffte der „Schwarze Tod“ von 1348 bis 1351 ein Drittel der Menschheit hin (Bd. 1, 140). In den Folgejahren trat die Pest fast jedes Jahr an irgendeinem Ort in Westeuropa auf. Die Folge waren ein Zusammenbruch des öffentlichen Lebens, eine Auseinandersetzung mit der Pest in den verschiedenen Kunstsparten sowie als psychische Reaktionen stoischer Gleichmut und Ausschweifungen und natürlich die Suche nach einem Rückhalt in der Religion. Verbunden war damit auch die Suche nach Schuldigen und man hat sie bekanntlich in den Juden gefunden, was zahlreiche Verfolgungen und Ermordungen nach sich zog. Delumeau untersucht auch die Angst als Ursache von Aufständen. So zitiert er eine Studie, dass alleine in Aquitanien zwischen 1590 und 1715 450 bis 500 Volksaufstände stattfanden. Bei diesen Aufständen spielte die Angst, etwa die Angst, vor Hunger zu sterben, eine zentrale Rolle. Es gab eine Angst vor dem Umsturz, es gab Ängste vor erdrückenden Steuerlasten, es gab die Angst vor der Verelendung. Diese Ängste hatten zum Teil nachvollziehbare Ursachen. So wurde die Angst vor dem Krieg nicht bloß damit begründet, dass man in den Kriegshandlungen sein Leben opfert. Zum Teil sehr viel schlimmer waren die Opfer der Bevölkerung, die dadurch entstanden, dass die durchziehenden Armeen ihren Lebensunterhalt von der Bevölkerung der Gegenden erpressten, durch die sie gerade zogen. Es ist bekannt, dass im Dreißigjährigen Krieg zwischen marodierenden Söldnergruppen, Landstreichern und Räubergruppen kein Unterschied bestand. Die Folge waren gravierende und begründete Existenzängste. Es ist also nicht verwunderlich, dass in der Geschichte der Menschenrechte zwar von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit die Rede ist, dass aber an erster Stelle der Wunsch nach körperlicher Integrität stand. Die Literaturwissenschaftlerin Elaine Scarry (1992) hat dies zum Gegenstand einer eindrucksvollen Studie gemacht: „dieses Buch hat nur ein einziges Thema, das sich allerdings in drei Elemente gliedern lässt; das erste ist die Schwierigkeit, körperlichen Schmerz auszudrücken, das zweite sind die Komplikationen, die politisch und in der Wahrnehmung aus dieser Schwierigkeit erwachsen, das dritte ist die Fähigkeit zu materiellem und sprachlichem Ausdruck oder, einfacher gesagt, das Wesen menschlicher Kreativität. 30 Der körperliche Schmerz hat keine Stimme. Findet er jedoch zu einer Stimme, so beginnt er, eine Geschichte zu erzählen. Diese Geschichte handelt von der unauflöslichen Verschränkung der drei Elemente, die ich genannt habe.“ (11) Scarry untersucht folgerichtig Krieg und Folter, bei denen der Mensch auf seine bloße physische Existenz reduziert wird (vergleiche hierzu die Ausführungen in Kapitel 8: Formen der Unterdrückung – Macht, Gewalt, Herrschaft in Fuchs 2016). Ein weiterer ergiebiger Ansatz ist die Mentalitätsgeschichte. Dinzelbacher (1993) beschreibt in seinem Handbuch zur europäischen Mentalitätsgeschichte die Aufgaben wie folgt: „Die Mentalitätsgeschichte konzentriert sich auf die bewussten und besonders die unbewussten Leitlinien, nach denen Menschen in Epochen typischerweise Vorstellungen entwickeln, nach denen sie empfinden, nach denen sie handeln.“ (IX) Entsprechend finden sich Beiträge zur Religiosität, zum Körper und der Seele, zur Krankheit, zur Sexualität und Liebe, zu Ängsten und Hoffnungen, zu Freude, Leid und Glück. Ähnlich verfährt Wolfgang Reinhard (2004), wenn er in einzelnen Kapiteln unter anderem Sinne und Emotionen oder die Todeserfahrung und Jenseitshoffnung behandelt als essenzielle Bestandteile der von ihm untersuchten Lebensformen in der Geschichte. Eine weitere Fundgrube in diesem Zusammenhang ist das Handbuch historische Anthropologie „Vom Menschen“ (Wulf 1997). Aus demselben Kontext stammt die Textsammlung „Die Seele. Ihre Geschichte im Abendland“ (Jüttemann/Sonntag/Wulf 2005). Im Vorwort dieses Buches heißt es: „Sich um eine „Geschichte der Seele“ zu bemühen, müsste ein Versuch der Vergegenwärtigung sein Vergegenwärtigung dessen, woran wir uns angesichts des Umstandes zu erinnern vermögen, dass die Seele einmal mit einem Heilsversprechen verbunden war, dass sie sich heiß umkämpft sah von den die Welt ebenso gestaltenden wie erschütternden Mächten des Guten und des Bösen, dass sie Anlass für die größten künstlerischen Bemühungen war, Zentrum der höchsten Anstrengung des abendländischen Denkens und gar Voraussetzung des Lebens schlechthin, insofern die lebenden Wesen sich von den toten Dingen durch den Besitz einer Seele unterschieden.“ (1) Dieses Projekt ist Teil einer wissenschaftlichen Bewegung einer „Rückkehr des Körpers bzw. des Leibes“ als Protest gegen reduktionistische Vorstellungen vom Menschen und es wird wesentlich von Erziehungswissenschaftlern getragen. 31 4. Emotionen und Kunst Man hat in der Geschichte den Künsten nicht bloß einen engen Bezug zu den Emotionen zugesprochen: über eine lange Zeit hinweg sah man sogar in der Artikulation und in der Beeinflussung von Gefühlen ihre primäre Aufgabe. Dabei wurde diese Aufgabenstellung für jede Kunstsparte gesondert diskutiert, denn einen Oberbegriff von Kunst, unter dem sich alle Sparten einordnen können, gab es erst mit der Ästhetik von Alexander Baumgarten Mitte des 18. Jahrhunderts. Zwar sprach man schon in der griechischen Antike von der Mimesis als übergreifendem Prinzip allen künstlerisch-ästhetischen Schaffens, doch verlief sowohl die Realgeschichte der künstlerischen Praxen als auch die Geschichte der Versuche ihrer Theoretisierung weitgehend getrennt voneinander. So gehörte etwa bei Platon durchaus eine Sachkunde im Hinblick auf die Bildhauerei zur Bildung des Polisbürgers. Doch fand bei aller Wertschätzung der Produkte dieser künstlerischen Tätigkeit die künstlerische Tätigkeit selbst keine Gnade vor den Augen Platons, da sie eine zu große Verwandtschaft mit der gering geschätzten handwerklichen Tätigkeit hatte. Dem Theater sprach Platon zudem die Fähigkeit zu, die Sitten der Polis zu verderben, weshalb er es aus der Polis verbannt wissen wollte. Zu den Literaten hatte er wiederum ein spannungsvolles Verhältnis, weil er in ihnen eine Konkurrenz zu der neuen Berufsgruppe der Philosophen im Hinblick auf das Deutungsrecht in der Polis sah. Lediglich die Musik fand Gnade vor seinen Augen, weil er in ihr eine gemeinschaftsbildende Kraft sah. Zudem muss man sehen, dass vor dem Hintergrund der Theorien von Pythagoras eine enge Verbindung zwischen Mathematik und Musik gesehen wurde, was bis ins hohe Mittelalter den Lehrplan der Universitäten bestimmte. Zudem gab es – möglicherweise bis heute – Konkurrenzen im Hinblick auf die Wirksamkeit der unterschiedlichen Kunstsparten. So befasste sich Lessing in seinem Laokoon mit der Frage, welche der Kunstsparten am besten in der Lage ist, menschliche Gefühle auszudrücken. Auch innerhalb derselben Kunstsparte, etwa in der Literatur, die man immer in enger Verbindung mit dem Theater gesehen hat, gab es Rangunterschiede, etwa zwischen der Tragödie und der Komödie und später zwischen Lyrik und Roman sowie zwischen dem Theater (das man lange bloß als ausführendes Organ der eigentlich wichtigen literarischen Vorlage gesehen hat) und der Literatur. Auch dies hat etwas mit Gefühlen zu tun, denn eine Komödie ist verbunden mit dem Lachen und man hat relativ schnell erkannt, dass Lachen auch etwas mit politischer Macht zu tun haben kann. Nicht umsonst spricht man davon, dass etwas lächerlich gemacht wird und dadurch auch an Bedeutung verliert. Umberto Eco hat in seinem Roman „Im Namen der Rose“ diesen Gedanken literarisch ausgearbeitet. Hierbei war es die Kirche, die um jeden Preis verhindern wollte, dass eine verschollen geglaubte Schrift von Aristoteles zur Komödie öffentlich bekannt wird. Aristoteles wurde im Verlaufe der Scholastik trotz seiner heidnischen Herkunft zu einer zentralen Referenzfigur in der theologischen Philosophie – etwa bei Thomas von Aquin – bekommen. Daher hätte es eine große Bedeutung gehabt, wenn diese Schrift über die Komödie bekannt geworden wäre, denn diese wäre ein Zeichen der Wertschätzung der Komödie und damit des Lachens gewesen. Dieses spannungsvolle Verhältnis von Lachen und Macht kann man auch in der Geschichte des Karnevals oder auch an der Kunstform der Karikatur erkennen, bei denen man sich über die Herrschenden lustig gemacht hat. Die enge Verbindung von Emotionalität und Kunst lässt sich auch daran erkennen, dass bis ins 18. Jahrhundert hinein die Rhetorik die Grundlage für die Theorien zur Kunst lieferte. Die Rhetorik war ursprünglich weitaus mehr als eine bloß manipulative Beeinflussung von Menschen, sie war eine 32 umfassende Anthropologie und Bildungstheorie. Es spielte in der Tat das Problem des Überzeugens durch Argumente sowohl bei der politischen Entscheidungsfindung in der Polis als auch vor Gericht eine entscheidende Rolle. Man übertrug daher diese Überlegungen der Wirksamkeit einer geschickt aufgebauten Rede auf die Künste insgesamt. Insbesondere wurde – etwa am Beispiel von Rubens – gezeigt, in welcher Weise die Malerei die Absicht verfolgte, mit einer religiösen Zielstellung Menschen zu überzeugen und wie sich Theoretiker und Praktiker daher an der Rhetorik als genuiner Kunsttheorie orientierten (Heinen/Thielemann2001). Dies gilt in ähnlicher Weise auch für das Theater. Man erinnere sich an die frühe Schrift von Schiller über das Theater als moralischer Anstalt, in der ganz in diesem Geiste argumentiert. Das Theater war das „Labor der Seele und der Emotionen“ (Ruppert 1995), es war eine Schule der Sitten, eine moralische Anstalt und diente der Popularisierung der bürgerlichen Moralphilosophie, so Ruppert. Theater bedeutete eine „Diskursivisierung der bürgerlichen Innenwelt“ und war ein wichtiger Teil der entstehenden bürgerlichen Öffentlichkeit. Diese Funktion konnte umso besser erfüllt werden, je mehr man sich an dem Motto aus der Ars Poetica von Horaz hielt: Prodesse et delectare. Das Theater sollte - wie alle Künste - nützen und erfreuen. Bekanntlich haben sich viele Künstlerinnen und Künstler und auch viele Ansätze in der Ästhetik und Kunsttheorie mit der Durchsetzung des Autonomieprinzips – wie auch der Schiller der 1790er Jahre – von dieser Maßgabe abgegrenzt. Allerdings gibt es bis heute eine starke Strömung in den Künsten, die sich zu einer gesellschaftspolitischen und einer entsprechenden Bildungsaufgabe bewusst bekennt. In denselben Kontext gehört die Verbindung von Emotionalität und Kunst auf der einen Seite und der Entwicklung moralischer Vorstellungen auf der anderen Seite. Man muss daran erinnern, dass die Idee einer autonomen Kunst erst im späten 18. Jahrhundert entstanden ist. Bis dahin war es selbstverständlich für alle, die mit den Künsten zu tun hatten, dass die Künste eine politische, eine religiöse, eine moralische und natürlich auch eine ästhetische Funktion hatten (Busch 1987). Trotz der weitgehend akzeptierten These von der Autonomie der Kunst, die ihren Niederschlag sogar in den Verfassungen vieler Länder gefunden hat, wird diese Verbindung von Kunst und Moral bis heute (kontrovers) diskutiert. So schreibt die Philosophin Maria-Sibylla Lotter an der Universität Bochum im Sommersemester 2015 ein Seminar „Kunst und Moral“ mit den folgenden Worten aus: „Während Ethik lange Zeit als eine Domäne der Philosophie betrachtet wurde, in der es darum geht, allgemeine moralische Standards zu begründen, ist die Relevanz dieses Unternehmens für das wirkliche Leben in den letzten Jahrzehnten zunehmend auf Skepsis gestoßen. Es wird kritisiert, dass Moralphilosophen sich zu sehr auf rationale Prinzipien fokussieren, auf Unparteilichkeit, Universalität und Allgemeinheit, auf Regeln und Begriffe, und viele andere psychische Fähigkeiten vernachlässigen, die für die moralische Ansprechbarkeit und somit auch für das moralische Handeln wichtig sind, wie die Gefühle, die differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit, die ethische Motivation und die Fähigkeit, komplexe und singuläre Situationen einzuschätzen. Entsprechend hat sich die Aufmerksamkeit den Künsten, insbesondere Literatur, Lyrik, Theater und Film als Medien der Vermittlung ethischer Kompetenzen und Einsichten zugewandt. Der Kunst wird nicht nur die Fähigkeit zugeschrieben, neue Chancen der Selbst- und Welterfahrung zu öffnen, sondern auch ein Verständnis komplexer ethischer 33 Problemlagen zu entwickeln, die Fähigkeit zum Mitgefühl zu wecken und die Solidarität zu steigern. Das Seminar dient der Einübung in den fortgeschrittenen wissenschaftlichen Diskurs. Am Leitfaden ausgewählter Schriften von Stanley Cavell, Iris Murdoch, Martha Nussbaum, Richard Rorty, Robert Pippin werden wir im Seminar versuchen, die Literatur und Film zugeschriebenen ethischen Leistungen zu unterscheiden und ihre Voraussetzungen zu untersuchen. Dabei werden wir auch der Frage nachgehen, inwieweit die Kunst, um ein tieferes ethisches Verständnis fördern zu können, wiederum der Auseinandersetzung mit der Philosophie bedarf.“ (Vorlesungsverzeichnis SS 15; vgl. auch den Beitrag von Fenner in Fuchs/Braun 2016 sowie die verschiedenen Bücher von Martin Seel, etwa Seel 1996). Diese Relevanz der Künste lässt sich auch an dem Umfang der Bezüge in theoretischen Schriften zur Emotionalität und/oder Ethik auf literarische, musikalische oder Bilder erkennen. So argumentieren Peter Bieri, Martha Nussbaum und viele andere bewusst auf der Basis von Kunstwerken, um ihre philosophischen Thesen zu belegen: Kunst wird quasi als legitime Form von Empirie genutzt. Die Philosophin Brigitte Scheer setzt sich in einem umfangreichen Handbuch-Artikel (in Barck u. a. 2001, Bd. 2, Artikel „Gefühl“) mit der Geschichte insbesondere des ästhetischen Gefühls auseinander. Sie weist darauf hin, dass der Begriff des Gefühls erst relativ spät, nämlich am Ende des 17. Jahrhunderts auftaucht und sich zunächst nur auf den Tastsinn bezieht. Vor dem Hintergrund der Dominanz einer fundamentalen Opposition von Körper und Geist, von Sinnlichkeit und Vernunft, von Gefühl und Intellekt ergibt sich die Bedeutung von Baumgarten und seinen Nachfolgern, nämlich mit der Rehabilitation der Sinnlichkeit des Menschen auch das Gefühl zu rehabilitieren. Aktuell sieht sie eine Tendenz zur Individualisierung des Gefühls in der analytischen Philosophie sowie eine Emotionalisierung des Intellekts im postmodernen Denken. (631) Sie verfolgt die Behandlung des (ästhetischen) Fühlens bei Pascal, Shaftesbury, Hutcheson und Hume (mit der engen Verbindung von moralischen und ästhetischen Gefühlen in deren Philosophien). Sie verfolgt die deutsche Philosophie von Baumgarten bis Hegel mit dessen Kritik an der These, dass es „die Aufgabe und Zweck der Kunst sei, ....die schlummernden Gefühle, Neigungen und Leidenschaften aller Art zu wecken und zu beleben, das Herz zu erfüllen und den Menschen, entwickelt oder noch unentwickelt, alles durchfühlen zu lassen“ (655; vgl. dagegen die Forderung des kanadischen Philosophen und Hegel-Spezialisten Charles Taylor 2009 mit seiner Forderung nach Fülle). Sie streift die „Psychologisierung des Gefühls im 19. Jahrhundert“ (656 f.) und beendet ihren Artikel mit einer Beschreibung der „Randständigkeit des ästhetischen Gefühls im 20. Jahrhundert“ (657-660). Eine Ausnahme machen hier die auch oben erwähnten Ansätze der amerikanischen Philosophin Susanne Langer und phänomenologische Autoren, insbesondere der Begründer der Neuen Phänomenologie Hermann Schmitz. Eine zentrale Rolle spielen die Gefühle dort, wo die rezipierenden oder produzierenden Subjekte (und weniger die Werke) im Mittelpunkt der Ästhetik stehen. Dies beginnt schon bei der rationalen Ästhetik von Kant, der die ästhetische Urteilskraft auf den Gefühlen von Lust und Unlust aufbaut. Kernbegriff einer Ästhetik, bei der das Subjekt im Mittelpunkt steht, ist der Begriff der ästhetischen Erfahrung. Aufgrund der Subjektorientierung dieses Begriffes steht dieser daher auch im Mittelpunkt 34 eines pädagogischen Umgangs mit den Künsten: Es geht um die Wirkungen einer ästhetischen Praxis auf das Subjekt im Hinblick auf dessen Bildung und Erziehung. Aus diesem Grund gehe ich im letzten Kapitel dieses Textes auf dieses Thema ein. Im 19. Jahrhundert entwickelt sich eine „Ästhetik von unten“, die sich im Rahmen einer psychologischen Ästhetik mit den individuellen Reaktionen in einer ästhetisch-künstlerischen Praxis befasst (Gustav Theodor Fechner; vgl. Allesch 1987 und 2006). Christian Allesch (2006) weitet den Untersuchungsbereich der psychologischen Ästhetik sogar noch über den engeren Bereich einer des Künstlerischen aus: „Wo also von „psychologischer Ästhetik“ die Rede ist, ist stets von der gesamten menschlichen Wahrnehmung die Rede – nicht nur von der auf die besonderen Gegenstandsbereiche des Künstlerischen oder des Schönen gerichteten Wahrnehmung.“ (17) Es geht also ganz so, wie Alexander Baumgarten Mitte des 18. Jahrhunderts Ästhetik unter Bezug auf die ursprüngliche griechische Bedeutung von aisthesis als sinnlicher Wahrnehmung konzipiert hat, um den Prozess der Wahrnehmung und der sinnlichen Erkenntnis. Bei diesem Prozess spielen Emotionen eine entscheidende Rolle, weil sie die Wahrnehmungsprozesse steuern und die Wahrnehmungsergebnisse bewerten. Gegenüber den sensualistischen Theorien hat bereits Holzkamp (1973) gezeigt, dass der Mensch keineswegs als leeres Gefäß mit Wahrnehmungsgegenständen konfrontiert wird, sondern immer schon über Kategorien, Vorbegriffe und Begriffe verfügt, die die Wahrnehmungsinhalte gestalten. In diesem Ansatz spielt die Emotionalität unter anderem die Rolle der Bewertung der Wahrnehmungen (Holzkamp 1983, Kap. 7). Man muss sich dabei immer wieder klarmachen, dass zwar die aktuellen Neurowissenschaften versuchen, bestimmte psychische Prozesse in bestimmten Bereichen des Gehirns zu lokalisieren, dass aber trotzdem die Trennung von Kognition, Wahrnehmung und Emotion eine weitgehend analytische Trennung ist, da in der Praxis die Bereiche zusammenfallen und die Prozesse des Wahrnehmens, Sortierens und Bewertens gleichzeitig geschehen. In diesem Rahmen kann man eine spezifische ästhetische Erfahrung von anderen Erfahrungsformen unterscheiden, indem man sie auf bestimmte ästhetische Gestaltqualitäten der Wahrnehmungsgegenstände gerichtet sieht. Die spezifischen ästhetischen Erfahrungsmöglichkeiten an ausgewiesenen Kunstgegenständen wiederum ergeben sich meines Erachtens dadurch, dass das Wahrnehmen des Subjekt mit einer bestimmten Erwartungshaltung des Subjekts erfolgt, das an diese bestimmte Gattung von Erfahrungsgegenständen herangeht: Es weiß, dass die künstlerischen Prozesse und Artefakte in einer bestimmten Absicht von entsprechend ausgebildeten Menschen hergestellt wurden, was wiederum zu einer neugierigen Grundhaltung bei dem ästhetischen Wahrnehmungsprozess führt. Neben einer allgemeinen psychologischen Ästhetik haben sich in den letzten 200 Jahren spartenspezifische Kunstpsychologien entwickelt, die jeweils den Umgang des Menschen mit bildender Kunst, mit Theater, mit Musik, mit Tanz oder Literatur untersuchen. (vgl. etwa Winner 1982, die in ihrer Psychologie der Künste auf die Malerei, die Musik und die Literatur eingeht und 35 abschließend auch auf die Rolle der Künste im Hinblick auf psychische Erkrankungen thematisiert). Eine besondere Arbeitsform betrifft den Einsatz künstlerischer Methoden in der therapeutischen Praxis, also bei der Behandlung von psychisch kranken Menschen, wobei diese Methoden sowohl bei der Diagnose als auch bei der Therapie benutzt werden. Diese Ansätze sind insofern von pädagogischem Interesse, weil in der aktuell florierenden Debatte über die Wirkungsforschung in meiner Wahrnehmung diese Theorien der Kunstwirkung in therapeutischen Settings zu wenig berücksichtigt werden. Die nach meiner Kenntnis umfangreichste Auseinandersetzung mit den Emotionen in den Künsten fand bei dem internationalen Kongress "Pathos, Affekt, Leidenschaft" in Frankfurt im Jahre 2002 statt (Herding/Stumpfhaus 2004). Das Vorwort der Herausgeber der Kongressdokumentation weist darauf hin, dass dieser Kongress - auch als Teil der oben erwähnten „emotionalen Wende“ - in den unterschiedlichsten Wissenschaftsdisziplinen viele Nachfolger gefunden hat. In durchaus ambitionierter Weise werden auf 650 Seiten nahezu alle Dimensionen des Themas angesprochen: • erkenntnistheoretische Voraussetzungen, historische und anthropologische Bestimmungen von Emotionen • Genese einer Theorie der Emotionen in der Geschichte der Ästhetik • das Kunstwerk als Feld des emotionalen Ausdrucks • eine Auseinandersetzung mit ästhetischen Normen in den Medien der Gegenwart (ebd., 18). Es kommen Kunstwissenschaftler/innen aus unterschiedlichsten Disziplinen, Psychologen, Philosophen, Soziologen, Ethnologen sowie Künstlerinnen und Künstler aus allen Sparten zu Wort. Diese diskutieren über Emotionen im Hinblick auf Wahrnehmung und Kognition sowie auf die Möglichkeit, Urteile auszusprechen. Es werden die Beziehungen von Emotionen zur Moral diskutiert (im Rahmen der Künste) und dies alles nicht bloß in einer europäischen, sondern auch in einer weltweiten internationalen Perspektive. Zudem werden Emotionen in den Künsten im Kontext des kommerziellen Kinos, der Politik und der Werbung vorgestellt. Das Ästhetische – Eine Erfolgsgeschichte der Moderne? Das Ästhetische ist, insbesondere im Zusammenhang mit Bildung, nicht nur kein isoliertes Feld, sondern vielmehr aufs engste verbunden mit außerkünstlerischen Entwicklungen (Eagleton 1994). Man muss sich nur in Erinnerung rufen, dass sich unsere heutige grobe Aufteilung der Philosophie in Erkenntnistheorie, Ethik und Ästhetik zwar auf eine Traditionslinie bis zu den Griechen beziehen kann: Eine Eigenständigkeit der Felder, so wie wir sie heute kennen, ist allerdings erheblich jüngeren Datums. Ein zentrales Datum ist dabei das Werk von Alexander Baumgarten Mitte des 18. Jahrhunderts, der den Begriff der Ästhetik und eine neue Deutung des Arbeitsfeldes in den Fachdiskurs eingeführt hat – freilich mit Widerständen bis tief ins 19. Jahrhundert (Fuchs 2011). Natürlich hat man über das Schöne – gerade in der Verbindung mit dem Guten und dem Wahren – immer schon nachgedacht. Aber diese Beziehung war immer als Einheit gedacht, gerade in pädagogischen Überlegungen. Mit der Moderne ergibt sich allerdings ein Prozess der 36 Ausdifferenzierung, der alle gesellschaftlichen Felder und letztlich auch die disziplinären Fachstrukturen in den Wissenschaften und in der Philosophie erfasst. Es geht um einen Prozess der Autonomisierung, darum also, dass sich immer mehr Bereiche im realen und im geistigen Leben segmentieren und sich selbst die Regeln des Handelns innerhalb dieses Feldes geben wollen. In den Künsten geschieht das in der Realität im 18., spätestens im 19. Jahrhundert. Reflektiert wurde dieser Prozess mit dem schillernden Begriff der „Autonomie“, der deshalb schillert, weil es nie so ganz klar ist, wessen Autonomie gemeint ist: der Bereich der Künstler (als Produzenten von Kunstwerken), das Feld einer autonomen Kunstrezeption, der sich herauskristallisierende Kunstmarkt, der Kunstdiskurs mit seinen verschiedenen Akteuren (Künstler, Kuratoren, Kritiker, Händler, Sammler, Ausbildungsstätten, Kunstwissenschaftler etc.). Eine Besonderheit im Kunstbereich scheint allerdings darin zu bestehen, dass man sich im Hinblick auf „Autonomie“ als etwas Besonderes auffasst, obwohl ein solcher Autonomisierungsprozess der verschiedenen Felder der „normale“ Entwicklungsweg in der sich ausdifferenzierenden Moderne ist. Dies ist allerdings bereits eine erste wichtige Feststellung: Es gibt eine besondere Variante eines ästhetischen Sonderwegsbewusstseins, das nicht zur Kenntnis nehmen will, dass Autonomisierung kein Alleinstellungsmerkmal der Künste ist. Auch die Künste und ihre Systeme sind also eingebettet in gesellschaftliche Prozesse. Doch wie hängt deren spezifische Entwicklung mit den Entwicklungen anderer Bereiche zusammen? Eine Geschichtsschreibung dieses Feldes hilft nur begrenzt weiter. Denn während man in den Überlegungen zur Genese der Erkenntnistheorie kaum die Entwicklung der Erkenntnisinstrumente (und damit die entsprechenden gesellschaftlichen Veränderungsprozesse) vernachlässigen kann, während man ebenso im Bereich der Moralphilosophie auf alte und neue gesellschaftliche Problemlagen hat reagieren müssen, konnte man offenbar im Bereich des Ästhetischen (und der ästhetischen Bildung) diese soziale Eingebundenheit weitgehend vernachlässigen. Dabei zeigen die Arbeiten zur Ästhetik der Neuzeit, gerade bei den französischen und englischen Ästhetikern des 18. Jahrhunderts, wie stark diese Denker die Künste im Hinblick auf ihre gesellschaftlichen Aufgaben reflektiert haben. Die Frage ist also zu stellen, wieso es immer wieder zu Konjunkturen des Ästhetischen (in Theorie und Praxis) bekommen ist (vgl. Eagleton 1994). Eine erste Erkenntnis wurde hinreichend oft beschrieben: Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen der Thematisierung des (bürgerlichen) Subjekts der Moderne und ästhetischen Fragen. Dies bedeutet, dem Zusammenhang zwischen den Konstitutionsbedingungen der realen Künste und ihrer theoretischen Reflektion auf der einen Seite und den Konstitutionsbedingungen des bürgerlichen Subjekts andererseits nachzugehen. Hierbei liegt es auf der Hand (ist es „evident“), dass die Frage des richtigen Verhaltens im sozialen Kontext und die Frage der Schönheit über die Brückenkategorie des Geschmacks verbunden werden. Hinzuweisen ist hier auf das Werk etwa von Knigge. Das Ästhetische hatte die klare Funktion einer Vorbereitung des Einzelnen auf seine gesellschaftlichen Aufgaben in der sich entwickelnden modernen bürgerlichen Gesellschaft. Es ist dabei festzustellen, dass dieser Prozess parallel zu der Ausdifferenzierung und Autonomisierung des Kunstfeldes verläuft. Daher ist zu fragen, wieso man ausgerechnet ein scheinbar sich nach außen abschottendes („autonomes“) Feld dafür geeignet hielt, eine zentrale gesellschaftliche Funktion zu erfüllen. Eine Schlüsselstellung bei der Beantwortung dieser Frage nimmt dabei das auch unter Zeitgenossen heftig 37 diskutierte Werk von Schiller (Briefe zur ästhetischen Erziehung, 1795) ein. Insgesamt ist die Zeit rund um die Jahrhundertwende 1800 (ebenso wie die Zeit um 1900) hoch relevant für diese Fragestellung: Es gibt sehr gute Gründe, sie als „Sattelzeit“ (Kosellek) in ihrer Bedeutung für soziale, geistige und politische Veränderungsprozesse hervorzuheben (gemeint ist die Zeit zwischen 1770 und 1830). Es sind übrigens immer auch politische und gesellschaftliche Gründe, die Philosophen dazu veranlassten, skeptisch oder sogar ablehnend gegenüber den Künsten zu sein (Abbildung im Anhang). Gerade im Zuge der Durchsetzung der Moderne wächst allerdings die Bedeutung des Ästhetischen. Ein erster Hinweis auf diese Bedeutung gibt – wie oben erwähnt - der Kultursoziologe Andreas Reckwitz (2006), der ein vertieftes Verständnis von „Kultur“ über das Studium jeweils vorhandener Subjekt-Typen erlangen will. So unterscheidet er für die verschiedenen Etappen seit 1800 Paare von Subjektformen – das moralisch-souveräne Subjekt – das expressive Subjekt der Romantik (Vormoderne), – das Angestelltensubjekt – das Subjekt der Avantgarde (organisierte Moderne), - das konsumorientierte Kreativsubjekt – das Subjekt der counter culture. Es ist interessant, dass in diesen Gegenüberstellungen dem „mainstream“ – Subjekt jeweils ein Gegenstück zur Seite gestellt wird, das ästhetisch definiert ist. Interessant ist zudem, dass dieser Gegentyp, obwohl scheinbar dysfunktional für den sich entwickelnden Kapitalismus, offenbar doch notwendig für die Aufrechterhaltung des Systems ist. Dieser Problemstellung ist also weiter nachzugehen – und dies nicht bloß aus einem historischen Interesse heraus. Denn möglicherweise erhält man hierbei Hinweise auf mögliche Gründe für die aktuelle Konjunktur kultureller Bildung. Die Romantik nimmt bei dieser Untersuchung eine Schlüsselstellung ein. Denn bis heute führt man alle Protest- und Gegenbewegungen zu tatsächlichen oder gefühlten Pathologien der Moderne auf romantische Motive zurück. Immerhin ist – trotz einer bis heute anzutreffenden anderslautenden Rhetorik – festzuhalten: Der Prozess der Autonomisierung der Künste ist keine Gegenentwicklung zur, sondern ein immanenter Teil innerhalb des Prozesses der Modernisierung. Daher wird man ihn im Kontext der Genese der Moderne untersuchen müssen. Insbesondere muss dann die Frage danach gestellt werden, ob es sich in den Künsten tatsächlich um „das Andere der Vernunft“ handelt, das insbesondere dann als notwendig erachtet wird, wenn man der Moderne mit ihrer Rationalität/Vernunft alle möglichen menschenfeindlichen Potenziale zuspricht. Ein erster Verdacht, dass die Sache mit der Andersartigkeit des Ästhetischen nicht so einfach sein könnte, liefert dabei die Betrachtung des Kunstsystems selbst. Denn in der Tat gab es einen Autonomie-Gewinn der Künstler dadurch, dass man sie aus der Abhängigkeit von den Höfen (als Auftraggeber) befreit hat. Zugleich hat man sie jedoch der Logik eines anonymen Marktes überlassen 38 mit der Konsequenz einer sich bis heute beschleunigenden Kommodifizierung und Kommerzialisierung: Der Kunstmarkt funktioniert offensichtlich nach denselben Prinzipien wie andere Märkte – er ist eben ein Markt - und es ist eine ernstzunehmende Frage, ob die Marktlogik dem künstlerischen Schaffen bloß äußerlich bleibt (siehe hierzu die aufschlussreichen Bücher des Kunsthistorikers Wolfgang Ullrich). Pathologien der Moderne als Ausgangspunkt für die Suche nach „Heilung“ durch das Ästhetische Es ist inzwischen eine Binsenweisheit, dass zunächst positiv erscheinende und daher gewünschte Entwicklungen erhebliche Risiken und Nebenwirkungen haben. So ist die Geschichte der Neuzeit natürlich eine Geschichte nicht nur der Thematisierung, sondern sogar der Befreiung des Einzelnen. Das Individuum wird - in den philosophischen Theorien und in den Kunstwerken - zunehmend zum Subjekt seines Lebens. Es erhält Rechte, Leibeigenschaft, entwürdigende Arbeits- und Wohnverhältnisse werden – zumindest in einigen Ländern – abgebaut. Es entwickelt sich ein Rechtsstaat, es entwickeln sich weitgehende Möglichkeiten politischer Partizipation. Es entwickelt sich allerdings auch - wie von Elias und später von Foucault beschrieben - eine andere, raffiniertere Form der Machtausübung. Es entwickeln sich neue Ungleichheiten und neues Elend. Die Versprechungen der Moderne (Subjektivität, Liebesehe, Fortschritt, Wohlstand, Frieden, Freiheit, Gleichheit) werden von der Wirklichkeit immer wieder blamiert. Der Protest gegen die Moderne und ihre Kultur rund um Rationalität und Wissenschaft wird bereits zu einer Zeit artikuliert, als sie sich noch gar nicht umfassend realisiert hat. Deshalb fällt es Bollenbeck (2007) leicht, eine Geschichte der Kultur(-theorie) der Moderne als Geschichte der Kulturkritik zu schreiben: Rousseau, die Romantik, Nietzsche, die Lebensreformbewegungen bis hin zu den Protestbewegungen unserer Tage sind ein Beleg für das Unbehagen an der Moderne. Dieses Unbehagen geht so weit, dass man mit großer Begeisterung am Ende des letzten Jahrhunderts ihr Ende erklären wollte (Postmoderne). Auch dies ist also festzuhalten: Es sind zu einem großen Teil Gegenbewegungen zur Moderne, in denen das Ästhetische als alternative Lebensform eine große Bedeutung erhält. Dabei lässt sich bereits jetzt feststellen, dass man sehr unterschiedlich auf die Pathologien der Moderne reagieren kann: Man versucht ihnen zu entgehen (die autarke ökologische Oase), man nimmt sie hin und sucht nach Tröstungen oder man protestiert dagegen. Der Buchtitel „Flucht – Trost – Revolte. Die Moderne und ihre ästhetischen Gegenwelten“ von C. Klinger (1995) bringt dies auf den Punkt. Das Ästhetische als Basis von Gegenbewegungen zur Moderne – dies mag eine Erklärung für dessen gewachsene Relevanz sein. D.h. aber auch, dass man etwas besser verstehen muss, wogegen man das Ästhetische in Stellung bringen will: Man benötigt Theorien, Erkenntnisse, Erfahrungen über die Moderne und ihrer Ambivalenz. Das bedeutet aber erneut, dass man die Rolle des Ästhetischen eben nicht aus sich selbst erklären kann, sondern dass man die Rahmenbedingungen kennen muss, in denen seine Relevanz entsteht. An Mängelanalysen zur Moderne ist kein Mangel. Man muss sich nur einschlägige Buchtitel anschauen, bei denen von einem Unbehagen an der Moderne, einem unabgeschlossenen Projekt, einer ambivalenten Modern oder von einer Unbehaustheit in der Moderne die Rede ist. Immer schon 39 gab es den harten Verdacht, dass die Moderne deformierte Subjekte erzieht: Der eindimensionale Mensch (Marcuse) ist ein Beispiel dafür. Stets ist es die Rationalität, die Rechenhaftigkeit, die als Grundzug der Moderne entsprechend deformierte Subjekte produziert. Ein weiteres Problem ist die Individualität, die eine wichtige Rolle bei der Durchsetzung der Moderne gespielt hat. Denn die Betonung der Stärke des Einzelnen, so wie er – nach Burckhardt – in der Renaissance entdeckt wurde, verbunden mit dem sich allmählich entwickelnden Schub zur Stärkung des Einzelnen durch die Menschenrechte, hatte als Schattenseite das Problem, dass nunmehr in der Theorie widerspruchsfrei zu denken und in der Praxis zu realisieren war, in einer Gemeinschaft zu leben und insbesondere sich als Teil eines Staates zu fühlen: notwendige Gemeinschaftlichkeit als Begrenzung der individuellen Freiheit – ein komplizierter theoretischer und praktischer Balanceakt. Leichter wurde dieses Problem sozialer Integration auch nicht dadurch, dass schottische Moralphilosophen die eigentlich grandiose Idee entwickelten, dass der Kapitalismus dasjenige System sei, bei dem ausgelebter Egoismus zu gesellschaftlicher Wohlfahrt führe. Eine „unsichtbare Hand“ werde schon dafür sorgen, dass ein harmonischer Ausgleich der Interessen geschieht. Hegel gilt als erster philosophischer Theoretiker der modernen bürgerlichen Gesellschaft. Er begründete die Trennung von Gesellschaft und Staat. Er führte zudem den Gedanken der Entfremdung ein. Seither sind Entfremdung oder Zerrissenheit – eben weil der Einzelne nunmehr verschiedene Arenen bespielen muss, die recht unterschiedlichen Handlungslogiken gehorchen – zentrale Topoi der Gesellschaftsanalysen. Es tauchten zudem Probleme auf, die die vormoderne Gesellschaft nicht hatte, etwa die Frage nach Sinn und Orientierung. Die Frage stellte sich früher deshalb nicht, weil anerkannte Institutionen (die Kirche) diesen Bedarf deckten. Doch gab es mit der Reformation plötzlich zwei dieser Instanzen, so dass man eine Wahl hatte, der man sich nicht entziehen konnte. Heute gilt Wahlfreiheit unter einer Vielzahl von Angeboten als unhinterfragter Wert. Doch heißt Wahlfreiheit oft genug auch Wahlzwang. Und: Das autonome Individuum ist selbst dafür verantwortlich, wenn es die falsche Entscheidung getroffen hat. Es liegt daher auf der Hand, dass die Unsicherheit bei dem Einzelnen und in der Gesellschaft wächst. Dies ist der Grund dafür, dass neue Reflexionsinstanzen geschaffen werden. Die sich als neue Disziplin entwickelnde Soziologie am Anfang des 19. Jahrhunderts ist eine solche Instanz. Sogleich sind es die typischen Problemlagen der modernen Gesellschaft, die thematisiert werden: sozialer Zusammenhang oder Agonie, Selbstmord, Integration (ein Wort, das erst im 19. Jahrhundert eingeführt wird). Insbesondere ist es Max Weber, der eine tiefgründige Analyse der Moderne und des Kapitalismus vornimmt: das stählerne Gehäuse, methodische Lebensführung, Wissenschaftlichkeit und Rationalität, die Frage nach den ethischen Voraussetzungen des Kapitalismus, alles Begriffe und Themen, die bis heute die soziologische Debatte und Zeitdiagnose prägen. Weber (und seine Mitstreiter Tönnies, Simmel, Troeltsch und sein Bruder Alfred) unterscheiden „Wertsphären in der Gesellschaft", die einem auch heute noch bekannt vorkommen, weil sie sich von Talcott Parsons bis zu R. Münch, Habermas und Luhmann in den aktuellen Gesellschaftstheorien wieder finden. Diese Wertsphären arbeiten mit eigenen Medien. Bekannt ist das Vierfelder-Schema, das T. Parsons in seiner Sichtung der soziologischen Theorien aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt hat: 40 Politik Wirtschaft Soziales Kultur Dabei arbeiten die vier Subsysteme Wirtschaft, Politik, Soziales und Kultur mit jeweils unterschiedlichen Medien, nämlich mit Geld, Macht, Solidarität und Sinn. Diese Unterscheidungen finden sich bereits bei Max Weber: – kognitive Rationalität der Naturwissenschaften und Technik, – Ethik und ihre evaluative Rationalität und – ästhetisch-expressive Rationalität (Kunst und Erotik). Das Problem ist klar: Es geht darum, unter anderem für die folgenden Pathologien der Moderne Gegengewichte zu finden: – Zerrissenheit – Einheit und Ganzheitlichkeit – Ratlosigkeit Heimatlosigkeit Desorientierung – Orientierung – Sinnlosigkeit – Sinn – Entfremdung – Aufhebung von Entfremdung – Vereinzelung – Gemeinschaft. Zum Teil waren dies Probleme, die sich bereits als Erblast der Aufklärung gezeigt haben und auf die Hegel wie erwähnt mit seiner Theorie der bürgerlichen Gesellschaft reagiert hat. Es waren dies Probleme, die die Ursache für die Bewegung der Romantik darstellen. Inzwischen hat man die ursprüngliche Deutung in der Romantik als bloß vergangenheitsorientiert und antimodern weitgehend überwunden. Man sieht sie vielmehr als Bewegung, die gerade in ihrer frühen Etappe Fehler des Aufklärungsdenkens im Interesse der Durchsetzung einer humanistisch gedeuteten Moderne beheben will. Zu einem späteren Zeitpunkt gestehen sich allerdings die Akteure ihr Scheitern ein und treten einen Rückzug – auch im Glauben eine Rückkehr zum Katholizismus – an. 41 Doch in der Frühzeit gehen sie auch aus politischen Gründen in Distanz zu den beiden Großen von Weimar, vor allem zu Goethe, den sie als "Fürstenknecht" betrachten. Die Frage ist, ob die Ästhetisierung des Denkens und Lebens, die die Romantiker wollten, überhaupt geeignet ist, die gewünschten Reparaturleistungen zu erbringen. Einen interessanten Ansatz bietet Klinger (1995) in ihrer Analyse und Bewertung der „ästhetischen Gegenwelten“ zu den „kalten Skeletthänden“ der rationalen Ordnung. Sie identifiziert vier Deutungen des Verhältnisses der ästhetischen Gegenwelten (zunächst der Romantik, später auch der verschiedenen Lebensreformbewegungen um 1900) zu der kalten Rationalität der technisch-kapitalistischen Welt: Externalisierung: In dieser Deutung werden die ästhetischen Gegenwelten als (reaktionärer) Rückzug ins Vormoderne interpretiert. Diese Interpretation ist ihrer Meinung nach „am falschesten“ (9). Ausdifferenzierung: In diesem Ansatz betrachtet man die ästhetische Bewegung durchaus als integralen Bestandteil der Modernisierung. Allerdings, so Klinger (14 ff.), erkennen weder Weber noch Habermas (gemeint ist sein Hauptwerk 1981, in dem er sich umfassend mit Webers Thesen zur Rationalisierung auseinandersetzt) die dritte (ästhetisch-expressive) Wertsphäre als gleichwertig zu den beiden anderen an. Einen Grund für diese Ablehnung sieht Klinger darin, dass dieser dritte Bereich auf der Ebene des Einzelnen Einheit, Ganzheit und Sinn herstellen soll, was unter der Perspektive der sich gesamtgesellschaftlich durchsetzenden Prinzipien der kognitiven Rationalität als irrational, reaktionär, totalitär und anti-modern angesehen wird (16). Da die genannten Aufgaben dieses Feldes (Ganzheitlichkeit, Authentizität, Einheit etc.) zu den oft genannten Prinzipien ästhetisch-kultureller Bildung gehören, ist der Befund wichtig: Der dritte Bereich ist zwielichtig, manchmal erscheint er als irrelevant, manchmal als übermächtig (17). In der Tat lässt sich dieser Befund an der Gemütslage heutiger Akteure verifizieren: Man schwankt zwischen den Gefühlen der Machtlosigkeit und des Größenwahns. Wichtig hierbei ist die Feststellung, dass dies nicht aufgrund einer Unzulänglichkeit der Akteure entsteht, sondern strukturell mit dem Status dieses dritten Feldes in seiner Beziehung insbesondere zu dem ersten Feld (Naturwissenschaft und Ökonomie) zu tun hat. Trifft dies zu, dann ließe sich die eingangs beschriebene Sucht nach „Evidenzbasierheit“ durchaus als Versuch erklären, dieses „weiche“ dritte Feld mit den Methoden des ersten Feldes satisfaktionsfähig zu machen, also Spielregeln anzuwenden, die nicht für dieses Feld gemacht und geeignet sind Komplementarität: Hier fungiert das Feld des Ästhetischen als notwendige Ergänzung und Kompensation von Lücken des ersten Feldes: Wo dort Entzauberung betrieben wird, kann -zumindest im Privatbereich – begrenzt eine Wiederverzauberung stattfinden. Damit erhält das dritte Feld eine systemstabilisierende Funktion und gehört eindeutig in den Kontext der Modernisierung. Also keine Flucht, keine Revolte, sondern Affirmation und Stabilisierung des Bestehenden. Korrespondenz: Hierbei geht es darum, eine enge Beziehung zwischen dem Ästhetischen und der 42 Moderne zu belegen (33). Festmachen lässt sich dies an der Entwicklung der Künste spätestens seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo der Kunst zunehmend die Aufgabe zugewiesen wird, die Zerrissenheit der modernen Welt aufzuzeigen. Mit der Entstehung einer Ästhetik des Hässlichen, der Thematisierung der „nicht mehr schönen Künste“, mit dem Auflösen von Harmonie und Gestaltung geben die Künste nicht nur das Kritikwürdige an der Gegenwart wieder, sie verweisen zugleich utopisch auf eine bessere Zukunft. Damit unterstützen sie jedoch uneingeschränkt das zentrale Prinzip der Moderne: den Fortschritt. Die Kunst wird Vorreiterin, wird Vorschein und Vorzeichen einer besseren Welt. Die Künstler marschieren voran (wörtlich: Avantgarde, vgl. Hepp 1992). Natürlich ist diese Funktionszuweisung nicht mehr mit der idealistischen Autonomiekonzeption früherer Zeiten kompatibel. Dieses ideologische Konzept (Müller 1972) hat längst ausgedient, auch wenn es bei Legitimationsdiskursen bis heute beliebt ist. Es gründet sich der Werkbund, Stadtplanung und Design als angewandte Künste wollen zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Die – auch etwa von M. Seel beschworene – kritische Distanz des Ästhetischen zur Gesellschaft entlarvt Klinger (47 S.) als frommen Selbstbetrug und in sich widersprüchlich. Die „Versprechungen des Ästhetischen“ (Ehrenspeck 1998) werden weiter (kontrafaktisch!) gepflegt. Ihr nüchternes Fazit: „Was als Besonderheit des dritten Wertsphärenbereichs erscheint, sein Irrationalismus, seine Antimodernität, seine Alternität, seine „Gefährlichkeit“, sind das nichts anderes als die unbegriffenen und verdrängten Züge der Moderne selbst. Die Moderne hat sich als unendlich offen und unüberholbar (miß-)verstehen können, erstens weil sie aufgrund ihrer besonderen Entstehungsbedingungen noch lange ein „polemisches“ Prinzip geblieben ist, d.h. sie hat das vorgängige Vorhandensein einer entgegengesetzten Denk- und Gesellschaftsordnung, konkret das christlich-metaphysische Weltbild vorausgesetzt, gegen das sie einerseits opponiert, in dem sie aber andererseits eingestandenerweise gewisse Ressourcen (und zwar besonders religiöse und moralische Sinnressourcen) finden konnte; zweitens und wichtiger noch, weil der Ausdifferenzierungsprozess verschiedener Wertsphären Gelegenheit bot, eine genuin moderne Strategie für den Umgang mit Problemen der Einheits-, Ganzheits- und Sinnstiftung zu entwickeln. Zwar sind Einheit, Ganzheit und Sinn als Kategorien einer objektiven Ordnung in der Moderne illegitim und nachgerade bedrohlich geworden, doch sollte die Bearbeitung bestimmter als unabweislich angesehener Aufgaben bzw. deren subjektive Gewährleistung an den dritten, den ästhetisch-expressiven Strang der modernen Rationalität delegiert werden können. Ohne diese Delegierungsstrategie wäre der moderne Weg der völligen Eliminierung der Fragen nach Einheit, Ganzheit und Sinn aus den Konzeptionen sowohl der naturwissenschaftlich-technischen wie der gesellschaftlich-rechtlichen Rationalität vermutlich gar nicht gangbar gewesen. Über weite Strecken des Modernisierungsprozesses ist die Alterität jener Gegenwelten für diesen zumindest partiell funktional und konstitutiv gewesen. Der hohe Preis für diese Lösung bestand im prekären und ambivalenten Status jener Gegenwelten im Kontext der Moderne. Sie sollten an ihrem Prozess teilhaben und gleichzeitig auch nicht teilhaben. Sie waren mehr als nur ausdifferenziert, sie waren ausgegrenzt. Umgekehrt gesehen musste von dieser zweideutigen Konstellation eine nie ganz auszuschließende Bedrohung der Moderne durch ihre 43 Gegenlager ausgehen. Die Geschichte der Moderne ist auch eine der permanenten Furcht vor potentiellen Grenzüberschreitungen und Übergriffen der ihr zugehörigen Gegenwelten.“ (52 f.) Im Folgenden untersucht Klinger zentrale Konstitutionsprinzipien der Romantik (nicht nur verstanden als konkrete historische Etappe, sondern vielmehr als „romantisches Syndrom“, also als geistige Haltung gegenüber der Moderne) anhand der folgenden Themen: – die Ausweitung und Umdeutung der Gesellschaftskritik zur Zivilisation- und Epochenkritik; - die Wendung zum Subjekt (als Individuum); - die Wendung zur Ästhetik; - die Wendung zur Gemeinschaft; - die Wendung zur Natur; - die Wendung zu Mythologie und Religion. (82) Auch das Ausblenden des Zusammenhangs von Ethik und Ästhetik (weil Kunst „autonom“ zu sein hat), könnte gefährlich werden, wie man am Beispiel prominenter Künstler (Nolde, Benn, Whigman, von Laban, Gründgens, R. Strauß etc.) sehen kann. Denn faktisch ist Kunst natürlich nicht autonom, so dass die Ideologie der Kunstautonomie entweder ein frommer Selbstbetrug oder ein Betrug an anderen ist. Künste sind wirkungsvoll, deshalb braucht sie der Mensch, doch erzählen sie nicht im Selbstlauf, wofür man sie verwendet: Gerade im Umgang mit dem Ästhetischen sollte man sein kritisches Denkvermögen nicht ausschalten. Die Ambivalenz des Ästhetischen besteht gerade darin, dass sie ganz so, wie es Schiller beschrieben hat, Freiheitsbedürfnisse zu entwickeln gestattet, zur Freiheit ermutigt. Künste erschließen allerdings auch das Innerste des Menschen, das eben anderen Formen von Rationalität und deren Herrschaftsansprüche nicht zugänglich ist – und machen so den Menschen in seinem Innersten zugänglich für Manipulationen. „Kultur macht“ – eben nicht im Selbstlauf – „stark“, sondern sie kann durchaus auch schwach und verletzlich machen (vgl. Fuchs 2016b). Das Subjekt im historischen Wandel Viele Wissenschaftler/innen sind sich darüber einig, dass der Jahrhundertwechsel 1800 von erheblicher Bedeutung für die Entwicklung in unterschiedlichen Feldern der Gesellschaft ist: Es setzt sich die bürgerliche Gesellschaft im 19. Jahrhundert (und damit das Bürgertum als entscheidende politische Kraft) durch, sodass das 19. Jahrhundert zurecht das bürgerliche Jahrhundert genannt wird. Es setzt sich die kapitalistische Wirtschaftsordnung zusammen mit einer florierenden Industrialisierung durch, was erhebliche Folgen für die Konstitution des Subjektes hat. Die 44 voranschreitende Säkularisierung der Gesellschaft hat zur Folge, dass Alternativen für die Sinnstiftung gefunden werden müssen. Vor diesem Hintergrund wird die wachsende Rolle der bürgerlichen Kultur mit den Künsten und ihren Institutionen im Mittelpunkt verständlich: Man spricht davon, dass – gefördert durch die Romantik – die Kunst ein funktionales Äquivalent der Religion wird (der Begriff der Kunstreligion geht auf diese Entwicklung zurück). Mit dem Jahrhundertwechsel 1900 bringen viele Historiker einen erneuten Epochenwechsel in Verbindung. Im Bereich der Künste ist diese Zeit verbunden mit einer revolutionären Veränderung der Formensprache. Man spricht von einer allgemeinen Krise, die mit den wissenschaftlichen und politischen Revolutionen (Freud, Einstein, Lenin und anderen) verbunden ist und die zu einem tief empfundenen Krisenbewusstsein führt, das allerdings die Moderne von Anfang an begleitet (Bollenbeck 2007; vgl. auch Klinger 2002). Verbunden mit den gesellschaftlichen Veränderungsprozessen sind Veränderungen im Verständnis dessen, was Subjektivität jeweils bedeutet. So beschreibt Klinger (2013) einen Wandel im Verständnis von Individualität: Zwar ist auch das 18. Jahrhundert geprägt von einem Individualitätsdiskurs, doch meint man hier eine „Universalität der Einzelheit“ (so Klinger 1995, 110 ff.), bei der die Gesellschaft zwar individualistisch gedacht wird, aber alle Individuen als gleich verstanden werden. Dagegen sieht sie später ein Verständnis von Individualität, das seine Wurzeln zwar in der Romantik, das sich aber erst im 20. Jahrhundert durchgesetzt hat, bei dem die einzelnen Individuen unterschiedlich voneinander verstanden werden (Differenz). Es geht – so Klinger – nun nicht mehr bloß um Selbsterhaltung und Selbstbestimmung, sondern um Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung (ebd.). Eine erneute Veränderung im Verständnis von Individualität und Subjektivität stellt sie beim Übergang von einem fordistischen Kapitalismus zu einem neoliberalen oder postfordistischen Kapitalismus fest, so wie er sich seit den 1970er Jahren entwickelt hat: Mit der Romantik kommen die Innerlichkeit des Menschen, seine Fantasie, sein Gefühlsleben und seine Empfindsamkeit zu ihrem Recht. Allerdings ist es im Zuge der mit der Moderne verbundenen Trennung von Privatheit und Öffentlichkeit das Private, in dem diese Dispositionen menschlicher Persönlichkeit gepflegt und ausgelebt werden. Dies ändert sich mit der Entwicklung des Kapitalismus im 20. Jahrhundert. Nunmehr wird die Wirkung von Waren und später Dienstleistungen auf Emotionen zu einem integralen Bestandteil der Warenwirtschaft: Man kauft nicht bloß ein Konsumgut zum Zwecke der Lebenserhaltung, sondern man kauft zugleich Empathie, Weltschmerz, Selbstwertgefühl etc.). Klinger spricht von einer (im Neoliberalismus noch gesteigerten) Emotionalisierung der Wirtschaft. Eine weitere Sprengung des Privaten geschieht durch eine Vermarktlichung von bislang privat ausgeübten bzw. staatlich bereitgestellten Versorgungsleistungen (Versorgung von Kindern und von kranken und alten Menschen, Ökonomisierung der Bildung und der Kultur etc.). Dieser ökonomische Paradigmenwechsel hat insofern Folgen für die Vorstellungen von Subjektivität, als der einzelne Mensch nunmehr als „Unternehmer seiner selbst“ und als "Ich-AG" (Bröckling 2007) verstanden wird. Zugleich wird das, was bislang eine Forderung des Einzelnen an die Gesellschaft war, nunmehr als Pflicht des Subjekts gegenüber der Gesellschaft und vor allem der Wirtschaft gegenüber verstanden. So erhält etwa der Gedanke der Autonomie die Bedeutung, dass der Einzelne die Verantwortung für die Gestaltung seines Lebens auch in solchen Fällen übernehmen muss, für die er nicht verantwortlich war (Arbeitslosigkeit, Krankheit etc.). Der Einzelne hat nunmehr dafür zu sorgen, dass er in körperlicher, geistiger und mentaler Hinsicht fit für den Arbeitsmarkt ist, sodass seine 45 Dispositionen der Persönlichkeit zum "Humankapital" werden. Dadurch bestätigt sich die These von Boltanski/Chiapello (2003), dass die Lebendigkeit des Kapitalismus daher rührt, dass er jede Kritik und kritische Strömung und Bewegung in seine eigene Logik integrieren kann. Man kann dies am Schicksal ästhetischer Gegenwelten studieren, die zwar aufgrund einer Kritik an antihumanen Tendenzen der kapitalistischen Entwicklung entstanden sind, die sich aber im Laufe der Zeit als durchaus funktional für diese Entwicklung des Kapitalismus erweisen (Klinger 1995, Reckwitz 2006). Es ist also durchaus die Frage relevant, inwieweit ästhetische Praktiken und ästhetische Bildung einen Beitrag zur Formung des neoliberalen Subjekts leisten, obwohl im Selbstverständnis der Akteure Ziele wie Autonomie, Emanzipation und Empowerment angestrebt werden. 46 5. Pädagogik und Gefühle Wer in einer Suchmaschine die Begriffe Pädagogik und Gefühle eingibt, erhält eine Menge an Angaben aus dem Bereich der Kindergartenpädagogik und er wird zu dem Begriff der emotionalen Kompetenz (ebenfalls bei Kindern) geführt. Eine weitere Recherche führt unter Umständen zu dem Begriff der Education Sentimentale, einem Roman von Gustave Flaubert, bei dem es um die Einführung eines jungen Mannes in die körperliche Liebe durch eine ältere Frau geht. Nun ist Flaubert durchaus eine interessante Person in der Geschichte der Künste, denn es haben sich sowohl Jean-Paul Sartre als auch Pierre Bourdieu in umfangreichen Studien mit ihm befasst. Der Grund dafür liegt darin, dass man am Beispiel von Flaubert die Autonomisierung des literarischen Feldes zeigen kann: dass nämlich der Bereich der Künste sich nunmehr selbst die Prinzipien seines Arbeitens gibt. Im Hinblick auf unsere Fragestellung, der Rolle der Gefühle in pädagogischen Kontexten, ist jedoch das spezifische Anliegen dieses Romans ein wenig zu eng. Weitere Publikationen zu diesem Thema befassen sich etwa mit dem Umgang mit Emotionen durch pädagogische Profis. Auch dies ist durchaus ein relevantes Thema in diesem Kontext, denn die Beziehung zwischen dem Lehrenden bzw. Erziehenden und dem – in alter Terminologie – Zögling ist ein wichtiges Thema. So wurde etwa der Begriff des „pädagogischen Bezugs“ der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik zur Beschreibung dieses Verhältnisses begründet und jeder, der sich in einer erziehenden oder bildenden Rolle befindet, wird sich mit diesem Aspekt seiner Arbeit auseinandersetzen müssen. Dies gilt umso mehr, als hier ein ausgesprochen empfindlicher Bereich betroffen ist. Man erinnere sich nur an die Missbrauchsskandale in wichtigen reformpädagogischen Bildungsanstalten, in denen man unter einem (problematischen) Bezug auf platonische Gedanken über Jahrzehnte systematisch anvertraute Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht hat. Hartmut von Hentig, aus dessen Freundeskreis einer der Haupttäter der Odenwaldschule, Gerold Becker, stammt, hat in diesem Zusammenhang den Vorschlag eines „sokratischen Eides“ analog zu dem Eid des Hippokrates bei Ärzten unterbreitet, bei dem es etwa um die körperliche und seelische Unversehrtheit der anvertrauten Kinder und Jugendlichen geht, um die Integrität der Person, um Schutz, um Hilfe bei der Überwindung von Angst und Schuld, Bosheit und Lüge, Zweifel und Misstrauen. Es geht um die Leiblichkeit und Selbstsucht. Hartmut von Hentig war es auch, der kluge Maßstäbe eines angemessenen Bildungsbegriffs formuliert hat: • Abscheu und Abwehr von Unmenschlichkeit, • die Wahrnehmung von Glück, 47 • die Fähigkeit und den Willen sich zu verständigen, • ein Bewusstsein von der Geschichtlichkeit der eigenen Existenz, • Wachheit für letzte Fragen, • die Bereitschaft zur Selbstverantwortung und Verantwortung in der res publica (Hentig 2009). Es fällt nicht schwer, in dieser Konzeption von Bildung auch einen zu kultivierenden emotionalen Zugang zur Welt und zu sich selbst zu finden. Doch wie läßt sich (knapp) ein Verständnis von (kultureller) Bildung formulieren? Bildung als Entwicklung und Transformation von Welt- und Selbstverhältnissen und die ästhetische Praxis In einer traditionellen Sicht versteht man im Anschluss an Wilhelm von Humboldt unter Bildung die wechselseitige Verschränkung von Mensch und Welt. Es geht dabei um die Entwicklung eines bewussten Verhältnisses des Menschen zu sich, zu seiner natürlichen, sozialen und kulturellen Umwelt und zur Zeit (Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft). In einer philosophischen Sprache kann man dies als Entwicklung der Welt- und Selbstverhältnisse des Menschen bezeichnen. Doch ergeben sich einige Fragen, z. B.: Was versteht man unter Welt- und Selbstverhältnissen, wie entstehen sie, welche Ausgestaltung erfahren sie, in welcher Beziehung stehen Welt- und Selbstverhältnisse zur betreffenden Person, wie verändern sie sich und warum? Akzeptiert man die Definition von Bildung als Entwicklung und Transformation von Welt- und Selbstverhältnissen, dann ergibt sich daraus, dass man mit dieser Klärung zugleich den schwierig fassbaren Bildungsbegriff definitorisch transparenter macht. Ich gehe davon aus, dass der Mensch aufgrund seiner anthropologischen Mitgift im Zuge der Ontogenese die Fähigkeiten entwickelt und ständig weiterentwickelt, eine bewusste Beziehung sowohl zur Welt als auch zu sich selber aufzunehmen. Eine anthropologische Basis für diese These liefert etwa der Gedanke der exzentrischen Positionalität, den Helmuth Plessner entwickelt hat. Der Mensch ist in der Lage, zu sich und seinen Lebensverhältnissen in eine gewisse Distanz zu treten, was die Möglichkeit einer reflexiven Selbstvergewisserung eröffnet. Ist diese Möglichkeit einmal benutzt worden, hat also der Mensch ein reflexives Verhältnis aktualisiert, so kann er wiederum auch zu 48 diesem reflexiven Verhältnis in eine reflexive Beziehung treten. Der Prozess des Reflexivwerdens ist also grundsätzlich nicht abschließbar. Eine weitere Hilfe aus der Kulturphilosophie und Anthropologie liefert die Philosophie der symbolischen Formen von Ernst Cassirer, der zeigt, dass der Mensch auf unterschiedliche Weise in Beziehung zur Welt und zu sich selbst treten kann: Er entwickelt eine Vielzahl symbolischer Formen, die dazu führen, dass aus der Welt, in der er sich befindet, jeweils je nach symbolischer Zugangsform unterschiedliche Wirklichkeiten gebildet werden. So kann man nach Cassirer einen theoretischen, religiösen, mythologischen, politischen, ökonomischen, technischen oder ästhetischen (und einen bei Cassirer nicht berücksichtigten moralischen) Zugang zur Welt praktizieren. Eine wichtige Erkenntnis besteht hierbei darin, dass es zum einen keine Hierarchie zwischen den unterschiedlichen Zugangsweisen zur Welt gibt und dass ein vollständiges Bild der Welt nur durch Nutzung aller Zugangsweisen zu erreichen ist (vgl. Fuchs 1998). Man kann aufgrund der unterstellten Parallelität von Welt- und Selbstverhältnissen nunmehr von analogen Zugängen des Subjekts zu sich selbst ausgehen. Das bedeutet, dass man überprüfen kann, welches Bild von sich durch die Nutzung der unterschiedlichen symbolischen Formen in diesem selbstreflexiven Prozess der Selbsterkenntnis und Selbstgestaltung entsteht. Auf der anderen Seite ist das Thema der Selbsterkenntnis schon immer ein eigenständiges Thema philosophischer Reflexion gewesen. Man denke etwa den Spruch des Orakels von Delphi: Erkenne dich selbst! Die gesamte sokratische und damit platonische Philosophie kann als Versuch gedeutet werden, dieser Aufforderung zu folgen. Damit kommen etwa alle die Kategorien ins Spiel, die in diesem Kontext entwickelt worden sind und die alle mit „Selbst-" beginnen (Selbstbestimmung, Selbstbild, Selbstorganisation etc.; s. u.). Analog zu dem obigen Vorgehen und aufgrund der Unterstellung einer Parallelität von Selbst- und Weltverhältnissen lässt sich daher fragen, inwieweit all diese Begriffe Sinn machen, wenn man den Begriff des „Selbst“ durch den Begriff der „Welt“ ersetzt. Im Zuge dieses Prozesses der Entwicklung von Welt- und Selbstverhältnissen entwickeln sich im Einzelnen Fähigkeiten und Kompetenzen, Haltungen und Einstellungen, die wiederum den Zugang des Einzelnen zu sich und zur Welt steuern. Diese individuellen Dispositionen werden mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten erfasst: Haltung, Kompetenzen, Habitus, Persönlichkeitsmerkmale wie Interesse oder Neugierde, Fähigkeiten zur Empfindung von Liebe oder Hass, Dispositionen zur Sorge und Fürsorge, zur Anerkennung und Wertschätzung. In einer traditionellen Sprache nennt man dies Charakter. Heute diskutiert man dies im deutschsprachigen Bereich eher unter dem Begriff der Person und der Persönlichkeit. Dieser ganze Prozess der Entwicklung von Welt- und Selbstverhältnissen spielt sich nicht in einer isolierten Situation ab, in der ein singulärer Einzelner, quasi als Leibnizsche fensterlose Monade, der Welt und sich selbst begegnet. Vielmehr dürfte es inzwischen sowohl in der Philosophie als auch in den Einzelwissenschaften Standard sein, dass sich Individualität nur in sozialen Prozessen entwickelt. Dies bedeutet, dass auch die Entwicklung der Selbst- und Weltverhältnisse eingebettet ist in jeweils konkrete gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Es bedeutet aber auch, dass gesellschaftlich vorhandene Individualitäts- und Denkformen (Sozialcharaktere, Charaktermasken, Persönlichkeitstypen oder wie solche Begriffe heißen, die gesellschaftliche Rollenangebote 49 beschreiben vgl. Fuchs 2012) den Rahmen für je individuelle Entwicklungsprozesse bilden. Dies bedeutet nicht, dass in einer straff milieutheoretischen Sichtweise eine feste Struktur für die jeweilige Persönlichkeitsentwicklung vorgegeben ist. Es bedeutet allerdings auch nicht, dass individuelle Entwicklungen jenseits aller gesellschaftlichen Verhaltenserwartungen und Rollenangebote stattfinden können und zudem eine biologische Basis haben. Selbstverhältnisse Im Hinblick auf die Präzisierung dessen, was unter Selbstverhältnissen verstanden werden kann, bietet wie oben erwähnt die Moralphilosophie eine gute Quelle. So diskutiert der Berliner Ethiker Volker Gerhardt (1990) die folgenden Kategorien: Selbsterkenntnis, Selbstständigkeit, Selbstherrschaft, Selbstbestimmung, Selbstzweck, Selbstorganisation, Selbstbewusstsein, Selbststeigerung, Selbstverantwortung, Selbstbegriff, Selbstgesetzgebung und Selbstverwirklichung. Seine Überlegungen haben zum Ziel, die Unhintergehbarkeit der Individualität zu belegen (Gerhardt 2000) oder wie es der Philosoph Heiner Hastedt (1998) sagt: den Wert des Einzelnen und damit den Individualismus zu verteidigen. In eine ähnliche Richtung gehen Arbeiten, die sich etwa mit einer Philosophie der Person befassen (Sturma 1997). Im Hinblick auf den besonderen Fokus dieser Arbeit lässt sich daher fragen, inwieweit eine ästhetische Praxis dazu beiträgt, die Dimensionen des Selbstverhältnisses zu entwickeln. Im Bereich der ästhetischen Theorie spielt seit langem die These eine Rolle, dass Kunst eine Form der Selbstvergewisserung des Menschen ist. Bei Shakespeare taucht etwa die berühmte SpiegelMetapher auf, derzufolge das Theater der Gesellschaft einen Spiegel vorhält. Der Spiegel ist das klassische Bild der Selbstreflexion. Weitere Thesen in diesem Zusammenhang betreffen etwa die Aussage, dass ästhetische Erfahrungen gestatten, Erfahrungen über Erfahrungen zu machen. Auch die Kantsche These, dass das Empfinden von Schönheit auf der Freude darüber beruht, dass der eigene Erkenntnisapparat auf die gegenständliche Welt passt (Bertram 2014, Fuchs 2011, Kleimann 2002), gehört in diesen Kontext. Natürlich muss dies noch genauer analysiert werden (etwa im Hinblick auf die Vollständigkeit des Katalogs von Gerhardt; so ist etwa auch der Aspekt der Selbstachtung und der Selbstliebe zu berücksichtigen. Es sind zudem die Gegensätze oder negative Aspekte von Selbstverhältnissen in Rechnung zu stellen wie etwa Selbsthass oder Selbstaufgabe). Es können dabei die Diskussionen rund um die Lebenskunst (die wesentlich die Sorge um sich selbst enthält) einbezogen werden. Weltverhältnisse Entsprechend dem oben formulierten Vorschlag wäre zu überprüfen, inwieweit es Sinn macht, in all den genannten Begriffen das Wort „Selbst“ durch das Wort „Welt“ zu ersetzen. Bei einigen der Begriffe ist es unmittelbar einsichtig, dass dies gut funktioniert: Welterkenntnis, Weltgestaltung, Weltverbesserung, Weltsteuerung, Weltorganisation, Weltbild. Dabei ist es keineswegs so, dass all diese Begriffe positiv bewertet werden müssen. So wird heute etwa in ökologischer Hinsicht sehr kritisch diskutiert, was man im Zuge der Moderne Unter Weltsteuerung verstanden hat. Auch dies ist ein wichtiger Hinweis, der auch für die Selbstverhältnisse gilt: Man kann zu viel des Guten wollen. Dies führt zum einen zu Überforderungen, dies kann zum anderen aber auch zu unbeabsichtigten 50 Schäden führen. Daher ist zu fragen, wie sicherzustellen ist, dass all diese Prozesse der Entwicklung der Selbst- und Weltverhältnisse in die richtige Richtung gehen. Gefragt ist also nach einem Kompass, wobei im Hinblick auf das Handeln der Menschen die dafür zuständigen philosophischen Disziplinen, nämlich die Ethik und Moralphilosophie, in den Blick geraten; siehe hierzu Kap. 3 Bei Kant gibt es das „Ding an sich“, das zwar die Sinne affiziert und Erkenntnisprozesse auslöst, das aber im Wesentlichen unerkennbar bleibt. Als moderatem Konstruktivisten entstehen bei ihm Wirklichkeiten erst durch die Erkenntnistätigkeiten des Subjekts. Ähnliches gilt für Ernst Cassirer, der zwar mit seinen symbolischen Formen das Spektrum der Welt-Zugangsweisen erheblich erweitert hat, bei dem aber auch unterschiedliche Wirklichkeiten entsprechend der angewandten symbolischen Formen entstehen. Wichtig ist zudem folgender Hinweis: Der Begriff der Verhältnisse ist zurückzuführen auf den Begriff des Verhaltens. Verhalten ist aber eine Aktivität des Subjekts, so dass hier unterstellt wird, dass es Tätigkeiten oder Praktiken sind, aufgrund derer Welt- und Selbstverhältnisse und die entsprechenden Welt und Selbstbilder entstehen. Bei einer Untersuchung dessen, was konkret bei der Genese von Welt- und Selbstverhältnissen geschieht, kann man daher auf die in letzter Zeit eine Konjunktur erlebende Theorie der Praktiken (Schmidt 2012) zurückgreifen. Eine der interessantesten soziologischen Untersuchungen zur Genese von Subjektivität (Reckwitz 2006) geht genauso vor: Reckwitz untersucht etwa bürgerliche Praktiken der Arbeit, er untersucht bürgerliche Technologien des Selbst (Lesen, Schreiben, ästhetische Praxen). Er untersucht nachbürgerliche Praktiken des Konsums oder gegen-kulturelle Praktiken (Rock und Pop, sexuelle Revolution), er untersucht Praktiken der Ästhetisierung der Körperlichkeit etc.). Ein weiteres ist zu berücksichtigen. Der einzelne Mensch ist niemals mit „der Gesellschaft“ als Ganzes konfrontiert, er bewegt sich vielmehr in je konkreten Lebenswelten. Dieser Gedanke eröffnet die Möglichkeit, die vielfältigen phänomenologischen Theorien der Lebenswelt zu nutzen, sie zu identifizieren, sie im Hinblick auf notwendige Handlungslogiken zu analysieren. Dabei ist die durchaus kontroverse Karriere des Lebensweltbegriffs von Husserl über Schütz bis zu Habermas in Rechnung zu stellen (Welz 1996). Es ist dabei zudem zu berücksichtigen, dass jeder Einzelne eine gewisse Souveränität im Umgang mit sehr unterschiedlichen Lebenswelten benötigt, weil die jeweiligen Lebenswelten auch mit entsprechenden Lebensformen korrespondieren. Man muss insbesondere sehen, dass die unterschiedlichen Lebenswelten, in denen der Einzelne lebt, durchaus widersprüchliche Verhaltenserwartungen an diesen Einzelnen stellt, was zu persönlichen Krisen führen kann. Und ein weiteres ist interessant und führt zu dem nächsten Abschnitt: Individuelle Dispositionen wie etwa die, Vertrauen entwickeln zu können, aber auch Neid zu empfinden, sind die Basis für soziales Zusammenleben (Schoeck 1987, Endress 2002, Sennett 2002). Person, Persönlichkeit und Charakter Wie oben angedeutet ist davon auszugehen, dass sich im Individuum individuelle Dispositionen einer Haltung zur Welt im Wechselspiel mit der Entwicklung der Welt- und Selbstverhältnisse ergeben. Bei diesen individuellen Dispositionen handelt es sich also um Antworten auf die Frage, in welcher Haltung man auf die Welt und auf sich selbst zugeht. Es geht also um den Bereich der Gefühle und Sympathien, was überhaupt keine neue Erkenntnis ist, denn in der Geschichte der Philosophie spielten diese immer schon eine wichtige Rolle. So hat etwa der Begründer einer Theorie des Kapitalismus, der schottische Moralphilosoph Adam Smith, vor seinem Hauptwerk über den Reichtum der Nationen eine Theorie der Gefühle beschrieben. Auch die Philosophen der griechischen 51 und römischen Antike beschäftigen sich ausführlich mit den Gefühlen. Man kann etwa die große Rolle, die die Rhetorik im öffentlichen Leben der Polis und der römischen Republik spielte, damit begründen, dass diese eine Technik der Weckung solcher Gefühle ist, die die Zuhörer dem eigenen Anliegen gewogen machen sollten. Alle sozialen Beziehungen wie etwa Liebe, Freundschaft, Solidarität, Mitleid, Sympathie, Empathie und Antipathie haben ihre Basis in der Emotionalität ihrer Beteiligten. In diesem Kontext spielen auch Tugenden und Laster eine Rolle: „Tugenden sind jene individuellen Kompetenzen, die es Individuen ermöglichen, sich gegenüber gesellschaftlichen Zumutungen aller Art zu behaupten und eigenständig, wenngleich im Verein mit anderen, Motive eines guten Lebens auszubilden und ihnen nachzugehen. Tugenden sind nicht kulturunabhängig zu bestimmen, aber ihre kontextuelle Verankerung nimmt ihnen im Rahmen ihrer Kultur nichts von ihrer Geltung.“ (Brumlik 2002, 149) Es ist darauf hinzuweisen, dass es seit der griechischen Antike – und sicherlich auch in den vorgriechischen Kulturen – Kataloge von Tugenden und Laster gibt (ein besonderes Beispiel ist etwa die Nikomachische Ethik von Aristoteles). Auch die christlichen Tugenden wie Glaube, Liebe und Hoffnung spielen in der westlichen Tradition eine wichtige Rolle. Für die Pädagogik ist die Frage nach der Entwicklung entsprechender Haltungen von entscheidender Bedeutung. Man kann sogar behaupten, dass diese Frage zu den Grundmotiven der Entstehung einer systematischen Reflexion pädagogischer Fragen gehört. So spielte im Zuge der Entwicklung der Moderne die Domestizierung der Leidenschaften eine entscheidende Rolle, was unter anderem dazu geführt hat, die sinnliche Seite des Menschen zu unterdrücken (weswegen Descartes der Hauptfeind aller späteren leibbezogenen philosophischen Ansätze wie etwa der Phänomenologie ist). Auch eine weitere These aus dem zitierten Buch von Micha Brumlik ist zu berücksichtigen: Er geht wie selbstverständlich von einer Struktur-Homologie zum einen zwischen dem Charakter und familiären Umgangsformen und zum anderen von einer Homologie familiärer Umgangsformen mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen aus. Man kann nunmehr die Vielzahl der unterschiedlichen Welt- und Selbstverhältnisse (z. B politische, moralische, praktische, wissenschaftliche und natürlich auch emotionale) weiter untersuchen. Dies soll im Folgenden für den Bereich des Emotionalen geschehen. Wie eingangs beschrieben, wird man bei der Suche nach einer umfassenden pädagogischen Theorie der Emotionen nicht fündig. Man wird daher aus den in diesem Text immer wieder vorgestellten Katalogen unterschiedlichster Emotionen einzelne Emotionen konkret herausgreifen müssen. So spielen in pädagogischen Kontexten etwa die Konzepte des Selbstwertgefühls, des Selbstbildes, des Vertrauens, auch des Vertrauens in die eigene Kraft, der Selbstständigkeit eine wichtige Rolle sowohl bei der Formulierung von Bildungszielen als auch bei der Entwicklung entsprechender pädagogischer Handlungsprinzipien. Auch das im Katalog von Hentig auftauchende Glück ist inzwischen ein zentrales Thema der Pädagogik, oft verbunden mit Konzeptionen der Lebenskunst und Lebensführung (BKJ 1998; Brenner/Zirfas 2015, Burow 2011, Brumlik 2002). Die Frage der Lebenskunst und der Lebensführung gehört zu dem Feld der Individualethik als Teil der praktischen Philosophie. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der Untertitel des Buches von Micha 52 Brumlik „Bildung und Glück“ lautet: „Versuch einer Theorie der Tugenden“. Mit der Thematisierung der Tugenden ist man dabei nicht nur im Feld der praktischen Philosophie, zu dem traditionell in früheren Zeiten auch die Pädagogik gehört hat, man bewegt sich auch in einem Bereich, den man in der deutschen Sprache unter der Rubrik „Charakter“ bearbeitet hat. In der Tat kann man das Buch von Brumlik auch als Lehrbuch einer (umfassenderen als bei Flaubert) éducation sentimentale lesen, denn es tauchen sehr viele Begriffe auf, die in früheren Kapiteln zu einer Philosophie, Soziologie oder Psychologie der Emotionen bereits behandelt worden sind: Leidenschaft der Pädagogik, Vertrauen und Scham, moralische Gefühle. Auch in dem Lexikon der Lebenskunst von Andreas Brenner und Jörg Zirfas wird man in dieser Hinsicht fündig. Es gibt darin nämlich Beiträge wie Angst haben, ärgern, egoistisch sein, Ekel empfinden, Freund sein, Gefühle aufbringen, glücklich sein, Hassen, Heuchelei, Lieben, Lust empfinden, Schmerzen haben, Sinnenreize, Verzeihen, wehleidig sein, also alles Begriffe, die auch in einem Lexikon einer pädagogischen Theorien der Emotionen auftauchen müssten. Nach all diesen Umkreisungen unserer Thematik gibt es zumindest zwei berichtenswerte Funde, die explizit das Thema Gefühle und Pädagogik aufgreifen. So ist zum einen mit einer gewissen Verwunderung festzustellen, dass es in einer zentralen erziehungswissenschaftlichen Forschungsstelle, nämlich im Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, nicht nur einen Arbeitsbereich „Geschichte der Gefühle“ gibt, dieser Arbeitsbereich wird zudem von einer Direktorin des Instituts geleitet, der Historikerin Ute Frevert, auf deren Arbeiten ich mich in diesem vorliegenden Text einige Male bezogen habe. Betrachtet man die Publikationen, die aus diesem Arbeitsbereich hervorgegangen sind, dann stellt man fest, dass sie rein geschichtswissenschaftliche Arbeiten sind, die (zunächst einmal) wenig mit Pädagogik zu tun haben, zumal sich keine Bildungshistoriker darunter befinden. Immerhin geht Frevert in ihren eigenen Arbeiten immer wieder auf die Pädagogik ein. So behandelt sie etwa in ihrer Publikation „Vertrauensfragen“ (2013) unter der Überschrift „Urvertrauen, Selbstvertrauen, Weltvertrauen“ das Gefühl des sich-verlassen-dürfens unter Bezug auf den Psychologen Erik Erikson und seinem Konzept des Urvertrauens. Es geht dabei wieder um die Erziehung von Kindern, es geht um die Beziehung zwischen Mutter und Kind und die Ansätze von Friedrich Fröbel am Anfang des 19. Jahrhunderts, einem Schüler des Schweizer Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi. Dieser sprach davon, dass Vertrauen gelernt, erprobt und erzogen werden müsse (88). In diesem Kontext geht sie auch auf die Reformpädagogik und die Landerziehungsheime und deren Gründer ein, etwa auf Gustav Wyneken und Paul Geheeb (92ff.). Geheeb gründete im Jahre 1910 die Odenwaldschule bei Heppenheim, in der es bereits in den 1920er Jahren zu sexuellen Übergriffen auf Schülerinnen und Schülern gekommen ist. Es entsteht so der Eindruck einer jahrzehntelangen Traditionslinie eines systematischen Kindesmissbrauchs, der trotz einer großen Zahl betroffener Kinder und Jugendlichen und trotz immer wieder erhobener Vorwürfe insbesondere gegen den Schulleiter Gerold Becker erst sehr spät öffentlich diskutiert wurde und schließlich aktuell zur Schließung dieser Schule führt. Ich erwähne diese Vorfälle deshalb hier so ausführlich, weil gerade bei einem pädagogischen Umgang mit Emotionen aufgrund der Natur der Emotionen das Problem von Distanz und Nähe in besonderer Weise berücksichtigt werden muss. 53 Ein zweiter hier vorzustellen Fund ist das Sonderheft 16 der Zeitschrift für Erziehungswissenschaft aus dem Jahre 2012 mit dem Thema „Die Bildung der Gefühle“ (Frevert/Wulf 2012). Die Beiträge zu diesem Band sind vier Gruppen zugeordnet: Kindheit und Familie, Schule und Peergroup, Medien und Bildung und Kultur und Lernen. Die Autorinnen und Autoren kommen aus dem Feld der Philosophie, der Geschichtswissenschaft, der Psychologie und der Pädagogik. Die Einführung erinnert daran, welch große Rolle die „Bildung des Herzens“ (Schiller) bzw. die Bildung des Gemüts (Wilhelm von Humboldt) in früheren Zeiten spielte. Auch die oft als rationalistische etikettierte Aufklärungspädagogik befasste sich ausführlich mit Trieben, Begierden, Affekten und Gemütsbewegungen. Es wird daran erinnert, dass in dieser Zeit schulische Lehrpläne drei Schwerpunkte hatten: Körper-, Geistes- und Herzensbildung. Allerdings wurde dies im 19. Jahrhundert insbesondere aus dem Gymnasium verdrängt. Mit Verwunderung stellen die beiden Herausgeber fest, dass es trotz wichtiger Referenzpapiere wie der UNESCO Empfehlung "Learning - The Treasure Within" (Delors 1997), in denen emotionale Dispositionen quasi die Basis für die Realisierung des vorgestellten Bildungskonzepte sind, in der Erziehungswissenschaft in den letzten Jahrzehnten kaum zu einer Thematisierung der Bildung der Gefühle gekommen ist. Vor diesem Hintergrund befassen sich die einzelnen Beiträge etwa damit, dass Emotionen im sozialen Miteinander gelernt werden und die Sprache hierbei eine zentrale Rolle spielt. Dies gilt nicht nur für die frühkindliche Erziehung, sondern es gilt auch für die schwierige Zeit jugendlicher Identitätsfindung in der Pubertät, etwa bei der Entwicklung eines stabilen Verhältnisses zu sich, zu Anderen und zur Welt. In unserer heutigen Mediengesellschaft wird man die Medien in ihrer Wirkung auf Bildung und Erziehung nicht vernachlässigen dürfen. Denn der Umgang mit oft großen Gefühlen (Neid, Gier, Trauer, Gewalt etc.) stehen in den verschiedensten künstlerischen und technischen Medien im Mittelpunkt. Dass dabei die Gefühle abhängig sind von kulturellen Kontexten, wie kulturvergleichende bzw. historische Untersuchungen feststellen, zeigen die Beiträge im vierten Teil dieser Publikation. Ein weiterer interessanter Fund ist die Entdeckung, dass entgegen einer gewissen Abstinenz gegenüber dem Begriff des Charakters und speziell der Charaktererziehung im deutschsprachigen Bereich "character education" im angloamerikanischen Bereich durchaus verbreitet ist. So gibt es nicht bloß veritable Handbücher wie das Handbook of Moral and Character Education (Nucci/Narvarez 2008), es gibt auch eigene Organisationen, es gibt Gütesiegel für Schulen, die sich in diesem Feld besonders ausgewiesen haben und es gibt nicht zuletzt praktische Handreichungen für eine entsprechende Schulentwicklung wie etwa die "11 Priciples of Character Education" (character.org 2014). Wie der Titel des Handbuchs schon aussagt, geht es bei der Charakterbildung um ethische Werte und Moralerziehung, geht es um Haltungen der Schülerinnen und Schüler gegenüber sich selbst und anderen (Empathie). Es geht um Atmosphären und das Gefühl, willkommen und anerkannt zu sein, es geht um die Entwicklung von Mitgefühl und Verantwortung. 54 Dieser angloamerikanische Ansatz ist in gewisser Weise vergleichbar mit bestimmten Konzepten wie etwa dem der demokratischen Schule oder dem Schulentwicklungsansatz von Olaf-Axel Burow (2011). Wichtige Stichworte aus diesem Ansatz sind Glück, Leidenschaft, Anerkennung und Wertschätzung oder der Begriff des subjektiven Wohlbefindens. Diesen letzten Begriff sieht Burow als übergeordneten Begriff, der am besten geeignet sei, Glück zu messen (102). Er identifiziert in der einschlägigen Forschung vier entscheidende Faktoren: – Glück als intensives, emotional positives Erlebnis, die ganze Person erfassend, überdauernd, sich im Lebenslauf entwickelnd; – Zufriedenheit als eher kognitive Einschätzung des eigenen Lebens als positiv, auf diversen Vergleichsprozessen (eigene Ansprüche, sozialer Vergleich) beruhend; – Freude als emotionaler Zustand des Sich-gut-Fühlens, eher kurzfristig, an konkrete Situationen gebunden; – Belastungsfreiheit als angenehmer Zustand der Unbeschwertheit und Entspannung, auf der Einschätzung der Abwesenheit von negativen Befindensfaktoren beruhend. (ebd.) Basistheorien sind u. a. die Salutogenese von Aaron Antonovsky, die Theorie multipler Intelligenz des amerikanischen Sozialpsychologen Howard Gardner, Erkenntnisse des Neurowissenschaftlers Ernst Pöppel und unterschiedliche Konzeptionen der Lebenskunst. Interessant ist, dass man die intensive Debatte über die Formulierung und Systematik von Lernzielen aus den 1960 er und 1970 er Jahren (Stichwort Curriculumentwicklung) offenbar vergessen hat. In der damaligen Systematik unterschied man kognitive, sensumotorische, sozial-kommunikative und affektive-motivationale Lernziele und entwickelte für alle Bereiche systematische Auflistungen, so genannte Taxonomien. Eine wichtige Referenztheorie war die Entwicklungspsychologie von Jean Piaget. Insbesondere entwickelte Jean Piaget für den kognitiven Bereich eine Stufentheorie der Entwicklung. Später entwickelte er eine ähnliche Stufentheorie für die moralische Entwicklung, wie in den Vereinigten Staaten insbesondere von Kohlberg aufgegriffen und weiterentwickelt worden ist. Für das Feld des Affektiven entwickelte Krathwohl mit Mitarbeitern (1975) eine Taxonomie, die bis heute vor allem in der schulpraktischen Lehrerausbildung Verwendung findet. Krathwohl unterscheidet im Bereich der affektive Lernziele die Stufen aufnehmen, reagieren, werten, Wertordnung, bestimmt sein durch Werte (im englischen: receiving, awareness, attending; responding; valuing; characterisation). Krathwohl beschreibt die affektive Entwicklung als Prozess der internen Realisierung: „Den Prozess der Internalisierung kann man beschreiben, indem man das Kontinuum auf nacheinanderfolgenden Stufen zusammenfasst, so wie diese in der affektiven Taxonomie erscheinen. Der Prozess beginnt dann damit, dass die Aufmerksamkeit eines Schülers durch irgendein Phänomen, ein Merkmal oder einen Wert in Anspruch genommen wird. Indem er dem Phänomen, dem Merkmal oder dem Wert seine Aufmerksamkeit widmet, differenziert er es von anderen Dingen, die in seinem Wahrnehmungsfeld auch vorhanden sind. Nach der Differenzierung setzt umso mehr ein Bemühen um das Phänomen ein, je mehr der Schüler ihm nach und nach eine emotionale Bedeutung und einen Wert zumißt. In dem voranschreitenden Prozess verbindet er dieses Phänomen dann mit 55 anderen Phänomenen, die einen Wert für ihn haben und auf die er reagiert. Dies vollzieht sich so häufig, dass der Schüler schließlich regelmäßig und fast automatisch auf das Phänomen und auch andere Dinge, die ähnlich sind, reagiert. Schließlich sind die Werte in einer Struktur oder einer Weltanschauung miteinander verbunden, in die er an neue Probleme angeht“ (ebd., 32) Wir finden in der Beschreibung dieses Prozesses Überlegungen, so wie sie oben bereits vorgestellt worden sind: die Intentionalität der Aufmerksamkeit, den Prozess der emotionalen Wertung, eine Habitualisierung solcher Prozesse. Es fehlt in dieser Beschreibung die Berücksichtigung des sozialen Kontextes, neu ist der Hinweis auf die Entwicklung einer umfassenden Sicht auf die Welt. 56 6. Ästhetische Praxis und Emotionen: Schlussfolgerungen für die Theorie und Praxis kulturellästhetischer Bildung Bildung soll im Folgenden - wie oben erläutert - als Entwicklung und Transformation von Welt- und Selbstverhältnissen des Subjekts verstanden werden. In diesem Prozess setzt sich das Subjekt mit sich und der gegenständlichen, kulturellen und sozialen Welt auseinander und entwickelt in diesem Auseinandersetzungsprozess Fähigkeiten, Dispositionen und Haltungen. Selbst- und Weltverhältnisse müssen dabei als zwei Seiten derselben Medaille betrachtet werden. So zitiert Gößling zustimmend die These von Dieter Henrich: „In allem Verhalten verhält sich der Mensch zugleich auch zu sich selbst. Er kann sich kein Bild von seiner Welt machen, in das nicht zugleich ein Bild von ihm selbst eingezeichnet ist.“ (ebd., 1). Praktisch wirksam wird eine solche Bildung in der alltäglichen Lebensführung (vgl. Fuchs 2016), so dass der seinerzeitige Vorschlag des Bundesjugendkuratoriums, mit dem Begriff der Lebenskompetenz den abstrakten Begriff der Bildung zu konkretisieren plausibel ist (Münchmeier 2002). In dieselbe Richtung gehen Versuche mit dem Konzept der Lebenskunst (BKJ 1999, Brenner/Zirfas 2015). Ein solches Verständnis von Bildung hat – wie ebenfalls oben beschrieben - eine anthropologische Grundlage, wie sie etwa in der Anthropologie von Helmuth Plessner in Verbindung mit der Anthropologie/Kulturphilosophie von Ernst Cassirer gefunden werden kann (vgl. Fuchs 2008). Basis ist ein Verständnis von Persönlichkeit, das alle Dimensionen der Persönlichkeit erfasst (Kognition, Emotion, Motivation, Wahrnehmungsfähigkeit, Fantasie, Soziabilität etc.). Bei der Anthropologie von Plessner steht das Konzept der exzentrischen Positionalität im Mittelpunkt, das davon ausgeht, dass der Mensch – zumindest virtuell – in eine Distanz zu sich selber treten kann, was ihm ein reflexives Verhältnis zu sich selbst ermöglicht. Diese Selbstreflexivität ist ein entscheidendes Bestimmungsmerkmal menschlichen Lebens und betrifft alle Facetten seiner Persönlichkeit: die sinnliche Wahrnehmung, die Kognition, die Fantasie und natürlich auch die Emotionalität. Denn der Mensch hat nicht nur Gefühle, er ist auch in der Lage, ein bewusstes Verhältnis zu diesen Gefühlen zu entwickeln. Die Philosophie der symbolischen Formen von Ernst Cassirer enthält ein Spektrum unterschiedlicher Zugangsweisen zur Welt und zu sich selbst: Politik, Sprache, Mythos, Religion, Wissenschaft, Wirtschaft, Technik und Kunst als Formen der Welt-(und Selbst-) Verhältnisse. Aus meiner Sicht ist ein solcher Ansatz kompatibel etwa mit dem capability approach von Martha Nussbaum und Amartya Sen. Für eine weitere Ausdifferenzierung des Begriffs der Selbstverhältnisse kann man das Buch „Selbstbestimmung“ von Volker Gerhardt (1999) zu Hilfe nehmen, der eine ganze Reihe von Selbst- 57 Begriffen durchdekliniert: Selbsterkenntnis, Selbstständigkeit, Selbstherrschaft, Selbstbestimmung und Selbstzweck, Selbstorganisation, Selbstbewusstsein, Selbststeigerung, Selbstverantwortung, Selbstbegriff, Selbstgesetzgebung und Selbstverwirklichung. In dieser moralphilosophischen Schrift finden sich zahlreiche Begriffe, so wie sie in Persönlichkeitstheorien, die in unserem Kontext hilfreich sind, auch verwendet werden (etwa die Ansätze von Deci/Ryan, Antonovsky oder den zurzeit vermutlich verbreitetsten Ansatz in der Persönlichkeitstheorie der „Big Five“, vgl. Pervin 2000, Kap. 8; siehe auch Burow 2011). Zur Klärung des Komplexes der unterschiedlichen Weltverhältnisse könnte man in einem heuristischen Vorgehen ausprobieren, inwieweit die Liste von Gerhardt Sinn macht, wenn überall das Wort "Selbst-" durch das Wort "Welt-" ersetzt werden würde; das soll allerdings hier nicht geschehen. Als globales Ziel dieses Bildungsprozesses kann das – natürlich nur in Grenzen mögliche – Verfügen über die Lebensbedingungen (Holzkamp) formuliert werden. Es geht also um die Gewinnung von Souveränität bei der individuellen Lebensgestaltung, wobei dies im Wechselspiel von persönlichen Dispositionen und äußeren Rahmenbedingungen geschieht, ganz so, wie es der Capability Approach präzise beschreibt. Kernbegriff einer ästhetischen Praxis ist der Begriff der ästhetischen Erfahrung. Es geht hierbei darum, welche Wirkungen eine solche Praxis auf das Subjekt hat. Genauer kann man in bildungstheoretischer Hinsicht fragen, welche Wirkungen eine ästhetische Praxis im Hinblick auf die Selbst- und Weltverhältnisse des Subjekts hat. Man kann danach fragen, welche Einflüsse es in dieser Praxis auf die unterschiedlichen Dimensionen der Persönlichkeit gibt, wie also die ästhetische Praxis die Bereiche der Wahrnehmung und Kognition, der Emotion, der Motivation und Volition, die Fähigkeiten zum Umgang mit anderen Menschen und den Dingen der Umgebung, die Fähigkeit im Umgang mit der Zeit (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft), mit der Fantasie und Kreativität hat. Auf der Basis der Anthropologie von Helmuth Plessner und seinem Konzept der exzentrischen Positionalität muss man davon ausgehen, dass der Mensch ein reflexives Verhältnis zu all diesen Dimensionen der Persönlichkeit hat bzw. ausbilden muss. Dies ist letztlich auch ein wesentliches Definitionsmerkmal des Begriffs der Bildung: nämlich ein bewusstes Verhältnis zu all den genannten Dimensionen der Persönlichkeit auszubilden. Bewusstheit beschränkt sich also keineswegs nur auf den Bereich des Kognitiven, sondern sie erfasst auch alle anderen Bereiche wie etwa die Wahrnehmung und Sinnlichkeit, die Motivation und schließlich auch die Emotionalität. Ein wesentliches Element ästhetischer Erfahrung ist daher die Entwicklung einer ästhetischen Reflexivität, was bedeutet, im Rahmen einer ästhetischen Praxis ein selbstreflexives Verhältnis zu den genannten Persönlichkeitsdimensionen zu entwickeln. Man weiß, dass eine ästhetische Praxis für diese Form der reflexiven Selbstvergewisserung und damit für die Entwicklung von Selbstverhältnissen in besonderer Weise geeignet ist. Alheit/Brandt (2006) zeigen dies auf der 58 Grundlage der Zivilisationsstudien von Norbert Elias an der literarischen Form der Autobiografie, wobei sie in ihrem historischen Zugriff zugleich zeigen können, in welcher Weise sich dieser Zugriff auf das Selbst im Laufe der Zeit verändert: „Im Epochenvergleich lässt sich ein tiefer, widerspruchsvoller Wandel der ästhetischen Erfahrung rekonstruieren. Ausgehend von einer mehr oder minder normengeleiteten äußerlichen Betrachtung der Welt unter ästhetischen Gesichtspunkten entwickelt sie sich zu einer Weise des selbstständigen Umgangs mit verschiedenen Wissensordnungen und verknüpft Ästhetik und Sozialität, Distanzierung und Nähe auf eine Weise, die für die Zivilisierung moderner Gesellschaften von grundlegender Bedeutung ist. Wir entdecken gleichsam den ästhetischen Kern moderner Individuation, zugleich aber auch seine Gefährdung am Ende des 20. Jahrhunderts.“ (ebd., 10) Emotionen als Teil der Selbst- und Weltverhältnisse Der Mensch ist – wie oben skizziert – mit einer Reihe von Dispositionen, Fähigkeiten und Haltungen ausgestattet, mit denen er seine Welt- und Selbstverhältnisse gestaltet und die er bei der Realisierung seiner Welt- und Selbstverhältnisse entwickelt. Zu diesen Dimensionen der Persönlichkeit gehören seine Emotionalität, seine Kognition, seine Moralität, seine Fantasie, seine Motivation und Volition, seine Soziabilität und seine praktischen Fähigkeiten. In unserer ausdifferenzierten modernen Gesellschaft kann man unterschiedliche soziale Felder unterscheiden, in denen diese Dimensionen der Persönlichkeit entwickelt werden. Im Hinblick auf Kinder und Jugendliche spricht man von Sozialisationsinstanzen wie der Familie, dem Kindergarten, der Schule, außerschulischen Lernorten, den Medien, Kultureinrichtungen, dem Freundeskreis. In späteren Jahren kommt der Bereich des Arbeitens dazu. Zudem spielen der Bereich des Konsums und die Art der Freizeitgestaltung eine wichtige Rolle (Hurrelmann 2008). Man kann nun untersuchen, welche Handlungsanforderungen in jedem dieser sozialen Felder bestehen. Zugleich gibt es für jedes dieser sozialen Felder Angebote eines geeigneten Verhaltens, die der Einzelne übernehmen kann, die er zum Teil sogar übernehmen muss, will er in diesen Feldern angemessen agieren. Man spricht von einer Homologie zwischen der Persönlichkeitsstruktur und den Strukturen der jeweiligen sozialen Felder, wobei man davon ausgehen muss, dass sich die Strukturen in diesen sozialen Feldern zum Teil erheblich unterscheiden. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer Kompetenz, das jeweils richtige Verhalten in den verschiedenen Feldern lernen zu müssen und dabei angemessen mit den Unterschieden der Verhaltenserwartungen umzugehen. Ein immer populärer werdender Weg, diese Beziehungen zu untersuchen, besteht darin, sich auf die Praktiken des Subjekts zu konzentrieren. So analysiert etwa Andreas Reckwitz (2006) unterschiedliche Typen von Praktiken (Praktiken der Arbeit und Technologien des Selbst) und kann 59 auf diese Weise unterschiedliche Subjektformen in den letzten 200 Jahren unterscheiden. Der Wandel der Praktiken führt dabei zu einem Wandel der mentalen Innenausstattung des Menschen. Vor dem Hintergrund dieser Untersuchungen werden Analysen der aktuellen neoliberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung bedeutsam, so wie sie etwa der Kulturwissenschaftler Richard Sennett oder der französische Philosoph Michel Foucault im Hinblick auf den Strukturwandel der Mentalitäten der Subjekte vorgenommen haben (vgl. auch Bröckling 2007). Im Hinblick auf die im Mittelpunkt stehende Rolle der ästhetischen Praxis sind diese Studien insofern relevant, als ästhetische Praxen im Kontext einer oft beschriebenen Ästhetisierung der Lebenswelt durchaus Teil einer – wie Jürgen Habermas sagt – Kolonialisierung der Lebenswelt sein können. Vor diesem Hintergrund wird die Frage interessant, inwieweit es im Rahmen einer ästhetischen Praxis gelingen kann, Widerständigkeit als traditionell zentrales Element einer entwickelten Subjektivität zu entwickeln (vgl. Fuchs 2016) Einige Schlussfolgerungen und Beispiele Im Folgenden will ich einige weitere Aspekte zusammentragen, die sich aus der obigen Betrachtung und Auswertung der unterschiedlichen disziplinären Diskurse zur Emotionalität ergeben. 1. Eine Pädagogik der Emotionen und insbesondere die ästhetische Bildung von Emotionen bzw. die Rolle der Emotionen im Rahmen ästhetischer Bildungsprozesse müssen die Vielzahl an Definitionen und Begriffen, müssen eine gewisse Unübersichtlichkeit und zum Teil erhebliche Differenzen in der Begriffsbildung zur Kenntnis nehmen und berücksichtigen. 2. Immerhin gibt es in den verschiedenen Disziplinen einen gewissen Konsens darüber, dass die Trennung der Persönlichkeitsdispositionen (Kognition, Emotionalität, Moralität etc.). Eine bloß analytische Trennung ist und insbesondere eine Entgegensetzung von Kognition und Emotion nicht aufrechterhalten werden kann: Jede Kognition hat emotionale Elemente und jede Emotion kann auch auf rationale Weise untersucht werden. 3. Emotionen entstehen in sozialen Interaktionen, diese sind gestaltbar und veränderlich. 4. Trotz der Versuche, allgemeingültige universelle Emotionen – etwa auf der Basis einer gleichen biologischen Grundausstattung des Menschen – zu identifizieren, muss man davon ausgehen, dass sich (die meisten) Emotionen sowohl regional als auch zeitlich (sowohl bezogen auf die eigene Biografie als auch auf die historische Zeit) verändern. Für die historische Dimension siehe Gestrich 1999. 5. Es gibt eine enge Beziehung zwischen Künsten und ästhetischer Praxis auf der einen Seite und der Entstehung, Artikulation und Beeinflussung von Emotionen auf der anderen Seite. So spielen die den 60 Emotionen zugesprochenen Wertungsprozesse in der ästhetischen Praxis ebenso eine Rolle, wie der These (von Koppe 1993), dass Künste etwas mit der Artikulation von Bedürfnissen zu tun haben, eine hohe Relevanz für die Emotionalität des Menschen hat. Die besondere Nähe der beiden Bereiche zeigt bereits der Begriff der ästhetischen Erfahrung, denn Erfahrung generell enthält die innere emotionale Verarbeitung der Wahrnehmungen, Widerfahrnisse und Erlebnisse. Einige Beispiele Im Folgenden will ich einige Überlegungen wiedergeben, bei denen ich zeige, in welcher Weise bestimmte psychische Dispositionen in einer ästhetischen Praxis gefördert werden können. Ich orientiere mich dabei lose an den oben genannten Ausdifferenzierungen des Selbstbestimmungsbegriffs von Volker Gerhardt (1999). Es ist zudem zu sehen, dass alle drei Bereiche, die Pädagogik, die Emotionalität und die ästhetische Praxis, ihr Fundament in der Leiblichkeit des Menschen haben. Selbstwirksamkeit und Selbstwertgefühl Das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung geht auf den Psychologen Albert Bandura zurück. Es geht dabei um den Glauben des Menschen, selbst etwas bewirken zu können. Dies wiederum ist notwendig, damit so etwas wie Selbstbewusstsein und eine Zuversicht entsteht, sein Leben auch bewältigen zu können. Hilfreich in diesem Kontext ist es, wenn Dinge entstehen, die man sich selber zu schreiben kann bzw. an deren Entstehung man beteiligt ist und die dann mit einer gewissen Resonanz der Öffentlichkeit vorgeführt werden können. Es ist also sowohl ein Akt der Kommunikation mit sich selbst als auch mit denen, die an der Produktion dieses Produktes beteiligt sind und als auch eine Kommunikation mit denen, die mit diesem Produkt konfrontiert werden. Wenn das Produkt Interesse auslöst und möglicherweise sogar eine positive Resonanz erzielt, dann hat sich die Selbstwirksamkeitserwartung erfüllt. Der dadurch entstandene Mut in die eigene Schaffenskraft ist gerade in heutigen Zeiten besonders wichtig, da in einer neoliberalen Sichtweise die Verantwortung für die Gestaltung des eigenen Lebens auch dann dem Einzelnen zugemutet wird, wenn die von ihm nicht verantworteten Rahmenbedingungen schlecht sind. Mut in die Zukunft ist daher eine wichtige Disposition. Denn anders als in früheren Zeiten, als man die Einstellung zum gegenwärtigen Leben als Resultat vergangener Erlebnisse interpretiert hat, weiß man heute, dass die Einstellung zur Gegenwart in erheblichem Umfang davon abhängt, welche Perspektiven man in der Zukunft für sich sieht. Es ist offensichtlich, dass eine ästhetische Praxis sehr viel mit dem Produzieren und Zeigen zu tun hat. Sie ermöglicht daher auf besondere Weise die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, sie zeigt, dass man aus eigener Kraft etwas schaffen kann. Finden solche ästhetischen Praxen zudem in einem pädagogischen Setting statt, das nach kulturpädagogischen Prinzipien – etwa dem der 61 Fehlerfreundlichkeit und der Stärkenorientierung – gestaltet ist, dann ist die Entwicklung einer solchen individuellen Stärke hoch wahrscheinlich. Selbststeigerung und Selbstverantwortung Es liegt in der Natur einer ästhetischen Praxis, dass man auch ohne äußere Einflussnahme eine bestimmte Qualität in seiner Produktion erreichen will. Denn man weiß, dass das, was man erarbeitet hat, später einer Öffentlichkeit vorgeführt werden soll. Man spürt dabei selbst, was funktioniert hat und was hätte besser sein können. Gleichzeitig hat man die Erfahrung gemacht, dass der Erfolg in einem kulturpädagogischen Projekt dazu führt, dass man es gerne wiederholen möchte. Es liegt also in der Logik dieser ästhetischen Praxis, nicht bloß Dinge gut machen zu wollen: Man erlebt auch selbst, dass dazu bestimmte Handlungsdispositionen notwendig sind. Insbesondere sind es die oft zu Unrecht kritisierten sogenannten Sekundärtugenden wie Pünktlichkeit oder Zuverlässigkeit, die man in einer ästhetischen Praxis realisieren muss, soll diese gelingen. Man merkt zudem, dass man die für die Entwicklung notwendiger Fähigkeiten selbst die Verantwortung übernehmen muss. Auch führt die Entwicklung solcher Dispositionen der Persönlichkeit zu einer Stärkung des Selbstwertgefühls. Außerdem führt der Wunsch, bestimmte Fehler das nächste Mal nicht mehr zu machen, zu einem Prozess der Selbststeigerung. Selbsterkenntnis und Selbstbild Ästhetische Praxen gibt es in vielfältigster Form. Es gibt daher die unterschiedlichsten Möglichkeiten, die verschiedensten Fähigkeiten und Kompetenzen in sich zu entdecken bzw. auch herauszufinden, dass einem bestimmte Dinge nicht so gut liegen. Eine ästhetische Praxis ist also automatisch ein Prozess der Selbsterkenntnis, an dessen Ende die Entwicklung eines realistischen Selbstbildes steht. Insgesamt ist in einer ästhetischen Praxis und in einer Auseinandersetzung mit den Künsten all dies zu erleben, was in dem obigen Kapitel zu dem Thema Kunst und Emotion ausgeführt worden ist. Künste dienen der Darstellung von Verhaltensweisen, sie zeigen auf, in welcher Weise Emotionen notwendig sind und wohin eine Übersteigerung bzw. ein Fehlen führen kann. Selbst in der bloßen Rezeption solcher Werke findet eine Auseinandersetzung mit der eigenen Emotionalität statt. Dies wird gesteigert, wenn man selber aktiv an einer produzierenden ästhetischen Praxis beteiligt ist. Insbesondere ist es der Prozess der Selbsterfahrung als wesentlicher Teil der Entwicklung von Bildung (hier: als Entwicklung eines reflektierten Selbstverhältnisses), bei dem ästhetische Praxen eine wichtige Rolle spielen. So gilt nicht nur die Autobiographie als Element der „Entdeckung des Individuums“ (Burckhardt), sondern als wichtige literarische Form, so wie sie umfassend der Schwiegersohn und Schüler von Wilhelm Dilthey, Georg Misch, in einem mehrbändigen Werk beschrieben hat: Sie ist bis heute und in allen Lebensaltern eine erfolgreiche Methode der Konstitution des Selbst (vgl. Alheit/Brandt 2006; siehe auch das verstörende autobiographische Mammutprojekt des norwegischen Schriftstellers Karl Ove Knausgard). Für den bildkünstlerischen Bereich siehe etwa Schuhmacher-Chilla 1995 für as Theater Kreuder u.a. 2012. 62 Das Gefühl der Achtung als ethische Grundhaltung Der Zusammenhang von Gefühlen mit Ethik und Moral auf der einen Seite und einer ästhetischen Praxis und den Künsten auf der anderen Seite wurde bereits mehrfach angesprochen. Vor diesem Hintergrund sind die Überlegungen von Kesselring (2009, v. a. Kapitel I.4) interessant. Entgegen der hier auch erwähnten Traditionen etwa von Adam Smith (bei dem Sympathie als Fähigkeit ist, sich auf die Gefühle anderer Personen einzulassen) die Grundlage der Moral ist, oder Schopenhauer (bei dem Moral auf dem Gefühl des Mitleids basiert), wehrt Kesselring den Bezug auf zu starke Gefühle als Grundlage der Moral ab. Er schlägt vielmehr vor, Achtung (als Einstellung, die wir anderen Personen aufgrund ihrer Würde entgegenbringen) als Basis zu nehmen. Achtung bedeutet dabei Aufmerksamkeit, die Beachtung von Regeln oder sogar Hochachtung. Moralische Achtung siedelt er dabei zwischen Beachtung und Hochachtung an. Mit einer ästhetischen Praxis hat dies insofern zu tun, als das Erlernen einer spezifischen Aufmerksamkeit gegenüber sich selbst und gegenüber anderen ein Kernelement der ästhetischen Erfahrung ist. . Krisen und ihre Bewältigung Eine besondere Rolle spielt eine Auseinandersetzung mit den Künsten in krisenhaften Situationen. Man kann dabei die sogenannten Entwicklungsaufgaben, mit denen der Mensch im Laufe seines Lebens konfrontiert wird, als solche krisenhaften Situationen beschreiben. Es geht dabei darum, dass man erlebt, dass man durch Veränderungen der eigenen Person oder durch gravierende Veränderungen im Umfeld gezwungen ist, seine Einstellung zum Leben zu überdenken und gegebenenfalls zu verändern. Beispiele sind etwa die Übergänge, etwa der Übergang in eine Kindertagesstätte, der spätere Übergang zur Schule, der Übergang von der Grundschule zu einer weiterführenden Schule, der Übergang von der Schule zum Beruf oder zum Studium. Weitere Entwicklungsaufgaben sind die Bewältigung der Pubertät, das Eingehen von Lebenspartnerschaften, Elternschaft, die Verarbeitung von Trauer, wenn nahe Verwandte sterben, berufliche Rückschläge oder Karrieresprünge, der Übergang vom Beruf in die Rente, das Erleben des Abbaus körperlicher Leistungsfähigkeit, lebensbedrohende Krankheiten etc.. In all diesen Fällen muss man emotional die Situation verarbeiten, wobei es vielfältige Erfahrungen gibt, dass eine Auseinandersetzung mit den Künsten und dass eine ästhetische Praxis ausgesprochen hilfreich bei der Bewältigung solcher Entwicklungsaufgaben sein können. 63 Vor dem Hintergrund reichhaltiger pädagogischer Erfahrungen mit einem Einfluss einer ästhetischen Praxis auf die Entwicklung der Emotionalität ist es erstaunlich, dass diese Erfahrungen bislang ausgesprochen selten zum Gegenstand von Forschungsprojekten speziell von Projekten der Wirkungsforschung geworden sind. So gab es zwar ambitionierte Projekte, die eine positive Wirkung einer musikalischen Praxis auf die kognitiven Leistungen nachweisen wollten (etwa die berühmten Bastian-Studien: „Mozart macht schlau“). Auch gibt es zahllose Wirkungsstudien im angloamerikanischen Bereich, die den Nachweis zum Ziel haben, dass eine ästhetische Praxis positive Wirkungen bei der Verbesserung kognitiver Leistungen hat. Doch muss man sehen, dass – obwohl dies sicherlich der Fall ist – andere Bereiche der Persönlichkeit wie etwa die Emotionalität eine sehr viel größere Affinität zu einer ästhetischen Praxis haben. Daher ist es ausgesprochen sinnvoll, die Bemühungen der Forschungen in diesem Feld zu verstärken. 7. Anhang Emotionen und andere Dimensionen der Persönlichkeit - Notizen Pervin (2000, 40) schreibt: „Zur Persönlichkeit gehören Kognitionen (Denkprozesse), Affekte (Emotionen, Gefühle) und offen sichtbare Verhaltensweisen.“ Dies bedeutet, dass zumindest neben den Emotionen auch die beiden anderen genannten Bereiche entsprechend untersucht werden müssten, wenn man die Rolle des Ästhetischen bei der Entwicklung der Persönlichkeit untersuchen will. Dies kann hier nicht geschehen, zumal auch andere Felder und Dimensionen der Persönlichkeit zu berücksichtigen wären: Motivation und Volition, der Bereich der Fantasie und der Einbildungskraft, das Feld der Moral und der Bereich praktischer Kompetenzen. Pervin beschreibt sechs Gruppen von Persönlichkeitstheorien: Ansätze der Psychoanalyse,, Theorien aus dem Bereich der humanistischen Psychologie (Rogers: Selbstverwirklichung, Wertschätzung; Maslow und Goldstein), Theorien der Wesenszüge den sich darauf stützenden Ansatz der Konzeption der Big Five, lerntheoretische Ansätze (Skinner), kognitivistische Theorien (Kelly) und schließlich sozial-kognitivistische Theorien (Bandura: Modelllernen, Selbstwirksamkeitstheorie; Mischel). 64 Im Folgenden will ich einige Stichworte zu dem Zusammenhang des Ästhetischen mit weiteren Dimensionen der Persönlichkeit angeben, allerdings ohne systematischen Anspruch, sondern eher als Impulse und Erinnerungen an bekannte Tatbestände. Ästhetik und Moral Zu dem Bereich der Moral und ihrer Beziehung zum Ästhetischen konnten in dem voranstehenden Text immer wieder Hinweise auf enge Zusammenhänge mit der Emotionalität des Menschen gegeben werden. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Zusammenhang zwischen Kunst und Moral habe ich in Fuchs 2011 vorgenommen. Man kann zeigen, dass bis zur Jahrhundertwende 1800 die enge Verbindung zwischen beiden Bereichen völlig unproblematisch und für alle Beteiligten selbstverständlich war. Erst mit dem Aufkommen der Autonomiethese wurde dieser Zusammenhang immer wieder infrage gestellt. Doch entspricht es bis heute im Selbstverständnis vieler Künstlerinnen und Künstler - und es wird auch so in einigen Kunsttheorien und Ästhetik formuliert -, dass eine Trennung dieser beiden Bereiche weder der moralischen noch der ästhetischen Praxis gerecht wird. Kognition Wer unter dem Stichwort, Kognition (cognoscere = erkennen, erfahren, kennenlernen) bei Wikipedia nachschaut, wird mit der folgenden Aufzählung kognitiver Fähigkeiten des Menschen konfrontiert: Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Erinnerung, Lernen, Problemlösen, Kreativität, Planen, Orientieren, Imagination, Argumentation, Introspektion, Wille, Glauben. Offenbar handelt es sich hierbei um einen weiten Begriff von Kognition, der einige der Persönlichkeitsdimensionen, die oben aufgelistet worden sind (etwa Imagination und Kreativität oder Wille/Volition) mit erfasst, der weit über rationale Fähigkeiten und Tätigkeiten im engeren Sinn (Denken, Begreifen, Urteilen, Argumentieren etc.) hinausgeht und sich mit dem Bereich des Emotionalen überschneidet. Dies deckt sich insofern mit hier vorgestellten Theorien der Emotionalität, die eine zu rigide Trennung von Emotionalität und Rationalität ablehnen. In der Geschichte des Ästhetischen gibt es zudem viele Beispiele, die einen engen Zusammenhang von Kunst und Rationalität belegen. Dies beginnt schon mit der ersten Theorie zur Musik bei Pythagoras, der im Rahmen seiner Theorie, dass sich alles in der Welt als Verhältnis ganzer Zahlen darstellen lässt, dies am Beispiel des Verhältnisses der Tonhöhen mit der jeweiligen Länge einer angeschlagenen Saite zeigte. Musik war als Teil des Lehrplanes (sieben freie Künste) bis ins hohe Mittelalter im wesentlichen Musiktheorie (und keine 65 Musikpraxis), und diese Musiktheorie war Mathematik. Auch in den astronomischen Überlegungen von Kepler spielte der Gedanke (musikalischer) Sphären eine zentrale Rolle. In der bildenden Kunst wiederum arbeiteten die Universalgenies der Renaissance mit der engen Verknüpfung der Mathematik (Proportionen, Perspektiven) mit der malerischen Darstellung. Bekanntlich ging Albrecht Dürer nach Italien, um diese enge Verknüpfung und die entsprechenden Lehren der Italiener besser kennen zu lernen. In dieser Zeit wurde auch die Zentralperspektive als zugleich ästhetisches und mathematisches Prinzip erfunden. Zudem spielten bei der Definition von „Schönheit“ lange Zeit mathematisch darstellbare Proportionen eine zentrale Rolle (vgl. den Beitrag von Thomas Weth: Die Schönheit der Mathematik in Fuchs/Braun 2015). Die Rolle des Körpers bzw. des Leibes wird zudem dort deutlich, wo man über tänzerische Bewegungen mathematische Strukturen lernen kann. Solche Ansätze spielen dort eine Rolle, wo man versucht, künstlerische Methoden in nicht künstlerischen Unterrichtsfächern anzuwenden (siehe die Beiträge in Teil 3 von Fuchs/Braun 2015). Soziabilität Es wurden oben zahlreiche Emotionen vorgestellt, die nicht nur nach außen gerichtet sind, sondern die sich speziell mit der sozialen Welt befassen (Empathie und Sympathie, Liebe und Hass, Neid und Eifersucht, Vertrauen, Toleranz, Konfliktfähigkeit etc.). Es wurde zugleich gezeigt, dass solche Emotionen immer wieder zum Gegenstand der Künste werden. Gerade in diesem Feld gibt es zudem interessante aktuelle Studien im Kontext der evolutionären Anthropologie, die die Grundlagen und Bedingungen von Kooperation untersuchen. Phantasie und Einbildungskraft Der griechische Begriff der Phantasie (lat.: imaginatio) wurde erst im Spätmittelalter von Paracelsus mit „Einbildungskraft“ ins Deutsche übersetzt. Er gehört zu den Begriffen, die in der Geschichte nicht bloß einen Bedeutungswandel erfahren haben – das dürfte für alle philosophischen Begriffe gelten: Er wurde im Laufe der Geschichte geradezu in sein Gegenteil verkehrt. Aristoteles bestimmte Phantasie als einen im Grunde animalischen und daher rational zu kontrollierenden psychischen Vorgang (Schulte-Sasse 2002, 779). Über Jahrhunderte weg verlor Phantasie ihren kognitiven und moralischen Makel nicht. Man sah in ihr die Ursache dafür, dass durch die Herstellung diffuser Wunschbilder eine wahre Erkenntnis verhindert wird. Erst mit der Rehabilitation der Sinnlichkeit durch Alexander Baumgarten Mitte des 18. Jahrhunderts konnte sie diesen Makel verlieren und 66 wurde zunehmend zu einem Kernbegriff insbesondere des künstlerischen Schaffens. So kann man sie als Fähigkeit betrachten, abwesende oder fiktive Objekte oder Tatbestände sich vorzustellen. (Trebeß 2006, 89). Allerdings fielen die Begriffe der Phantasie und der Einbildungskraft zunächst einmal auseinander: Während Phantasie die domestizierungsbedürftige Disposition des Menschen blieb, sah man in der Einbildungskraft ein notwendiges Vermögen zur Vermittlung von Sinneswahrnehmungen mit einem geordneten intellektuell erfassten Ganzen. Erst mit der Romantik wurde Phantasie als kreatives Vermögen rehabilitiert. Allerdings blieb bis in die Studentenbewegung des 20. Jahrhunderts die Assoziation mit wildem, kritischem, nichtkonformem Denken erhalten, was seinen Ausdruck in dem berühmten Kampfruf fand: Die Phantasie an die Macht. (Schulte-Sasse 2000) Man muss davon ausgehen, dass es genau diese kritische und soziale Phantasie ist, die unter der Perspektive der Macht diejenigen, die bislang die Macht haben, nicht zu Anhängern einer solchen Phantasie macht. Denn es geht um Veränderung des Bestehenden. Die Orientierung auf ein zu entwickelndes Neues in sozialer und politischer Hinsicht, durchaus aber auch im Hinblick auf die Wissenschaften und Künste, zieht also notgedrungenerweise Skepsis oder sogar Feindschaft auf sich. So war es im Mittelalter sogar verboten, im Handwerk Innovationen einzuführen, und dies aus dem guten Grund, weil Innovation eine Rationalisierung bedeuten würde, die das bestehende Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage stören würde. Man muss also sehen, dass es durchaus von kulturellen, sozialen und politischen Rahmenbedingungen abhängt, welchen Stellenwert eine Orientierung auf Neues hat und in welchen Bereichen Neues erwünscht und wo es verpönt ist. Es kann dabei auch gute Gründe dafür geben, nicht um jeden Preis zu neuen Ideen zu ermutigen. Es war daher durchaus mutig, wenn sich Philosophen und Wissenschaftler darum bemüht haben, eine ars inveniendi, also eine Erfindungskunst, zu entwickeln. Wie vieles hatte eine solche Erfindungskunst ihre Wurzeln in der Antike, wobei es darum ging, im Rahmen der Rhetorik gute Gründe für die Unterstützung eigener Thesen zu finden. Mit Beginn der Neuzeit ging es dann darum, neues Wissen zu generieren. Dazu gehörte eine neue und offene Haltung gegenüber sich selbst und der Welt. Leibniz hat sich in dieser Hinsicht – wie in vielen anderen Wissensgebieten – hervorgetan. Neues zu denken heißt in erkenntnistheoretischer Sicht, neue Wahrheiten zu finden, was eine gewisse Unzufriedenheit mit bestehenden Wahrheiten voraussetzt. Neues zu denken heißt in ontologischer Sicht, andere Wirklichkeiten vorstellbar zu machen. Neues zu denken bedeutet dann auch, sich von der Gegenwart des Seienden zu lösen, so dass hierbei die Kategorie des Scheins und des Erscheinens ins Spiel kommt. 67 Hierbei gibt es also eine Verwandtschaft mit den Utopien, wie sie von Thomas Morus, Campanella oder Francis Bacon im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit entwickelt wurden. Die Entwicklung von utopischen Vorstellungen einer Gesellschaft, so wie es sie in der Vergangenheit und in der Gegenwart noch nicht gegeben hat bzw. gibt, bedeutet einen spezifischen Umgang mit der Zeit: Utopisches Denken ist Denken in Kategorien der Zukunft. In der Literatur ist es insbesondere Robert Musil, der von einem Möglichkeitsdenken spricht. Phantasie und Einbildungskraft gehören daher in ein Wortfeld, zu dem, Erfindungsgeist, Vorstellungsvermögen, Innovation, Möglichkeitsdenken, Imagination und auch Kreativität gehören. Heute spricht man kaum noch von Einbildungskraft und nur noch selten von Phantasie: Der Kreativitätsbegriff hat offensichtlich die beiden anderen Begriffe verdrängt. In vielen Ländern – vor allem im angloamerikanischen Raum – gibt es geradezu einen Hype rund um das Konzept der Kreativität. Der Kreativitätsbegriff stellt zwar zum einen eine Verbindung zu dem lateinischen creatio her, also eine Assoziation mit dem christlichen Schöpfergedanken, der ebenfalls seit der Romantik in Bezug auf die Künste und die Künstlerinnen und Künstler verwendet worden ist („Kunstreligion“). Es gibt allerdings auch erhebliche Vorbehalte. Ein erster Vorbehalt betrifft seine Genese, nämlich eine amerikanische Psychologie im Dienste des Kalten Krieges und des Militärs. In den letzten Jahrzehnten ist der Kreativitätsbegriff zudem zu einem Kernbegriff in der Ökonomie und speziell der Wirtschaftspolitik geworden („creative industries“). Genau diese Bedeutungszuweisung ist aber das genaue Gegenteil dessen, was mit dem oben dargestellten Charakter einer kritischen Phantasie verbunden worden ist: Es geht quasi um eine Enteignung und Funktionalisierungen schöpferischer Potenzen des Menschen. 68 8. Literatur Alheit, Peter/Brandt, Morton (2006): Autobiographie und ästhetische Erfahrung. Entdeckung und Wandel des Selbst in der Moderne.. Frankfurt/M.-New York: Campus. Allesch, Christian (1987): Geschichte der psychologischen Ästhetik. Göttingen: Hogrefe. Allesch, Christian (2006): Einführung in die psychologische Ästhetik. Wien: WUV/UTB. Bertram, Georg (2014): Kunst als menschliche Praxis. Berlin: Suhrkamp. Böhme, Hartmut (2010): Artikel Gefühl. In Wulf 2010, 525 – 547. Bollenbeck, Georg (2007): Geschichte der Kulturkritik. München: Beck. Boltanski, Luc/Chiapello, Eve (2003): Der neue Geist des Kapitalismus. Konstenz: UVA. Brandstädter, Jochen (2011): Positive Entwicklung. Zur Psychologie gelingender Lebensführung. Heidelberg: Spektrum. Brenner, Andres/Zirfas, Jörg (2015): Lexikon der Lebenskunst. Stuttgart: Reclam. Bröckling, Ulrich (2007): Das unternehmerische Selbst. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Brumlik, Micha (2002): Bildung und Glück. Versuch einer Theorie der Tugenden. Berlin/Wien: Philo. Brumlik, Micha/Brunkhorst, Hauke (Hg.)(1993): Gemeinschaft und Gerechtigkeit. Frankfurt/M.: Fischer. Bundesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ, 1998): Lernziel Lebenskunst. Remscheid: BKJ. Burow, Olaf-Axel (2011): Positive Pädagogik. Sieben Wege zur Lernfreude und Schulglück. Weinheim/Basel: Beltz.. Busch, Werner (Hg.)(1987): Funkkolleg Kunst. Frankfurt/M.: Fischer. Damasio, Antonio (1994): Descartes Irrtum. München: List. Delors, Jaques (1997): Lernfähigkeit: Unser verborgener Reichtum. Neuwied: Luchterhand. Delumeau, Jean (1985): Angst im Abendland. Die Geschichte kollektiver Ängste im Europa des 14. Bis 18. Jahrhunderts. 2 Bde. Reinbek: Rowohlt. 69 Demmerling, Christoph/Landweer, Hilge (Hg.)(2007): Philosophie der Gefühle. Stuttgart: Metzler. Dinzelbacher, Peter (Hg.)(1993): Europäische Mentalitätsgeschichte. Stuttgart: Kröner. Döring, Sabine (Hg.)(2009): Philosophie der Gefühle. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Ehrenberg, Alain (2015): Das erschöpfte Selbst. Depression und Gesellschaft in der Gegenwart. Frankfurt/M.: Campus. Endress, Martin (2002): Vertrauen. Bielefeld: transcript. Flam, Helena (2002): Soziologie der Emotionen. Konstanz: UVK. Frevert, Ute (2013): Vergängliche Gefühle. Göttingen: Wallstein. Frevert, Ute (2013): Vertrauensfragen. Eine Obsession der Moderne. München: Beck. Frevert, Ute/Wulf, Christoph (Hg.)(2012): Die Bildung der Gefühle .Sonderheft 16 der ZfE, Wiesbaden: Springer. Fuchs, Max (1984): Das Scheitern des Philanthropen Ernst Christian Trapp. Weinheim/Basel: Beltz. Fuchs, Max (1998): Mensch und Kultur. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. Fuchs, Max (2014): Subjektivität heute. München: Utz. Fuchs, Max (2011): Kunst als kulturelle Praxis. München: Kopaed. Fuchs, Max (2016): Das starke Subjekt. München: Kopaed. Fuchs, Max/Braun, Tom (Hg.)(2016): Die Kulturschule und kulturelle Schulentwicklung, Bd. 2: Zur ästhetischen Dimension von Schule. Weinheim/Basel: Beltz-Juventa. Gerhards, Jürgen (1998): Soziologie der Emotionen. Weinheim/München: Juventa Gerhardt, Volker 1999): Selbstbestimmung. Stuttgart: Reclam. Gestrich, Andreas (1999): Vergesellschaftung des Menschen. Einführung in die historische Sozialisationsforschung. Tübingen: Ed. Diskord. Gößling, Jürgen (2008): Selbstverhältnisse LS Gegenstand der Erziehungswissenschaft. Münster: Lit. Goleman, Daniel (1997): Emotionale Intelligenz. München: DTV. Hartmann, Martin (1994): Die Praxis des Vertrauens. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Hartmann, Martin/Offe, Claus (2001): Vertrauen. Die Grundlagen des sozialen Zusammenhalts. Frankfurt/M.: Campus. Hartmann, Martin (2010): Gefühle. Wie die Wissenschaften sie erklären. Frankfurt/M.: Campus Hastedt, Heiner (2005): Gefühle. Philosophische Bemerkungen. Stuttgart: Reclam. Heinen, Ulrich (1996): Rubens zwischen Predigt und Kunst. Weimar. 70 Heinen, Ulrich/Thielemann (Hg.)(2001): Rubens Passioni. Die Kultur der Leidenschaften im Barock. Göttingen. Heller, Agnes (1980): Theorie der Gefühle. Hamburg: VSA. Hentig, Hartmut von (1996): Bildung- Ein Essay. München: Hanser. Herding, Klaus/Stumpfhaus, Bernhard (Hg.)(2004): Pathos, Affekt, Gefühl. Die Emotionen in den Künsten. Berlin/New York: de Gruyter. Holodynski, Manfred (2006): Emotionen – Entwicklung und Regulation. Heidelberg: Springer. Holzkamp, Klaus (1973): Sinnliche Erkenntnis – Historischer Ursprung und gesellschaftliche Bedeutung von Wahrnehmung. Frankfurt/M.: Athenäus. Holzkamp, Klaus (1984): Grundlegung der Psychologie. Frankfurt/M.: Campus. Honneth, Axel (1994): Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Hurrelmann, Klaus/Grundmann, Matthias/Walper, Sabine (Hg.)(2008): Handbuch Sozialisationsforschung. Weinheim/Basel: Beltz. Illouz, Eva (2003): Der Konsum der Romantik. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Jaeger, Siegfrie/Staeuble, Irmingard (1978): Die gesellschaftliche Genese der Psychologie. Frankfurt/M.: Campus. Jüttemann, Gerd/Sonntag, Michael/Wulf, Christoph (Hg.)(2005): Die Seele. Ihre Geschichte im Abendland. Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht. Kahle, Gerd (1981): Logik des Herzens. Die soziale Dimension der Gefühle. Frankfurt: M.: Suhrkamp. Kahle, Gerd (1983): Handlung, Emotion, Selbst. Diss. Universität Bayreuth. Kast, Verena (1996): Neid und Eifersucht. Die Herausforderung durch unangenehme Gefühle. Zürich/Düsseldorf: Walter. Kesselring, Thomas (2006): Handbuch Ethik für Pädagogen. Grundlagen und Praxis. Darmstadt: WBG. Kleimann, Bernd (2002): Das ästhetische Weltverhältnis. München: Fink. Kliche, Dieter (2002): Artikel Passion/Leidenschaft. In: Barck, Karlheinz u.a. (2002): Ästhetische Grundbegriffe, Bd.4. Stuttgart: Metzler. Klinger, Cornelia (1995): Flucht, Trost, Revolte. München/Wien: Hanser. Klinger, Cornelia (2002): Artikel "Modern/Moderne/Modernismus" in Barck, Karlheinz u. a. (Hg.)(2002): Ästhetische Grundbegriffe, Bd. 4. Stuttgart: Metzler. Klinger, Cornelia (2013): Für sich selbst sorgen oder Sozialtechnologie. Das Subjekt zwischen liberaler Tradition und Neoliberalismus. Vortrag in Linz am 20.3.2013. (Veröffentlicht auf youtube) 71 König, Helmut (1992): Zivilisation und Leidenschaften. Die Masse im bürgerlichen Zeitalter. Reinbek: Rowohlt. Koppe, Franz (Hg.)(1993): Perspektiven der Kunstphilosophie. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Krathwohl, David/Bloom, Benjamin/Masia, Bertram (1969): Taxonomy of Educational Objectives. Handbook II: Affective Domain. New York: McKay. Kreuder, Friedemann/Bachmann, Michael/Pfahl, Julia/Volz, Dorothea (Hg.)(2012): Theater und Subjektkonstitution. Bielefeld: transcript. Landweer, Hilge/Renz, Ursula (Hg.)(2008): Klassische Emotionstheorien. Berlin/New York: de Gruyter. LeDoux, Joseph (1998): Im Netz der Gefühle. Wie Emotionen entstehen. München: Hanser. Luhmann, Niklas (1994): Liebe als Passion. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Luhmann, Niklas (1989): Vertrauen. Ein Mechanismus zur Reduktion von Komplexität. Stuttgart: UTB. Meier-Seethaler, Carola (2001): Gefühl und Urteilskraft. Ein Plädoyer für die emotionale Vernunft. München: Beck. Merker, Barbara (Hg.)(2009): Leben mit Gefühlen. Emotionen, Werte und ihre Kritik. Paderborn: Mentis. Münchmeier, Richard (Hg.)(2002): Bildung und Lebenskompetenz. Opladen: Leske und Budrich. Nucci, Larry/Narvarez, Darcia (2009): Handbook of Moral and Character Education. New York/London: Rouledge. Nussbaum, Martha (2001): Upheavels of Thought. The Intelligence of Emotions. Cambridge: University Press. Nussbaum, Martha (2014): Politische Emotionen. Warum Liebe für die Gerechtigkeit wichtig ist. Berlin: Suhrkamp. Otto, Jürgen/Euler, Harald/Mandl, Heinz (Hg.)(2000):Emotionspsychologie. Ein Handbuch. Weinheim: Beltz. Pervin, Lawrence (2000): Persönlichkeitstheorien. München/Basel: Reinhardt. Petzold, Hilarion (Hg.)(1995): Die Wiederentdeckung des Gefühls. Paderborn: Jungfermann. Reckwitz, Andres (2006): Das hybride Subjekt. Weilerswist: Velbrück. Reinhard, Wolfgang (2004): Lebensformen Europas. Eine historische Kulturanthropologie. München: Beck. Ritter, Joachim (Hg.)(1971): Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 1. Darmstadt: WBG. Roth, Gerhard (2001): Fühlen, Denken, Handeln. Frankfurt/M.: Suhrkamp. 72 Ruppert, Rainer (1995): Labor der Seele. Funktionen des Theaters im 18. und frühen 19. Jahrhundert. Berlin: Sigma. Scarry, Elaine (1992): Der Körper im Schmerz. Frankfurt/M.: Fischer. Scheer, Brigitte (2001): Gefühl. In: Barck, Karlheinz u.a. (Hg.)(2001): Ästhetische Grundbegriffe. Bd. 2: Stuttgart: Metzler. Scherke, Katharina (2009): Emotionen als Forschungsgegenstand der deutschsprachigen Soziologie. Wiesbaden: VS. Schmidt, Robert (2012): Soziologie der Praktiken. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Schoeck, Helmut (1987): Der Neid und die Gesellschaft. Berlin: Ullstein. Schützeichel, Rainer (Hg.)(2006): Emotionen und Sozialtheorie. Frankfurt/M.: Campus. Schuhmacher-Chilla, Doris (1995): Ästhetische Sozialisation und Erziehung. Berlin: Reimer. Schulte-Sasse, Jochen (2000): Arikel „Einbildunskraft“ und „Phantasie“ in Barck, Karlheinz u. a. (Hg.): Ästhetische Grundbegriffe, Bd. 2 (Einbildungskraft) und Band 4 (Phantasie). Stuttgart: Metzler. Schulze, Ralf/Freund, P. Alexander/Doberts, Richard (Hg.)(2006): Emotionale Intelligenz. Ein internationales Handbuch. Göttingen usw.: Hogrefe. Seel, Martin (1996): Ethisch-ästhetische Schriften. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Sennett, Richard (2002): Respekt im Zeitalter der Ungleichheit. Berlin: Berlin-Verlag. Shusterman, Richard (2002): Philosophie als Lebenspraxis. Berlin: Akademie-Verlag. Sousa, Ronald de (1997): Die Rationalität des Gefühls. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Stalfort, Jutta (2013): Die Erfindung der Gefühle. Eine Studie über den historischen Wandel menschlicher Emotionalität (1750 – 1850). Bielefeld: transcript. Taylor, Charles (2009): Ein säkulares Zeitalter. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Trebeß, Achim (Hg.)(2006): Metzler Lexikon Ästhetik. Stuttgart: Metzler. Ulich, Dieter (1989): Das Gefühl. Eine Einführung in die Emotionspsychologie. München: PVU. Vester, Heinz-Günther (1991): Emotion. Gesellschaft und Kultur. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. Vester, Heinz-Günther (1996): Kollektive Identitäten und Mentalitäten. Frankfurt/M.: IKO. Winner, Ellen (1982): Invented Worlds. The Psychology of Arts. Cambridge: Harvard University Press. Wulf, Christoph (Hg.)(2010): Der Mensch und seine Kultur. Köln: Anaconda (Seitenidentischer Nachdruck des Buches „Vom Menschen“, 1997). Wulf, Christoph/Zirfas, Jörg (Hg.)(2014): Handbuch pädagogische Anthropologie. Wiesbaden: Springer. 73