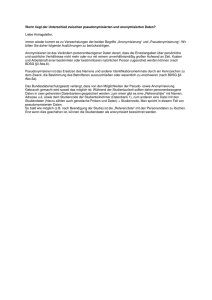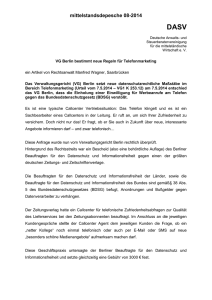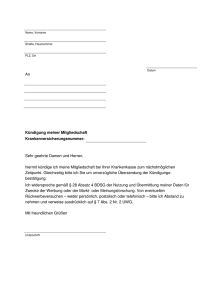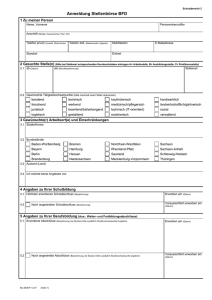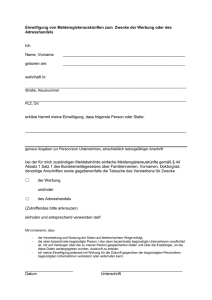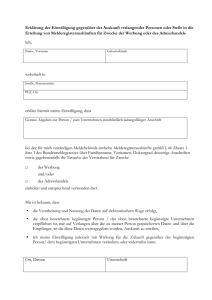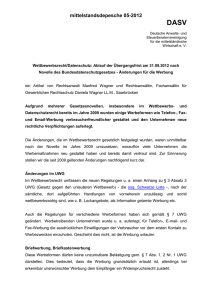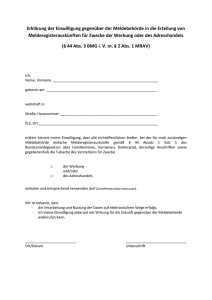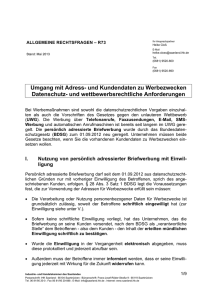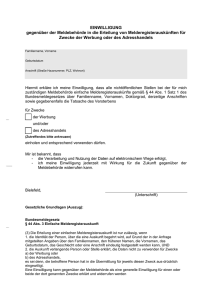Original Downloaden
Werbung
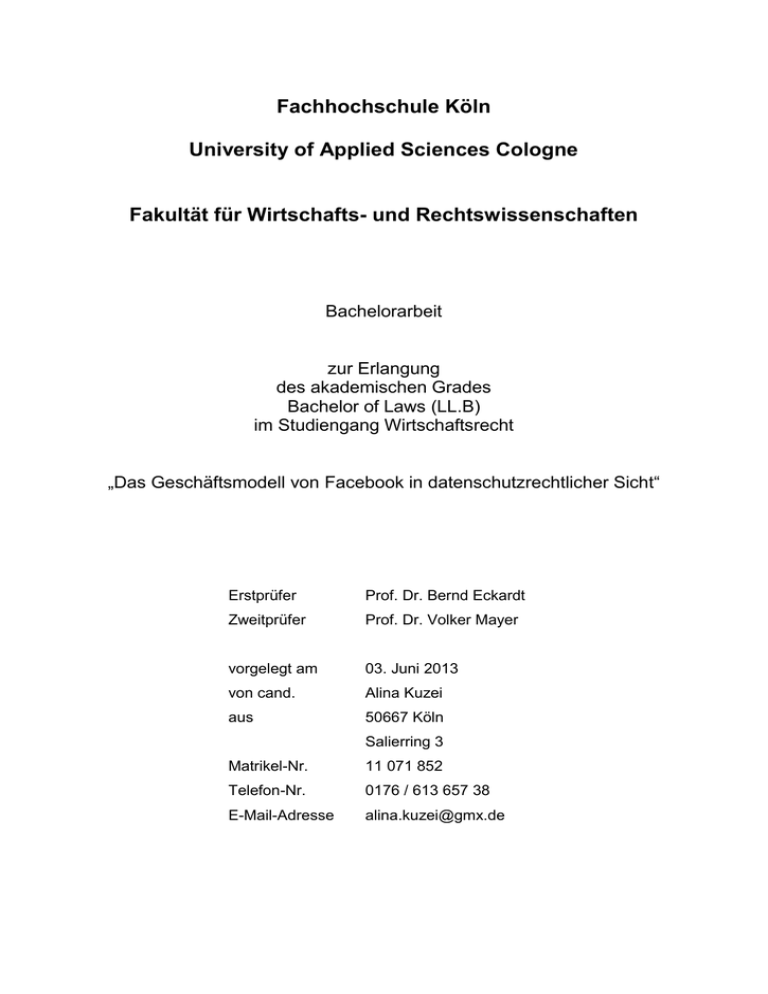
Fachhochschule Köln University of Applied Sciences Cologne Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Laws (LL.B) im Studiengang Wirtschaftsrecht „Das Geschäftsmodell von Facebook in datenschutzrechtlicher Sicht“ Erstprüfer Prof. Dr. Bernd Eckardt Zweitprüfer Prof. Dr. Volker Mayer vorgelegt am 03. Juni 2013 von cand. Alina Kuzei aus 50667 Köln Salierring 3 Matrikel-Nr. 11 071 852 Telefon-Nr. 0176 / 613 657 38 E-Mail-Adresse [email protected] I Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis ........................................................................................I Abbildungsverzeichnis ............................................................................... III Abkürzungsverzeichnis ............................................................................. IV 1. 2. Einleitung ...........................................................................................1 1.1 Problemstellung und Relevanz .................................................2 1.2 Vorgehensweise der Arbeit .......................................................2 Das Geschäftsmodell von Facebook ..................................................3 2.1 Die Facebook Incorporated .......................................................3 2.1.1 Die Facebook Ireland Limited ........................................4 2.1.2 Die Facebook Germany GmbH .....................................4 2.2 Die Funktionen des sozialen Netzwerks....................................5 2.2.1 Nutzungs,- Schattenprofile und personalisierte Werbung........................................................................6 2.2.2 Der Social Plugin „Like-Button“ .................................... 10 3. 4. Datenschutzrechtliche Grundbegriffe ............................................... 13 3.1 Deutsches Datenschutzrecht .................................................. 13 3.2 Personenbezogene Daten ...................................................... 15 3.3 Automatisierte Verarbeitung.................................................... 16 3.4 Einwilligung ............................................................................. 18 Wo beginnt das Datenschutzproblem bei Social Plugins .................. 18 4.1 Übermittlung personenbezogener Daten in einen Drittstaat? Welches Recht findet Anwendung .......................................... 19 4.2 Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten ......... 22 4.2.1 Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit des Webseitenbetreibers.................................................... 23 II 4.2.2 Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit Facebooks .. 26 4.3 Erstellen von Nutzungsprofilen ............................................... 28 4.3.1 Nutzungsprofil durch Like-Buttons ............................... 28 4.3.2 Nutzungsprofil durch Zustimmung von Dritten ............. 31 4.4 Löschungspflicht ..................................................................... 32 4.5 Lösungsvorschläge für datenschutzkonformes Verhalten ....... 32 4.5.1 Lösungsvorschläge für Facebook ................................ 33 4.5.2 Lösungsvorschläge für Facebook-Nutzer .................... 36 5. Urteil des LG Berlin vom 30.04.2013................................................ 36 5.1 Anwendbares Recht................................................................ 37 5.2 Datenerhebung Dritter ohne deren Einwilligung ...................... 38 5.3 Datenweitergabe zu Werbezwecken ....................................... 38 5.4 Globale Einwilligung................................................................ 39 5.5 Zusammenführen von Nutzungsdaten mit anderen Informationen .......................................................................... 39 6. Fazit ................................................................................................. 40 Literaturverzeichnis ................................................................................... VI Rechtsprechungsverzeichnis ................................................................... XV Eidesstaatliche Erklärung ........................................................................ XVI III Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Abbildung 2: Abbildung 3: Abbildung 4: Abbildung 5: Abbildung 6: Abbildung 7: Abbildung 8: Bsp. Nutzungsprofil………………………………........ Bsp. Schattenprofil…………………………………….. Schattenprofil von Max Schrems…………………….. Social Plugin von Facebook……….………………..... Facebookprofil der FH Köln…………………………… Praxisbeispiel…………………………………………… Platzhalter statt Like-Button…………………………... Platzhalter und datenschutzrechtliche Belehrung...... S.07 S.08 S.09 S.11 S.12 S.13 S.34 S.35 IV Abkürzungsverzeichnis a.a.O. Abs. AG AGB Art. ASF Az. BDSG BeckRS BFDI BGB BMWI CD Co. DANA DDR DuD ebd. EG EU EU-DSRL et al. e.V. EWR f. ff. FAZ FDC FH gem. GG Hrsg. HS. Inc. IP IT Kap. KSt. LDSG Lfg. LG Ltd. am angegebenen Ort Absatz Amtsgericht Allgemeine Geschäftsbedingungen Artikel Aktion Sühnezeichen Friedendienste Aktenzeichen Bundesdatenschutzgesetz Beck-Rechtsprechung Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Bürgerliches Gesetzbuch Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Compact Disc compagnie Die Datenschutznachrichten Deutsche Demokratische Republik Datenschutz und Datensicherheit ebenda Europäische Gemeinschaft Europäische Union Europäische Datenschutzrichtlinie et alia (aus dem lateinischen: und andere) eingetragener Verein Europäischer Wirtschaftsraum folgende die folgenden Frankfurter Allgemeine Zeitung Federal Trade Commission Fachhochschule gemäß Grundgesetz Herausgeber Halbsatz Incorporated Internetprotokoll Information Technology Kapitel Körperschaftssteuer Landesdatenschutzgesetz Lieferung Landgericht Limited V MMR NJOZ NJW NVwZ OVG PC RA RDV Rn. S. s. TKG TMG ULD USA VG vs. VZBV VZU ZD MultiMedia und Recht Neue Juristische Online Zeitschrift Neue Juristische Wochenschrift Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht Oberverwaltungsgericht Personal Computer Rechtsanwalt Recht der Verarbeitung Randnummer Satz siehe Telekommunikationsgesetz Telemediengesetz Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz United States of America Verwaltungsgericht versus Verbraucherzentrale Bundesverband Volkszählungsurteil Zeitschrift für Datenschutz 1 1. Einleitung “The question isn't, What do we want to know about people?, It's, What do people want to tell about themselves?” 1 In der Bundesrepublik Deutschland besitzen 80% der deutschen Bevölkerung über dem 14ten Lebensjahr einen Internet-Zugang.2 Das Internet hat sich bei den meisten Menschen zu einem erweiterten Lebensraum entwickelt und es gibt kaum noch jemanden, der behaupten kann nicht Mitglied eines sozialen Netzwerks zu sein.3 Das Teilen4 von privaten Fotos, Videos, Musikclips, und anderen Vorlieben wird durch soziale Netzwerke ermöglicht und unterstützt. Xing, Twitter, Google+, und verschiedene Kontaktbörsen sind nur wenige bekannte Beispiele. Aber das auf der Welt am meisten genutzte soziale Netzwerk ist Facebook.5 Die Nutzerzahlen liegen bei einer Milliarde weltweit und etwa 25 Mio. Nutzer sind allein in Deutschland registriert worden.6 Bei einer Einwohnerzahl von ca. 82 Mio.7, macht das 30% der Bevölkerung Deutschlands aus. Viele Menschen nutzen dieses Netzwerk, wissen jedoch nicht, dass Facebook ihre Daten für immer speichert, ggf. an Dritte weiterleitet, oder dafür nutzt, um daraus Nutzungsprofile zu generieren, um personalisierte Werbung zu schalten. Die Währung mit der man nämlich heutzutage im Internet bezahlt, sind personenbezogene Daten.8 Demzufolge häufen sich Negativmeldungen zum Thema Datenschutz und Wahrung des Persönlichkeitsrechts der Bürger Deutschlands. 1 Übersetzt: Die Frage lautet nicht, Was wollen wir über die Menschen wissen, sondern was wollen die Menschen uns über sich erzählen. v. Marc Zuckerberg, Marc Zuckerberg Quotes. 2 Vgl. Schmölz, Die DIVSI-Milieu-Studie, RDV, S. 290. 3 Vgl. Kurz,Rieger, Die Datenfresser, S. 77. 4 Teilen (von „to share“ aus dem Englischen) bedeutet auf der eigenen Profilseite veröffentlichen. 5 Vgl. Grabs/Bannour, Follow me!, S. 214. 6 Vgl. Buggisch, Social Media Nutzerzahlen in Deutschland – Update 2013. 7 Vgl. Tatsachen über Deutschland, Bevölkerung. 8 Vgl. Weichert, Datenschutzverstoß als Geschäftsmodell – der Fall Facebook, DuD, S. 716. 2 1.1 Problemstellung und Relevanz Das Datenschutzrecht ist im ständigen Wandel und muss mit den fortlaufenden Entwicklungen in der virtuellen Welt mithalten.9 Insbesondere das europäische Datenschutzrecht ist zum derzeitigen Zeitpunkt, eines der größten Diskussionsthemen. Am 13. und 14. März 2013 trafen sich die deutschen Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder zur zum 85. Mal zu einer Konferenz, um sich mit dem oben genannten Thema auseinanderzusetzen.10 Speziell die sozialen Netzwerke waren Mittelpunkt der Debatte, denn es hieß, diese bräuchten „Leitplanken“ im Umgang mit dem Datenschutz.11 In diesem Zusammenhang wurde vom Gesetzgeber verlangt, die Gesetzeslücken, die es sozialen Netzwerken erlauben gegen das Datenschutzrecht zu verstoßen, zu schließen. Besonders Facebook fällt im datenschutzrechtlichen Bereich besonders negativ auf. Auch andere Verstöße standen in der Vergangenheit zur Diskussion und tun es noch immer. Es reichte von möglichen Wettbewerbsverstößen12 über Urheberrechtverletzungen13, bis hin zu Datenschutzverstößen14, die entweder durch Facebook selbst, oder durch dessen Nutzer vorgenommen wurden. Diese Arbeit wird sich mit dem datenschutzrechtlichen Teil der Verstöße von Facebook befassen und in diesem Zusammenhang untersuchen, ob nur Facebook allein, oder auch die Nutzer eine Teilschuld bei den Verstößen tragen. 1.2 Vorgehensweise der Arbeit Im Kapitel 2. wird das Geschäftsmodell Facebook vorgestellt und beschrieben. Zur Konkretisierung der Thematik beinhaltet Kapitel 3. die datenschutzrechtlichen Grundbegriffe. Der in Kapitel 4. behandelte Hauptteil wird sich mit der Frage auseinandersetzen, ob Facebook gegen deutsche Rechtsvorschriften verstößt und wo der Verstoß beginnen könnte. Unterschieden wird zwischen der Übermittlung der Daten in ei9 Vgl. Schwenke, Social Media Marketing & Recht, S. 372. Vgl. Pressemitteilung bfdi vom 14.03.2013. 11 Vgl. Pressemitteilung bfdi vom 14.03.2013. 12 Vgl. LG Berlin, Az. 16 O 551 /10, Telemedicus. 13 Vgl. AG München, 158 C 28716/11, BeckRS, 2012, 17813. 14 Vgl. VG Schleswig, 8 B 61/12, BeckRS 2013, 46930.; vgl. OVG Schleswig, 4 MB 11/13, BeckRS 2013, 49919. 10 3 nen Drittstaat und dem in diesem Zusammenhang anwendbaren Recht, der Erhebung und Verarbeitung der Daten, dem Erstellen von Nutzungsund Schattenprofilen, und der Löschpflicht. Weiterhin werden Lösungsvorschläge für datenschutzkonformes Verhalten unterbreitet. Im Kapitel 5. wird das Verhalten von Facebook anhand eines aktuellen Urteils gegen den Konzern Apple.Inc analysiert und versucht Analogien zu Facebook zu ziehen. 2. Das Geschäftsmodell von Facebook Facebook ist das erfolgreichste soziale Netzwerk der Welt.15 Im Folgenden wird näher auf das Geschäftsmodell eingegangen und die Funktion des sozialen Netzwerks beschrieben. 2.1 Die Facebook Incorporated Mark Zuckerberg und 3 weitere Studenten der Harvard University, Boston entwickelten im Jahre 2004 die soziale Plattform thefacebook.com, welche zunächst nur für Studenten der Universität zugänglich war.16 Später wurde der Zutritt zum sozialen Netzwerk auf alle Universitäten in den USA, sowie für Nichtstudenten und Nutzer außerhalb Amerikas erweitert.17 Ab diesem Moment konnte M. Zuckerberg den meisten Erfolg mit dem sozialen Netzwerk verbuchen.18 Ein Jahr darauf verließ M. Zuckerberg die Universität und gründete Facebook Incorporated (Inc.), wie wir es heute kennen, mit Hauptsitz im Stanford Research Park, Kalifornien.19 2008 wurde Facebook in deutscher Sprache eingeführt.20 Der Name „Facebook“, übersetzt „Gesichtsbuch“, ist sinngemäß auf das Jahrbuch21 zurückzuführen, welches für Schüler und Studenten in Amerika dazu dient, vergangene Schuljahre/Semester und damit einhergehenden Höhepunkte festzuhalten. Heutzutage steht Facebook in über 15 Vgl. Adamek,Die Facebook-Falle, S. 15. Vgl. Grabs/Bannour, Follow me!, S. 216. 17 Vgl. Schwindt, Das Facebook-Buch, S. 21. 18 Vgl. Grabs/Bannour, a.a.O., S. 216. 19 Vgl. Kurz,Rieger, Die Datenfresser, S. 77. 20 Vgl. Schwindt, a.a.O., S. 21. 21 s. Juneco e.V., Jahrbücher. 16 4 80. verschiedenen Sprachen zur Verfügung.22 Im Jahr 2012 ging die Plattform an die Börse und musste zum ersten Mal seine Bilanzen offenlegen.23 Es kam heraus, dass es im Jahre 2011 3,7 Milliarden US-Dollar, umgerechnet ca. 2,8 Mrd. Euro erwirtschaftet und 1. Mrd. Dollar, umgerechnet ca. 750 Millionen Euro Gewinn gemacht hat.24 3,15 Mrd. Dollar, demnach 82% des Umsatzes von Facebook wurden durch personalisierte Werbung eingenommen.25 2.1.1 Die Facebook Ireland Limited Einen weiteren Sitz hat Facebook in Irland.26 Den Sitz hat es aus steuerlichen Gründen gewählt, mit dem Ziel Steuern zu vermeiden.27 Im Vergleich zu Deutschland, wo eine Körperschaftsteuer (KSt.), in Höhe von (i.H.v.) ca. 35% anfallen würde, fallen dort lediglich 2-3 % KSt an.28 Die dort betriebene Niederlassung wurde vom Oberverwaltungsgericht Schleswig auch als solche anerkannt, da sie mit dem vorhandenen Personal und den dortigen Einrichtungen jegliche Voraussetzungen für eine solche Niederlassung erfülle.29 Deutsche Datenschützer haben jedoch Schwierigkeiten damit, den Sitz in Irland als eine feste Einrichtung30 zu betrachten und sehen darin lediglich eine Beschwerdestelle31. 2.1.2 Die Facebook Germany GmbH Seit dem 11. Februar 2010 betreibt Facebook eine weitere Niederlassung in Deutschland, in Form einer juristischen Person.32 Doch diesen Sitz hat das OVG Schleswig nicht als eine zulässige Niederlassung in 22 Vgl. Grabs/Bannour, Follow me!, S. 216. Vgl. Kleinz, Die Milliarden-Maschine c´t 12/2012, S. 82 f. 24 Vgl. ebd. 25 Vgl. Weichert, Datenschutzverstoß als Geschäftsmodell – der Fall Facebook, S. 716. 26 Vgl. Facebook, Datenschutzerklärung unter: Impressum. 27 Vgl. Schrems, Universität Passau, Vortrag v. 18./19.0413, ab min. 7:10. 28 Vgl. ebd. 29 Vgl. VG Schleswig, 8 B 61/12, BeckRS 2013, 46930. 30 Vgl. Beschwerdebegründung des ULD zum Beschluss des VG Schleswig, v. 14.02.2012. 31 Vgl. Schwenke, Social Media Marketing & Recht, S. 377. 32 Vgl. ULD, Schreiben vom 18.01.13 an das an das Verwaltungsgericht Schleswig in Verwaltungsrechtssachen gegen Facebook Inc und Facebook Ireland Ltd. 23 5 dem Sinne anerkannt, da diese im Bereich der Anzeigenakquise und des Marketings tätig ist und keine Datenverarbeitung betreibt.33 2.2 Die Funktionen des sozialen Netzwerks Unter einem sozialen Netzwerk im Sinne dieser Arbeit ist eine Internetplattform zu verstehen, durch die Informationen über die eigene Person nach außen getragen und mit seinen virtuellen Freunden geteilt werden kann. Die meisten „Freunde“ kennt man im Normalfall bereits aus dem wahren Leben, was Facebook nutzt, um dem Nutzer die Möglichkeit zu geben, eine virtuelle Kopie seines sozialen Beziehungsumfeldes zu erschaffen.34 Dies erscheint sehr praktisch, da sich durch das Netzwerk oft Menschen wiederfinden, die sich länger nicht gesehen oder gehört haben.35 Oft lernt man allerdings auch neue Menschen über Facebook kennen.36 Auf einer einzigen Plattform wird die Möglichkeit geboten, viele Empfänger zu erreichen.37 Stickiness38 wird der Zustand beschrieben, den Facebook bei seinen Usern schafft,39 da das Löschen des Kontos oder das Wechseln zur Konkurrenz stark erschwert wird, weil die Nutzer in der Regel viel Mühe, Zeit und Informationen in ihr Profil investiert haben.40 Facebook hat sich eine monopolähnliche Stellung aufgebaut,41 was einen Wechsel zu einem anderen Netzwerk nicht nur erschwert, sondern auch nicht sonderlich sinnvoll macht, da dort kaum jemand zu finden sein dürfte.42 33 Vgl. VG Schleswig, 8 B 61/12, BeckRS 2013, 46930; vgl. OVG Schleswig, 4 MB 11/13, BeckRS 2013, 49919. 34 Vgl. Grabs/Bannour, Follow me!, S. 216. 35 Vgl. Grabs/Bannour, a.a.O. 36 Eigene Erfahrung. 37 Vgl. Kurz/Rieger, Die Datenfresser, S. 75. 38 Aus dem englischen: Klebrigkeit. 39 Vgl. Kurz/Rieger, a.a.O. 40 Vgl. ebd. 41 Vgl. Schrems, Auf Facebook kannst du nichts löschen, FAZ. 42 Vgl. Schrems, Universität Passau, Vortrag v. 18./19.0413, ab min. 33:50. 6 2.2.1 Nutzungs,- Schattenprofile und personalisierte Werbung Wie bereits erwähnt, hat Facebook alleine mit zielgerichteter Werbung 82% seines Umsatzes verbucht.43 Das Profil eines Nutzers ist ca. 100 € für Facebook wert.44 Doch wie funktioniert die zielgerichtete Werbung des sozialen Netzwerks: Durch das Sammeln der Daten, erstellt die Plattform im Hintergrund mit dem Analysewerkzeug Insights45, Nutzungsprofile, zugeschnitten auf das Konsumverhalten jedes einzelnen Users.46 Gefällt-Mir Angaben, Besuche auf anderen Webseiten, die mit Facebook durch einen Social Plugin verbunden sind, Verweildauer auf den jeweiligen Seiten, Likes von Fanpages und vieles mehr geben einen Rückschluss auf das Konsumverhalten der Nutzer.47 Durch die Verknüpfung der Cookies, die Facebook bei den Nutzern setzt und den Daten die der Nutzer bei der Registrierung eingegeben hat, sowie den oben genannten Daten, wird zugeschnitten auf die Vorlieben der Nutzer, personalisierte Werbung auf der Facebookseite platziert.48 Nicht selten wundern sich Nutzer in letzter Zeit, warum die eingeblendete Werbung so gut auf die eigenen Interessen passt.49 Soziale Netzwerke werden demnach als die Zukunft der Online-Werbung gesehen.50 Die Abbildung 1 soll die Erstellung eines Nutzungsprofils besser veranschaulichen: Vgl. Weichert, Datenschutzverstoß als Geschäftsmodell – der Fall Facebook, S. 716. 44 Vgl. Weichert, a.a.O. 45 Facebook Insights: Facebook stellt mit Hilfe des Werkzeugs „Insights“ detaillierte Statistikinformationen über Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung, die von Betreibern von Facebook-Seiten (Administratoren von sog. Fanpages) und Facebook-Plattform-Anwendungsentwicklern sowie Webseitenbetreibern, die Funktionen der Facebook-Plattform in ihrer Webseite per SocialPlugin wie dem Like-Button integrieren, abrufbar sind. Diese Statistiken beziehen sich auf authentifizierte Nutzende und die ihnen zugeordneten Facebook-Seiten, Anwendungen oder Webseiten. Sie sind von dafür eingetragenen Administratoren mit Facebook-Konto über https://facebook.com/insights/ abrufbar, ULD, Datenschutzrechtliche Bewertung der Reichweitenanalyse durch Facebook , S. 12. 46 Vgl. Weichert, a.a.O. 47 Vgl. Bauer, Personalisierte Werbung auf Social Community-Websites Datenschutzrechtliche Zulässigkeit der Verwendung von Bestandsdaten und Nutzungsprofilen, MMR, S. 437. 48 Vgl. Niemann/Scholz, Privacy by Design und Privacy by Default – Wege zu einem funktionierenden Datenschutz in Sozialen Netzwerken, in: Peters/Kersten/Wolfenstetter, Innovativer Datenschutz, S. 119; vgl. Tätigkeitsbericht 2013 des ULD, S. 115 f., 7.1.4. 49 Eigene Erfahrung. 50 Vgl. Alex, Marketing-Konzept 2.0, S. 20. 43 7 Abbildung 1: Bsp. Nutzungsprofil51 Bei der Ziffer 1 hat der Nutzer (User) die Macht über sein Profil und kann selbst entscheiden, was er veröffentlicht, teilt oder löscht. Im zweiten Schritt saugt Facebook die Daten des Users auf und erstellt ein weiteres Profil, das analysiert und für personalisierte Werbung genutzt wird.52 Facebook sammelt angeblich selbst von Nichtnutzern Daten und erstellt sogenannte Schattenprofile.53 Max Schrems, ein 25 jähriger Jurastudent aus Wien hat als erster Interessent all seine Daten bei Facebook angefragt und eine CD mit 1222 Seiten Infomaterial zugesandt bekommen, aus welcher sich herausstellte, dass Facebook selbst nach dem Löschen, Daten vorrätig hält.54 Der Student hat mittlerweile 22 Beschwerden gegen den Konzern eingereicht und plant ein Verfahren gegen das Unternehmen einzuleiten.55 Eine der Beschwerden wurde wegen der Erstellung von Schattenprofilen verfasst, in der es heißt, Facebook würde im Hintergrund Daten von Personen sammeln, ohne dass die Betroffenen dies bemerken, oder dem zugestimmt haben.56 Dies ist eine recht neue Information über die Verhaltensweise von Facebook mit Da- 51 Schrems, Universität Passau, Präsentation v. 05.05.2013, S. 13. Vgl. Schrems, Universität Passau, Vortrag v. 18./19.0413, ab min. 6:00. 53 s. Europe vs. Facebook, Anzeigen gegen Facebook, „Schattenprofile“. 54 Vgl. Fichter, Der junge Mann und der Multi, Zeit Online, S. 1. 55 Vgl. Fichter, a.a.O. 56 Vgl. Europe vs. Facebook, a.a.O. 52 8 ten,57 die Max Schrems im Rahmen seiner Untersuchungen zu seinen eigenen Daten aufgefallen ist und betreffe vor allem Personen ohne ein Profil bei Facebook.58 Die Abbildung 2 soll näher beschreiben wie das funktioniert: Abbildung 2: Bsp. Schattenprofil 59 Die folgende Beschreibung der Abbildung 2 entspricht dem Vortrag vom Herrn Schrems auf einem Symposium der Universität Passau60: Die Person in der Mitte besitzt kein Profil bei Facebook.61 Die Freunde der Person sind jedoch Mitglieder von Facebook und haben über die Facebook-App62 ihre Kontakte mit Facebook synchronisieren lassen. Dies funktioniert im Übrigen auch über den E-Mailaccount.63 Durch die Synchronisation mit den Kontakten erhält Facebook über alle Kontakte Informationen, wie den Namen, das Geburtsdatum, die E-Mail-Adresse und vieles mehr. Hier kommt es darauf an, welche Angaben genau die 57 Vgl. Schrems, Universität Passau, Vortrag v. 18./19.0413, ab min. 22:10. Vgl. Europe vs. Facebook, Anzeigen gegen Facebook, „Schattenprofile“ (zuletzt abgerufen am: 22.05.13); vgl. Niemann/Scholz, Privacy by Design und Privacy by Default – Wege zu einem funktionierenden Datenschutz in Sozialen Netzwerken, in: Peters/Kersten/Wolfenstetter, Innovativer Datenschutz, S. 122. 59 Schrems, Universität Passau, Präsentation v. 05.05.2013., S. 48. 60 Vgl. Schrems, Universität Passau, Vortrag v. 18./19.0413, ab min. 22:10. 61 Der Ablauf wäre bei jemandem, der zwar bei Facebook ein Profil hätte, jedoch all diese Angaben nicht gemacht hätte der gleiche. 62 Die Facebook-App ist eine Applikation, die es Nutzern ermöglicht Facebook über ein Smartphone zu nutzen. 63 Vgl. Horvát et al., One Plus One Makes Three (for Social Networks). 58 9 Freunde der o.g. Person in ihren Kontakten über diese gespeichert haben. Beispielsweise haben drei der Freunde bei Firma A gearbeitet, zwei haben die Schule Y besucht und zwei weitere gehören der Partei X an. Facebook rechnet somit aus, dass die Person höchstwahrscheinlich all diese Aktivitäten mit den Personen geteilt hat. Herr Schrems hat diese Analyse bei sich selbst angewendet und folgendes ist dabei herausgekommen: Abbildung 3: Schattenprofil von Max Schrems64 Auf Abbildung 3 ist Herr Schrems mit dem gelben Punkt in der Mitte dargestellt. Die Verbindungen zwischen den anderen kleinen Punkten stellen die Freundschaften seiner Freunde bei Facebook dar. Die kleinen gelben Punkte stellen männliche und die blauen, weibliche Freunde dar. Die Tatsache darüber, dass Herr Schrems an der Universität Wien studiert oder bei ASF gearbeitet hat oder sich irgendwann in Malaysien aufgehalten hat, hat er selbst nicht angegeben. Diese Angaben haben seine Freunde bei Facebook in ihren eigenen Profilen veröffentlicht. Durch deren Erlaubnis zur Synchronisation der Kontakte kann Facebook ableiten, dass diese Angaben für Herrn Schrems auch stimmen könnten. Forscher des Interdisziplinären Zentrums für Wissenschaftliches Rechnen der Universität Heidelberg, sind dem Phänomen Schattenprofile auch nachgegangen und haben erforscht, dass bei einer Synchronisati64 Schrems, Universität Passau, Präsentation v. 05.05.2013, S. 49. 10 on des E-Mailaccounts eine 40-prozentig richtige Vorhersage über die Bekanntschaft zwischen den Mitgliedern und der Person, die kein Mitglied eines sozialen Netzwerks ist, getroffen werden kann.65 Diese Angaben beruhen lediglich auf reinen Kontaktdaten, also Telefonnummer, Name, Adresse und ähnlichem. Die Forscher behaupten, dass wenn man dies auf weitere Informationen ausbreitet, noch genauere Angaben gemacht werden können66, wie man im Beispiel von Max Schrems auch erkennen kann. 2.2.2 Der Social Plugin „Like-Button“ Seit April 2010 hat Facebook seinen Nutzern sogenannte Social Plugins zur Verfügung gestellt.67 Seitdem wurden sie täglich von ca. 10.000 Webseitenbetreibern in deren Websites integriert, wodurch bis 2012 ca. 2,5 Mio. Websites mit Facebook verbunden waren.68 Unter den Social Plugins, ist eines der bekanntesten Beispiele der „Gefällt-mir“-Button (auch Like-Button genannt). Daneben existieren auch andere Plugins, wie “Comments”-Plugin, “Recommendations”-Plugin, “Activity Feed”, „Like Box“, „Login Button“69 und andere, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll. Der Like-Button wird von Telemedienanbietern auf ihren Webseiten platziert, um damit zu gewährleisten, dass Besucher durch das Anklicken dieser, ihre Sympathie für ihr Unternehmen innerhalb ihres Facebook-Accounts zum Ausdruck bringen können.70 Facebook führt näher aus: „Der Like-Button gibt dem Internet-Nutzer die Möglichkeit, die von ihm besuchten Inhalte mit seinen Freunden bei Facebook zu teilen“.71 Doch das Teilen soll nicht ohne Grund geschehen. Damit einhergehend wird im Hintergrund ein sogenanntes Nutzungsprofil des Users erstellt und personalisierte Werbung entwickelt, worauf im vorherigen Kapitel bereits näher eingegangen wurde. Das Problem, was diese Buttons rechtlich mit sich bringen, ist das Verarbeiten personen- 65 Vgl. Horvát et al., One Plus One Makes Three (for Social Networks). Vgl. ebd. 67 Vgl. Schwindt, Das Facebook-Buch, S. 19. 68 Vgl. Schwindt, a.a.O. 69 Vgl. Schwenke, Social Media Marketing & Recht, Abbildung 8-14, S. 393. 70 Vgl. Ernst, Social Plugins: Der „Like-Button” als datenschutzrechtliches Problem, NJOZ, S. 1917. 71 S. Facebook Developers, Like Button. 66 11 bezogener Daten ohne angemessene Einwilligung des Betroffenen erhalten zu haben, sowie, ohne dem Nutzer die Möglichkeit geboten zu haben, dem Vorgang zu wiedersprechen.72 Für Webseitenbetreiber stellt der Button eine Art Empfehlungsmarketing dar, da sich die Werbung fast nur an bedeutsame Zielgruppen richtet.73 Für Facebook stellt er eine Art Analysewerkzeug zur Auswertung des Nutzerverhaltens dar.74 Auf den Like-Button wurden Datenschützer insbesondere wegen eines Falles aufmerksam. Die Stadt Hamburg installierte diesen im Jahre 2010 auf ihrer Seite, wonach später nachgewiesen werden konnte, dass der Button die Daten aller Besucher der Webseite sammelt und an Facebook übermittelt.75 Das Verwerfliche an der Sache ist jedoch, dass Facebook auch Daten von Nichtmitgliedern Facebooks sammelte, sowie ihr sonstiges Surfverhalten nachvollziehen konnte und in diesem Zusammenhang sogenannte Schattenprofile erstellte.76 Da die Stadt Hamburg einen großen Wert auf den Schutz der Daten seiner Besucher legt, schafften sie den Button auf hamburg.de ab.77 In Abbildung 4 kann man einen Social Plugin auf der Homepage der Fachhochschule Köln erkennen: Abbildung 4: Social Plugin von Facebook78 Vgl. Ernst, Social Plugins: Der „Like-Button” als datenschutzrechtliches Problem, NJOZ, S. 1917. 73 Vgl. Schwenke, Social Media Marketing & Recht, S. 393. 74 Vgl. Schwenke, a.a.O. 75 Vgl. Ernst, a.a.O. 76 Vgl. ebd. 77 Vgl. ebd. 78 Startseite des Webauftritts der Fachhochschule Köln. 72 12 Wenn man nicht parallel auf Facebook eingeloggt ist, gelangt man nach Anklicken des Buttons auf das Facebookprofil der Fachhochschule Köln: Abbildung 5: Facebookprofil der FH Köln79 Rechts neben dem Namen des Profils kann man den Button erneut erkennen. Diesmal steht in dem Button „Gefällt-Mir“. Wäre der User angemeldet bei Facebook, hätte er nun die Möglichkeit, durch das Anklicken des Buttons, seine Sympathie für die Fachhochschule Köln auf seiner eigenen Profilseite sichtbar zu machen. Dies würde dann auf seiner eigenen Profilseite auftauchen, sowie im Newsfeed seiner Freunde (unter “Neuigkeiten”). Freunde des Users können folglich, nach dem Besuchen dessen Seite, seine Sympathie für die Fachhochschule Köln erkennen. Dies würde dann auf dem Profil des Users folgendermaßen aussehen: 79 Facebookprofil der Fachhochschule Köln. 13 Abbildung 6: Praxisbeispiel80 Facebook kann via Cookies81 auf dem Rechner des Nutzers eindeutig identifizieren, welche Bewertungen durch andere User abgegeben werden.82 Diese Bewertungen werden dann im eigenen Profil des Users sichtbar und können parallel von Facebookgruppen, aber auch von sonstigen Facebook-Applikationen, z.B. für zielgerichtetes Marketing, verwendet werden, ohne den Nutzer nach einer Einwilligung zu fragen.83 3. Datenschutzrechtliche Grundbegriffe Im Folgenden werden konkrete datenschutzrechtliche Begriffe näher erläutert, um die Thematik besser zu veranschaulichen. 3.1 Deutsches Datenschutzrecht Dem Datenschutzrecht wird in Deutschland grundsätzlich ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Dies beruht insbesondere auf der historischen Vorgeschichte des Nationalsozialismus, sowie den Zeiten in der DDR.84 Der Datenschutz zählt insbesondere seit dem im Jahre 1983 gefällten Volkszählungsurteil (VZU), als „informationelles Selbstbestimmungsrecht“ zu den deutschen Grundrechten.85 Dieses Grundrecht fin- 80 Facebookprofil der Verfasserin. Vgl. Köhler/Kirchmann, IT von A bis Z, Cookies: Mit Cookies lassen sich im Internet Zustände speichern, um einen Benutzer bei einem späteren Besuch wiederzuerkennen und ihn seine gewohnte Umgebung vorfinden zu lassen. 82 Vgl. Redaktion MMR Aktuell, "Social Plugins" als weiterer Eingriff in den Datenschutz von Internetnutzern, MMR-Aktuell, S. 303975. 83 Vgl. Redaktion MMR Aktuell, a.a.O. 84 Vgl. Masing, Herausforderungen des Datenschutzes, NJW, S. 2305. 85 Vgl. Witt, Datenschutz kompakt und verständlich, S. 47. 81 14 det seine Verankerung im allgemeinen Persönlichkeitsrecht.86 Grundsätzlich bieten Grundrechte Bürgern in der Bundesrepublik Deutschland Schutz vor dem Staat.87 So verhält es sich mit der informationellen Selbstbestimmung ebenfalls.88 Allerdings findet man im dritten Abschnitt des Bundesdatenschutzgesetzes, sowie auf einfacher gesetzlicher Ebene etliche Datenschutzvorschriften, die bis in den privaten Bereich der Nutzer vordringen.89 Die informationelle Selbstbestimmung räumt jedem Bürger das Recht ein, selbst zu entscheiden, welche seiner Daten er zur Verfügung stellen und offenbaren möchte.90 Datenschutzrechtliche Anwendungsregeln ergeben sich insbesondere aus dem deutschen Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), den Landesdatenschutzgesetzen (LDSG), dem Telemediengesetz (TMG), dem Telekommunikationsgesetz (TKG) und in bestimmten Fällen aus der Europäischen Datenschutzrichtlinie (EU-DSRL).91 Das Ziel des Datenschutzrechts kann man dem Wortlaut des §1 Abs.1 BDSG entnehmen: „Zweck dieses Gesetzes ist es, den einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird.“ Durch die dynamische Entwicklung der virtuellen Welt, fällt es den Gesetzgebern immer schwerer mitzuhalten und Regelungen zu schaffen, die alles Rechtliche im virtuellen Bereich abdecken.92 Aus diesem Grunde sind datenschutzrechtliche Gesetze relativ „abstrakt“ verfasst, was man an Formulierungen, wie „erforderlich“, „angemessen“, oder „schützenswürdig“ erkennt.93 Eine klare Definition dieser Begriffe wurde bisher nicht vorgenommen. In einem konkreten Fall legen Gerichte diese Begrifflichkeiten in Entscheidungen aus.94 Grundsätzlich ist die unerlaubte Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten nicht mit dem Gesetz vereinbar und führt zu einer Persönlichkeitsrechtsverletzung.95 86 Vgl. Witt, Datenschutz kompakt und verständlich, S. 47. Vgl. Di Fabio, in: Maunz/Düring, Grundgesetz-Kommentar, Art 2, Rn. 179. 88 Vgl. Di Fabio, a.a.O., Art 2, Rn. 132. 89 Vgl. Moos, Datenschutzrecht – schnell erfasst, S. 2. 90 Vgl. ebd. 91 Vgl. Baumgartner/Ewald, Apps und Recht, Rn. 193. 92 Vgl. Schwenke, Social Media Marketing & Recht, S. 372. 93 Vgl. Schwenke, a.a.O., S. 374. 94 Vgl. Schwenke, a.a.O. 95 Vgl. § 1 Abs. 1 BDSG. 87 15 3.2 Personenbezogene Daten Nicht alle Daten sind vom BDSG und anderen Gesetzen geschützt.96 Geschützt ist nach § 1 Abs. 1 BDSG, der Einzelne vor der Verletzung seines Persönlichkeitsrechts im Zusammenhang mit dem Umgang seiner personenbezogenen Daten.97 Was unter personenbezogenen Daten zu verstehen ist, führt § 3 Abs. 1 BDSG genauer aus: „Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener)“98. Daten können verschiedene Angaben preisgeben, die zu einer bestimmten Person zurückführen können.99 Beispiele wären: die E-Mail-Adresse, Postadresse, Familienstand, oder berufliche Aktivität.100 Daten können auch Auskunft über den Namen oder über eine Handlungen geben, z.B. das Besuchen der Facebook-Seite.101 Zusammengefasst sind personenbezogene Daten solche, die den Zusammenhang zu einer Person mit verhältnismäßigen Mitteln gewährleisten können.102 Neben den personenbezogenen Daten existieren pseudonymisierte und anonymisierte Daten.103 § 3a BDSG spricht davon, im Zweifelsfalle von der Möglichkeit einer „Pseudonymisierung“ oder einer „Anonymisierung“ Gebrauch zu machen. Daten sind dann anonym, wenn jeglicher persönlicher Bezug zum Betroffenen gelöscht wird oder nicht nachvollzogen werden kann.104 Pseudonyme Daten sind jene, bei denen der Name des Betroffenen durch ein anderes Identifikationsmerkmal, wie z.B. eine Kundennummer ersetzt wird.105 Durch das Anwenden eines der beiden Methoden wird die Möglichkeit geboten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu verarbeiten. Die Frage die sich seit geraumer Zeit stellt ist, ob die Internetprotokoll (IP)-Adresse auch unter den Schutzbe- 96 Für die Erklärung personenbezogener Daten bezieht sich die Verfasserin verstärkt auf den Wortlaut des BDSG. 97 Vgl. § 1 Abs. 1 BDSG. 98 § 3 Abs. 1 BDSG. 99 Vgl. Gola/Schomerus, BDSG Kommentar, § 3, Rn. 10. 100 Vgl. Gola/Schomerus, a.a.O., § 3, Rn. 2. 101 Vgl. Schwenke, Social Media Marketing & Recht, S. 377. 102 Vgl. Gola/Schomerus, a.a.O. 103 Vgl. Spindler/Nink, in: Spindler/Schuster, Anonyme und pseudonyme Nutzung, Recht der elektronischen Medien, § 13 TMG, Rn. 10. 104 Vgl. § 3 Abs. 6 BDSG. 105 Vgl. Moos, Datenschutzrecht – schnell erfasst, S. 59. 16 reich eines personenbezogenen Datums fällt.106 Durch die o.g. Adresse können Geräte, die mit dem Internet verbunden sind mit einem Zahlencode identifiziert werden.107 Durch das Aufrufen einer beliebigen Webseite teilt man dem zuständigen Server108 seine IP-Adresse mit, welcher im nächsten Schritt einen Befehl mit der Aufforderung an die Webseite weiterleitet, das verlangte Datenpaket an die IP-Adresse zu senden.109 Es herrschen zwei Theorien die über den Personenbezug der IPAdresse diskutieren, die relative und absolute Theorie.110 Nach der relativen Theorie würde im Rahmen einer IP-Adresse ein Personenbezug erst dann zu erkennen sein, wenn in der IP-Adresse persönliche Informationen verschlüsselt sind, die auf den Inhaber der IP-Adresse schließen lassen,111 denn grds. könnte man den Personenbezug eigentlich nur im Rahmen einer Strafermittlung feststellen, indem man den Internetprovider dazu verpflichtet die dazugehörigen Daten über den Besitzer der IP-Adresse herauszugeben.112 Nach der absoluten Theorie geht man stets von einem Personenbezug in der IP-Adresse aus.113 Deutsche Datenschutzbeauftragte und ein Teil der Gerichte114 zählen die IPAdresse, nach der absoluten Theorie zu den personenbezogenen Daten.115 3.3 Automatisierte Verarbeitung Bei der automatisierten Verarbeitung, hat der Gesetzgeber im § 3 Abs. 2 BDSG, mit Einbeziehung der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten praktisch jede Bewegung in Verbindung mit personenbezogenen Daten unter Schutz gestellt. Gemäß § 3 BDSG versteht man unter „Erheben“ das Beschaffen von Daten über den Be- 106Vgl. Schwenke, Schwenke, Social Media Marketing & Recht, S. 378. Vgl. ebd. 108 Server: Rechner, der Anwendungen, Programme und Dokumente bereithält, auf die andere Rechner (Clients) zugreifen können, Köhler/Kirchmann, IT von A bis Z, S. 208. 109 Vgl. Schwenke, a.a.O. 110 Vgl. Voigt/Alich, Facebook-Like-Button und Co. – Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit der Webseitenbetreiber, NJW, S. 3542. 111 Vgl. ebd. 112 Vgl. Adamek, Die Facebook Falle, S. 331. 113 Vgl. Voigt/Alich, a.a.O. 114 Vgl. AG Berlin Mitte, Az. 5 C 314/0, Telemedicus. 115 Vgl. Schwenke, a.a.O., S. 379. 107 17 troffenen.116 Hierbei ist es nicht von großer Bedeutung, ob die Daten schriftlich, oder mündlich beschafft werden, sowie ob sie über den Betroffenen oder einen Dritten beschafft werden, sondern das zielgerichtete Beschaffen der Daten.117 Unter der Verarbeitung werden mehrere Vorgänge verstanden: das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen von personenbezogenen Daten.118 Das „Speichern“ meint das: „Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren personenbezogener Daten auf einem Datenträger zum Zwecke ihrer weiteren Verarbeitung oder Nutzung, […]“.119 Unter Erfassen wird in der Literatur das schriftliche Fixieren und unter Aufnehmen, das Fixieren der Daten, allerdings mit Hilfe von technischen Mitteln, wie Datenträgern, Ton- und Videobänden und sonstigen Medien verstanden.120 Aufbewahren bedeutet, Vorhalten der Daten.121 Mit „Löschen“ meint das Gesetz, das Unkenntlichmachen gespeicherter personenbezogener Daten.122 Um Daten unkenntlich zu machen, dürfen sie nicht mehr lesbar sein. Grundsätzlich kann man sagen, dass Daten dann gelöscht sind, wenn man sie nicht mehr rekonstruieren kann.123 Mit „Nutzen“ wird jegliche Verwendung personenbezogener Daten gemeint, sofern es sich nicht um eine Verarbeitung handelt.124 Dieser weit gefasste Anwendungsbereich steht in Verbindung mit Art. 2b der EU-DSRL, in der jeder Vorgang in Verbindung mit personenbezogenen Daten erfasst wird und dient als Auffangtatbestand, sofern es sich bei dem jeweiligen Vorgang nicht um Verarbeitung nach § 3 Abs. 4 BDSG handelt. Festzuhalten ist, dass jede zweckmäßige Anwendung personenbezogener Daten geschützt ist.125 Bürger haben grundsätzlich jedoch das Recht, sich gegen eine uneingeschränkte Erhebung, Speicherung, Nutzung und Weitergabe ihrer Daten zu wehren126, denn aus diesen Rechtsverstößen können als Reaktion, zivilrechtliche Ansprüche 116 Vgl. § 3 Abs. 3 BDSG. Vgl. Moos, Datenschutzrecht – schnell erfasst, S. 25. 118 Vgl. § 3 Abs. 4 BDSG; Näheres zu den anderen Umgangsarten mit Daten, s. § 3 Abs. 4 Nr. 1-5. 119 § 3 Abs. 4 Nr. 1 BDSG. 120 Vgl. Moos, a.a.O., S. 26. 121 Vgl. ebd. 122 Vgl. § 3 Abs. 4 Nr. 5 BDSG. 123 Vgl. Moos, a.a.O., S. 29. 124 Vgl. § 3 Abs. 5 BDSG. 125 Vgl. Moos, a.a.O., S. 29. 126 Vgl. Bamberger, Beck'scher Online-Kommentar BGB, § 12, Rn. 161. 117 18 auf Unterlassung, Beseitigung, Auskunft und Ersatz des daraus entstandenen materiellen und immateriellen Schadens entstehen.127 3.4 Einwilligung Gemäß § 4 Abs. 1 BDSG, § 12 Abs. 1 TMG, Art. 7a EU-DSRL ist eine Datenverarbeitung erst dann zulässig, wenn vorher eine ausdrückliche Einwilligung seitens der betroffenen Person stattgefunden hat. Die Einwilligung ist nach § 4a BDSG erst rechtswirksam, wenn der Betroffene diese freiwillig abgibt und zuvor über die Erhebung und Verwendung der zu erhebenden Daten in Kenntnis gesetzt wurde.128 Aus der Einwilligung müssen die genaue Absicht, der Umfang der zu erhebenden Daten, sowie der Charakter dieser und die daraus resultierenden Folgen erkennbar sein.129 Pauschalisierte Erklärungen seitens eines Dienstanbieters wären daher nicht wirksam. Für das Vorliegen der Einwilligung trägt der verantwortliche Dienstanbieter die Beweislast.130 Weiterhin bedarf die Einwilligung nach § 4a Abs. 1 S. 2 BDSG der Schriftform, soweit nicht wegen bestimmter Umstände eine andere Form angemessen ist. § 13 Abs. 2 TMG erlaubt eine elektronische Form der Erklärung einer Einwilligung, wenn der Dienstanbieter sicherstellen kann, dass der Nutzer sich bewusst über die Abgabe der Einwilligung war und diese eindeutig erteilt hat. Weiterhin die Einwilligung protokolliert und die Möglichkeit erteilt wurde, den Inhalt der Einwilligung jederzeit abzurufen, sowie dem User die Option erteilt wurde, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen.131 4. Wo beginnt das Datenschutzproblem bei Social Plugins Dieses Kapitel wird sich mit der Frage auseinandersetzen, gegen welche deutschen Rechtsvorschriften das soziale Netzwerk genau verstößt 127 Vgl. Bamberger, Beck'scher Online-Kommentar BGB, § 12, Rn. 161. Vgl. § 4a BDSG. 129 Vgl. ULD, Datenschutzrechtliche Bewertung der Reichweitenanalyse durch Facebook , S. 20. 130 Vgl. Moos, Datenschutzrecht – schnell erfasst, S. 47. 131 Vgl. § 13 Abs. 2 TMG. 128 19 und wo der Verstoß genau beginnen könnte. Beginnt der Verstoß beim Übermitteln der Daten in einen Drittstaat, im Falle von Facebook in die USA und welches Recht findet aus deutscher Sicht auf Facebook Anwendung. Weiterhin ob die Übermittlung nach dem anwendbaren Recht stattfinden darf. Oder beginnt das Datenschutzproblem erst beim nächsten Schritt, der Erhebung bzw. der Verarbeitung der Daten. Eines der hilfreichsten Tools, die Facebook dafür verwendet ist wie bereits in Kap. 2.5.1 erwähnt, der Like-Button, der das Surfverhalten des Webseitenbesuchers analysiert und die dadurch gewonnenen Daten an Facebook weiterleitet. Die rechtliche Prüfung im Rahmen des Kap. 4.2 geht näher auf die durch den Button gewonnenen Daten ein und prüft in diesem Rahmen, ob die Erhebung und Verarbeitung dieser, rechtskonform abläuft. Die Prüfung unterscheidet zwischen Facebook selbst und dem Webseitenbetreiber. Zu guter Letzt wird geprüft, ob das Erstellen von Nutzungs- und Schattenprofilen rechtskonform abläuft. 4.1 Übermittlung personenbezogener Daten in einen Drittstaat? Welches Recht findet Anwendung Facebook hat seinen Hauptsitz in den vereinigten Staaten, in Form einer Incorporated.132 Zunächst muss geklärt werden, welches Recht in Deutschland auf den Konzern Anwendung findet. In Frage käme grds. das deutsche, europäische, irische oder amerikanische Recht, da Facebook seinen Hauptsitz in den USA betreibt und weitere Niederlassungen in Irland und Deutschland hat. In Amerika ist das sogenannte Opt-Out-Prinzip vertreten, welches amerikanischen Unternehmen durchweg das Verarbeiten von personenbezogenen Daten so lange erlaubt, bis die Nutzer dem aktiv wiedersprechen.133 In Europa sowie in Deutschland dagegen herrscht das Opt-InPrinzip, welches vor der Verarbeitung der Daten eine Einwilligung des Nutzers verlangt.134 Das erstgenannte versucht Facebook auch in 132 S. Kap. 2.1. Vgl. Schwenke, Social Media Marketing & Recht, S. 372. 134 Vgl. ebd. 133 20 Deutschland durchzusetzen, womit deutsche Datenschützer große Probleme haben.135 Als europäisches Recht ist grds. die Richtlinie 95/46/EG (EU-DSRL) gemeint, die durch die Umsetzung in nationales Recht am 23. Mai 2001 zur Novellierung des BDSG geführt hat.136 § 1 Abs. 5 BDSG enthält aus dem Art. 4 EU-DSRL übernommene Kollisionsregeln, die besagen, dass wenn eine datenbeziehende Stelle ihren Sitz außerhalb des deutschen Territoriums hat, insbesondere außerhalb der Europäischen Union (EU) und dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und Daten im Inland, also Deutschland erhebt, verarbeitet oder nutzt, deutsches Recht anzuwenden ist.137 Dies wird als das Territorial,- oder Sitzprinzip bezeichnet.138 Facebook.inc hat seinen Sitz in den USA, demnach außerhalb der EU, sowie dem ERW. Weiterhin müsste eine Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der Daten stattfinden. Das Setzen von Cookies auf Rechnern der deutschen Nutzer stellt grds. eine Erhebung dar139, da durch die gesetzten Cookies die Möglichkeit geboten wird Nutzungsprofile zu generieren140. Abgesehen davon heißt es im Art. 4 Abs. 1 lit. c EU-DSRL, dass Daten dann im Inland erhoben oder verarbeitet werden, wenn auf Mittel zurückgegriffen wird, die im Inland belegen sind. Man könnte es so auslegen, dass es deutschen Nutzern ohne ihren, in Deutschland belegenen PC nicht möglich wäre, ihre Daten in Facebook.com einzugeben und dem Portal somit die Verarbeitung der Daten zu ermöglichen. Somit greift Facebook auf Mittel, die im Inland belegen sind. Im Zwischenergebnis würde auf Facebook.inc deutsches Recht Anwendung finden. Eine Ausnahme wäre, wenn das im Ausland belegene Unternehmen seine unternehmerische Tätigkeit durch eine Filiale oder Niederlassung, im EWR nachweisen kann. Facebook hat, wie in Kap. 2.1.1 erwähnt 135 Vgl. Schwenke, Social Media Marketing & Recht, S. 372. Vgl. Moos, Datenschutzrecht – schnell erfasst, S. 13. 137 Vgl. § 1 Abs. 5 BDSG. 138 Vgl. Kühling/Seidel/Sivridis, Datenschutzrecht, 2. Kapitel, S. 104. 139 Vgl. Stadler, Gilt deutsches Datenschutzrecht für Facebook überhaupt?; vgl. Beschwerdebegründung des ULD zum Beschluss des VG Schleswig, v. 14.02.2012. 140 Vgl. Schwartmann, Praxishandbuch Medien-, IT- und Urheberrecht, 18. Kap. Datenschutzrecht, S. 611, Rn. 10. 136 21 einen weiteren Sitz in Irland, was die Anwendbarkeit des irischen Rechts zulassen würde.141 Es sei denn, der Datenverarbeitungsvorgang erfolgte gem. § 1 Abs. 5 S. 1 HS. 2 BDSG durch eine Niederlassung im Inland, also in Deutschland. In diesem Fall würde nämlich wieder deutsches Recht Anwendung finden. Facebook hat auch in Deutschland eine weitere Niederlassung.142 Die deutsche Niederlassung wurde jedoch, wie in Kap. 2.1.2 bereits erwähnt, in zwei Beschlüssen des VG und des OVG Schleswig als eine Niederlassung in dem Sinne nicht anerkannt. In der Datenschutzerklärung von Facebook heißt es, dass der Vertrag, der vom Nutzer eingegangen wird, eine Vereinbarung zwischen Facebook Ireland Ltd. darstellt, sofern man seinen Wohnsitz nicht in den USA oder Kanada hat.143 Deutsche Datenschützer haben wie bereits in Kap. 2.2 erwähnt, Schwierigkeiten damit, den Sitz in Irland letztendlich als eine feste Einrichtung zu betrachten, was die Antwort bzgl. des anwendbaren Rechts erschwert. Mithin würde § 1 Abs. 5 S. 1 BDSG letztendlich dann gelten und in diesem Zusammenhang das deutsche Recht Anwendung finden, wenn die Niederlassung des Mutterunternehmens personenbezogene Daten im Inland, also in Deutschland erhebt, verarbeitet oder nutzt. Facebook.Ltd spricht sich durch seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) das Recht zu, die Daten der Nutzer in die USA zu übermitteln, damit sie dort verarbeitet werden,144 was impliziert, dass nicht Facebook.Ltd die Daten verarbeitet, sondern das Mutterunternehmen Facebook.Inc., welches in den USA ansässig ist. Demnach ist nicht Facebook Ltd. die datenverarbeitende Stelle, sondern Facebook.Inc. Schlussendlich wird die Meinung des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz (ULD)145 dahingehend unterstützt, dass Facebook sich gem. § 1 Abs. 5 BDSG dem deutschen Datenschutzrecht anpassen müsste, aus den oben genannten Gründen. Die Übermittlung personenbezogener Daten an ein amerikanisches Unternehmen wäre grds. auch dann zulässig, wenn davon auszugehen ist, 141 Vgl. Schwenke, Social Media Marketing & Recht, S. 376 f. s. 2.1.2. 143 Vgl. Facebook Nutzungsbedingungen, 19. Sonstiges. 144 Vgl. Facebook Nutzungsbedingungen, 17. Besondere Bestimmungen für Nutzer außerhalb der USA. 145 Vgl. ULD, Datenschutzrechtliche Bewertung der Reichweitenanalyse durch Facebook , S. 20. 142 22 dass die Daten den gleichen Datenschutzstandards wie in der EU unterfallen.146 Dies wäre der Fall, wenn Facebook dem Safe Harbour147 Abkommen beigetreten wäre. Dies ist zwar der Fall, jedoch kommt weder Facebook, noch die US- Verbraucherschutzbehörde Federal Trade Commission (FDC) ihren Pflichten in Bezug auf das Abkommen nach148, somit dürfte nach § 4b Abs. 2 S. 2. BDSG eine Übermittlung in die USA erst dann stattfinden, wenn der Betroffene kein schutzwürdiges Interesse am Ausschluss der Übermittlung hätte.149 Ein schutzwürdiges Interesse könnte bei fehlendem angemessenem Schutzniveau der zu übermittelnden Daten bestehen.150 Ausnahmen für eine rechtskonforme Übermittlung, trotz nicht angemessenem Schutzniveau könnten die im § 4c Abs. 1 BDSG aufgeführten Regelungen darstellen. Diese Rechtsnorm gilt insbesondere für den Wirtschaftsverkehr mit den Drittstaaten.151 Eine der Ausnahmen könnte eine Einwilligung des Betroffenen darstellen, die jedoch, wie die folgende Prüfung zeigen wird grds. nicht gegeben ist. 4.2 Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten Wie bereits in Kap. 2.5.3 beschrieben, erstellt Facebook von seinen Nutzern im Hintergrund Nutzungs- und Schattenprofile, um personalisiert zu werben, worüber weder die Nutzer, noch die Freunde der Nutzer, die nicht bei Facebook angemeldet sind, in Kenntnis gesetzt werden.152 Die Voraussetzung, um personalisierte Werbung erstellen zu können, ist die Erhebung und Zusammenstellung von Daten in Nutzungsprofilen und schlussendlich die damit einhergehende Verwendung 146 Vgl. Dramburg/Schwenke, Rechtliche Stolperfallen beim Facebookmarketing, Kap. 14.5, S. 79. 147 Bei Safe Harbor (Sicherer Hafen) handelt es sich um eine zwischen der EU und den USA im Jahre 2000 getroffene Vereinbarung, die gewährleistet, dass personenbezogene Daten legal in die USA übermittelt werden können. Ausgangspunkt für diese Vereinbarung bilden die Vorschriften der Art. 25 und 26 der Europäischen Datenschutzrichtlinie, nach denen ein Datentransfer in Drittstaaten verboten ist, die über kein dem EU-Recht vergleichbares Datenschutzniveau verfügen, vgl. bfdi, Safe Harbour. 148 s. ULD Pressemitteilung v. 14.03.2013; vgl. ULD Tätigkeitsbericht 2013, 7.1.4., S. 115 f. 149 Vgl. Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, BDSG § 4b, Rn. 5. 150 Vgl. ebd. 151 Vgl. Erbs/Kohlhaas, a.a.O., BDSG § 4c, Rn. 2. 152 s. Kap. 2.5.3. 23 dieser Daten und Nutzungsprofile.153 Bei der Prüfung wird zwischen Facebook und dem Webseitenbetreiber, der den Like-Button auf seine Seite platziert und eine Verarbeitung der Daten ermöglicht, unterschieden. Grundsätzlich hat das Bundesdatenschutzgesetz auf Bundesebene Vorrang, wenn es sich in einem Einzelfall um personenbezogene Daten handelt. Es tritt jedoch hinter speziellere Regelungen, wenn der Sachverhalt in deren Anwendungsbereich fällt.154 Wenn z.B. im TMG etwas Spezielles nicht geregelt wurde, bleibt das BDSG subsidiär anwendbar und nimmt die Form einer Auffangregelung an.155 Bei FacebookFanpagebetreibern und Webseitenbetreibern mit Sitz in Deutschland handelt es sich grundsätzlich um Dienstanbieter von Telemedien, auf die das TMG anzuwenden ist.156 Im § 12 TMG157 ist geregelt, wann personenbezogene Daten erhoben und verwendet werden dürfen. 4.2.1 Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit des Webseitenbetreibers Durch das Einbinden von Socal Plugins in seine Webseite, unterstützt der Webseitenbetreiber Facebook dabei, Nutzungsprofile von den Besuchern der Site zu erstellen.158 Der Betreiber könnte nach § 11 Abs. 1 BDSG, als Auftraggeber in Betracht kommen und würde dann zur Verantwortung gezogen werden dürfen.159 Allerdings ist dies gleich zu verneinen, weil es insbesondere an einem Auftragsverhältnis zwischen den beiden Parteien scheitert.160 Ein Datenschutzverstoß des Webseitenbetreibers, durch das Einbringen von Drittinhalten, in unserem Fall des Plugins, würde gegen § 12 Abs. 2 TMG161 verstoßen, wenn personen153 Vgl. Bauer, Personalisierte Werbung auf Social Community-Websites Datenschutzrechtliche Zulässigkeit der Verwendung von Bestandsdaten und Nutzungsprofilen, MMR, S. 435. 154 Vgl. § 1 Abs. 3 BDSG. 155 Vgl. Bauer, Personalisierte Werbung auf Social Community-Websites Datenschutzrechtliche Zulässigkeit der Verwendung von Bestandsdaten und Nutzungsprofilen, MMR, S. 435. 156 Vgl. ULD, Datenschutzrechtliche Bewertung der Reichweitenanalyse durch Facebook, S. 17; vgl. § 2 Nr. 1 TMG. 157 s. auch: § 4 Abs. 1 BDSG. 158 Vgl. ULD, a.a.O., S. 23. 159 Vgl. Ernst, Social Plugins: Der „Like-Button” als datenschutzrechtliches Problem, NJOZ, S. 1918. 160 Vgl. ebd. 161 s. auch: § 4 Abs. 1 BDSG. 24 bezogene Daten, ohne eine gesetzliche oder andere Rechtsvorschrift, die sich auf Telemedien bezieht, jedoch insbesondere ohne die Einwilligung des Betroffenen, für andere Zwecke verwendet werden würden. Als personenbezogenes Datum würde im Falle des Like-Buttons die IPAdresse in Frage kommen.162 Nun müsste entschieden werden, nach welcher Theorie man die o.g. Adresse betrachtet. Würde man sie nach der absoluten Theorie betrachten, würde man grundsätzlich davon ausgehen, dass die IP-Adresse zu den personenbezogenen Daten zählt und die Verarbeitung dieser würde dann zu einem Verstoß führen.163 Nach der relativen Theorie müsste man zunächst untersuchen, ob man bei näherer Betrachtung der IP-Adresse einen Personenbezug zu dem Betreffenden feststellen kann.164 Sollte die Untersuchung positiv ausfallen, würde ein personenbezogenes Datum vorliegen, andernfalls nicht. Ferner dürfte keine gesetzliche oder andere Rechtsvorschrift, die sich auf Telemedien bezieht, dem Webseitenbetreiber das Verarbeiten der Daten legitimieren. Es gibt weder im TMG, noch im BDSG oder anderen Rechtsvorschriften, sowie in der Literatur eine Legitimation für das Platzieren eines Social Plugins, welcher personenbezogene Daten erhebt und verarbeitet. Weiterhin müsste der Betroffene in den Nutzungsvorgang, nach §§ 12 Abs. 2, 13 TMG eingewilligt haben. Beim Anklicken des Buttons könnte man eventuell von einer konkludenten Form der Einwilligung ausgehen. Dies wäre nur dann zu bejahen, wenn der Betreffende über die Art, den Zweck des Nutzungsvorgangs, sowie auf die Folgen der Verweigerung der Einwilligungen und vieles mehr in Kenntnis gesetzt würde.165 Nach eigener Erfahrung der Autorin gehen dem bisher nur wenige Webseitenbetreiber nach.166 Somit findet beim Anklicken, insbesondere jedoch beim Nichtanklicken des Buttons, wo mittlerweile nachweislich perso162 Vgl. ULD, Datenschutzrechtliche Bewertung der Reichweitenanalyse durch Facebook, S. 15. 163 Vgl. ebd. 164 Vgl. Voigt/Alich, Facebook-Like-Button und Co. – Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit der Webseitenbetreiber, NJW, S. 3542 f. 165 Vgl. § 4a Abs. 1 BDSG. 166 Vgl. ULD, a.a.O., S. 14. 25 nenbezogene Daten der Webseitenbesucher an Facebook übermittelt werden, in den meisten Fällen keine Einwilligung in dem Sinne statt.167 Der andere Zweck könnte das Übermitteln an einen Drittanbieter, hier Facebook darstellen.168 Über die Frage, ob ein Webseitenbetreiber letztendlich dieselbe Schuld trifft, wie Facebook, wird stark diskutiert. Auf der einen Seite wird die Meinung vertreten, dass eine Datenerhebung durch Facebook, ohne das Bereitstellen des Werkzeugs gar nicht möglich wäre und demnach auch keine Datenverarbeitung stattfinden könnte.169 Auf der anderen Seite wird mit der Tatsache argumentiert, dass nach § 3 Abs. 4, Nr. 3 BDSG aus der Sicht des Webseitenbetreibers keine Übermittlung in dem Sinne stattfindet.170 Man könnte jedoch behaupten, dass der Webseitenbetreiber die Daten bereithält, was eine Übermittlung injizieren würde.171 In diesem Fall müsste lt. Gesetz, die Handlung vom Datenempfänger in Form von „Einsehen“ oder „Abrufen“ ausgehen und der Übermittler wäre dann im Grunde genommen derjenige, der die Daten zum Einsehen oder Abrufen zur Verfügung stellt.172 In einem hypothetischen Fall, wo der Webseitenbetreiber einen HTML-Code173 für die Erhebung von IP-Adressen für den Drittanbieter bereithalten würde, könnte man das Bereithalten durchaus als die Übermittlung verstehen.174 Durch das Einsetzen eines Plugins auf einer Webseite, werden die Daten von alleine an Facebook weitergeleitet. Somit ist von einem Bereithalten dieser Daten aus der Sicht des Webseitenbetreibers abzusehen.175 Zusätzlich müssten die Daten vom Webseitenbetreiber vor der Übermittlung „gespeichert“ oder durch Datenverarbeitung „gewonnen“ Vgl Ernst, Social Plugins: Der „Like-Button” als datenschutzrechtliches Problem, NJOZ, S. 1917. 168 Vgl. Ernst, a.a.O., S. 1918. 169 s. dazu: Ernst, Social Plugins: Der „Like-Button” als datenschutzrechtliches Problem, NJOZ, S. 1918. 170 Vgl. Voigt/Alich, Facebook-Like-Button und Co. – Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit der Webseitenbetreiber, NJW, S. 3542. 171 Vgl. ebd.; vgl. § 3 Abs. 4 Nr. 3 lit. b BDSG. 172 Vgl. Voigt/Alich, a.a.O.; vgl. § 3 Abs. 4, Nr. 3 lit. b BDSG. 173 HTML: Seitenbeschreibungssprache im World Wide Web, Vgl. Köhler/Kirchmann, IT von A bis Z, S. 110; Code: Eine Zeichenkette, die als abgekürztes Mittel zum Zweck der Aufzeichnung und Identifizierung von Informationen dient, Köhler/Kirchmann, a.a.O., S. 47. 174 Vgl. Voigt/Alich, a.a.O., S. 3542 f. 175 Vgl. ebd. 167 26 sein, was ebenfalls nicht zutrifft und die gesamte Sachlage verneint werden kann.176 Im Ergebnis würde der Webseitenbetreiber nach dem § 12 TMG rechtlich nicht beanstandet werden können, da aus der Sicht des Betreibers keine Übermittlung im Sinne des TMG stattfindet. Trotzdem verfolgt die Autorin die Meinung des ULD177, sowie der Datenschutzgruppe178, dass der Webseitenbetreiber eine Art Teilschuld nach § 3 Abs. 7 BDSG innehat,179 da ohne Platzieren des Buttons auf seiner Webseite ebendiese Verarbeitung der Daten durch Facebook nicht durchgeführt werden könnte. 4.2.2 Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit Facebooks Facebook bietet ebenfalls Telemedien an, somit findet auch im Falle des sozialen Netzwerks das TMG und im Rahmen der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten, der § 12 Abs. 1 TMG Anwendung. Gem. § 12 Abs. 1 TMG müssten erneut personenbezogene Daten vorliegen. Im Falle des Like-Buttons bekommt Facebook die IP-Adresse des Besuchers, mit welcher man feststellen kann, dass die Person die Webseite besucht hat und wie lange sie darauf verweilt hat.180 Es kommt grds. darauf an, welche Meinung man vertritt. Vertritt man die Meinung, dass die IP-Adresse zu den personenbezogenen Daten zählt, dann ist der Fall nicht weiter schwierig und das Vorliegen von personenbezogenen Daten, die verarbeitet würden, wäre gegeben. Im anderen Fall würden keine personenbezogenen Daten vorliegen und Facebook würde dementsprechend auch keine personenbezogenen Daten, sondern Vgl. Vgl. Voigt/Alich, Facebook-Like-Button und Co. – Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit der Webseitenbetreiber, NJW, S. 3542. 177 S. ULD, Datenschutzrechtliche Bewertung der Reichweitenanalyse durch Facebook ,S. 17. 178 S. WP 169, Art 29 Datenschutzgruppe, Stellungnahme 1/2010 zu den Begriffen „für die Verarbeitung Verantwortlicher“ und „Auftragsverarbeiter“, S. 22. 179 Vgl. Schwenke, Social Media Marketing & Recht, S. 397. 180 Vgl. Bauer, Personalisierte Werbung auf Social Community-Websites Datenschutzrechtliche Zulässigkeit der Verwendung von Bestandsdaten und Nutzungsprofilen, MMR, S. 437. 176 27 pseudonyme oder anonyme Daten181 des Besuchers verarbeiten, was bedeutet, dass es bei der Prüfung bereits am ersten Tatbestand scheitern würde, da das TMG, sowie das BDSG nur die personenbezogene Daten schützt.182 Die Autorin schließt sich erneut der Meinung an, dass die IP-Adresse spätestens bei der Verknüpfung zum Profil des Besuchers einen Personenbezug darstellt.183 Weiterhin dürfte keine gesetzliche oder andere Rechtsvorschrift, die sich auf Telemedien bezieht, Facebook das Verarbeiten der Daten legitimieren. Durch den Like-Button kommt Facebook an die IP-Adresse des Nutzers und erstellt in diesem Zusammenhang Nutzungsprofile, um dem Nutzer personalisierte Werbung schicken zu können. Der § 15 Abs. 3 TMG wird in der Literatur als eventueller Rechtfertigungsgrund für die Einwilligung nach § 13 TMG, für das Verarbeiten personenbezogener Daten angesehen.184 Diese Meinung ist stark umstritten.185 Nach § 15 Abs. 1 TMG ist die Übermittlung der Daten grundsätzlich nicht erforderlich ist, um die Inanspruchnahme von Telemedien zu gewährleisten.186 Ferner müsste eine Einwilligung seitens des Betroffenen im Sinne der (i.S.d.) §§ 12 Abs. 1, 13 Abs. 2,3 TMG vorliegen. Rechtlich betrachtet behauptet Facebook, die Einwilligung in die Verarbeitung der Daten im Rahmen der Nutzungsbedingungen bei Registrierung, vom Nutzer erhalten zu haben187, was eine Art globale Einwilligung188 darstellen würde. Dies entspricht jedoch nicht den gesetzlichen Regelungen des § 13 Abs. 1 TMG, der besagt, dass der Nutzer zu Beginn des Nutzungsvorgangs über Art, Umfang und Zweck der Erhebung personenbezogener Daten zu unterrichten ist. Die von Facebook angewandte Methode entspricht 181 Das müsste dann näher untersucht werden, um welche Daten es sich genau handelt. 182 Vgl. § 12 TMG, § 1 BDSG. 183 Vgl. Voigt/Alich, Facebook-Like-Button und Co. – Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit der Webseitenbetreiber, NJW, S. 3542 f. 184 Vgl. z.B. Bauer, Personalisierte Werbung auf Social Community-Websites Datenschutzrechtliche Zulässigkeit der Verwendung von Bestandsdaten und Nutzungsprofilen, MMR, S. 435 ff.; vgl. Schwenke, Social Media Marketing & Recht, S. 386; vgl. Solmecke, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, 21.1 Rn. 29. 185 Vgl. z.B. Bauer, a.a.O.; Schwenke, a.a.O.; Solmecke, a.a.O. 186 s. dazu: Solmecke, a.a.O. 187 Vgl. Solmecke, a.a.O., 21.1, Rn. 28. 188 s. LG Berlin, 15 O 92/12, BeckRS 2013, 08005. 28 demnach nicht den datenschutzrechtlichen Ansprüchen, da weder Art, noch Umfang der Weitergabe der Daten in den Nutzungsbedingungen, die der Nutzer bei Registrierung bestätigt, geregelt ist.189 Im Konkreten würde der Verstoß gegen die §§ 12, 13 Abs. 2,3 TMG190 vorliegen191, der nach § 16 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 TMG mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 € geahndet werden kann.192 4.3 Erstellen von Nutzungsprofilen Um die Erstellung von Nutzungsprofilen für das Platzieren von personenbezogener Werbung zu legitimieren, tritt in der Literatur oft die Meinung auf, dass statt der Einwilligung des Betroffenen gemäß (gem.) §§ 12, 13 TMG die gesetzliche Vorschrift des § 15 Abs. 3 als Rechtfertigungsgrund greifen könnte.193 Es gilt jedoch auch bei den Nutzungsprofilen zu unterscheiden zwischen denen, in welchen Facebook mit den Daten arbeitet, die der Nutzer freiwillig auf seinem Profil zur Verfügung stellt und Schattenprofilen, für welche Daten durch Dritte bereitgestellt werden, wovon Nutzer, sowie Nichtnutzer nicht in Kenntnis gesetzt werden. Die Folgende Prüfung geht von einem Facebooknutzer aus, der eine Webseite mit einem installierten Like-Button besucht. Der Button leitet im nächsten Schritt seinen Besuch an das Analysewerkzeug Facebook Insights weiter. Insights hält diesen Besuch fest und verarbeitet die gewonnenen Informationen zu einem Nutzungsprofil.194 4.3.1 Nutzungsprofil durch Like-Buttons In diesem Rahmen muss zunächst eine Unterscheidung der personenbezogenen Datenarten vorgenommen werden. Unterschieden wird zwischen Bestandsdaten nach § 14 TMG und Nutzungsdaten nach § 15 TMG. Nach § 14 TMG ist es erlaubt, Bestandsdaten zu verarbeiten, 189 Vgl. Solmecke, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, 21.1 Rn. 28. Verstoß liegt auch gegen § 4a BDSG vor. 191 Vgl. Weichert, Datenschutzverstoß als Geschäftsmodell – der Fall Facebook, DuD, S. 717. 192 Vgl. Solmecke, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, 21.1, Rn. 31. 193 Vgl. Voigt/Alich, Facebook-Like-Button und Co. – Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit der Webseitenbetreiber, NJW, S. 3543. 194 Vgl. Tätigkeitsbericht 2013 des ULD, 7.1.1, S. 111. 190 29 sofern es als erforderlich für die Vertragsgestaltung erscheint. Die Vorschrift listet keinen Datenkatalog von möglichen Datenarten auf, sondern macht es letztendlich von der Erforderlichkeit abhängig.195 Jedoch könnten Angaben wie Name, E-Mail-Adresse, Postadresse oder Geburtsdatum, also sogenannte (sog.) Bestandsdaten verstanden werden.196 Unter Nutzungsdaten werden nach § 15 Abs. 1 TMG diejenigen Daten verstanden, die erforderlich sind, die Inanspruchnahme der Telemediendienste zu ermöglichen und abzurechnen. Im Vergleich zu den Bestandsdaten listet der § 15 Abs. 1 TMG in seinem Anwendungsbereich einen Katalog von Nutzungsdaten auf.197 Dieser Datenkatalog steht ebenfalls im Einzelfall in Abhängigkeit von der Erforderlichkeit und führt daher in der Praxis eher zu Verwirrungen, als dass er hilfreich ist.198 Unter Nutzungsdaten können im konkreten die IP-Adresse, Nutzername, Passwort, die allerdings auch gleichzeitig Bestandsdaten darstellen, fallen.199 Wie man unschwer erkennen kann, ist eine Trennung der jeweiligen Datenarten schwer vorzunehmen.200 Ferner können von Nutzern in sozialen Netzwerken freiwillig weitere Daten, wie Hobbies, Beziehungsstatus, Anzahl der Kinder, Namen der Familienmitglieder usw. angegeben werden, die als Inhaltsdaten bezeichnet werden.201 Ein Teil der Literatur sieht diese als eine Unterkategorie der Nutzerdaten nach § 15 TMG an und der andere Teil ist der gegensätzlichen Meinung und teilt diese den §§ 27 ff. BDSG zu.202 Festzuhalten ist, dass die Verarbeitung der Daten für Werbung auf sozialen Netzwerken weder in § 14 TMG, noch in § 15 TMG zugelassen wird und die Verarbeitung von Bestands-, Nutzungs-, und Inhaltsdaten daher nur mit Einwilligung des Nutzers gem. § 12 Abs. 1 und 2 TMG vorge195 Vgl. Schmitz, in: Hoeren/Sieber/Holznagel,16.2 Rn. 170. Vgl. Bauer, Personalisierte Werbung auf Social Community-Websites Datenschutzrechtliche Zulässigkeit der Verwendung von Bestandsdaten und Nutzungsprofilen, MMR, S. 436. 197 S. § 15 Abs. 1 TMG. 198 Vgl. Schmitz, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, 16.2, Rn. 198. 199 Vgl. Bauer, Personalisierte Werbung auf Social Community-Websites Datenschutzrechtliche Zulässigkeit der Verwendung von Bestandsdaten und Nutzungsprofilen, MMR, S. 436. 200 Vgl. Niemann/Scholz, Privacy by Design und Privacy by Default – Wege zu einem funktionierenden Datenschutz in Sozialen Netzwerken, in: Peters/Kersten/Wolfenstetter, Innovativer Datenschutz, S. 121. 201 Vgl. Bauer, a.a.O. 202 S. ebd. 196 30 nommen werden kann. Webseitenbetreiber argumentieren zwar damit, dass die Profile kostenlos zur Verfügung stehen und dies weiterhin von den Einnahmen durch die Werbung gewährleistet werden kann, gesetzlich jedoch stellt die Werbung keine Voraussetzung für die Vertragsschließung, sondern eher eine sekundäre Komponente dar.203 Die Norm §15 Abs. 3 TMG erlaubt jedoch das Erstellen eines Nutzungsprofils, bei Verwendung von Pseudonymen, ohne die Einholung einer Einwilligung des Nutzers. Auf die Pseudonymisierung wurde bereits in Kap. 3.2 eingegangen. Es dürfen demnach alle Nutzungsdaten, nicht jedoch Bestands-, oder Inhaltsdaten des Nutzers für diesen Zweck verwendet werden204, sofern der Nutzer dem nicht widerspricht, was impliziert, dass dem Nutzer zu Beginn des Vorgangs ein Widerspruchsrecht eingeräumt werden müsste. An diesem Tatbestand scheitert es grundsätzlich, da bei dem Besuch einer Webseite, ausgestattet mit einem Like-Button, dem Besucher kein Widerspruchsrecht eingeräumt wird und von Facebook keine technische Möglichkeit eingeräumt wird dies zu verwirklichen.205 Facebook könnte jedoch solch eine Widerspruchsmöglichkeit einräumen, hatte bis dato jedoch, laut kein Interesse daran.206 Weiterhin herrscht ein sogenanntes „Verbot der nachträglichen Zusammenführung“207, welches eine Zusammenführung von Pseudonymen mit personenbezogenen Daten verbietet. Spätestens bei der Verknüpfung mit dem Facebookprofil findet auch hier eine solche Zusammenführung statt, da die Nutzer meistens mit ihren richtigen Namen dort registriert sind.208 Weiterhin müsste geklärt werden, ob personalisierte Werbung in den Anwendungsbereich des § 15 Abs. 3 TMG fällt. Personalisierte Werbung würde dann unter dem Begriff der Werbung gefasst werden können und die Rechtsnorm könnte datenschutzrechtlich als zulässig erklärt werden209, würde es nicht an dem Tatbestand der fehlenden Wi- 203 Vgl. Bauer, Personalisierte Werbung auf Social Community-Websites Datenschutzrechtliche Zulässigkeit der Verwendung von Bestandsdaten und Nutzungsprofilen, MMR, S. 437; vgl. §§ 14, 15 TMG. 204 Vgl. Bauer, a.a.O. 205 Vgl. ULD, Tätigkeitsbericht 2013, 7.1.1, S. 111. 206 Vgl. ebd. 207 Schmitz, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, 16.2, Rn. 220. 208 Vgl. Bauer, a.a.O., S. 438. 209 Vgl. Niemann/Scholz, Privacy by Design und Privacy by Default – Wege zu einem funktionierenden Datenschutz in Sozialen Netzwerken, in: Peters/Kersten/Wolfenstetter, Innovativer Datenschutz, S. 120. 31 derspruchsmöglichkeit und der Zusammenführung von pseudonymen und personenbezogenen Daten scheitern. 4.3.2 Nutzungsprofil durch Zustimmung von Dritten Bei der Bildung von Nutzungsprofilen durch die Zustimmung von Dritten geht es um das Erheben und Hinzuspeichern von Daten, die der Betroffene nicht selbst preisgegeben hat, bzw. bei Schattenprofilen um das Erheben und Speichern von Daten ganz ohne Wissen des Betroffenen. Für beide Fälle müsste eine Rechtsgrundlage existieren, die diesen Vorgang erlaubt. § 15 TMG könnte eine solche Rechtsgrundlage darstellen. Doch diese scheitert insbesondere am Tatbestandsmerkmal der Einwilligung, dem Widerspruchsrecht, sowie an der Zusammenführung von pseudonymen und anonymen Daten mit personenbezogenen Daten, weil bei der Bildung der Nutzungsprofile durch Zustimmung von Dritten eben ein Personenbezug beabsichtigt wird, da dieser nachweislich zu mindestens 40%, wenn nicht sogar noch genauer festgestellt werden kann.210 Bei Facebooknutzern könnte man in den Nutzungsbedingungen nach einem Erlaubnistatbestand suchen, der diesen Vorgang erlauben könnte. Unter dem Punkt „Von Dritten bereitgestellte Informationen über dich“211 findet man tatsächlich eine Passage, die als ein Erlaubnistatbestand verstanden werden könnte: „Wir erhalten Informationen über dich von deinen Freunden sowie anderen Personen, z. B. wenn sie deine Kontaktinformationen hochladen, ein Foto von dir posten, dich auf einem Foto, in einer Statusmeldung oder an einem Ort markieren bzw. dich zu einer Gruppe hinzufügen. Wenn Nutzer Facebook nutzen, können sie Informationen, die sie über dich und andere Personen haben, speichern und teilen, z. B. wenn sie ihre Einladungen und Kontakte hochladen und verwalten.“212 Diese Art der Zustimmung kann nicht Wille des deutschen Datenschutzrechtssystems sein, demnach ist der Charakter eines solchen Erlaubnistatbestandes gleichweg abzulehnen und als Verstoß gegen das Recht der freien Einwilligung des Betroffenen selbst, sowie gegen das Grundrecht der informationel210 Vgl. Horvát et al., One Plus One Makes Three (for Social Networks). Datenverwendungsrichtlinien Facebook, unter dem Punkt Von Dritten bereitgestellte Informationen über dich. 212 ebd. 211 32 len Selbstbestimmung nach Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG anzusehen, insbesondere, weil der Betroffene in diesem Fall selbst nicht bestimmen kann, was mit seinen Daten geschieht. 4.4 Löschungspflicht Wie bereits herausgearbeitet, verstößt Facebook nicht nur im Rahmen der Erhebung, Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten, es verstößt auch gegen die Löschungspflicht nach §§ 13 Abs. 4 S. 2,15 Abs. 8 TMG213. Daten, die zwar von den Nutzern gelöscht werden, tauchen an anderen Stellen wieder auf.214 Bei Wegfall der Erforderlichkeit der Verwendung der Daten, sind diese nach den o.g. Normen zu löschen, es sei denn, es existiert ein erlaubter Verwendungszweck nach § 15 TMG oder anderen Vorschriften.215 Einen Wegfall der Erforderlichkeit könnte ein Ende der Nutzung des sozialen Netzwerks darstellen.216 In diesem Zusammenhang entfällt die Erforderlichkeit der Nutzung der Daten und der Dienstanbieter hat diese zu löschen.217 Jedoch, wenn die Datenerhebung nach den §§ 12 Abs. 1; 15 Abs. 1 TMG gar nicht erst erforderlich war für die Nutzung, greift die Löschpflicht erst recht.218 Die Daten, die Facebook im Rahmen der Besuche der Webseiten mit installierten Social Plugins erhebt, sind bestimmt nicht notwendig für die Nutzung des sozialen Netzwerks. 4.5 Lösungsvorschläge für datenschutzkonformes Verhalten Wie in den bereits behandelten Kapitel konnte man unschwer erkennen, dass Facebook sich weder für den deutschen Datenschutz interessiert, noch für den europäischen. Sollte Facebook jedoch irgendwann Interesse entwickeln, oder Regelungen vorgeschrieben bekommen, z.B. durch ein Verfahren mit Herrn Schrems, das während diese Abschlussarbeit 213 Der Verstoß liegt auch in den §§ 34, 35 Abs. 2 BDSG zugrunde. Vgl. Erd, Datenschutzrechtliche Probleme sozialer Netzwerke, NVwZ, S. 20. 215 Vgl. Schmitz, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, 16.2, Rn. 202. 216 Vgl. Schmitz, a.a.O., 16.2, Rn. 201. 217 Vgl. ebd. 218 Vgl. Schmitz, a.a.O., 16.2, Rn. 205. 214 33 verfasst wird, geplant wird, dann wären dies die möglichen Lösungsvorschläge für Facebook, sowie für die Nutzer von Facebook. 4.5.1 Lösungsvorschläge für Facebook Um sich dem deutschen, sowie dem europäischen Recht anzupassen könnte Facebook bei seinen Datenschutzrichtlinien und den Nutzungsbedingungen beginnen. Es ist weder erkenntlich, wer genau für Facebook verantwortlich ist, noch welche Daten für welche Zwecke verwendet werden und welches Recht Anwendung findet.219 Richard Allan, Facebooks Oberlobbyist konnte Max Schrems in einem Interview auf die Frage, wer denn nun für Facebook verantwortlich sei, keine deutliche Antwort geben.220 Dies ist auch einer der Gründe, warum Herr Rößler, Deutschlands Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, im Mai 2013 nach Kalifornien reiste.221 Neben Absprachen über gesetzeskonforme Verhaltensweisen in Bezug auf den Datenschutz, regte er den Konzern an, einen einheitlichen Ansprechpartner für den Datenschutz in Europa einzuführen.222 Weiterhin ist nicht klar, welche Daten oder Informationen Facebook von den Nutzern verarbeitet und speichert. In dessen Datenverwendungsrichtlinien, heißt es: „Bestimmte Informationen sind erforderlich, um dir Dienste anzubieten. Deshalb löschen wir solche Informationen erst, nachdem du dein Konto gelöscht hast.“223 Welche Informationen gemeint sind, ist dem Nutzer ebenfalls nicht klar. Ferner heißt es in den AGB: „Wir verwenden die uns bereitgestellten Informationen über dich im Zusammenhang mit den Dienstleistungen und Funktionen, die wir dir und anderen Nutzern (wie zum Beispiel deinen Freunden, unseren Partnern, den Werbetreibenden, die Werbeanzeigen auf Facebook buchen, sowie den Entwicklern der von dir genutzten Spiele, Anwendungen und Webseiten) anbieten.“ Auch hier sehr ungenau, da Facebook sich praktisch selbst die Erlaubnis erteilt, personenbezogene Daten im Rahmen aller Dienste, die es in Verbindung mit dem Profilin219 Vgl. Schrems, Universität Passau, Vortrag v. 18./19.0413, ab min. 03:18. Vgl. Schrems, Universität Passau, Vortrag v. 18./19.0413, ab min. 03:48. 221 Vgl. bmwi, Rösler im Silicon Valley: Werben um Investitionen für IT-Standort Deutschland. 222 Vgl. Behrens, Wie Facebook ein deutsches Ministerium vorführt, S. 2, Focus-Online. 223 Datenverwendungsrichtlinien Facebook, unter dem Punkt Löschung. 220 34 haber und anderen Nutzern anwendet, zu verarbeiten. Dies sind nur wenige von sehr vielen Beispielen, wo Facebook Verbesserungen vornehmen sollte, um den Umgang mit den Daten transparenter zu gestalten. Weiterhin ist es essenziell, Webseitenbetreibern, die gerne einen Like-Button auf ihrer Seite installieren möchten, die Möglichkeit zu geben, den Besucher eine Unterrichtung im Rahmen des Widerspruchsrechts nach § 13 Abs. 1 TMG durchzuführen.224 In diesem Rahmen sollten jedoch auch die Webseitenbetreiber mitarbeiten und eine Datenschutzerklärung auf ihrer Webseite einrichten, an welcher das Widerspruchsrecht gekoppelt sein könnte.225 Neben dem Widerspruchsrecht sollte der Nutzer in die Datenverarbeitung, die mit dem Button einhergeht, einverstanden sein und seine Einwilligung dazu abgeben, was wie bereits untersucht, im Falle des Like-Buttons grds. nicht geschieht. Dafür wird in der Literatur eine sogenannte 2-Klick-Lösung vorgeschlagen.226 In diesem Fall ersetzen sogenannte Platzhalter den Button. Ein Beispiel soll dies veranschaulichen: Abbildung 7: Platzhalter statt Like-Button.227 Beim Kontakt der Maus mit dem Platzhalter erscheint ein Text, der den Besucher über die datenschutzrechtliche Situation aufklärt. Somit liegt die Entscheidung und die Macht über die Datenverwendung letztendlich beim Nutzer.228 Die Hochschule für Medien, Stuttgart hat diesen Vorschlag beherzigt und umgesetzt:229 224 Vgl. ULD, Datenschutzrechtliche Bewertung der Reichweitenanalyse durch Facebook ,S. 22. 225 Vgl. ebd. 226 Vgl. Schwenke, Social Media Marketing & Recht, S. 395; vgl. Voigt/Alich, Facebook-Like-Button und Co. – Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit der Webseitenbetreiber, NJW, S. 3544; vgl. Solmecke, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, 21.1 Rn. 30. 227 Startseite der Hochschule für Medien, Stuttgart. 228 Vgl. Solmecke, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, 21.1 Rn. 30. 229 S. Abb. 8. 35 Abbildung 8: Platzhalter und datenschutzrechtliche Belehrung 230 Wie bereits in früheren Kapiteln erwähnt, weist Facebook Ähnlichkeiten mit einer Monopolstellung auf. Dies ist vermutlich auch der Grund, warum der Konzern eher desinteressiert auf Kritik vom ULD, oder auf Anzeigen vom Jurastudenten Max Schrems reagiert.231 Eine Lösung, die Gesetzgeber grds. anstreben könnten, wären Schnittstellen, die es ermöglichen, Daten und Informationen, die man bis dato über sich in seinem Profil veröffentlicht hat, in ein anderes Profil, von einem anderen Anbieter zu übertragen. Facebook könnte sich jedoch auch zu einer Art offenem Netzwerk entwickeln, indem es eine Schnittstelle einbaut, über die eine Option geschaffen wird, mit anderen Netzwerken übergreifend zu kommunizieren.232 Man könnte sich das ähnlich wie bei den vier Telefontarifanbietern, die zurzeit auf dem Markt angeboten werden, vorstellen: Durch die Verknüpfung der Netze ist es möglich von einem in das andere Netz telefonieren zu können.233 So sollte es in der Zukunft auch zwischen sozialen Netzwerken möglich sein. Dies wäre ein möglicher Lösungsansatz für die Zukunft der sozialen Netzwerke, insbesondere für Facebook. Dafür müssten jedoch die Gesetze überarbeitet werden, sodass diese Entscheidung von der Legislative ausgeht, da Facebook höchstwahrscheinlich nicht freiwillig bereit wäre, seine Monopolstellung aufzugeben und sich an alle Regeln und Regelungen zu halten. Ferner sollte Facebook beim Erstellen von Nutzungsprofilen nur noch Nutzungsdaten nach § 15 TMG verarbeiten und somit pseudonyme, oder anonyme Profile erstellen, wie vom Gesetz gewollt234 und von perso230 Startseite der Hochschule für Medien, Stuttgart. Vgl. Schrems, Universität Passau, Vortrag v. 18./19.0413, ab min. 33:30. 232 Vgl. Schrems, Universität Passau, Vortrag v. 18./19.0413, ab min. 34:10. 233 Vgl. ebd. 234 s. dazu: § 15 Abs. 3 TMG; § 3 BDSG. 231 36 nenbezogenen Daten absehen. Die Erstellung von Schattenprofilen wäre ein weiterer Punkt, den das soziale Netzwerk einstellen muss, denn es kann wirklich nicht sein, dass selbst Nichtnutzer unter dem Datenmissbrauch leiden. Doch auch das wird Facebook sicherlich nicht freiwillig tun und müsste von der Legislative angeordnet werden. 4.5.2 Lösungsvorschläge für Facebook-Nutzer Der Datenschutz zählt, wie bereits erwähnt als informationelles Selbstbestimmungsrecht zu den deutschen Grundrechten.235 Das Selbstbestimmungsrecht sollte jeder Nutzer ernst nehmen und sich bewusst darüber sein, welche Daten er von sich preisgibt, da diese mittlerweile nachweislich236 nicht mehr gelöscht werden. Dies bedeutet, dass jegliche Konversationen, die via Facebook stattfinden, jedes Foto, was Nutzer von sich hochladen, alle Interessen, sowie politische Einstellungen, für unbestimmte Zeit gespeichert werden. Was Facebook mit den Daten tut oder vor hat, das verrät es nicht.237 Eine Möglichkeit wäre eine verpflichtende Einbindung eines Videos mit einer Rechtsbelehrung über den Datenschutz. Weiterhin könnte eine Art Anleitung für die recht unübersichtlichen Einstellungen Facebooks eingegliedert werden. Dieses Video sollte so platziert werden, dass eine Registrierung ohne das Anschauen des Videos nicht möglich wäre. In diesem Rahmen wäre der Nutzer besser informiert, beziehungsweise überhaupt über sein Grundrecht zur informationellen Selbstbestimmung informiert und könnte seine Einstellungen danach anpassen. 5. Urteil des LG Berlin vom 30.04.2013 Während diese Abschlussarbeit verfasst wird, wurde ein Urteil des LG Berlin gegen Apple.Inc gefällt.238 Geklagt hat die Verbraucherzentrale Bundesverband gegen das US-amerikanische Unternehmen Apple we- 235 s. Kap. 3.1. Vgl. Schrems, Auf Facebook kannst du nichts löschen, FAZ, (18.04.13). 237 Vgl. Schrems, Universität Passau, Vortrag v. 18./19.0413, ab min. 14:10; vgl. ULD, Datenschutzrechtliche Bewertung der Reichweitenanalyse durch Facebook, S. 5. 238 s. LG Berlin, 15 O 92/12, BeckRS 2013, 08005. 236 37 gen unwirksamer AGB-Klauseln, die Verbraucher unangemessen benachteiligen würden. Das Interessante dabei ist, dass Apple genau wie Facebook einen Hauptsitz in den USA und eine Niederlassung in Irland betreibt, jedoch für diesen Fall, im Gegensatz zu den Beschlüssen des VG und OVG Schleswig, das deutsche Recht als anwendbares erklärt wurde. Jegliche Klauseln wurden für unzulässig erklärt, die insbesondere die folgenden Regelungen als Inhalt hatten:239 Die Datenerhebung Dritter ohne deren Einwilligung Datenweitergabe zu Werbezwecken Globale Einwilligungen Zusammenführen von Nutzungsdaten mit anderen Informationen Die Verfasserin prüft im Folgenden, ob der Fall mit dem von Facebook verglichen werden könnte und ob eventuell im Falle von Facebook ein ähnliches Urteil hätte gefällt werden können. 5.1 Anwendbares Recht Bei der Prüfung des anwendbaren Rechts hat das LG Berlin mit Art. 6 ROM-I-VO argumentiert. Dort heißt es, dass bei Verträgen die ein Verbraucher mit einem Unternehmen schließt, das Recht Anwendung findet, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Folglich würde bei Verbrauchern aus Deutschland, deutsches Recht gelten. Die ROM-I-VO enthält Kollisionsregelungen für vertragliche Schuldverhältnisse in Zivil- und Handelssachen, die eine Verbindung zum Recht verschiedener Staaten aufweisen.240 Nun ist die Frage, ob das Gericht den Eingriffsnormcharakter des Art. 9 ROM-I-VO i.V.m. § 1 Abs. 5 BDSG hätte beachten und die § 1 Abs. 5 BDSG demnach anwenden müssen.241 Dies sei erstmals so dahingestellt. Hätte das Gericht nach § 1 Abs. 5 BDSG entscheiden müssen, müsste die Prüfung ähnlich, wie in Kap. 4.1 ablaufen. Die essentielle Frage die sich dann stellen würde, wäre erneut, ob die Niederlassung in Irland für die Verarbeitung der Da239 Vgl. LG Berlin, 15 O 92/12, BeckRS 2013, 08005. Vgl. Art. 1 Abs. 1 ROM-I-VO. 241 Vgl. Piltz, VZBV gegen Apple – leider nicht super für das Datenschutzrecht. 240 38 ten zuständig ist, oder ob die Daten ähnlich wie bei Facebook, vom Hauptsitz in den USA verarbeitet werden. Eine Passage aus den Nutzungsbedingungen von Apple bestätigt, dass auch in diesem Fall der Mutterkonzern die Daten in den USA verarbeitet: „Persönliche Daten von Personen mit Wohnsitz in einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) werden von Apple Distribution International in Cork, Irland überwacht und in dessen Namen von Apple Inc. verarbeitet.“242 Apple.Inc wäre mithin die entscheidende verarbeitende Stelle nach § 1 Abs. 5 BDSG. Würde man diese Situation mit der von Facebook vergleichen, würde für das soziale Netzwerk ebenfalls das deutsche Recht einschlägig sein. 5.2 Datenerhebung Dritter ohne deren Einwilligung In Klausel 4 der Nutzungsbedingungen von Apple behält sich das Unternehmen das Recht vor, Daten wie Name, Adresse, E-Mailadresse und Telefonnummer von Kontakten des jeweiligen Kunden zu erheben.243 Diese Klausel wurde vom Gericht als unzulässig erklärt, da den betroffenen Dritten keine Möglichkeit eingeräumt wurde, eine Einwilligung abzugeben. Ergo könnte diese Entscheidung deckungsgleich auf die Erstellung von Nutzungs- und Schattenprofilen in dem Fall von Facebook angewendet werden und auch dort eine Unzulässigkeit mit sich bringen. 5.3 Datenweitergabe zu Werbezwecken Der IT-Konzern nahm sich in Klausel 8 das Recht heraus, personenbezogene Daten an strategische Partner weiterzugeben, ohne den Betroffenen darüber zu informieren, um wen es sich dabei genau handelt.244 Das Gericht urteilte, dass die Klausel eindeutig über den Bereich der Vertragserfüllung nach § 28 Absatz 1 Nr. 1 BDSG hinausgeht.245 Der Bereich der Weitergabe von personenbezogenen Daten bei dem Unternehmen Facebook.Inc, wurde in dieser Arbeit nicht untersucht. 242 Nutzungsbedingungen von Apple, Internationale Nutzer. Vgl. LG Berlin, 15 O 92/12, BeckRS 2013, 08005. 244 Vgl. ebd. 245 Vgl. ebd. 243 39 Doch sollte auch dabei herauskommen, dass das soziale Netzwerk dies ähnlich praktiziert, wäre auch in diesem Fall von einer unzulässigen Handlung auszugehen. 5.4 Globale Einwilligung In den Klauseln 1 und 5 wurden globale Einwilligungen vom Gericht als unwirksam erklärt. Globale Einwilligungen entstehen laut dem LG dann, wenn der Umfang der Einwilligung dem Betroffenen gem. § 4a BDSG nicht hinreichend transparent dargelegt wurde.246 Facebook argumentiert, wie bereits herausgearbeitet, in seinen Nutzungsbedingungen ebenfalls mit globalen Einwilligungen. Demnach wäre auch dieses Verhalten rechtlich nicht tragbar. 5.5 Zusammenführen von Nutzungsdaten mit anderen Informationen In Klausel 3 erklärte Apple, dass es personenbezogene Daten mit anderen Informationen verbinden würde, um Produkte, Dienstleistungen, Inhalte und Werbung des Unternehmens zu verbessern. Das Gericht entschied, dass dies gegen die §§ 4, 4a BDSG und §§ 12, 13 TMG verstoße. Dieser Umgang mit Daten würde auch gegen § 15 TMG im Rahmen des Verbotes der nachträglichen Zusammenführung von Nutzungsdaten mit personenbezogenen Daten verstoßen und demnach auch auf die von Facebook erstellten Nutzungs- und Schattenprofile Anwendung finden. Abschließend ist festzuhalten, dass wenn Facebook in diesem Urteil angeklagt worden wäre, würde in den o.g. Punkten ein ähnliches Urteil gefällt werden.247 246 247 Vgl. ebd. S. Umfassende Meinungen zu dem Urteil im Internet: Dr. Carlo Piltz; Prof. Niko Härting; RA Thomas Stadler; RA Sebastian Dosch. 40 6. Fazit Der Richter des Bundesverfassungsgerichts Johannes Masing behauptet, dass die Schwächung der Ordnungsfunktion des demokratischen Rechtsstaats sich nirgends so deutlich zeigt, wie in der Internetkommunikation und damit auch beim Datenschutz.248 Nach datenschutzrechtlicher Untersuchung des erfolgreichsten sozialen Netzwerks der Welt, kann ist sich der Meinung des Richters nur anschließen. Das Fazit dieser Arbeit ist, dass bei Facebook große Lücken insbesondere im Bereich der Informationspflichten herrschen, die diverse Persönlichkeits- und damit einhergehend Datenschutzrechtsverletzungen nach sich ziehen. Die Datenschutzrechtsverletzungen resultieren insbesondere aus der Einbindung des Like-Buttons in externe Webseiten, der Bildung von Nutzungsprofilen von Nutzern sowie Schattenprofilen bei Nichtnutzern, als auch der Speicherung von Daten auf unbestimmte Zeit und das alles, ohne den Nutzer nach seiner Einwilligung zu fragen. Das auf Datenschutzverstöße basierende Geschäftsmodell von Facebook stellt ein Beispiel für internationale Unternehmen dar, wie man trotz Rechtsverstößen profitabel auf dem Markt existieren kann. Facebook nutzt seine monopolähnliche Stellung aus und verhält sich nicht gerade gastfreundlich in Deutschland sowie der EU. Demnach muss der Gesetzgeber sehr bald auf Unternehmen wie Facebook reagieren. Eine möglichst zügige Einführung der EU-Datenschutzreform ist daher zu begrüßen. Die aktuell geltenden europäischen Datenschutzregelungen stammen aus dem Jahre 1995 und müssen dringend an das Zeitalter der Smartphones, der sozialen Netzwerke und des Online-Handels angepasst werden. Dann hört vielleicht auch die Verwirrung über das geltende Recht auf, die zurzeit offensichtlich in deutschen Gerichten herrscht. Zu guter Letzt ist eine Sensibilisierung der Internetnutzer für den Datenschutz unabdingbar. User müssen über den Datenschutz besser informiert werden, um in Zukunft bewusster mit ihren Informationen umgehen zu können und sich über eventuelle Konsequenzen Gedanken zu machen. Das Internet vergisst ja bekanntlich nichts und Facebook scheinbar auch nicht. Man will sich nicht vorstellen, was mit den Daten aller Nutzer passiert, sollte 248 Vgl. Masing, Herausforderungen des Datenschutzes, NJW, S. 2309. 41 jemals ein ernst zu nehmender Hackangriff oder eine Insolvenz von Facebook eintreten. VI Literaturverzeichnis Adamek, Sascha: Die Facebook-Falle – Wie das soziale Netzwerk unser Leben verkauft, 3. Auflage, München: Wilhelm Heyne Verlag, 2011. Alex, Werner Gustav: Marketing Konzept 2.0 – Marketing im WEB 2.0Zeitalter, 2. Auflage, Norderstedt: Books on Demand GmbH Verlag, 2012. Ambs, Friedrich: BDSG § 4 Zulässigkeit der Datenerhebung, verarbeitung und –nutzung, in: Erbs, Georg; Kohlhaas, Max: Strafrechtliche Nebengesetze, Stand November 2012 (192. Lfg.), München: C.H. Beck Verlag, 2012, Rn. 1-20. Bamberger, Heinz Georg (Hrsg.); Roth, Herbert (Hrsg.): Beck’scher Online- Kommentar BGB, München: C.H. Beck Verlag, Stand Februar 2013, Edition: 26, § 12 Datenschutz, Rn. 161-165. Baumgartner, Ulrich; Ewald, Konstantin: Apps und Recht, München: C.H. Beck Verlag, 2013. Di Fabio, Udo, in: Maunz, Theodor; Dürig Günter: GrundgesetzKommentar, Stand November 2012 (67. Lfg.), München: C.H. Beck Verlag, 2012. Dramburg, Sebastian; Schwenke, Thomas: Rechtliche Stolperfallen beim Facebookmarketing, 2011. Gola, Peter; Schomerus, Rudolf: BDSG Bundesdatenschutzgesetz Kommentar, 11. Auflage, München: C.H. Beck, 2012. Grabs, Anne; Bannour, Karim-Patrick: Follow me! – Erfolgreiches Social Media Marketing mit Facebook, Twitter & Co., Bonn: Galileo Computing Verlag, 2011. Kania, Thomas: A. Arbeitsrecht, in: Röller, Jürgen (Hrsg.): Personalbuch, Stand März 2013, München: C.H. Beck Verlag, 2013, Rn. 1-16. Köhler, Thomas R.; Kirchmann, Walter: IT von a bis Z – Das schnelle und kompakte Nachschlagewerk, Frankfurt: Frankfurter Allgemeine Buch Verlag, 2007. Köhler, Thomas R.: Die Internetfalle, Frankfurt: Frankfurter Allgemeine Buch Verlag, 2012. VII Kurz, Constanze; Rieger, Frank: Die Datenfresser – Wie Internetfirmen und Staat sich unsere persönlichen Daten einverleiben und wie wir die Kontrolle darüber zurückerlangen, Frankfurt am Main: Fischer taschenbuch Verlag, 2012. Kühling, Jürgen; Seidel, Christian; Sivridis, Anastasios: Datenschutzrecht, 2. Auflage, Heidelberg: C.F. Müller Verlag, 2011. Moos, Flemming: Datenschutzrecht – schnell erfasst, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2012. Niemann, Fabian; Scholz, Philip: Privacy by Design und Privacy by Default – Wege zu einem funktionierenden Datenschutz in sozialen Netzwerken: Peters, Falk (Hrsg.); Kersten, Heinrich (Hrsg.); Wolfenstetter, Klaus – Dieter: Innovativer Datenschutz, Berlin: Duncker & Humblot, 2012. Schmitz, Peter: Verarbeitung von Bestandsdaten, in: Hoeren, Thomas (Hrsg.); Sieber, Ulrich (Hrsg.); Holznagel, Bernd (Hrsg.): Handbuch Multimedia-Recht, Stand Dezember 2012 (33. Lfg.), München: C.H. Beck Verlag, 2012, 16.2, Rn. 167-187. Schmitz, Peter: Verarbeitung von Nutzungsdaten, in: Hoeren, Thomas (Hrsg.); Sieber, Ulrich (Hrsg.); Holznagel, Bernd (Hrsg.): Handbuch Multimedia-Recht, Stand Dezember 2012 (33. Lfg.), München: C.H. Beck Verlag, 2012, 16.2, Rn. 197-207. Schwartmann, Rolf: Praxishandbuch Medien-, IT- und Urheberrecht, 2. Auflage, Heidelberg: C.F. Müller Verlag, 2011. Schwenke, Thomas: Social Media Marketing & Recht, Köln: O’Reilly Verlag, 2012. Schwindt, Annette: Das Facebook-Buch, 3. Auflage, Köln: O’Reilly Verlag, 2012. Solmecke, Christian: Datenschutz und der Facebook-Like-Button, in: Hoeren, Thomas (Hrsg.); Sieber, Ulrich (Hrsg.); Holznagel, Bernd (Hrsg.): Handbuch Multimedia-Recht, Stand Dezember 2012 (33. Lfg.), München: C.H. Beck Verlag, 2012, 21.1, Rn. 28-31. Spindler, Gerald; Nink, Judith: Anonyme und pseudonyme Nutzung, in: Spindler, Gerald (Hrsg.); Schuster, Fabian (Hrsg.): Recht der elektronischen Medien, 2. Auflage, 2011, § 13 TMG, Rn. 10. Witt, Bernhard C.: Datenschutz kompakt und verständlich, 2. Auflage, Wiesbaden: Viewegt Teubner Verlag, 2010. VIII WP 169, Art. 29, Datenschutzgruppe, Stellungnahme 1/2010 zu den Begriffen „für die Verarbeitung Verantwortlicher“ und „Auftragsverarbeiter“, angenommen am 16. Februar 2010, 00264/10/DE. Zeitschriftenbeiträge: Bauer, Stephan: Personalisierte Werbung auf Social Community Websites – Datenschutzrechtliche Zulässigkeit der Verwendung von Bestandsdaten und Nutzungsprofilen, in: MMR, 2008, Heft 7., S. 435438. Erd, Rainer: Datenschutzrechtliche Probleme sozialer Netzwerke, in: NVwZ, 2011, Heft 1., S. 19-22. Ernst, Stefan: Social Plugins: Der „Like-Button“ als datenschutzrechtliches Problem, in: NJOZ, 2010, Heft 36., S. 1917-1919. Kleinz, Thorsten, o. Datum: „Die Milliarden – Maschine – Wie Facebook mit Ihren Daten Geld verdient, in: c’t 12/2012, S. 82f. Masing, Johannes: Herausforderungen des Datenschutzes, in: NJW, 2012, Heft 32., S. 2305-2384. Redaktion MMR – Aktuell: „Social Plugins“ als weiterer Eingriff in den Datenschutz von Internetnutzern, in: MMR-Aktuell, 2010, Ausgabe 09., S. 303975. Redaktion MMR – Aktuell: LG – Berlin: Facebook unterliegt in Wettbewerbsprozess, in: MMR-Aktuell, 2012, Ausgabe 06., S. 329977. Roßnagel, Alexander: 20 Jahre Volkszählungsurteil, in: MMR, 2003, Heft 11., S. V-760, Rn. 693-694. Schmölz, Joanna: Die DIVSI-Milieu-Studie zu Vertrauen und Sicherheit im Internet: Sicherheit und Datenschutz – nicht nur eine Frage des richtigen Häckchens, in: RDV, 2012, Heft 6., S 290. Voigt, Paul; Alich, Stefan: Facebook-Like-Button und Co.- Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit der Webseitenbetreiber, in: NJW, 2011, Heft 49., S. 3541-3544. IX Weichert, Thilo: Datenschutzverstoß als Geschäftsmodell – der Fall Facebook, in: DuD, 2012, Ausgabe 10, S. 716-721. ZD – Aktuell: VG – Schleswig: Klarnamenpflicht bei Facebook unterliegt irischem Datenschutzrecht, in: ZD-Aktuell, 2013, Heft 3., S. 03459. Internetquellen: Apple Nutzungsbedingungen, Internationale Nutzer: <http://www.apple.com/de/privacy/> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) Behrens, Christoph, v. 23.05.2013: „Wie Facebook ein deutsches Ministerium vorführt“: <http://www.focus.de/finanzen/news/unternehmen/tid-31379/philipproesler-im-silicon-valley-wie-Facebook-ein-deutsches-ministeriumvorfuehrt_aid_996934.html> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) Bethge, Philip u.a., 05.12.2011: „Die fantastischen vier“, in: Der Spiegel, 29/2011: <http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-82612679.html> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) Brainy Quote, Marc Zuckerberg Quotes: <http://www.brainyquote.com/quotes/authors/m/mark_zuckerberg.html> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) Buggisch, Christian, v. 02.01.2013: „Social Media Nutzerzahlen in Deutschland – Update 2013“: <http://buggisch.wordpress.com/2013/01/02/social-media-nutzerzahlenin-deutschland-update-2013/> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) X Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, v. 25.03.2013: „Rösler im Silicon Valley: Werben um Investitionen für IT-Standort Deutschland“ <http://www.bmwi.de/DE/Themen/mittelstand,did=577392.html> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit: Pressemitteilung, 14.03.2013: „Datenschutz in Europa stärken“: <http://www.bfdi.bund.de/DE/Oeffentlichkeitsarbeit/Pressemitteilunge n/2013/85DSK_PressemeldungLDBremen.html?nn=408920> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) Küter, Carolin, 13.03.2013: „Zu wenig Ehrgeiz gezeigt – Datenschutzbeauftragter Peter Schaar fordert von der Politik mehr Engagement“: <http://www.bfdi.bund.de/DE/Oeffentlichkeitsarbeit/RedenUndIntervie ws/2013/WeserKurier13032013.html?nn=408922> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) Beitrag zum „Safe Harbour“ Abkommen: <http://www.bfdi.bund.de/DE/EuropaUndInternationales/Art29Gruppe/ Artikel/SafeHarbor.html?nn=409532> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) Dosch, Sebastian, 07.05.2013: „Kurzer Prozess mit Apples Datenschutzrichtlinien“: <http://klawtext.blogspot.de/2013/05/kurzer-prozess-mit-apples.html> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) Europe vs.Facebook, Anzeige gegen Facebook wegen „Schattenprofilen“: <http://www.europe-v-Facebook.org/DE/Anzeigen/anzeigen.html> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) Facebook: XI Facebook Datenschutzerklärung: <https://www.Facebook.com/legal/terms> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) Facebook Developers, „Like-Button“: <https://developers.Facebook.com/docs/reference/plugins/like/> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) Facebook Datenverwendungsrichtlinien: <https://de-de.Facebook.com/about/privacy/your-info> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) Facebookprofil der Fachhochschule Köln: <https://www.Facebook.com/fhkoeln> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) Fichter, Alina, 24.01.2013: „Der junge Mann und der Multi“, in: Zeit Online <http://www.zeit.de/2013/05/Max-Schrems-Facebook-Datenschutz> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) Horvat, Emöke – Agnes u.a., 06.04.2012, “One Plus One Makes Three (for Social Networks”, in: Universität Heidelberg, 30.04.2012, “Was soziale Netzwerke im Internet auch über Nichtmitglieder wissen können.”: Originalpublikation: <http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pon e.0034740> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) Publikation der Uni Heidelberg: <http://www.uniheidelberg.de/presse/news2012/pm20120430_netzwerk e.html> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) Juneco e.V.: „Jahrbücher“: <http://www.juneco.de/jahrbuecher.php> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) XII Niko, Härting, 07.05.2013: „Nicht überzeugend: LG Berlin zu Apple – Datenschutzbedingungen“: <http://www.cr-online.de/blog/2013/05/07/nicht-uberzeugend-lg-berlinzu-apple-datenschutzbedingungen/> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) Piltz, Carlo, 07.05.2013: „VZBV gegen Apple – leider nicht super für das Datenschutzrecht“: <http://www.delegedata.de/2013/05/vzbv-gegen-apple-leider-nichtsuper-fur-das-datenschutzrecht/> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) Schrems, Max: 26.10.2011: „Auf Facebook kannst du nichts löschen“, in: FAZ.NET: <http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/soziale-netzwerke-aufFacebook-kannst-du-nichts-loeschen-11504650.html> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) Vortrag v. 05.05.2013: „Europe vs. Facebook: Stand und Perspektiven – Max Schrems“, in: Social Media als Geschäftsmodell, 8. Internationales For..Net Symposium, Universität Passau: <http://video.uni-passau.de/video/Europe-vs-Facebook%253A-Standund-Perspektiven---MaxSchrems/34fecd24664eed739076d684f044cdfd> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) Präsentation v. Vortrag v. 05.05.2013: „Europe vs. Facebook: Stand und Perspektiven – Max Schrems“, in: Social Media als Geschäftsmodell, 8. Internationales For..Net Symposium: <http://europe-v-Facebook.org/passau.pdf> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) Stadler, Thomas: XIII 18.08.2011: „Gilt deutsches Datenschutzrecht für Facebook überhaupt?“ <http://www.internet-law.de/2011/08/gilt-deutsches-datenschutzrechtfur-Facebook-uberhaupt.html> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) 07.05.2013: „Zentrale Datenschutzklauseln von Apple sind rechtswidrig“: <http://www.internet-law.de/2013/05/verschiedenedatenschutzklauseln-von-apple-sind-rechtswidrig.html> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) Startseite der Hochschule für Medien, Stuttgart: <http://www.hdm-stuttgart.de/> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) Startseite der Fachhochschule Köln: <http://www.fh-koeln.de/> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) Tatsachen über Deutschland: „Bevölkerung“: <http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/inhaltsseitenhome/zahlen-fakten/bevoelkerung.html> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) Telekom, Was ist Facebook eigentlich?, o. Datum: <http://www.t-online.de/computer/internet/Facebook/id_45084978/wasist-Facebook-eigentlich-.html> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein: Beiträge zu Facebook: XIV <https://www.datenschutzzentrum.de/Facebook/> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) Tätigkeitsbericht 2013, 19.03.2013: Datenschutz als globale Herausforderung: <https://www.datenschutzzentrum.de/material/tb/tb34/kap07.htm#71> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) Pressemitteilung, 21.09.2012: Konzentrierte Aktion von datenschützern gegen Facebook“: <https://www.datenschutzzentrum.de/presse/20120921datenschuetzer-gegen-Facebook.htm> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) Beschwerdebegründung zum Beschluss des VG Schleswig v. 14.02.2013, Az.: 8 B 61/12: <https://www.datenschutzzentrum.de/Facebook/20130312beschwerdebegruendung-Facebook-inc.html> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) Schreiben vom 18.01.13, an das Verwaltungsgericht Schleswig: <https://www.datenschutzzentrum.de/Facebook/20130204-Facebookklarnamen.html> (zuletzt abgerufen am: 02.06.2013) XV Rechtsprechungsverzeichnis AG Berlin Mitte, Urteil v. 27.03.2007, Az. 5 C 314/0, Telemedicus. <http://tlmd.in/u/133> AG München, Urteil v. 15.06.2012, 158 C 28716/11, BeckRS, 2012, 17813. LG Berlin, Urteil v. 06.03.2012, Az. 16 O 551 /10, Telemedicus. <http://tlmd.in/u/1354> LG Berlin, Urteil v. 30.04.2013, 15 O 92/12, BeckRS 2013, 08005. VG Schleswig, Beschluss vom 14.02.2013 - 8 B 61/12, BeckRS 2013, 46930. OVG Schleswig, Beschluss vom 22.04.2013 - 4 MB 11/13, 2013, 49919. BeckRS XVI Eidesstaatliche Erklärung Ich versichere, die von mir vorgelegte Arbeit selbständig verfasst zu haben. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder nicht veröffentlichten Arbeiten anderer entnommen sind, habe ich als entnommen kenntlich gemacht. Sämtliche Quellen und Hilfsmittel, die ich für die Arbeit benutzt habe, sind angegeben. Die Arbeit hat mit gleichem Inhalt bzw. in wesentlichen Teilen noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen. Köln, den _______________________________