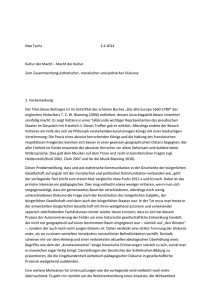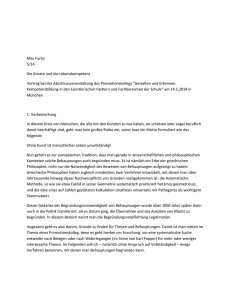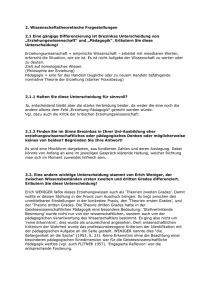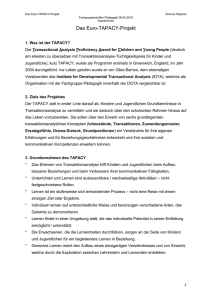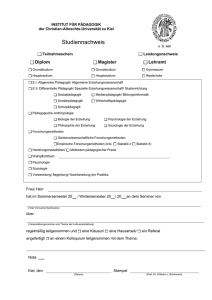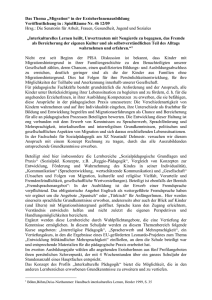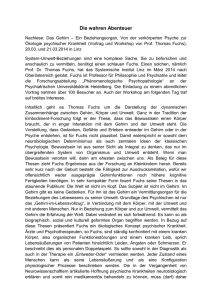- Max Fuchs
Werbung
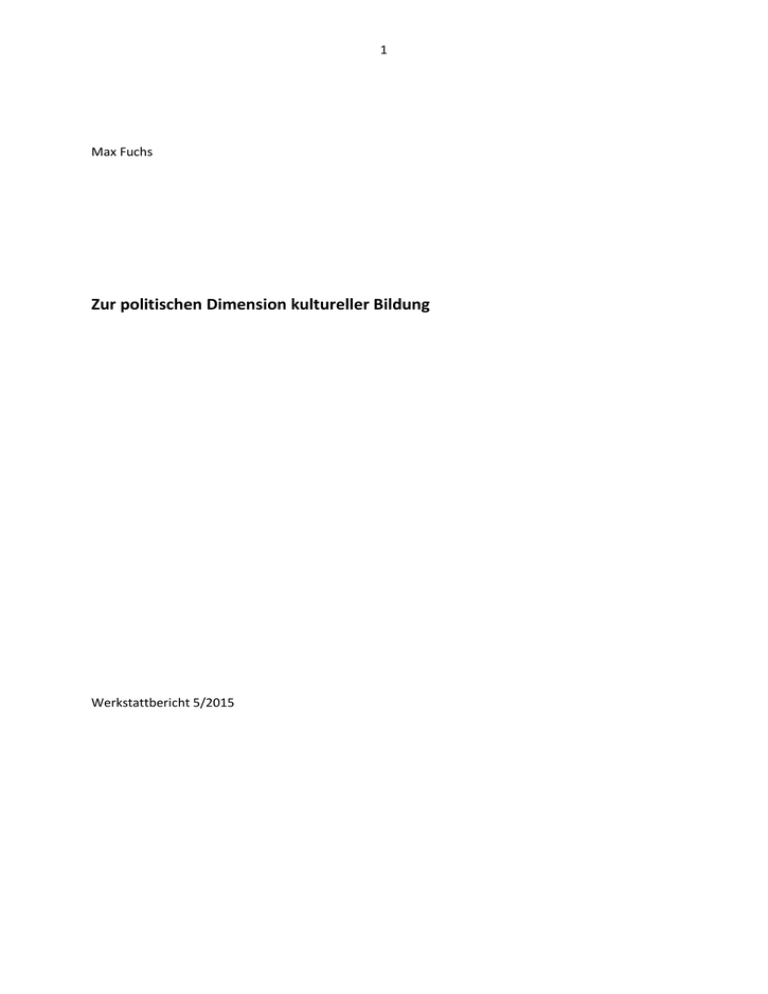
1 Max Fuchs Zur politischen Dimension kultureller Bildung Werkstattbericht 5/2015 2 Inhaltsverzeichnis 1. Zur Einführung 3 2. Zur politischen Dimension von Bildung 5 3. Kunst, Ästhetik und Politik: Hinweise zu ihrem Zusammenhang 14 4. Kulturelle Bildungspolitik und Educational Governance 36 5. Kulturelle Bildung, das Subjekt und die Menschenrechte 52 6. Schlußbemerkung 58 3 1. Zur Einführung Dass die Geschichte der Bildung sowohl auf der Ebene der theoretischen Reflexion als auch im Hinblick auf die Realgeschichte der Institutionalisierung eines umfassenden Bildungssystems aufs engste mit jeweiligen politischen Rahmenbedingungen verbunden ist, zeigt ein auch nur oberflächlicher Blick in eine beliebige historische Darstellung. Selbst eine ideen- und geistesgeschichtlich orientierte Darstellung kommt nicht umhin, das jeweilige Verständnis von Bildung einzuordnen in das wissenschaftliche und philosophische Denken der betreffenden Zeit. Zudem kann man leicht feststellen, dass wichtige Denker, die sich mit Bildung und Erziehung befasst haben, zugleich auch darüber nachgedacht haben, welcher Weise die Gemeinschaft politisch gestaltet werden soll. So findet man etwa bei Platon oder bei Wilhelm von Humboldt wichtige bildungstheoretische Erörterungen in ihren staatstheoretischen Schriften: Pädagogik und Politik sind zwei Seiten derselben Medaille. Kommt man von der Politik her, so landet man automatisch bei der Frage danach, wie die Subjekte beschaffen sein müssen, die die vorgestellte politische Vision auch realisieren können. Kommt man dagegen von der Pädagogik her, so muss man sich die Frage stellen, unter welchen politischen Bedingungen die vorgetragene pädagogische Vision realisiert werden kann. In beiden Fällen wird man sich zudem mit der Frage auseinandersetzen müssen, welche Bedingungen in der jeweiligen Realität die Umsetzung der politischen bzw. pädagogischen Vision verhindern. Das bedeutet aber zugleich, dass jedem Nachdenken über Politik oder Pädagogik eine kritische Grundhaltung immanent sein muss. Natürlich fallen die Antworten auf die Frage nach dem Verhältnis zwischen Pädagogik und Politik sehr unterschiedlich aus. Dies gilt nicht nur für die jeweilige politische Ausrichtung, es gilt auch für die Wege der Argumentation. Verbreitet ist etwa die Vorstellung, dass auf dem pädagogischen Wege erst diejenigen Subjekte geformt werden müssen, die die jeweilige politische Vision später dann auch realisieren können. In jedem Fall setzt man die (politische) Konstitution der Gesellschaft in eine enge Relation zu der (pädagogischen) Konstitution des Einzelnen. Eine ästhetische Praxis spielt dabei in zahlreichen philosophischen Konzeptionen eine besondere Rolle. So setzt sich bereits Platon in seinen staatstheoretischen Schriften ausführlich mit der Frage auseinander, welche Kunstsparten in der von ihm vorgestellten Polis erwünscht und welche unerwünscht sind. Trotz dieser langen Tradition einer Verbindung von pädagogischen, kunsttheoretischen und politischen Erwägungen erlebt das 18. Jahrhundert einen qualitativen Sprung bei der Behandlung dieses Fragekomplexes. Bekanntlich hat Alexander Baumgarten Mitte des Jahrhunderts „Ästhetik“ als neue philosophische Disziplin begründet. Er wählte diese - lange umstrittene - Bezeichnung für die neue Disziplin, weil sich deren griechische Grundbedeutung auf sinnliche Erkenntnis bezieht. Genau darum ging es ihm: um eine Rehabilitation der sinnlichen Seite des Menschen. Diese Rehabilitation war zumindest auf dem europäischen Kontinent deshalb nötig, weil seit Descartes der Rationalismus die dominante philosophische Richtung war. Dieser Rationalismus wurde immer mehr als unzureichend erkannt, weil mit der Wende zur Neuzeit der Mensch auf Entdeckungsreise ging. Das gilt in geographischer Hinsicht (durchaus nicht in humanistischer Absicht) und er entdeckte – aus der Perspektive Europas – neue Kontinente. Es gilt in wissenschaftlicher Hinsicht, was zu einer Explosion des Wissens führte. In beiden Dimensionen des Entdeckens waren die Sinne ein entscheidendes Instrument. 4 Mit eine Rolle spielte dabei durchaus auch der Aspekt, dass mit Newton wichtige Fortschritte im Bereich der experimentellen Philosophie (so nannte man die entstehenden Naturwissenschaften) auf englischem Boden geschahen, was philosophisch durch die sensualistische Philosophie von John Locke fundiert wurde. Damit ergab sich auf der Ebene der Wissenschaften und der Philosophie ein Pendant zu einem Konkurrenzverhältnis zwischen England und Frankreich, so wie es seit langem auf der Ebene des Politischen bestand. Man muss sehen, dass bei aller Eigenlogik der philosophische Reflexion und der wissenschaftlichen Forschung diese nicht im luftleeren Raum stattfinden, sondern in vielfältiger Weise mit außerphilosophischen Interessen verbunden sind. Dazu kommt, dass auch Denkformen und Begrifflichkeiten nicht bloß auf der Ebene der Reflexion entwickelt werden, sondern dass diese oft eine Basis im praktischen Verhalten der Menschen haben. So gibt es durchaus interessante Studien darüber, inwieweit in den realen Praktiken der entstehenden modernen Gesellschaft die Basis für abstrakte Begriffe gefunden werden kann, die in den philosophischen und wissenschaftlichen Systemen benötigt werden (so etwa im Anschluss an Sohn-Rethel, A.: Geistige und körperliche Arbeit. Frankfurt/M. 1976). Auch das Projekt der neuen philosophischen Disziplin Ästhetik ist in diesen Kontext eingebunden. Denn der Streit zwischen Rationalismus und Sensualismus war nicht bloß ein Streit um eine widerspruchsfreiere philosophische Konzeption, sondern er wurde überlagert durch politische Entwicklungen. Es ist die Zeit der Aufklärung, der sich entwickelnden bürgerlichen Gesellschaft, es ist die Zeit des Niedergangs des anciens regime. Wenn man sich daher die Frage danach stellt, wieso ausgerechnet Mitte des 18. Jahrhunderts die neue philosophische Disziplin Ästhetik begründet wurde, so wird man die Veränderungen in den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des Lebens und Denkens nicht vernachlässigen dürfen. Die Brücke zu der eingangs beschriebenen Komplementarität von Politik und Pädagogik dürfte dabei in der These zu finden sein, die Terry Eagleton (Ästhetik. Stuttgart 1994) zum Ausgangspunkt seiner Darstellung der Geschichte des ästhetischen Denkens gewählt hat: dass nämlich mit der Debatte des Ästhetischen auch ganz andere Fragen verbunden waren, die erst die Relevanz des Ästhetischen begründeten. Es ging nämlich primär um die Frage nach der Konstitution des (bürgerlichen) Subjekts. Damit erhält das Beziehungsverhältnis zwischen Pädagogik und Politik einen dritten Pol. Im Folgenden sollen einige Erkenntnisse darüber zusammengetragen werden, wie sich diese Beziehungen zwischen Pädagogik, Politik und Ästhetik historisch entwickelt haben, wobei man im Blick behalten muss, dass dieser interdependente Entwicklungsprozess sowohl auf der Ebene der Praxis als auch auf der Ebene der theoretischen Reflexion geschieht und sich beide Ebenen permanent gegenseitig beeinflussen. 5 2. Zur politischen Dimension von Bildung Anliegen Bildung wird entsprechend einer klassischen Definition als wechselseitige Verschränkung von Mensch und Welt (W. v. Humboldt) verstanden (Fuchs: Kulturelle Bildung. München 2008). Die politische Dimension des Bildungsbegriffs lässt sich dabei (u. a.) an der Rolle festmachen, in welcher Weise mit Partizipation als einem Grundelement des Politischen umgegangen wird (Gerhardt, V.: Partizipation. München 2007).Diese Rede von einer „wechselseitigen Verschränkung von Mensch und Welt“ bedeutet bereits, dass es nicht um einen isolierten Einzelnen ohne soziale und politische Bezüge gehen kann: Der Einzelne wird in diesem Verständnis von Bildung als Subjekt seines Lebens aufgefasst. „Subjektivität“, verstanden als Fähigkeit und Bedürfnis zum Gestalten des eigenen Lebens und dessen Rahmenbedingungen, ist dabei ein eminent politisches Konzept, das aufgrund der ebenfalls angesprochenen Handlungsorientierung zur politischen Einmischung geradezu auffordert (Fuchs 2012). Dies wird bereits dort deutlich, wo die Verbindung von Bildung, Subjektivität, Politik und Kunst erstmals in einen Zusammenhang gebracht wird: In den Konzeptionen von Friedrich Schiller und Wilhelm von Humboldt. Ich werde darauf zurückkommen. An dieser Stelle könnte man daher ruhig aufhören zu lesen. Denn auf konzeptioneller Ebene scheinen alle Probleme gelöst zu sein: Natürlich ist „Partizipation“ Bestandteil eines aktuellen Bildungsbegriffs, zumal gerade die künstlerischen Arbeitsformen eine Menge Möglichkeiten bieten, die öffentliche Wirksamkeit der Kinder und Jugendlichen zu unterstützen. Dies zeigen auch die Praxisbeispiele in diesem Buch. Trotz dieser scheinbaren Eindeutigkeit gibt es jedoch sowohl auf konzeptioneller Ebene, aber auch in der Praxis Probleme und auch Widerstände. Im Folgenden will ich durch eine erneute Betrachtung des Bildungsbegriffs zeigen, dass es sich bei diesen Friktionen nicht um eine widerständige Position handelt, die gegen besseres Wissen unterhalb der Möglichkeiten und Notwendigkeiten eines zeitgemäßen Bildungskonzepts bleibt, sondern die vielmehr sehr viel mit der Spezifik des (deutschen) Bildungsdiskurses zu tun hat. Wir sind hier Erben einer zumindest 200jährigen Tradition, die zur Kenntnis zu nehmen nicht bloß sinnvoll ist, um genauer heutige Widersprüche zu verstehen, sondern deren Kenntnis auch Teil der Selbstanwendung des oben skizzierten Bildungskonzeptes darstellt: nämlich die Herstellung eines bewussten Verhältnisses zur eigenen Geschichte in einem hoch sensiblen Punkt. Vielleicht motiviert zusätzlich die folgende These zur Beschäftigung mit einer Ideen- und Sozialgeschichte des Bildungsbegriffs, die 200 Jahre und länger zurückreicht. Die These lautet: „Bildung“ ist eine zentrale pädagogische Kategorie. Dies ist jedoch nur ein Teil der Wahrheit. Man versteht die Rolle von „Bildung“ in der deutschen Geschichte – auch in der Diskussion über den sogenannten „Sonderweg“ Deutschlands – jedoch erst dann richtig, wenn man „Bildung“ als spezifisch deutsche Antwort auf soziale und politische Problemlagen betrachtet, für die in anderen Ländern völlig andere Antworten gefunden worden sind. Um einen Vorgeschmack zu geben, worum es sich hierbei handeln könnte, will ich bloß die bürgerlichen Revolutionen in England und vor allem 6 in Frankreich anführen: „Bildung“ ist zu einem guten Stück deutscher Ersatz für eine nicht stattgefundene beziehungsweise erfolglose bürgerliche Revolution. Damit wird „Bildung“ sofort sehr viel stärker zu einem politischen Begriff, als seine bloß pädagogische Konnotation und Verwendungsweise zunächst vermuten lässt. Allerdings zeigt diese These über den politischen Ursprung des Bildungskonzeptes bereits einen ersten Schritt zur Entpolitisierung, der später noch vertieft werden soll: Insofern spätestens seit und mit der Romantik die politische Konnotation zugunsten einer nur noch individualistischkünstlerischen Auslegung zurück gedrängt wird – und dies in durchaus politischer Absicht! „Entfremdung“ als Krisenerfahrung der Moderne: Jean Jaques Rousseau Leu (in BKJ 2000, 25 ff.) weist am Anfang seines Beitrages auf Rousseau (1712–1778) und das veränderte Bild vom Kinde hin, das nunmehr als „Wesen eigener Geltung“ aufgefasst wird. Dies ist – wie Leu später am Beispiel anderer wissenschaftlicher Kindheitsbilder zeigt – ein „gesellschaftliches Konstrukt“, das mit anderen Konstrukten – zum Teil bis heute – konkurriert. Warum kommt Rousseau zu dieser Veränderung in der Sichtweise? Um dies zu verstehen, ist es notwendig, nicht bloß die überall spürbare Überkommenheit des Ancien Régime, sondern auch die bis dahin nur intellektuelle oder künstlerische Kritik an den Zuständen der Zeit, so wie sie die Aufklärer Voltaire, Diderot und d'Alembert betreiben, einzubeziehen. Rousseau schließt sich bei aller kritischen Grundhaltung gegenüber dem bestehenden maroden ökonomischen und politischen System dem Lob der Zivilisation und der Vernunft durch die Enzyklopädisten nicht an. Auslöser für seine neue gesellschaftskritische Haltung, so beschreibt er es später selbst in seinen verschiedenen Lebensrückblicken, ist die Preisaufgabe der Akademie von Dijon im Jahre 1750: „Hat der Wiederaufstieg der Wissenschaften und Künste zur Läuterung der Sitten beigetragen?“ Rousseau antwortet mit seinem ersten Discours, in dem er ein klares Nein begründet. Man hat, gerade in der Pädagogik, lange Zeit den politischen Rousseau des „Gesellschaftsvertrages“, den Kultur- und Zeitkritiker Rousseau der beiden „Discours“, den Schriftsteller und den Verfasser des „Emile“ strikt voneinander unterschieden. Ich gehe davon aus, dass es sinnvoll ist, sein Werk einheitlich, also als Synthese von Zeitkritik, politischer Philosophie, Anthropologie, Pädagogik und Literatur zu sehen. Denn die gemeinsame krisenhafte Grunderfahrung, die Rousseau eindrucksvoll beschreibt und für deren Behebung er seine politischen und pädagogischen Entwürfe entwickelt, ist die der Entfremdung: Zivilisation ist mitnichten Fortschritt, sondern hat vielmehr zur Zerrissenheit, zur Zerstörung einer zunächst vorhandenen Natürlichkeit und schließlich auch zu den schlimmen Zuständen in Politik und Gesellschaft geführt. Das neue Bild des Kindes als „Wesen eigener Geltung“ ist daher notwendiger systematischer Teil dieses umfassenden Entwurfes, aus dem sich dann auch 7 konsequent ein neues Verständnis von Pädagogik entwickelt. Und dieses ist kompatibel mit seiner Politiktheorie. Es ist kein Wunder, dass es die griechische Polis ist – freilich ebenfalls ein idealtypisches Konstrukt –, das als Vorbild für die Unmittelbarkeit der politischen Steuerung dient und das er in seiner überschaubaren Heimatstadt Genf angewandt wissen will: Alle Polisbürger entscheiden, führen aus, spüren sofort die Auswirkung ihres Handelns und werden dadurch erneut zu einem weiteren politischen Engagement motiviert. Anthropologie, Politik und Pädagogik gehören daher in diesem Entwurf zusammen. Ein Auseinandertriften des Einzelnen und seiner Gesellschaft soll vermieden werden. „Selbstliebe“, ein zentrales Konzept von Rousseau, ist daher gerade kein Gegensatz zu sozialer und politischer Beteiligung, sondern geradezu integraler Bestandteil. Damit formuliert Rousseau eine moderne Fortsetzung des griechischen Ideals: Nämlich nur dadurch, dass der Polisbürger seine Polis-Pflichten erfüllt, kann er als Individuum seine Glückansprüche realisieren. Hier wird der Bezug zwischen Lebenskunst und Bildung, zwischen Pädagogik und Politik, zwischen individueller und gesellschaftlicher Entwicklung deutlich. Man mache es sich klar: Schon alleine die Tatsache, dass über Gemeinsamkeiten und Unterschiede von individueller Lebensgestaltung und sozialer Mitwirkung nachgedacht werden muss, ist spätestens seit Rousseau ein Indikator für Entfremdung und Entzweiung und zeigt an, wie krisenhaft sich die Moderne entwickelt hat, wenn das Ganze und seine Teile in ein derart konflikthaltiges Verhältnis zueinander geraten. Rousseau formuliert als erster mit unglaublichem Nachdruck diese Kritik an der Moderne. Alle Autoren der Folgezeit, gerade auch die Deutschen Kant, Herder, Schiller, Humboldt und Hegel, setzen sich mit Rousseau auseinander. Er ist trotz seines tragischen Lebensschicksals einer der wichtigsten – vielleicht der wichtigste – Autor des 18. Jahrhunderts. Die Probleme, die er benennt, sind bis heute hochrelevant und stehen daher im Mittelpunkt bei Marx und Nietzsche, bei Weber und Simmel bis hin zu dem Streit zwischen Kommunitaristen und Liberalen. Denn auch hierbei geht es genau um diese Frage: Ist es der Einzelne mit seinen egoistischen Interessen, seinem Eigennutz, in dessen Verfolg automatisch ein Soziales entsteht, das eine optimale Güterversorgung gewährleistet (Liberalismus), oder ist es eher die Gemeinschaft mit ihren Werten und Normen, die Vorrang haben sollte (Kommunitarismus)? „Bildung“ – eine deutsche Antwort Als Begründer des deutschen Bildungskonzeptes gilt Wilhelm von Humboldt (1767– 1835). Die Quellen des deutschen Bildungs-Begriffs sind gut untersucht. Es ist etwa das theologische Konzept des „imago dei“ einflussreich, also die Vorstellung des Menschen, den Gott als sein Ebenbild 8 geschaffen hat. Hierauf sind alle Assoziationen zurückzuführen, die Bildung in den Bedeutungszusammenhang von „Bild“ stellen. Auch die eher künstlerisch inspirierte Vorstellung von „Bildung“ im Sinne einer Formung, so wie sie auch im französischen „formation“ und in der englischen „formation“ angesprochen wird, ist mit dieser Vorstellung verwandt. Näher an Humboldt rückt man mit Begriffen, die „Bildung“ als „cultivation“ (englisch und französisch) deuten, wobei die landwirtschaftliche Konnotation bekanntlich auf Ciceros tusculanische Schriften zurückgeht (colere als pflegen). Diese biologisch-pflanzliche Assoziation als Hege und Pflege gibt es bis heute in der Pädagogik, etwa im Begriff des Kindergartens, wobei die Rousseausche Vorstellung mitgegebener Anlagen, die durch geeignete Pflege zum Erblühen gebracht werden, stets präsent ist. Die diesem Gedanken entsprechende programmatische These ist, dass der Mensch erst werden muss, was er (von seinen natürlichen Anlagen her) ist. Ebenso wie bei Rousseau ist auch der Blick auf Humboldt durch die Geschichte des pädagogischen Denkens des 19. Jahrhunderts verstellt. Und ebenso wie bei Rousseau zeigt die jüngere Humboldtforschung, was Zeitgenossen noch selbstverständlich war: die Einheit des politischen und pädagogischen Denkens, was etwa an der politischen Funktion des Altertums im Bildungsdenken von Humboldt gezeigt werden kann(s. u.). Allerdings geht eine spezifische Einseitigkeit ebenfalls auf Humboldt zurück: die Konzentration auf das (bloß) Geistige. Man erinnere sich: Der junge Humboldt macht entsprechend seinem höheren gesellschaftlichen Rang unter der Leitung eines Privatlehrers seine obligatorische Bildungsreise auch ins (revolutionäre) Frankreich. Sein Lehrer ist der prominente Aufklärungsdenker Campe, das Schulhaupt der „Philanthropen“, einer in der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts überaus einflussreichen Pädagogengemeinschaft. Die Französische Revolution wird – auf der Basis der Kritik am Ancien Régime von Rousseau, aber auch der Enzyklopädisten – von den deutschen Intellektuellen neugierig beobachtet. Der junge Hegel, zu dieser Zeit Student im theologischen Tübinger Stift verfolgt die Entwicklung ebenso wie Schiller oder Kant. Das Freiheitspathos des deutschen Sturm und Drang zeigt, wie sehr alle kritischen Intellektuellen glaubten, dass nunmehr die von Rousseau so scharf gebrandmarkte Ungleichheit und Unterdrückung aufgehoben werden können. Alle relevanten Denker befassen sich zu dieser Zeit mit beiden Fragen: der Rolle der „richtigen“ Verfassung des Staates und der Funktion der Erziehung. Kant hält Vorlesungen zur Pädagogik und denkt gleichzeitig über den „ewigen Frieden“ nach. Hegel schreibt über Staatsrecht und Verfassungen und war viele Jahre als Leiter eines Gymnasiums in Nürnberg bildungspolitisch und – theoretisch involviert. Man muss sich zudem verdeutlichen, dass wir uns in der Hochzeit der Weimarer Klassik befinden. Kant hat seine wesentlichen Schriften publiziert (er stirbt 80jährig im Jahre 1804). Neben Rousseau ist er es, der das intellektuelle Leben immer mehr bestimmt. Er gilt als „Kopernikus der Philosophie“, weil er – revolutionär – die Macht in das erkennende und tätige 9 Subjekt gelegt hat. Dieses ist es, das mit seinen Kategorien die Wahrnehmungsinhalte erst konstituiert; dieses ist es, das eigenverantwortlich über richtig und falsch entscheidet; und dieses ist es, das ästhetische Geschmacksurteile fällt. Aber: Bei all diesen Prozessen wird das Soziale und Allgemeine mitgedacht, stellt sich bei aller Individualität von Erkenntnis, Moral und Geschmack ein soziales Allgemeines her. Dies ist der raffinierte „Trick“, so wie er etwa im sensus communis, der Konzeption des „Gemeinsinns“, zum Ausdruck kommt: Jeder entscheidet zwar selber. Aber in verinnerlichter Form ist das Urteil der Anderen immer auch im individuellen Entscheidungsprozess präsent, so dass das Soziale und Gemeinsame in Form von Intersubjektivität entsteht. Der Einzelne und die Gemeinschaft sind daher aufs engste miteinander verbunden. Dieses ist eine einflussreiche idealtypische Konstruktion am Reißbrett, an der sich die Empirie bewähren muss. Und die Empirie erfüllt mitnichten diese hohen Anforderungen. Daher denkt der studierte Jurist von Humboldt über geeignete und ungeeignete Verfassungen nach, die eben die Herausbildung einer solchen sozialen Individualität erleichtern oder erschweren. Er schreibt (kritisch!) im Jahre 1792 über die Grenzen der Staatstätigkeit. Und genau in dieser staatstheoretischen Schrift findet sich seine verbreitetste Definition von Bildung: „Der wahre Zweck des Menschen ist die höchste und proportionirlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. In dieser Bildung ist Freiheit die erste und unerläßliche Bedingung“. (Band 1, S. 64) Dies zu unterstützen ist der (einzige und vornehmste) Zweck des Staates. Der Staat hat Rahmenbedingungen zu schaffen, darf jedoch niemals Selbstzweck werden: Der einzige legitime Zweck des Menschen ist der Mensch selbst. „Bildung“ wird daher der Schlüsselbegriff dieser politischen Konzeption: Bildung ist Selbstbildung des Menschen. „Der Mensch“ wird bei Humboldt im Laufe seines Lebens mehr und mehr zum „Individuum“. Dies ist der Kern des Liberalismus, den Humboldt hier auf der Grundlage der Kunsttheorie und Moralphilosophie von Kant formuliert. Auch „die Griechen“, die – ebenso wie bei Rousseau – ein zentrales Gewicht im Bildungsdenken Humboldts erhalten, bedeuten mitnichten ein Rückzug aus der widerständigen Welt. Denn in Griechenland hat sich (idealtypisch gesehen) eine solche Kultur entwickelt, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, die den Staat in seiner dienenden Funktion sieht und die daher emanzipatorisches Modell für eine gegenwärtige politische und Bildungspraxis werden kann. „Distanz“ von einer schlechten Gegenwart – auch durch eine alte Sprache –, „Bildung“ am idealtypischen Beispiel, Formung der inneren Kräfte an einer wohlausgebildeten Kultur: Dies ist Humboldts Lösung des Problems der Entfremdung. Identität findet der Mensch nur über diesen Umweg. In diesem individuellen Bildungsprozess erobert sich jedes Individuum je für sich dasselbe Allgemeine, so dass im Ergebnis trotz der hohen Individualität des Prozesses gelebte Allgemeinheit entsteht. 10 Schiller hat in seinen „Briefen zur ästhetischen Erziehung“ – in enger Freundschaft mit Humboldt – in diesem politisch-pädagogischen Prozess die Rolle der Künste hervorgehoben. Gerade angesichts des „Terreur“ von Robespierre erschien die Reform der Gesellschaft über Bildungsprozesse als die im Vergleich zu einer Revolution humanere Lösung. So erklärt sich vielleicht, dass das Ziel immer noch ein politisches war, der Weg dazu jedoch keine politische Tat, sondern die Beschäftigung mit der Antike, mit dem Griechischen, mit Kunst. „Bildung“ ist hier immer noch emanzipatorisch und politisch gedacht. In der Verlagerung auf das Geistige wird jedoch die Grundlage dafür gelegt, dass sich als Trägergruppe eine aristokratische „Bildungselite“ als Teil des Bürgertums konstituiert, die das zunächst emanzipatorische neuhumanistische Bildungskonzept zu einer reaktionären Stützungsideologie einer überkommenen politischen Ordnung macht. Das Gymnasium, das Humboldt als Ort der Freiheit und „Bildung“ geplant hatte, wird zur üblen Paukschule, die später nur noch um die Berechtigung kämpft, als einzige Schulform den Zugang zur Universität zu ermöglichen. Heinrich Mann hat gleich zwei Produkte dieser Entwicklung im Wilhelminischen Reich beschrieben: den Gymnasialprofessor Unrat und den Chemiker und Unternehmer Hessling („Der Untertan“); der eine als durchaus mitleiderheischende tragische Gestalt, der andere bereits nur noch mit Verachtung zu strafen. Das ist also aus der Humboldtschen Vision des „gebildeten Menschen“ geworden! Politik wird zum schmutzigen Geschäft, für das die Geistesarbeiter und Kunstbeflissenen zu fein sind. Thomas Mann gibt in seiner Entwicklung ein gutes Beispiel: Am Ende des ersten Weltkrieges proklamiert er in seinen „Betrachtungen eines Unpolitischen“ den Rückzug aus der Politik, was er 1938 deutlich korrigieren muss. Dies ist die vielleicht tragisch zu nennende Geschichte des humanistischen Bildungskonzeptes: Als geistiges Konzept der Überwindung von Entfremdung und der Gestaltung eines humanen Gemeinwesens wird es in einer scheinbar antipolitischen Umdeutung im 19. Jahrhundert zu einem äußerst wichtigen politisch-ideologischen Konzept der Repression, der Herrschaft und Reaktion. Arbeit als Bildung: Hegel und Marx „Bildung als Ritterschlag des Bürgertums“ – so lautet eine bürgerlich-selbstbewusste Charakterisierung der sozialen Funktion, die Bildung im 19. Jahrhundert erhält. Doch macht sich schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch in Deutschland, bei dem das Bürgertum mit einer erheblichen Verspätung gegenüber Frankreich oder gar England seinen Anteil an der politischen Macht (vergeblich) reklamiert, die Erkenntnis breit, dass mit der Emanzipation des Bürgertums immer noch ein – zudem ständig wachsender – Bevölkerungsanteil von gesellschaftlicher Partizipation und Mitsteuerung ausgeschlossen bleibt: Frühsozialisten in England und Frankreich entdecken die Arbeiterklasse. Im herkömmlichen öffentlichen Bildungssystem bleibt dieser Klasse 11 bestenfalls die Volksschule, ständiges Stiefkind des Erziehungssystems. Einen neuen Weg, diese ins pädagogische und politische Geschäft einzubeziehen, beschreitet – freilich kaum in klassenkämpferischer Absicht – Hegel. Dieser war als Autor der „Phänomenologie des Geistes noch lange nicht der preußische Staatsphilosoph der späten Jahre, sondern im Jahre 1805 junger, schlecht bezahlter außerordentlicher Professor in Jena auf der Suche nach einer Stelle, die ihm zumindest ein Mindestmaß an Lebensstandard garantiert, so dass er endlich heiraten kann. Geradezu abenteuerlich ist seine Flucht vor den französischen Truppen, das Manuskript seines Grundwerkes in der Tasche. Und dieses Grundwerk liest sich nicht bloß als philosophischer Bildungsroman, sondern enthält den Kern einer Dialektik der Arbeit: Der Mensch erzeugt sich selbst durch Arbeit. Und so macht er auch plausibel, dass der unterdrückte Knecht, der die Dinge für seinen Herrn schafft, eben dadurch diesen in seine Abhängigkeit bringt. Arbeit schafft Herrschaftsbeziehungen, aber man muss aufpassen, sonst werden diese aufgrund der immanenten Logik der Arbeit umgedreht. Freiheit, Bildung, Arbeit, Herrschaft: Diesen Zusammenhang greift Marx – ebenfalls auf der Grundlage der Anerkennung von gravierenden Entfremdungserscheinungen – auf. Zunehmend entwickelt Marx eine politische Lösung des Entfremdungs- (und damit Bildungs-)problems. Und: Der Weg zur Bildung als Befreiung führt nicht mehr über die Griechen, sondern – später – über praktisches Tun (polytechnische Bildung), zunächst jedoch über Revolution. Wohlgemerkt: Es geht immer noch um das klassische Problem der Entfremdung des Menschen von sich selbst. Es geht immer noch um Herrschaft und Freiheit. Und es geht immer noch um Subjektivität und Geschichte. Doch wird nun das Subjekt ein kollektives: die Klasse der Proletarier. Und es wird die individuelle Subjektivität als Teilhabe an dieser kollektiven Subjektivität gedeutet. „Aneignung“ steht nach wie vor an. Doch ist es nun eine praktische Aneignung durch Arbeit, die die Freiheit schafft, die Bildung ausmacht. Damit ist ein neuer Ansatz geboren, der seither – zustimmend oder abwehrend – das politische und pädagogische Denken prägt. Aktuelle Bildungstheorie muss sich mit all diesen Konzeptionen auseinandersetzen: der emanzipatorischen Tradition von Schiller und Humboldt, die jedoch von Anfang an Handeln auf bloß geistiges Handeln beschränkte; die reaktionäre Überlagerung, die daraus ein Instrument der Erhaltung von undemokratischen und repressiven Strukturen macht, und die praktisch-politische Lösung des Entfremdungsproblems durch Revolution bzw. durch Arbeit. Die aktuelle Diskussion Es ist vor diesem ideologischen Hintergrund durchaus verständlich, dass man auf dem Weg zu einem demokratischen Bildungswesen gerade in Zeiten der Bildungsreform der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts auf ein derart diskreditiertes Konzept von „Bildung“ verzichten wollte. Trotzdem gab es 12 bei den Schülern und Enkelschülern der Vertreter der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik (Nohl, W. Flitner, Litt, Spranger, Weniger) erhebliche Bemühungen zur Modernisierung des Bildungskonzeptes, zur Wiedergewinnung von beidem: dem emanzipatorischen und dem politischen Gehalt. Zu nennen sind hier in erster Linie Wolfgang Klafki, Hans-Joachim Heydorn, Herwig Blankertz und Klaus Mollenhauer. Der Weg, den ich hier skizziert habe, mag manchem überflüssig erscheinen. Doch sollte man bedenken, dass kulturelle Traditionen – und solche haben das Verständnis des deutschen Bildungsbegriffs stark geprägt – immer dann besonders wirken, wenn man glaubt, sie ignorieren zu können. Die hier skizzierte Entwicklungslinie hat in dieser Form nur in Deutschland stattgefunden. Dies macht den deutschen Bildungsbegriff so unhandlich im internationalen Diskurs. Er ist jedoch zu rekonstruieren als tief verankert mit der Entwicklung der Politik, der Künste und der Pädagogik in Deutschland, so wie ich es eingangs skizziert und ausführlicher in meinem Beitrag zu dem Buch „Lernziel Lebenskunst“ (BKJ 1999) dargestellt habe. Aus bildungstheoretischer Sicht die Einbeziehung von Partizipation in die kulturpädagogische Praxis zu betreiben, ist sinnvoll und notwendig, eben weil Bildung immer schon ein pädagogischer und vielleicht sogar noch stärker ein politischer Begriff war und ist. Die Betonung der politischen Dimension von „Bildung“ ist daher zugleich eine Wiederentdeckung des ursprünglichen, aber zwischenzeitlich verschütteten Konzeptes von Bildung, die deshalb notwendig ist, weil die ursprünglichen Anlässe nach wie vor aktuell sind: Entfremdung und Herrschaft zugunsten von Freiheit und Demokratie abzubauen und zugleich soziale Individualität – eben: Bildung als humane Lebensform – zu ermöglichen. Die Grundidee dieses Bildungskonzeptes bleibt also erhalten, die Umsetzung – auch auf konzeptioneller Ebene – muss natürlich die 200 Jahre, die inzwischen vergangen sind, berücksichtigen. Dies bedeutet insbesondere, die qualitative Messlatte für Prozesse der Partizipation hoch genug zu legen und sich nicht mit Akten bloß symbolischer Politik zufrieden zu geben. Literatur Fuchs, M.: Kulturpolitik als gesellschaftliche Aufgabe. Eine Einführung in Theorie, Geschichte, Praxis. Opladen/Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 1998. Fuchs, M.: Kultur Macht Politik. Studien zur Bildung und Kultur der Moderne. Remscheid: BKJ 1998. Fuchs, M.: Die Macht der Symbole. Ein Versuch über Kultur, Medien und Subjektivität. München: Utz 2012 Fuchs, M.: Persönlichkeit und Subjektivität. Opladen: Leske&Budrich 2001 Hegel, G. F. W.: Werke. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1983 13 Heydorn, H.-J.: Über den Widerspruch von Bildung und Herrschaft. Frankfurt/M. 1970. Heydorn, H.-J.: Zu einer Neufassung des Bildungsbegriffs. Frankfurt/M.: 1972. Heydorn, H.-J./Koneffke, G.: Studien zur Sozialgeschichte und Philosophie der Bildung I + II. München 1973. Humboldt, W. v.: Werke in fünf Bänden (Hg.: A. Flitner/K. Giel). Darmstadt: WBG 1960. Kocka, J.: (Hg.): Bürgertum im 19. Jahrhundert. Deutschland im europäischen Vergleich. Drei Bände. München: dtv 1988. Koselleck, R. (Hg.): Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert. Teil II: Bildungsgüter und Bildungswissen. Stuttgart: Klett-Cotta 1990. Mann, Th.: Gesammelte Werke, 12 Bde. Frankfurt/M.: Fischer 1960. Marx-Engels-Werke (MEW). Berlin 1958ff. Meier, Chr.: Die Entstehung des Politischen bei den Griechen. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1989. Meyer, Th.: Die Transformation des Politischen. Frankfurt/M: Suhrkamp 1994. Nipperdey, Th.: Deutsche Geschichte. 1800 - 1866. Bürgerrecht und starker Staat. München: Beck 1983. Reese-Schäfer, W.: Grenzgötter der Moral. Der neuere europäisch-amerikanische Diskurs zur politischen Ethik. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1997 Rousseau, J.-J.: Schriften in zwei Bänden. (Hg.: H. Ritter). München: Hanser 1978. Schiller, F.: Sämtliche Werke, Bd. V: Erzählungen, theoretische Schriften. München: Hanser 1959. Steenblock, V.: Theorie der kulturellen Bildung. Zur Philosophie und Didaktik der Geisteswissenschaften. München: Fink 1999. Vierhaus, R.: Bildung. In: Brunner, O./Conze, W./Koselleck, K. (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. 1. Stuttgart 1971. Weil, H.: Die Entstehung des deutschen Bildungsprinzips. Bonn: Bouvier 1967. 14 3. Kunst, Ästhetik und Politik: Hinweise zu ihrem Zusammenhang A) Die Künste Seit Menschen über sich selbst nachdenken, denken sie offenbar auch darüber nach, ob und wie bestimmte Bereiche ihres Tuns miteinander zusammenhängen oder sich sogar wechselseitig bedingen. So stellten schon die frühen Geschichtsschreiber Zusammenhänge her zwischen der Lebensweise und den geographischen Bedingungen der Völker, über die sie berichteten. Es sollte daher auch nicht verwundern, dass auch Zusammenhänge zwischen den Künsten, der politischen Gestaltung und der Erziehung der Menschen hergestellt worden sind. Im ersten Kapitel wurde gezeigt, wie eng Pädagogik und Politik miteinander zusammenhängen und wie diese engen Zusammenhänge auch immer wieder diskutiert wurden. Auch die ästhetische Praxis der Menschen wurde zu beidem in Beziehung gesetzt: zu dem Problem der Erziehung und zu der Aufgabe der politischen Gestaltung. Neben die ästhetische Gestaltung selbst tritt spätestens seit den Griechen auch die Reflexion über diese ästhetische Praxis, so dass sich im Hinblick auf die wechselseitige Beeinflussung drei Pole ergeben, die man im Hinblick auf ihre Beziehungen untereinander betrachten kann: die Künste selbst, die theoretische Reflexion über sie und die Politik, wobei man bei Letzterer auch die praktische und die theoretische Seite unterscheiden kann. Eine solche Betrachtungsweise hat eine lange Tradition. So spricht der Schweizer Kulturhistoriker Jacob Burckhardt (2007) in seinen weltgeschichtlichen Betrachtungen von den drei „Potenzen“ Kultur, Religion und Staat und untersucht die wechselseitigen Beziehungen. Dabei weist Burckhardt die Frage danach zurück, ob eine der drei untersuchten Potenzen eine Priorität gegenüber den anderen habe (785). Bekanntlich haben sich auch materialistische Ansätze für solche Zusammenhänge interessiert, wobei man der materiellen Basis die Priorität gegenüber dem geistigen Überbau zugesprochen hat. Solche vereinfachenden Kausalitätsvorstellungen konnten in der Praxis immer wieder widerlegt werden, da sie die Eigenlogik in der Entwicklung der Künste oder der Wissenschaften vernachlässigten. Selbst Marx und Engels sprachen lediglich davon, dass die materielle Basis in letzter Instanz den entscheidenden Entwicklungsimpuls gebe und sich nicht jede Regung des Geistes unmittelbar auf entsprechende Entwicklungen in der ökonomischen Basis zurückführen ließe. In diesem Kapitel können natürlich nur einige Hinweise auf solche Zusammenhänge gegeben werden. Auf den engen Zusammenhang, den Platon zwischen einer ästhetischen Praxis und der politischen Gestaltung gesehen hat, bin ich eingangs schon eingegangen. Im Hinblick auf die Frage nach der politischen Dimension der Künste und des ästhetischen Denkens könnte man nunmehr einige 15 Unterscheidungen treffen: Man kann danach fragen, inwieweit die Akteure im Bereich der Künste und des Ästhetischen sich selber politisch engagierten und was das mit ihrer genuinen Arbeit zu tun hatte. Man kann danach fragen, inwieweit im Bereich der Künste politische Themen aufgegriffen worden sind. Verlässt man den unmittelbaren Bereich der künstlerischen Produktion, so kann man danach Fragen, inwieweit die Organisationsform der Künste etwas mit den jeweiligen politischen Rahmenbedingungen zu tun hat, ob etwa die jeweilige Politik die Künste durch die Einrichtung bestimmter Institutionen (etwa Akademien wie in Frankreich im 17. Jahrhundert) bzw. durch die Vorgabe berufsspezifischer Bedingungen unterstützt und beeinflusst hat. Natürlich spielt auch die Bereitstellung von Finanzen eine Rolle. In umgekehrter Richtung lässt sich fragen, inwieweit durch künstlerische Aktivitäten eine bestimmte Politik unterstützt oder verhindert worden ist. Immerhin gewinnt man durch eine künstlerische Praxis eine Öffentlichkeit (weshalb etwa Faulstich in seiner mehrbändigen Geschichte der Medien die Künste mit einbezieht) und es ist unstrittig, dass Kunstwerke den Menschen berühren und beeinflussen. Diesen Aspekt der Beeinflussung der Beziehung von Künsten zu den Menschen habe ich an anderer Stelle Mentalitätspolitik (Fuchs 2013) genannt. Den Zusammenhang zwischen den Künsten und dem Politischen oder allgemeiner: der Gesellschaft untersuchen insbesondere sozialgeschichtliche Darstellungen der jeweiligen Kunstpraxen. So befasst sich das berühmte Standardwerk von Arnold Hauser (1990) mit der Sozialgeschichte der bildenden Kunst und der Literatur und verfolgt diese von der älteren Steinzeit bis zu den Filmkunstwerken der jungen Sowjetrepublik. Das Funkkolleg Kunst (Busch 1987) beschreibt die Geschichte der Kunst im Wandel ihrer Funktionen (so der Untertitel) und unterscheidet systematisch die religiöse, die ästhetische, die politische und die abbildende Funktion von Kunst. Es wird gezeigt, dass es völlig selbstverständlich war, dass die Kunst der Darstellung der Macht (des Fürsten oder der Kirche) diente und später eine wichtige Rolle bei der Herstellung eines Nationalbewusstseins spielte. Aber auch in dem Kapitel über die ästhetische Funktion der Kunst wird gezeigt, welche Bedeutung das Ästhetische im Hinblick auf die Formung des Subjekts hat und dass man auf der Basis dieser Grundüberzeugung die Künste nicht nur im Bereich der angewandten Künste (Wohnungsausstattung, Design, Architektur, Mode) förderte, sondern auch für die später als autonom verstandenen Künste entsprechende Einrichtungen und Förderinstrumente schaffte, damit sie ihre sozialen Funktionen erfüllen konnten (Wagner 2009). Dabei ist immer wieder daran zu erinnern, dass zwar eine explizite Rede einer Kunstautonomie ein Kind des späten 18. Jahrhundert ist, dass aber auch diese Rede von einer Kunstautonomie aufs engste verbunden war mit Vorstellungen einer politischen und sozialen Nutzung vgl. Fuchs 2012). 16 Schiller (1959) war bekanntlich der erste, der in raffinierter Weise die politische Dimension einer als autonom verstandenen und damit in einem Schutzraum praktizierten Kunst für die Formulierung einer politischen Vision nutzte. Die Vielfalt der Bezüge zur Gesellschaft und zur Politik ist beachtlich. So kann man anhand der Motive und Themen den jeweiligen Zeitgeist und den Wandel gesellschaftlicher Verhältnisse erkennen. Wenn etwa nicht mehr bloß Adlige, sondern auch Bürgerliche und – im 19. Jahrhundert bei Courbet – unterbürgerliche und proletarische Menschen und ihre Lebenssituationen dargestellt werden, wenn man überhaupt den Menschen in seiner Einzigartigkeit literarisch oder bildlich den Mittelpunkt eines Werkes stellt, dann ist dies Ausdruck eines erheblichen gesellschaftlichen Wandels (Fuchs 2001). Es gab auch immer wieder Versuche, Verbindungen zwischen der Struktur der Werke und der Struktur der Gesellschaft herzustellen. In der Literaturtheorie des Philosophen Lucien Goldmann wird der Gedanke entfaltet, dass die Struktur des Romans korrespondiere mit der Struktur der jeweiligen Gesellschaft. Panofsky stellte eine Verbindung her zwischen der Struktur der Architektur und dem logischen Aufbau der philosophischen Systeme und brachte dies in Verbindung mit seiner (später von Bourdieu übernommenen) Theorie des Habitus (Bourdieu 1994). Spätestens seit dem 19. Jahrhundert versuchten Kunsttheoretiker den Wandel des Stils in den Künsten mit Veränderungen in anderen Bereichen der Gesellschaft in Verbindung zu bringen. Noch weiter gehen sol´che Untersuchungen, die Veränderungen im Bereich der Künste in Verbindung bringen mit Veränderungen in der Art und Weise der sinnlichen Wahrnehmung und deren intellektueller Verarbeitung bei den Menschen. Es ist bekannt, dass die Erfindung der Zentralperspektive mit einer Veränderung der Wahrnehmungsformen der Menschen zu tun hatte. Auch der Kunsthistoriker Heinrich Wölfflin verankerte seine Arbeiten über „kunstgeschichtliche Grundbegriffe“ in einer Geschichte des Sehens. Eine weitere Dimension, die offensichtlich etwas mit gesellschaftlichen Veränderungsprozessen zu tun hat, ist die Art und Weise der Organisation der verschiedenen Kunstformen. Man spricht davon, dass mit der Entstehung der modernen Gesellschaft eine Autonomisierung der verschiedenen Kunstfelder stattfindet (für die Literatur vgl. etwa Schmidt 1989). Diese Autonomisierung der Kunstfelder kann dabei im Hinblick auf verschiedene Dimensionen betrachtet werden: Sie ist verbunden mit der Professionalisierung der jeweiligen Künste. Sie ist verbunden mit der Art und Weise, wie ästhetische Standards entstehen und sich durchsetzen. Sie ist verbunden damit, in welcher Weise eine Berufstätigkeit im Feld des Künstlerischen möglich wird. Sie ist zudem verbunden mit einem möglichen Funktionswandel der Künste in der Gesellschaft. Dies betrifft etwa die Trägerund die Nutzergruppen der Künste. Insbesondere ist es spätestens seit dem 18. Jahrhundert das Bürgertum, das bei der Produktion der Künste, ihrer Finanzierung, ihrer Verbreitung und ihrer 17 Nutzung eine immer bedeutendere Rolle spielt. Balet und Gerhard (1972) gehen in ihrer Studie der „Verbürgerlichung der deutschen Kunst, Literatur und Musik im 18. Jahrhundert“ nach und versuchen, die Verbindungslinien zwischen dem Stilwandel in den betrachteten Künsten in dieser Zeit und der gesellschaftlichen Entwicklung aufzuzeigen: „Verbürgerlichung heißt den Autoren nicht nur Kapitalisierung des Wirtschaftslebens und Durchsetzung bürgerlicher Normen und Verkehrsformen in den Teilbereichen des sozialen und kulturellen Lebens; sie bezeichnen vielmehr mit diesem Terminus auch das innere telos, nach dem im Laufe des Jahrhunderts zunehmend die Künste ihre Stoffe verarbeiten: also den sozialen Inhalt des von Balet und Gerhard konstatierten Stilwandels.“ (G. Mattenklott in Balet/Gerhard 1972, XI). Ähnlichen Fragestellungen geht nicht nur die Geschichtsschreibung der einzelnen Künste, sondern auch die Soziologie der unterschiedlichen Kunstsparten nach. Doch wie steht es nun mit der reflexiven Dimension des Ästhetischen, welche Zusammenhänge lassen sich hier aufzeigen? B) Kultur der Macht – Macht der Kultur. Zum Zusammenhang ästhetischer, moralischer und politischer Diskurse Vorbemerkung Der Titel dieses Beitrages ist dem Untertitel des schönen Buches „Das alte Europa 1660-1789“ des englischen Historikers T. C. W. Blanning (2006) entliehen, dessen Umschlagsbild diesen Untertitel sinnfällig macht: Es zeigt Voltaire in einer Tafelrunde wichtiger Repräsentanten des preußischen Staates im Gespräch mit Friedrich II. Dieses Treffen gab es wirklich. Allerdings endete der Besuch Voltaires am Hofe des sich als Philosoph verstehenden kunstsinnigen Königs mit einer beidseitigen Verstimmung: Die Praxis eines absolut herrschenden Königs und die Haltung des französischen respektlosen Freigeistes konnten sich besser in einer gewissen geographischen Distanz begegnen. Bei aller Freiheit im Geiste erwartete der absolute Herrscher vor allem Gehorsam und duldete keine Widersprüche. Dies galt dem Musiker auf dem Thron erst recht in künstlerischen Fragen (vgl. Heidenreich/Kroll 2002, Clark 2007 und für die Musik Blanning 2010). Dieser Problemstellung, dass und wie ästhetische Kommunikation in der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft auf engste mit der moralischen und politischen Kommunikation verbunden war, geht der vorliegende Text (nicht zum ersten Mal; vergleiche etwa Fuchs 2012 a und b) nach. Dabei ist das primäre Interesse ein pädagogisches. Dies mag vielleicht etwas weniger irritieren, wenn man sich 18 vergegenwärtigt, dass ein gemeinsames Band der verschiedenen, allerdings noch wenig unterschiedenen Diskurse die Frage nach der Konstitution des bürgerlichen Subjekts, der bürgerlichen Gesellschaft und dann auch des bürgerlichen Staates war. In der Tat muss man heute in der entwickelten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren weitgehend autonom und voneinander separiert stattfindenden Fachdiskursen immer wieder daran erinnern, dass es sich bei diesem Prozess der Autonomisierung der Felder um eine historische gesellschaftliche Entwicklung handelt, die nicht nur geographisch auf einen bestimmten Raum eingegrenzt war – nämlich auf „den Westen“ –, sondern der auch noch recht jungen Datums ist. Daher verdeckt eine strikte Trennung der Diskurse mehr, als sie zu einem vertieften Verständnis menschlicher Befindlichkeiten verhilft. Deshalb scheinen mir vor dem Hintergrund einer verbreiteten aktuellen ideologischen Überhöhung eines Begriffes wie dem der „Kunstautonomie“ einige historische Erinnerungen nützlich zu sein, zumal man es inzwischen sogar fertig bringt, Darstellungen der Geschichte der ästhetischen Bildung zu präsentieren, die die Eingebundenheit ästhetisch-pädagogischer Diskurse in gesellschaftliche Prozesse weitgehend ausblenden. Eine weitere Motivation für Untersuchungen wie die vorliegende wird vielleicht noch mehr überraschend. Es geht mir nämlich um die Weiterentwicklung eines Ansatzes, die Wirksamkeit kultureller Schulentwicklung zu untersuchen. An einer anderen Stelle (Fuchs 2014) habe ich versucht, den großen Begriff der Menschenwürde mit seinen Facetten (Selbstbestimmung, Selbstbild, Selbstwirksamkeit etc.) als Messlatte für die Wirksamkeit pädagogisch-künstlerischer Interventionen nutzbar zu machen. Inwieweit trägt eine entsprechende ästhetische Praxis, so die Frage, dazu bei, dass sich auch im Kontext von Schule starke Subjekte entwickeln? Mit dieser Frage ist allerdings bereits ein systematischer Zusammenhang von politischen, moralischen, ästhetischen und pädagogischen Diskursen hergestellt. Diesen Zusammenhang gilt es – auch in seiner historischen Entwicklung – zu erläutern. Im Kontext der kulturellen Schulentwicklung ersetzt dies natürlich nicht die Mühe, eine praktikable Methodologie nicht nur der konkreten Schulentwicklung, sondern auch ihrer Evaluation zu erarbeiten. Es ist lediglich eine flankierende Untersuchungsrichtung, die zeigt, dass sich gerade die Pädagogik nicht auf eine eher technokratische quantitative Evaluationsforschung ohne Verlust ihrer kulturellen und humanen Dimension begrenzen lässt. Zudem haben die Organisationstheorien und die Theorien der Schulentwicklung die zu verändernden Institutionen längst als Orte entdeckt, in denen Machtspiele eine wichtige Rolle spielen (Stichwort „Mikropolitik“), so dass möglicherweise eine Aufdeckung des Zusammenhangs von Kunst/Kultur und Macht auf der großen Bühne der Gesellschaft auch eine Relevanz haben könnte auf der kleinen Bühne der Schule. Man wird sehen! 19 Zum Grundwiderspruch der (entstehenden) bürgerlichen Gesellschaft: Freiheit und/oder Determinismus Die Schule als ein Kind der Moderne steht als solches im Brennpunkt der „Pathologien des Sozialen“ (Honneth 1994). Insbesondere zeigt sich dies an der Funktionsbestimmung von Schule: In einer pädagogischen Perspektive geht es primär – manche sagen: ausschließlich – um die Entwicklung des Einzelnen, andere thematisieren die gesellschaftlichen Anforderungen an die Schule (Qualifikation, Legitimation, Allokation/Selektion und Enkulturation). Es liegt auf der Hand, dass sich je nach Perspektive sehr unterschiedliche Vorstellungen von Schule ergeben (Weigand 2005, Fuchs 2012c, Apel 1995, Fend 2006). Wieder andere meinen, dass beide Perspektiven sich ergänzen müssen, zumal Individualität nur im sozialen Kontext entstehen kann, so dass die subjektorientierte und die gesellschaftliche Perspektive nicht in einen Gegensatz zueinander gesetzt werden dürfen. So sehr diese letzte Perspektive zwar theoretisch zutrifft und als Vision anzustreben ist, so ergeben sich doch in der Realität immer wieder Spannungen. Das Interessante hierbei ist, dass diese Spannungen zwischen Individuum und Gesellschaft nicht immer existiert haben bzw. nicht als solche empfunden wurden, sondern historisch entstanden sind, nämlich mit der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft. Zudem ist ein analoger Widerspruch in allen Gesellschaftsfeldern (und nicht nur in der Schule) zu finden, so dass er auch nicht isoliert in der und für die Schule gelöst werden kann. Vielmehr zeigt es sich, dass dieser Widerspruch sowohl in der Erkenntnistheorie, in der politischen Theorie – eng verbunden mit der Debatte über Ethik und Moral – und auch in der Ästhetik gefunden und bearbeitet worden ist. Dies soll im Folgenden skizziert werden. Zunächst einmal muss man sich verdeutlichen, dass in der Tat dieser Widerspruch erst in der Neuzeit auftaucht, ja erst dann auftauchen kann. Denn er ist eng verbunden mit der Denkfigur des einzelnen Individuums, das selbst verantwortlich für die Gestaltung seines Lebens ist. Erst als dieser Einzelne Ausgangspunkt des Denkens wurde, stellte sich nämlich das Problem, wie mehrere dieser (zunehmend autonomen) Einzelnen überhaupt eine Gemeinschaft, ein Volk dann auch noch einen Staat bilden können und wollen. Zwar gibt es viele Argumente dafür, dass das Denken aus der Perspektive eines Einzelnen nicht erst in der Renaissance entdeckt oder – wie manche sagen – sogar erst erfunden wurde (Burckhardt 2006, Dülmen 1997, vgl. auch Fuchs 2001). So ist der Hinweis auf die Bekenntnisse des Augustinus (354 – 430), also einer Lebensbeschreibung, bei der ein einzelnes Individuum im Mittelpunkt steht, natürlich relevant. Auch die Einzelschicksale in der griechischen Tragödie sind anzuführen (vgl. insgesamt Fetz 1998; siehe auch Fuchs 2001 und 2012). Doch ist das Denken sowohl in der Antike als auch im Mittelalter wesentlich eines, das vom Kollektiv ausgeht. Der Einzelne ist lediglich (je nach Stand!) Teil der Polis bzw. Teil eines Lehens, eines Reiches, in jedem Fall 20 aber: Teil der katholischen Kirche. Dabei bezieht sich bereits der Begriff des Katholischen von seiner griechischen Wortbedeutung her auf das Allgemeine. Es war also trotz der angeführten Einzelfälle ein enormer Paradigmenwechsel, als sich die Umstellung auf das Denken in Kategorien des Einzelnen in und nach der Renaissance vollzog. Die Reformation ist dabei ein wichtiger Teil dieses Prozesses, da nunmehr der Einzelne unmittelbar gegenüber Gott sein Handeln verantworten muss (Luther war Augustinermönch, steht also in einer diesbezüglichen Tradition). Dies macht daher auch die kultur- (und nicht bloß die literatur-) geschichtliche Bedeutung von Petrarca und seinem Aufstieg auf den Mont Ventoux verständlich, da er sich sehr deutlich – auch über sein individuelles ästhetisches Erleben der Natur – als Gestalter seines Lebens versteht. Diese Entwicklung ist in dieser Form ausschließlich eine europäische Erscheinung. Denn bis zum Ende des 20. Jahrhunderts konnte der Ethnologe Clifford Geertz (1987) noch feststellen, dass das Denken in Kategorien einer individuellen Persönlichkeit im Weltmaßstab als eine sehr eigenartige Idee gelten muss. Wie wenig dieses Problem Individuum und/oder Gesellschaft bis heute gelöst ist, lässt sich zudem an dem interessantesten philosophischen Streit der letzten Jahrzehnte erkennen, nämlich an dem Streit zwischen dem philosophischen Liberalismus (unter anderem John Rawls), der von dem einzelnen Individuum ausgeht, und den Kommunitaristen, die die Gemeinschaft prioritär sehen (Brumlik/Brunkhorst 1993). Vieles, wenn nicht sogar alles am ästhetischen, politischen und moralischen Denken in Europa lässt sich auf diesen individuumsbezogenen Denkansatz beziehen. Um ein erstes Beispiel zu zitieren: „Europa hat den Staat erfunden.“ – So beginnt Reinhard (1999, 15) sein preisgekröntes Werk über die „Geschichte der Staatsgewalt“. Das Buch handelt von der Entstehung, Legitimation, Erhaltung und dem Verlust von Macht, wobei die Genese des Staates in unserem heutigen Verständnis mit der Neuzeit und damit mit dem Denken in Kategorien der Individualität verbunden ist. Denn: „Auch noch in der Frühneuzeit setzte sich die Gesellschaft weniger aus autonomen Individuen als aus Gruppen und Interaktionsnetzen zusammen, in denen die Individuen bereits auf Gedeih und Verderb verkettet waren.“ (ebd. S. 23). Die allmählich entstehende Staatsgewalt war natürlich auch mit sich verändernden ökonomischen Bedingungen verbunden. Es spielten allerdings auch kulturelle Prozesse eine so große Rolle, dass man „Staatsbildung als kulturellen Prozess“ (Asch/Freist 2005) beschreiben kann. In diesem Prozess der entsprechenden Mentalitätsentwicklung, der geistigen Durchdringung von Staatshandeln und seiner Legitimation spielt das Kulturelle also genau die Doppelrolle, die in der Überschrift formuliert wird: 21 Die Macht nutzt zum einen die Kultur (Religion, Künste, Bildungswesen, Wissenschaften etc.) zur eigenen Stabilisierung. Daher beschreibt Reinhard die Kulturpolitik neben Gewalt, Finanzen und Diplomatie als viertes Machtmittel und integralen Bestandteil der Machtpolitik (a. a. O., Kapitel IV.4). Zum andern entfalten die – immer mehr um ihre Autonomie ringenden - Kulturmächte eine eigenständige Macht, den Staat, seine Institutionen und Akteure zu beeinflussen. In diesem Prozess spielt die Ästhetik eine wichtige Rolle (wobei bekanntlich der Begriff der Ästhetik Mitte des 18. Jahrhunderts von A. Baumgarten erfunden wurde und bis ins 19. Jahrhundert umstritten blieb). In dem Moment, in dem die natürliche oder gottgegebene Ordnung (ein König „von Gottes Gnaden“) zunehmend infrage gestellt wird, stellt sich das Problem, wie man sich den Zusammenhalt der Gesellschaft vorstellen kann. Dies hängt entschieden mit dem Menschenbild zusammen, also damit, ob man den Menschen als zoon politikon (Aristoteles) oder als isolierte Monade (Leibniz) versteht. Eine Diskurslinie ist dabei, dass es die wilden Triebe, quasi die Naturseite des Menschen, sind, die zu Gewalt und Krieg führen, weshalb diese zu domestizieren sind (König 1992). Auf der Basis einer solchen negativen – allerdings auch realistischen – Anthropologie hat Thomas Hobbes seine Konstruktion von Gesellschaft und politischer Ordnung aufgebaut (der Mensch ist dem Menschen ein Wolf). Nachfolger von ihm haben versucht, aus individuellen Charakterschwächen (zum Beispiel einem „natürlich“ gegebenen Egoismus) einen gesellschaftlichen Nutzen zu entwickeln. Dies ist – allerdings über 100 Jahre später – die Grundidee der ersten Theorie des Kapitalismus, die der Moralphilosoph (!) Adam Smith entwickelt hat. Hobbes Ansatz ist dabei von einer kaum zu überschätzenden Bedeutung. Denn er rezipiert die neue Naturwissenschaft in ihrem Ziel und in ihrer Methode, die Natur als gesetzmäßigen Zusammenhang zu begreifen (Fuchs 1984). Dies war deshalb gefährlich – und zog daher aus guten Gründen die Feindschaft der Kirche auf sich –, weil ein gesetzmäßig ablaufender Zusammenhang keine Eingriffe von außen nötig macht und zulässt. Damit ist der Allmacht Gottes eine deutliche Grenze gesetzt. In der Tat mangelt es den Naturphilosophen dieser Zeit nicht an Selbstbewusstsein. Unser Wissen, so etwa Galilei, ist dem Wissen Gottes in der Qualität ebenbürtig. Denn Gott hat die Natur in den „Lettern der Mathematik“ geschrieben, und diese beherrscht inzwischen der Mensch genauso gut. Aus diesem Grund hat Descartes eine Zweiteilung in eine res extensa (wo Naturgesetze deterministisch herrschen) und eine res cogitans (wo Gott uneingeschränkt herrschen kann) eingeführt. Es hat ihn vor einer Verfolgung nicht geschützt: Er musste sein Leben überwiegend im Exil verbringen, wobei er noch Glück hatte, denn Kollegen von ihm landeten auf dem Scheiterhaufen. Immerhin haben wir erstmals hier explizit ausgeführt und begründet eine Trennung der Welt des Menschen in ein Reich der Freiheit und in ein Reich der Notwendigkeit und des Determinismus. In 22 Ersterem konnte sich dann später das Individuum austoben, als Teil der Natur war es aber zugleich der gnadenlosen Gesetzmäßigkeit des zweiten Feldes, der Natur, unterworfen, konnte dieses jedoch zumindest erforschen. Beides, dies muss man sich klarmachen, war jedoch emanzipatorisch gegenüber den Herrschenden: der Determinismus, weil er die Allmacht Gottes (also der Kirche!) einschränkte, so dass im jahrhundertelangen Kampf zwischen Glauben und Wissen das Wissen siegte; die Freiheit, weil diese zum zentralen Charakteristikum des Lebens des Einzelnen in der Neuzeit wurde. Thomas Hobbes gehörte zu denjenigen Philosophen, die das erfolgreiche Modell des Determinismus des mechanistischen Denkens in der Naturwissenschaft auf die Gesellschaft übertragen hat. Weltanschaulich war das durchaus riskant und konnte sicherlich in kaum einem anderen Land als in England stattfinden. Denn dort gelang es weitaus früher als in anderen europäischen Ländern, eine Mitbeteiligung an der politischen Gestaltung durch weitere Gesellschaftsmitglieder durchzusetzen. Doch mussten auch englische („liberale“) Philosophen – ebenso wie Hobbes - immer wieder ins Exil. Hobbes (1588-1679) ahmt in seinem Vorgehen in seiner Gesellschaftstheorie (in seinem Grundwerk „Vom Menschen“ -1657- und „Vom Bürger“ -1642/1647) die axiomatische Methode der Naturwissenschaft nach mit exakten Definitionen, Behauptungen und Beweisen, wodurch er dem Werk eine besondere Dignitität geben wollte. Damit war ein weiterer Bereich nach dem der Natur dem Eingriff fremder Mächte entzogen: Die Gesellschaft funktioniert in dieser Theorie ebenso maschinenmäßig wie ein Uhrwerk, so dass man Machttechniker als Spezialisten braucht, die damit umgehen können. Damit geht zugleich ein anderes Verständnis von Macht und Herrschaft ein: Der Herrscher ist gebunden an Regeln. Er hat der Erhaltung des Friedens zu dienen (Habermas 1971,72 ff.) und für ein angenehmes Leben der (sich jetzt als Bürger verstehenden) Untertanen zu sorgen. Der Erfolg seines Herrscherhandelns wird dann zur Legitimationsgrundlage seiner Herrschaft – und kann natürlich von allen überprüft werden (MacPherson 1973). Allerdings ergibt sich auch hierbei der Grundwiderspruch: Wenn der naturgesetzliche Determinismus – durchaus in emanzipatorischer Absicht und im Interesse der Bürger – auf die Gesellschaft übertragen wird, dann schränkt dies die Freiheit des Einzelnen erneut ein. Es gibt nunmehr ein neues Feld, in dem sich der Widerspruch zwischen individueller Freiheit des Einzelnen und einer allgemeinen und einschränkenden Gesetzmäßigkeit (Gesellschaft) auftut. Interessant dabei ist die Feststellung, dass sich gerade auch in dieser Frage das angelsächsische und das kontinentale, vor allem aber das deutsche politische Denken auseinander entwickeln. So stützen sich politische Philosophien auf der Insel und auf dem Kontinent zwar gleichermaßen auf das Naturrecht (und eben nicht mehr auf ein Gottesrecht oder ein königliches Recht), doch wird in der Folgezeit vor allem bei John Locke (der der zentrale Stichwortgeber für die Verfassungsdiskussion in 23 den entstehenden Vereinigten Staaten war; Habermas 1971, 111ff.) der liberale Gedanke des starken Individuums in den Vordergrund gestellt (zusammen mit der Konstruktion eines Gesellschaftsvertrages), wohingegen in Deutschland der Akzent auf dem allgemeinen Gesetz liegt: Etatismus erfreut sich bis in die jüngsten kulturpolitischen Diskussionen rund um einen Kulturstaat in Deutschland einer großen Beliebtheit. Bei einer Entscheidung zwischen Freiheit und Form neigt man hierzulande offenbar eindeutig zur Bevorzugung der Form (Caygill 1982; vgl. auch Cassirer 1917). Immerhin ergibt sich immer dringlicher das Problem, zumindest geistig diesen Widerspruch zu überwinden. Nun mag man glauben, dass eine bloß theoretische Schreibtischarbeit einer widerspruchsfreien Konstruktion für die politische Praxis irrelevant gewesen wäre. Denn diese Praxis entwickelte sich ohnehin etwa auf der Basis der Entwicklung der Produktivkräfte (Jonas 1969) oder durch eine Eigendynamik praktischer Politik. Doch wächst – auch dies ein Spezifikum der Neuzeit – in immer breiteren Schichten der Bedarf an theoretischer Grundlegung und an nachvollziehbaren Argumentationen. Es gibt einen zunehmenden intellektuellen Wettstreit, denn nach wie vor gibt es starke Kräfte, die für das Bestehende argumentieren (auf Seiten der Kirche bzw. des weltlichen Machthabers). Dieser Prozess einer wachsenden Begründungsnotwendigkeit (Legitimation) kann unter dem Thema einer sich konstituierenden Öffentlichkeit betrachtet werden (Habermas 1990, Sennett 1983, siehe aktuell Gerhardt 2012). Die Entstehung und Stabilisierung einer solchen Öffentlichkeit hängt natürlich aufs engste mit der Ausbreitung der Lesefähigkeit, der Ausweitung der Nutzung der jeweiligen Landessprache und der Entstehung eines veritablen Marktes an Büchern und Zeitschriften zusammen (Faulstich 1988, 2002). Faulstich zeigt dabei, wie auch die verschiedenen Künste (Bilder, Musik, Theaterstücke) ihren Beitrag zur Konstitution einer Öffentlichkeit haben leisten können, so dass sich immer mehr eine politische Kommunikation (Schorn-Schütte 2004), eine ästhetische Kommunikation (Plumpe 1993) und eine moralische Kommunikation sowohl jede für sich, meist aber gemeinsam entwickeln. Es gibt zunehmend Strukturen und Medien und vor allem gibt es eine gebildete bürgerliche Trägerschicht für eine solche Debatte. In besonderer Weise sieht man dabei in ästhetischen Debatten eine Chance, die oben skizzierte Widersprüchlichkeit zwischen Einzelnem und Allgemeinem aufzulösen. Zudem brauchte man aus Gründen des persönlichen Schutzes das Ästhetische als ungefährlicheren Bereich, um quasi unterschwellig und subversiv Fragen der Politik zu diskutieren. 24 Ästhetische Kommunikation und die Macht Wer die Schriften von Shaftesbury, Hutchinson oder Burke kennt – es genügt bereits die Kenntnis der Überschriften –, kann nicht mehr der Überzeugung sein, dass Ästhetik und Ethik scharf voneinander zu trennende Bereiche sind. Vielmehr gehört es zur europäischen Tradition seit den Griechen, Fragen der Tugend, des richtigen Verhaltens, des Schönen und der Bildung stets zusammen zu diskutieren. Gerade im 17. und vor allem im 18. Jahrhundert bündelten sich diese Diskussion in dem Begriff des Geschmacks (taste, gout). Man verhandelte über Geschmacksbildung als Teil der Zivilisierung und Humanisierung des Menschen (Pädagogik), und dies im Interesse eines harmonischen Miteinanders (Politik), wobei zu dem richtigen Benehmen auch eine ästhetische Kultiviertheit gehört. Ein roter Faden dieser Diskurse war dabei die Frage nach der Konstitution des bürgerlichen Subjekts. Dieses Thema war zentraler Inhalt der künstlerischen Werke in der bildenden Kunst, in der Literatur und im Theater. Eine interessante Studie („Aesthetics and Civil Society“, 1982) von Howard Caygill zeigt zudem, dass die Theorien sowohl über Kunst als auch über die Gesellschaft in der Zeit von 1640 bis 1790 auch in ihrer Architektonik eine Strukturähnlichkeit haben: Die Theorien des (ästhetischen) Geschmacks und die moralischen Theorien der bürgerlichen Gesellschaft (civil society) bis hin zu den Studien von Kant korrespondieren miteinander. Insbesondere steht Kants Kritik der Urteilskraft (1790) im Mittelpunkt der Studie von Caygill, wobei er zeigt, wie stark die ästhetische Theorie im ersten Teil der Kritik der Urteilskraft bezogen ist auf die sehr viel seltener rezipierte Theorie der Kultur im zweiten Teil. Vor diesem Hintergrund gewinnen Formulierungen wie die Rede von einer Staats-„Kunst“, von dem (Kunst-) Handwerk der Politik, von dem „ästhetischen Staat“ (Schiller) oder dem „Staat als Kunstwerk“ mehr als eine bloß metaphorische Bedeutung: Die perfekt organisierte Gesellschaft wird analog zu einem gelungenen Kunstwerk betrachtet (siehe etwa den letzten Brief in Schillers Briefen zur ästhetischen Erziehung; 1959). Dass diese Verbindung von Ethik, Moral und Politik (und Pädagogik) nicht bloß ein vergangenes historisches Ereignis ist, sondern bis heute aktuell ist, erkennt man etwa einer konfliktreichen Debatte über die Ästhetisierung des Staates (Benjamin 1963, Rebentisch 2012). Die Frage ist nun, ob es in der Ästhetik und in den Künsten gelingen kann, den oben beschriebenen Widerspruch zwischen Individuum und Gesellschaft aufzulösen. Das Ästhetische „Geschmack“, so wurde es eben dargestellt, entwickelt sich im 18. Jahrhundert quasi zu einem Brückenkonzept zwischen Politik, Bildung, Ethik und Ästhetik. In ihrer Studie „Culture and the State“ gehen Lloyd/Thomas (1998) genau dieser Frage nach: „How are subjects formed as citizens who by 25 definition and for all practical purposes accept the forms and precepts oft the state at least to the extent that alternatives become literally and figuratively the state`s „unthinkable“?“(S. 4) Die Antwort - zumindest seit dem späten 18. Jahrhundert - unter Bezug auf Schiller und die Romantik: durch Ästhetik. Durch diese findet eine Kultivierung, eine Bildung des ethischen (bürgerlichen) Subjekts statt, das seinen Staat auch akzeptiert. Kultivierung heißt dabei in erster Linie Geschmacksbildung. Neben den Vertretern der deutschen Romantik sind es in England Wordsworth und Coleridge sowie später Matthew Arnold, die ein solches Konzept publikumswirksam vertreten. Dabei erhält das Konzept ausgehend von der freiheitlich-republikanischen Perspektive Kants, der mit dem sensus communis ein soziales Band zwischen den Individuen schafft und dabei zwanglos den Einzelnen mit dem Allgemeinen verbindet, über den Freiheitsdichter Schiller zunehmend eine konservative Ausrichtung: Es geht immer mehr um Versöhnung etwa der im Zuge der Industrialisierung immer deutlicher werdenden Klassengegensätze, wobei das dahinter stehende Kunst- und Kulturverständnis der bürgerlichen Klasse dominiert, die auf diese Weise zumindest in diesem Feld siegreich aus dem Kampf um (hier: kulturelle) Hegemonie hervorgeht. Das Mittel für diesen Erfolgsprozess war das Bildungssystem. Allerdings – so die Autoren – wehrt sich die Arbeiterklasse in England gegen eine solche Vereinnahmung durch die Pädagogik. Ihr Vorwurf: Gerade linke Theoretiker von Marx bis zu den heutigen cultural studies übernehmen das entsprechende Kulturkonzept unkritisch für gegeben hin und übersehen, dass nicht bloß von den Inhalten her, sondern auch vom formalen Aufbau eine große Parallelität zwischen den jeweiligen Bereichstheorien besteht. Sie sprechen von einer „intrinsic relation of culture and the idea of the state". Eine ähnliche Beobachtung lässt sich auch für Deutschland anstellen. Auch hier kann man Belege dafür finden, dass die zunehmende Unsicherheit der Machthaber, ob die Integration der Gesellschaft bei den wachsenden Klassenkonflikten erhalten bleibt, zu bestimmten Maßnahmen veranlasst: Die Einführung der Sozialversicherung von Bismarck etwa war eine solche Idee zur Herstellung von Massenloyalität. Flankiert wurde dies durch eine reaktionäre Schulpolitik. Auf intellektueller Ebene verbreiterte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zudem der Kulturdiskurs bis hin zur Entwicklung eines Konkurrenzprogramms zur – sozialdemokratisch konnotierten – Sozialpädagogik eines Paul Natorp, nämlich dem Ansatz einer Kulturpädagogik zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die eine kulturelle Sinnstiftung von oben versuchte (Fuchs 2013). All dies lässt sich durchaus als Teil eines ideologischen Klassenkampfes beschreiben. Die Künste und das Ästhetische fungierten also als Hoffnungsträger für Verschiedenes: für die Auflösung des Widerspruches zwischen dem Einzelnen und dem Allgemeinen, als Oase der (Einübung in) Freiheit und immer wieder als idealer Erziehungs- und Bildungsbereich für die Formung 26 geeigneter Subjekte. Entgegen einer aktuellen Ideologie von Kunstautonomie hatten und haben Künste also vielfältige Funktionen. Diese waren sogar immer schon der Grund für ihre Förderung. Im Funkkolleg Kunst (Busch 1987) unterscheidet und diskutiert man daher konsequent die religiöse, politische und ästhetische Funktion von Kunst. Wer sozialgeschichtlich sensible Darstellungen der Geschichte einzelner Künste liest (Hauser 1972, Fischer-Lichte 1993, Blanning 2010), wird Schwierigkeiten damit haben, eine Loslösung der Kunstproduktion und -rezeption von ihren sozialen und kulturellen Kontexten zu akzeptieren. Sogar die tatsächlich zu belegenden Prozesse einer Autonomisierung der sich allmählich konstituierenden Kunstfelder, die Tatsache nämlich, dass Experten der jeweiligen Felder definieren, was in ihrem Bereich als „Kunst“ zu gelten hat, ist ein Teil der Modernisierungsprozesse der bürgerlichen Gesellschaft. In besonderer Weise betrifft diese „Funktionalisierung“ der Künste den Bereich der Formung der Bürger als vielleicht wichtigster sozialer Funktion von Kunst. Es ist so, wie es (nicht nur) Eagleton 1994, S.3 beschreibt: Man redet zwar über Künste, thematisiert jedoch stets das bürgerliche Subjekt. Selbst die theoretischste Ästhetik-Konzeption wie etwa die Kritik der Urteilskraft von Kant tut dies. Denn die Erfahrung von Lust in dieser Konzeption hat ihren Grund darin, dass das Subjekt spürt, dass und wie seine mentale Ausstattung auf die Wahrnehmungsreize von außen passt – und es sich deshalb freut. Es ist daher ein durchaus plausibler Ansatz, nicht nur die jeweiligen Diskurse als ästhetische, politische oder pädagogische Kommunikation zu verstehen (Schorn-Schütte 2004, Plumpe 1993), sondern die vielfachen Verflechtungen zwischen diesen Kommunikationsformen zu untersuchen. Diese reichen – so Caygill oder Lloyd/Thomas – bis in die Architektur der Theorienkonstruktionen. „Geschmack“ war also die zentrale Vermittlungs- (andere sprechen von „Versöhnungs-“) Kategorie zwischen den verschiedenen Feldern (siehe auch Gadamer). Geschmack wird das einigende Band einer „Verbürgerlichung der deutschen Kunst, Literatur und Musik im 18. Jahrhundert“ (Balet/Gerhard 1972). Träger dieses Geschmacks ist das bürgerliche Subjekt, die „schöne Seele“ oder die „schöne Individualität“ (Ewers 1978). Hier wird Kunst endgültig zu einem Mittel einer visionären humanen/humanistischen Gestaltung der Gesellschaft und ihrer Subjekte. Die Formung des Subjekts durch Kunst Dass man über eine entsprechende Formung des Subjekts eine Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse bewirken will und man bei der Konstruktion politischer Ordnungsrahmen stets die Frage danach berücksichtigt, wie denn die Einzelnen beschaffen sein müssen, die das Ganze tragen sollen, ist ein roter Faden seit Beginn des pädagogischen und politischen Denkens. Dabei haben immer 27 wieder die Menschen - durchaus gerade diejenigen, die in den politischen Konstruktionen bzw. in der jeweiligen Realität keine Berücksichtigung fanden - durch die unterschiedlichsten Protestformen daran erinnert, dass es auch um sie selbst geht. So sehr im Bewusstsein der Machthaber die Möglichkeit von Protest oder gar Aufstand präsent war, so wenig hat offenbar die Geschichtswissenschaft dies lange Zeit berücksichtigt. So lässt George Rude (1977) seine Geschichte der „Unruhen, Aufstände und Revolutionen in England und Frankreich 1730-1848“ (so der Untertitel) mit den Worten beginnen: „Vermutlich ist kein geschichtliches Phänomen von der Geschichtswissenschaft so sehr vernachlässigt worden wie das der Massen…“ (S. 9). Zwar hat man spätestens am Ende des 19. Jahrhunderts die „Masse“ entdeckt (LeBon, Freud und andere), doch sind die meisten dieser Darstellungen eher von Sorgen und Ängsten der Intellektuellen getrieben. Mit einiger Berechtigung kann man diese Ängste auf die Französische Revolution zurückführen, als das französische peuble im Deutschen zum Pöbel mutiert: „Den Sklaven, wenn er die Ketten bricht, den freien Menschen, den fürchtet nicht“ dichtete folgerichtig unser größter Freiheitsdichter Friedrich Schiller. Im Anschluss an Rude hat sich jedoch rasch eine Geschichtsschreibung entwickelt, die jenseits der „Haupt- und Staatsaktionen“ der etablierten Geschichtswissenschaft die „Massen“ in den Mittelpunkt stellte und danach fragte, wie die unterprivilegierten Schichten lebten, fühlten, dachten und was sie insbesondere zu einem Protest veranlasste. So stellt der englische Historiker Edward P. Thompson (hier in Puls 1979, S. 13ff.) die „Moral Economy" (in diesem Band mit „sittlicher Ökonomie“ übersetzt) in den Mittelpunkt, nämlich ein ökonomisches Verhalten, das sich an Maßstäben gelebter Sittlichkeit orientiert. Aufstände kamen dann zustande, wenn das Volk zu lange und zu gravierende Verstöße gegen diese Moralnormen aushalten musste. Diese These unterstützte B. Moore mit seiner bahnbrechenden Studie über „Ungerechtigkeiten“ (1987, zuerst 1978): Nicht alleine Hunger und anderes Elend veranlasste die Menschen zum Protest, sondern das Gefühl, dass eine andere Gesellschaftsordnung, die ein besseres Leben verspricht, als gerecht empfunden wird. Der Wert des philosophischen Prinzips der Gerechtigkeit erhält daher in einer solchen sozialgeschichtlichen Perspektive quasi eine empirische Unterstützungen seiner Relevanz (Sen 2010, Ebert 2010). Gerade die Arbeiten des Ökonomen Amartya Sen zeigen, wie eng Freiheit und Gerechtigkeit miteinander verwoben sind und wie sich die Ökonomie in ihrer Zuständigkeit für die materielle Versorgung der Menschen an moralischen Kriterien messen lassen muss (Sen 2002). Man kann dies durchaus als anhaltende Relevanz der Idee einer „sittlichen Ökonomie“ verstehen, deren Herstellung bekanntlich das Motiv des ersten Theoretikers des Kapitalismus, des Moralphilosophen Adam Smith war und das von der katholischen Soziallehre über die Gründungsväter der Sozialen Marktwirtschaft bis heute eine beunruhigende Relevanz hat (vergleiche etwa das Kapitel „Wirtschaft als Kultur“ in Fuchs 2011). 28 Die Protestbewegungen gegen als ungerecht empfundenes Herrschaftsverhalten zeigen, dass „Widerstand“ eine große Bedeutung hat. Dies wird heute auch zunehmend in der Pädagogik erkannt. Widerstand gegen zu einfache Vorstellungen von Fortschritt veranlasste Rousseau bereits im 18. Jahrhundert zu einem ersten fulminanten Protest. Widerstand war zudem ein Leitmotiv in der Zeit des Sturm und Drang, Widerstand gegen einengende Verhältnisse beschäftigte die Künste, die politische und soziale Theorie und nicht zuletzt die Pädagogik. „Widerstand“ wird heute – im Anschluss an Heydorn – geradezu als zentrale pädagogische Kategorie wieder entdeckt (Bernhard 2011). Auch in der kulturellen Bildung sollte daher Widerständigkeit eine Rolle spielen, zumal selbst staatliche Programme heute formulieren: Kultur macht stark. Es wird darauf ankommen, welche Stärke erwünscht ist und welche Stärke die beteiligten Jugendlichen entwickeln. Jedenfalls befindet man sich mit diesem Programm sehr viel intensiver in einer Geschichte der Emanzipation der Subjekte, als manche glauben wollen (Fuchs 2014). Doch wie steht es nun mit der Frage, ob und wie der Grundwiderspruch zwischen Einzelnem und Allgemeinem gelöst worden ist bzw. überhaupt gelöst werden kann? Eine erste theoretisch mögliche Lösung kommt heute kaum mehr in Frage: die vorneuzeitliche Lösung, also eine Rücknahme der Idee des autonomen Subjekts, so dass ein (kollektivistisches) Eingliedern in ein Ganzes leicht fiele. Versucht hat man eine solche Rücknahme allerdings durchaus. In Zeiten der Diktatur und der Militarisierung der Gesellschaft findet man solche Versuche: „Ein Volk, ein Reich, ein Führer!“ war ein Slogan, der das Ganze der Gemeinschaft, orientiert auf die Person eines Führers, in den Vordergrund stellte. Zwei historische Anknüpfungspunkte gab es für eine solche Denkfigur: das Rousseausche Konzept eines volonte generale, eines allgemeinen Willens (der in der Diktatur durch den Willen des Führers repräsentiert wird), und Hegels Vorstellung, dass der Staat die Verkörperung des sittlich Guten und des Allgemeinen ist. Dies machte beide Ansätze in der Tat nutzbar für menschenfeindliche Systeme. Es ist allerdings befriedigend, dass keine der Diktaturen auf europäischem Gebiet (Deutschland/Österreich, Spanien, Griechenland, Portugal, die sozialistische Länder) auf Dauer überlebt hat. Auf einer anderen Ebene bewegen sich Bemühungen, den Ich-Kult der modernen Konsumgesellschaft zugunsten einer Gemeinschaftsorientierung zu reduzieren. Gemeinwohl, Gemeinnutz, Verantwortung für das Ganze und die oben erwähnten kommunitaristischen Ansätze gehen in diese Richtung. Allerdings stehen diesen Ansätzen die Verkaufslogiken kapitalistischer Märkte entgegen, so dass man gegen eine offenbar überwältigende und alle Bereiche erfassende Weltsicht ankämpfen muss. Auch aus diesem Grund wird von vielen Theoretikern das Denken in 29 Kategorien des Marktes als ein wichtiges Hindernis betrachtet, überhaupt demokratische Verhältnisse zu erreichen (MacPherson 1977). Darauf ist später noch zurückzukommen. Eine letzte hier zu nennende Möglichkeit ist der freiwillige Verzicht auf Autonomie (auf Krankheiten, die zur Einschränkung von Subjektivität führen, gehe ich hier nicht ein). Es geht um Sekten, bei denen systematisch die Autonomie individueller Willensfreiheit gebrochen wird. Alle diese Wege sind also entweder nicht wünschbar bzw. unwahrscheinlich. Welche Wege stehen aber dann sonst zur Verfügung? Ein aussichtsreicher Weg besteht darin, überzogene Ansprüche an Autonomie zu reduzieren. Dies ist insofern aussichtsreich, als Autonomie in der Tat von Autarkie unterschieden werden muss, so dass nicht jede Form von Fremdbestimmung gleich als empfindlicher Angriff auf die individuelle Autonomie und die Selbstbestimmung verstanden werden muss. So hat man im Kontext einer kritischen Diskussion des Lebenskunstkonzeptes darauf hingewiesen, dass jedes noch so autonome Leben Regeln des Sozialen akzeptieren muss (Kersting/Langbehn 2007). In der Demokratietheorie löst man dieses Problem dadurch, dass der Einzelne an der Entwicklung dieser Regeln durch ein demokratisches Verfahren beteiligt wird. Ein besonderer Fall ist dabei die Pädagogik mit ihrem Grundwiderspruch, dass diese nämlich immer versucht, „Freiheit bei dem Zwange“ (Kant) durch Erziehungsprozesse zu entwickeln. Pädagogik ist offensichtlich ein Gewaltverhältnis. Dietrich Benner (1987) rettet sich damit, dass er von einem „sich selbst aufhebenden Gewaltverhältnis“ spricht, der Pädagoge in seiner Erziehungsarbeit also nach und nach seinen Einfluss reduzieren muss. In diese Richtung gehen auch Ansätze einer pädagogischen Ethik bzw. einer pädagogischen Professionstheorie. Aber immerhin: Es bleibt die Akzeptanz von Macht. Der Ansatz von Foucault erklärt hierbei, dass Macht im Prozess der „Subjektivierung“ einen Doppelcharakter hat: Es geht zwar auch um Unterwerfung, es geht aber auch um Ermöglichung. Letzteres findet sich auch in der Rehabilitation einer (allgemeinen) Form und Gestalt bei Cassirer (zum Beispiel 1917): Freiheit bedarf der Form. Dies gilt letztlich auch und gerade für die Künste: Künste bedeuten Gestaltung und Formgebung. Das Kunstwerk galt (und gilt?) als (Mikro-) Kosmos, also als wohlgestalteter gesetzmäßiger Zusammenhang. Form und Gestalt sind hier keine Eingrenzungen von Freiheit, sondern Bedingungen der Möglichkeit von Freiheit. Aber auch diese muss gelebt werden. Es bleibt also die Aufgabe, stets zwischen Formung als Eingrenzung und als Freiheitsermöglichung abzuwägen. Bei aller Unabänderlichkeit von partieller Fremdbestimmung ist dieser Prozess letztlich in die Hand des Einzelnen zu geben. Dies gilt auch für die Zwangsanstalt Schule. Auch hierbei geht es darum, trotz eines harten, gesetzlich abgesicherten Regelregimes darum, Freiheit – und d.h.: Mitgestaltung – 30 zu ermöglichen. Dies bedeutet, die Schule als „Schule der Person“ (Weigand 2005), als „Schule der Teilhabe“ (Rihm 2008), als demokratische Schule (Dewey) zu verstehen. Auch die Künste – es wurde im Kontext von Form und Gestalt angesprochen – sind ein Regelsystem und nicht ein Reich uneingeschränkter Freiheit. Sie können auch nicht als Modell oder als Oase gelten, wie es die politische Vision Schillers vorsah. In der Realität ist professionelle Kunst mit ihren harten Spielregeln der Konkurrenz, des Kampfes um Aufmerksamkeit sogar ein besonders schlechtes Lernfeld. Dies wird auch durch die Studien von Bourdieu (1987) unterstützt, der zeigt, dass die Künste nicht nur effektive Medien der Unterscheidung, sondern sogar effektive Medien der politischen Unterdrückung sind. Daher wurde er nicht müde, gegen die Illusionen der (Kantschen) AutonomieÄsthetik an zu argumentieren. Allerdings gibt es eine immanente Logik der Künste („Eigensinn“), die durchaus zur Stärkung des Einzelnen führen kann. Genau darum geht es bei den obigen Ausführungen: um die Idee einer Stärkung des Subjekts, das den Widerspruch zwischen individueller Freiheit und notwendiger Einordnung in ein Ganzes erkennt und damit umzugehen weiß. Ästhetisch-kulturelle Bildung ist daher insoweit politische Bildung, als sie ein solches starke Subjekt anstrebt. Doch sollte man nicht der neoliberalen Lehre folgen, dass nunmehr der Einzelne allein sein Leben zu bewältigen habe (Ich-AG, Agenda 2010 etc.). Hierbei gilt es vielmehr zu erkennen, dass die aktuelle gesellschaftliche Ordnung historisch entstanden ist, von Menschen gemacht wird und keineswegs „alternativlos“ – so ein beliebtes Kanzlerinnenwort – ist. Es ist zu erkennen, dass die aktuelle gesellschaftliche Ordnung ein Versprechen auf individuelle Freiheit gibt, für die sie jedoch kaum geeignete Rahmenbedingungen bereitstellt. Dies wird auch zunehmend erkannt, wie man an den aufblühenden kritischen Gesellschafts- und Subjektdiskursen ablesen kann. So entwickelt etwa Dux (2013) ein Anspruchstableau an eine menschenwürdige Politik und kommt zu dem Ergebnis, dass sich Kapitalismus und Demokratie geradezu ausschließen. Es gehört zu diesem Befund die Ökonomisierung aller Lebensbereiche, die von einer neoliberalen Gesellschaftstheorie angestrebt wird. Davon bleibt auch die Öffentlichkeit mit ihren emanzipatorischen Wirkungen in der Frühzeit der bürgerlichen Gesellschaft nicht verschont, so dass bereits der junge Habermas (1990, zuerst 1962) geradezu einen Abgesang auf eine solche emanzipatorische Öffentlichkeit formuliert hat. Gegenwärtig geht es daher darum, nahezu vergessene Konzepte des letzten Jahrhunderts wiederzubeleben. „Gegenöffentlichkeit“ gehört zu diesen Konzepten. In der Tat gibt es einen wachsenden Widerstand gegen eine Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, in der – so ein Beispiel – die sich selbst durch schlechtes und riskantes Management in den Ruin getriebenen Banken mit öffentlichen Mitteln gerettet werden, wobei diese dann nach ihrer Rettung ungeniert und unbeeindruckt ihr Spiel weiterspielen. Zu erinnern ist an die These von Moore (1983), dass ein 31 Empfinden von Ungerechtigkeit die Menschen zum Protest veranlasst. Der Tatbestand von Ungerechtigkeit ist heute objektiv längst gegeben. Ein kritischer Diskurs über die Mängel der bestehenden Ordnung ist daher durchaus lebendig und kommt dynamisch in Gang (Dörre 2012). Wenn Kultur also wirklich „stark“ (in diesem Sinne) macht, dann gibt es durchaus Grund zu Optimismus. Man muss sich dabei nicht unbedingt dem harten Urteil von Dux über die völlige Unvereinbarkeit von Demokratie und Kapitalismus anschließen, wobei allerdings bereits vor Jahren MacPherson (1977) zu dem Schluss kam, dass alle aktuellen liberalen Demokratietheorien nur scheitern können, solange sie an dem Konzeptes Besitzindividualismus festhalten. Dieses Konzept hat er in seiner viel zitierten gleichnamigen Studie (1973) als dasjenige anthropologische Modell analysiert, das insbesondere den Theorien von Hobbes und Locke zugrunde lag (der Mensch als vereinzelter Egoist ohne Solidarität mit seinen Mitmenschen, der ständig nach einer Vermehrung von Macht und Reichtum strebt). MacPherson zeigt, dass auch aktuelle liberale Konzeptionen (wie die von John Rawls) von diesem Menschenbild ausgehen und daher in Theorie und Praxis nur scheitern können. Heutigen Gesellschaftsanalysen ist es dabei wichtig, dass man die Realität unterschiedlicher Ausprägungen des Kapitalismus beachtet (Fuchs 2014), in denen die Rolle des Staates bei der Schaffung von Rahmenbedingungen für die Entwicklungsmöglichkeiten des Einzelnen sehr unterschiedlich ist. Es lohnt sich also, sich auch innerhalb des Kapitalismus um eine sozialverträglichere Variante einzusetzen. In dieser Situation helfen Studien wie die von Hein (2013), die unterschiedliche Wege der Kapitalismuskritik, hier konkret: Marx, Bourdieu und Foucault, in ihrer Kompatibilität nachweisen. So zeigt Hein, dass weder eine ökonomistische Deutung von Marx noch eine rein diskurstheoretische Machttheorie bei Foucault noch eine bloße symboltheoretische Kulturtheorie bei Bourdieu den jeweiligen Theorieansätzen gerecht wird. Dies ist deshalb wichtig, weil man sich daran erinnern muss, dass am Ende des letzten Jahrhunderts eine Lebensstil- und Risikogesellschafts-Soziologie das Ende einer gravierenden ökonomischen Ungleichheit behauptet hat und daher anti-ökonomisch bloß noch kulturalistische Gesellschaftsanalysen akzeptieren wollte. Vor diesem Hintergrund scheint als erstes politisches und dann auch pädagogisches Ziel die Überzeugung bedeutsam zu sein, dass keine Realität „alternativlos“ ist, dass es eben keine deterministische Teleologie gibt, die die heutige Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung als alternativloses „Ende der Geschichte“ (Fukuyama) produziert hat. Erinnert man sich daran, dass ein Definitionsmerkmal aktueller Künste die Erfahrung von Kontingenz ist, dass eben alles auch anders sein könnte, als es jeweils ist, dann ergibt sich dadurch ein wichtiges emanzipatorisches Bildungsziel ästhetisch-kultureller Bildungsarbeit, das diese ohne Überanstrengung auch tatsächlich erreichen kann: Das starke Subjekt kann nämlich als ein solches 32 bestimmt werden, das sich mit ungerechten Verhältnissen eben nicht abfindet. Voraussetzung für diese Dispositionen ist eine sensible Wachheit und Wahrnehmungsfähigkeit, ganz so, wie sie in einer ästhetischen Praxis entstehen kann. Auf diese Weise kann – unter aktuellen Bedingungen – eine erneute Synthese von Ästhetik, Ethik und Politik hergestellt werden, ganz so, wie es als emanzipatorisches Programm in der Frühzeit der bürgerlichen Gesellschaft üblich war. Literatur Apel, H.-J.: Theorie der Schule. Donauwörth: Auer 1995 Asch, R. G./Freist, D. (Hg.): Staatsbildung als kultureller Prozess. Köln: Böhlau 2005 Balet, L./Gerhard, E.: Die Verbürgerlichung der deutschen Kunst, Literatur und Musik im 18. Jahrhundert. Frankfurt/M. usw. 1972 Benjamin, W.: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1963 Benner, D.: Allgemeine Pädagogik. Weinheim/Basel: Juventa 1987 Bergbauer, H.: Kulturtheoretiker denken den Staat. Baden-Baden: Nomos 2013 Bernhard, A.: Allgemeine Pädagogik auf praxisphilosophischer Grundlage. Baltmannsweiler: Schneider 2011 Blanning, T. C. W.: Das Alte Europa 1660 - 1789. Darmstadt: WBG 2006 Blanning, T.: Triumph der Musik. Von Bach bis Bono. München: Bertelsmann 2010 Borkenau, F.: Der Übergang vom feudalen zum bürgerlichen Weltbild. Darmstadt: WBG 1971 (1934) Bourdieu, P.: Die feinen Unterschiede. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1987 Bourdieu, P.: Zur Soziologie der symbolischen Formen. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1994 Brumlik, M./Brunkhorst, H. (Hg.): Gemeinschaft und Gerechtigkeit. Frankfurt/M.: Fischer 1993 Burckhardt, J.: Das Geschichtswerk. Frankfurt/M. zweitausendeins 2007 Busch, W.(Hg.): Funkkolleg Kunst. München: Piper 1987 Cassirer, E.: Freiheit und Form. Berlin: Cassirer 1917 33 Caygill, H.: Aesthetics and Civil Society: Theories of Art and Society 1640 - 1790. Diss. University of Sussex 1982 Clark, Chr.: Preußen. Bonn: bpb 2007 Dülmen, R. v.: Die Entdeckung des Individuums 1500 bis 1800. Frankfurt/M.: Fischer 1997 Dux, G.: Demokratie als Lebensform. Weilerswist: Delbrück 2013 Eagleton, T.: Ästhetik. Die Geschichte ihrer Ideologie. Stuttgart: Metzler 1994 Ebert, Th.: Soziale Gerechtigkeit. Bonn: bpb 2010 Ewers, H.-H.: Die schöne Individualität. Zur Genesis des bürgerlichen Kunstideals. Stuttgart: Metzler 1978 Faulstich, W.: Medien zwischen Herrschaft und Revolte. Göttingen: V&R 1988 Faulstich, W.: Die bürgerliche Mediengesellschaft (1700 - 1830). Göttingen: V&R 2002 Fend, H.: Neue Theorie der Schule. Wiesbaden: VS 2006 Fetz, R. L. u. a. (Hg.): Geschichte und Vorgeschichte der modernen Subjektivität. 2 Bde. Berlin/New York: de Gruyter 1998 Fischer-Lichte, E.: Kurze Geschichte des deutschen Theaters. Tübingen usw.: UTB 1993 Fuchs, M.: Zur Geschichte des mathematischen und naturwissenschaftlichen Denkens. Weinheim: Beltz 1984 Fuchs, M.: Persönlichkeit und Subjektivität. Opladen: Leske und Budrich 2001 Fuchs, M.: Kampf um Sinn. München: Utz 2010 Fuchs, M.: Kunst als kulturelle Praxis. München: Kopaed 2012 Fuchs, M.: Kultur und Subjekt. München: Kopaed 2012 Fuchs, M.: Die Kulturschule. München: Kopaed 2012 Fuchs, M.: Kunstfreiheit und Kunstautonomie. Kubi-online.de (2012) Fuchs, M.: Pädagogik und Moderne. München: Utz 2013 Fuchs, M.: Kulturpolitik als Mentalitätspolitik. Wuppertal 2013 (auf maxfuchs.eu/Buchpublikationen) Fuchs, M.: Schule, ästhetische Praxis und das Subjekt. Wuppertal 2014 (siehe die homepage maxfuchs.eu, Aufsätze und Vorträge) 34 Fuchs, M.: Subjektivität heute. München: Utz 2014 Gadamer, H.-G.: Wahrheit und Methode. Tübingen: Mohr 1960 Geertz, Cl.: Dichte Beschreibung. Frankfurt/M. Suhrkamp 1987 Gerhardt, V.: Öffentlichkeit. München: Beck 2012 Habermas, J.: Theorie und Praxis. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1971 Habermas, J.: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1990 Hauser, A.: Sozialgeschichte der Kunst und Literatur. München: Beck 1972 Heidenreich, B./Kroll, F.-L. (Hg.): Macht- oder Kulturstaat? Preußen ohne Legende. Berlin: Spitz 2002 Hein, T.: Metamorphosen des Kapitals. Münster: transcript 2013 Hirschmann, A. O.: Leidenschaften und Interessen. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1987 Hobbes, Th.: Vom Menschen. Vom Bürger. Hamburg: Meiner 1994 Hobbes, Th.: Leviathan. Leipzig: Reclam 1995 Honneth, A. (Hg.): Pathologien des Sozialen. Frankfurt/M.: Fischer 1994 Jonas, W. u. a. : Die Produktivkräfte in der Geschichte. Berlin: Dietz 1969 Kersting, W./Langbehn, C. (Hg.): Kritik der Lebenskunst. Frankfurt/M. Suhrkamp 2007 König, H.: Zivilisation und Leidenschaften. Reinbek: Rowohlt 1992 Lloyd, D./Thomas, P.: Culture and the State. New York/London: Routledge 1998 MacPherson, C. B.: Die politische Theorie des Besitzindividualismus. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1973 MacPherson, C. B.: Demokratietheorie. München: Beck 1977 Moore, B.: Ungerechtigkeit. Frankfurt/M. Suhrkamp 1987 Münkler, H.: Im Namen des Staates. Frankfurt/M.: Fischer 1987 Plumpe, G.: Ästhetische Kommunikation der Moderne. 2 Bde.. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 1993 Puls, D. u. a.: Wahrnehmungsformen und Protestverhalten. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1979 Rebentisch, J.: Die Kunst der Freiheit. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2012 Reckwitz, A.: Die Erfindung der Kreativität. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2012 35 Rihm, Th. (Hg.): Teilhaben an Schule. Wiesbaden: VS 2008 Reinhard, W.: Geschichte der Staatsgewalt. München: Beck 1999 Rude, G.: Die Volksmassen in der Geschichte. Frankfurt/M.: Campus 1977 Schorn-Schütte, L. (Hg.): Aspekte der politischen Kommunikation im Europa des 16. und 17. Jahrhunderts. München: Oldenbourg 2004 Sattler, E.: Die riskierte Souveränität. Bielefeld: transcript 2009 Schmidt, S.J.: Die Selbstorganisation des Sozialsystems Literatur im 18. Jahrhundert. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1989 Sen, A.: Ökonomie für den Menschen. München/Wien: Hanser 2000 Sen, A.: Die Idee der Gerechtigkeit. München: Beck 2010 Sennett, R.: Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Frankfurt/M.: Fischer 1983 Volz, G. B. (Hg.): Friedrich der Große. Köln: Anaconda 2006 Wagner, B.: Fürstenhof und Bürgergesellschaft. Essen: klartext 2009 Weigand, G.: Schule der Person. Würzburg: Ergon 2005 36 4. Kulturelle Bildungspolitik und Educational Governance Politische Rahmenbedingungen, neue Akteurskonstellationen und Motivationen Kulturelle Bildung im Überschneidungsbereich unterschiedlicher Politikfelder Die Geschichte politischer Visionen und Leitbilder ist lange und eindrucksvoll. Sie ist vermutlich genauso lange, wie Menschen in Gruppen zusammen leben und darüber nachdenken, wie dieses Zusammenleben funktionieren kann. Spätestens seit den Griechen gibt es tiefgründige theoretische Reflexionen über die beste Art und Weise, wie die Polis zu organisieren ist (Rausch 1974). Neben diesen großen philosophischen Ideen über eine gelingende politische Gestaltung gibt es aber auch die alltägliche Praxis, gibt es das politische Handeln unterschiedlicher Akteure, die versuchen, ihre Ideen zu realisieren. Insbesondere ist diese Problemstellung wichtig für diejenigen, denen man die Macht für die Regierungsgeschäfte übertragen hat (Ellwein 1976). Dieses Regierungshandeln, also die alltägliche Praxis der Aufrechterhaltung einer politischen Ordnung, nannte man lange Zeit Regierungskunst. Die Rede von einer Kunst war dabei in den unterschiedlichsten Handlungsfeldern von Belang: Die Kunst (im Griechischen techne und im Lateinischen ars) hatte zunächst einmal nichts mit den schönen Künsten des Theaterspiels, des Malens oder Musizierens zu tun, sondern es war generell ein regelgeleitetes Tun. Auch die schönen Künste wurden lange Zeit in diesem Sinne als regelgeleitetes Tun, als Handwerk betrachtet. Dieses politische Handwerk spielt – neben den großen Ideen – in dem Nachdenken über Politik von Anfang an eine wichtige Rolle. Denn es ging letzten Endes immer um die entscheidende Frage, in welcher Weise die Ausübung von Macht in der Gesellschaft geregelt werden kann (Reinhard 1999). In diesem Diskussionskontext spielt nicht umsonst die Arbeit von Machiavelli (2008) eine entscheidende Rolle, weil er sich intensiv mit der Frage der Eroberung und der Erhaltung von Macht befasst hat. Fragen der Moral traten vor dieser pragmagischen Schwerpunktsetzung in den Hintergrund. Wie aktuell diese Renaissanceschriften sind, kann man an solchen organisationstheoretischen Ansätzen erkennen, in denen von einer „Mikropolitik der Macht“ die Rede ist. Selbst in kleinen Kulturverbänden gibt es ein solches, mitunter raffiniertes Spiel um Einfluss und um Vorstandspositionen. Offenbar gibt es allgemeine Spielregeln, die über die Zeiten hinweg und den unterschiedlichsten Kontexten funktionieren. In einem demokratischen Rechtsstaat mit seiner idealtypischen Gewaltenteilung in eine Legislative, Exekutive und Judikative gehört die Regierungskunst in das Feld der Exekutive, wobei man nicht nur an die Spitzen der Exekutive zu denken hat, sondern vielmehr an den gesamten Verwaltungsapparat, der nötig ist, um die politischen Ziele umzusetzen. Dies gilt natürlich auch für das Feld, das in dem vorliegenden Text im Mittelpunkt steht. Es geht um die Frage, wie politische Steuerung heute geschehen kann, wie insbesondere Veränderungen in der Praxis herbeigeführt werden können. Diese und andere Aspekte führen zu der Aufgabe, genauer zu analysieren, unter welchen Umständen innovative pädagogische Ansätze erfolgreich in die Fläche implementiert werden können, welche Rolle hierbei Begründungen und Argumentationsmuster spielen, wer die relevanten Akteure sind und welche Einflussmöglichkeiten sie jeweils haben. Diese Problemstellung ist dabei weniger ein Problem einer Theorie der kulturellen Bildung, sondern sie gehört vielmehr in den politikwissenschaftlichen 37 Kontext der politischen Steuerung. Es scheint dabei so zu sein, dass sich gerade in diesem Feld seit einigen Jahren erhebliche Veränderungstendenzen abzeichnen. Gerade im Kontext von Regierungen, die gezielt politische Reformen anvisieren, musste man nämlich feststellen, dass herkömmliche Verfahren einer top down Steuerung, bei der die politische Spitze die Richtung angibt und die Verwaltung dafür sorgt, dass die neuen politischen Leitlinien in der Praxis auch umgesetzt werden, sehr wenig Erfolg hatten. Diese erwiesene Erfolgslosigkeit gerade bei dem Versuch, politische Reformen umzusetzen, hat zu einem Umdenken in der Politikwissenschaft darüber geführt, wie politische Steuerung überhaupt unter sich verändernden gesellschaftlichen Bedingungen funktionieren kann (Behrens 1995). Dies gilt insbesondere für das Bildungswesen, da es zur deutschen Tradition gehört, dass dieses sehr fest in der Hand des Staates ist. Daher ist es auf den ersten Blick verwunderlich, dass sich ein solches Praxisfeld, bei dem der Staat erheblich größere Einflussmöglichkeiten hat als in anderen Feldern, durchaus resistent gegenüber Reformansätzen zeigt. Im Folgenden will ich mich explorativ dieser Problemstellung annähern. Eine Besonderheit des Praxisfeldes der kulturellen Bildung besteht dabei darin, dass es quer zu sehr unterschiedlichen Politikfeldern liegt, da kulturelle Bildungsarbeit mindestens in der Schul-, Jugend- und Kulturpolitik stattfindet, so dass die Art und Weise der politischen Steuerung in diesen drei Feldern Relevanz hat. Es gibt dabei bereits relevante Untersuchungen darüber, wie geeignete politische Rahmenbedingungen der Schul-, Jugend- und Kulturpolitik jeweils gestaltet werden müssen, doch ist man von einer integrativen kulturellen Bildungspolitik noch weit entfernt. Man muss dabei berücksichtigen, dass die drei genannten Politikfelder sich nicht bloß erheblich im Hinblick auf die gesetzliche Absicherung, die unterschiedlichen Trägerstrukturen, die jeweiligen Handlungslogiken und die finanzielle Ausstattung unterscheiden, sie stehen auch in sehr verschiedenen Traditionslinien, die bis in die Gegenwart Einfluss auf die politische Gestaltungsrealität haben. So kann man zwar durchaus von einer Kulturpolitik sprechen, wenn in der Geschichte Fürsten und Könige bzw. die Kirche künstlerische Ausdrucksformen benutzt haben, um das Volk davon zu überzeugen, dass die Macht in den richtigen Händen ist (Reinhard 1999, 388 ff.). Die Künste hatten nämlich nicht nur eine ästhetische Funktion, sondern sie hatten immer auch eine politische Funktion, die sogar ein wesentlicher Grund für ihre Förderung war (für die bildenden Künste vergleiche etwa Busch 1987). Eine Kulturpolitik in unserem heutigen Verständnis hat sich erst im 19. Jahrhundert entwickelt (vgl. Wagner 2009), wobei bis in die 1920er Jahren die staatliche Kulturpolitik offen als Mittel der Macht (national und international) verstanden wurde. Eine Förderung der Künste auf der Basis der Kunstfreiheitsgarantie, so wie sie das Grundgesetz auf der Grundlage einer etwa 200 -jährigen Diskurstradition über Kunstautonomie garantiert, gibt es in Deutschland erst nach dem zweiten Weltkrieg. Erst in jüngster Zeit hat sich zudem eingebürgert, neben den zwei traditionellen Säulen der Kulturpolitik, nämlich der Pflege des Kulturerbes und der Künstlerförderung, die Förderung kultureller Bildung als drittes Aktivitätsfeld zu benennen. Von einer staatlichen Steuerung dieses Feldes kann man allerdings nur indirekt sprechen. Zwar gibt es eine solche auch, insofern jede Mittelvergabe auch mit Einflussnahme verbunden ist. Zudem nimmt die öffentliche Hand auch Einfluss auf die Besetzung wichtiger Leitungsstellen im Kulturbereich und es ist die Förderung der Kultur eingebunden in Strategiepapiere, die die 38 politischen Gremien diskutiert und verabschiedet haben. Unterhalb dieser globalen Zielsetzungen jedoch gibt es ein großes Maß an Gestaltungsfreiheit der Künstlerinnen und Künstler und der Kultureinrichtungen. Kulturpolitik gehört also zu denjenigen Politikfeldern, in denen eine diskursive Aushandlung zwischen den unterschiedlichen Akteuren geradezu zur Tradition gehört. Die Kulturpolitik (insbesondere bei Museen und Theatern) ist allerdings auch dasjenige Feld, in dem zuerst Strategien einer Neuen Steuerung (Tillburger Modell) in den 1980er Jahren erprobt wurden. Insofern sind viele Elemente des unten vorzustellenden neuen Governance-Ansatzes längst in der Kulturpolitik etabliert, allerdings ohne diese Bezeichnung zu verwenden. Ein zweites Politikfeld, das viele Ähnlichkeiten mit dem kulturpolitischen Feld hat, ist der Bereich der Jugendpolitik. Eine staatliche Jugendpolitik ist erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden und hat sehr viel mit Verwerfungsprozessen in der Gesellschaft zu tun, unter denen insbesondere die Jugendlichen zu leiden hatten. Dem Staat ging es insbesondere um eine Disziplinierung einer Jugend, die nach ihrer Schulzeit nicht mehr einer staatlichen Disziplinargewalt unterworfen war. Das erste Jugendhilfegesetz stammt aus dem Jahre 1922, wobei bis heute in dem aktuellen Kinder- und Jugendhilfegesetz die beiden Dimensionen der Disziplinierung und der pädagogischen Hilfe nebeneinanderstehen. Im Sozialbereich, zu dem die Jugendpolitik gerechnet wird, gilt das Subsidiaritätsprinzip. Dies bedeutet zum einen, dass Probleme dort gelöst werden sollen, wo sie auch entstehen, also an der Basis. Es bedeutet speziell in der deutschen Tradition, dass es neben den Kirchen viele freie Träger gibt, die – mit einem Anspruch auf öffentliche Unterstützung – Jugendhilfe vor Ort praktisch realisieren. Auch in diesem Politikfeld gibt es daher von Anfang an einen – inzwischen auch gesetzlich abgesicherten – Dialog zwischen öffentlichen und freien Trägern und zwischen der Trägerstruktur der Jugendhilfe und der Politik. Im Hinblick auf eine Pluralität von Akteuren und die Realität von Aushandlungsprozessen sind also auch in diesem Feld wichtige Elemente des Governance-Ansatzes traditionell realisiert. In der Jugendhilfe war allerdings der Widerstand gegen die Einführung des Neuen Steuerungsmodells erheblich größer als in der Kulturpolitik. Als drittes Politikfeld, das für kulturelle Bildung Relevanz hat, ist die Bildungspolitik, speziell die Schulpolitik zu nennen. Im 19. Jahrhundert war es eine wichtige Errungenschaft, dass der Staat die Verantwortung für die Schule von der Kirche übernahm. Vorangegangen sind einzelne gesetzliche Regelungen, insbesondere ist hier das preußische Landrecht von 1794 zu nennen, in denen diese Übernahme der Schule durch den Staat angebahnt wurde. Mit der Übernahme der Verantwortung für die Schule fand gleichermaßen die Übernahme der Zuständigkeit für die Lehrpläne, für die Trägerschaft und für die Ausbildung und Anstellung der Lehrerinnen und Lehrer statt und es wurde ein spezifisches Schulverwaltungsrecht entwickelt. Die Bildungspolitik entwickelte sich so zu einem Kernbereich hoheitlicher Staatsaufgaben, wobei speziell in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern eine freie Trägerschaft von Schulen eine sehr kleine Rolle spielte. Auch andere Akteure als der Staat wie etwa Lehrergewerkschaften spielten in diesem Politikfeld keine große Rolle. Allerdings war die Schule in der öffentlichen Kommunikation stets ein wichtiges Thema, was insbesondere den strukturellen Aufbau des Schulsystems (Mehrgliedrigkeit) betrifft. Für die Bildungspolitik ist daher der Governance-Ansatz mit seinen verschiedenen Aspekten (s.u.) in der Tat 39 Neuland. Neu ist auch in der Bildungspolitik die politisch gewünschte Kooperation zwischen Schule und Einrichtungen aus dem Bereich der Kultur oder der Jugendhilfe, wobei es notwendigerweise auf allen Ebenen zu oft spannungsvollen Beziehungen kommt. Denn das Bildungswesen ist als Kernbereich hoheitlicher Aufgaben einer staatlichen Steuerungslogik in einer Weise unterworfen, wie das im Bereich der Jugend- und Kulturpolitik nicht der Fall ist. Ein Rückblick in die Geschichte der Bildungspolitik Unter den drei genannten Politikfeldern ist die Schulpolitik dasjenige Politikfeld mit der längsten Tradition, das zudem heute unter der Perspektive der politischen Steuerung dem größten Wandel unterworfen zu sein scheint. Es lohnt sich daher ein Blick in die Geschichte dieses Politikfeldes, weil damit auch deutlich wird, dass unter den relevanten Akteuren der Bildungspolitik gerade im Hinblick auf die Kunst des Regierens das Handeln der Verwaltung in seiner hohen Bedeutung aufgezeigt werden kann. Dies gilt gerade in Bezug auf die Bildungsreformpolitik während der Sattelzeit (17701830), wobei insbesondere die Entwicklung in Preußen interessant ist (Tenorth 2000, Jeismann/Lundgreen 1987, Roessler 1961). Denn zu dieser Zeit gab es nicht bloß eine dynamische Entwicklung in der Philosophie und dem pädagogischen Denken, man setzte sich sowohl in Theorie als auch in der Praxis damit auseinander, welches das passende Modell politischer Steuerung für die entstehende und nicht mehr aufzuhaltende Industriegesellschaft sein kann. Die Französische Revolution und ihre Folgen (Napoleon) haben wesentlich zur Zerstörung des herkömmlichen (aufgeklärt-) absolutistischen Systems beigetragen. Die sich beschleunigende Industrialisierung führte zudem zu einer Zerstörung der früheren Stände-Gesellschaft und zur Herausbildung einer funktional differenzierten modernen Gesellschaft. Philosophen wie Kant, Fichte und Hegel reflektierten sehr genau diesen Veränderungsprozess, der notwendigerweise zu einer Neubestimmung der Vorstellungen von Staat, Politik und Gesellschaft sowie der sich verändernden Rolle der Kirche und der Religion insgesamt führte. Es entwickelte sich nicht nur die kapitalistische Klassengesellschaft, es entstanden mit dieser auch gravierende Widersprüche zwischen dem herkömmlichen Regierungssystem, dem sich konstituierenden Bürgertum, dem entstehenden Proletariat, der Kirche und dem Adel (Reinhardt 1999). Die Philosophie stärkte die Idee der Freiheit und der Selbstbestimmung, die nunmehr auch im politischen Denken des 19. Jahrhunderts nicht mehr zu vernachlässigen war. Man entwickelt neue Ideen eines Staates, der nicht mehr aus Untertanen, sondern aus mündigen Bürgern bestand, woraus sich unmittelbar ergab, genauer die Wechselbeziehungen zwischen Staat, Erziehung und Gesellschaft zu untersuchen: „Die Errichtung eines staatlichen Unterrichtswesens setzt eine Vorstellung vom Zusammenhang der öffentlichen Erziehung mit dem Staatszweck, also eine Koinzidenz von Pädagogik und Politik voraus.“ (Jeismann in Jeismann/Lundgreen 1987, 106). Im 19. Jahrhundert entstanden die bis heute relevanten politischen Strömungen des Liberalismus, des Konservativismus und des Sozialismus, es entstand die Ideen eines Sozial- und Kulturstaates, der sich in anderer Weise als der herkömmliche Polizeystaat um das Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger kümmert. 40 Das Bildungssystem spielte bei diesen anvisierten Veränderungsprozessen eine entscheidende Rolle und es waren – gerade in Preußen – in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts die Bedingungen für eine Veränderung recht günstig, denn es gab einen Schulterschluss zwischen einer reformwilligen Regierung, einer qualifizierten Verwaltung und einem ambitionierten philosophischen und bildungstheoretischen Diskurs. Obwohl diese Sattelzeit gerade für Preußen in der Geschichtswissenschaft, der Pädagogik und in der Philosophie gut untersucht ist, kommt Jeismann (a.a.O., 106) zu dem Schluss: „Von einer einhelligen Urteilsbildung über Motive und Folgen staatlicher Schulpolitik und die darauf einwirkenden gesellschaftlichen Gruppen sind wir jedoch weit entfernt; insbesondere ist die Frage nach dem Verhältnis von sozial mobilisierenden zu sozial stabilisierenden Wirkungen des staatlich gelenkten Erziehungswesens umstritten. Die Bedeutung des staatlichen Bildungswesens für die Geschichte der Mentalitäten ist bisher überhaupt noch wenig beachtet worden und bedarf gründlicher Untersuchung.“ Immerhin zeigen entsprechende Untersuchungen, dass es nicht bloß im Bereich der pädagogischen, staatstheoretischen, verwaltungswissenschaftlichen und philosophischen Theorienbildung erhebliche Kontroversen gab, auch in der politischen Praxis weiß man um den Einfluss unterschiedlicher Akteure und die Komplexität der Verschränkung unterschiedlicher Entwicklungstendenzen: „…die Umstrukturierung des durch Unterricht vermittelten Wissensbestandes unter der Herrschaft eines neuen Bildungsbegriffes; die Neuorganisation der Schule nach Typen, der Lehrerbildung, der Fachverwaltung; die Heranbildung von wissenschaftlichem, technisch-wirtschaftlichem und verwaltungspolitischen Sachverstand, der die Effizienz im politischen wie wirtschaftlichen Bereich steigerte; die Auflösung der schon labil gewordenen ständischen Gesellschaftsordnung; die Überlagerung der Reste dieser Sozialordnung durch eine nach Bildungsart und Bildungshöhe sich differenzierende „Bildungsgesellschaft“, deren Trennlinien sich nicht mit denen der jüngeren kapitalistischen Klassenbildung decken; die Forderung der Gebildeten nach politischer Partizipation, d.h. nach Transformation des absolutistischen Verwaltungsstaates in den Verfassungsstaat.“ Und weiter: „So traten eine Vielzahl von ideellen und materiellen Widersprüchen zwischen den Zielen und Interessen der Beteiligten auf. Die Konzeption der Erziehung und die Organisation des Unterrichtswesens wurden zu Faktoren im Kampf um die politische Ordnung und die Gliederung der Gesellschaft.“ (ebd., 105f.) Wir haben es also mit verschiedenen Akteuren und Akteursgruppen zu tun, die jeweils unterschiedliche Interessen verfolgen und die sich dabei auf veritable Reflexionen aus Wissenschaft und Philosophie beziehen können. In moderner Sprache: Es gibt also auch in dieser frühen Reformzeit eine komplexe Akteurskonstellation, es gibt einen Diskurszusammenhang, bei dem es um die Durchsetzung gruppenspezifischer Interessen geht. Ein Grundcharakteristikum dieses Diskurszusammenhanges ist dabei der Widerspruch zwischen den jeweiligen Interessen und den darauf basierenden Forderungen. Die schon ältere Schrift von Romberg (1979), die aus dem Kontext der Verfassungsgeschichte (Ernst Rudolf Huber) stammt, beschreibt nicht bloß präzise die handelnden Personen und Akteursgruppen 41 (Kirche, Parteien, Kommunen, der Lehrerstand, Eltern und Schüler und Verwaltung), sie stellt ihre philosophischen, pädagogischen und staatstheoretischen Grundüberzeugungen zusammen mit ihren politischen Vorschlägen (Humboldt, Fichte, Zöllner, Krug, Schleiermacher, vom Stein, Süvern u. a.) vor, sie macht auch deutlich, wie stark die Rolle der sich entwickelnden staatlichen Verwaltung gerade in der Bildungspolitik war. Man muss sehen, dass auch Autoren, die in Darstellungen des pädagogischen Denkens ein wichtige Rolle als Bildungstheoretiker spielen (Humboldt, Schleiermacher, später Troeltsch) ihre politische Wirksamkeit nur in ihrer oft kurzen Zeit als hohe Verwaltungsbeamte entfalten konnten. Immer wieder betont die Autorin nicht nur die nicht zu überschätzende Rolle des Bildungssystems bei der Umsetzung einer bestimmten Vorstellung des Staates, sie zeigt auch, dass der entscheidende Machthaber in diesem Prozess die Schulverwaltung war. Pädagogik und Politik sind also zwei Seiten derselben Medaille, wobei der zentrale Hebel der Wirksamkeit die Verwaltung ist: „Die Reform des Bildungswesens war ein integrierender Bestandteil der gesamten preußischen Reformen. In der fruchtbarsten Reformphase (1808-1814) stimmten die leitenden Politiker und die neuen humanistischen Schulreformer in ihren Konzeptionen grundsätzlich überein, dass sich bei der Neugestaltung des Staatswesens Politik und Pädagogik wechselseitig bedingen.“ Und weiter: „Bei der Einschätzung der Möglichkeiten und Grenzen der neuen humanistischen Bildungsreform ist die spezifische Interessenkonstellation zu berücksichtigen, innerhalb derer die Bildungsreformer handelten. Der vornehmliche Träger der Reform war die nach Herkunft und Interessenslage in besonderer Weise auf den Staat bezogene gebildete Beamtenschaft, die eine Mittelstellung einnahm zwischen der im Revolutionszeitalter vorübergehend geschwächten Herrenklasse und dem erst im Entstehen begriffenen, politisch einflusslosen Wirtschaftsbürgertum.“ (Herrlitz/Hopf/Titze 1993, 43f.) Der Governance-Ansatz als neuer Weg der politischen Steuerung Der Staat, so wie wir ihn heute kennen, ist ein integraler Bestandteil der Entstehung der modernen Gesellschaft. In ökonomischer, kultureller und politischer Hinsicht hat sich die Notwendigkeit ergeben, eine Alternative für das nicht mehr funktionierende herkömmliche Modell einer absolutistischen Monarchie zu suchen. Seit Beginn der Neuzeit denken daher Philosophen und andere Theoretiker darüber nach, wie dieses neue Element „Staat“ beschaffen sein muss, welches seine Bestimmungsmerkmale sind, wie es zustande kommen kann, welche Aufgaben es haben soll. Vom „Leviathan“ (Hobbes), also einem starken Staat unter der Herrschaft eines absoluten Monarchen, bis zu den zeitgenössischen Formen des Staates in einer parlamentarischen Demokratie stellt sich die Frage, wie der Einfluss dieses Staates auf das Leben seiner Bürger gesichert werden kann. Dabei variieren die Vorstellungen über die Zugriffsmöglichkeiten und die Zuständigkeiten dieses Staates bis heute: von einem reinen (liberalen) „Nachtwächterstaat“, der sich lediglich um die Sicherheit seiner Bürger kümmern muss, bis zu einem Wohlfahrtsstaat, der sich umfassend für das gute Leben seiner Bürgerinnen und Bürger kümmert, reicht das Spektrum. Allerdings gibt es spätestens seit der (zum Teil gescheiterten) Reformpolitik der 1960er und 1970er Jahr einen Konsens darüber, dass Vorstellungen einer direkten Steuerung gesellschaftlicher (also 42 ökonomischer, kultureller oder sozialer) Prozesse durch den Staat nicht funktionieren. Vor diesem Hintergrund geistert seit einigen Jahrzehnten das Konzept der Governance durch die Debatten: „Governance impliziert, dass staatliches Handeln nicht oder nicht allein in der Form hierarchischer Steuerung, sondern in Kooperation mit privaten Akteuren stattfindet. Umstritten bleibt dabei, welche Form der Interaktion zwischen staatlichen und privaten Akteuren unter Governance gefasst werden sollen.“ (Blumenthal 2014, 87). Nach wie vor gibt es dabei keinen Konsens darüber, wie der Ansatz konkret zu definieren ist bis hin zu der kritischen Anfrage, ob es sich dabei vielleicht lediglich um ein Modebegriff handelt. Immerhin wird der Begriff in unterschiedlichen Disziplinen verwendet: Politikwissenschaft, Soziologie, Ökonomie, Rechtswissenschaft und nicht zuletzt auch in der Bildungsforschung. Bei allen unterschiedlichen Verwendungsweisen geht es dabei um die Erfassung von vier Dimensionen: – sich wandelnde und neue Akteurskonstellationen – sich wandelnde und neue institutionelle Arrangements und Regelungsstrukturen – sich auflösende, bzw. verwischende bisherige Grenzziehungen wie etwa zwischen National und International, öffentlich und privat, formal und informal – sich wandelnde oder neu zu entwickelnde Legitimationskonzepte, die die Geborgenheit nationalstaatlicher Legitimationskonzepte überwinden. (Schuppert, zitiert nach Blumenthal a.a.O., 95) Die Problematik des Governance-Ansatzes liegt auch darin, dass er offenbar mit zwei unterschiedlichen normativen Orientierungen verwendet werden kann: einer „sozialdemokratischetatistischen Philosophie“ und andererseits mit einer „liberalen oder auch kommunitarischen Auffassung“ (so Offe, zitiert nach Blumenthal a.a.O., 104). Noch etwas präziser werden die Dimensionen dieses Ansatzes bei Altrichter/Maag Merki (2010, 17 ff.) benannt: – viele Steuerungsakteure mit multiplen Interessen – Akteure und Systeme mit Eigenlogiken und Eigendynamiken – Verselbstständigung und Verschränkung – keine direkte Steuerung, aber indirekte Beeinflussung durch aktive Übersetzungsvorgängen – Intentionale Gestaltung mit teilweise transintentionalen Ergebnissen. Neben der Frage der Optimierung von Steuerung spielte bei der Einführung des GovernanceKonzeptes gerade auf internationaler Ebene (Vereinte Nationen) auch eine Rolle, dass die Politik sich dort wesentlich auf Staaten mit einer sehr begrenzten Legitimation stützen kann. Von daher gab es ein Interesse, neben den offiziellen Machthabern auch zivilgesellschaftliche Organisationen als 43 politische Gestalter anzuerkennen. Vor diesem Hintergrund ist die offiziöse Definition einer entsprechenden Kommission entstanden: „Ordnungspolitik bzw. Governance ist die Gesamtheit der zahlreichen Wege, auf denen Individuen sowie öffentliche und private Institutionen ihre gemeinsamen Angelegenheiten regeln. Es handelt sich um einen kontinuierlichen Prozess, durch den kontroverse und unterschiedliche Interessen ausgeglichen werden und kooperatives Handeln innitiiert werden kann. Der Begriff umfasst sowohl formelle Institutionen und mit Durchsetzungsmacht versehene Herrschaftssysteme als auch informelle Regelungen, die von Menschen und Institutionen vereinbart oder als im eigenen Interesse angesehen wird.“ (Commission on Global Governance 1996, Seite 4) Begriffe, die im Kontext dieser Debatten immer wieder genannt werden sind: Mehrebenensystem, Kooperation zwischen öffentlichen, zivilgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Instanzen, Vielfalt von Akteuren und damit verbunden eine Vielfalt von Steuerungslogiken. Insbesondere im Hinblick auf die Zusammenarbeit zwischen Staat und Wirtschaft und auf die sich verändernde Rolle der Verwaltung kann als Bestandteil des Governance-Ansatzes die Einführung des Neuen Steuerungsmodells (New Public Management) gesehen werden mit all seinen inzwischen hinreichend diskutierten und kritisierten Bestandteilen (Evaluation, Outputsteuerung, Zielvereinbarungen, Dienstleistungsorientierung, Public Private Partnerships, Abbau und Privatisierung öffentlicher Aufgaben etc.) (Bogumil/Jann 2005). Educational Governance Speziell in der Bildungspolitik hat sich gezeigt, dass der Versuch einer top down Steuerung des Bildungssystems nicht funktioniert. Daher stellte sich gerade in diesem Bereich mit besonderer Vehemenz die Frage, wie Innovationen in die Breite des Bildungssystems gelangen können. Vor diesem Hintergrund gibt es in den letzten Jahren verstärkt Bemühungen, Elemente des GovernanceAnsatzes in der Bildungspolitik zu etablieren, zum Teil, ohne dies explizit so zu benennen, zum Teil unter dem neuen Label der "Educational Governance". Altrichter/Maag Merki (2010, 35) identifizieren drei Kernbereiche der Umsetzung des Neuen Steuerungsmodells im Bildungswesen: – Schulautonomie und Erhöhung einzelschulischer Gestaltungsspielräume – Verbetrieblichung der Einzelschule – evidenzbasierte Bildungspolitik und Schulentwicklung (Bildungsstandards und Qualitätsrahmen, Lernstandserhebungen und Schulinspektionen, Bildungsberichterstattung und -monitoring). Zumindest in der Wissenschaft hat dieser Ansatz inzwischen reiche Früchte getragen, denn es werden immer mehr Professuren im Bereich der Erziehungswissenschaft im Hinblick auf diese Dimensionen umdefiniert. Daher ist es nötig, sich immer wieder möglicher Kritikpunkte an diesem Ansatz zu vergewissern. Es gibt dabei eine globale Kritik an dem Ansatz insgesamt, so wie sie in der Politikwissenschaft formuliert wird: So wird beklagt, dass es ein normatives Defizit dieses Ansatzes gibt. Man kann zudem feststellen, dass der Machtaspekt kaum berücksichtigt wird. So ist zwar für jeden ersichtlich, dass es diese Vielzahl unterschiedlicher Akteure gibt, doch wird man feststellen 44 müssen, dass bei den unterschiedlichen Akteure in der Regel nicht berücksichtigt wird, woraus sie ihre Legitimation für ihre Einmischung beziehen. Zudem wird nicht reflektiert, dass die unterschiedlichen Akteure einen unterschiedlich großen Einfluss auf die Gestaltung haben können. Kritik wird zudem an einzelnen Elementen dieses Ansatzes geübt. Man hat ihn zuerst bei der Reform der Kommunal-Verwaltung Ende der 1980er Jahre angewandt („Tillburger Modell“). Hierbei ist man von der neuen Sichtweise ausgegangen, die Kommunen und ihre Verwaltungen als Unternehmen zu sehen, die für ihre Kunden (die Bürgerinnen und Bürger) Dienstleistungen zu erbringen haben. In diesem Kontext sind viele kommunale Einrichtungen privatisiert worden. Jahre später hat man erkannt, dass eine Kommune ein politisches Gebilde und kein Unternehmen ist von daher nur begrenzt einer betriebswirtschaftlichen Sichtweise zugänglich sein kann. Zudem hat man bemerkt, dass die in der Anfangszeit euphorisch betriebenen Privatisierungen kommunaler Einrichtungen auch in einer ökonomischen Perspektive wenig erfolgreich waren. Im Bereich der Erziehungswissenschaft gibt es inzwischen eine reichhaltige kritische Diskussion über die unterschiedlichen Elemente der educational governance (diese beginnt bei PISA, dem Bildungsverständnis, der zu starken Orientierung an ökonomischen Bedürfnissen, dem Verlust an theoretischer und historischer Reflexion, der Unterstellung einer Verwertungslogik etc.). Cultural Governance Das demokratisch-parlamentarische System hat sich – nach dem Scheitern eines ersten Versuches nach dem Ersten Weltkrieg – 70 Jahre nach dem zweiten Weltkrieg in Deutschland stabilisiert. Allerdings ist das staatstheoretische Erbe des 19. Jahrhunderts immer noch lebendig, denn nach wie vor gibt es einen Meinungsstreit darüber, welche Rolle der Staat in der Gesellschaft zu spielen hat. Man kann sagen, dass sich Behauptungen eines Staatsversagens und eines Marktversagens immer wieder abwechseln, wobei dann zur Behebung des Staatsversagens die Rolle eines marktorientieren Denkens in den Vordergrund tritt (Neues Steuerungsmodell) und im Falle eines Marktversagens der Ruf nach einem stärker regulierenden Staat stärker wird (Beispiel Finanzkrise). Nach wie vor existieren die im 19. Jahrhundert entstandenen politischen Philosophien und die damit verbundenen Staatsmodelle (Liberalismus, Konservativismus, Sozialismus), wobei sich Sozialismus und Konservativismus einig darin sind, dass der Staat eine sehr viel größere Rolle als im Rahmen eines philosophischen und politischen Liberalismus spielen sollten. Das Problem mit dem aktuellen, als Partei organisierten Liberalismus besteht zur Zeit darin, dass von den zwei Standbeinen des philosophischen Liberalismus, nämlich die Betonung des freien Individuums und seiner Bürgerrechte auf der einen Seite und die These von einem notwendigen freien Markt auf der anderen Seite die wirtschaftsliberale Denkweise eindeutig dominiert, so dass es ein Defizit im Bereich der Vertretung der Bürger- und Menschenrechte gibt (abzulesen etwa an Fragen wie der Vorratsspeicherung). In jedem Fall kann man feststellen, dass die Rolle des Staates im Rückzug ist und ehemals von der öffentlichen Hand bereitgestellte Leistungen trotz inzwischen vorliegender schlechter Erfahrungen weiter privatisiert werden sollen. Trotzdem scheint gerade im deutschen praxisbezogenen politischen Denken die spätestens mit Fichte und Hegel prominent gewordene Idee eines Staates als einer über allen Interessen stehende Instanz eine wichtige Rolle zu spielen. So wurde in den letzten Jahren der Gedanke eines „aktivierenden Staates“ entwickelt, der sich zwar aus der bislang öffentlichen Bereitstellung 45 bestimmter Leistungen (etwa im Sozialbereich) zurückzieht, der aber zumindest in einer strukturierenden und impulsgebenden Funktion weiterhin eine zentrale Rolle spielen will. In der Kulturpolitik hat man den Gedanken eines „Kulturstaates“ oder sogar die Idee eines "aktivierenden Kulturstaates" (Scheytt 2008, zur Kritik vgl. Fuchs 2011) aus dem frühen 19. Jahrhundert wieder aufgegriffen, wobei es heute primär um die Sicherstellung der kulturellen Infrastruktur durch die öffentliche Hand geht. Dabei hat man kaum reflektiert, dass zum einen der "Kulturstaat" des 19. Jahrhunderts sich im Wesentlichen um Fragen der Bildung bzw. um das Verhältnis zur Kirche kümmerte (Romberg 1979) und die Erhaltung der kulturellen Infrastruktur – die ohnehin vor allem in kommunaler Hand war – keine große Rolle spielte (Wagner 2009). Zum anderen hat man das dahinter stehende problematische Verständnis von Staat und Gesellschaft kaum berücksichtigt. Es gibt also (immer noch) eine starke etatistische Tradition in Deutschland, wobei es durchaus zu eigenartigen Verbindungen von Gedanken eines aktivierenden Kulturstaates mit der Denkweise des neuen Steuerungsmodells gibt (so tendenziell in Deutscher Bundestag 2008, 125ff., vgl. auch Knoblich/Scheytt 2009). Ein anerkannter Grundsatz des modernen Staatsdenkens besteht in der Anerkennung des Gewaltmonopols des Staates. Ein Blick nicht nur in die europäische Geschichte, sondern auch in diejenigen Regionen der Welt, in denen es keine entwickelte Form von Staatlichkeit gibt und in denen daher Warlords und terroristische Banden miteinander um die Herrschaft streiten, überzeugt sofort von der Notwendigkeit eines solchen Prinzips. Doch muss man unterhalb dieser Auseinandersetzungen, in denen körperliche Gewalt eine entscheidende Rolle spielt, sehen, dass auch im modernen demokratischen Staat mit seinem Gewaltmonopol problematische Erscheinungen auftreten. Es ist gerade die Dimension des Sozialstaates, die immer wieder zu Problematisierungen führt. Denn zum einen ist die Errichtung eines sozialen Netzes eine wichtige zivilisatorische Errungenschaft (auch wenn bei der Geburt der Sozialpolitik in der Zeit von Bismarck weniger altruistische und philanthropische Motive eine Rolle spielten, sondern der Erhalt der Massenloyalität angesichts einer wachsenden sozialdemokratischen Gefahr), zum anderen führt gerade der Ausbau des Sozialstaates zu einer enormen Vergrößerung der Verwaltung der entsprechenden Etats, die durchaus in Kategorien von Macht und Gewalt analysiert werden können. Man muss einfach davon ausgehen, dass wichtige Grundprinzipien unserer Verfassung miteinander in einem Spannungsverhältnis stehen, hier etwa das Sozialstaatsprinzip mit der Frage der Menschenwürde. Auch im Kulturbereich sind derartige Spannungen zu spüren, wenn man einerseits eine öffentliche Förderung von kulturellen Einrichtungen wünscht (wobei jeder weiß, dass eine Mittelvergabe auch ein wirksames Instrument von Macht ist), und man sich andererseits auf die Kunstfreiheitsgarantie des Grundgesetzes bezieht. Unsere gesellschaftliche Entwicklung hat dazu geführt, dass der Einzelne immer wichtiger wurde. Allerdings wurde dies in den Wissenschaften durchaus kritisch diskutiert, da es nämlich geradezu zu einem Ich-Kult gekommen ist, der den Einzelnen weit gehend losgelöst aus sozialen Bindungen (Individualisierungsthese) und nur noch als konsumierenden Einzelnen betrachten kann. 46 Kulturelle Bildung und Educational Governance Zu der Entwicklung der modernen Gesellschaft gehört eine Ausdifferenzierung der verschiedenen Praxis- und Theoriefelder, so dass sich spätestens seit dem 18. Jahrhundert (vorbereitet durch einen längeren Vorlauf; vgl. Fuchs 2012) nicht bloß die gesellschaftlichen Subsysteme entwickeln, sondern auch die verschiedenen Theorie- und Praxisfelder an Eigenständigkeit gewinnen. So diskutiert man die Frage des Wahren, Guten und Schönen, also die klassischen philosophischen Disziplinen der Erkenntnistheorie, der Moralphilosophie und der Ästhetik, zunehmend getrennt voneinander, obwohl noch Kant die drei entscheidenden Fragen (Was kann ich wissen? Was darf ich hoffen? Was soll ich tun?) in der einen Frage gebündelt sah: Was ist der Mensch? Mit der zunehmenden Ausdifferenzierung der Praxis- und Theoriefelder stellt sich dann das Problem nach dem Zusammenhang, etwa zwischen Ethik/Politik und Ästhetik. Schiller hat in seinen Briefen zur ästhetischen Erziehung einen raffinierten Entwurf vorgelegt, der gerade in einer autonomen Kunst das wirkungsvollste Mittel einer humanistischen Gesellschaftsreform sah. Hannah Arendt hat in diesem Zusammenhang unter Bezug auf Kant (Kritik der Urteilskraft, 1790) einen interessanten Deutungsvorschlag unterbreitet. Ihr innovativer Ansatz besteht darin, in dieser ästhetischen Hauptschrift von Kant eine politische Philosophie zu erkennen (Arendt 2012). Kant setzt sich nämlich mit der Frage auseinander, inwieweit man bei der höchst individuellen Bildung von Geschmacksurteilen doch von einer gewissen Allgemeingültigkeit sprechen kann. Er gibt sich nicht mit der auch damals schon verbreiteten These zufrieden, über Geschmack könne man nicht streiten. Er findet den gemeinsamen Nenner, die Basis also dafür, dass auch individuelle Geschmacksurteile einen überindividuellen Geltungsbereich haben können, darin, dass es einen sensus communis, einen Gemeinsinn, gibt, den alle Menschen teilen. Seine Grundidee besteht darin, dass auch bei einem individuellen ästhetischen Geschmacksurteil der Mensch nicht aus seiner sozialen Eingebundenheit aussteigen kann, sondern die Gemeinschaft quasi mit ihrer Urteilsfähigkeit ein Teil seines Selbst ist. Hierin sieht Hannah Arendt auch die Basis einer politischen Philosophie, denn auch die Konstitution des Politischen setzt voraus, dass die beteiligten Menschen eine Gemeinsamkeit haben. Das Ästhetische wird so zu einem Erprobungsfeld für das Politische. Nachdem oben skizziert wurde, dass es bei der Entstehung und dem Ausbau des öffentlichen Bildungs- und Erziehungswesens allen Beteiligten immer bewusst war, dass Politik und Pädagogik zwei einander bedingende Seiten derselben Medaille sind, kann nunmehr als drittes Element das Ästhetische in das Denken einbezogen wird. Es liegt auf der Hand, dass dies von höchster Bedeutung nicht nur dann ist, wenn man über Theorien der kulturellen und ästhetischen Bildung nachdenkt. Es ist offensichtlich, dass dies auch dann eine zentrale Rolle spielen muss, wenn man über kulturelle und ästhetische Bildung als Praxisfeld und die Möglichkeiten seiner politischen Gestaltung nachdenkt. Im Folgenden sollen einige Bestandteile der Überlegungen zu einer neuen politischen Steuerung im Hinblick auf kulturelle Bildung angesprochen werden. Mehrebenensystem Entsprechend unserem föderalen Aufbau lassen sich die kommunale, die Länder- und die Bundesebene unterscheiden. An Relevanz gewinnt zudem die europäische und internationale Ebene 47 (Europäische Union, Europarat, UNESCO, Vereinte Nationen, OECD). In der Erziehungswissenschaft unterscheidet man zudem die Mikro-, die Meso- und Makroebene, wobei die Mikroebene die unmittelbare pädagogische Arbeit erfasst, sich die Meso-Ebene auf die Institution bezieht und die Makroebene die politischen Rahmenbedingungen reflektiert. Offensichtlich setzt diese Unterscheidung die politische Unterscheidung eines Mehrebenensystems nach unten fort. Kulturelle Bildung findet zudem zumindest in der Schul-, in der Kultur- und in der Jugendpolitik statt. Es ergibt sich so eine Matrix, bei der man in jedem dieser drei Politikfelder die oben beschriebenen Ebenen unterscheiden kann. Es lässt sich nunmehr fragen, in welcher Weise kulturelle Bildung in jedem dieser Matrixfelder behandelt wird. Eine solche systematische Untersuchung liegt bislang noch nicht vor, obwohl es natürlich politikfeldspezifische Analysen zur kulturellen Bildung gibt (vergleiche etwa die Beiträge von Schäfer, Sievers und Hübner in kubi-online jeweils zur Jugend-, Kultur- und Bildungspolitik). Ein Vergleich dieser unterschiedlichen Felder ist deshalb notwendig, weil die verschiedenen Politikfelder eigenen Handlungslogiken gehorchen, was unter anderem zu einem unterschiedlichen Verständnis der jeweils benötigten Professionalität führen kann. So treffen etwa bei der Kooperation von Schulen mit außerschulischen Trägern Personen aufeinander (nämlich Künstlerinnen und Künstler, Kulturpädagoginnen und Kulturpädagogen und Lehrerinnen und Lehrer), die ihre Sozialisation jeweils feldspezifisch absolviert haben. Akteurskonstellationen Man unterscheidet (in unterschiedlichen Disziplinen) im Hinblick auf die Gesellschaft drei Bereiche: den Staat bzw. den öffentlich-rechtlichen Bereich, den Markt und den sogenannten „Dritten Sektor“ als den frei-gemeinnützigen Bereich. Die Güter und Dienstleistungen in einer Volkswirtschaft werden in diesen drei Bereichen bereitgestellt, wobei es für jeden dieser Bereiche unterschiedliche Handlungsprinzipien und Ziele gibt. Dass eine marktorientierte Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen sich an dem Prinzip der Gewinnmaximierung orientiert, gehört zur Logik der kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Zudem gibt es einen Dritten Sektor, in dem ohne Gewinnabsicht notwendige Güter und Dienstleistungen hergestellt werden, weshalb dieser Bereich auch besondere Vorzüge in steuerlicher Hinsicht genießt. Die öffentliche Hand wiederum stellt im Rahmen des Prinzips der Daseinsvorsorge – auch ein Begriff, der im staatstheoretischen Denken des 19. Jahrhunderts entwickelt und von dem Staatstheoretiker Ernst Forsthoff systematisiert worden ist – solche Güter und Dienstleistungen bereit, die in den beiden anderen Sektoren nicht bereitgestellt werden. Wie oben erwähnt, gibt es seit Beginn des bürgerlichen Staates eine Auseinandersetzung darüber, welcher Bereich jeweils die Verantwortung für die Bereitstellung bestimmter Güter und Dienstleistungen übernehmen soll. Dieses Drei-Felder-Schema ist nicht nur interessant im Hinblick auf die Bereitstellungsfunktion, man kann es auch verwenden im Hinblick auf die Identifikation von Akteuren im Bereich der politischen Steuerung. Dass der Staat hierbei eine zentrale Rolle spielt, liegt auf der Hand. Aber auch aus dem Feld des Marktes und dem Dritten Sektor gibt es erhebliche Einmischungen in die politische Steuerung. Es sind insbesondere die jeweiligen Verbände, die die Interessen der von ihnen organisierten Institutionen und Menschen artikulieren. Dabei ist die Abgrenzung nicht immer so einfach, wie es die Aufteilung in drei Felder suggerieren mag. So schließen sich etwa 48 Wirtschaftsbetriebe zu Verbänden zusammen, die wiederum als „zivilgesellschaftliche“ Organisationen auftreten. Auch Stiftungen, die mit privaten Geldern aus dem Bereich der Wirtschaft errichtet wurden, können aufgrund ihrer Gemeinnützigkeit beanspruchen, zu den zivilgesellschaftlichen Organisationen gerechnet zu werden, obwohl Motivation und Ausrichtung der Aktivitäten ihren Ursprung aus dem Feld der Wirtschaft oft nicht verhehlen. Dieses Drei-Felder-Schema wurde von dem amerikanischen Soziologen Talcott Parsons systematisch zu einem Vier-Felder-Schema ausgebaut, das die vier gesellschaftliche Subsysteme Wirtschaft, Politik, Gemeinschaft und Kultur unterschied, die jeweils mit den „Medien“ Geld, Macht, Solidarität und Sinn kommunizieren. Dieses Vier-Felder-Schema wurde von Helmut Fend bereits vor 40 Jahren dazu genutzt, gesellschaftliche Funktionen des Bildungssystems generell und auch einzelner Bildungseinrichtungen zu identifizieren. So erhebt das Subsystem Wirtschaft Anspruch darauf, dass das Bildungssystem zur Qualifikation der Heranwachsenden beiträgt. Das Subsystem Politik erwartet, dass die Aufgabe der Legitimation des jeweiligen politischen Systems erfüllt wird. Im Hinblick auf die Gemeinschaft spricht Fend von den Funktionen der Allokation und Selektion. Im Kulturbereich schließlich (Kunst, Wissenschaften, Religion) wird erwartet, dass die Funktion der Enkulturation erfüllt wird. Auch hierbei lassen sich jetzt in jedem der vier Subsysteme Akteure identifizieren, die die subsystemspezifischen Anliegen und Erwartungen in den politischen Raum kommunizieren und gegebenenfalls selbst Aktivitäten unternehmen, die ihrem Anliegen einen gewissen Druck verleihen. Die „Machtmittel“ sind dabei recht unterschiedlich. Die öffentliche Hand hat dabei die üblichen Mittel des Staates, nämlich Gesetze und finanzielle Förderung, zur Verfügung. Der Bereich der Wirtschaft kann Geld zur Durchsetzung seiner Interessen einsetzen. Im Bereich der Gemeinschaft kann es zu Gründungen von Lobbyorganisationen kommen, die bestimmte soziale Interessen verfolgen (gesellschaftspolitische Themen wie etwa Geschlechterverhältnisse, Nachhaltigkeit und Umweltschutz, Entwicklungshilfe oder andere humanitäre Anliegen etc.). Auch der Kulturbereich hat seine Verbände im Bereich der Wissenschaft und der Künste. Zudem mischen sich die Kirchen immer wieder mit ihren Anliegen in die politischen Gestaltungsprozesse ein. Ein wesentliches Kennzeichen eines demokratischen Gemeinwesens ist dabei die öffentliche Kommunikation, also eine gut entwickelte Öffentlichkeit mit einer Vielzahl unterschiedlichster Medien und Kommunikationsformen. In diesem Feld spielt sich daher auch der Kampf um Einfluss ab in einer Weise, die etwa Jürgen Habermas im Rahmen seiner Idee einer herrschaftsfreien Kommunikation zur Grundlage eines demokratischen politischen Denkens genommen hat (durchaus in der Nachfolge von Hannah Arendt mit ihrer aristotelischen Unterscheidung von Arbeit, Herstellen und Praxis, vgl. Arendt 1981 und Habermas 1981). Im Hinblick auf kulturelle Bildung ließe sich jetzt analysieren, welche Entwicklung und Steuerungsimpulse jeweils aus den vier Subsysteme formuliert und in die öffentliche Kommunikation gebracht werden, wie das administrative System diese Impulse verarbeitet und in die Praxis umsetzen will und wie schließlich die Praxis selbst diese Impulse aufgreift und realisiert. Dies wäre Aufgabe einer zu entwickelnden kulturellen Bildungspolitikforschung, die es bislang bestenfalls in Ansätzen gibt. 49 Einige Probleme und offene Fragen Das oben skizzierte Vier-Felder-Schema und die vorgestellte Mehrebenen-Matrix scheinen auf den ersten Blick eine saubere Strukturierung des Feldes der kulturellen Bildung in Theorie, Praxis und Politik zu ermöglichen. Es wird jedoch von der angesprochenen empirischen Analyse realer politischer Gestaltungsprozesse abhängen, ob diese beiden Strukturierungsvorschläge hinreichend präzise den Sachverhalt beschreiben. Einige Probleme wurden bereits angesprochen, etwa die Schwierigkeit, bestimmte Akteure wie etwa Stiftungen eindeutig Feldern zuzuordnen. Erschwert wird dies noch dadurch, dass gerade im Bereich der Stiftungen auch die öffentliche Hand gerne bei der Organisation der von ihr geförderten Einrichtungen zu diesen juristischen Geschäftsmodellen greift, was eine eindeutige Zuordnung zu bestimmten Feldern erschwert. Auch im Bereich des Segments des Staates gibt es Abgrenzungsschwierigkeiten. Viele von uns haben noch in der Schule gelernt, dass ein Kennzeichen eines demokratischen Staates in der Gewaltenteilung (Legislative, Exekutive, Rechtswesen) besteht. In der Realität hat es diese saubere Form der Gewaltenteilung vermutlich nie gegeben. Man muss sich nur einmal anschauen, wer im Deutschen Bundestag Gesetzesvorlagen einbringt. Die wenigsten Gesetzesvorlagen kommen von Parlamentsmitgliedern und ihrem (kleinen) Stab von Mitarbeitern, der Großteil der Gesetzesvorhaben wird von der Regierung vorgelegt, wobei es hier die Aufgabe der Ministerialbürokratie (also der Verwaltung) ist, nicht bloß die entsprechenden Vorschläge zu entwickeln, sondern sie auch bis zur Abstimmungsreife auszuarbeiten. Ein anderer Aspekt betrifft das Bundesverfassungsgericht, das zwar einerseits zu dem Feld des Rechtswesens gehört, dem aber immer wieder vorgeworfen wird, in den Zuständigkeitsbereich der Legislative und Exekutive einzugreifen. Gibt bereits auf nationaler Ebene die idealistische Theorie der Gewaltenteilung nicht, so verschiebt sich auf der Ebene der Europäischen Union die Macht noch stärker in Richtung Exekutive. Auch wenn das europäische Parlament in den letzten Jahren an Einfluss gewonnen hat, so hat die Kommission (als Exekutivorgan der Europäischen Union) und dessen zentrale Kontrollinstanz, der Ministerrat (der wiederum von den Spitzen der nationalen Exekutive besetzt wird) kaum an Einfluss eingebüßt. Die Exekutive kontrolliert sich also selbst und die parlamentarische Mitsprache spielt kaum die Rolle, die sich die Theoretiker der Demokratie vorgestellt haben. Dies gilt insbesondere im Schulwesen. Es wurde oben bereits angesprochen, dass die zentralen Entwicklungsimpulse beim Auf- und Ausbau des Schulwesens aus der Bildungsverwaltung kommen. In der Tat ist es eine Besonderheit der Entwicklung der Nationalstaatlichkeit in Deutschland im 19. Jahrhundert, dass sich die Verwaltungslehre als Verwaltungswissenschaft als wissenschaftliche Einzeldisziplin konstituierte und dynamisch entwickelte, weil man sie bei der Qualifikation der benötigten Fachkräfte in der Verwaltung benötigte. Dies gilt insbesondere für den Bereich der Schule: „In der gleichen Zeit gewannen Schulrecht und Schulverfassungsgesetz – beide oft unter einem dieser Namen zusammengefasst – die Prägung einer selbstständigen Disziplin. Seit der Reformationszeit war das Schulrecht mit dem Kirchenrecht verschmolzen und nach und nach durch Verordnung sehr ungleichen Rechtscharakters erweitert worden. Als ein Teil des Staatsrechtes wurde es zuerst in Preußen (1794), dann auch in anderen Staaten bezeichnet, ohne dass es damit zu einer eigentlichen Schulgesetzgebung kommen wäre.“ (Flitner 1957, 169). 50 Die Schule und das Bildungswesen insgesamt waren also von Anfang an ein Feld, in dem die unterschiedlichen Akteure Einfluss gewinnen bzw. sichern wollten. Ging es zunächst darum, die Schule aus der Verantwortung der Kirche in die Verantwortung des Staates zu übernehmen, so mischen sich zunehmend Kräfte aus der Wirtschaft in die Schulpolitik ein, wobei das staatliche Interesse an der Schulpolitik immer auch darin bestand, die Loyalität der Massen zu dem jeweiligen politischen System zu erhalten. Man findet in dieser Konstellation ohne Probleme die gesellschaftlichen Funktionen wieder, sowie Sie Fend auf der Basis des Vier-Felder-Schemas entwickelt hat. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass sich dies in der aktuellen Situation geändert hätte. Es wäre daher durchaus von Interesse, auch im Hinblick auf die kulturelle Bildung zu untersuchen, welche Interessen die unterschiedlichen Akteure in den verschiedenen gesellschaftlichen Feldern und diese dann auch mit welchen Maßnahmen verfolgen. Es handelt sich also um Aspekte der Macht, wobei man mit einer gewissen Verwunderung feststellen kann, dass seit den machtsensiblen Diskursen aus der Zeit der 1960er und 1970er Jahren es geradezu verpönt erscheint, solche Fragestellungen im Feld der kulturellen Bildung zu verfolgen. Bei aller Nützlichkeit des Vier-Felder-Schemas ist dabei zu berücksichtigen, dass dieses Schema eine gewisse Gleichberechtigung der vier Felder suggeriert, die in der Praxis so nicht gegeben ist. So kann man feststellen, dass es in den letzten Jahren zwar nach wie vor eine Machtdominanz der Verwaltung bei der Gestaltung der Praxis gibt, dass aber in dem politischen Aushandlungsgeschäft die demokratisch verfassten zivilgesellschaftlichen Organisationen im Jugend- und Kulturbereich an Einfluss verlieren zu Gunsten von Akteuren, die ihre Legitimität im Wesentlichen aus der Verfügung über Geldmittel beziehen. Gerade Ansätze, die im Rahmen eines Educational Governance-Ansatzes propagiert werden, etwa der Gedanke einer Public-Private-Partnership, liefern dieser Machtverschiebung ein theoretisches Fundament. Ebenso wie in theoretischer Hinsicht der Ansatz von Hannah Arendt Hinweise darauf gibt, dass die Felder des Ästhetischen und des Politischen möglicherweise mehr miteinander zu tun haben, als ein oberflächlicher Autonomiediskurs heute suggerieren will, scheint es notwendig zu sein, auch in der Kulturpädagogik die politische Naivität abzulegen. Literatur Altrichter, Herbert/Maag Merki, Katharina (Hg.)(2010): Handbuch Neue Steuerung im Schulsystem. Wiesbaden: VS. Arendt, Hannah (1981): Vita Activa oder vom tätigen Leben. München/Zürich: Piper. Arendt, Hannah (2012): Das Urteilen. München/Zürich: Piper. Arendt, Hannah (2012b): Zwischen Vergangenheit und Zukunft. München/Zürich: Piper. Behrens, Fritz u.a. (1995) Den Staat neu denken. Berlin: Sigma. Benz, Arthur u.a. (Hg.)(2007): Handbuch Governance. Theoretische Grundlagen und empirische Anwendungsfelder. Wiesbaden: VS. 51 Blumenthal, Julia von (2010): Governance im und durch den Staat. Politikwissenschaftliche Perspektiven der Governance-Forschung. In: Maag Merki u.a. 2010. Bogumil, Jörg/Jann, Werner (2005) : Verwaltung und Verwaltungswissenschaft in Deutschland. Wiesbaden: VS. Busch, Werner (Hg.)(1987): Funkkolleg Kunst. München: Piper. Commission on Global Governance (Kommission für Weltordnungspolitik) (1995): Nachbarn in einer Welt. Bonn: SEF. Deutscher Bundestag (2008): Kultur in Deutschland. Schlussbericht der Enquete-Kommission. Regensburg: ConBrio. Ellwein, Thomas (1976): Regieren und Verwalten. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. Flitner, Andreas (1957): Die politische Erziehung in Deutschland. Tübingen: Niemeyer. Fuchs, Max (1998): Kulturpolitik als gesellschaftliche Aufgabe. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. Fuchs, Max (2011): Leitformeln und Slogans in der Kulturpolitik. Wiesbaden: VS. Fuchs, Max (2012): Kunst als kulturelle Praxis. München: Kopaed. Häußermann, Hartmut (1977): Die Politik der Bürokratie. Frankfurt/M.: Campus. Herrlitz, Hans-Georg/Hopf, Wulf/Titze, Hartmut (1993): Deutsche Schulgeschichte von 1800 bis zur Gegenwart. Eine Einführung. Weinheim/München: Juventa. Jeismann, Karl-Ernst/Lundgreen, Peter (Hg.)(1987): Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte Bd. III: 1800-1870. München: Beck. Knoblich, Tobias/Scheytt, Oliver (2009): Zur Begründung von Cultural Governance. Aus Politik und Zeitgeschichte 8/200, 34-40 Maag Merki, Katharina/Langer, Roman/Altrichter, Herbert (Hg.)(2014): Educational Governance als Forschungsperspektive. Wiesbaden: Springer. Macchiavelli, Niccolo (2008): Gesammelte Werke. Frankfurt/M.: Zweitausendeins. Rausch, Heinz von (1974): Politische Denker. 2 Bände. München: Bayrische Landeszentrale. Reinhardt, Wolfgang (1999): Geschichte der Staatsgewalt. München: Beck. Roessler, Wilhelm (1961): Die Entstehung des modernen Erziehungswesens in Deutschland. Stuttgart: Kohlhammer. Romberg, Helga (1979): Staat und Höhere Schule. Weinheim/Basel: Beltz. Scheytt, Oliver (2008): Der Kulturstaat. Bielefeld: transcript. Tenorth, Heinz-Elmar (2000): Geschichte der Erziehung. Weinheim/München: Juventa. Wagner, Bernd (2009): Fürstenhof und Bürgergesellschaft. Essen: Klartext. 52 5. Kulturelle Bildung, das Subjekt und die Menschenrechte Kulturelle Bildung als Teil der Subjektivität des Menschen Bildung verstanden als Lebenskompetenz (siehe Kapitel 1) ist die Fähigkeit zur bewussten Gestaltung eines guten, gelungenen und glücklichen Lebens. Bereits in dieser Begriffsbestimmung tauchen notwendigerweise zentrale Kategorien der praktischen Philosophie wie das gute Leben oder Glück auf. Dahinter steckt ein Menschenbild, das im Wesentlichen mit der Neuzeit verbunden ist: der Mensch ist Gestalter seiner selbst. Diese aktive Form des bewussten Umgangs mit sich, mit anderen und mit der Welt gilt als Kernelement des Subjektbegriffs. Überzieht man allerdings diesen Gestaltungsaspekt (so wie es etwa in der Romantik geschehen ist), dann handelt man sich zurecht die Kritik ein, die ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts am Subjektbegriff geübt wird und die insbesondere mit der Postmoderne im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts eine zentrale Rolle spielt. Berücksichtigt man allerdings die Dialektik von Autonomie und Heteronomie, dann gelangt man zu einem Konzept von Handlungsfähigkeit, ohne das Pädagogik nicht auskommt. Sinnvoll ist dabei die Unterscheidung, die Klaus Holzkamp vorgeschlagen hat: nämlich von einer restringierten und einer verallgemeinerten Handlungsfähigkeit zu sprechen, wobei sich eine restringierte Handlungsfähigkeit auf das Handeln im Rahmen gegebener Bedingungen bezieht und eine verallgemeinerte Handlungsfähigkeit in die Gestaltung dieser Rahmenbedingungen eingreift. Kulturelle Bildungsangebote bieten eine Möglichkeit, eine solche Handlungsfähigkeit zu erlernen und einzuüben und sind daher ein wichtiger Bestandteil bei der Konstitution von Subjektivität. Ein Subjekt im Verständnis dieses Textes überprüft daher auch kritisch die Verhaltenserwartungen, die die Gesellschaft an es stellt. Wichtig an diesem Prozess ist dabei die Möglichkeit, inakzeptable Handlungsanforderungen abzulehnen. Daher ist Widerständigkeit ein zentrales Bildungsziel. In dieser Hinsicht hat kulturelle Bildung wie jede Form von Bildung eine politische Dimension. Es geht dabei auch darum, eine klassische Tradition des Bildungsbegriffs zu bewahren, in der die Sehnsucht nach Frieden und ein Widerstand gegen Gewalt spätestens seit der Zeit des Dreißigjährigen Krieges (Comenius) ein integraler Bestandteil des Bildungskonzeptes war. Der Begriff der Bildung gehört daher zu einem Begriffsgeflecht weiterer großer Begriffe aus der praktischen Philosophie wie Gerechtigkeit, Gleichheit, Solidarität. Auch in einer zweiten Hinsicht berührt der Bildungsdiskurs diese großen Begriffe, wenn es nämlich um die politische Gestaltung des Bildungssystems geht. Nicht von ungefähr spricht man auf der Basis der letztlich empörenden Ergebnisse der PISA-Studien verstärkt von Bildungsungerechtigkeit, von Ungleichheit im Bildungssystem, von struktureller Demütigung. Der Begriff der Menschenwürde, so wie er in der Renaissance unter anderem von Pico della Mirandola formuliert wurde, kann dabei als wichtigster Begriff gesehen werden, auf den sich alle anderen Begriffe wie Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit oder Sicherheit beziehen. 53 Zur Menschenwürde „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ So heißt es in Art. 1 des Grundgesetzes. Später ist dann von einem Bekenntnis des Deutschen Volkes zu den „unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt“ die Rede. Man sagt, dass die anschließenden Artikel des Grundgesetzes nur dazu dienen, den zentralen Begriff der Menschenwürde zu präzisieren. Damit ist dieser Begriff natürlich auch für die praktische Pädagogik und Erziehungswissenschaft hochrelevant. Diese Relevanz wird durch weitere, eher zufällig herausgegriffene Befunde unterstrichen. Wenn etwa im ersten Pisa-Bericht davon die Rede ist, dass unser Schulsystem mit „struktureller Demütigung“ in Verbindung gebracht werden muss, dann muss man dies auch mit der Kategorie (verletzter) Menschenwürde in Verbindung bringen. Bei aller noch durchzuführenden notwendigen Präzisierung der Begrifflichkeit wird man zudem Gewalt (etwa gegen Kinder) als gravierenden Verstoß gegen die Menschenwürde sehen. Von diesem Hintergrund wird es überraschen, dass Deutschland erst im Jahre 2000 den Paragraphen 1631 BGB eingeführt hat, der gewaltfreie Erziehung gesetzlich vorschreibt (Schweden: 1979). Dies hat insofern mit dem durchaus schillernden Begriff der Menschenwürde zu tun, als man zumindest in einer ersten Annäherung Gewalt oder Demütigung als Gegenbegriff zur Menschenwürde verstehen kann. Doch was versteht man positiv darunter? Als ein früher wichtiger Theoretiker gilt Pico della Mirandola, der in der Renaissance – ohnehin die Zeit der Entdeckung (Burckhardt) oder sogar Erfindung (Dülmen) der Individualität – das Recht auf und die Fähigkeit zur aktiven Gestaltung des eigenen Lebens proklamiert hat. Das war insofern neu und zeugt von einem gestärkten Selbstbewusstsein des Menschen, als im religiösen mittelalterlichen Denken Gott als zentrale Verantwortungsinstanz für das Leben galt.(Fuchs 2001) „Würde“ ist also bereits hier erkennbar als Loslösung von vorgegebenen Autoritäten, als Übernahme von Eigenverantwortung. Der Mensch gilt nunmehr als frei in seiner Gestaltung der Lebensweise. Dazu gehört die Fähigkeit, selbst zu denken, ganz so, wie Kant es später in seiner bekannten Definition von „Aufklärung“ formuliert hat: sapere aude, und er beschreibt die Aufklärung als Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Der Mensch gibt sich die Gesetze seines Lebens selbst, ist frei und autonom. Es gibt also ein Netzwerk von Begriffen, die alle aufeinander verweisen: Rationalität und Selbstdenken, Freiheit und Selbstbestimmung, Selbstgestaltung und Partizipation. Dazu kommt der zentrale Gedanke in Kants praktischer Philosophie, dass der Mensch niemals als Mittel für einen fremden Zweck dienen dürfte. Die Selbstzweckhaftigkeit des Menschen ist Kern der theoretischen und praktischen Philosophie bei Kant.Mit diesen Überlegungen wird „Menschenwürde“ zu einem zentralen Begriff der Anthropologie und der praktischen Philosophie. Daneben wurde er aber auch von dem Rechtsdenken übernommen, wurde ganz so, wie der eingangs zitierte Art. 1 des Grundgesetzes es formuliert, er wird zu einem Begriff des Verfassungsrechts und der Menschenrechte. Historisch reagierte man mit dem Begriff auf Verletzungstatbestände: Folter, Zwangsarbeit, Massenmord, Sklaverei. Als Rechtsbegriff, vor allem als Begriff, der mit 54 Straftatbeständen zu tun hat, braucht er jedoch präzisere und handhabbare Abgrenzungen als im philosophischen Diskurs. Bayertz (1999, 826) zitiert die die folgenden Komponenten: - Sicherheit des individuellen und sozialen Lebens - rechtliche Gleichheit der Menschen - Wahrung menschlicher Identität und Integrität - Begrenzung staatlicher Gewaltanwendung - Achtung der körperlichen Kontingenz des Menschen. In pädagogischen Kontexten – bekanntlich gehörte die Pädagogik lange Zeit zur praktischen Philosophie – ist es ebenfalls nötig, Unterscheidungen zu treffen. Denn nicht jede Einschränkung der Autonomie ist gleich eine Verletzung der Menschenwürde. Jeder Einzelne braucht nur die eigenen Lebensumstände zu betrachten, um zu sehen, wie vielfältig wir eingebunden sind in Regelungssystem (Gesetze, Verordnungen, Hausordnungen, ungeschriebene Regeln bestimmter sozialer Kontexte, Satzungen etc.), die unsere Handlungsfreiheit begrenzen. Wir können eben nicht immer und überall das tun, was wir gerade tun wollen, ohne dass wir unsere Menschenwürde beschädigt sehen. Hilfreich ist in diesem Zusammenhang das Buch des Philosophen und Schriftstellers Peter Bieri: Eine Art zu leben (2013). Seine Dimensionen des Würdebegriffs sind die folgenden, die sich dann auch als Kapitelüberschriften wieder finden: - Würde als Selbstständigkeit - Würde als Begegnung - Würde als Achtung vor Intimität - Würde als Wahrhaftigkeit - Würde als Selbstachtung - Würde als moralische Integrität - Würde als Sinn für das Wichtige - Würde als Anerkennung der Endlichkeit. Es geht also darum, wie ich mit mir umgehe, wie ich mit anderen umgehe und wie andere mit mir umgehen. Bieri entfaltet seine Begriffsarbeit an diskursiv präsentierten Beispielen und Problemfällen, die oft aus literarischen Vorlagen entnommen werden. Doch warum braucht man Würde: „Die Lebensform der Würde… ist die existenzielle Antwort auf die existenzielle Erfahrung der Gefährdung“ (15). Einige Unterscheidungen: Nicht jede Ohnmacht ist bereits Demütigung, sondern sie wird es „erst dann, wenn ein anderer einen anderen gezielt in eine Lage der Ohnmacht bringt“ (34), denn: „Würde ist das Recht, nicht gedemütigt zu werden.“ (35). Auch die Notwendigkeit, andere um etwas zu bitten, mag den eigenen Stolz beschädigen, wird aber erst dann zur Beschädigung von Würde, 55 wenn dieser Andere seine Machtposition demütigend ausnutzt. Das literarische Beispiel ist der Handelsvertreter Willy Loman, der seinen Chef vergeblich um eine Versetzung in den Innendienst bittet („Tod eines Handlungsreisenden“). Dieser kostet geradezu aus, dem Wunsch nicht entsprechen zu wollen. Weitere eindrucksvolle Beispiele sind Patienten, die von Ärzten nicht als Subjekte behandelt werden. Sogar eine wohlmeinende Entmündigung kann eine Verletzung der Würde sein. Josef K., der aus unerfindlichen Gründen im „Prozess“ von Kafka zum Angeklagten wird, wird gedemütigt, weil man ihm Erklärungen für seine Verhaftung vorenthält (124). Immer wieder drehen sich die Beispiele von Bieri, die selten eine schnelle Bewertung zulassen, um die Grundidee: „Die Würde des Menschen ist seine Selbstständigkeit als Subjekt, seine Fähigkeit, über sein Leben selbst zu bestimmen. Seine Würde zu achten, heißt, diese Fähigkeit zu achten.“ (346). Schwierig wird dieser Grundsatz allerdings bei Fragen der Selbsttötung oder bei nachlassender Selbststeuerungsfähigkeit im Falle von Krankheit. Man kann auch seine Würde opfern. So leckt die Auschwitzinsassin in dem Lagerleiter Rudolf Höss die Füße, um ihr Kind retten oder zumindest ein letztes Mal sehen zu können. Und sie tut es, ohne ihre Würde zu verlieren. Macht, Gewalt und Unterwerfung der Pädagogik Körperliche Gewalt in der Erziehung findet sicherlich noch statt, ist jedoch inzwischen zumindest juristisch geächtet. Doch bleibt nach wie vor die Feststellung von Benner (1987), Pädagogik sei ein – sich selbst aufhebendes – Gewaltverhältnis. Damit reformuliert Benner die Aussagen Kants in seinen pädagogischen Schriften (1982, 711), dass das Paradoxe, ja das Widersprüchliche bei der Pädagogik in dem Problem bestehe, „wie man die Unterwerfung unter den gesetzlichen Zwang mit der Fähigkeit, sich seiner Freiheit zu bedienen, vereinigen könne. Denn Zwang ist nötig! Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?" Dass es sich bei der gesetzlichen Schulpflicht, bei dem Besuch der Zwangsanstalt Schule nicht um eine Demütigung oder eine Verletzung der Menschenwürde handelt, ist nach dem oben Gesagten klar. Damit hat die Schule jedoch keinen Blankoscheck. Vielmehr ist ständig sowohl die Struktur des Bildungswesens, sind die Regelungen – etwa der Leistungsbeurteilung und der (Nicht-) Versetzung –, ist die Organisation, die Atmosphäre und die Schulkultur der Einzelschule daraufhin zu überprüfen, ob nicht doch eine solche Verletzung vorliegt. Immerhin ist die vielfach festgestellte Bildungsungerechtigkeit ein Hinweis darauf, dass die Menschenwürde bedroht sein könnte. In dieselbe Richtung geht die Rede von einer „strukturellen Demütigung“. Es geht also um andere Formen von Gewalt als bloßer körperlicher Gewalt. Zwei Begriffe sind hierbei relevant: der seinerzeit von Johan Galtung eingeführte Begriff der "strukturellen Gewalt" und der Begriff von Bourdieu der "symbolischen Gewalt". Zu diesen Gewaltformen gehören Euro- und Ethnozentrismus, Rassismus, Vorstellungen von „Normalität“, an denen Schülerinnen und Schüler gemessen werden, Ideologien. Es geht also stets darum, dass äußere Verhältnisse den Subjektcharakter des Einzelnen bedrohen oder sogar diesen Einzelnen unterwerfen, so dass Gefühle der Machtlosigkeit, des Ausgeliefertseins, der Sinnlosigkeit, der Verdinglichung entstehen. Allerdings genügen diese nicht, wie Bieri in seinen Einzelstudien zeigt. In jedem Fall muss sorgfältig befolgt 56 werden, was Bayertz (a.a.O., 826) fordert: „Grundsätzlich ist daran festzuhalten, dass begründet werden muss, was Menschenwürde ist und warum im gegebenen Fall ein Verstoß dagegen vorliegt.“ Auch und gerade im Umgang mit den Künsten ist dabei Sorgsamkeit angesagt, dass die von Bourdieu (1987) detailliert erforschten Distinktionsmechanismen, die die Künste bewirken, eben auch Mechanismen der Wertung, des Ausschlusses von Teilhabe und der Diskriminierung sind. Widerstandsfähigkeit als notwendiger Teil von Bildung Wird Bildung als Lebenskompetenz verstanden, dann erfasst dies insbesondere die Disposition, sich (für sich und andere) für menschenwürdige Verhältnisse einzusetzen. Dazu gehören die Fähigkeiten, wie sie Bieri (2013) beschreibt: Steigerung der Achtsamkeit, Offenheit für Fragen und für die Suche nach Antworten, eine wache, kenntnisreiche und kritische Aneignung von Kultur. „Kritisch“ meint hierbei auch, wohlmeinende Angebote auch ablehnen zu können. Empowerment gegen Entmachtung, Selbstbestimmung gegen Unterdrückung, Selbstwirksamkeit gegen behauptete und organisierte Einflusslosigkeit gehören dann zu der Stärkung des Subjektes mit seinem Anspruch auf autonome Lebensgestaltung. In dieser Hinsicht ist eine Pädagogik der (Stärkung der) Würde eine „Befreiungswissenschaft“ (so Bernhard 1996 im Anschluss an Heydorn), die die emanzipativen Potenzen von Erziehungs- und Bildungsvorgängen ermittelt. Vor diesem Hintergrund erhalten die üblichen Ziele der Pädagogik und speziell der Kulturpädagogik eine erneute Begründung (Fuchs 2008): Es geht um Selbstwirksamkeit (zu spüren, dass man etwas lernen kann und dass man etwas beherrscht), um Anerkennung und Wertschätzung (dass die eigene Leistung im sozialen Kontext gewürdigt wird), um Möglichkeitsdenken (um so die scheinbare und oft behauptete Unveränderbarkeit der Realität zu durchbrechen und Fantasien freizusetzen). Es geht um Partizipation und das Einüben in Meinungsbildungsprozesse, es geht um Ichstärkung etc. Allerdings genügt es nicht, alle diese wichtigen Ziele, die offensichtlich zu einem Leben in Würde gehören, nur erneut plausibel zu machen: Es geht auch darum zu belegen, dass und wie eine ästhetisch-künstlerische Praxis diese Ziele realisieren kann. Bislang wird die Debatte noch zu stark von bloßen Legitimationsdiskursen geprägt, in denen mehr behauptet als belegt wird. Es muss dabei gerade bei solchen Nachweisen darauf geachtet werden, dass nicht wieder die Subjekte als bloße Objekte einer Forschungsmethodologie betrachtet werden. Deshalb basiert etwa der Kompetenznachweis Kultur der BKJ auf dem dialogischen Verfahren, bei dem beide Lernenden (Projektleiter und Jugendliche) gemeinsam Lernfortschritte ermitteln: Subjekte müssen auch Subjekte ihres Lernens und dessen Bewertung sein. Literatur Bayertz, K.: Menschenwürde. In: Sandkühler, H.-J. (Hg.): Enzyklopädie Philosophie. Hamburg 1999 Benner, D.: Allgemeine Pädagogik. Weinheim 1987 57 Bernhard, A.: Der Bildungsprozess in einer Epoche der Ambivalenz. Frankfurt/M. 1996 Bieri, P.: Eine Art zu leben. München 2013 Bieri, P.: Wie wollen wir leben? München 2014 Bockhorst, H. (Hg.): Kunststück Freiheit. München 2011 Bourdieu, P.: Der feine Unterschied. Frankfurt/M. 1987 Fuchs, M.: Persönlichkeit und Subjektivität. Opladen 2001 Fuchs, M.: Kulturelle Bildung. München 2008 Fuchs, M.: Subjektivität heute. München 2014 Gerhardt, V.: Selbstbestimmung. Leipzig 1999 Gerhardt, V.: Partizipation. München 2006 Heitmeyer, W./Schröttle, M. (Hg.): Gewalt. Bonn 2006 Kant, I.: Schriften zur Anthropologie und Pädagogik. Frankfurt/M. 1982 Schmidt, R./Woltersdorff, V.(Hg.): Symbolische Gewalt. Konstanz 2008 Wulf, Chr./Zirfas, J. (Hg.): Handbuch Pädagogische Anthropologie. Wiesbaden 2014 58 6. Schlussbemerkungen Sowohl auf der Ebene der Realität und in der Praxis als auch auf der Ebene der theoretischen Reflexion lässt sich der enge Zusammenhang von Pädagogik, Politik, den Künsten und der Ästhetik nachweisen. Eine Theorie, die sowohl die personenbezogene Sicht der Bildung als auch die gesellschaftsbezogene Sicht der politischen Gestaltung miteinander verbindet, ist der Befähigungsansatz (capability approach) von Amartya Sen und Martha Nussbaum: „Die „Befähigungsperspektive“, die seit einiger Zeit genauer untersucht wird, passt genau zu dem Verständnis von Gerechtigkeit, das sich an der Lebensführung und den Freiheiten orientiert, die für Personen tatsächlich erreichbar sind.“ (Sen 2010, 11) Literatur Sen, Amartya: Die Idee der Gerechtigkeit. München: Beck 2010