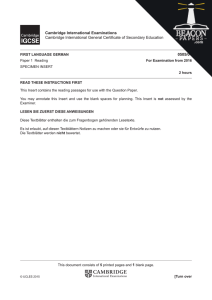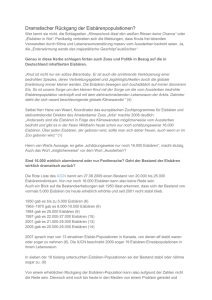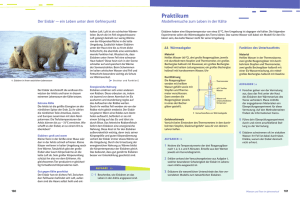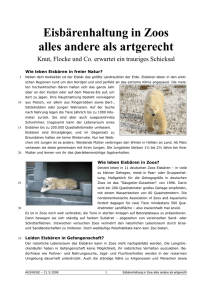Wimmer_Churchill
Werbung
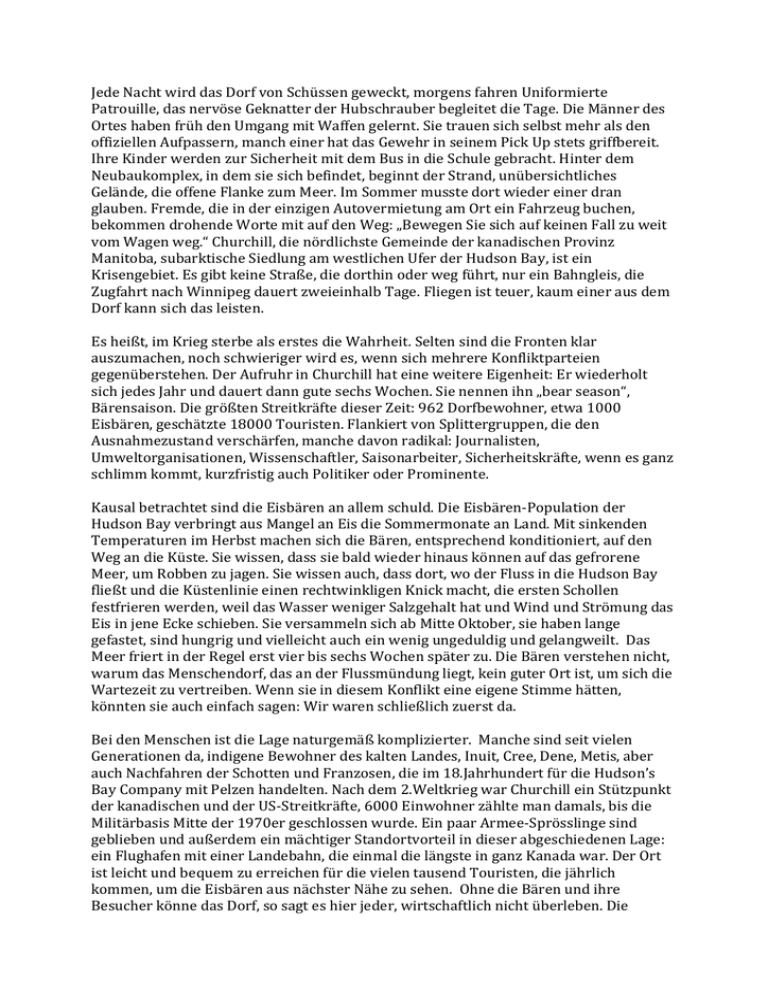
Jede Nacht wird das Dorf von Schüssen geweckt, morgens fahren Uniformierte Patrouille, das nervöse Geknatter der Hubschrauber begleitet die Tage. Die Männer des Ortes haben früh den Umgang mit Waffen gelernt. Sie trauen sich selbst mehr als den offiziellen Aufpassern, manch einer hat das Gewehr in seinem Pick Up stets griffbereit. Ihre Kinder werden zur Sicherheit mit dem Bus in die Schule gebracht. Hinter dem Neubaukomplex, in dem sie sich befindet, beginnt der Strand, unübersichtliches Gelände, die offene Flanke zum Meer. Im Sommer musste dort wieder einer dran glauben. Fremde, die in der einzigen Autovermietung am Ort ein Fahrzeug buchen, bekommen drohende Worte mit auf den Weg: „Bewegen Sie sich auf keinen Fall zu weit vom Wagen weg.“ Churchill, die nördlichste Gemeinde der kanadischen Provinz Manitoba, subarktische Siedlung am westlichen Ufer der Hudson Bay, ist ein Krisengebiet. Es gibt keine Straße, die dorthin oder weg führt, nur ein Bahngleis, die Zugfahrt nach Winnipeg dauert zweieinhalb Tage. Fliegen ist teuer, kaum einer aus dem Dorf kann sich das leisten. Es heißt, im Krieg sterbe als erstes die Wahrheit. Selten sind die Fronten klar auszumachen, noch schwieriger wird es, wenn sich mehrere Konfliktparteien gegenüberstehen. Der Aufruhr in Churchill hat eine weitere Eigenheit: Er wiederholt sich jedes Jahr und dauert dann gute sechs Wochen. Sie nennen ihn „bear season“, Bärensaison. Die größten Streitkräfte dieser Zeit: 962 Dorfbewohner, etwa 1000 Eisbären, geschätzte 18000 Touristen. Flankiert von Splittergruppen, die den Ausnahmezustand verschärfen, manche davon radikal: Journalisten, Umweltorganisationen, Wissenschaftler, Saisonarbeiter, Sicherheitskräfte, wenn es ganz schlimm kommt, kurzfristig auch Politiker oder Prominente. Kausal betrachtet sind die Eisbären an allem schuld. Die Eisbären-Population der Hudson Bay verbringt aus Mangel an Eis die Sommermonate an Land. Mit sinkenden Temperaturen im Herbst machen sich die Bären, entsprechend konditioniert, auf den Weg an die Küste. Sie wissen, dass sie bald wieder hinaus können auf das gefrorene Meer, um Robben zu jagen. Sie wissen auch, dass dort, wo der Fluss in die Hudson Bay fließt und die Küstenlinie einen rechtwinkligen Knick macht, die ersten Schollen festfrieren werden, weil das Wasser weniger Salzgehalt hat und Wind und Strömung das Eis in jene Ecke schieben. Sie versammeln sich ab Mitte Oktober, sie haben lange gefastet, sind hungrig und vielleicht auch ein wenig ungeduldig und gelangweilt. Das Meer friert in der Regel erst vier bis sechs Wochen später zu. Die Bären verstehen nicht, warum das Menschendorf, das an der Flussmündung liegt, kein guter Ort ist, um sich die Wartezeit zu vertreiben. Wenn sie in diesem Konflikt eine eigene Stimme hätten, könnten sie auch einfach sagen: Wir waren schließlich zuerst da. Bei den Menschen ist die Lage naturgemäß komplizierter. Manche sind seit vielen Generationen da, indigene Bewohner des kalten Landes, Inuit, Cree, Dene, Metis, aber auch Nachfahren der Schotten und Franzosen, die im 18.Jahrhundert für die Hudson’s Bay Company mit Pelzen handelten. Nach dem 2.Weltkrieg war Churchill ein Stützpunkt der kanadischen und der US-Streitkräfte, 6000 Einwohner zählte man damals, bis die Militärbasis Mitte der 1970er geschlossen wurde. Ein paar Armee-Sprösslinge sind geblieben und außerdem ein mächtiger Standortvorteil in dieser abgeschiedenen Lage: ein Flughafen mit einer Landebahn, die einmal die längste in ganz Kanada war. Der Ort ist leicht und bequem zu erreichen für die vielen tausend Touristen, die jährlich kommen, um die Eisbären aus nächster Nähe zu sehen. Ohne die Bären und ihre Besucher könne das Dorf, so sagt es hier jeder, wirtschaftlich nicht überleben. Die Ausgangslage ist also einigermaßen absurd: Man schützt sich und die Touristen vor den Bären, die man schützen muss, um die eigene Existenz zu sichern. Und dann kommen auch noch jedes Jahr die Wissenschaftler und malen das Schreckgespenst des Klimawandels an die Wand, sie sagen: In vierzig Jahren gebe es das alles sowieso nicht mehr – Eis in der Bay, Bären an Land, ausgebuchte Hotels wenigstens sechs Wochen im Jahr. Die Menschen sind sich nur in zwei Dingen wirklich einig: Sie wissen, dass man den Eisbären nicht zu nahe kommen sollte, und unbewaffnet gegen die Tiere im Ernstfall keine Chance hat. Und alle sagen: sie wollen nur das Beste für den Bär. Was wollte man auch anderes äußern, wenn man den weißen Räuber da draußen in der Tundra sieht, wo er gemächlich durch die Landschaft trottet und das perfekte Bild abgibt. Um das zu sehen, hat vor 25 Jahren ein Mann aus dem Dorf namens Lance Smith, eine Art Supergeländebus aus den alten Löschfahrzeugen der Air Force gebastelt, mit dem man in Matsch und Schnee fernab der einzigen Straße den Eisbären nahe kommen kann. Smith hat seine Fahrzeuge und die Idee gewinnbringend verkauft, er lebt heute im warmen Florida und baut Boote. Sein „Tundra Buggy“ aber ist das entscheidende Instrument in der touristischen Verwertbarkeit der Eisbären. Gute 30 Personen haben darin Platz, die Busse sind geheizt, es gibt eine Toilette und mittags warme Suppe. Tageweise werden die Gäste durch die unzugängliche Wildnis kutschiert, die gute 30 Kilometer östlich von Churchill beginnt, wo die einzige Straße endet. Die Klientel: gut situierte Menschen fortgeschrittenen Alters aus der ganzen Welt. Eine 6-tägige Eisbärenreise nach Churchill ist unter umgerechnet 3000 Euro pro Person nicht zu haben, nur der Flug von Winnipeg ist bei der Anreise inklusive. Es ist ein Einmal-imLeben-Trip für Leute, die schon vieles gesehen haben. In den Souvenir-Läden von Chruchill begrüßen sich Touristen überrascht den Worten: „Sind wir uns nicht letztes Jahr auf Safari in Botswana begegnet?“ Kevin Burke, ein kräftiger Mann mit wachen Augen und schnellem Humor, fährt seit 26 Jahren Tundra Buggy. Er sagt, er sei stolz darauf, an so einem besonderen Ort zu leben: „Ich gebe gerne mit meinem Hinterhof an.“ Er meint damit das meilenweite Nichts mit Nadelbäumen, in dem er seit seiner Kindheit jagen geht. Chauffiert er Touristen, freut er sich an der Begeisterung, mit der die Leute den Eisbären begegnen, wenn diese so nahe an den Bus kommen, dass man sie berühren könnte. Wenn die Bärensaison vorbei ist, trainiert er die Mitarbeiter des nahen Nationalparks am Gewehr und nimmt an längeren Militärübungen im Freien teil, bei minus 30 bis minus 40 Grad. Kevin Burke kann einiges aushalten, man merkt es an der geduldigen Art, mit der er seine Passagiere auf die Fahrt vorbereitet: „Immer gut festhalten. Der Türknauf der Toilette dreht sich nach rechts. Der Lichtschalter ist links. Die Fenster im Bus lassen sich nach oben schieben. Bei der Fahrt bitte sitzen bleiben. Die Bären nicht füttern. Die Hände im Bus behalten.“ Die Gäste, die er heute kutschiert, sind für eine Tagestour eingeflogen, sie kommen direkt vom Flughafen, abends geht es wieder zurück nach Winnipeg. Der Dame in der vordersten Sitzreihe, die keine Socken in ihren dünnen Turnschuhen trägt, schiebt er vorsorglich eine Styropor-Platte unter die Füße. Draußen hat es minus 17 Grad, Burke sagt trocken: „Tut mir leid, dass wir keine bessere Fußbodenheizung haben.“ Als er viele Stunden später glückliche Menschen mit reicher Fotobeute im schwindenden Licht zum Ausgangspunkt zurückfährt, quert wie ein letztes Geschenk eine Bärin mit zwei Jungen die zart rosa getönte Schneelandschaft als schwarze Silhouette. Ein Passagier fragt: „Sind sie immer noch weiß?“ Ein anderer antwortet: „Klar, es sind doch Eisbären.“ Nichts davon ist offenbar als Scherz gemeint. Burke hört so was täglich, er verzieht keine Miene. Fahren die Menschen im Buggy zu den Bären, ist das ein kontrollierbares Vergnügen. So einseitig sollen die Begegnungen bleiben, deswegen hat die Provinzverwaltung das „Polar Bear Alert Program“, ausgearbeitet, Schutzverordnungen, von denen böse Zungen behaupten, sie seien vor allem erfunden worden, damit keinem dummen Touristen was passiert. Bob Windsor sieht an diesem Novembermorgen aus wie ein Mann, der mit sich und der Welt zufrieden ist. Die Temperaturen sind gesunken, zum ersten Mal in diesem Jahr hat es in Churchill in der Nacht größere Mengen geschneit. Jetzt treibt der eiskalte Wind das feine Pulver waagrecht durch die Straßen, vielleicht gibt es bald Eis auf der Bay und das Ende der angespannten Lage ist nur noch eine Frage der Zeit. Die Uhr zeigt keine zehn, und Windsor hat heute schon mehrfach seine Pflicht erfüllt, dort draußen, wo er für die Sicherheit aller zuständig ist, der Menschen und der Bären. Drei Eisbären hat er mit seinen Beamten an jenen Ort gebracht, der den Richtlinien zufolge „polar bear holding facility“ heißt. Selbst Bob Windsor sagt, wenn er höchstoffiziell in seiner Amtsstube Auskunft gibt, „bear jail“, Bärenknast, dazu. Er hat seine Fellmütze an den Haken gehängt und den Daunenparka abgestreift, sein Büro und seine Erscheinung verschwimmen zu einer bizarren farblichen Einheit. Alles ist natogrün, Wände wie Kleidung, nur das runde Gesicht und seine Halbglatze leuchten freudig erregt und von der plötzlichen Wärme befeuert in Rot. Auf dem Ärmel seines Hemds prangt ein Aufnäher mit dem Wappen der Provinz Manitoba und der Aufschrift: „Natural Resource Officer“. Bob Windsor ist zusammen mit fünf Kollegen, die seinem Kommando unterstehen, die Exekutive einer Verordnung, die weltweit einzigartig ist. Eisbären, die die Dorfgrenze überschreiten, verscheucht die Wildhüter-Brigade mit Schreckfeuer, Knallkörpern, Gummigeschossen oder tief fliegenden Hubschraubern. Jedes Kind kennt in Churchill die rund um die Uhr besetzte Notrufnummer der „Bärenpolizei“: 675-bear. Zeigt sich ein Bär unbeeindruckt oder aggressiv, wird er mit einem lähmenden Drogenpfeil erledigt und in einem Netz mit dem Hubschrauber in das Bärengefängnis gebracht. Dort bekommt er nur Wasser und darf erst nach etwa dreißig Tagen wieder raus. Trägt die Hudson Bay dann immer noch kein Eis, oder droht dem Gefängnis mit seinen 28 Käfigen Überfüllung, fliegt man die Tiere 60 bis 70 Kilometer gen Norden und hofft, dass sie nicht zurückkehren. Bevor das „Polar Bear Alert Program“ in den frühen 1980ern startete, wurde jeder Problembär sofort erschossen. 1983 hat zum letzten Mal ein Eisbär in Churchill einen Menschen getötet. In einem abgebrannten Hotel wollten beide in der selben Nacht die Kühlschränke plündern. Falsche Zeit, falscher Ort sagen jene im Dorf, die die wilden Tage noch erlebt haben. Bob Windsor musste 2011 drei Eisbären niederstrecken. Einer habe am Strand hinter der Schule einem unvorsichtigen Fotografen den Rückweg zur Straße abgeschnitten und beim Versuch ihn zu vertreiben, das Auto der Wildhüter attackiert. Die Dellen sehe man deutlich in der Motorhaube seines schweren Jeeps. Einen zweiten hätten sie bei einem Einsatz versehentlich angefahren, er war nicht mehr zu retten. Der dritte hatte eine kriminelle Vorgeschichte, er war schon mehrfach in Häuser am Ortsrand eingebrochen. Sie hätten ihn auf frischer Tat ertappt, und leider kein Lähmungsmittel dabei gehabt. Der Officer seufzt, er sagt, es war eine schwere Entscheidung. Bob Windsor arbeitet seit 21 Jahren für die Behörde, der in Manitoba die wilde Natur des nördlichen Kanadas untersteht. Die Zeugnisse seines Berufslebens hängen als Fotocollage an der Wand. Alle Bilder zeigen ihn in stolzer Pose mit toten oder betäubten Tieren. Bevor er im Herbst vor zwei Jahren nach Churchill versetzt wurde, waren ihm Eisbären nur im Zoo begegnet. Fragen nach seinem Verhältnis zu den Einheimischen, Menschen wie Bären, bekommen eine knappe Antwort: „Ich folge meinen Anweisungen. Ich tue meine Pflicht.“ Brian Ladoon ist kein Diplomat, wenn er für sich spricht, aber das ist ihm egal, es geht schließlich um Tod oder Leben. „Zwei Arten, kurz vor dem Aussterben, und was machen diese verblödeten Volltrottel? Sie fangen meine Bären.“ Jeder im Dorf kennt Brian, den wettergegerbten, charismatischen Kerl mit dem Lederstirnband um die weißen, schulterlangen Haare. Brian, der vor fast 60 Jahren in Churchill geboren ist, und sich als Teenager auf ein Schiff geschlichen hat, der über die Weltmeere gefahren ist, nach Südamerika, Afrika, Asien, der Wale gejagt hat und Frauen verführt, der zarte Ölbilder malen kann und seinem Ort, der fast nur aus flachen Holzhäuschen besteht, ein steinernes Burghotel mit Meerblick bauen wollte. Das Fundament und ein paar Mauern stehen schon, mächtig auf einer Anhöhe, ein wenig außerhalb, nur Geld ist seit zehn Jahren keines mehr dafür da. Eine Finanzierung ist schief gelaufen, es gab keine Verträge, einer wie Brian macht keine Verträge, er besitzt ja noch nicht mal ein Telefon. Und das Geld, das er hat, braucht er für die Hunde. Brian Ladoon züchtet seit über dreißig Jahren Kanadische Eskimo Hunde, die älteste Hunderasse Nordamerikas, es gibt sie geschätzt seit 2000 v. Chr.. Sie waren die Schlittenhunde der Inuit, bis die Motorschlitten ihre Arbeit übernahmen. In den 1970ern gab es weltweit keine 100 Tiere mehr. Brian Ladoon hält den größten Genpool der seltenen Art, 150 Hunde auf einem Stück Land an der Küste, gute zwanzig Kilometer außerhalb des Dorfs. Es ist auf den ersten Blick ein grimmiges Reich, die Hunde an langen Ketten auf verschneitem Schotter, im Meer verrottet ein gestrandeter Eisenkahn. In Sichtweite zwei große Eisbären, die sich langsam nähern. Brian Ladoon füttert die Hunde zweimal am Tag, mit dem Pick Up dreht er langsam seine Runden, Jeremy, sein jugendlicher Helfer sitzt bewaffnet auf der Ladefläche und wirft den Hunden gefrorene Fleischklötze zu. Es ist eine angespannte, sehr konzentrierte Aktion, Ladoon kennt jeden Hund, er beobachtet die Tiere und ihr Verhalten mit scharfem Blick und muss gleichzeitig die Eisbären im Auge behalten. Seine Eisbären. Er kenne sie wie seine Hunde, sagt Ladoon, dieselben acht bis zehn großen männlichen Eisbären kehrten jedes Jahr auf sein Gelände zurück. Die Bären wiederum sind mit den Hunden vertraut, es gibt zahlreiche Fotos und Filme, die sie gemeinsam zeigen, im fröhlichen Spiel. Ausgehungerte Eisbären, die sich fast zärtlich mit Schlittenhunden balgen, in denen sie offenbar keine Beute sehen. Brian Ladoon sagt, sie lebten hier gut zusammen, seine Bären beschützten die Hunde vor den anderen Bären, den jungen, aggressiven, die sie hier „bad bears“ nennen. Einen Eisbären, der zwischenzeitlich seinem Auto zu nahe kommt, verscheucht er mit einem laut gebrüllten: „No!“ Der Bär zieht sich zurück, legt sich ein paar Meter entfernt zu Boden, Ladoon ruft ihm anerkennend zu: „Good boy.“ Es scheint, als würde der Bär ihm wirklich gehorchen. Ladoon sagt: „Keiner verbringt so viel Zeit mit den Tieren wie ich, ich bin jeden Tag viele Stunden hier draußen, das ganze Jahr, nicht nur die schicken sechs Wochen im Herbst.“ Die Hunderasse vor dem Aussterben gerettet zu haben, das sei sein Lebenswerk. Er finanziert es damit, dass er gegen Gebühr Besuchern die Zufahrt zu seinem Gelände gewährt. Es kommen Familien aus dem Dorf genauso wie Reisegruppen mit Bussen, am meisten Profit macht er, wenn er Fotografen und Kamerateams betreut. Sie bekommen bei ihm die besten Bilder. Jeder will die Eisbären, die mit Hunden spielen, dahinter das dunkelblaue Meer. Das Gleichgewicht in seinem Reich ist allerdings gestört, vor einigen Tagen hat die Bärenpolizei eine Razzia auf Ladoons Gelände veranstaltet, sie haben drei Eisbären ins Gefängnis abtransportiert. Der offizielle Grund: Ladoon zähme die Bären und füttere sie, er gefährde damit die öffentliche Sicherheit. Ladoon sagt, es sei eine groß angelegte PRAktion der Officer gewesen, veranstaltet für ein französisches Fernsehteam, das eine Dokumentation über die Arbeit der Bärenpolizei drehe. Sein Gelände und das, was er dort tut, steht seither unter Beobachtung. Und der tägliche Besuch der Behörde gleicht einem Einsatz, wie man ihn aus amerikanischen Krimiserien kennt. Drei Autos kreisen Ladoon in seinem Pick Up auf dem Gelände ein. Beamte mit verspiegelten Brillen klären ihn über seine Rechte und Pflichten auf, durchsuchen das Auto seines Freundes Wayne nach Waffen. Zum Abschied sagen sie: „Wir wollen nur deine Hunde beschützen.“ Wer den Gesprächen bei Gypsy’s lauscht, lernt schnell: Es geht um sehr viel mehr. Gypsy’s Restaurant & Bakery ist die lokale Nachrichtenbörse von Churchill, während der Bärensaison ist ein Tisch dort durchgängig für Einheimische reserviert. Sie nennen ihn „BS-table“, BS wie: „Bullshit“. Wer immer dort sitzt, Rhoda, die Busfahrerin mit der polternden Lache, Brian Ladoon beim täglichen Frühstück, Lea, die zarte 17-jährige, die die Sommer gerne alleine in der Jagdhütte ihres Vaters verbringt, oder Wayne, der wütende Fotograf, der ständig mit seinem Labtop irgendeine Rechtslage checkt, alle begegnen sie den Auswüchsen der Bärensaison und dem Auftreten der Bärenpolizei mit großem Misstrauen und kräftigen Sprüchen. Das große Touristengeschäft mit den Buggys macht ein Reiseveranstalter aus dem Süden, kein Ortsansässiger. Ihm könnte es missfallen, dass Einheimische günstigere Möglichkeiten anbieten, Bären zu sehen. Kein normaler Bürger aus Churchill könne sich eine Fahrt auf dem Buggy leisten. Warum, so fragen sie sich außerdem, werde die Interaktion der Eisbären mit den Touristen auf den Buggies von den Behörden offenbar weniger kritisch gesehen als die auf Ladoons Gelände. Die Bärenpolizisten in ihren Augen: lauter kümmerliche Gestalten, die keine Ahnung hätten, aber den großen Max markierten. Und auf jeden Eisbären in Panik mit fünfzig Krachern ballerten, wo ein bis zwei oft schon reichen würden. Kein Wunder, dass die Tiere dann durchdrehten und ins Gefängnis müssten. Es ist ein altes Gefecht des kleinen Mannes gegen die Allianz der Macht. Es ist ebenso ein Kampf der Naturburschen gegen die Fremdbestimmung unwissender Schreibtischtäter. Der Tisch, an dem sie all das täglich debattieren ist eine seltene Enklave in den Wochen der Bärensaison. Wer im Herbst nach Churchill reist, sieht Souvenirläden an Hotels gereiht, sie heißen „Bear Country Inn“ oder „Lazy Bear Lodge“, jedes Restaurant ist ausgebucht. Wenn die Touristen nicht gerade in Bussen zu den Bären fahren, wandern sie in hochfunktioneller Outdoor-Kleidung wenige Meter zum Postamt, um dort den begehrten Eisbärenstempel in ihren Pass zu bekommen. Es gibt bis spät in die Nacht Live-Musik in urigen Pubs und großen Trinkhallen, die Einheimischen feiern den Ausnahmezustand dort ekstatischer als die Touristen, sie wissen, dass die Party ab Ende November für lange Zeit vorüber ist. Dann schließen alle Lokalitäten bis auf das Hotel des Bürgermeisters. Selbst Gypsy’s macht erstmal für drei Monate zu. An all den ausgelassenen Abenden, an denen sich die jungen, schönen Saisonkräfte der Hotels und Restaurants gegenseitig das Mikrofon aus der Hand reißen, um schmutzige Witze zu erzählen oder Neil-Young-Hits zu seufzen und überdrehte Touristen sich gegenseitig die immergleichen schönsten Fotos des Tages zeigen, könnte man denken, Churchill sei einfach ein Urlaubsort in der Hochsaison. Man könnte vergessen, um was es wirklich geht. Um ein wildes Tier und die Menschen – und um beider Lebensraum. Droht das Gefängnis zu voll zu werden, fliegt man die Bären aus. Ein bevorstehender „bear lift“ ist eine willkommene Bereicherung im Programm der Besucher, alle Reiseveranstalter und anwesenden Medienvertreter werden darüber informiert. Eisbärenbilder verkaufen sich immer. Vielleicht sogar immer besser, weil man mit ihnen noch ganz andere Geschichten erzählen kann als die eines Dorfes am Rande der Welt. Hinter dem Absperrband um das Bärengefängnis warten Kamerateams von der BBC und vom südkoreanischen Fernsehen zusammen mit den Passagieren von mehreren Reisebussen – die vorderen Stehplätze sind schnell besetzt. Als sich das Tor der Containerhalle öffnet, geht ein hörbares Seufzen durch die Menge, einer sagt verächtlich: „Wie bei einer Hinrichtung im Mittelalter.“ Der Eisbär liegt bäuchlings bewegungslos auf einem Wagen, die mächtigen Pranken baumeln schlapp herunter. Von mehreren Männern wird er in ein Netz auf dem Boden gehievt, mehrere Hubschrauber stehen bereit. Aus einigen steigen Menschen, die auffällig anders gekleidet sind, als die natogrünen Officer. Damen mit blütenweißen Daunenmänteln etwa, die den gelähmten Eisbär aus nächster Nähe von allen Seiten betrachten. Dann geht alles sehr schnell, ein Hubschrauber hebt ab, das Netz zieht sich zu, der Bär baumelt hoch über den Köpfen der Menge und ist bald nicht mehr zu sehen. Die anderen Hubschrauber folgen ihm. In einem Haus an der Hauptstraße in Churchill sitzt ein bärtiger, etwas mitgenommen aussehender Mann auf dem Boden eines spärlich möblierten Zimmers und sagt: „Es geht um das große Ganze. Wir töten Eisbären, während wir zuhause gemütlich im Lehnstuhl sitzen.“ Er heißt Robert Buchanan und ist Vorsitzender von „Polar Bears International“ (PBI), einer Organisation, die sich für das Wohl der Eisbären einsetzt. Seit vielen Jahren ist PBI in Churchill vor Ort, ihre Operationsbasis ist ein fest stationierter Tundra Buggy, draußen im Eisbärenland. Sie veranstalten dort Fortbildungen mit Zoodirektoren, Lehrern, Studenten, mit Menschen, die ihre Botschaft weitertragen können: Das Eis schmilzt, die Bären verhungern, wir müssen den Klimawandel stoppen. Das, so denkt PBI, lässt sich besser vermitteln, wenn die Menschen das Tier selber sehen können. Oder, wie Buchanan es sagt: „Wenn ein Eisbär dir in die Augen schaut, kann er dich tief in deinem Herzen und deiner Seele berühren und dein Leben für immer verändern, wie kein anderes Tier auf dieser Welt.“ PBI organisiert für zahlungskräftige Anhänger die Hubschrauberflüge, die die „bear lifts“ begleiten dürfen, sie arbeiten eng mit den Wildhütern und deren Behörde zusammen. Es ist zu warm in Churchill, es ist Mitte November, und auf der Bay ist kein bisschen Eis zu sehen. Die Eisdecke bricht früher auf und friert später zu, die Bären verbringen mehr Zeit an Land, müssen länger hungern, ihre Zahl hat abgenommen, sie sind dünner. Das haben Wissenschaftler über die Jahre festgestellt. An keinem Ort der Welt lässt sich der Klimawandel besser und publikumsträchtiger darstellen als in Churchill. Coca Cola hat 2011 zwei Millionen amerikanische Dollar an den WWF gespendet zur Rettung des Eisbären, er ziert die Sonderedition der Coladose zum Weihnachtsgeschäft. Die Oberen des Konzerns und der Organisation sind mit zwei Privatjets eingeflogen, um die Eisbären vor Ort zu besuchen. Mit an Bord: ein Moderator der amerikanischen Fernsehshow American Idol zur Aufwertung der PR-Bilder, die von Churchill aus über den Kontinent gehen werden. Paul Ratson sagt: „Du darfst einem Eisbären nie in die Augen schauen. Das könnte er als Provokation begreifen.“ Ratson führt Wanderungen durch die Tundra, er ist schon vielen Eisbären begegnet, von Angesicht zu Angesicht. Früher hat er auch Forscher begleitet, Fotografen und Fernsehteams, er hat darüber den Glauben an die Bilder und die selbst ernannten Gerechten verloren. „Sie wollen Bären filmen, du führst sie zu einem prächtigen Exemplar, sie sagen: Der ist zu dick, wir brauchen einen, der verhungert aussieht.“ Polar Bear International hat unlängst Werbung für die eigene Sache gemacht, mit der Filmaufnahme eines sterbenden kleinen Eisbären, eine Art Snuff-Video zur Spendenbeschaffung. Paul Ratson will das nicht verstehen: „Wenn die Tiere wirklich verhungern, sollten sie vielleicht erstmal die Tiere retten und nicht gleich die ganze Welt.“ Ratson nennt die Leute von PBI „die Schlümpfe“, wegen der gesponserten blauen Daunenjacken, die diese alle tragen. „Keiner hier hat auch nur einen Hauch von Respekt für die.“ Auf seinen Touren erzählt er den Besuchern seine Sicht der Dinge: „Wir sollten die Bären Bären sein lassen. Wir fangen sie, weil sie uns im Weg sind, wir setzen sie unter Drogen, tätowieren sie, ziehen ihnen Zähne, malen sie an, verfolgen sie mit Hubschraubern, um zu beweisen, wie schlecht es ihnen geht. Ich glaube nicht, dass ihnen das gefällt.“ Es gibt Reiseveranstalter, mit denen Ratson nicht mehr arbeitet, weil sie ihn darum gebeten haben, den Touristen zu verschweigen, dass er Fleisch isst und wie fast jeder Einheimische aus Churchill leidenschaftlicher Jäger und Trapper ist. Ratson sagt: „Wir sind hier nicht in Scheiß Disney World.“ Er wohnt weit draußen, bei ihm laufen die Eisbären täglich über den Hof. Er fühle sich dort sicher, sagt er, er beobachte sie und lasse sie gewähren, so lange sie nicht „herumlungern“. Sein Haus ist von Elektrodrähten umwickelt, seine Eingangstür von einem massiven Eisendrahtvorbau geschützt. „Die Eisbären werden nicht aussterben,“ sagt Ratson. „Sie passen sich an, wie wir.“ In diesen Tagen sammeln sich die Eisbären verstärkt ganz in seiner Nähe, am früheren Müllplatz, dort wo man seit Jahrzehnten die Rückstände der Getreideverschiffung an Churchills Hafen vergräbt. Die Eisbären buddeln ganz tief im Erdreich und fressen das Getreide, sie machen das dieses Jahr zum ersten Mal. Das Getreide, so Ratson sei vergoren, die Bären würden quasi betrunken davon. Mindestens zehn Bären wühlen dort im Dreck, man kann mit dem Auto bis auf wenige Meter an sie heranfahren. Der Platz ist ein neuer günstiger Beobachtungsposten geworden für Dörfler und Touristen, seit Brian Ladoons Bären im Gefängnis sitzen. Ein Eisbär liegt in der Kuhle, die er gegraben hat, den Kopf matt auf die Erde gebettet, er ist vollkommen verdreckt, seine Augen halb geschlossen. Er bewegt sich im Scheinwerferlicht der Autos, die ihn umringen, keinen Millimeter. Der König der Arktis, ein trauriger Anblick. Es sieht so aus, als habe er keine Ahnung, was um ihn herum so alles passiert.