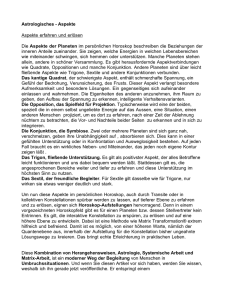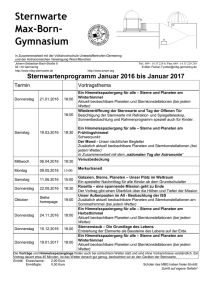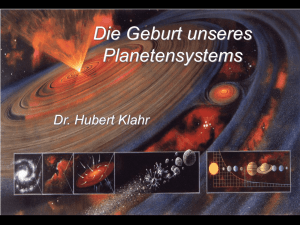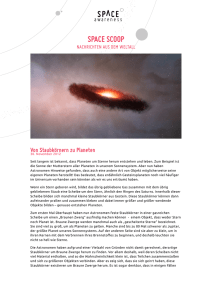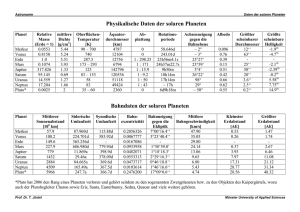Astrobiologie - Gibt es Leben im All?
Werbung
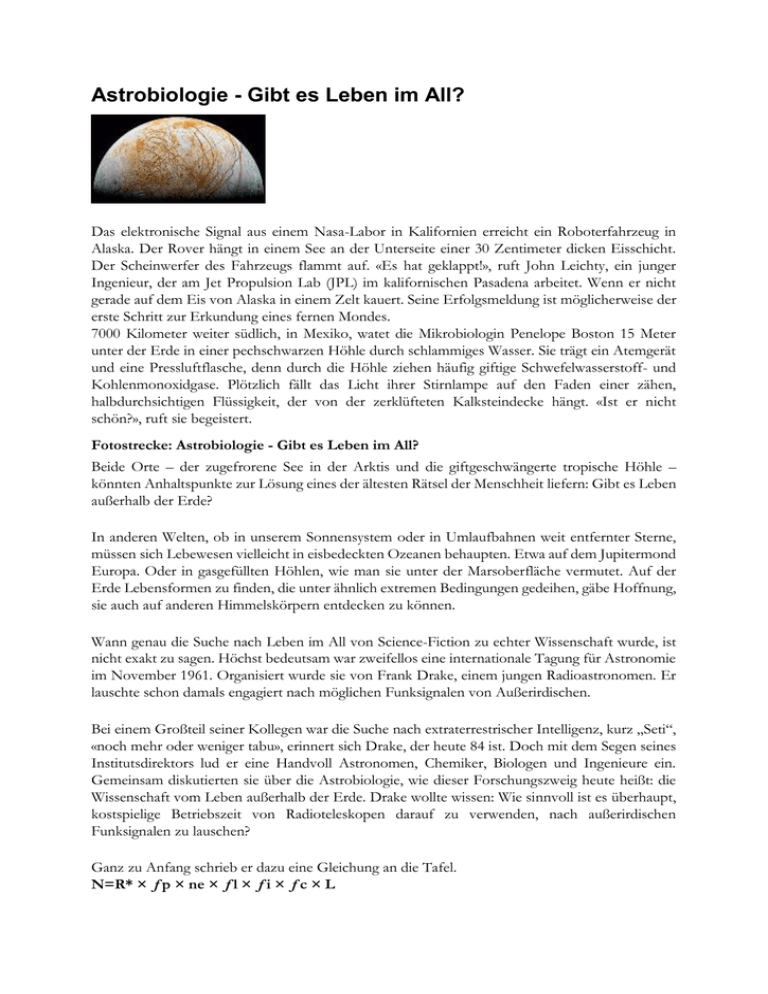
Astrobiologie - Gibt es Leben im All? Das elektronische Signal aus einem Nasa-Labor in Kalifornien erreicht ein Roboterfahrzeug in Alaska. Der Rover hängt in einem See an der Unterseite einer 30 Zentimeter dicken Eisschicht. Der Scheinwerfer des Fahrzeugs flammt auf. «Es hat geklappt!», ruft John Leichty, ein junger Ingenieur, der am Jet Propulsion Lab (JPL) im kalifornischen Pasadena arbeitet. Wenn er nicht gerade auf dem Eis von Alaska in einem Zelt kauert. Seine Erfolgsmeldung ist möglicherweise der erste Schritt zur Erkundung eines fernen Mondes. 7000 Kilometer weiter südlich, in Mexiko, watet die Mikrobiologin Penelope Boston 15 Meter unter der Erde in einer pechschwarzen Höhle durch schlammiges Wasser. Sie trägt ein Atemgerät und eine Pressluftflasche, denn durch die Höhle ziehen häufig giftige Schwefelwasserstoff- und Kohlenmonoxidgase. Plötzlich fällt das Licht ihrer Stirnlampe auf den Faden einer zähen, halbdurchsichtigen Flüssigkeit, der von der zerklüfteten Kalksteindecke hängt. «Ist er nicht schön?», ruft sie begeistert. Fotostrecke: Astrobiologie - Gibt es Leben im All? Beide Orte – der zugefrorene See in der Arktis und die giftgeschwängerte tropische Höhle – könnten Anhaltspunkte zur Lösung eines der ältesten Rätsel der Menschheit liefern: Gibt es Leben außerhalb der Erde? In anderen Welten, ob in unserem Sonnensystem oder in Umlaufbahnen weit entfernter Sterne, müssen sich Lebewesen vielleicht in eisbedeckten Ozeanen behaupten. Etwa auf dem Jupitermond Europa. Oder in gasgefüllten Höhlen, wie man sie unter der Marsoberfläche vermutet. Auf der Erde Lebensformen zu finden, die unter ähnlich extremen Bedingungen gedeihen, gäbe Hoffnung, sie auch auf anderen Himmelskörpern entdecken zu können. Wann genau die Suche nach Leben im All von Science-Fiction zu echter Wissenschaft wurde, ist nicht exakt zu sagen. Höchst bedeutsam war zweifellos eine internationale Tagung für Astronomie im November 1961. Organisiert wurde sie von Frank Drake, einem jungen Radioastronomen. Er lauschte schon damals engagiert nach möglichen Funksignalen von Außerirdischen. Bei einem Großteil seiner Kollegen war die Suche nach extraterrestrischer Intelligenz, kurz „Seti“, «noch mehr oder weniger tabu», erinnert sich Drake, der heute 84 ist. Doch mit dem Segen seines Institutsdirektors lud er eine Handvoll Astronomen, Chemiker, Biologen und Ingenieure ein. Gemeinsam diskutierten sie über die Astrobiologie, wie dieser Forschungszweig heute heißt: die Wissenschaft vom Leben außerhalb der Erde. Drake wollte wissen: Wie sinnvoll ist es überhaupt, kostspielige Betriebszeit von Radioteleskopen darauf zu verwenden, nach außerirdischen Funksignalen zu lauschen? Ganz zu Anfang schrieb er dazu eine Gleichung an die Tafel. N=R* × ƒp × ne × ƒl × ƒi × ƒc × L Sein Gekritzel wurde als „Drake-Formel“ weltberühmt. Die Lösung (N) besagt, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, mit außerirdischen Intelligenzen Kontakt aufnehmen zu können. Ausgangsfaktor ist die Häufigkeit, mit der sonnenähnliche Sterne in der Milchstraße entstehen (R*). Man multipliziert diese Zahl mit dem Anteil von Sternen, die ein Planetensystem besitzen (ƒp) und dieses Ergebnis mit der Anzahl der Planeten in einer lebensfreundlichen Zone (ne) – also mit der Zahl der Planeten, die ungefähr so groß sind wie die Erde und die ihren Stern in einer Entfernung umkreisen, die Leben möglich macht. Den neuen Wert multipliziert man mit dem Anteil der Planeten, auf denen wirklich Leben entsteht (ƒl) und den wiederum mit dem Anteil der Planeten, auf denen sich Intelligenz entwickelt (ƒi). Im vorletzten Schritt multipliziert man das Zwischenergebnis mit dem Anteil von Planeten, auf denen eine Technologie entstanden ist, die das Versenden von Funksignalen ermöglicht, die wir entdecken könnten (ƒc). Jetzt fehlt noch ein Faktor: die Lebensdauer einer solchen funkfähigen Zivilisation (L). Denn es gibt ja viele Gefahren, die das Leben auf einem Planeten bedrohen – angefangen bei katastrophalen Vulkanausbrüchen über Asteroideneinschläge bis hin zu einem Atomkrieg. Könnte ja sein, dass wir das Zeitfenster knapp verpasst haben, in dem außerirdische Intelligenzen Funksignale ins All sandten. Die Gleichung war völlig plausibel. Sie hatte nur einen Haken: Niemand wusste, wie groß die jeweiligen Zahlen in den einzelnen Teilen der Formel waren. Man kannte nur die allererste Variable: die Häufigkeit, mit der sich sonnenähnliche Sterne bilden. Alles Weitere war Spekulation. Nun waren die Experten der verschiedenen Fachgebiete gefragt, die Positionen der Drake-Gleichung mit begründbaren Zahlen auszufüllen – etwa über den Anteil sonnenähnlicher Sterne mit einem Planetensystem und den Anteil solcher Planeten, auf denen Leben entstanden sein könnte. Eine Forschergeneration lang konnten nicht einmal grobe Schätzwerte in die Gleichung eintragen werden. Der erste Planet, der außerhalb unseres Sonnensystems einen sonnenähnlichen Stern umkreist, wurde 1995 entdeckt: „51 Pegasi b“ ist rund 50 Lichtjahre von der Erde entfernt, eine riesige Gaskugel, halb so groß wie der Jupiter. Wegen seiner engen Umlaufbahn dauert sein „Jahr“ nur vier Tage, dort ist es über 1000 Grad heiß. An Leben unter solch höllischen Bedingungen glaubte niemand. Doch die Entdeckung dieses Planeten war der Durchbruch. Nachdem man kurz darauf einen zweiten und einen dritten extrasolaren Planeten nachgewiesen hatte, waren die Schleusen geöffnet. Heute kennen die Astronomen fast 2000 Exoplaneten. Die kleinsten sind kleiner als die Erde, die größten größer als der Jupiter. Für weitere Tausende gibt es Hinweise, sie müssen aber noch bestätigt werden. Keiner dieser Planeten ist genau wie die Erde, aber die Astronomen sind zuversichtlich, über kurz oder lang so einen zu finden. Nach neuesten Schätzungen könnte jeder fünfte sonnenähnliche Stern von Planeten umkreist werden, die lebensfreundliche Bedingungen aufweisen. Für die Astrobiologen ist das eine gute Nachricht. Hinzu kommt: In den vergangenen Jahren ist den Planetenjägern klar geworden, dass kein Anlass besteht, die Suche auf Sterne zu beschränken, die unserer Sonne ähneln. «Zu meiner Schulzeit haben wir gelernt, dass die Erde einen ganz durchschnittlichen Stern umkreist», sagt der Astronom David Charbonneau von der Harvard- Universität. «Das stimmt aber gar nicht.» Tatsächlich sind 80 Prozent der Sterne in der Milchstraße sogenannte M-Zwerge: kleine, kühle, schwach leuchtende, rötliche Himmelskörper. Umkreist ein erdähnlicher Planet einen M-Zwerg in der richtigen Entfernung – sie müsste kleiner sein als der Abstand zwischen Erde und Sonne, sonst wäre es zu kalt –, könnte Leben dort ebenso leicht entstehen wie auf einem erdähnlichen Planeten eines Sterns, der unserer Sonne gleicht. Ein Planet muss nicht einmal ähnlich groß wie die Erde sein, um Leben hervorbringen zu können. «Alles zwischen einer und fünf – vielleicht sogar zehn – Erdmassen kommt dafür infrage», sagt etwa der Harvard-Astronom Dimitar Sasselov. Kurz gesagt: Die Anzahl der Sterne mit möglicherweise lebensfreundlichen Planeten ist wohl viel größer, als Frank Drake 1961 eher vorsichtig geschätzt hatte. Und das ist noch nicht alles: Extremophile Lebewesen können in einem viel breiteren Spektrum von Temperaturen und chemischen Umweltbedingungen gedeihen, als die Forscher es sich bei Drakes Tagung vorgestellt hatten. Schon vor 50 Jahren entdeckten Meeresforscher, dar- unter der von National Geographic geförderte Robert Ballard, die „Schwarzen Raucher“. Das sind Schlote am Meeresboden, aus denen mineralienreiches heißes Wasser austritt: Lebensgrundlage für ein reichhaltiges Ökosystem aus Bakterien. Die Mikroben ernähren sich von Schwefelwasserstoff und anderen im Wasser gelösten Verbindungen und dienen ihrerseits größeren Tieren als Nahrung. Andere Organismen gedeihen in heißen Quellen, in eisigen Seen unter der antarktischen Eiskappe, in extrem säure-, basen- oder salzhaltigen Umgebungen, bei starker Radioaktivität oder in mikroskopischen Gesteinsrissen, mehr als tausend Meter unter der Erdoberfläche. «Bei uns auf der Erde sind das kleine ökologische Nischen», sagt Lisa Kaltenegger vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg, «auf einem anderen Planeten könnte das aber der Normalzustand sein.» Unverzichtbar für Leben, wie wir es kennen, ist nach Ansicht von Biologen nur eines: Wasser in flüssiger Form, das innerhalb eines Organismus Nährstoffe überall dorthin transportieren kann, wo sie gebraucht werden. Auf dem Mars floss früher Wasser. Das wissen wir seit 1971, als die Raumsonde „Mariner 9“ den Roten Planeten kartierte. Es könnte dort also Leben gegeben haben. Denkbar ist sogar, dass unter der Marsoberfläche, wo es vielleicht noch flüssiges Wasser oder Eis gibt, Lebensspuren zu finden sein werden. Risse in der eisbedeckten Oberfläche des Jupitermondes Europa sind ein Indiz, dass dort unter dem Eis ein Ozean aus flüssigem Wasser liegt. Weil Europa ungefähr 800 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt ist – mehr als dreimal so weit wie die Erde –, sollte das Wasser dort eigentlich dauerhaft gefroren sein. Aber der Mond verformt sich ständig durch das Ziehen und Drücken der vom Jupiter und seinen anderen Monden verursachten Gezeiten. Dabei entsteht Wärme, die das Wasser unter dem Eismantel flüssig hält. Theoretisch könnte es also dort Leben geben.