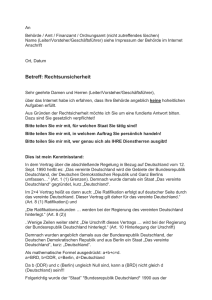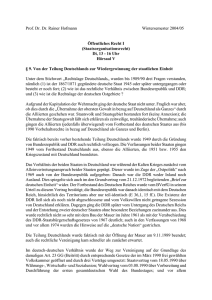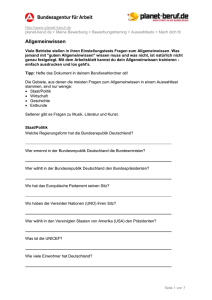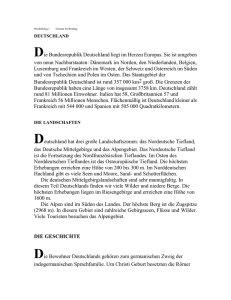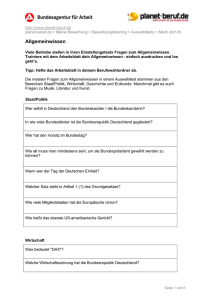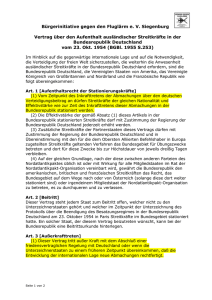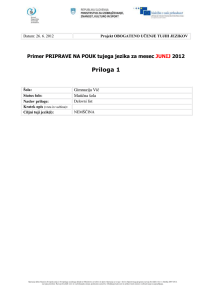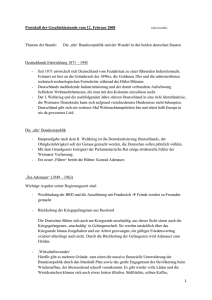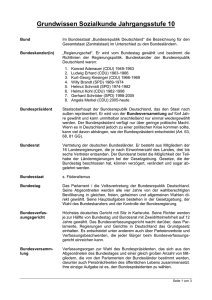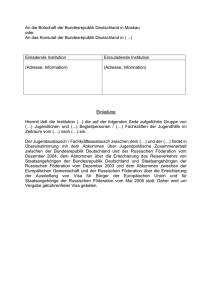27 Krisenmanagement – von der Handels
Werbung

1 27 Krisenmanagement – von der Handels- zur Währungsmacht Nach de Gaulles Rücktritt veränderte sich die französische Sicht zum britischen EG-Beitritt. Jetzt sah Frankreich darin ein Gegengewicht zu der wirtschaftlich starken und politisch immer selbstbewussteren Bundesrepublik Deutschland. Die französische Seite rechnete auch damit, dass Großbritannien seinen Bedarf an Agrarprodukten in Zukunft stärker in Frankreich decken würde und seine Sonderbeziehungen zum Commonwealth nach und nach aufgeben würde. 2 Die deutsche Politik, voran Kanzler Brandt, unterstützte den britischen Beitritt in die Gemeinschaft mit Nachdruck. Genau wie Paris auch, erwartete Bonn von London einen wirtschaftlichen Gewinn und politische Unterstützung, im deutschen Fall bei der Ostpolitik. Beide wurden von Großbritannien enttäuscht. Zwar legten die chronischen Wirtschaftsprobleme Großbritanniens den Beitritt nahe, die britische Distanz zum europäischen Kontinent und die Sonderbeziehungen zu den Vereinigten Staaten und zum Commonwealth standen aber einer positiven Rolle in Europa entgegen. 3 Die EG erreichte 1970 gemäß den Verträgen von Rom eine neue Phase. Nach der Übergangsperiode begann nun das endgültige Stadium der EG-Integration. Zu lösen war die definitive Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik sowie eine Erweiterung der Budgetkompetenz des Europäischen Parlaments. Für beide Fälle bekam die EG nun eigene Einnahmen. Zur Agrarfinanzierung sollten Einfuhrzölle für Agrarprodukte und alle Zolleinkünfte von Industrieimporten dienen. Auch die Gemeinsame Außenhandelspolitik trat nun in ein entscheidendes Stadium. Die Zahl der Assoziierungsabkommen nahm zu, die Beitrittsverhandlungen mit Großbritannien, Dänemark, Norwegen und Irland begannen. Im Werner-Plan, nach Pierre Werner, dem Finanzminister von Luxemburg, entwickelte die EG auch einen ersten Zeitplan für eine Währungsunion. Ein gemeinsamer Währungsraum sollte die EG vom störenden Einfluss des schwankenden Dollars lösen und den Binnenhandel erleichtern. 4 Die deutsche Seite bestand auf einem Junktim zwischen Wirtschafts- und Währungsunion. Das Problem mit dem Werner-Plan war, dass zwar alle seine Schutzfunktionen nach außen begrüßten, über die EG-interne Funktion aber Uneinigkeit herrschte. Die Bundesrepublik wollte die wirtschaftlich schwächeren EG-Partner nicht uneingeschränkt unterstützen, weil deren Geldpolitik nicht ihren Stabilitätskriterien entsprach. Die Monetaristen Frankreich und Belgien wollten zuerst eine Währungsunion und dann eine Harmonisierung der Wirtschaftspolitik. Die Bundesrepublik und die Niederlande, die „Ökonomisten“, wollten hingegen zuerst Stabilisierungsprogramme und die Koordinierung der nationalen Wirtschaftspolitiken. Zwischen der Bundesrepublik und Frankreich bestanden klare Interessenunterschiede. 5 Die Bundesrepublik wurde eine wirtschaftliche Großmacht. 1968 war sie zum größten Kapitalexportland der Welt geworden. In Washington wurde schon von einer deutsch-amerikanischen wirtschaftspolitischen Doppelhegemonie gesprochen. Aus deutscher Sicht bestand vor allem ein Interesse an wirtschaftlicher Konsolidierung und Geldwertstabilität im eigenen Land. Frankreich war hingegen wirtschaftlich zurückgefallen und wollte die deutsche Wirtschaftsmacht in der EG in seinem Sinne einbinden. 6 In der Bundesrepublik selbst herrschten Meinungsunterschiede zwischen den „Regionalisten“ und den liberalen „Wirtschaftsglobalisten“. Brandt war wie Adenauer eher regionalistisch eingestellt, sein Wirtschaftsminister, Karl Schiller, wie damals Ludwig Erhard auch, eher globalistisch. Schillers Kurs war auch der der Deutschen Bundesbank. Zwar kam der Werner-Plan sowieso nicht zum Zuge, aber die Debatte um ihn verdeutlicht die Diskrepanz zwischen politischen und wirtschaftlichen Zielsetzungen. Noch kam die EG im Währungsbereich nicht voran. Der Beitritt der neuen Mitglieder zur EG (9) erfolgte hingegen im Januar 1972. Norwegen blieb auf eigenen Wunsch nach einer negativen Volksabstimmung draußen. 7 1971 war das Jahr der Weltgeldkrise, die auch auf die EG einwirkte. Der Dollar war Anfang der siebziger Jahre immer mehr unter Druck geraten und die DM zum Spekulationsobjekt geworden. Die USA selbst hatten die Rolle des Dollar im Interesse ihrer eigenen Fiskalpolitik missbraucht. 1970 hatten die USA ein Defizit von 10,7 Mrd. Dollar gegenüber ausländischen Zentralbanken zu verzeichnen. Der Dollar galt als überbewertet, und es begannen massive Kapitalbewegungen. Die alte Bindung zwischen Dollar und Gold war für die USA nicht mehr haltbar. Präsident Nixon hob daher im August 1971 die Goldkonvertibilität des Dollars auf. Zudem verhängte er eine zehnprozentige Zusatzsteuer auf bestimmte Importgüter. Die neue amerikanische Wirtschaftspolitik gab den Partnerstaaten die Hauptschuld an den wirtschaftlichen Problemen der USA. 8 Die USA zielten besonders auf die Bundesrepublik. Im deutschamerikanischen Verhältnis waren Sicherheitspolitik und Währungspolitik eng verknüpft. Konkret sah die amerikanische Seite in deutschen wirtschaftspolitischen Zugeständnissen eine Lastenteilung. Über die Unterhaltskosten der amerikanischen Truppen in Deutschland hinaus wollten die USA, dass die Bundesrepublik währungspolitisch in ihrem Sinne verfuhr. Aus deutscher und europäischer Sicht hatte sich jedoch der Eindruck verfestigt, dass die Amerikaner die Europäer zur Finanzierung des Vietnam-Krieges indirekt zur Kasse bitten wollten. Die USA wollten den Dollar möglichst nicht abwerten, weil das ihre Weltpolitik verteuert und z. B. auch den Aufkauf europäischer Firmen durch amerikanische Konzerne erschwert hätte. Vor dem Hintergrund dieser Debatte schrieb der Franzose Jean-Jacques Servan-Schreiber sein damals aufsehenerregendes Buch über die „Amerikanische Herausforderung“. 9 Das Weltwährungssystem stand zur Reform an, weil es die USA allein nicht mehr garantieren konnten. Zu einer kooperativ ausgehandelten Lösung waren die USA noch nicht bereit, sie konnten nur das alte System durch die Aufhebung der Gold-Konvertibilität sterben lassen. In dieser Krise waren die wirtschaftlichen und monetären Meinungsverschiedenheiten zwischen Frankreich und Deutschland evident. Die Bundesrepublik wollte im Gegensatz zu Frankreich einen Ausgleich mit den USA finden. Die Bundesrepublik hatte also jetzt nach allen Richtungen harte Verhandlungen zu führen. Im Dezember 1971 gab Präsident Nixon nach und wertete den Dollar um 10 bis 12 Prozent ab. Die Deutsche Mark gewann dadurch um 13,5 Prozent an Wert, der Französische Franc und das Britische Pfund um 8,6 Prozent. Das sogenannte Smithsonian-Abkommen war allerdings nur eine kurzfristig wirksame Lösung. 10 Nach der Demonetisierung des Goldes gab es jetzt einen Dollarstandard im Weltwährungssystem. Auf deutscher Seite wurde dieses Abkommen im wesentlichen begrüßt. Die Rolle der D-Mark im EG-Raum gewann immer mehr an Bedeutung. Das Modell der „Währungsschlange“ sah Kursschwankungen zwischen den EG-Währungen von 2,25 Prozent vor. Die „Schlange im Tunnel“, der Tunnel wurde durch die Drittwährungen gebildet, war die Grundlage für ein späteres gemeinsames Währungssystem in Europa. Praktisch war das Schlangenmodell recht problematisch, weil es sich als stark anfällig erwies. Ohne harmonisierte Wirtschafts- und Finanzpolitik der Mitgliedsstaaten waren die Zentralbanken immer wieder gezwungen, schwächere EG-Währungen in großen Mengen anzukaufen. Im Grunde waren das kurzfristige Kreditvereinbarungen. 11 Im Frühjahr 1973 zerfiel das alte Bretton-Woods-Währungssystem. Ein gewaltiger Dollarzustrom in die Bundesrepublik schwemmte das System der festen Wechselkurse weg. Die Bundesbank musste am 1. März 1973 allein fast 2,7 Mrd. Dollar, das waren damals fast 8 Mrd. Mark, aufkaufen. Es kam daraufhin zum sogenannten allgemeinen Floaten. Die Bundesbank erhielt durch den Übergang zu freien Wechselkursen ein neues Maß an monetärer Selbstbestimmung. 12 Jetzt konnte sie eine eigene Geldmengenpolitik betreiben. Nun waren nach streng ökonomischen Kriterien die Binnenwirtschaften und deren Stabilität Grundvoraussetzung für stabile außenwirtschaftliche Beziehungen. Unter freien Wechselkursen spiegelten die nationalen Währungen das internationale Ansehen einer Wirtschaft wider. In der Praxis waren diese Lehrbuchweisheiten jedoch nicht all zu viel wert. Die Wechselkursschwankungen waren bald unberechenbar und sehr viel größer als erwartet. Die D-Mark wurde stark aufgewertet, und der Dollar schwankte erheblich im Wert. Das neue flexible System heizte nämlich die Währungsspekulation an. 13 Die Europäer bewegten sich auf Grund dieser Situation langsam aber sicher auf ein regionales System zu. Helmut Schmidt, der Willy Brandt 1974 nachfolgte, stellte die Wirtschaftsprobleme jetzt in den Vordergrund der deutschen Außenpolitik. Das deutsche Exportgeschäft blühte, die Arbeitslosigkeit und die Inflation zählten zu den niedrigsten im OECD-Bereich. Auch den ersten Ölpreisschock von 1973/74 hatte die deutsche Wirtschaft gut überstanden. Helmut Schmidt wollte ein guter Europäer sein, dazu gehörte nach seinem Verständnis aber auch, dass er die lockere Budget- und Ausgabenpolitik der meisten EG-Staaten geißelte. 14 Nach der Ölkrise war die Liquidität durch die vagabundierenden Petro-Dollars rapide gewachsen. Die massiven Kapitalbewegungen entzogen sich weitgehend der Steuerung durch nationale Zentralbanken und internationale Währungsorganisationen. Diese Instabilitäten brachten die Bundesrepublik und Frankreich dazu, die Währungskoordination der Gemeinschaft zu verbessern. Die persönlich guten Beziehungen zwischen Helmut Schmidt und dem französischen Präsidenten Valéry Giscard d'Estaing waren der Schaffung eines Europäischen Währungssystems (EWS) im Sommer 1978 förderlich. Die Währungsschlange war praktisch in eine D-Mark-Zone geschrumpft. 15 Anfangs ohne britische Beteiligung wurde eine Europäische Währungseinheit (European Currency Unit, ECU) geschaffen, die als Bezugsgröße für die Leitkurse diente. Sie war ein Währungskorb, an dem alle Währungen je nach ihrem Gewicht beteiligt waren. Das EWS war in der Praxis eher ein System fester Wechselkurse als eine Währungsunion. Der ECU selbst war kein Zahlungsmittel und sollte allenfalls langfristig zu einer Gemeinschaftswährung werden. Änderungen der Leitkurse machten die Zustimmung aller Beteiligten erforderlich. Die zentralen Merkmale des EWS waren Regelungsmechanismen, um die Kursschwankungen zwischen den EG-Währungen zu begrenzen. Ferner bildete der ECU eine Verrechnungseinheit für Interventionsmaßnahmen in den Währungsmärkten und für Kredithilfen bei Zahlungsbilanzschwierigkeiten. Aus deutscher Sicht verteilte das EWS die Währungsrisiken von der D-Mark auf das gesamte System. Das EWS hatte also einen transnationalen europäischen Akzent. 16 Das EWS richtete sich nicht dezidiert absichtlich gegen die USA, schuf aber praktisch doch einen Euro-Block, der die Reservewährung DM gegen die destabilisierenden Wirkungen des Dollars stärkte. Der Dollar wurde dadurch noch mehr geschwächt. Er verfiel in der Endphase der Regierung Carter immer mehr. Europäer und Japaner mutmaßten, dass dies von den USA hingenommen würde, um die Exportkraft zu stärken. In der Außenwirkung war das EWS unbestreitbar ein symbolischer und praktischer Schritt zu einem selbstbewussteren Europa. Von außen wurde das EWS vielfach als ein deutscher Währungsblock angesehen. Andere Zentralbanken seien nur noch Satelliten der Deutschen Bundesbank. Aus deutscher Sicht hatte die Stabilitätszone Vorrang. Für die Bundesrepublik war nämlich das EWS nicht nur ein Vorteil, weil die verstärkte Rolle der DM als Reservewährung die interne Geldpolitik erschwerte. 17 Die politisch-psychologische Seite dieses EWS als DM-Zone hieß, dass die Bundesrepublik besonders in Frankreich verdächtigt wurde, monetäre Stärke in politische Einflussnahme umzusetzen. Schmidt reagierte auf solche Vorwürfe gegen das Modell Deutschland äußerst empfindlich und strich heraus, dass die Bundesrepublik vielmehr eine positive Stabilitätsleistung für Europa erbringen würde. Solange Schmidt und Giscard d'Estaing das EWS politisch absicherten, hielt es in Europa. Für die Bundesrepublik tauchte aber das alte Problem wieder auf, dass eine Euro-Lösung die Spannungen mit den USA intensivierte. Mit Carter verstand sich Schmidt sowieso nicht. Bonn setzte jetzt mehr auf Europa und weniger auf die USA, die Ende der siebziger Jahre in eine neue unübersehbare Schwächephase geraten waren. 18 Der zweite Ölpreisschock von 1979/80 traf die USA besonders hart. Die sowjetische Invasion in Afghanistan, der Sturz des Schahs im Iran und das Teheraner Geiseldrama unterminierten das politische Vertrauen in die USA. Für die Bundesrepublik sollte daraus in den achtziger Jahren wieder eine Zerreißprobe werden, weil die unentrinnbare Sicherheitsabhängigkeit Deutschlands der amerikanischen Seite nach wie vor einen starken Hebel in die Hand gab.