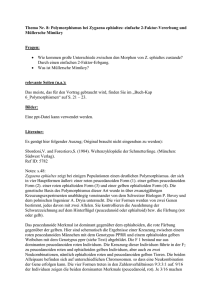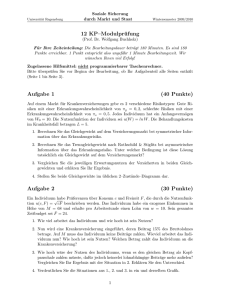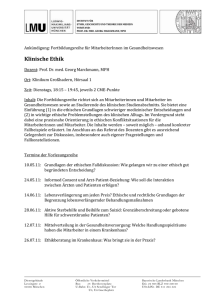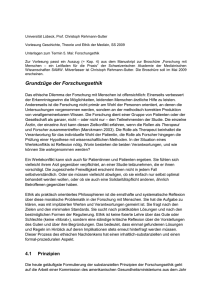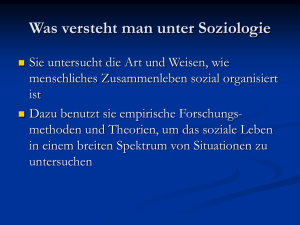Wirtschaftsethik - Frankfurt School
Werbung

1
Wirtschaftsethik
Hartmut Kliemt
Frankfurt School of Finance and Management
Kursmaterial
Vorläufiges Skriptum
(Endgültige Überarbeitung, Vereinheitlichung und Korrekturen etc. stehen
noch aus, doch dürfte das vorliegende dem Endprodukt nahe genug stehen,
um schon dessen wesentliche Funktionen zu erfüllen)
Alle Rechte vorbehalten!
2
I. Einleitung: Grundannahmen, -probleme und –methoden einer
Wirtschaftsethik im freiheitlichen Rechtsstaat
1. Grundwerte freiheitlicher Gesellschaften
2. Gewachsene Grenzen der Gemeinwohlverantwortung
3. Ethik und individuelle (Vertrags-)Autonomie
4. Die Suche nach Kohärenz
II. Exemplarische wirtschaftsethische Falldiskussionen
1. Vorstandsgehälter und leistungsgerechte Entlohnung
1.1. Primär faktische Überlegungen
1.2. Primär normative Überlegungen
2. Der „Schrecken von Geld wie Heu“ und die Heuschrecken
2.1. Geld wie Heu und seine Schrecken
2.2. Heuschrecken
2.3. Von Wincor-Nixdorf zu Grohe und zurück
3. Patentrechte und der Schutz von Menschen in der „Dritten Welt“
3.1. Patentschutz
3.2. Patentschutz von Medikamenten
3.3. Suspendierung des Patentschutzes angesichts der AIDS-Epidemie
4. „Trafigura“, Recht und Moral
3
III. Moral am Werk
1. Moralische Bindung und rationale Interessenverfolgung
1.1. Proximat, ultimat und tugendhaft
1.2. Das Beispiel des Ultimatumspiels und der Besitz der Tugend
1.3. Vorteilhaftigkeit von Bindungen
1.4. Bindungen in Aktion
2. Profiterzielung als moralische Aufgabe?
4
IV. Allgemeine ethische Hintergründe und Methoden der
Wirtschaftsethik
1. Ethik und Entscheidung
1.1.
Entscheidungsverantwortung
1.2.
Kerncharakteristika des Entscheidungsbegriffes
1.3.
Elementare Präzisierungen
1.4.
Entscheidungen und ethische Methodologie
2. Ein Entscheidungsverfahren für die normative Ethik nach Rawls
2.1. Kennzeichen eines kompetenten Moralbeurteilers
2.2. Kennzeichen eines wohlerwogenen Moralurteils
2.3. Begriff der Explikation bei Rawls
3. Utilitarismus, Rawls und Vertragstheorie
3.1. Klassischer Utilitarismus
3.1.1. Hedonistische und andere Wertlehren
3.1.2. Prinzipien utilitaristischer Verallgemeinerung
3.1.3. Kommensurabilität und interindividuelle Substitutierbarkeit
3.1.4. Utilitaristische Politiken
3.2. Entscheidungstheoretische Präzisierungen des Utilitarismus
3.2.1. Die Lotterie des Lebens
3.2.2. Grobe Formalisierung der Lebenslotterie
3.2.3. Unparteilichkeit und ihre Grenzen
5
3.3. Rawlsscher Antiutilitarismus
3.3.1. Vor dem Wiederaufstieg der praktischen Philosophie
3.3.2. Die Situation bei Veröffentlichung der Rawlsschen Theorie
3.3.3. Der Grundansatz von Rawls’ Gerechtigkeitstheorie
4. Habermas, Kant und der Diskurs
4.1. Verständigungsorientiertes als strategisches Handeln und umgekehrt
4.1.1. Hypothetische Imperative und institutionelle Pflichten
4.1.2. Nicht-konsequentialistische, insbesondere „transzendentale“ Rechtfertigungen
von Pflichten
4.1.2.1. Eine Prise Kant
4.1.2.2. Von Kant über Apel zu Habermas
4.2. Diskurs-Ethik ohne transzendentale Begleitmusik
4.3. Lehrer-Wagner-Modelle intersubjektiven Konsenses
4.3.1. Das Grundmodell von Lehrer und Wagner
4.3.2. Die Frage nach dem Grenzverhalten
4.3.3. Die Interessen- oder Nutzendimension
4.3.3.1. Gemeinwohlbezogene Nutzenurteile
4.3.3.2. Die Aggregation von individuellen Gemeinwohlurteilen
4.3.4. Einige abschließende Beobachtungen zu Lehrer-Wagner-Modellen
V. Kurze Schlüsse
1. Loyalität und Widerspruch
2. Ethik ist keine Ingenieurwissenschaft
6
Präambel
Die nachfolgenden Überlegungen profitierten wesentlich von der Lektüre der in
der aller Regel ausgezeichneten Fallstudien, die die Studenten des
Wirtschaftsethik-Kurses im Masterprogramm der Frankfurt School of Finance
and Management im WS 2006/2007 anfertigten. Ihnen gilt mein besonderer
Dank.
Gewiss stimmen die Kursteilnehmer nicht sämtlich mit meinen eher libertären
Grundhaltungen überein. Ich gehe in den nachfolgenden Ausführungen
keineswegs davon aus, dass meine eigenen Wertüberzeugungen die allein
richtigen und verbindlichen sind. Das ist der Grund, warum ich sie von Beginn
an als eine unter alternativen mögliche Ansichten der Dinge offen lege. Ich gehe
nicht davon aus, dass es „die“ Wirtschaftethik im Sinne einer einzigen rational
verbindlichen Auffassung gibt. Auch der Anspruch, dass es bestimmte
fundamentale Überzeugungen gebe, über die sich alle vernünftigen
Diskursteilnehmer einig seien, führt nur zu Selbstgerechtigkeit und dazu, andere
vorschnell als irrational oder moralisch verwerfliche Individuen anzusehen.
Jeder, der sich mit angewandter Ethik im allgemeinen und Wirtschaftsethik im
besonderen auseinandersetzt, muss wissen, dass es immer eine Vielfalt von
Auffassungen geben wird, die jeweils in sich einigermaßen kohärent vertreten
werden können, doch zu widersprüchlichen Ergebnissen führen. Ich plädiere
dafür, sich dessen stets bewusst zu bleiben und nicht nach der richtigen Lösung
zu suchen, sondern nach einer im Rahmen der eigenen letzten
Wertüberzeugungen vertretbaren. Das feste Eintreten für die eigenen
Überzeugungen und das Bemühen, die eigene Position soweit wie möglich
argumentativ auszubauen und zu stützen schließen nicht aus anzuerkennen, dass,
erstens, andere Individuen abweichende Wertüberzeugungen haben und dass,
zweitens, bestimmte Kontroversen sich argumentativ nicht entscheiden lassen.
Wer etwas zeigen will, der muss auch etwas annehmen! Erst an konkret
vorgeschlagenen Problemlösungen und Argumenten kann sich Kritik abarbeiten.
Wenn es diesem Skriptum gelingt, zur Kritik und zur Schärfung abweichender
Positionen beim Leser anzuregen, hat es seinen Zweck erfüllt. Der Leser sei
ausdrücklich aufgefordert, meine Argumente von seinem möglicherweise
abweichenden Wertstandpunkt zu prüfen. In der wirtschaftsethischen
Ausbildung muss es primär darum gehen, kontrovers wirtschaftsethisch
argumentieren zu lernen. Das Predigen von Werten ist eine Sache, die die
akademische Lehre anderen überlassen sollte. Das sollte aber nicht daran
7
hindern, einen eigenen Wertstandpunkt einzunehmen und dann auszuarbeiten,
was folgt, wenn man von ihm ausgeht.
Ich bin überdies der Überzeugung, dass de facto die argumentative
Beschäftigung mit unseren wirtschaftlichen, moralischen und rechtlichen
Praktiken ganz unabhängig von den inhaltlichen Wertstandpunkten, die wir in
der Auseinandersetzung einnehmen mögen, als solche positive Auswirkungen
auf unsere Praxis haben kann. Dazu gehört vor allem auch ein vertieftes
Verständnis für die Vielfalt der wirtschaftsethisch relevanten Wertüberzeugungen. Auch einander widersprechende solche Überzeugungen kann man jeweils
mit guten Gründen vertreten. Wirtschaftethik wird nie eine IngenieurDisziplin sein, die uns allgemeine evidenz-basierte Regeln angemessenen
Handelns an die Hand gibt. Nicht der wirtschaftsethisch informierte
Sozialingenieur, sondern der zu kluger eigenständiger Urteilbildung befähigte
wirtschaftliche Akteur muss das Ideal einer wirtschaftsethischen Bildung sein.
Zu wissen, wo es lang geht und anderen auf der Basis dieses Wissens zu sagen,
welche Ziele sie letztlich verfolgen sollen, wird allenthalben in Anspruch
genommen. Das entsprechende Orientierungswissen gibt es jedoch bei
nüchterner Betrachtung nicht. Es kann in der wirtschaftsethischen Bildung
deshalb nicht um die Vermittlung von Orientierungswissen gehen. Man darf
aber hoffen, dass man anhand einer Kenntnis von wirtschaftsethischen
Argumenten und Diskussionen lernen kann, sich selbst besser zu orientieren.
8
I. Einleitung: Grundannahmen einer
freiheitlich-rechtsstaatlichen
Wirtschaftsethik
Wer heute eine Anhebung der ethischen Standards des Wirtschaftens verlangt,
kann auf breite Zustimmung hoffen. Dabei stellen sich freilich alle vor, dass
durch die „Anhebung der Standards“ genau ihre eigenen ethischen
Vorstellungen und Ziele gefördert werden sollen. In Theorie und Praxis vergisst
man leicht, dass die Vorstellungen davon, was denn ethisch falsch und richtig
sein soll, weit auseinander gehen können. Psychologisch ist dies verständlich,
doch sind die Auswirkungen dieser „Parteilichkeit für die eigene Form der
Unparteilichkeit“ in Theorie und Praxis eher fragwürdig. Weil man ein ethisches,
über das eigene Interesse hinausreichendes Anliegen hat, fühlt man sich
tendenziell berechtigt, was man für das Interesse aller hält, auch für alle
durchzusetzen. Der Glaube, wir verfolgten das Allgemeininteresse, verführt uns
leicht dazu, uns weniger Zurückhaltung aufzuerlegen. Doch gerade dann, wenn
es darum geht, das Gemeinwohl zu fördern und ethische Anliegen zu verfolgen,
ist Misstrauen auch gegenüber dem angebracht, was man selbst für ethisch
richtig und wünschenswert hält.
Man erhebt zwar möglicherweise einen ethischen Allgemeinheitsanspruch,
doch wird dieser Anspruch de facto immer von einer nicht allgemein geteilten
Position aus erhoben. Mit einiger Plausibilität lässt sich zwar im Rahmen
bestimmter ethischer Prämissen behaupten, dass alle eine bestimmte Auffassung
teilen sollten; unplausibel ist es hingegen zu behaupten, dass alle de facto eine
bestimmte Position teilen. Der viel beschworene Konsens aller ist niemals ein
Faktum, sondern benennt allenfalls eine normative Vorstellung, von der man
behauptet, alle sollten sie vernünftigerweise teilen.
Eine Theorien und Probleme reflektierende Beschäftigung mit Ethik im
allgemeinen und mit Wirtschaftsethik im besonderen ist dennoch sinnvoll. Diese
Beschäftigung kann zur Ausbildung unserer eigenen „Tugenden“ rationaler,
wertender Urteilsbildung beitragen. Sie kann uns auch die Einsicht in die
Notwendigkeit der Bescheidung lehren. Unsere eigenen ethischen Auffassungen
bilden niemals mehr als eine Position in einer Vielfalt vertretbarer ethischer
Auffassungen.
9
Mehr als die Vertretbarkeit und Kohärenz (innere Nicht-Widersprüchlichkeit
und
wechselseitige
Plausibilität)
unserer
vielfältigen
wertenden,
vorschreibenden und auch beschreibenden Überzeugungen können wir sinnvoll
nicht anstreben. Wenn es dazu noch gelingt, vielfältige ethische Theorien und
vorherrschende rechtliche wie moralische Überzeugungen in unsere
Überlegungen einzubeziehen, haben wir viel erreicht. „Die“ eine, allein richtige,
mit für alle Beteiligten und Betroffenen zwingenden Gründen versehene Lösung
praktisch-ethischer Probleme werden wir nicht finden. Wir werden allerdings
viele antreffen, die genau solche Ansprüche erheben, doch bezeichnenderweise
für ganz unterschiedliche Thesen.
Die Vielfalt der ethischen Überzeugungen anzuerkennen, heißt nicht, dass
man andere Überzeugungen nicht vom je eigenen Standpunkt kritisieren dürfte.
Selbst dann, wenn man für die eigene Position nicht in Anspruch nimmt, dass
sie in irgendeinem argumentativ-logischen Sinne besser fundiert sei als alle
anderen, bleibt sie doch die eigene Position, die die eigenen Ideale und
Lebensentwürfe ausdrückt. Auch dann, wenn man nicht behauptet, zwingende
Gründe für die eigenen Auffassungen und deren Überlegenheit gegenüber
anderen Auffassungen zu haben, kann man völlig widerspruchslos eine feste
Position einnehmen und versuchen, die eigenen Überzeugungen umzusetzen.
Vor allem kann man aber auch versuchen, andere zu überzeugen und für die
eigene Position und deren Vorteile in der Konkurrenz mit anderen Auffassungen
argumentativ zu werben (das ist im wesentlichen die Position des kritischen
Rationalismus; vgl. dazu einführend Albert, H. (1968), Albert, H. (1978)).
Man muss allerdings akzeptieren, dass man nur dann etwas argumentativ zeigen
kann, wenn man etwas anderes annimmt bzw. voraussetzt. Alles auf einmal
kann man weder sinnvoll bezweifeln noch sinnvoll begründen. Mit irgend etwas
muss man beginnen, ohne dafür weitere Argumente präsentieren zu können.
Mit Bezug auf die Wirtschaftsethik in einem freiheitlichen Rechtsstaat spricht
viel dafür, mit Grundprinzipien einer freiheitlichen Gesellschaft zu beginnen.
Jedenfalls ist die Variante der sogenannten „angewandten Ethik“, die im
weiteren skizziert wird, von der Akzeptanz einer bestimmten Version westlicher
Rechtsstaatlichkeit und dem sogenannten Vorrang der Freiheit, der diese
kennzeichnet, geprägt (vgl. zum Vorrang der Freiheit vor allem auch Rawls, J.
(1975)). Man muss die entsprechenden Grundwerte freiheitlicher Gesellschaften
nicht akzeptieren, wenn man sie akzeptiert, hat das jedoch bestimmte
Konsequenzen, für das, was man noch kohärent vertreten kann.
10
1. Grundwerte freiheitlicher Gesellschaften
Die Liberalität und Freiheitlichkeit einer Gesellschaft zeigen sich nicht nur darin,
dass man die einzelnen ihr jeweils eigenes Interesse und ihre je eigenen Ziele
verfolgen lässt, sondern vor allem auch darin, dass man die Vielfalt von
Konzeptionen des Allgemeininteresses anerkennt und sich in der Verfolgung
allgemeiner Interessen Beschränkungen auferlegt. Nehmen wir Immanuel Kant
ernst und benutzen sein Werk nicht nur zum üblichen Obsthandel mit
Lesefrüchten, so ist das erste Anliegen einer freiheitlichen Rechts- und
Wirtschaftsordnung ‚die größte Freiheit jedes einzelnen zu sichern, die mit der
gleichen Freiheit jedes anderen zusammengehen kann’.
Diese programmatische Formel bedarf der Ausfüllung. Im Sinne eines solchen
Programms ist jedoch klar, dass die Rechtsordnung für den Wirtschaftsbereich
zunächst und vor allem eine Fahrordnung für den Verkehr unter Menschen zu
sein hat. Wie die Straßenverkehrsordnung erlaubt eine freie Wirtschaftsordnung
es jedem einzelnen, seine eigenen Ziele mit seinen eigenen Mitteln anzustreben,
soweit dadurch andere nicht in der gleichen Zielverfolgung behindert werden.
Die freiheitliche Rechtsordnung gibt den Menschen nicht die Ziele vor, zu denen
ihre persönliche Lebensreise zu gehen hat. Ihre Hauptaufgabe besteht vielmehr
darin, Zusammenstöße und Konflikte zu verhindern.
Im Gegensatz zu landläufigen Überzeugungen drohen Zusammenstöße zwischen
den Bürgern vor allem dann, wenn die Individuen nicht ihre eigennützigen,
sondern durchaus selbstlos Interessen verfolgen, die ihre je persönliche Sicht
vom allgemeinen Wohl zum Ausdruck bringen. Die Durchsetzung für alle
verbindlicher Politiken, mögen diese auch aus Sicht ihrer Befürworter dem
allgemeinen Wohl dienen, ist immer mit Zwang verbunden. Allgemeine
Politiken zur Wahrung des allgemeinen Wohls müssen eine bestimmte Sicht
vom Gemeinwohl für alle verbindlich festschreiben und damit jene, die eine
andere Sicht vertreten, unter die allgemeine Politik zwingen. Das ist völlig
unausweichlich, sofern man überhaupt allgemein verbindliche Regeln in einer
Gesellschaft festlegen will. Damit ist auch klar, dass Zwangsausübung auch
im freiheitlichen Rechtsstaat unvermeidlich ist. Man kann schon deshalb als
Anhänger des Rechtsstaates nicht kohärent sagen, dass jede Form der
Zwangsausübung ethisch illegitim sein muss. Man darf jedoch durchaus
behaupten, dass das Bemühen darum, mit so wenig Zwang wie möglich
auszukommen, eine ethische Forderung ist, die alle glaubwürdigen freiheitlichen
Positionen teilen.
11
Die westlichen Normen der Toleranz und des wechselseitigen Respekts fügen
sich nahtlos in diesen Kontext. Aber auch die Forderung, den Bereich
staatlichen Handelns im Zweifel eher zu beschränken als auszudehnen, erscheint
als direkte Folge solcher Überzeugungen. Da staatliches Handeln immer damit
verbunden ist, bestimmte Regelungen für alle verbindlich festzuschreiben (und
sei es nur durch Zwangsfinanzierung), muss es unweigerlich jenen, die
bestimmte Regelungen ablehnen, mit einem gewissen Maß von Zwang
begegnen. Rechtsstaatlich gezähmter Zwang ist gewiss annehmbarer als jede
Form staatlicher Zwangsausübung außerhalb rechtsstaatlicher Verhältnisse und
der Prüfbarkeit durch unabhängige Gerichte. Da aber dennoch Zwang das bleibt,
was er ist, nämlich Zwang, sollte man im Rahmen einer Suche nach maximaler
gleicher Freiheit versuchen, dieses Übel, soweit es geht, zu vermeiden.
Es ist wichtig zu erkennen, dass es sich bei der Zwangsausübung nicht nur für
den Gezwungenen, sondern auch für den andere zwingenden Anhänger
freiheitlicher Prinzipien um ein Übel handelt. Sofern derjenige, der Zwang
ausübt, die Individualität und Eigenständigkeit anderer Menschen respektieren
möchte, muss er zögern, andere zu etwas zwingen zu wollen – und sei es zu
deren eigenem Wohl. Diese Selbstbeschränkung gilt auch und gerade für die
Durchsetzung von Normen, die andere dazu zwingen, das aus Sicht der
Zwangsausübenden ethisch Richtige zu tun. Auch die Durchsetzung höchster
ethischer Normen gegen widerstrebende Auffassungen anderer bleibt für den
Anhänger freiheitlicher Prinzipien grundsätzlich ein ethisches Übel; wobei
unbestritten ist, dass das Zwangsübel um höherer Güter willen gerechtfertigt
sein kann.
Im Rahmen von Normen wechselseitigen Respekts gibt es sehr gute ethische
Gründe dafür, vom Staat Zurückhaltung zu erwarten. Diese Zurückhaltung kann
man allerdings nicht in allen Bereichen gleichermaßen üben. Zum Beispiel kann
man die Festlegung und Durchsetzung von Grundrechten beziehungsweise
grundlegenden strafrechtlichen Normen nicht – jedenfalls ist dies die ganz
herrschende Meinung fast aller Theoretiker – außerhalb staatlicher
Rechtsordnungen sinnvoll vornehmen (partiell abweichend hierzu, de Jasay, A.
(1997)). Ebenso scheint es nicht möglich, fundamentale Kollektivgüter wie etwa
das der Verteidigung der Rechtsordnung nach außen und innen privater
Initiative zu überlassen. Dennoch kann man weite Bereiche privater
Lebensführung und insbesondere den Bereich wirtschaftlicher Tätigkeit nahezu
vollständig von staatlicher Bevormundung und Fixierung einzelner Regeln der
Zielverfolgung freihalten.
12
Wer es ernst meint mit der Formel von der größtmöglichen Freiheit jedes
einzelnen, die mit der gleichen Freiheit jedes anderen zusammengehen kann, der
hat einen starken ethischen Grund, Wirtschaftsleben und private Lebensführung
so weit wie möglich der Gestaltungshoheit der einzelnen Individuen zu
überantworten. Das ist die einzige Möglichkeit zu vermeiden, dass Individuen
etwas durch allgemeine Regelungen aufgezwungen wird. Diese Einsicht ist
zugleich ein starkes Motiv dafür, strengere Varianten des Subsidiaritätsprinzips
zu befürworten und dem Staat nur dann einen Eingriff zu erlauben, wenn die
Bürger ohne Staatseingriff ihre Ziele nicht verwirklichen können (vgl. zu
letzterem ausführlicher ergänzend Kliemt, H. (1995)).
Vor allem im Wirtschaftsleben ist Zwangsvermeidung auch häufig tatsächlich
möglich. Gegenüber der häufig leichtfertig erhobenen Forderung nach mehr
staatlich verordneter ethischer Orientierung des Wirtschaftslebens ist der
ordnungspolitische Grundwert des Primats der individuellen Zielverfolgung
nachdrücklich zu betonen (vgl. dazu auch Eucken, W. (1948/1981)). Nicht nur,
doch insbesondere im Wirtschaftsbereich ist der freiheitliche Rechtsstaat als
eine Privatrechtsgesellschaft (im Sinne von Franz Böhm, Böhm, F. (1966)) zu
sehen. Was mündige Bürger in freier vertraglicher Übereinkunft vereinbaren,
verdient den Respekt der Gesellschaft und der von ihr getragenen
Rechtsordnung. Das gilt auch dann, wenn die Vereinbarungen anderer
bestimmten ethischen Auffassung widersprechen. Denn abgesehen von einem
rechtsethischen Kernbereich, der zentrale negative Abwehrrechte und gewisse
positive Teilhaberecht umfasst, beruht die Freiheitlichkeit unseres Rechts- und
Sozialstaats wesentlich auf der Bereitschaft, gerade die Unterschiedlichkeit und
Vielfalt individueller Lebensentwürfe einschließlich der Vielfalt ethischer
Überzeugungen anzuerkennen (wo immer das möglich ist, ohne die gleichen
Rechte Dritter zu tangieren).
2. Gewachsene Grenzen der Gemeinwohlverantwortung
Die Unterschiedlichkeit und Vielfalt individueller Lebensentwürfe wird im
Rahmen von freien Markinstitutionen auf selbstverständliche Weise respektiert.
Das ist ein ethisches Verdienst freier marktlicher Institutionen, was immer sonst
für oder gegen sie sprechen mag. Der marktliche Respekt für das Individuum ist
darüber hinaus im allgemeinen mit einer Wohlfahrtsteigerung gegenüber alternativen Organisationsweisen des Wirtschaftens verbunden.
13
Die Freisetzung der individuellen Wirtschaftstätigkeit von übergeordneten
Gemeinwohlzielen war zentraler Faktor für die Wirtschaftsentwicklung des
Westens (vgl.Rosenberg, N. and L. E. J. Birdzell (1986), Jones, E. L. (1991)).
Der Westen wurde reich, gerade weil es eine Festlegung auf bestimmte ethische
Ziele im Wirtschaften nicht mehr gab. Unternehmen sind ebenso wenig wie
Individuen auf eine direkte Verfolgung des Gemeinwohls verpflichtet, sondern
werden rechtlich und moralisch dazu autorisiert, ihre je eigenen partikularen
Ziele mit ihrem je eigenen partikularen Wissen zu verfolgen (vgl. zu dieser Sicht
Hayek, F. A. v. (1971)).
Die Freistellung von der moralischen Pflicht zur Verfolgung des allgemeinen
Wohls zugunsten der moralischen Befugnis zur Verfolgung des partikularen
Wohls des Individuums und der ihm unmittelbar Nahestehenden wirft eine
Reihe von wichtigen moralischen Fragen auf, die breit in der Literatur diskutiert
wurden. In der Diskussion dieser Fragen wird allerdings gewöhnlich recht
einseitig auf eine enge Interpretation der Metapher von der unsichtbaren Hand
abgestellt (vgl. zu dieser die Originaltexte in Schneider, L. (1967)). Es wird
anerkannt, dass auf Märkten die unsichtbare Hand des Eigeninteresses das
Gemeinwohl fördernde Wirkungen haben kann. Es wird dann aber sogleich
betont, dass dieses Argument nur für eng umgrenzte wirtschaftliche Ziele zu
gebrauchen sei. Man übersieht darüber, dass die betreffende Sichtweise im
Prinzip völlig allgemeiner Natur ist.
In einer freiheitlichen Gesellschaft sind menschliche Individuen umfassend zur
Verfolgung ihrer je eigenen Ziele ermächtigt. Die meisten „liberalen“ Moralphilosophen würden dieser Sichtweise grundsätzlich zustimmen (zum
Verhältnis zwischen dem ethischen Liberalismus und seinen ethischen
Konkurrenten vgl. Kymlicka, W. (1996)). Viele würden jedoch zugleich der
Auffassung sein, dass man die Verfolgung partikularer Interessen aus
moralischen Gründen um übergeordnete Gesichtspunkte moralischer Art
ergänzen muss. Wenn solche Theoretiker die Gemeinwohlorientierung
einschränken, dann in der Regel nur aus pragmatischen Gründen einer
motivationalen Überforderung des Individuums. Die Freiheit von der Pflicht zur
Verfolgung des Gemeinwohls (auf und außerhalb von Märkten) wird aus
instrumentellen Gründen gewährt, nicht aber als ein Wert in sich angesehen.
Eine Minderheit liberaler Moralphilosophen befürwortet die Vielfalt der
Individualität als solche als primären, anderen ethischen Zielen übergeordneten
Wert (vgl. dazu ursprünglich Humboldt, W. v. (1851/1967)). Einige dieser
Theoretiker halten eine Gemeinwohlorientierung des individuellen Handelns in
14
der Regel nicht nur für unmöglich, sondern für tendenziell schädlich. Die
Grundintution hierbei ist, dass man gar nicht wissen kann, was das je eigene
Handeln für andere bedeutet. Nach dieser Sicht kann das einzelne Individuum in
der Regel überhaupt nicht einschätzen, welche seiner möglichen Handlungen,
den über alle potentiell betroffenen Individuen größten Beitrag zum allgemeinen
Wohl oder zum Wohl aller leistet. Deshalb scheidet eine Orientierung am
Gemeinwohl für die individuellen Handlungen aus.
Der einzelne soll sich allein lokal, in seinem jeweiligen Umfeld um eine
Förderung des Wohls der von seinen Handlungen direkt betroffenen Individuen
bemühen. Eine Pflicht sich an übergreifenden ethischen Zielsetzungen in seinem
alltäglichen Handeln zu orientieren, besteht nicht. Eine solche Orientierung
würde vielmehr im allgemeinen schlechte Folgen haben. Mit den Worten eines
der klassisch liberalen Anhängers solcher Gedanken:
“All the possible differences in men’s moral attitudes amount to little,
so far as their significance of social organization is concerned,
compared with the fact that all man’s mind can effectively
comprehend of the facts of the narrow circle of which he is the center;
that, whether he is completely selfish or the most perfect altruist, the
human needs for which he can effectively care are an almost
negligible faction of the needs of all members of society. The real
question, therefore, is not whether man is, or ought to be, guided by
selfish motives but whether we can allow him to be guided in his
actions by those immediate consequences which he can know and care
for or whether he ought to be made to do what seems appropriate to
somebody else who is supposed to possess a fuller comprehension of
the significance of these actions to society as a whole.
To the accepted Christian tradition that man must be freed to follow
his conscience in moral matters if his actions are to be of any merit,
the economists added the further argument that he should be freed to
make full use of his knowledge and skill, that he must be allowed to
be guided by his concern for the particular things of which he knows
and for which he cares, if he is to make as great a contribution to the
common purposes of society as he is capable of making. Their main
problem was how these limited concerns, which did in fact determine
people's actions, could be made effective inducements to cause them
momentarily to contribute as much as possible to needs which lay
outside the range of their vision. What the economists understood for
15
the first time was that the market as it had grown up was an effective
way of making man take part in a process more complex and extended
than he could comprehend and that it was through the market that he
was made to contribute ‘to ends which were not part of his purpose’.
“ (Hayek, F. A. v. (1948), 14-15)
Es bleibt eine offene Frage, ob die Sicht Hayeks, die für Marktinstitutionen und
ein Verhalten im Rahmen dieser Institutionen volle Berechtigung zu haben
scheint, auch außerhalb dieses Kontextes ausnahmslos zu beachten ist. Es
scheint insbesondere im politischen Kontext zumindest weit fraglicher, ob eine
Freisetzung von allen moralischen Gemeinwohlorientierungen vertretbar sein
kann. Wenn es beispielsweise um eine allgemeine Abstimmung in politischen
Fragen geht, wird man vermutlich dazu neigen, Intentionen, die sich auf das
allgemeine und nicht nur auf das spezielle oder partikulare Wohl richten, für
politisch wünschenswert und möglicherweise sogar erforderlich zu halten. Es ist
plausibel, dass in einer gut funktionierenden Demokratie die Wähler in der
Niedrigkosten-Situation der Wahlentscheidung zumindest teilweise ihre
allgemeinen politisch-moralischen Überzeugungen ausdrücken und nicht allein
ihr privates Wohl strategisch verfolgen sollten. Denn es ist so überaus
unwahrscheinlich, dass eine einzelne Stimme die Entscheidung insgesamt kausal
zum Umschwung bringt, dass der einzelne mit Bezug auf diesen Aspekt seines
Handelns nicht strategisch vorgehen wird (vgl. dazu Brennan, H. G. and J. M.
Buchanan (1984), Brennan, H. G. and L. Lomasky (1984), Brennan, G. and L.
Lomasky (1985), Brennan, H. G. and L. E. Lomasky (1993), Kliemt, H. (1986)).
Wenn es darum geht, dass Individuen in der Wahlentscheidung ihre
Überzeugungen durch ihre Stimme zum Ausdruck bringen, dann ist das sicher
manchmal für die Durchsetzung im weiteren Sinne ethischer Ziele in der Politik
günstig. Man darf aber in diesem Zusammenhang auch Hannah Arendts
Verweis auf die merkwürdige Selbstlosigkeit der Massen in der Verfolgung
des Gemeinwohls – oder dessen, was den Massen als solches nahegelegt wird –
nicht vergessen (vgl. Arendt, H. (2003)). In solcher selbstloser Gemeinwohlorientierung liegt die Ursache vieler politischer Übel auch im demokratischen
Prozess. Selbstlose Folgebereitschaft und die Bereitschaft zur Aufopferung der
eigenen partikularen für übergreifende Ziele, die von selbsterklärten politischmoralischen Eliten vorgegeben werden, bildet eine wesentliche Ursache des
modernen Totalitarismus (und auch der Gedanke an die Selbstmordattentäter
liegt nicht fern).
16
Angesichts der Gefahren totalitärer Bewegungen wären wir am Ende womöglich
besser gestellt, wenn wir eine Orientierung an jeglichen übergreifenden Motiven
bekämpften, anstatt die Orientierung an übergeordneten Zielen in der Politik
manchmal fordern und manchmal ablehnen. Vielleicht ist es besser, sich gegen
alle Propheten des Gemeinwohls zu wenden. Um die falschen Propheten
zurückzudrängen, muss man womöglich auch auf die rechten verzichten. Die
Fehler erster müssen gegen die zweiter Art abgewogen werden und am Ende
könnte es besser sein, einen „bias“ gegen die Fehler, die von moralischen
Orientierungen an gemeinsamen Zielen erzeugt werden, zu entwickeln.
Für die weiteren Überlegungen wird von der insoweit optimistischeren
Annahme ausgegangen, dass wirtschaftsethische Reflexionen das Gemeinwohl
eher fördern als schädigen werden. Dabei spielen vor allem konkrete Beispiele
und das Ziel, eine Kohärenz unserer Überzeugungen vorschreibender und
beschreibender Art zu erreichen, eine Rolle.
3. Ethik und individuelle (Vertrags-)Autonomie
Die Respektierung freier Übereinkünfte im Vertragsrecht, die sogenannte
„Vertragsfreiheit“, ist wesentlicher Ausdruck des ethischen Zieles Individuen als
autonome Akteure zu behandeln. Sehr viele Vorschläge, ethische Standards im
Wirtschaftsleben zu verbessern, lassen es aber gewollt oder ungewollt am
Respekt für die Vertragsfreiheit fehlen. Wenn beispielsweise die schlechten
Arbeitsbedingungen in bestimmten Unternehmen des Einzelhandels beklagt
werden, dann geschieht das gewiss nicht grundlos. Es gibt Gründe für Kritik.
Doch ist auch daran zu erinnern, dass die Beschäftigten nicht in irgendeinem
vernünftigen Sinne des Begriffs dazu gezwungen wurden, die betreffenden
Arbeitsverträge abzuschließen. Sofern der Beschäftigte jederzeit der Arbeit
(ohne über den Verlust des Lohnes hinausgehende Nachteile) fernbleiben kann,
ist davon auszugehen, dass er in einem grundlegenden Sinne freiwillig der
Beschäftigung nachgeht. Wieso dürfen wir, wenn wir sonst für die
Respektierung freier Übereinkünfte zwischen mündigen Bürgern eintreten, in
diesem Bereich, wie von vielen wirtschaftsethischen Konzeptionen gefordert,
eingreifen?
Die Tatsache, dass gerade niedrig qualifizierte Menschen Schwierigkeiten haben,
Arbeit zu finden und daher häufig besonders ungünstige Arbeitsbedingungen
hinnehmen müssen, ist unstrittig und muss aus Sicht jedes mitfühlenden besser
gestellten Individuums bedauert werden. Unstrittig scheint es aber auch, dass die
ethische Verantwortung für diese Schwierigkeiten, soweit es überhaupt eine
solche Verantwortung gibt, gewiss nicht bei den beschäftigenden
17
Einzelhandelsunternehmen, sondern allenfalls beim Gesetzgeber und dessen
Sozialpolitik liegt. Wenn sie mit einem potentiellen Mitarbeiter einen Vertrag
schließen und im Vertragsschluss dessen Rechte respektieren, warum sollten wir
als Dritte diese freier Vereinbarung kritisieren wollen?
Relativ zu ihrer jeweiligen lokalen Verantwortung haben alle angemessen
gehandelt. Sie darüber hinaus auf die Verfolgung von außen vorgegebener
sozialer Ziele festzulegen, erscheint als falsch. Jedenfalls dann, wenn es dem
Arbeitnehmer ohne größere zusätzliche Einbußen möglich ist, jederzeit aus dem
Vertrag auszuscheiden, beziehungsweise diesen ohne zusätzliche Strafzahlungen
zu brechen, indem er einfach nicht mehr zur Arbeit erscheint, sollte man von der
Freiwilligkeit der Beziehungen ausgehen dürfen. Es ist daher vom Standpunkt
einer Privatrechtsgesellschaft kein Grund ersichtlich, die betreffenden Verträge
nicht anzuerkennen.
Über die Frage, ob man die Umgehung von Vorschriften etwa für die Bildung
von Betriebsräten in Einzelhandelsunternehmen für legitim hält oder nicht, darf
ordnungspolitisch und rechtsethisch gestritten werden. Es gibt gerade auch bei
Abwägung der Arbeitnehmerinteressen ethische Argumente für und wider
bestimmte arbeitsrechtliche Regelungen. Klar ist jedoch, dass bei nüchterner
Betrachtung der Adressat solcher ethischer Vorschläge primär der Gesetzgeber
und nicht der einzelne Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, der mit einem
Arbeitgeber Verträge schließt, sein müssen. Wenn der Gesetzgeber eingreift,
dann ist das allerdings, daran sei erinnert, notwendig mit fundamentaler
Zwangsausübung verbunden und bedarf besonderer Rechtfertigung, wenn man
den Vorrang der Freiheit der einzelnen ernst nimmt.
Ebenso wie den Wirtschaftsunternehmen ethische Verfehlungen im Niedriglohnsektor allenthalben angekreidet werden, so werden auch bestimmte
Praktiken an der Spitze der Einkommens-Pyramide als moralisch anstößig
beurteilt. Wenn es so wäre, dass das Angebot finanzieller Zahlungen als solches
schon Zwang auf denjenigen ausübt, dem diese Zahlungen geboten werden,
wäre das aus einer Sicht, die Zwang ablehnt, zu verurteilen. Dann würden
Vorstandsmitglieder in besonders hohem Maße dem Zwang unterliegen: Je
höher die Zahlung, desto größer müsste der Zwang sein den ein Arbeitnehmer
erleidet, wenn ihm Bezüge angeboten werden. Das scheint einigermaßen absurd,
ist aber in der Logik jener sehr verbreiteten Positionen angelegt, die finanzielle
Belohnungen ablehnen, weil sie die Autonomie des Belohnten gefährden.
Um zu veranschaulichen, worum es hier geht, ist es womöglich hilfreich, an ein
Beispiel aus einem ganz anderen Bereich zu denken: an die Diskussion um die
18
Frage der Entgeltlichkeit und Unentgeltlichkeit der Lebendspende menschlicher
Organe. Solange die Lebendspende in der Familie für nahe stehende Menschen
geschieht, wird die Freiwilligkeit der Spende fast selbstverständlich unterstellt.
Sobald es jedoch um die Spende gegen Entgelt geht, soll die Freiwilligkeit
gefährdet sein. Schenkungsverträge werden also offenkundig völlig anders als
Verkaufsverträge hinsichtlich menschlicher Organe behandelt. Die Ersteren
gelten als freiwillig, die Letzteren jedoch als erzwungen.
Für diese Unterschiedlichkeit der Behandlung mag es andere gute Gründe geben,
doch bleibt die Ansicht, dass derjenige, der seine Organe für Geld hergibt, durch
das Angebot der Geldzahlung zur Hergabe „gezwungen“ wurde, so absurd, dass
man sich unwillkürlich fragt, warum hartnäckig Thesen vorgebracht werden, die
nur bei Unterstellung dieser Absurdität plausibel sind. Diese Hartnäckigkeit
erklärt sich womöglich damit, dass viele Gegner der Entgeltlichkeit der
Lebendorganspende zugleich Anhänger der Grundprinzipien wechselseitigen
Respekts für die Autonomie menschlicher Individuen sind. Sie spüren, dass sie
dann, wenn sie die entsprechenden Respektsnormen akzeptieren, an sich auch
autonome Vertragsschlüsse über die Hergabe von Organen gegen Geld
respektieren müssten. Sie versuchen zugleich eine Widersprüchlichkeit der
eigenen Position zu vermeiden. Da Zwang die Autonomie aufhebt, könnte man
ohne Verletzung der Autonomie – die ja ohnehin aufgehoben ist – Zwang gegen
Geldzahlungen ausüben. Die eigene Position des erklärten Respektes bliebe
kohärent, wenn Geldzahlungen Zwang, dem man durch Zwang entgegentreten
muss, beinhalten könnten.
Die Gegner der Entgeltlichkeit der Organvergabe empfinden es einerseits
aufgrund ihrer anderweitigen Grundüberzeugungen als ethisch erforderlich, jede
Form des Handels mit menschlichen Organen zu verbieten, andererseits haben
sie aber auch etwas dagegen, andere Menschen ethisch zu bevormunden.
Ethische Bevormundungen können sie mit der eigenen Position nur dann in
Übereinstimmung bringen, wenn sie dem Schutz der Autonomie des Betroffenen
selber dient. Der Schutz vor Zwang bietet hier einen Ausweg. Wenn das
Angebot von Geldzahlungen wirklich wie bei einem Süchtigen die Droge die
üblichen Mechanismen der Selbstkontrolle außer Kraft setzen würde, dann wäre
es plausibel, Entgeltlichkeit der Organhergabe zum Schutz der Autonomie der
betroffenen Individuen zu untersagen.
Aber es scheint ziemlich absurd, eine solche Abhängigkeit von der
„Gelddroge“ allgemein zu unterstellen. Es hängt vielmehr alles davon ab, wie
gut derjenige, dem Geld geboten wird, wenn er das Angebot ausschlägt, gestellt
19
sein würde. Dann ist es aber nicht generell zu verbieten, die betreffenden
Verträge zu schließen, sondern allein denen, die sich nicht in geordneten
wirtschaftlichen Verhältnissen befinden.
4. Die Suche nach Kohärenz
Die Frage der Entgeltlichkeit oder Unentgeltlichkeit der Lebendorganspende ist
wirtschaftsethisch durchaus aufschlussreich, aber an dieser Stelle nicht weiter zu
diskutieren. Sie dient im gegenwärtigen Zusammenhang nur als Beispiel für
einen allgemeineren Sachverhalt. Man erkennt an dem Beispiel, wie schwer wir
uns mit der Respektierung autonomer Entschlüsse anderer tun, wenn wir
abweichende ethische Vorstellungen vom „guten und rechten Leben“ haben. An
der etwas verqueren Argumentation von der Zwangsausübung durch
Geldangebote wird auch deutlich, dass bis in die politische Auseinandersetzung
hinein Normen der Kohärenz beziehungsweise der Vermeidung von
Widersprüchen in den eigenen Auffassungen eine Rolle spielen.
Da die ethische Auseinandersetzung im Rahmen der Philosophie wesentlich
getragen wird von Kohärenzüberlegungen, treffen sich philosophisch ethische
und alltägliche ethische Überlegungen an dieser Stelle. Insoweit hat die
philosophische Ethik durchaus etwas für die rationale praktische
Auseinandersetzung in unserer Gesellschaft zu bieten. Im Bereich der
philosophischen Ethikdiskussionen wird nämlich vorgeführt, auf welche Weise
man systematisch die Kohärenz der jeweiligen eigenen Überzeugungssysteme
prüfen und steigern kann.
Wer einander widersprechende Wertüberzeugungen zu vertreten sucht, wird
normalerweise auf den Nachweis der Widersprüchlichkeit mit dem Versuch
reagieren, seine Auffassungen so zu revidieren beziehungsweise zu ergänzen,
dass sie wieder kohärent zu sein scheinen. Eine Kenntnis der philosophischen
Ethikdiskussion kann hierbei sehr hilfreich sein. Bei dem Bemühen um
Kohärenz spielen allerdings nicht nur Wertüberzeugungen eine Rolle, sondern
immer auch empirische Bedingungen. In dem Beispiel von der Entgeltlichkeit
der Organhergabe etwa ist es eine wichtige empirisch-psychologische Frage,
unter welchen Bedingungen das Angebot von Geldzahlungen die Autonomie
von Menschen untergräbt. So wird man – wie bereits mit der Anforderung
geordneter wirtschaftlicher Verhältnisse implizit unterstellt – vermutlich beim
hoch verschuldeten Menschen, der keinen anderen Ausweg mehr aus seiner
persönlichen Schuldenfalle sieht, eine höhere Gefährdung unterstellen als bei
einem durchaus wohlsituierten Bürger, der für einen sehr hohen Geldbetrag
bereit ist, eine Niere zu verkaufen.
20
Die potentielle Gefährdung der Autonomie des Spenders ist aber noch kein
hinreichender Grund, die betreffenden freien Übereinkünfte anderen zu
verbieten. So, wie man die Freiwilligkeit einer Lebend-Organ-Schenkung unter
Verwandten zu prüfen hat, um die Autonomie des Schenkenden zu sichern, so
könnte man die Autonomie eines Organ-Verkäufers durch entsprechende
Prüfungen zu sichern versuchen. Warum die Autonomie in dem einen Falle in
der Regel und in dem anderen Fall in der Regel nicht gegeben sein soll, scheint
zunächst eher unerfindlich. Daher hat man wieder ein Kohärenzproblem, wenn
man im einen Falle eine Vergabe verbieten und im anderen erlauben möchte.
Beides unter autonomie-sichernden Bedingungen zu erlauben oder beides zu
verbieten, weil die Autonomie nie hinreichend gesichert werden könnte, scheint
plausibler als die tatsächlichen rechtlichen Vorgehensweisen.
Arbeitsverträge sollten eigentlich in noch höherem Maße als freie Verträge über
die Hergabe von Organen respektiert werden. Geldangebote als solche wird man
nicht mit einer Zwangsausübung auf den Arbeitnehmer gleichsetzen können.
Am unteren Ende der Lohnskala gefährdet nicht das Gebot eines Lohnes die
Autonomie. Entscheidend für die Freiheitlichkeit ist die Existenz und Art von
Alternativen. Je besser die Alternative der Zurückweisung des angebotenen
Vertrages beziehungsweise der Verletzung eines bestehenden Vertrages, umso
besser scheint die Freiwilligkeit geschützt zu sein.
Geht man davon aus, dass die Absicherung gegen die Risiken der
Arbeitslosigkeit eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, dann fällt es nicht in
die Verantwortung der Arbeitsverträge anbietenden Arbeitgeber, für die
Freiwilligkeit der entstehenden Arbeits-Beziehungen Sorge zu tragen. Insoweit
würden wirtschaftsethische Vorhaltungen hinsichtlich der Gestaltung von
Arbeitsverträgen gegenüber Unternehmen ins Leere laufen. Wenn man
autonome Verträge respektieren will, dann sollten auch autonom eingegangene
Arbeitsverträge respektiert werden.
Wenn es demgegenüber beispielsweise eine Reduzierung der Freiwilligkeit
beinhalten würde, die Lohnangebote zu erhöhen, dann hätte ein der Norm der
Freiwilligkeit verpflichteter Arbeitgeber eine moralische Pflicht, möglichst
geringe Löhne zu zahlen. Umgekehrt, je höher die angebotene Lohn-Zahlung
würde, desto größer müsste, wie gesagt, der ausgeübte Zwang auf den
Arbeitnehmer sein. Das scheint nicht besonders plausibel zu sein. Wenn also
Arbeitnehmer aufgrund der höheren Löhne aus einem bestimmten
Vertragsverhältnis bereit sind, sehr unangenehme Arbeitsbedingungen auf sich
zu nehmen, dann sollte man auch diese Handlungen zunächst als freiwillig
21
ansehen. Warum man Arbeitnehmer dagegen schützen sollte, freiwillig die
Pflicht zu unangenehmen Handlungen auf sich zu nehmen, ist für den Anhänger
der Autonomie zunächst kaum ersichtlich. Jedenfalls solange für den
Arbeitnehmer akzeptable Alternativen außerhalb des Vertrages oder bei
Ausscheiden aus dem Vertrag existieren, sollte man den autonomen Entschluss
des Vertragsnehmers, im Vertragsverhältnis zu verbleiben, als Ausdruck seiner
freien Entscheidungen respektieren.
In dem vorangehenden zeigt sich bereits ein wesentlicher Aspekt jeder
theoriegeleiteten wirtschaftsethischen Diskussion, die nicht einfach wechselnde
gesellschaftspolitische Auseinandersetzungen widerspiegeln will: Die Frage
nach einer wirtschaftswissenschaftlichen Erklärung jener Phänomene, die einer
wirtschaftsethischen Bewertung unterzogen werden sollen, ist ein integraler
Bestandteil seriöser wirtschaftsethischer Überlegungen. Man muss sich über
verschiedene potentielle Erklärungen für eine Sachlage Gedanken machen und
dann zu einem Schluss darüber kommen, welche diese Erklärungen man für
wahrscheinlich oder gar für die eine wahre Erklärung hält. Von zentraler
Bedeutung für einen angemessenen Zugang zu wirtschaftsethischen
Diskussionen ist es, zwischen Werturteilen und Sachaussagen zu trennen und
zugleich die überragende Bedeutung von Sachfragen auch für die Wertfragen
anzuerkennen. Es ist selbst eine ethische Forderung, Werturteile nur auf der
Basis der jeweils besten empirischen Theorien und Hypothesen, über die wir
verfügen, zu fällen. Das Bemühen um möglichst umfassende Informationen über
die sachlichen wirtschaftlichen Zusammenhänge gepaart mit dem Bemühen um
eine Kohärenz aller Sach- und Werturteile sind primäre Tugenden des
Wirtschaftsethikers. Die Ernsthaftigkeit dieser Bemühungen und das Training
darin, wie man in diesen Bemühungen zu verfahren hat, sind wichtiger als die
„Indoktrination“ mit irgendwelchen inhaltlichen Werten.
Wie schon Schopenhauer wusste, ist es schwierig, Moral zu begründen, während
es leicht fällt, Moral zu predigen. Die Wirtschaftsethik selbst sollte es sich nicht
in diesem Sinne leicht machen und die Ausbildung in wirtschaftsethischen
Argumentationsweisen ebenfalls nicht. Die nachfolgende Einführung wird mit
einigen Fallstudien aus dem Wirtschaftsleben beginnen, um an diesen ganz
pragmatisch das vorangehend Gesagte zu illustrieren. Es geht darum, in
wirtschaftsethischen Fragestellungen zunächst einmal fern von den ohnehin eher
abgehobenen Diskussionen der theoretischen philosophischen Ethik möglichst
kohärente und empirisch informierte „Gleichgewichte von Überlegungen“ zu
erreichen.
22
Dabei wird, wie bereits in dieser Einleitung deutlich geworden sein dürfte,
generell unterstellt, dass bestimmte Standardauffassungen der Wirtschaftstheorie
Geltung
besitzen.
Ebenso
wird
vorausgesetzt,
dass
bestimmte
Grundauffassungen von den Prinzipien freiheitlicher Rechtsstaatlichkeit
akzeptiert sind. Beides geht in jede Suche nach wirtschaftsethischen
Überlegungsgleichgewichten gleichermaßen ein. Hinzutreten Kenntnisse
gewisser allgemeiner ethischer Theorien, weil die Suche letztlich einem so
genannten allgemeinen oder weiten Überlegungsgleichgewicht, WÜG, gelten
muss (zum WRE „wide reflective equilibrium“, vgl. ursprünglich Daniels, N.
(1979)). Die Suche nach einem WÜG bezieht intuitive moralische Einzelurteile,
allgemein akzeptierte ethische Regeln und Prinzipien sowie allgemeine ethische
Hintergrundtheorien in einen kohänrenzsteigernden wechselseitigen Anpassungsprozess aller spezifischen und allgemeinen Überzeugungen ein.
Alle Voraussetzungen der nachfolgenden Diskussionen, die im weiteren Sinne
einer Suche nach einem WÜG dienen, kann man selbstverständlich angreifen.
Ein solcher Angriff ist immer begrüßenswert, da jede Theorie und jede
umfassendere theoretische Positionen nur dadurch verbessert werden kann, dass
man sie grundsätzlich herausfordert. Jeder, der in der Wirtschaftsethik
konstruktiv etwas beizutragen sucht, muss von vornherein anerkennen, dass
seine Ausführungen von vielerlei Annahmen abhängen und schon insoweit der
Herausforderung und steten Prüfung bedürfen.
Wer aus Sicht der Wirtschaftsethik spricht, erhebt immer strikt nur eine Stimme
in einem übergreifenden größeren Diskurs konkurrierender Stimmen. Die
Vielzahl der Stimmen in diesem Diskurs sollte uns jedoch nicht davon abhalten,
an den Auseinandersetzungen teilnehmen zu wollen. Jedermann sollte vielmehr
versuchen, seine je eigenen Positionen möglichst gut auszuarbeiten. Sowie auf
Märkten Konkurrenz zu besonders guten Produkten und Dienstleistungen führt,
so ist es auch in der theoretischen und intellektuellen Auseinandersetzung
hilfreich, auf die freie Konkurrenz zu setzen.
Es gibt so etwas, wie einen Markt der Ideen. Wer diesen Markt betritt, der sollte
allerdings auch über gewisse Voraussetzungen und Fähigkeiten verfügen, wenn
er dort bestehen will. Deshalb wendet sich diese Einführung im nächsten Schritt
Fallbeispielen (II.) zu, an denen man seine Intuitionen schärfen und erste
Schritte auf dem Weg zu mehr Kohärenz probieren kann. Dann geht es darum,
in einem Zwischenschritt zu überlegen, wie und in welchen Kontexten im
weiteren Sinne moralische Motive real wirksam werden. Dabei geht es mit
Bezug auf spezifisch wirtschaftsethische Fragen zum einen um den Nachweis,
23
dass es sich lohnen kann, moralische Bindungen einzugehen, zum anderen um
die Frage, welchen moralischen Status das Profitmotiv selbst angesichts der
Koordinations- und Informationsfunktion von Gewinnen hat bzw. haben kann
(III.). Dann wenden wir uns der Aufgabe zu, einige inhaltliche ethische Theorien
wie den Utilitarismus, Rawls’ Anti-Utilitarismus oder die Diskurstheorie
wenigstens in elementaren Grundzügen vorzustellen und abschließend exemplarisch zu überlegen, wieweit Konsens verfahrensmäßig angesichts fortbestehender Überzeugungsvielfalt womöglich gesichert werden kann (IV.). Abschließend
gebietet es die intellektuelle Redlichkeit, eine Warnung vor einer Überschätzung
der Wirtschaftsethik als „Orientierungswissen“ auszusprechen; da sie uns allenfalls helfen kann, uns selbst zu orientieren, aber nicht inhaltlich darüber
informiert, wo es lang gehen soll (V.).
24
II. Exemplarische wirtschaftsethische
Falldiskussionen
1. Vorstandsgehälter und leistungsgerechte Entlohnung
1.1. Primär faktische Aspekte
Vorstandsgehälter großer Aktiengesellschaften sind zumindest in Deutschland
allgemein ins Gerede gekommen. Es überrascht nicht, dass im Zuge dieser
Entwicklung die Vorstandsgehälter der Deutschen Bank besondere
Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Die Deutsche Bank ist als größte
deutsche Geschäftsbank immer von besonderem Interesse. Darüber hinaus war –
betrachtet man allein die deutschen DAX-30 Unternehmen – sowohl das Gehalt
des Vorsitzenden des Vorstandes als auch das durchschnittliche Gehalt eines
Vorstandsmitgliedes der Deutschen Bank in jüngerer Vergangenheit und
insbesondere in den Jahren 2004 und 2005 im deutschen
Unternehmensvergleich am höchsten.
Es hat einen allgemeinen Anstieg der Vergütung von Vorständen von DAX-30
Unternehmen in den letzten Jahren gegeben. Die Vergütungssteigerung für
Vorstände der Deutschen Bank war eher geringer als in anderen Unternehmen.
Doch die Deutsche Bank hat schon zuvor höhere Gehälter gezahlt und insofern
trifft es weiterhin zu, dass die Vorstandsgehälter bei der Deutschen Bank
insbesondere auch für den Vorsitzenden eine Spitzenposition in Deutschland
einnehmen.
Vom Jahre 2003 bis zum Jahr 2005 stieg z.B. die Vergütung für Josef
Ackermann, den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank, von 7,72
Millionen € auf 11, 9 Millionen € an. In der gleichen Zeit veränderten sich aber
auch alle wesentlichen Kennzahlen des Geschäftserfolges deutlich zum Besseren.
Beispielsweise wurde die Eigenkapitalrendite von 10,2% im Jahre 2002, dem
Jahr des Amtsantritts von Josef Ackermann, auf über 30% im Jahre 2006
gesteigert. Auch der Börsenkurs der Aktie, die im Jahre 2001 schon einmal bei
über 105 € notierte, hat 2007 diese Marke wieder erreicht.
Diese vorteilhafte Entwicklung ist gewiss nicht allein auf das Wirken von Josef
Ackermann zurückzuführen. Andere deutsche Wirtschaftszweige entwickelten
sich, zumal von 2004-2006, ebenfalls sehr gut. Speziell der Bankensektor
25
konnte nach der Konsolidierungsphase zu Beginn des ersten Jahrzehnts des
21ten Jahrhunderts recht positive Nahrichten verbreiten. Die Gewinnentwicklung der Commerzbank darf man insoweit hervorheben. Doch muss man,
will man einen Vergleich zur Deutschen Bank vornehmen, auch feststellen, dass
die Commerzbank tatsächlich von sehr weit unten antrat, während die Deutsche
Bank sich bereits auf einem vergleichsweise günstigen Ausgangsniveau befand.
In den Fällen, in denen ein Umschwung überhaupt gelingt, wird aber ein in der
Krise befindliches Unternehmen besonders starke Gewinnsteigerungen
aufweisen: Wenn es aus der Verlustzone in die positive Zone und dann weiter
geht, sind die prozentualen Steigerungen naturgemäß besonders hoch. Insoweit
sind die Fälle der Deutschen Bank und der Commerzbank nicht vergleichbar.
Eine vergleichsweise prozentual höhere Verbesserung bestimmter Erfolgsparameter der Commerzbank darf nicht überbewertet werden.
Man kann der Deutschen Bank insgesamt bescheinigen, dass sie in den letzten
Jahren auch Branchenvergleich sehr erfolgreich war. Mit Bezug auf zukünftige
Erwartungen scheint sie sich überdies in einer günstigen Volatilitäts- und
Risikosituation zu befinden. Es handelt sich beim Erreichten also vermutlich um
eine nachhaltige Verbesserung und zwar selbst dann, wenn man die günstige
Ertragssituation bestimmter Unternehmensteile nicht einfach in die Zukunft
fortschreiben will.
Schwer vermittelbar für eine breitere Öffentlichkeit war es, dass die Deutsche
Bank ungeachtet der skizzierten grundlegend positiven Entwicklung
Entlassungen in größerem Umfang vornahm. Die öffentliche Meinung empörte
sich ziemlich stark darüber, dass auf ein und derselben Hauptversammlung
positive wirtschaftliche Ergebnisse berichtet und Entlassungen angekündigt
wurden. Dabei war die Berichterstattung in der veröffentlichten Meinung
allerdings wenig ausgewogen. Es wurde kaum darüber berichtet, dass viele der
Entlassungen mit Umstrukturierungen innerhalb der Bank zu tun hatten. Zum
einen ließ die konjunkturelle Lage zu der Zeit, als die Entlassungen vollzogen
wurden, keine Besserung des allgemeinen wirtschaftlichen Klimas erwarten.
Zum anderen wurde keineswegs hinreichend bedacht, dass viele Entlassungen
im Ausland und zudem in Geschäftsbereichen stattfanden, die zuvor eher zu
stark ausgebaut worden beziehungsweise aufgrund von Zukäufen überbesetzt
waren. Zwar waren die entsprechenden personellen Überkapazitäten für die
Bank gewiss nicht unmittelbar existenzbedrohend, doch hätten sie bei weiterem
Zuwarten zumindest zu einer Unterbewertung der Aktie geführt und das
Unternehmen womöglich zu einem Übernahmekandidaten werden lassen.
26
Wenn man im übrigen davon ausgeht, dass effizientes und vorausschauendes
Wirtschaften zu den Pflichten einer Unternehmensführung gehört, dann kann
man es ihr kaum vorwerfen, wenn sie sich von unrentablen Bereichen trennt.
Alles spricht dafür, dass es sich keineswegs um eine frivole Willküraktion
gehandelt hat, als die Deutsche Bank Entlassungen und im gleichen Atemzuge
hohe Gewinne ankündigte. Höchst scheinheilig wirkt es, wenn die gleichen
Personen, die das Thema zum Anlass orchestrierter Empörung nahmen, auf
entsprechende Vorhaltungen hin einräumten, dass es sich zwar möglicherweise
um rechtfertigungsfähige Maßnahmen handelte, dass aber das Medienmanagement der Deutschen Bank unprofessionell gewesen sei. So wechselte man vom
Vorwurf einer moralischen Verfehlung zum Vorwurf unprofessionellen schlechten Managements und zwar nicht in der Sache selbst, sondern nur mit Bezug auf
die Medien.
Kritische Medien sind im freiheitlichen Rechtsstaat von ausschlaggebender
Bedeutung. Selbst dann, wenn sie in der Berichterstattung eigene
Voreingenommenheiten zum Ausdruck bringen, können sie bei Wahrung der
Vielfalt unterschiedlicher Voreingenommenheiten ihre kritische Funktion
weiterhin erfüllen. Funktionsträgern ist auch überschießende Kritik durchaus
zuzumuten. Zugleich ist es aber Aufgabe des jeweils besser informierten Teiles
der Öffentlichkeit, nicht jeder neuen Aufgeregtheit nachzulaufen, sondern die
Stimme der Vernunft und Sachlichkeit zu erheben.
Insbesondere in notorisch emotionsgeladenen Debatten um Themen wie das der
leistungsgerechten Entlohnung, sozialer Gerechtigkeit und Gleichheit gilt es mit
Beharrlichkeit Grundtatbestände und -prinzipien einer Wettbewerbswirtschaft
immer wieder hervorzuheben. Die Diskussionen um Vorstandsgehälter, die im
Fokus des Interesses der gegenwärtigen Überlegungen stehen, bilden insoweit
keine Ausnahme.1
Wie bereits festgestellt wurde, liegen die Gehälter der Vorstände der Deutschen
Bank im Durchschnitt und in der Spitze des Vorstandsvorsitzenden deutlich
höher als in anderen deutschen Unternehmen. Es ist allerdings ebenfalls
festzuhalten, dass die Bezüge des Vorstandsvorsitzenden zum allergrößten Teil
aus Zahlungen besteht, die von bestimmten Ertragskennziffern abhängig sind.
Das feste Grundgehalt ist zwar hoch (ca. 2 Millionen Euro), doch weit entfernt
von den aufgrund eines Bonussystems gezahlten Gesamtbezügen. Der
1
Selbstverständlich kann man gegen die Wettbewerbsgesellschaft argumentieren. Ebenso kann man gegen die
den Wettbewerb stützende freiheitliche Grundordnung argumentieren, aber das ist im Rahmen der hier zugrunde
gelegten ethischen Prämissen nicht möglich. Es bleibt konkurrierenden ethischen Ansätzen vorbehalten, die
entsprechenden Auffassungen auszuarbeiten.
27
Forderung, dass die Bezüge der Führung eines Unternehmens von der
Entwicklung der wesentlichen Kennziffern für den Unternehmenserfolg abhängig sein sollen, wurde insoweit im Falle der Deutschen Bank Genüge getan.
Es scheint allerdings zweifelhaft, dass Bonuszahlungen in der tatsächlich
verfügten Höhe erforderlich sind, um (zusätzliche) Verhaltenswirkungen auf
Vorstände auszuüben. Ob Herr Ackermann nun 6 Millionen € oder 12
Millionen € verdient, dürfte vermutlich für sein Verhalten recht unerheblich
sein. Vernünftige Aktionäre und Aufsichtsräte hätten insoweit guten Grund, die
Erfolgsprämien niedriger anzusetzen bzw. eine niedrigere Skala zu benutzen.
Dem könnte jedoch entgegenstehen, dass andere Beschäftigte der Deutschen
Bank, die im Investmentbereich selbst unter heutigen Bedingungen mehr als
Herr Ackermann verdienen, dann das Vielfache des Vorsitzenden der Deutschen
Bank erhalten würden. Das schiene zumindest merkwürdig. Überdies wäre zu
bedenken, welche Angebote Spitzenkräften aus dem Bereich der Deutschen
Bank von außen gemacht werden könnten, wenn man das Gehaltsniveau massiv
nach unten skalieren würde. Denn klarerweise würden die anderen
Vorstandsmitglieder weniger verdienen müssen als Herr Ackermann und die
darunter liegenden Etagen müssten entsprechend herabgestuft werden. Doch
selbst dafür gäbe es vermutlich einen Spielraum. Und dieser Spielraum besteht
auch in anderen Unternehmen angesichts der gewöhnlich exorbitanten
Einkommensunterschiede zwischen Vorständen und der jeweils nächsten
Führungsebene unterhalb des Vorstands.
Damit erhebt sich ganz generell die Frage, warum Vorstandsgehälter
allenthalben in solche Höhen gestiegen sind, wie wir es de facto beobachten.
Wenn man als Ökonom davon überzeugt ist, dass Wettbewerbsmärkte
grundsätzlich in Richtung auf effiziente Anpassungen der auf ihnen tätigen
Akteure hinwirken, dann stellt sich die Frage nach einem möglichen
„Effizienzgrund“ für die Steigerung von Vorstandsgehältern. Erst dann, wenn
man diese Frage beantwortet hat, kann man zu einer ethischen Beurteilung
kommen, die allen Gesichtspunkten, die für die normative Beurteilung von
Vorstandsgehältern relevant sind, auch nur annähernd gerecht werden kann.
Sollte man zu dem Ergebnis kommen, dass es keinerlei einsichtige
Effizienzgründe für die hohen Vorstandsgehälter gibt, dann gäbe es einen
einsichtigen Spielraum und wohl auch gute Gründe dafür, die Gehälter etwa
durch Satzungen im Unternehmen zu begrenzen.
Man könnte sogar an gesetzliche Normen denken wollen, um die Höhe der
Vorstandsgehälter in Unternehmen generell begrenzen zu können. Zumindest
28
wären solche Erwägungen nicht so vollkommen unvernünftig wie im Falle von
Effizienzverlusten.
Zwar
sprächen
grundlegende
ordnungspolitische
Erwägungen, an denen die überzeugten Anhänger einer freien Ordnung
aufgrund ihrer moralischen Grundüberzeugungen festhalten würden, immer
noch gegen gesetzliche Eingriffe in die Vertragsautonomie von Unternehmen
und der in ihnen tätigen Vorstände. Aber man könnte unter anderem auf das
Organisationsproblem von Kleinaktionären, die eine Begrenzung wünschen,
aber aufgrund von Transaktionskosten nicht durchsetzen können, verweisen.
Warum die Kleinaktionäre ihre diesbezüglichen Präferenzen nicht durch den
bevorzugten Ankauf von Aktien solcher Unternehmen, die geringere
Vorstandsgehälter zahlen, ausdrücken könnten, bleibt zwar unerfindlich, doch
kann man ein Organisationsproblem in Unternehmen mit Streubesitz durchaus
anerkennen.
Ganz abgesehen davon, ist wirtschaftsethisch anzuerkennen, dass auf
Vertragsfreiheit hinauslaufende ordnungspolitische Vorstellungen einfach
deshalb schon einen schweren Stand haben, weil die Prinzipien individueller
Entscheidungsautonomie in der ethischen Beurteilung des Wirtschaftens einen
schweren Stand haben. Die meisten Menschen unserer Gesellschaft teilen zwar
Normen und Ideale wechselseitigen Respekts in bestimmten Lebensbereichen.
Sie denken aber letztlich nicht über die Wirtschaftsordnung in solchen
Kategorien nach. Sie erscheint ihnen nicht in dem einleitend vorgeschlagenen
Sinne als eine Fahrordnung für den Verkehr zwischen Menschen, die alle ihre
eigenen Ziele verfolgen, sondern als einen Prozess gemeinsamer Zielverfolgung.
Es sind nicht viele Einzelindividuen, die in freien Verträgen ihr Handeln
koordinieren, um ihre unterschiedlichen persönlichen Ziele zu fördern. Es ist
vielmehr, so, dass „wir“ als Gesellschaft in den Augen der meisten Bürger
gemeinsam wirtschaften und gemeinsame Ziele der Wohlstandsmehrung
verfolgen. Wenn es um die Ethik des Wirtschaftens geht, sind die meisten
Bürger Anhänger gemeinwirtschaftlicher Ideale. Sie sind in diesem Sinne
„Sozialisten“, ohne dass ihnen das bewusst sein müsste und sie es vielleicht
sogar als beleidigende Unterstellung ansehen würden, als Sozialisten qualifiziert
zu werden.
Das mag man bedauern, doch hat man es gerade als jemand, der die Autonomie
anderer respektiert, zunächst anzuerkennen. Erkennt man an, dass die sozialen
Präferenzen großer Teile der Bürgerschaft der Politik nicht nur eine
Verantwortung für den steuerlichen Ausgleich der Einkommensverteilung
zuerkennen, sondern auch einkommensausgleichende Aufgaben außerhalb der
Steuerpolitik zuschreiben, dann spräche insoweit etwas für gesetzliche
29
Regulierungen von Vorstandsgehältern. Wenn deren Höhe keine wesentlichen
Auswirkungen auf die Effizienz des Wirtschaftens haben sollte, könnte man sich
wirtschaftlich vielleicht entsprechende Regelungen leisten. Regelungen, die eine
„zu starke“ Ungleichheit des Einkommensniveaus in Unternehmen begrenzen,
würden unter solchen Voraussetzungen geringe gesellschaftliche Kosten in
Form weniger effizienter Ressourcen-Allokation aufweisen und zugleich den
Wünschen einer breiten Öffentlichkeit entgegenkommen. Das Gemeinschaftsgefühl in der Gesellschaft würde gestärkt. Der soziale Friede würde symbolisch
gefördert und auf diese Weise ein wesentlicher positiver und produktiver
Standortfaktor ordnungspolitisch unterstützt.
Da zuvor bereits festgestellt wurde, dass eine zusätzliche Steuerungswirkung
von einer Hochskalierung der Bonussysteme im Falle von Vorstandsgehältern
ab einer gewissen Höhe der Bezüge nicht plausibel ist, scheint, jedenfalls im
Rahmen einer anreizbasierten (principal-agent) Konzeption von der
Unternehmenssteuerung das zentrale Argument für hohe Bonuszahlungen zu
entfallen. Allokationsentscheidungen der Vorstände mögen zwar auch von den
erwarteten Prämien motiviert werden. Sie mögen sich auch in Erwartung von
Geldzahlungen besonders anstrengen. Aber es ist einfach unplausibel, dass ein
Vorstand bei Erwartung von zusätzlichen Gratifikationen in Höhe von, sagen
wir 100.000 €, wesentlich anders entscheiden würde als in der Erwartung von,
sagen wir 200.000 €. Unterschiedliche Erfolgsprämien bei unterschiedlichem
Erfolg kann man auch auf niedrigerem Skalenniveau zahlen. Dafür, dass die
Unterschiedlichkeit so hochskaliert wird, wie das gegenwärtig zu beobachten ist,
gibt es bei Zugrundelegung einer plausiblen Motivationspsychologie zunächst
keinen einsichtigen effizienzbezogenen Grund. Zwar sollten diejenigen, die
höhere Gewinne mit einem Unternehmen erzielen, deshalb höhere Einkommen
haben, doch ist nicht zwingend erforderlich, dass die Einkommen eine
bestimmte absolute Höhe übertreffen müssten.
Um wieder an das Beispiel der Bezahlung von Herrn Ackermann anzuschließen,
so hat es gewiss eine Wirkung auf Herrn Ackermann, ob er bei höheren
Gewinnen mehr verdient und bei niedrigeren Gewinnen weniger als die
jeweilige Vergleichsbasis. Die Erfolgssignale, die sich unmittelbar auf sein
eigenes Einkommen und auch auf seinen Status auswirken, werden ihn dazu
bringen, soweit das durch Anreizstrukturen überhaupt erreicht werden kann,
vernünftige Allokationsentscheidungen im Sinne des Unternehmens zu treffen.
Wenn es aber für ein Unternehmen möglich ist, durch geringere Anreize, die
gleichen Allokationswirkungen zu erzielen wie durch hochskalierte
Anreizsysteme (zum Beispiel um den Faktor zwei), dann gebietet die allokative
30
Effizienz selbst, das Anreizsystem zu wählen, welches für das Unternehmen
preiswerter ist. Insoweit sprechen unternehmensbezogene Effizienzerwägungen
zumindest auf den ersten Blick nicht nur nicht dagegen, sondern im Gegenteil
dafür, Vorstandsbezüge in der Höhe, wie sie gegenwärtig für Vorstände der
Deutschen Bank gewährt werden, abzubauen.
Man hat, sollten die vorangehenden Überlegungen zutreffen, als Aktionär einen
prima facie Grund, Zahlungen der beobachtbaren Höhe für eine Verschwendung
und damit für ineffizient zu halten. Vor diesem Hintergrund sollte man ceteris
paribus Aktien von Unternehmen kaufen, die geringere Vorstandsgehälter
zahlen. Auch die Finanzinvestoren sollten entsprechende Entscheidungen treffen.
Eine solche Bestrafung „exzessiver“ Vorstandsbezüge findet auf den
Finanzmärkten aber offenkundig nicht statt.
Das könnte an der Internationalisierung der Wirtschaft und der relativen
Marktführerschaft US-amerikanischer Unternehmen auch auf den Märkten für
Humankapital liegen. Es wäre dann immer noch zu erklären, warum die US
Entwicklung so verlaufen ist, wie wir das beobachten konnten, aber es wäre
möglich, dass es sich um eine von Merkwürdigkeiten der US-Rechtsordnung
induzierte Sonderentwicklung handelt, die auf das Ausland abgestrahlt hat. Man
hätte es mit einer US „Gehalts-Bubble“ zu tun, die auf die Welt abstrahlte.
Wenn das so wäre, dann würde womöglich die Gefahr der Abwerbung in die
USA ausländische Unternehmen dazu zwingen, ihre Vorstandsgehälter zu
erhöhen, selbst dann, wenn sie nicht in den USA tätig sind. Die relative Stellung
von Vorständen und die relative Höhe von deren Gehältern zu Verdienstmöglichkeiten etwa als Fondsmanager oder Einzelunternehmer könnte angesichts der Öffnung von Kapitalmärkten und anderen Märkten ebenfalls eine
Rolle spielen.
Die Konkurrenz um Humankapital könnte die Erhöhung der Vorstandsgehälter
auch in deutschen Unternehmen erzwingen. Nun scheint die Konkurrenz auf
Märkten für Humankapital tatsächlich in hohem Maße die jeweils besten Talente
in bestimmten Sektoren – oder doch zumindest diejenigen, die für die besten
Talente gehalten werden – zu begünstigen. Zur gleichen Zeit erscheint es jedoch
als eher unplausibel, dass die vorgenannten Faktoren allein ausreichend sein
könnten, um Vorstandsgehälter in der heutigen Höhe zu erklären. Die
Auffassung, dass diese rund um die Welt aufgrund einer Zufälligkeit der
Entwicklung ohne systematische, wettbewerbsbedingte Gründe in dem
beobachtbaren Maße gestiegen seien, ist unplausibel. Es hätten sich in jedem
Falle Unternehmen herausbilden beziehungsweise Länder der westlichen
31
entwickelten Welt zeigen müssen, in denen die Entwicklung grundsätzlich
anders verlaufen wäre. Das scheint jedoch nicht der Fall zu sein. Und auch die
Steuersysteme sind fast überall im Spitzensteuersatz zurückgefahren worden.2
Die Frage nach einer angemessenen Erklärung für die Höhe heutiger
Vorstandsgehälter muss man als offen betrachten. Die vorangehenden Faktoren
erklären vielleicht bestimmte Effekte und Aspekte. Andere Faktoren wie etwa
der Aufstieg der großen institutionellen Anleger wie etwa der Hedge Fonds
wurden nur gestreift. Eine umfassende und vollständige Erklärung wird mit
Sicherheit zusätzliche Faktoren einbeziehen müssen. Solange wir diese nicht
gefunden haben, haben wir weder ein Überlegungsgleichgewicht erreicht, noch
sollten wir uns in unseren Bewertungen sicher fühlen. Denn es ist keineswegs so,
dass wir in allen Bereichen unseren Wert-Intuitionen einfach folgen würden,
ohne uns davon beeinflussen zu lassen, aufgrund welcher Faktoren beispielsweise bestimmte Einkommens Verteilungen zustande gekommen sind. Es ist
eine ganz wesentliche Einsicht, dass wir uns in Bereichen, in denen wir über die
Ursachenzusammenhänge allenfalls oberflächlich informiert sind, vernünftigerweise auch in unseren Bewertungen und darauf gestützten Politikvorstellungen
zurückhalten sollten. Man kann allerdings nicht behaupten, dass diese Art von
Vernunft besonders weit verbreitet sei.
Wenn man sich dennoch mit Politikvorschlägen befassen, so muss man eine
Vielzahl potentieller Erklärungen zumindest in Erwägung ziehen, bevor man
sich guten Gewissens für eine Intervention entscheiden darf. Ein potentieller
Erklärungsfaktor könnte beispielsweise darin bestehen, dass große Unternehmen
wesentlich davon abhängen, dass es ihnen gelingt, auf motivationaler Ebene das
tribale Erbe des Menschen zu mobilisieren. Jedes große Unternehmen ist ein
Stammesverband mit vielen Unterstämmen. Der Stamm bietet Gemeinschaftserlebnisse, die „dem Flüstern in uns“ entgegenkommen. Nicht nur das Gefühl
der Zugehörigkeit, sondern vor allem auch das Interesse an einer herausgehobenen Position im Stamm und damit das Interesse an der Erlangung eines so
genannten positionalen Gutes dürften bei den meisten Menschen auch in der
heutigen Zeit hochgradig verhaltenswirksam sein.
Das Interesse an positionalen Gütern scheint in der menschlichen Natur fest
verankert zu sein. Doch der wachsende Reichtum unsere Gesellschaften
verstärkt diesen Effekt noch. Menschen sollten nach ökonomischer Logik
nämlich an positionalen Gütern umso stärker interessiert sein, desto besser es
2
Es sei nochmals betont, dass die Wirtschaftsweise der amerikanischen Unternehmen hier zwar eine Rolle
spielen mag, doch bestimmt nicht allein ausschlaggebend sein kann.
32
ihnen materiell geht (vgl. zu diesem Argument Fred Hirshs etwa Frank, R.
(1985)). Denn wenn man an beiden Arten von Gütern, den materiellen und den
positionalen interessiert ist und die Versorgung mit den materiellen Gütern
anwächst, dann sollte der Grenznutzen zusätzlicher Einheiten materieller Güter
relativ zu den positionalen Gütern sinken. Der größere Reichtum an vermehrbaren Gütern in der Gesellschaft verstärkt die Nachfrage nach unvermehrbaren
positionalen Gütern.
Wenn man nicht genug zu essen hat, geht es zunächst einmal darum, genug
Nahrungsmittel zu bekommen. Ob man in der eigenen Gruppe einen hohen
Status hat oder nicht, ist nur insoweit bedeutsam, als der Status zur Beschaffung
der Nahrungsmittel beitragen kann. Statusbedürfnisse werden von dem Wunsch,
die Grundbedürfnisse zu befriedigen, insoweit also unterstützt, als in
menschlichen Populationen hoher Status auch die Chance zur Befriedigung der
Grundbedürfnisse erhöht. Das Statusstreben ist in armen Gesellschaften gewiss
dem Ziel der Überlebenssicherung nachgeordnet. In reichen Gesellschaften, in
denen die materiellen Grundbedürfnisse ohnehin befriedigt sind, bleibt aber das
ursprüngliche Streben nach Status bestehen. Biologisch sind wir auf diesen
Zustand nicht gut vorbereitet und agieren deshalb emotional nach wie vor so wie
in Stammesumgebungen.
Status wird in lokalen Hierarchien keineswegs nur durch Einkommen verliehen. Positionale Güter können vielmehr nach vielfältigen Kriterien vergeben
werden. Die starke Korrelation mit dem monetären Einkommen, die wir heute
beobachten, ist insoweit nicht zwingend. Es ist aber so, dass die Öffnung von
Konkurrenzmärkten für Humankapital, auf eine Stärkung der Rolle des
Einkommens bei der Statuszuteilung hinausläuft. Andererseits legt die
ökonomische Logik es nahe, dass Individuen für hohen Status, der nicht nur aus
Einkommen resultiert, bereit sind, Gehaltsabschläge hinzunehmen. Lokale
Hierarchien bieten solche herausgehobenen „Stammespositionen“ bestimmten
hoch qualifizierten Individuen. Firmen können sich das zu Nutze machen, indem
sie positionale Entlohnung statt monetärer vergeben. Wäre das so, müsste
allerdings das Einkommen von Vorständen erst recht verwundern. Denn sie
werden ja schon durch nicht-monetäre Statusgüter belohnt
Der eigentlich entscheidende Faktor der Zahlungen für Vorstände liegt
womöglich nicht in der Wirkung auf diejenigen, die bereits Vorstände sind.
Denn das Unternehmen ist nicht nur ein Stamm mit vielen Unterstämmen. Es ist
auch ein Stamm, in dem Turniere stattfinden. Die Auslobung hoher Preise für
Erlangung der Spitzenpositionen regt den Wettkampf im Turnier an. Es geht um
33
eine Intensivierung des Strebens all jener, die sich (noch) nicht in den höchsten
Positionen befinden, doch sich noch Hoffnung darauf machen können, solche
Positionen einmal zu erlangen. So wie der Jackpot die Phantasie der Menschen
anregt, sich – aus Sicht der materialen Gewinnaussichten – irrationaler Weise
zusätzliche Lottoscheine zuzulegen, so wird das Streben gerade der
entscheidenden jüngeren Führungseliten in einem Unternehmen durch die
großen Siegprämien im unternehmensinternen Turnier angeregt. Zusätzlich wird
die Loyalität zum Unternehmen gestärkt werden, wenn der Jackpot gerade
dieses Unternehmens besonders groß ist.
Um, soweit das überhaupt nötig sein sollte, anschaulicher zu machen, worum es
geht, ist es vermutlich sinnvoll, zunächst einmal auf andere Bereiche zu schauen.
Im Sport erkennen wir ganz ähnliche Phänomene. Da nur einer Weltmeister sein
kann, müssen sich alle ganz besonders anstrengen, in diese ausgezeichnete
Position zu gelangen. Die man allenthalben beobachten kann, steigt das
Leistungsniveau gewöhnlich auf breiter Front an. Am Ende ist jedoch immer nur
einer Weltmeister. Die Öffentlichkeit sieht nur jene, die es bis an die Spitze
geschafft haben. Kinder träumen davon, einmal Olympiasieger zu sein. Darüber
gerät das Heer derer in Vergessenheit, die ursprünglich zu dem Wettrennen
angetreten waren, doch unterwegs ausschieden. Von denen träumt kein Kind
und wenige nicht-betroffene Erwachsene gedenken ihrer.
Dem Profi-Sportler, der es geschafft hat, sieht man nicht mehr an, dass vielleicht
nur wenig fehlte und er hätte es nicht geschafft. Es gibt immer sehr viele, die nur
wenig geringer leistungsfähig sind und sich ebenso sehr wie der Erfolgreiche,
doch vergeblich anstrengten. In einem typischen Turnier, haben sich alle
verstärkt angestrengt, um am Ende zu den Besten zu gehören. Je größer die
Turniere, die einen einzelnen Sieger ermitteln, umso mehr Individuen strengen
sich vergeblich an. Denn aus analytischen Gründen kann immer nur einer der
erste sein. Aus gleichen Gründen bleibt das oberste Prozent das oberste Prozent,
gleichgültig wie hoch die absoluten Niveaus skaliert wurden.
Das Leistungsniveau hat sich im Leistungssport nicht nur in der Spitze, sondern
vor allem auch in der Breite stark angehoben. Auch die Trainingsintensität hat
sich auf breiter Front vergrößert. Das ist in vielen Sportarten eindeutig
erkennbar. Was den Sport anbelangt, hat man vermutlich einen guten Grund,
den fortwährenden Rüstungswettlauf zwischen denen, die für ihn die besten
Jahre ihres Lebens verschwenden, zu begrenzen. Hier könnte es durchaus
ethische Erwägung geben, die Spielregeln in einer konkurrenzmindernden
Weise festzulegen. Die Frage ist, ob sich das Argument auch auf
34
Vorstandbezüge übertragen ließe, um eine Verschwendung durch unproduktive
Statuskonkurrenz zu vermeiden.
Zur Beantwortung dieser Frage trägt es womöglich bei, zunächst einen Blick auf
die Ganoven und deren Organisationsformen zu werfen. Die Gangster sind, wie
einer der größten Philosophen des 20-ten Jahrhunderts, John Mackie (vgl.
Mackie, J. L. (1985)) bemerkte, ohnehin die besten Lehrer, wenn es um die
soziale Rolle von Moralsystemen geht. Denn angesichts des Fehlens staatlicher
Unterstützung muss die Ganovenehre und Ganovenmoral für den Zusammenhalt
und die Kooperation sorgen (natürlich auch mit Unterstützung unseres tribalen
Erbes).
Die in vielen Hinsichten aufschlussreiche Branche des illegalen Drogenhandels
bietet mit Bezug auf den im gegenwärtigen Kontext besonders interessierenden
Turniercharakter von organisationsinternen Wettbewerben besonders
aufschlussreiches Anschauungsmaterial. Wie Steven Levitt in seinem gar nicht
so „freakigen“ Buch „freakonomics“ (vgl. Levitt, S. and S. J. Dubner (2006))
schildert, geht es den meisten kleinen Drogenhändlern im Crack-Trade sehr
schlecht. Sie sind bereit, für Hungerlöhne die Risiken der Illegalität auf sich zu
nehmen. Sie könnten durch legale Arbeit häufig leicht mehr verdienen, als im
Crack-Trade, ohne Gefahr zu laufen, ins Gefängnis zu kommen oder von
konkurrierenden Banden verletzt oder gar erschossen zu werden.
Tatsächlich ist es so, dass jene Drogenhändler, die den Aufstieg in der
Hierarchie nicht schaffen, nach wenigen Jahren ausscheiden – wenn sie die
frühen Jahre ihrer Karriere überlebt haben und ggf. aus dem Gefängnis heraus
sind – und dann in legalen Tätigkeiten mehr verdienen als zuvor. So weit geht
die Ganovenehre nicht, dass nicht die Ganoven legale Tätigkeiten illegalen
grundsätzlich bei ähnlichen Verdienstmöglichkeiten vorziehen würden.
Die Erklärung dafür, warum sich Kleindealer dennoch im Zuge einer
Selbstausbeutung freiwillig für Hungerlöhne in der Drogenszene engagieren,
liegt nach Levitt darin, dass alle unteren Chargen für eine Weile darauf hoffen
dürfen, einer der Glücklichen zu sein, die es bis an die Spitze schaffen. Die
extremen Einkünfte an der Spitze der Drogenhändlerpyramide motivieren alle
unteren Stufen dazu, „überhöhten“ Einsatz zu zeigen. Alle hoffen darauf, das
große Los in der Lotterie des Drogenhandels zu ziehen. Wie beim Lotto ist die
Hoffnung auf den Gewinn des Turniers insgesamt nicht mit rationalen
Erwartungen vereinbar, doch verhaltenswirksam.
35
Die Analogien zu dem hier interessierenden legalen Tätigkeitsbereich scheinen
offenkundig. In ähnlicher Weise wie im Crack-Trade hat womöglich die
Aussicht auf die großen Vorstandsgehälter in Unternehmen eine Anreizwirkung,
die der Turnierwirkung im Leistungssport und in der Drogenszene vergleichbar
ist. Die Unternehmen können dadurch auf eine letztlich überzogene
Selbstausbeutung ihrer befähigsten jungen Kräfte hoffen. Da diese für den
Unternehmenserfolg letztlich ausschlaggebend sind, darf man diese Wirkung
unternehmensinterner Turniere mit hohen Prämien nicht unterschätzen. Diese
Turniere entfalten ihre Anreize sowohl auf der Basis der materiellen
Wohlstands-Wirkungen als auch der immateriellen positionalen Auswirkungen
erfolgreichen Abschneidens. Die Mitarbeiter werden zu übergroßen
Anstrengungen motiviert. Erfolgreiche Unternehmen leben insofern
möglicherweise von einer sozial ineffizienten Überinvestition ihrer Mitarbeiter.
Der in gewisser Weise „zu hohe“ Humankapitaleinsatz durch die Mitarbeiter
findet sich aufgrund der Konkurrenz zwischen den Unternehmen praktisch in
allen Unternehmungen. Da die anderen Unternehmen sich „auf die
Zehen“ stellen, muss jedes sich auf die Zehen stellen. Dies erfordert aber, dass
sich die Mitarbeiter „auf die Zehen“ stellen müssen. Man induziert das
womöglich am preiswertesten durch die große Prämie an der Spitze der
Einkommenshierarchie. Da sich diejenigen mit Aufstiegshoffnung vermehrt
anstrengen, müssen die anderen es auch tun. Alle werden mitgerissen. Die
Auslobung eines insgesamt für jedes Einzelunternehmen recht kleinen Preises
hat große multiplikative Wirkungen (es kommt zu einer work ethic ohne
ethische Motivation im engeren Sinne vgl. zur work ethic Buchanan, J. M.
(1999)).
Wieweit man die von unternehmensinternen Turnieren erzeugten Verhaltenswirkungen selbst für ethisch akzeptabel hält, ist eine weitere Frage. Um im Bilde
zu bleiben, sieht dann, wenn sich alle auf die Zehen stellen, am Ende keiner
besser. Insoweit wären die Anstrengungen letztlich vergeblich. Doch es kommt
insgesamt zu besseren Leistungen. Anders als im Sport und in der Drogenszene
bringen die Leistungen in und durch Unternehmen aber vermutlich für die
Allgemeinheit einen beachtlichen zusätzlichen Nutzen in Form verbesserter
Dienstleistungen und Produkte. Die für die Turnierbeteiligten direkt
unproduktiven Investitionen sind für die Gesellschaft insgesamt voraussichtlich
produktiv. Insoweit das wirklich der Fall ist, gibt es gute Effizienzgründe dafür,
die entsprechenden Anreize und Anstrengungen zuzulassen. Offen ist allerdings
die Frage, ob insgesamt die Wohlfahrtsteigerungen der Allgemeinheit die
Einbußen bei denen, die sich übermäßig anstrengen, aufwiegen. Da sich alle
36
freiwillig in die betreffende Situation begeben, sollte man darin jedoch innerhalb
einer liberalen wirtschaftsethischen Grundposition, die vom Respekt für die
autonomen Entscheidungen auch der Selbstausbeuter getragen wird, kein
größeres ethisches Problem erblicken.
Ob die hohen Vorstandsgehälter tatsächlich die ihnen in der vorangehenden
Erklärungsskizze zugeschriebenen Wirkungen haben, bedarf selbstverständlich
weiterer Prüfungen. Für den gegenwärtigen Zusammenhang machen die Überlegungen jedoch klar, wie wichtig es ist, in wirtschaftsethischen Erwägungen der
normativen Analyse und der ethischen Bewertung eine klare Faktenanalyse oder
eine Sichtung potentieller Erklärungen vorausgehen zu lassen.
Dabei will das vorangehende Argument mit seiner eher ungewöhnlichen
ökonomischen Erklärungsskizze für die Einsicht werben, dass gerade auch in
wirtschaftsethischen Kontexten nicht nur wie in der herkömmlichen Ethik
gedacht werden sollte. Diejenigen, die Wirtschaftsethik betreiben, sollten sich
davor hüten, den für den Ökonomen typischen Blick auf die soziale Realität zu
vernachlässigen. Empirisch muss insbesondere das Modell des Homo
oeconomicus keineswegs immer zutreffen (wie unten noch argumentiert werden
wird, scheint eher das Gegenteil der Fall zu sein). Menschen sind de facto nicht
nur an materiellen Gütern, sondern beispielsweise auch an der Verteilung von
Gütern interessiert (wie vorgeführt ihm positionalen Sinne, aber auch etwa im
Sinne der Gerechtigkeit). Darüber darf man jedoch nicht vergessen, dass in
einem wirtschaftsethischen Kontext, wie das vorangehende Beispiel illustriert,
im engeren Sinne ökonomisches Denken neue Perspektiven eröffnen kann (und
sei es nur als Kontrast).
Sollte an dem vorangehenden Argument etwas sein, dann hat man selbst als
Befürworter gesellschaftlicher Egalität unter Umständen einen guten Grund,
hohe Vorstandsgehälter im Namen der Wohlstandsmehrung für alle
hinzunehmen. Der klassische „trade off“ zwischen Effizienz und Gerechtigkeit
wäre auch mit Bezug auf Vorstandsgehälter und deren Höhe anzutreffen,
obwohl ein solcher trade-off bei einer ersten Betrachtung nicht erkennbar ist.
Verkennt man aber den Preis der Egalität, dann bezahlt man unter Umständen
für die Realisierung der ethischen Ideale mehr an Effizienzverlust als man
eigentlich gewillt ist, dafür aufzugeben.3
3
Bezüge zu der später noch diskutierten Auffassung von Rawls, dass Ungleichheiten, die den schlechter
Gestellten nützen, erlaubt sein sollen, sind offenkundig.
37
Letztlich wird auch der Turniercharakter des unternehmensinternen
Wettbewerbs allein nicht erklären können, wie es tatsächlich zu der auf breiter
Front beobachteten Erhöhung der Vorstandsgehälter kam. Diese sind
insbesondere bestimmt nicht eingeführt worden, um Turniere einzurichten. Hier
dürften vermutlich Kapitalmärkte und die Bedürfnisse von Pensionsfonds und
ähnlichen Investoren eine größere Rolle gespielt haben. Die Erhöhung der
Vorstandsgehälter ergab sich als um intendierte Nebenfolge anders motivierter
Verhaltensweisen.
1.2. Primär normative Überlegungen oft
Immer wieder wird mit dem Argument von der leistungsgerechten Entlohnung
argumentiert. Dahinter stehen alte Vorstellungen vom gerechten Preis und vom
moralischen Verdienst, das sich mit ehrlicher Arbeit verbindet. Überdies geht es
wie im Falle des positionalen Denkens um die Verteilung von Gütern in einem
Stamm. Aus einer gemeinschaftlichen oder Wir-Perspektive heraus wird einer
Referenzgruppe eine einheitliche Zielsetzung und eine Entlohnung mit Bezug
auf den Beitrag zum Ziel unterstellt. Der Preis insbesondere für Arbeitsleistungen ist nicht einfach das, was andere zu zahlen bereit sind. Es gibt vielmehr
einen angemessenen, gerechten oder wahren Preis, der mit Leistung, Verdienst
und Anstrengung in der Verfolgung gemeinsamer Ziele verbunden ist.
Solche häufig religiös eingefärbten Vorstellungen werden in Deutschland gern
auch von Kreisen vorgebracht, die sich für Befürworter der freien Marktwirtschaft halten. Der Slogan „Leistung muss sich wieder lohnen!“, wurde von den
Christdemokraten gegen die Sozialdemokratie benutzt, um deren marktfeindliche Einstellungen zu diskreditieren. Daran, dass die Einstellungen der Sozialdemokratie zur fraglichen Zeit zumindest nicht marktfreundlich waren, besteht
nach allgemeiner Auffassung und auch der Selbstwahrnehmung der Sozialdemokraten wenig Zweifel. Jene, die ihnen den erwähnten Slogan entgegenhielten, befanden sich jedoch im Zustand der Selbsttäuschung, wenn sie sich
damit als Verteidiger freier Marktwirtschaft und der ihr zugrunde liegenden
Vorstellung autonomer Vertragsgestaltung begriffen. Auffassungen vom
leistungs- im Gegensatz zum marktgerechten Lohn sind im Kontext einer
modernen Marktwirtschaft nämlich als höchst fragwürdig einzuschätzen. Denn
wenn es wirklich um subjektive Leistung und Anstrengung ginge, dann dürfte
manche Medienberühmtheit mit höchstem Einkommen fast nichts verdienen,
während ein ehrlicher Müllwerker sehr hoch in der Einkommenspyramide
38
stehen müsste. Vorstände würden insoweit vermutlich irgendwo in der Mitte
zwischen diesen Extremen stehen.
Die Forderung, dass sich Leistung lohnen müsse, ist im Kern marktfeindlich.
Denn auf einem Markt lohnt sich nicht die Leistung als solche, sondern das
Angebot dessen, was die Nachfrager wünschen. Ob man das, was die
Nachfrager wünschen, durch Anstrengung oder ohne Anstrengung bereitstellen
kann, spielt keine Rolle für den Marktpreis. Der Witz an einer freien
Marktwirtschaft ist es gerade, dass sie den Anbieter von Leistungen zu Gunsten
des Nachfragers zu entmachten sucht. Was eine „Leistung“ ist, die sich lohnt,
bestimmt der Nachfrage nicht der Anbieter.
Der Markt ist, wie die Freiburger Schule der deutschen Ordnungstheorie immer
betonte, eine Entmachtungsinstrument. 4 Ist er das nicht, dann haben wir es
typischerweise mit einem Marktversagen zu tun. Gegen Macht haben die
meisten von uns etwas. Deshalb ist es auch ein gutes Werbeargument für den
Markt, wenn man die ihm zugeschriebene Entmachtungswirkung tatsächlich
plausibel machen kann. Wann immer das gelingt, wachsen dem Markt und der
Konkurrenz moralische Legitimität zu. Die Entmachtungswirkung des Marktes
geht aber so weit, dass er Angebote generell unabhängig davon bewertet, wie
diese Angebote moralisch zu Stande kamen. Der arme behinderte Arbeiter, der
zur Ernährung seiner Familie in einem Dritte-Welt Land 50 Paar Schuhsohlen
am Tag unter die Sportschuhe heften kann, erhält ungeachtet seiner schier
unmenschlichen Anstrengung dafür nicht mehr, als der junge extrem geschickte
Kleber von Schuhsohlen, der es mit Leichtigkeit auf 500 Paar Schuhsohlen pro
Tag und in dem Dritte-Welt Land zu gemessen am dortigen Standard hohem
Lohn und Status bringt.
Wir in der ersten Welt zahlen für die Schuhe uniforme Preise und nicht für die
dahinter stehenden Leistungen unterschiedlich. Wir sorgen insoweit gerade nicht
dafür, dass nach Leistung bezahlt wird. Zwar gibt es auch Konsumenten, die
bereit sind, für Produkte von Behindertenwerkstätten mehr zu zahlen als für
andere Produkte. Die Bewertung auf dem Markt erfolgt jedoch generell nicht in
dieser Weise. Sie ist gerade unabhängig von der Bewertung der moralischen
Qualitäten des Bereitstellers oder der Bereitstellung von Dienstleistungen und
Gütern.
4
Deren zentrale Gründerfigur war sicher Walter Eucken heute werden entsprechende Auffassungen in Freiburg
insbesondere vom jetzigen Leiter des Walter Eucken Instituts, Viktor Vanberg vertreten. Im weiteren Umkreis
der Freiburger Schule ist im übrigen auch F.A. v. Hayek anzusiedeln.
39
Wenn die Leistungsgerechtigkeit zunächst einmal nichts mit der Bewertung von
marktgängigen Produkten zu tun hat, dann sollte auch die Bewertung der
Dienstleistungen von Vorständen nichts mit subjektiver Leistungsgerechtigkeit
zu tun haben. Natürlich kann sich niemand in der Rolle von Herrn Ackermann
so anstrengen, dass die subjektive Anstrengung die Verhundertfachung der
Bezüge gegenüber dem Einkommen von einem durchaus auch gut qualifizierten
Studienrat rechtfertigen könnte.
Herr Ackermann würde überdies vermutlich auch bei gleichem Gehalt nicht mit
dem Studienrat tauschen wollen. Der Markt gibt ein entsprechendes Studienratsgehalt ohnehin nicht her. Er zahlt nicht in diesem Sinne „leistungsgerecht“. Dass
das nicht immer eine positive Einstellung der Lehrerschaft zum Markt fördert,
ist kaum verwunderlich. Daran kann man nichts ändern. Die Befürworter freier
Marktwirtschaft sollten diese aber nicht mit den falschen Argumenten gegen die
dem Markt entgegengebrachte natürliche Skepsis verteidigen. Vor allem sollten
sie das unangemessene Moralisieren lassen. Sie unterstützen mit dem
fehlgeleiteten moralischen Argument von der Leistungsgerechtigkeit den Markt
gerade nicht. Einer im weiteren Sinne moralisch-ideologischen Unterstützung
des Marktes durch einen diesem angemessenen Gerechtigkeitssinn wirken sie
sogar auf fatale Weise entgegen. Denn indem gerade die Marktbefürworter, die
moralisch-ethische Dignität des Marktes nicht darin sehen, dass sich jeder auf
dem Markt den Bewertungen anderer zu unterwerfen und diese in diesem Sinne
zu respektieren hat, bauen sie keineswegs Marktskepsis ab. In den tatsächlich
vorhandenen wohlfahrtsfördernden und machtbegrenzenden Wirkungen des
Marktes könnte man zusätzlicher starker Argumente sehen. In der tatsächlich
gerade nicht vorhandenen Leistungsgerechtigkeit liegt die Rechtfertigung der
Marktpreise beziehungsweise der Marktpreisbildung gewiss nicht. Diejenigen,
die auf Leistungsgerechtigkeit in diesem Zusammenhang Bezug nehmen,
schießen mehr als ein Eigentor, sie unterminieren das Tor selbst. Aus Sicht einer
wohlverstandenen Wirtschaftsethik ist diese Art von Moralisieren ebenso
bedauerlich wie aus Sicht eines Individuums, das den Markt aus – wie jedenfalls
der Autor dieser Zeilen meint – einsichtigeren ethischen Gründen für
gerechtfertigt hält.
Was nun das Verhältnis von Konkurrenzmärkten und Unternehmen anbelangt,
ist allerdings eine gewisse Vorsicht angebracht. Unternehmen funktionieren
gerade in der Entlohnung ihrer Mitarbeiter auf eine Weise, die marktüblichen
Prozessen zumindest partiell entzogen ist. Im Unternehmen wirken die
Mitarbeiter zusammen, ohne dass sie über jeden Akt der Kooperation Verträge
schließen würden. Das Unternehmen verlässt sich gerade darauf, dass die
40
unternehmerisch organisierte Tätigkeit – insbesondere auch aufgrund der
erwähnten Mobilisierung des tribalen Erbes menschlicher Motivation – einer
Koordination des Wirtschaftens durch freie Marktverträge überlegen ist.
Insoweit kann man sich in dem vorangehenden Beispiel auch nicht – zumindest
nicht allein und nicht vollständig – auf das Argument von der Marktgängigkeit
der jeweiligen Leistung von Vorständen berufen. Ihre Gehälter sind vermutlich
allenfalls indirekt von der Preisbildung auf unternehmensexternen Humankapitalmärkten bestimmt. Sie stehen insoweit in einem unternehmensinternen
Vergleich. Unternehmensintern wird aber, da der Markt im Unternehmen gerade
außer Kraft gesetzt wird, nach Leistungsgerechtigkeit (Stammesgerechtigkeit)
entlohnt. Unternehmensintern könnte es daher durchaus ein Problem der
Leistungsgerechtigkeit der Entlohnung geben. Denn relativ zu den anderen
Beschäftigten des Unternehmens Deutsche Bank etwa dürfte der
Vorstandsvorsitzende
tatsächlich
bezogen
auf
seine
Leistungen
„zuviel“ verdienen.
Mit Bezug auf derartige Verteilungsfragen, wie sie sich innerhalb eines
Unternehmens stellen, ist die Leistungsgerechtigkeit nach den vorangehenden
Erwägungen sicherlich ein angemessener Maßstab. Dennoch sollte man sich
klarmachen, dass die externe Kritik an den hohen Vorstandsgehältern diesen
Maßstab gerade nicht im Auge hat. Zur gleichen Zeit scheint es so zu sein, dass
die Mitarbeiter der Deutschen Bank den betreffenden Maßstab selbst nur
beschränkt in Ansatz bringen. Sie wären diejenigen, die Grund dazu haben
könnten, entsprechende Gerechtigkeitsforderungen vorzubringen. Ihre
diesbezüglichen Einstellungen müssten vom Unternehmen auch in besonderem
Maße berücksichtigt werden. Allerdings könnten jedoch die demotivierenden
Wirkungen, die von der Disparität der Einkommen im Unternehmen ausgehen,
von den positiv motivierenden Wirkungen überkompensiert werden. Das würde
jedenfalls dann gelten, wenn die vorangehende Spekulation über den
Wettkampfcharakter der unternehmensinternen Bestrebungen um Aufstieg
zutreffen. Denn dann würde die Aussicht auf den „Jackpot“, Vorstandsgehalt,
gerade die für den Erfolg des Unternehmens besonders wichtigen hoch
motivierten jungen potentiellen Aufsteiger zu Höchstleistungen jenseits dessen
motivieren, was durch das Gehalt an sich zu erwarten wäre -- und dies würde
ihre Gerechtigkeitspräferenzen überwiegen.
Die vorangehenden Überlegungen wollen exemplarisch aufzeigen, wie
facettenreich eine angemessene wirtschaftsethische Betrachtung einer
anscheinend so einfachen Frage wie die er nach der angemessenen Höhe von
41
Vorstandsbezügen in deutschen Aktiengesellschaften ist. Dabei nimmt das
vorangehende keineswegs in Anspruch, bereits eine vollständige und
angemessene Analyse zu bieten. Es handelt sich vielmehr um eine Skizze dessen,
was in einer vollständigen und angemessenen Analyse zu untersuchen wäre.
Wenden wir uns nun in der gleichen einführenden Weise weiteren Beispielen zu,
so sollte keineswegs vergessen werden, dass die Behandlung der Beispiele nicht
den Anspruch erhebt, eine abschließende Würdigung mit ethischem Alleinvertretungsanspruch zu bieten. Es wird im Gegenteil unterstellt, dass man immer
auch mit ebenfalls vertretbaren Argumenten anderer Auffassung sein kann. Die
eine wirtschaftsethische richtige Sicht der Dinge gibt es gewiss nicht, sondern
nur weniger gut und besser vertretbare. Ein solcher ethischer Pluralismus
erkennt an, dass die eigene Position gewöhnlich nur eine von vielen möglichen
und gleich akzeptablen Auffassungen darstellt. Ein solches Anerkenntnis bringt
psychologisch vermutlich eine gewisse Toleranz hervor. Argumentationslogisch
legt sie ihre Anhänger jedoch keineswegs darauf fest, darauf zu verzichten, für
die eigene Position einzutreten und sie gegebenenfalls auch mit Machtmitteln -denn diese den zur Verfügung stehen -- durchzusetzen.
2. Der „Schrecken von Geld wie Heu“ und die
Heuschrecken
Die Rede von der Deutschland AG ist wohl bekannt. Sie verweist darauf, dass
die deutsche Wirtschaft über einen langen Zeitraum insbesondere durch
vielfältige Beteiligungen der Großbanken auf eine Weise miteinander
verflochten war, die man etwa in England oder den USA nicht kannte. Da
erfolgreiche Industrienationen wie Japan oder Korea ähnliche oder noch stärkere
Verflechtungen wie Deutschland in der Phase ihres Aufstieges kannten, darf
darüber spekuliert werden, ob gerade diese Art von Koordination die
Schlagkraft der Industrien der jeweiligen Nationen während ihres Aufstiegs
gestärkt haben könnte.
Es scheint allerdings einiges dafür zu sprechen, dass erfolgreiche Industrieunternehmen und Industrienationen nach ihrem Aufstieg als ganze nicht davon
profitieren, wenn zu starke Verflechtungsstrukturen auf den internen Märkten
und insbesondere auch den Kapitalmärkten existieren. Insoweit darf man
vermutlich davon ausgehen, dass die steuerliche Begünstigung der Veräußerung
von Unternehmensbeteiligungen, die ja auch in unserer bundesrepublikanischen
42
internen Diskussionen keineswegs unstrittig war und ist, durch ihren Beitrag zur
Entflechtung sehr viel positives bewirkt hat.
Dass die Entflechtung, die in Deutschland eingesetzt hat, einige Einzelunternehmen auch angreifbarer für externe Angriffe und Übernahmeversuche
gemacht hat, scheint klar. Weit strittiger ist es, ob darin eher etwas positives als
etwas negatives gesehen werden sollte. Die ordnungspolitischen und
ordnungsethischen Bewertungen gehen weit auseinander.
Auf der einen Seite betont man zu Recht, dass es insgesamt wünschenswert sei,
Kapital den jeweils profitabelsten Verwendungen zuzuführen. Da Effizienz auch
immer zum Wohlstand und damit zu weiteren Bedürfnisbefriedigungsmöglichkeiten beiträgt, ist die Effizienzförderung vor allem auch eine ethische
und nicht nur eine ökonomische Forderung. Ein Management, das sich fern von
Risiken einer Unternehmenspleite sieht und beispielsweise liquide Mittel hortet,
anstatt sie auszuschütten oder profitabel zu investieren, könnte und wird häufig
dazu tendieren, sich auf den Lorbeeren auszuruhen.5 Da externe Beobachter der
Unternehmenstätigkeit möglicherweise effizientere Formen der Leistungserstellung und des Kapitaleinsatzes im Blick haben, werden sie –
beziehungsweise wird ihre bloße Existenz – darauf hinwirken, dass auch in
einem Management, das ansonsten vielleicht zur Trägheit neigen könnte, eine
stetige Anpassung der Ansprüche nach oben erfolgt. Die latente Drohung mit
einer Übernahme durch einen externen Investor scheint insoweit in jedem Falle
insgesamt segensreich.
Auf der anderen Seite darf keineswegs übersehen werden, dass in den so
genannten „Übernahmeschlachten“ Motivationen eine Rolle spielen, die sich in
ihren Auswirkungen nur schwer mit einer Wahrung langfristiger Interessen von
Unternehmen oder der Gesellschaft insgesamt vereinbaren lassen. Auch wenn
die scheinbare oder wirkliche Irrationalität von Unternehmensübernahmen und
eine dabei stattfindende Kapitalvernichtung häufig übertrieben dargestellt
werden dürften, weil die betreffenden Einzelfälle so große Aufmerksamkeit
erregen, darf das Problem keineswegs vernachlässigt werden. Unternehmer und
Investoren sind eben auch nur Menschen und werden häufig von nahe liegenden
übermächtigen Situations-Eindrücken und Situations-Anreizen in einem Maß
beeinflusst, welches der Wahrung fern liegender langfristiger Interessen nicht
förderlich ist. Überdies ist das Vertrauen in die Weisheit von Märkten und die
überlegene Informationsverarbeitungskapazität von Märkten nur begrenzt
zutreffend Wie anfällig auch Kapitalmärkte für Täuschungsmanöver sind,
5
Siemens hat man früher manchmal als eine Bank mit angeschlossenem Elektrobetrieb karikiert.
43
zeigen die großen Finanzskandale der letzten Jahre, wobei die Karriere Enrons
vom überbewerteten Börsenstar zum Pleitier vermutlich besonders hervorgehoben werden muss.
Ordnungspolitisch sollte Effizienzverlusten, die Aufgrund der Schwächen der
menschlichen Natur eintreten, insgesamt entgegengewirkt werden. Da man
Vorteile von Kapitalmärkten nicht ohne gewisse Nachteile haben kann, muss bei
der Festlegung von Regeln für die Zulässigkeit externer Übernahmen eine
Abwägung stattfinden, die neben den effizienzfördernden Wirkungen rationaler
Übernahmevorhaben auch Rationalitätsmängel im menschlichen Bewertungsund Entscheidungsverhalten in die Bilanz aufnimmt.
Die Abwägung der Vor- und Nachteile von Regeln, die den Kapitalmarkt und
Unternehmensübernahmen steuern sollen, sollte im übrigen nicht in einem Zuge
am grünen Tisch erfolgen. Sie sollte tunlichst in einem erfahrungsbasierten
Prozess schrittweiser Anpassung vollzogen werden. Angesichts der Komplexität
wirtschaftlicher Institutionen muss man eher auf eine allmähliche Evolution als
auf eine Konstruktion angemessener Strukturen von Grund auf setzen.
Das enthebt uns aber nicht der Aufgabe, Ordnungspolitik zu betreiben und die
Politik ethisch zu begleiten. Ordnungsethisch betrachtet sind in Wahrnehmung
dieser Aufgabe in jedem Schritt möglichst umfassend die Vor- und Nachteile
einzelner Regelungen abzuwägen. Dabei gilt es, nicht nur Effizienzfragen,
sondern auch die grundlegenden Wertsetzungen freiheitlicher Rechtsstaatlichkeit und die Wertvorstellungen der Allgemeinheit im Auge zu behalten.
Versuchen wir also wiederum von diesem Grundwert ausgehend „in Ordnungen
zu denken“ und eine wirtschaftsethische Bewertung von Vorgängen zu skizzieren, die sich im Zuge von Übernahmen und ähnlichem vollziehen (zum
Denken in Ordnungen ausführlicher, vgl. Kliemt, H. (1991)).
2.1. Die Mannesmann Übernahme
Das prominenteste Beispiel einer Unternehmensübernahme, welches die jüngere
deutsche Wirtschaftsgeschichte zu bieten hat, bildet die sogenannte
„Übernahmeschlacht“ um Mannesmann in den Jahren 1999 und 2000.
Mannesmann hatte insgesamt in den Vorjahren außerordentlich erfolgreich beim
Aufbau eines Mobilfunknetzes operiert. Der Kurs der Aktie war stetig gestiegen.
Durch die Übernahmephantasien und schließlich die konkreten Übernahmeangebote stieg die Aktie weiterhin in hohem Maße an. Zunächst gab es ein
44
freundliches Übernahmeangebot, dem dann ein so genanntes feindliches
Angebot folgte. Schließlich kam es zu einer Einigung über die Übernahme.
In jedem Schritt profitierten die Aktionäre. Ob sie in noch höherem Maße hätten
profitieren können, lässt sich nur schwer einschätzen. Allerdings spricht sehr
viel dafür, dass sie durch das Verhalten des Mannesmann-Vorstandes – ob nun
von diesem intendiert oder nicht – dem maximal von ihnen zu erzielenden
Ertrag nahe kamen.
Von der Aufteilung des Unternehmens in einen Mobilfunkteil und andere dann
selbstständig operierende Unternehmensbereiche, die im Vorfeld und im Zuge
der Übernahme vollzogen wurde, scheinen auch die anderen Unternehmensbestandteile und damit viele andere „Stakeholder“ von Mannesmann im Großen
und Ganzen profitiert zu haben. Bei vernünftigem unternehmerischem Handeln
wäre eine Quersubvention durch die Mobilfunksparte in keinem Falle vertretbar
gewesen. Unabhängig handelnde Unternehmensteile konnten sich, wenn man
von den – bereits verworfenen –illegitimen Möglichkeiten einer dauerhaften
Quersubvention absieht, vermutlich besser entwickeln als im Verbund des
größeren Gesamtunternehmens. Da nennenswerte Synergie-Effekte zwischen
Mobilfunk und anderen Sparten nicht zu erwarten waren.
Ob die Aktionäre des übernehmenden Unternehmens in gleicher Weise
profitierten und das entstehende Gesamtunternehmen tatsächlich den Übernahmepreis rechtfertigende Synergie-Effekte innerhalb der entstehenden
größeren Mobilfunksparte realisieren konnte, ist relativ schwer zu beantworten,
weil man die alternativen, getrennten Expansionspfade von Vodafone und
Mannesmann-Mobilfunk nicht leicht beurteilen kann. Aber auch insoweit
besteht vermutlich kein Anlass zu einer übertrieben negativen Einschätzung.
Alles in allem wird man die Übernahme von Mannesmann durch Vodafone von
der Managementseite wie von der Frage des Gemeinwohls her eher positiv
beurteilen. Es gibt keine Indizien dafür, dass das unternehmerische Handeln
offenkundig auf Kapitalvernichtung und irrationale Augenblicksorientierungen
hinauslief. Unter den normativen bzw. ethischen Gesichtspunkten der Wahrung
gesellschaftlicher Wohlfahrt und der Einhaltung rechtsstaatlicher Normen
erscheint die Übernahme auch ex post insgesamt ethisch wünschenswert oder
doch in jedem Falle vertretbar, selbst dann, wenn man nicht von vornherein eine
wirtschaftsliberale Position vertritt.
Wie allgemein bekannt hatte der Übernahmevorgang für einige maßgeblich
daran beteiligte Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder ungeachtet der
45
vorangehenden Bemerkungen ein Nachspiel. Dieses Nachspiel bestand zum
einen aus einer breiten moralisch motivierten Kritik der Öffentlichkeit an den im
Zuge der Übernahme gezahlten Prämien insbesondere für Herrn Esser und,
vermutlich nicht ganz unabhängig von dem ersten Faktor, einer gerichtlichen
Überprüfung der Vorgänge. Es lohnt sich, wenn auch unter Vermeidung
rechtlicher Details, einen etwas näheren Blick auf diese Vorgänge zu werfen.
Zunächst einmal erregte die bloße Höhe der gezahlten Prämien Aufsehen.
Mehrstellige Millionenbeträge, die an einen ausscheidenden Vorstandsvorsitzenden gezahlt werden, sind in der deutschen Wirtschaftsgeschichte bis dahin ohne
Beispiel gewesen. Es kann kaum überraschen, dass es deshalb zu Nachfragen
nach einer Rechtfertigung der Zahlungen kam.
Wenn sich Herr Esser seine Zustimmung zur Übernahme hätte direkt
„abgelten“ lassen, so wäre das ökonomisch sehr plausibel gewesen. Da er
ohnehin als Agent anderer zu handeln hatte, wäre es aber rechtlich überaus
fragwürdig, weil korruptionsnah gewesen. Die Prämie wurde ihm jedoch
(offiziell) im Nachhinein für sein Wirken zugunsten des Unternehmens in der
Vergangenheit gewährt. Es handelte sich also nicht um eine Prämie im Zuge
eines „do ut des“ (ich leiste, damit Du leistest), sondern um eine (positiv
vergeltende) „retributive“ Gratifikation, die nicht um den Erhalt eines Vorteils,
sondern wegen des Erhalts von Vorteilen bedingungslos rückwirkend als Dank
gewährt wurde. Solche retributiven Gratifikationen spielen in unserer
moralischen Wirklichkeit eine bedeutende Rolle, doch weniger in der
wirtschaftlichen.
Akzeptieren wir das vorangehende als zutreffende Schilderung des Sachverhalts,
so lassen sich daran einige Bemerkungen knüpfen:
1. Nach dem Modell zukunftsgewandt rationalen Verhaltens, das wir
unserem Verständnis des Wirtschaftslebens zumindest als Ökonomen
gewöhnlich zu Grunde legen, gab es keine rationale Veranlassung für
die Herrn Esser gewährte Prämie. Weder konnte Herr Esser dadurch
zusätzlich mit Bezug auf die Zukunft des Unternehmens motiviert
werden, noch konnte man plausibel davon ausgehen, dass es positive
Wirkungen dieser Prämie auf das Verhalten der Mitarbeiter des
Unternehmens in der Zukunft geben würde.
46
2. Die Aktionäre wurden um Mittel gebracht, die im Unternehmen
hätten bleiben können. Das würde aber auch in Fällen geschehen, in
denen Spenden für wohltätige Zwecke aus der Unternehmenskasse
gemacht würden. Es ist eine interessante Frage, ob eine großzügige
Spende aus dem Vermögen der Firma Mannesmann etwa an das Rote
Kreuz zum Abschluss von deren eigenständiger Existenz ebenfalls auf
einen dem erhobenen Untreuevorwurf vergleichbaren Vorwurf
gestoßen wäre. Und wie wäre es mit einer Abschlussprämie an alle
Mitarbeiter gewesen? Was die Benutzung von anvertrauten Geldern
anbelangt, wäre der Fall jedoch nicht anders zu beurteilen gewesen.
Möglicherweise
noch
aufschlussreicher
wäre
der
Fall
einer
Dankesprämie an alle Mitarbeiter. Wäre eine solche Zahlung erfolgt,
hätte es sich ebenso um eine Benutzung des Geldes der Aktionäre
gehandelt. Rechtlich und moralisch wäre der entscheidende Aspekt
auch in diesem Falle die Verletzung beziehungsweise die mögliche
Verletzung der Intentionen der Aktionäre gewesen.
3. Diejenigen, die in der öffentlichen Meinung und vor allem der
veröffentlichten
Meinung
besonders
stark
als
Kritiker
der
Verwendung von Geldern des Unternehmens Mannesmann durch die
abschließenden Beschlüsse der Aufsichtsgremien aufgetreten sind,
waren typischerweise keineswegs Personen, die sich in anderen
Zusammenhängen für die Rechte von Aktionären beziehungsweise die
Rechte der Kapitaleignerseite stark machen würden. Von der
Aktionärsseite selber war vergleichsweise wenig, wenn überhaupt
Protest gegen die Bonuszahlungen zu vernehmen. Das ist mit Bezug
auf die Motive der Kritiker verdächtig und mit Bezug auf die
Interessen der Aktionäre eher beruhigend. Die Aufgeregtheit der
Debatte
war
vermutlich
weniger
einer
real
empfundenen
47
Interessenverletzung der Betroffenen als dem allgemeinen Interesse
an Kapitalismuskritik und Skandalen geschuldet.
4. Die Deutsche Bank selber hat in ihren Verlautbarungen darauf
verwiesen, dass man sich in einer rechtlichen Grauzone bewege. Sie
hat sich von ihrem Vorsitzenden nicht distanziert, doch betont
sachlich Stellung bezogen. Das war insgesamt sicherlich eine
ausgezeichnete Strategie. Es war überdies eine Strategie, die auch
dem Vorsitzenden des Vorstandes der Bank, weil er sich diesem
Vorgehen
keineswegs
widersetzt
zu
haben
scheint,
positiv
anzurechnen ist.
5. Der außen stehende Betrachter kann sich des Verdachtes nicht
erwehren, dass der Wille zum Gelingen und vielleicht auch eine
gewisse „Kameraderie der Macher“ ein eher hemdsärmeliges
Vorgehen im Zuge der Übernahmeverhandlungen begünstigt haben.
Wenn es dazu kam, so ist das menschlich sicherlich verständlich, da
gerade die entsprechenden Qualitäten pragmatischer Entscheidungsfreude an Managern besonders geschätzt werden. Auf der anderen
Seite begünstigen solche Handlungen grundsätzlich auch rechtliche
beziehungsweise moralische Fehltritte – und zwar unabhängig davon,
ob man die Motive, aus denen die betreffenden Schritte unternommen
werden, für respektabel hält oder nicht.
Zwar scheint das allfällige Skandalgeschrei in den moralischen und rechtlichen
Auseinandersetzungen um die Übernahme von Mannesmann durch Vodafone
verfehlt. Nicht verfehlt, sondern dringend angezeigt ist aber eine sachliche
Diskussion der Vorgänge aus Wirtschafts- uns rechtsethischer Perspektive.
Zunächst müssen wir uns fragen, ob es tatsächlich neuer rechtlicher Regeln
bedarf, um vergleichbare Sachverhalte in Zukunft allgemein zu regeln.
Womöglich ist es besser, die betreffenden Fragen mit dem bestehenden Regel-
48
und Rechtssystem behandeln zu wollen. Die rechtlichen Verfahren sind ja in
einer bestimmten Weise abgeschlossen worden. Dadurch hat implizit eine
Rechtsfortbildung stattgefunden. Daraus kann man für die Zukunft Schlüsse
ziehen. Wer in einem vergleichbaren Fall in Zukunft zu handeln hat, wird sich
jedenfalls sehr deutlich rechtlicher Risiken bewusst sein. Er kennt nun Grenzen,
die im Mannesmann-Verfahren ausgelotet wurden.
In der Tendenz muss man die rechtlichen Ergebnisse der Auseinandersetzung als
eine Stärkung einer am Anteilseigner ausgerichteten Konzeption des
Unternehmens ansehen. Das ist durchaus ironisch, da es die Anteilseigner
gerade nicht waren, die „Skandal“ riefen, sondern Kreise, denen das Konzept
der Steigerung des Shareholder values als Maxime unternehmerischen Handelns
suspekt ist (vgl. dazu unten mehr in der Diskussion der wirtschaftsethischen
Position Milton Friedmans). Aber Vorwürfe wie der der Untreue lassen kaum
eine andere Deutung zu als die, dass es primär um die Interessen der Aktionäre
ging.
Im vorangehenden wurde bereits betont, dass viel dafür spricht, dass die
Entscheidungen, die im Zuge der Übernahme getroffen wurden, vom
Standpunkt des Allgemeinwohls – auch dann, wenn dies nicht intendiertes Ziel
der Entscheidungen war – vermutlich insgesamt positiv zu werten sind. Denkt
man an ein alternatives Szenario, in dem es beispielsweise wegen großer
Vorsicht der Beteiligten nicht zu einem Abschluss gekommen wäre, wären
vermutlich nicht nur allgemeine Gesichtspunkte des Gemeinwohls, sondern
auch ganz speziell Aktionärsinteressen zunächst auf der Strecke geblieben. Die
Mannesmann Aktionäre hätten ein weniger gutes Geschäft mit ihren Aktien
gemacht. Wenn man Aktionäre also generell davor schützen will, Geld zu
verlieren, dann sollte man diesen Gesichtspunkt in die Gesamtbewertung
einbeziehen.
Herrn Essers Verhalten hat erkennbar zu Zugewinnen für die Aktionäre geführt.
Natürlich hätte Herr Esser nicht das Recht gehabt, sich seine Zustimmung
abkaufen zu lassen. Zur gleichen Zeit scheint es realitätsfern, ihn in seine
Führungsposition zu heben und dann zu vernachlässigen, dass er wie jedermann
immer auch eigene Interessen verfolgen wird. Zumindest nach der Auffassung
jener, für die immer die Interessen aller Stakeholder und nicht nur der
Shareholder zu berücksichtigen sind, müsste auch Herr Esser in einen fairen
Ausgleich der Interessen im Verhandlungsprozess einbezogen sein. Die
Anhänger der Stakeholder-Auffassung werden allerdings betonen, dass die
Herrn Esser gewährte Summe jenseits fairer Anteile zu liegen scheint.
49
Ein Gutteil der Kritik an den Vorgehensweisen im Rahmen der Übernahme von
Mannesmann durch Vodafone ist sicherlich dem Umstand geschuldet, dass die
gezahlten Boni als maßlos empfunden wurden. Aus Sicht der Beteiligten, die
mit schwindelerregenden Summen zu operieren hatten, stellte sich das gewiss
nicht so dar. Verglichen mit der Größe des „Deals“ handelte es sich um
moderate Beträge. Absolut waren die Zahlungen jedoch außergewöhnlich hoch.
Die Beteiligten verkannten gewiss, die Brisanz ihres Vorgehens in der
Außenwahrnehmung. Ob dieser Irrtum als solcher eine rechtliche oder ethische
Verfehlung darstellt, scheint offen. Um eine Management-Fehleinschätzung
handelte es sich gewiss. Insoweit scheint auch Kritik an Herrn Ackermann
berechtigt.
Dennoch muss man festhalten, dass die öffentliche Vorverurteilung und die
generelle Beurteilung des Verhaltens der Beteiligten selbst jenes Maß vermissen
ließ, dessen Fehlen man den maßgeblichen Personen vorwarf. Wenn man auf
diese Feststellung mit dem üblichen Schulterzucken reagieren würde, um es
einem Mangel an Sachinformation anzulasten, läge man nicht völlig falsch.
Auch gab es eine Skandalpresse, die dem Mangel an Sachinformation noch
kräftig durch Desinformation nachhalf. Dennoch macht man es sich zu leicht,
das große Unbehagen gegenüber den Mechanismen der heutigen Wirtschaft und
der Bewertung durch die Kapitalmärkte allein auf Unkenntnis und Irrationalität
zurückzuführen. Es gibt tiefere Ursachen für das Unbehagen an unserer
Wirtschaftskultur. Diese zeigen sich vor allem auch in der sogenannten
Heuschrecken-Debatte, der wir uns nun an konkreten Beispielen zuwenden
werden.
2.2. Heuschrecken
Politik wird mit Worten gemacht. Fähige Politiker haben dies zu allen Zeiten
verstanden. Indem sie bestimmte Begriffe mit einem bestimmten Wertgehalt
aufladen, suchen sie ihre eigenen Ziele zu fördern. Sobald bestimmte Begriffe
einmal in einer bestimmten Weise auf breiter Front verstanden werden, ist dem
betreffenden Begriffsgebrauch politisch kaum noch beizukommen und der
Transport bestimmter Wertungen gesichert. Das muss man als Theoretiker
anerkennen. Es wäre albern, gegen derartige Windmühlenflügel zu kämpfen.
Auf der anderen Seite ist es aber auch verfehlt, sich von der Politik die eigene
theoretische Analyse diktieren zu lassen. Das bedeutet mit Bezug auf die so
50
genannte Heuschreckendebatte, dass wir als wirtschafts-ethische Theoretiker die
negative Besetzung des Begriffes der Heuschrecken keineswegs von vornherein
als unumstößliche Wahrheit hinzunehmen haben.
Wie bereits in den einleitenden Überlegungen zu diesem Abschnitt festgestellt,
haben externe Investoren, die über Kapitalmärkte auf Unternehmen zuzugreifen
suchen, durchaus eine heilsame, hygienische Funktion in der wirtschaftlichen
Realität. Wenn die hässlichen Geier, um mit den Metaphern im Tierreich zu
bleiben, Aas eliminieren und Raubtiere bevorzugt schwache Individuen zur
Beute nehmen, dann verhalten sich die Heuschrecken des Finanzbereiches auf
vergleichsweise angenehme Art. Sie bringen gleichsam fett und faul gewordene
Unternehmen wieder auf Trab, um daraus einen Profit zu ziehen. Das Potenzial
des von ihnen auserkorenen Unternehmens wird von ihnen höher eingeschätzt
als das, was durch die Unternehmensleitung selber realisiert wird. Und wenn die
Heuschrecken Recht mit ihrer Einschätzung haben, dann hilft das dem
Unternehmen ebenso wie der Allgemeinheit und ihnen selbst.
Ein Unternehmen muss in irgendeiner Weise unterbewertet sein, damit sich die
bessere Werteinschätzung der externen Investoren zu deren Vorteil durchsetzen
kann. Die unbestechlichen Wahrheiten der Marktwirtschaft sagen immerhin so
viel. Das schließt allerdings nicht aus, dass Investoren, die sich Übernahmekandidaten auserkoren haben, zum Opfer von eigenen Fehleinschätzungen
werden können. Wenn das der Fall ist, dann kann es durchaus zu
wirtschaftlichen Verwerfungen kommen, die zur Kapitalvernichtung nicht nur
auf Seiten der externen Investoren, sondern auch auf Seiten der übernommenen
beziehungsweise angegriffenen Unternehmen führen.
Dass es unter den hedge fonds auch so genannte Geier-Fonds gibt steht dem
vorangehenden nicht entgegen. Die Geier-Fonds zerlegen Unternehmen in ihre
Bestandteile, weil sie erkannt haben, dass die Teile mehr wert sind als das
Ganze. Nach dem Verkauf der Einzelteile ist das ursprüngliche Unternehmen
zerschlagen, doch insgesamt, falls die Einschätzung einer Unterbewertung
korrekt war, ein Mehrwert realisiert worden. Auch hier wird nichts kahl
gefressen oder vernichtet; sondern es kommt zu einem „recycling“.
Wenn Großunternehmen derartiges selbst vollziehen, indem sie Teilbereiche
eines Konzerns als unabhängige Einzelunternehmen an die Börse bringen, so
werden derartige Strategien gewöhnlich mit weniger Skepsis und häufig
durchaus mit einem gewissen Wohlwollen bzw. sogar Applaus begleitet. Es ist
nicht einzusehen, warum ähnliche Handlungen, welche von private equity
Unternehmen oder hedge fonds vollzogen werden, als zerstörerische Angriffe
51
auf zuvor intakte Gesamtunternehmen angesehen werden sollen. Die schlechte
Presse, die solche Strategien häufig auf sich ziehen, erklärt sich vermutlich zum
großen Teil daraus, dass bei der Zerschlagung der größeren Konglomerate
erkennbar wird, dass zuvor versteckte Quersubventionen stattfanden. Hoch
profitable Unternehmensteile, die sich weit besser entwickeln könnten als im
Unternehmensverbund wurden dazu herangezogen, wenig profitable Unternehmensteile aufrechtzuerhalten. Die Angehörigen dieser Unternehmensteile
werden den Wegfall der „Stütze“ naturgemäß beklagen und die Sympathie
„sozial“ gesonnener externer Beobachter wird ihnen sicher sein.
Wer gegen Subventionen in der öffentlichen Wirtschaft ist, der sollte es
eigentlich auch im Bereich der Privatwirtschaft sein. Dann kann er letztlich nur
begrüßen, dass sich wirtschaftliche Vernunft auf welchen Wegen auch immer
gegen Subventionen durchsetzt. Dass dabei wie bei allen Anpassungen an neue
Marktbedingungen auch soziale Härten auftreten können und in der Regel
werden, ist vollkommen unbestritten. Zur gleichen Zeit spricht vermutlich
nahezu alles dafür, diese Härten über die Sozialpolitik zu mildern und nicht
dadurch, dass man Unternehmen dazu verurteilt, auf weniger effiziente Weise zu
wirtschaften als das möglich wäre. Das Letztere läuft auf eine Art versteckter
Sondersteuer hinaus und kann ohnehin nicht von nachhaltigen Erfolgen gekrönt
sein.
Alle diese Sachverhalte lassen sich vermutlich mit Bezug auf die deutschen
Verhältnisse besonders gut am Beispiel der Übernahme der Firmen WincorNixdorf und Grohe durch externe Investoren illustrieren. Das erste wird im
allgemeinen als geglückte, das zweite als missglückte Übernahme angesehen.
Wenden wir uns also diesen Beispielen zu.
2.3. Von Wincor-Nixdorf zu Grohe und zurück
Bis zum Jahre 1999 gehörte Wincor-Nixdorf zur Firma Siemens. Das
Unternehmen wurde im Jahr 1999 an einen externen Investor verkauft. Zu
diesem Zeitpunkt hatte es 3400 Mitarbeiter und einen Umsatz von 1,3
Milliarden €. Im Jahre 2004 wurde Wincor-Nixdorf wiederum an die Börse
gebracht. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Mitarbeiterzahl auf 6200 erhöht,
wobei sogar 1000 zusätzliche Stellen in Deutschland geschaffen wurden. Die
Ertragslage und andere Parameter hatten sich nachhaltig verbessert.
Ganz offenkundig handelt es sich in diesem Falle um eine Erfolgsgeschichte, die
zum einen kein besonders gutes Licht auf die Managementfähigkeiten im
52
Siemens-Konzern wirft, zum anderen aber auch zeigt, dass die Einschätzungen
externer Investoren ebenso wie deren eigene Fähigkeiten zur Entwicklung eines
Unternehmenspotenzials häufig Vorteile für alle Beteiligten bringen können.
Wer überhaupt für freie Märkte und insbesondere für freie Kapitalmärkte eintritt,
der wird kaum in der Lage sein, ein überzeugendes normatives Argument gegen
derartige Entwicklungen vorzubringen. Was die Ordnungspolitik und Ordnungsethik anbelangt, so erscheint es generell wünschenswert, dass die Marktregeln
Raum für solche Praktiken wie die Übernahme von Wincor-Nixdorf einräumen.
Der nächste Fall illustriert demgegenüber, wie es zu problematischen
Entwicklungen nach Übernahmen kommen kann. Das Familien-Unternehmen
Grohe wurde im Jahr 1999 von der Firma BC-Capital gekauft. Zum Zeitpunkt
des Kaufes war das Unternehmen börsennotiert. Die Investoren zahlten
geschätzte 1,2 Milliarden € an die Eignerfamilie, weitere 800 Millionen €
kamen als Darlehen hinzu. Die Börsennotierung wurde aufgehoben. Zunächst
stiegen die Investitionen und auch die Mitarbeiterzahl blieb im wesentlichen
konstant. Es kam zu einer gewissen Verlagerung von Produktion ins Ausland,
doch geschah dies in Absprache mit Betriebsrat und Gewerkschaften. Im Jahre
2003 wurden dem Unternehmen von den Erst-Investoren circa 350 Millionen €
entzogen und im Jahre 2004 wurde Grohe an die nächste Investorengruppe
weiterverkauft. In diesem Falle wurden zwischen 1,5 und 1,8 Milliarden €
zuzüglich der Übernahme der Verbindlichkeiten erlöst.
Dieser Preis erscheint aus Sicht der meisten Experten als überhöht. Die
Investoren begannen nach der Übernahme auf ziemlich hektische Weise, das
Unternehmen „auf Effizienz zu trimmen“. Das gesamte Management wurde
ausgetauscht und Arbeitsplätze insbesondere in Deutschland wurden in hohem
Maße abgebaut. Soweit diese Entscheidungen wirklich aus Effizienzgründen
nötig waren, sollte man sie begrüßen. Im vorliegenden Falle erheben sich jedoch
Zweifel, ob die betreffenden Entscheidungen nicht von fehlerhaften Vorentscheidungen induziert waren, ohne wirtschaftlich indiziert zu sein.
Das Verhalten des ersten Erwerbers war zunächst das eines auf mittel- bzw.
langfristige Unternehmensentwicklung abstellenden Investors. Ob Grohe unter
den ursprünglichen Eigentumsverhältnissen schlechter, ebenso gut oder besser
gestellt gewesen wäre, lässt sich nur schwer beurteilen. Dass Grohe jedoch nach
der Erstübernahme in keinem Falle eine negativ aus dem Rahmen fallende
Entwicklung durchlief, scheint klar zu sein. Mit dem Weiterverkauf hat auch der
Investor nach recht kurzer Frist seine Ziele erreicht oder kam doch, falls er nach
tieferer Einsicht in den Markt nicht mehr die gleichen Chancen wie ursprünglich
53
sah, „gut“ aus der Sache heraus. Da externe Finanzinvestoren stets Gebühren für
ihre Tätigkeit erheben und weil sie dem Unternehmen auch regelmäßig einen
Teil der Übernahmekosten in Form zusätzlicher Kreditaufnahme aufbürden,
zeigt die fortbestehende Ertragskraft von Grohe bis zum Weiterverkauf an, dass
die ursprüngliche Einschätzung des Erstinvestors, der von der
Steigerungsfähigkeit der Ertragskraft ausgegangen war, richtig gewesen sein
dürfte. Die Erzielung eines zusätzlichen Ertrages ist grundsätzlich positiv zu
bewerten – und zwar ungeachtet der Tatsache, dass der zusätzliche Ertrag an
einen externen Investor ging.
Alles in allem blieb der erste Eigentümerwechsel kanonisch innerhalb des
Rahmens, in dem man von externen Investments bzw. von deren genereller
Zulassung überwiegend positive Wohlfahrtseffekte und insoweit auch ethisch
wünschenswerte Ergebnisse erwarten darf. Durch den zweiten Verkauf ist Grohe
jedoch möglicherweise in eine Abwärtsspirale geführt worden. Durch überzogen
optimistische Markteinschätzungen und überzogene Erwartungen an
Ertragskraft und Entwicklungspotential der Firma geriet das Unternehmen in
eine Situation, in der ihm zu viele externe Lasten aufgebürdet wurden. Eine an
sich mögliche endogene Entwicklung wurde damit anscheinend verstellt. Die
Verlagerung von Produktionsprozessen in Schwellenländer wurde in einer für
den Außenstehenden doch eher überraschenden Geschwindigkeit und
Radikalität vollzogen.
Nun haben auch andere international operierende Unternehmen in
vergleichbarer Lage ungeachtet fortbestehender großer Ertragskraft Produktion
ins Ausland verlagert. Das außergewöhnlich erfolgreiche britische Unternehmen
Dyson etwa hat seine Staubsaugerproduktion in Großbritannien gänzlich
zugunsten auswärtiger Produktion im asiatischen Raum aufgegeben. Das
geschah vorausschauend und nicht aufgrund einer Krise, die eine entsprechende
Verlagerung existentiell erforderlich machte. Arbeitsplätze in Großbritannien
wurden in der Produktion abgebaut, dafür aber in anderen Unternehmensbereichen geschaffen. Eine ähnliche Neupositionierung wäre womöglich auch
bei Grohe ohnehin anhängig gewesen, es deuten jedoch, soweit das von einem
externen Standpunkt aus beurteilt werden kann, viele Indizien darauf hin, dass
bestimmte Restrukturierungsmaßnahmen im Fall Grohe überstürzt vollzogen
wurden. Die Ertragslage der Finanzinvestoren und nicht die Markt- und
Entwicklungsbedingungen der Firma selbst scheinen die Haupttriebfeder der
Entscheidungen gewesen zu sein.
54
Man hat plausibler Weise davon auszugehen, dass die zweite Übernahme von
Grohe
dem
Unternehmen,
seiner
Ertragskraft
und
seinen
Entwicklungspotenzialen überwiegend geschadet hat. Die erste Übernahme
hingegen scheint dem Unternehmen ähnlich gut bekommen zu sein, wie die
Übernahme von Wincor-Nixdorf durch externe Investoren. Vor dem
Hintergrund dieser beiden Feststellungen kann man die ordnungs-ethische
Kernfrage genauer anvisieren. Die Kernfrage besteht darin, ob man Aktivitäten
von private equity und hedge fonds samt deren modernen
Finanzierungsstrategien und Instrumenten bei Einbeziehung der Vor- wie der
Nachteile zulassen soll oder nicht.
Diese Frage ist keineswegs durch den Verweis auf mögliche negative
Konsequenzen wie im Fall Grohe entschieden. Man muss Regeln, die bestimmte
Praktiken erlauben, als generelle Regelungen mit Regeln vergleichen, die solche
Praktiken insgesamt verbieten. Es ist eine Illusion, dass man Regeln einführen
könnte, die die Übernahmetätigkeit genau auf die erfolgsversprechenden Fälle
einschränken würden. Chancen, die sich daraus ergeben, dass man
Entscheidungsträgern Freiräume gibt, nach ihren spezifischen Einschätzungen
und Kenntnissen zu entscheiden, gehen mit Risiken der Fehleinschätzung und
Fehlentscheidung derselben Entscheidungsträger notwendig einher.
So wie es in der Statistik neben Fehlern erster, immer auch Fehler zweiter Art
gibt, so muss man bei der Regelfestlegung immer Abwägungen vornehmen.
Erlässt man restriktive Regeln, dann vermeidet man womöglich gewisse
Verluste, die durch Fehlentscheidungen im Bereich der Finanzierung entstehen,
aber man vergibt Chancen auf Gewinnsteigerungen, die durch die
Steuerungswirkungen von Kapitalmärkten erst ermöglicht werden.
Im Falle von Grohe scheint es sich bezogen auf Finanzunternehmen um normale
unternehmerische Fehleinschätzungen zu handeln. Diese Fehleinschätzungen
fallen besonders auf, weil sie nach der Übernahme sichtbar wurden
beziehungsweise mit dieser systematisch verknüpft waren. Die möglichen
Fehlentscheidungen, die sich auf den Kapitaleinsatz durch die Eignerfamilie
bezogen, bleiben unsichtbar oder wurden ausgeblendet. Denn solange die Firma
Grohe unter den vorherigen Besitzverhältnissen operierte, wurde stillschweigend
vorausgesetzt, dass Entscheidungen nur die unternehmerischen Kernaufgaben in
Produktion-, Absatz, Marketing, der Produkt- und Kapazitätsentwicklung usw.
betrafen, nicht jedoch die Frage der Kapitalverwendung selbst. Damit wurde
eine wesentliche Dimension unternehmerischen Handelns vernachlässigt. Die
Kapitalisierung der Gruppe durch die Eigentümer wurde als gegeben
55
vorausgesetzt. Das übersah jedoch, dass aus ökonomischer Sicht die Eigentümer
zu prüfen haben, ob sie selbst diejenigen sind, die aus den eingesetzten Mitteln
den höchsten Ertrag erwirtschaften können.
Natürlich konnten sie bei einer insoweit negativen Diagnose versuchen, durch
Fremdmanager den Wert des eigenen Vermögens zu mehren und den besten
Kapitaleinsatz sicherzustellen. Aber auch die Delegation der betreffenden
Entscheidungen an Agenten stellt den oder die Prinzipale vor grundlegende
Managementaufgaben, für die sie sich womöglich nicht optimal befähigt sehen.
Volkswirtschaftlich betrachtet, ist es wünschenswert, dass auch der Kapitaleinsatz selbst noch hinsichtlich seiner Effizienz über die Kapitalmärkte bewertet
wird. Es ist höchst fragwürdig, so wie in vielen Familienunternehmen den
Kapitaleinsatz einfach als gegeben, gleichsam als sunk costs anzusehen. Lässt
man aber die stetige Bewertung des Kapitaleinsatzes durch Kapitalmärkte zu,
um dadurch eine zusätzliche effizienzsichernde Bewertungsdimension einzuführen, dann wird man auf diesem wie auf allen Märkten auch mit Fehlentscheidungen zu rechnen haben. Sie werden allerdings leichter sichtbar sein als
die stillschweigenden Fehlentscheidungen, die sich daraus ergeben, dass
beispielsweise bestimmte Bewertungen nicht vorgenommen und bestimmte
Entscheidungen deshalb unterlassen werden. Die vielen kleinen
Fehlentscheidungen, die sie aus dem Festhalten an alltäglichen Gewohnheiten
ergeben, bemerken wir nicht mehr. Durch Verschleierung können wir sie
verstecken, doch nicht eliminieren. Aus volkswirtschaftlicher Perspektive
können wir derartige Faktoren jedenfalls nicht ignorieren.
Wer eine Regel festlegt und sich von der Regel als solcher positive Wirkungen
erwartet, der muss sich klar darüber sein, dass er die Einzelfälle, die im
Entscheidungsspielraum, der von und unter der Regel eingeräumt wird,
entschieden werden können, gerade nicht mehr kontrollieren kann. Wer
ordnungspolitisch Regeln festlegt, um davon zu profitieren, dass Akteure ihre
eigenen Mittel und ihr eigenes Wissen für ihre eigenen Zwecke einsetzen, der
muss einsehen, dass er damit grundsätzlich von der Einzelfallintervention
Abstand nimmt.
Eine Bindung an Regeln, die sowohl positive als auch negative Folgen haben,
fällt uns auch deshalb schwer, weil wir alle dazu tendieren, Verluste gleichsam
doppelt wichtig zu nehmen (vgl. Kahneman, D. and A. Tversky (1984)). Sie
sind zudem konkret und anschaulich, während die Gewinne häufig unbemerkt
bleiben oder als selbstverständlich hingenommen werden. Grohe und der Abbau
von Arbeitsplätzen im Inland sind skandalträchtige Nachrichten. Die von
56
Wincor-Nixdorf
verbreiteten
positiven
Nachrichten
werden
zwar
wahrgenommen. Es wird aber nicht die an sich recht offenkundige Beziehung
zwischen beiden Arten von Nachrichten gesehen. Beide Entwicklungen beruhen
auf freiheitlichen Spielregeln für Finanzmärkte. Vorteile der Spielregeln kann
man nur um den Preis der Nachteile der gleichen Regeln haben. Etwas anderes
möchte, in der kann gerade nicht nach Regeln vorgehen, sondern muss an die
Einzelfalleingriffe wohlwollender Despoten glauben. Ein solcher Glaube ist in
sich noch nicht moralisch verwerflich, doch grenzt er mit seiner Naivität an das
Begehen einer moralischen Verfehlung.
Die vorangehenden Überlegungen rechtfertigen keineswegs bereits die heutigen
Regeln für Finanzmärkte. Ein abschließendes ordnungspolitisches und
ordnungsethisches Urteil müsste die möglichen alternativen Systeme von
Spielregeln sichten. Dabei würde die spieltheoretische und ökonomische
Analyse der Regelsysteme auf deren voraussichtliche Ergebnisse hin größeres
Gewicht haben als im engeren Sinne ethische Erwägungen. Das liegt jedoch
nicht daran, dass fundamentale ethische Erwägungen etwa zur Struktur der
grundlegenden Eigentumsordnung oder den grundlegenden Freiheitsrechten für
unser Wirtschaften und unser Leben insgesamt unbedeutend wären. Das
Gegenteil ist der Fall. Der Vorrang der Freiheit spricht unabhängig von
Effizienzgesichtspunkten dafür, auch im Falle von Finanzmärkten zumindest die
Beweislast bei den Befürwortern und nicht bei den Gegnern von Regulierungen
zu sehen.
Es ist generell festzuhalten, dass die meisten uns unmittelbar bewegenden
ordnungspolitischen Fragen eine Vielzahl von Antworten zulassen, die sämtlich
mit den ethischen Grundlagen eines freiheitlichen Rechtsstaats westlicher
Prägung und der in diesen inkorporierten Privatrechtsgesellschaft vereinbar sind.
Hier helfen ethische Theorien zunächst wenig, um zwischen alternativen
Vorschlägen direkt zu diskriminieren. Allerdings haben grundlegende ethische
Orientierungen als Hintergrundüberzeugungen sehr wohl großen Einfluss darauf,
ob wir z.B. unter zwei vertretbaren Regelungen eher eine wählen, die auf
Realisierung zusätzlicher Möglichkeiten und Chancen aufgrund der Einräumung
zusätzlicher Freiheitsräume setzt oder auf eine Regelung, die sich auf die
Vermeidung konkreter Verluste konzentriert und dafür Entscheidungsspielräume
beschneiden will.
57
3. Patentrechte und der Schutz von Menschen in der
„Dritten Welt“
3.1. Patentschutz
Der Schutz von Patenten und so genanntem „geistigem Eigentum“ ist eine
zentrale Institution entwickelter westlicher Privatrechtsgesellschaften. Zwar hat
es am staatlichen Patentschutz Kritik von Seiten „libertärer“ Staatsskeptiker
gegeben. Nach deren Auffassung ist es keineswegs zwingend, dass man ein
staatlich durchgesetztes Patentrecht braucht, um Innovationen anzuregen. Allzu
plausibel scheint diese These jedoch nicht.
Wäre es tatsächlich so, dass das gleiche Ausmaß an Innovation – oder ein
nahezu gleiches Maß – ohne Patentrecht und Patentschutz erreicht werden
könnte, dann würde das gegen das Patentrecht sprechen. Denn es hätte
offenkundige Wohlfahrtgewinne zur Folge, wenn das vorübergehend vom
Patentrecht eingeräumte Nutzungsmonopol für die geschützten Informationen
fortfiele. Denn Informationen sind ja so genannte reine öffentliche Güter, bei
denen keinerlei Rivalität im Konsum besteht. Das heißt, die Nutzung der
Information durch den einen hat grundsätzlich keine negativen (externen)
Effekte auf die Nutzung der gleichen Information durch einen anderen. Konkret,
wie viele Köche das gleiche Kochrezept auch benutzen, es nutzt sich nicht ab.
Wie viele Firmen die gleiche Blaupause für ihre Produkte zugrunde legen, die
Blaupause wird dadurch nicht in Mitleidenschaft gezogen usw.
Die Folgen, die eine Nutzung der Information für den jeweiligen Nutzer hat,
können sich jedoch gravierend danach unterscheiden, wie viele andere die
Information frei nutzen dürfen. Wenn durch Errichtung von Nutzungsbarrieren
ein Ausschluss von der Nutzung der Informationen und der Realisierung von
Informationserträgen erreicht werden kann, nützt das den privilegierten Nutzern.
Derjenige, der über ein staatlich geschütztes Patent verfügt, wird damit zu einem
temporären Monopolisten gemacht. Er hält kein so genanntes natürliches,
sondern ein von der Rechtsordnung künstlich errichtetes Monopol. Die
künstliche Einrichtung des Rechtes exklusiver Nutzung verhindert
vorübergehend, dass der volle Nutzwert der Information realisiert wird. Diese
zeitlich begrenzte Nutzenminderung muss man um der Schaffung von Anreizen
willen in Kauf nehmen. Sie hat zur Folge, dass sehr viele sich anstrengen, ein
solches vorübergehendes Monopol zu erlangen. Dadurch schaffen sie erst jene
nützliche Information, um die es geht. Man hat es beim Patentrecht mit einer
Turnierstruktur zu tun, die Anreize zu verstärkter Anstrengung bietet.
58
Monopolrenten und deren künstliche Einrichtung durch Benutzung der
staatlichen Zwangsgewalt sind immer rechtfertigungsbedürftig. In praktisch
allen Fällen, in denen es nicht um die Generierung neuer Informationen und
damit nicht um Innovationen geht, kann man dieser Rechtfertigungspflicht nicht
plausibel nachkommen. Diejenigen, die sich um die Erlangung des Monopols
bemühen, verzehren in dem Wettbewerb um die Erlangung des Monopols nur
Ressourcen, die für andere Zwecke eingesetzt werden könnten. Es geht darum,
das Monopol zu erlangen, ohne dass dabei – wie etwa bei der Generierung von
Informationen – neue Werte (Erfindungen) geschaffen würden. In solchen
Fällen, in denen im Wettbewerb um den Turniersieg also keine externen Werte
für andere geschaffen werden, handelt sich um sogenanntes reines „rentseeking“ mit den entsprechenden Verlusten an gesellschaftlicher Wohlfahrt (vgl.
dazu etwa Tullock, G. (1993), Rowley, C. K., R. D. Tollison and G. Tullock
(1988)). Ordnungspolitisch sollte man alles unternehmen, um Wohlfahrtsverluste durch ein „rent-seeking“, das keine indirekten positiven Wohlfahrtswirkungen hat, zu vermeiden. Das spricht aber nicht dagegen, so genanntes
produktives „rent-seeking“ zuzulassen.
Die frühere Praxis etwa, ein so genanntes Zündholzmonopol staatlich
durchzusetzen, lud zu einem unproduktiven „rent-seeking“ ein. Sie lief letztlich
auf eine verkappte Steuer hinaus. Die Konsumenten zahlten höhere Preise. Der
Monopolist schöpfte seine Vorteile als Monopolist aus. Wenn das Monopol an
einen privaten Anbieter vergeben wurde, so erzeugte das Konkurrenz unter
diesen privaten Anbietern und ein guter Teil der ökonomischen Vorteile wurde
darauf verwendet, der Monopolhalter zu werden. Direkt unproduktive
Handlungen wurden durchgeführt, nur um das Monopol zu erlangen.
Im Falle von Patentrechten sind hingegen die Handlungen, die zur Erzeugung
des Patentes führen, beziehungsweise dazu, die Grundlagen dafür zu schaffen,
dass ein Patent gewährt werden kann, soweit erfolgreich, direkt produktiv. Sie
schaffen neues Wissen und technische Möglichkeiten, die zur gesellschaftlichen
Wohlfahrt beitragen.
Ordnungspolitisch scheint somit ein recht guter Grund für den Schutz von
Patenten gegeben. Das gilt jedenfalls insoweit wie Patente tatsächlich nur für
echte Neuerungen vergeben werden. Nach Vergabe des Patentes hat man es
jedoch mit allen Nachteilen von Monopol-Positionen zu tun. Die Vergabe des
Patentes beziehungsweise der gesellschaftliche Nutzen der Patentvergabe
insgesamt sollten diese Nachteile – und die Ressourcenverschwendung durch
vergebliche Bemühungen um Innovation – aufwiegen.
59
Ungeachtet der zuvor erwähnten Kritik bestimmter libertärer Theoretiker
herrscht heute ein recht breiter Konsens darüber, dass Patente und das
Patentrecht insgesamt auch bei angemessener Würdigung der vorübergehenden
Nachteile von staatlich geschützten Monopolpositionen zur Steigerung der
gesellschaftlichen Wohlfahrt entscheidend beitragen können. Der internationale
Patentschutz ist unter den zivilisierten Nationen unstrittig, weil sie davon
überzeugt sind, dass ein wesentlicher Teil ihres informationsbasierten
Wohlstandes auf ihre geglückten Regeln zum Schutz geistigen Eigentums
zurückgeht.6
3.2. Patentschutz von Medikamenten
Insbesondere der medizinisch-technische Fortschritt ist so weit gehend
erwünscht und trägt in solchem Maße zur Wohlfahrt der betroffenen Individuen
bei, dass die möglichst weit reichende Anregung der Innovationstätigkeit
allgemein als wünschenswert erscheint. Es ist im Interesse von fast jedermann,
dass im Bereich der Arzneimittelforschung intensiv investiert wird. Jeder von
uns könnte in bestimmten Situationen potentieller Nutznießer neuartiger
Arzneimittel sein. Jeder ist bereit, im Krankheitsfalle auch hohe Summen für
eine mögliche Gesundung auszugeben.
Da die medizinischen Güter superiore Güter sind, deren Nachfrage sich mit
steigendem Wohlstand überproportional erhöht, ist das Interesse an
medizinischen Innovationen in den reichen Ländern der entwickelten Welt
besonders ausgeprägt. Die allgemeine Praxis des Patentschutzes führt dazu, dass
Forschungen weit intensiver als ohne den Schutz durchgeführt werden. Ohne
den Patentschutz würde es Innovationen noch nicht in einem annähernd so
großen Umfang geben, wie das gegenwärtig der Fall ist. Alles spricht insoweit
dafür, gerade auch im internationalen Maßstab Patentrechte für Arzneimittel
weiterhin zu schützen und jene Institutionen zu unterstützen, die Patentrechte
international durchsetzen.
Man kann zwar beklagen, dass in forschenden Unternehmen des
Arzneimittelsektors etwa doppelt so hohe Beträge in Marketingaktivitäten gehen
6
Strittiger ist der reine Markenschutz als solcher. Es ist häufig nicht klar, inwieweit der Schutz von bestimmten
Markenprodukten gegen Imitationen in gleicher Weise wie der Schutz von Patenten zur Schaffung neuer
wertvoller Produkte beiträgt. Die Grenzen mögen manchmal verschwimmen. Häufig ist die Marke als solche
wesentlicher Teil des Produktes und nicht nur dessen technische Eigenschaften. Auch für den Markenschutz lässt
sich insoweit vermutlich eine Rechtfertigung. Doch scheint es klar, dass sich erst recht eine solche
Rechtfertigung für den Bereich der innovativen Patente und hier insbesondere den Bereich der
Arzneimittelforschung geben lässt.
60
wie in Forschungsaktivitäten. Das zeigt jedoch keineswegs, dass die
Forschungstätigkeit nicht von dem Streben nach Patenten abhängt. Vermutlich
sind bestimmte Regeln des Arzneimittelmarktes nicht so angelegt, dass die
gesellschaftliche Wohlfahrt durch die Regeln optimal gefördert wird. Es scheint
insbesondere so zu sein, dass die von den betreffenden Firmen erlangten
Monopolpositionen zu übertriebenen Marketingaktivitäten führen, um, nachdem
Patente erlangt sind, daraus den maximalen Ertrag ziehen zu können.7
Sobald das Patent ausläuft und Generika erlaubt sind, werden zuvor patentierte
Informationen gewöhnlich breit genutzt. Die Informationen tragen dann, wenn
auch mit der durch das Patent bedingten zeitlichen Verzögerung das Maximum
zur gesellschaftlichen Wohlfahrt bei. Davon profitieren insbesondere auch
Länder der so genannten Dritten Welt. Sie können bestimmte Arzneimittel
aufgrund der nun frei verfügbaren Informationen, die zuvor von den PharmaUnternehmen in der entwickelten Welt generiert wurden, preiswert produzieren
bzw. importieren. Insoweit ist der Patentschutz in der entwickelten Welt gerade
auch im Interesse der Bürger der weniger entwickelten Länder. Denn die
billigen Kopien von Generika werden nur dadurch möglich, dass die
Information zunächst einmal erzeugt beziehungsweise geschaffen worden ist.
Dass es sich um Ressourcen handelt, die ausschließlich in den technisch
entwickelten Ländern aufgebracht werden und die – mit zeitlicher Verzögerung
– aber ohne eigenen Aufwand Nutzen auch bei denen schaffen, die zur
Generierung der Information selber nichts beitrugen – sollte jedem, der die
Förderung von Interessen der Bürger der ärmeren Länder im Auge hat, bewusst
sein. Jedenfalls solange, wie der Grenznutzen zusätzlicher erfolgreicher
Forschung im Pharmabereich von uns weiterhin so hoch veranschlagt wird, wie
er gegenwärtig von fast allen eingeschätzt wird, gibt es somit sehr gute Gründe,
am Patentschutz festzuhalten. Dieser wirkt sich zu unser aller Nutzen und
vermutlich langfristig gerade auch zugunsten derer aus, die sich anfänglich die
Nutzung der patentierten Information nicht leisten können.
Es fragt sich allerdings, ob von den vorangehenden Überlegungen nicht
abgewichen werden kann oder sollte, wenn es um die kurzfristige Bekämpfung
akuter Epidemien geht. Entsprechendes scheint insbesondere mit Bezug auf die
Situation in Ländern der Dritten Welt zu gelten. Die heutige Situation AidsKranker in Schwarzafrika bildet hierfür das vermutlich markanteste Beispiel.
Man muss großes Verständnis für jene haben, die angesichts des Ausmaßes der
7
Die Beeinflussbarkeit von Ärzten dürfte auf unberechtigte Einschränkungen der Konkurrenz etwa zwischen
Krankenversorgern und Krankenkassen beruhen.
61
Aids-Epidemie daran denken, den Patentschutz für anti-retrovirale Medikamente
nicht mehr zu respektieren.
3.3. Suspendierung des Patentschutzes angesichts der AIDSEpidemie
Da die Pharma-Unternehmen ohnehin nur einen geringen Anteil ihrer Gewinne
aus dem Absatz patent-geschützter Medikamente in Schwarzafrika beziehen,
könnte man argumentieren, dass Plagiat-Strategien in Afrika kaum Einfluss auf
die Forschungsneigung großer Pharma-Unternehmen in der Ersten Welt haben
würden. Mit Bezug auf neue Arzneimittel erwarten diese Pharma-Unternehmen
ihre Gewinne zunächst aus dem Absatz in der Ersten Welt. Deshalb könnte man
ohne Gefahr für den Nutzen exklusiver Patenrechte Ausnahmen in der Dritten
Welt zulassen.
Im übrigen müssen Pharmaunternehmen ein grundsätzliches Interesse daran
haben, dass sich die so genannte Dritte Welt entwickelt, weil dies die Märkte
auch für ihre innovativen Produkte erweitern würde. Insoweit spricht sehr viel
dafür, dass sogar die Pharma-Unternehmen selbst interessiert sein müssten, dass
die Aids-Epidemie Afrika nicht noch weiter zurückwirft.
Das zentrale Problem der Generika-Produktion vor Ablauf des Patentschutzes ist
damit jedoch noch nicht angesprochen. Dies ist der potentielle Rückimport in
Länder der ersten oder der entwickelten Welt. Sofern es gelingen könnte, den
Rückenimport von Aids-Medikamenten in die Erste Welt wirksam zu
verhindern und zu kontrollieren, könnte es der Pharmaindustrie und auch uns
relativ gleichgültig sein, wenn Patentrechte in der Dritten Welt nur mehr
eingeschränkt respektiert würden. Es würde die Gewinnerwartungen nur
unwesentlich senken und weitgehend folgenlos für die Innovationstätigkeit der
heutigen Pharma-Unternehmen sein, wenn in Ländern der Dritten Welt Generika
zur Aids-Bekämpfung produziert und eingesetzt würden, sofern Rückimporte
unterbunden werden könnten.
Der Kern des Problems liegt nicht in der Profitgier von Pharmaunternehmen, die
an der Dritten Welt verdienen wollen. Die Unternehmen wissen, dass sie in der
Dritten Welt nicht viel verdienen können. Der Kern des Problems liegt in der
Sicherung der Verdienstmöglichkeiten in der entwickelten Welt. Er liegt in der
Möglichkeit von Rückimporten. Was die Möglichkeit einer generellen
Verhinderung von Rückimporten anbelangt, scheint jedoch einige Skepsis
62
geboten zu sein. Die Pharma-Unternehmen ebenso wie wir alle, die wir an der
Innovationskraft der pharmazeutischen Industrie interessiert sind, könnten kaum
darauf vertrauen, dass eine wirksame Kontrolle von Rückimporten unter
heutigen politischen und rechtlichen Bedingungen durchgesetzt würde. Insoweit
besteht tatsächlich zunächst ein nicht-frivoler Grund, am Patentschutz auch in
den Ländern der Dritten Welt festhalten zu wollen.
Es ist nicht angemessen, in diesem Kontext nur auf die Pharma-Industrie und
deren Interessen zu schauen. Es geht ethisch um allgemeine gesellschaftliche
Interessen und deren Förderung. Es ist darüber nachzudenken, ob die
allgemeinen gesellschaftlichen Interessen ebenso wie die Interessen künftiger
Generationen in der Dritten Welt gewahrt werden können, ohne dass der
Patentschutz in der Dritten Welt gewahrt wird. Es geht also um die Frage, ob wir
in unserem Interesse an Innovationen im Medizinbereich darauf verzichten
können, Patente in der Dritten Welt weiterhin durchzusetzen bzw. deren
Durchsetzung auch angesichts der großen Leiden der dortigen Bevölkerung zu
verlangen. Es geht primär um ordnungs-ethische und ordnungspolitische Fragen,
die auf einer Ebene oberhalb der Unternehmen entschieden werden müssen.
Die großen Pharma-Unternehmen sind insoweit nicht die richtigen Adressaten
für Schuldzuweisungen. Man kann den Pharma-Unternehmen allerdings
vorwerfen, dass ihre Lobby-Tätigkeit in die falsche Richtung geht. Anstatt sich
darauf zu konzentrieren, für sie ungünstige Regelungen zu verhindern, sollten
sie versuchen, eine „positive“ Lobbyarbeit in Richtung auf günstigere
Regelungen für alle zu betreiben. Wären wir uns in den fortgeschrittenen
Rechtsordnungen einig, für wirksame Einschränkungen von Rückimporten von
Arzneimitteln aus der Dritten in die Erste Welt zu sorgen, wäre vermutlich viel
gewonnen. Ein auf entsprechende Einschränkungen gerichteter Lobbyismus der
Pharma-Unternehmen ist allerdings kaum zu erkennen. Dabei spielt sicherlich
auch eine Rolle, dass es „die“ Pharma-Industrie nicht gibt, sondern nur einzelne
pharmazeutisch forschende Unternehmen mit unterschiedlichen Interessen.
Probleme des kollektiven Handelns und des sogenannten Trittbrettfahrens
betreffen selbstverständlich auch diese Akteure.
Im Umgang mit den Ländern der so genannten Dritten Welt stellen sich
besondere Probleme für die entwickelte Welt. Unter diesen Problemen wird aus
ethischer Sicht häufig eher eine irreführende Rangordnung vorgenommen.
Insbesondere wird gern übersehen, dass das eigentliche Problem der so
genannten Dritten Welt nicht die Armut, sondern Defizite in den GovernanceStrukturen und den Rechtsordnungen sind.
63
Die Fehleinschätzung hinsichtlich der eigentlichen Wurzeln der Rückständigkeit
hat auch zur Folge gehabt, dass die übliche Entwicklungshilfe gewöhnlich auf
materielle Hilfen und weniger auf institutionelle Entwicklung gerichtet wurde.
Hinzukam die in der entwickelten Welt weit verbreitete Tendenz, die eigenen
internen ideologischen Projekte und Konflikte auf die so genannte Dritte Welt
zu projizieren. Daraus haben sich große Verwerfungen durch Zerstörung lokaler
Rechts- und Regierungsstrukturen ergeben. Zusammen mit den durch den
Kolonialismus bewirkten, ebenfalls den lokalen Traditionen widersprechenden
Aufteilungen in unabhängige Staaten beziehungsweise große Regierungs- oder
Rechtseinheiten wurden durch alle diese Faktoren die Entwicklungsmöglichkeiten der Drittweltländer behindert.
Alles dies muss man in einer angemessenen Urteilsbildung berücksichtigen. Für
den gegenwärtigen Kontext geht es ohnehin nicht darum, Klage über die
Vergangenheit zu führen, sondern darum, aus der Diagnose fehlender Rechtsund Regierungs(Governance-)Strukturen die richtigen Schlüsse für unser
jetziges ethisches Handeln zu ziehen. Dabei zeigt sich vor allem, dass uns in den
entwickelten Rechtsordnung eine Fürsorgepflicht für jene Menschen trifft, die
unter schlechteren rechtlichen Bedingungen als wir agieren müssen. Das
Problem der besonderen Schutzpflichten gegenüber einzelnen Individuen, die
unter weniger verlässlichen Rechtsordnungen zu leben haben, stellt sich in dem
nächsten hier zu betrachtenden Fall erneut und verschärft. Dieser Fall
exemplifiziert das genannte wirtschafts-ethische Kernproblem besonderer
Fürsorgepflicht für Menschen in der sogenannten Dritten Welt.
4. „Trafigura“, Recht und Moral,
Das holländische Unternehmen Trafigura ist als Rohstoffhändler und
Dienstleister beziehungsweise Transportunternehmen vor allem auf dem Gebiet
des Rohstoffhandels tätig. Es hat in den letzten Jahren große Wachstumsraten
realisieren können. Nicht die erfolgreiche Unternehmenstätigkeit brachte die
Firma jedoch in die Schlagzeilen, sondern ein tragischer Umweltskandal großen
Ausmaßes. Bei der Entsorgung von Rückständen aus einem Tankschiff, das von
der Firma betrieben wurde, kam es in Abidjan, der Hauptstadt der
Elfenbeinküste, zu einem Umweltzwischenfall mit sechs Toten und tausenden
von Verletzten.
Zufolge einschlägiger Darstellungen der Vorgänge scheint die Firma Trafigura
sämtliche in Europa und in Afrika geltenden Vorschriften eingehalten zu haben.
64
Rechtlich scheint Trafigura nichts vorzuwerfen zu sein. Dennoch stellt sich die
Frage, ob die Firma mit Einhaltung der Rechtsnormen auch ethisch aus dem
Schneider ist.
Das Tankschiff, dessen Reinigungsrückstände schließlich die Katastrophe
verursachten, wurde auf dem Rückweg durch die Ostsee von Rückständen
gereinigt. Die Rückstände sollten nach ursprünglicher Planung in den
Niederlanden entsorgt werden. Die Hafenoffiziellen in Rotterdam monierten
jedoch den strengen Geruch der Rückstände und traten von dem ursprünglichen
Vorhaben zurück. Nach Darstellung der Firma brachten die Verhandlungen über
die Entsorgung den Terminplan für das Schiff in Gefahr. Hohe
Konventionalstrafen für Verspätungen drohten. Deshalb und auch gewiss
deswegen, weil in Abidjan die größte afrikanische Entsorgungsstation für solche
Rückstände zugleich Preise anbot, die um 500 € unter den in Europa möglichen
Entsorgungsgebühren pro Tonne lagen, wurde das Tankschiff mit den
Rückständen nach Abidjan gesendet. Auch dafür lagen anscheinend
hinreichende offizielle Genehmigungen der Behörden vor. Zugleich hatte sich
die Firma Trafigura erkundigt, ob der Vertragspartner in Abidjan über eine
Lizenz für die Entsorgung solcher Rückstände verfügte und hatte die Auskunft
erhalten, dass die Lizenz drei Monate zuvor von der Regierung erteilt
(beziehungsweise erneuert) worden war.
Nach den vorliegenden Informationen wurden die Rückstände auf der örtlichen
Mülldeponie in Fässern gelagert, denen möglicherweise auch noch andere
Giftrückstände beigegeben wurden. Aus den Fässern traten schließlich giftige
Substanzen aus. Es waren infolge der Ereignisse sechs Todesopfer zu beklagen.
Tausende klagten über Atembeschwerden und suchten die örtlichen
Krankenhäuser auf. Die Mülldeponien wurden geschlossen, was zu einem MüllChaos in der Stadt und vermutlich zu weiteren Gesundheitsschäden führte.
Sucht man Verantwortlichkeit zuzuschreiben, so ist nicht klar, wessen Opfer die
zu beklagenden Toten und Verletzten in Abidjan waren. Selbstverständlich hätte
es die Opfer ohne die aufgrund der in der westlichen Industriewirtschaft
anfallenden Giftrückstände nicht gegeben. Wenn es keine Industrieproduktion
gibt, dann gibt es auch keine Rückstände aus solcher Produktion. Aber die
Politikoption, die Industrieproduktion wegen möglicher Schäden hier oder in der
Dritten Welt gänzlich einzustellen, weisen wir fast alle von vornherein als
absurd zurück.
Anstatt uns mit Zivilisationskritik zu befassen, ist ein Blick auf das nahe
liegende angebracht. Es ist eine politische Aufgabe, für die es sehr gute
65
rechtsethische Argumente geben dürfte, spezielle rechtliche Regelungen zum
Schutz von Bürgern in der Dritten Welt zu erlassen. Wenn Individualrechte
aufgrund des Fehlens rechtlicher Strukturen und Institutionen in anderen
Ländern nicht gesichert werden können, wir aber in unseren entwickelten
Ländern etwas zu deren Schutz unternehmen können, so trifft uns zumal dann,
wenn wir den Respekt des Individuums als primäres Ziel auf unsere moralische
Fahne geschrieben haben, eine ethische Pflicht, entsprechend zu handeln.
Die besondere Sorgfaltspflichten für Individuen bestehen für den politischen
Gesetzgeber beziehungsweise auch für Organisationen, die UN etc. auf der
Ebene des Regelerlasses. Auf der darunter liegenden Ebene einzelner Individuen
und deren Handlungen ist im vorliegenden Fall nach besonderen Pflichten der
Firma Trafigura im Umgang mit Individuen aus der Dritten Welt zu fragen.
Selbst wenn das Unternehmen, wie es tatsächlich der Fall gewesen zu sein
scheint, alle rechtlichen Pflichten und Regulierungen in Europa beachtet hat,
stellt sich doch die Frage, ob die Beteiligten nicht leichtfertig Vertrauen
gegenüber Institutionen und Individuen in einem Drittwelt-Land gezeigt haben.
Vielleicht hätten sie genauer nachfragen müssen. Auch dazu, wie man sich zu
informieren hat, lässt sich aus ethischer Sicht etwas sagen.
Nehmen wir an, was im vorliegenden Falle nicht zutraf, das betreffende Schiff
wäre ein so genannter Seelenverkäufer kurz vor dem Sinken gewesen. Nehmen
wir an, dieses Schiff wäre tatsächlich auf dem Weg von Estland nach Rotterdam
in der Ostsee gesunken. Unterstellen wir, die Führung des Unternehmens
Trafigura hätte durch einfache Nachforschung erfahren können, aber nicht
geprüft, ob der Seelenverkäufer, bevor er auf seine letzte Reise geschickt wurde,
voraussichtlich am Ziel ankommen würde. Unterstellen wir auch, dass es
keineswegs sicher gewesen wäre, dass der Seelenverkäufer untergehen musste.
Es war nur so, dass eine besondere Gefahr für einen solchen Zwischenfall
bestand und dass man sowohl einen Anfangsverdacht hegen als auch unter
zumutbarem Aufwand prüfen konnte, ob dieser Anfangsverdacht real berechtigt
war. Vermutlich hätten wir in einem solchen Fall eine ethische Schuld der
Verantwortlichen von Trafigura diagnostiziert. Auf der rechtlichen Seite hätten
wir aller Voraussicht nach zumindest Fahrlässigkeit und möglicherweise sogar
bewusste Inkaufnahme des Schadensfalles bejaht (zu einer solchen Form von
„dolus eventualis“ vgl. schon Clifford, W. K. (1974/1879)). Nicht nur der
moralische, sondern auch ein rechtlicher Vorwurf wäre damit gegeben gewesen.
Überträgt man diesen Gedanken auf die Reise nach Abidjan, dann stellt sich
sehr wohl die Frage, ob die Firma Trafigura nicht, selbst wenn auf der
66
Oberfläche alles in Ordnung war und selbst wenn die Regierungsstellen der
Elfenbeinküste alle Vorgänge mit Lizenzen versahen, einen Anfangsverdacht
und besondere Nachforschungspflichten gehabt hätte. Auch die Tatsache, dass
es in den Augen vieler als eine Diskriminierung erscheinen könnte, Länder wie
die Elfenbeinküste anders zu behandeln als andere Rechtsordnungen, hätte die
Firma Trafigura nicht zurückhalten dürfen. Eine an individuellen Rechten und
dem Respekt für einzelne Individuen orientierte ethische Grundposition würde
es vielmehr nahe legen, in ethischen Urteilen gegen Regierungen zu
diskriminieren, die Individualrechte mit Füßen treten, beziehungsweise keinen
besonderen Wert darauf legen, diese gegen Übergriffe zu schützen.
Die Rechtsordnung der Elfenbeinküste und deren Regierungsstrukturen sind,
wie die meisten derartigen Institutionen in afrikanischen Ländern keineswegs als
vorbildlich mit Bezug auf den Schutz individueller Rechte anzusehen. Man darf
auch davon ausgehen, dass die endemische Korruption in diesen Ländern dazu
führt, dass Regierungslizenzen nicht unbedingt vertrauenswürdige Signale von
Vertrauenswürdigkeit sind. Wer hochgiftige Stoffe in Länder der Dritten Welt
entsorgt, weiß alles dies oder kann und muss es doch wissen. Er muss überdies
in Rechnung stellen, dass mit diesen Stoffen Schindluder getrieben werden
könnte. Er muss antizipieren, dass es mit größerer Wahrscheinlichkeit zu
Verletzungen von Individuen in diesen Ländern kommen wird. Denn die
allgemeine Lebenserfahrung lehrt ihn, dass auf die angemessene Behandlung der
durch ihn erzeugten Gefahren durch Regierungen und Rechtsordnungen der
Drittwelt-Länder kein Verlass ist.
Die Firma Trafigura hat, so weit das bekannt ist, keine besonderen
Vorkehrungen getroffen, sondern gehandelt, als habe sie es mit einem Land mit
gefestigter Rechtsordnung und sicheren Prüfungsverfahren zu tun. Das scheint
ethisch so vorwerfbar, wie der Entschluss, einfach an die Seetüchtigkeit eines
Apfelkahnes zu glauben. Wenn allerdings die Regierungsstellen der
Elfenbeinküste zu einem Hilfsunternehmen angereiste Trafigura Mitarbeiter ins
Gefängnis werfen, dann ist das für die betreffenden Personen ziemlich tragisch,
aber auch von bitterer Ironie. Denn letztlich sind die Politiker der Elfenbeinküste
und die fehlenden Aufsichtsmechanismen dortiger Politik weit stärker
verantwortlich für das Geschehen als Beschäftigte der Firma Trafigura.
Da Trafigura anscheinend alle Rechtsregeln eingehalten hat, ist es illegitim,
sogar selbst ein ethisches Vergehen fundamentaler Art, rechtlich gegen die
Unternehmensführung vorzugehen. Die Tatsache, dass unerwünschte
Konsequenzen innerhalb der gültigen Rechtsnormen aufgetreten sind, weil vor
67
Ort bestimmte Personen Rechtsnormen gebrochen haben, darf man der Firma
Trafigura rechtlich nicht ankreiden. Moralisch scheint aber ein durchaus
gravierender Vorwurf der Verletzung besonderer Sorgfaltspflichten bestehen zu
bleiben.
Unterscheidet man zwischen Moral und moralischen Standards auf der einen
Seite und ethisch-theoretischen Maßstäben auf der anderen Seite, dann kann
man über die Differenzierung in rechtliche und moralische Pflichten hinaus noch
weitere Differenzierungen vornehmen. Etwas kann beispielsweise nach den
Standards der tatsächlich gelebten Sitten und den tatsächlich angelegten
Moralvorstellungen als falsch gelten, doch von einer bestimmten ethischen
Theorie her untadelig erscheinen. Man denke etwa an frühere sexuelle Tabus,
die auch in früheren Zeiten bereits im Lichte ethischer Theorien als höchst
fragwürdig erschienen, in der gesellschaftlichen Praxis aber als Tabus bestehen
blieben. Verhaltensweisen, die zumindest nach Auffassung der meisten
ethischen Theorien als harmlos gelten mussten, wurden im Sinne der gelebten
Sitte und Moral weiterhin kritisiert und mit Sanktionen belegt. Als konkretes
Beispiel denke man nur an private homosexuelle Beziehungen zwischen
Erwachsenen.
Umgekehrt kann es Verhaltensweisen geben, die nach der Alltagsmoral weit
gehend akzeptiert werden, die jedoch nach den Standards bestimmter ethischer
Theorien als tadelnswert erscheinen. So ist es angesichts der Reiselust der
Westeuropäer eine weit gehend akzeptierte Praxis, auch in Länder mit
diktatorischen Rechtsordnungen zu reisen. Nach Auffassung bestimmter
ethischer Theorien gibt es jedoch gute Gründe, von solchen Verhaltensweisen
Abstand zu nehmen, beziehungsweise diese zu kritisieren. Wer vom Primat des
Respekts für das Individuum und seine Rechte ausgeht, hat gute Gründe, auch in
seiner persönlichen Lebensführung entsprechenden Differenzierungen
zumindest zu erwägen.
Wenn von „Wirtschaftsethik“ gesprochen wird, dann ist es häufig unklar, ob an
eine primäre Anwendung herkömmlicher Moralvorstellungen auf das Handeln
von Wirtschaftssubjekten gedacht wird oder an die Anwendung theoretisch
begründeter oder reflektierter ethischer Standards. Wieder konkret bezogen auf
das Beispiel von Trafigura und die Katastrophe in Abidjan, lässt sich wohl
feststellen, dass es auch in Verlängerung der Alltagsmoral so zu sein scheint,
dass Trafigura eine Pflicht gehabt hätte, über die normativen Vorgaben der
Rechtsordnung hinauszugehen. Die Erfüllung des rechtlichen Pflichtprogramms
scheint nicht auszureichen, um die moralischen Pflichten zu erfüllen. Nach den
68
Maßstäben einer reflektierten Moralbetrachtung scheint es noch eindeutiger,
dass eine Pflicht der Verantwortlichen bestanden hätte, genaue Erkundigungen
einzuziehen. Eine Verletzung der alltags-moralischen oder aufgeklärt
moralischen Pflichten impliziert aber als solche gerade noch keine Verletzung
von rechtlichen Pflichten. Eine rechtliche Belangung von Verantwortlichen der
Firma Trafigura ist, um es zu wiederholen, sofern alle Rechtsnormen von der
Firma eingehalten wurden, nach einem der wichtigsten ethischen Grundsätze
zivilisierter Rechtsordnungen, dem Grundsatz „nulla poena sine lege“ nämlich
(keine Strafe ohne gesetzliche Grundlage), selbst eine moralische Verfehlung.
Die Unterscheidung zwischen dem, wozu wir nach etablierten Regeln
verpflichtet sind und dem, wozu uns eine persönlich „gefühlte“ ethische Pflicht
anhält, ist von übergreifender Bedeutung. Sie führt zu Spannungen auf
verschiedenen Verpflichtungsebenen. Sie ist von größter Bedeutung für
verschiedene reale ethische Konflikte. Auf solche Fragen wird abschließend
zurückzukommen sein. Im gegenwärtigen Zusammenhang ist es sinnvoller, auf
eine mittlere Ebene zu gehen und die Frage zu untersuchen, bis zu welchem
Grade moralische Motivationen überhaupt real verhaltenswirksam werden
können. Dabei stellt sich zugleich auch die Frage, inwieweit feste moralische
Bindungen selbst ein Mittel der Interessenverfolgung sein können. Viele
Diskussion in der Wirtschaftsethik leiden unter einem unangemessenen
Verständnis des durchaus komplexen Verhältnisses von Moral und Interesse.
Viel häufiger als der Gegensatz zwischen Moral und Interesse dürfte nämlich
der Fall sein, in dem moralisch akzeptables oder zumindest breit akzeptiertes
Verhalten im Interesse des Akteurs liegt.
69
III. Moral am Werk
1. Moralische Bindung und rationale Interessenverfolgung
Wer im sogenannten moralischen Diskurs die Frage stellt, wozu Moral und
moralische Orientierungen denn eigentlich gut sein möchten (vgl. Hegselmann,
R. (1988)), hat sich damit in den Augen der „professional good men and
women“, die in der Debatte den Ton angeben, schon als moralisch
„halbseidener“ nicht den wirklich höheren Werten zugewandter Mensch
„geoutet“. Bei nüchterner Betrachtung ist es jedoch schwer nachzuvollziehen,
warum es nicht zu den positiven Eigenschaften eines Moralsystems gehören
sollte, dass seine allgemeine Befolgung seinen Befolgern nützt. Wenn die
Akzeptanz und Befolgung eines Moralsystems dem einzelnen Betroffenen
ebenso wie einer Gruppe von Individuen, zum Vorteil gereicht, sollte das ganz
im Gegenteil zu den hervorstechendsten positiven moralischen Qualitäten des
Systems gehören (vgl. zur antiken gleich lautenden Ansicht McIntyre, A. (1980),
allgemein sozialtheoretisch Hegselmann, R. and H. Kliemt (1997)).
Viele der gängigen Verwirrungen, die eine zutreffende Analyse des
Verhältnisses von Moral und Interesse verhindern, beruhen auf einer einfachen
Ebenenverletzung. Man hält die Ebene der Regelfestlegung und der Institutionen
nicht hinreichend getrennt von der Ebene der Befolgung der Regeln (vgl. dazu
programmatisch Brennan, H. G. and J. M. Buchanan (1985)). Die erste,
konstitutionelle Ebene erfordert andere Betrachtungsweisen und andere
Argumente als die zweite, nach-konstitutionelle Ebene. Worum es geht, versteht
man vielleicht am besten, wenn man zunächst einen kleinen Ausflug in die
Biologie unternimmt.
1.1. Proximat, ultimat und tugendhaft
In der Biologie unterscheidet man ultimate von proximaten Erklärungen. Wenn
beispielsweise gefragt wird, warum Polar-Hasen weiß sind, besteht die
proximate Erklärung in dem Verweis auf die Reflexionseigenschaften des Fells
dieser Hasen. Das Fell von Hasen, die weiß aussehen, reflektiert bevorzugt Licht
einer bestimmten Wellenlänge. Das erklärt den hellen Eindruck. Neben diese
proximate Erklärung tritt die ultimate Erklärung, dass in der polaren Umgebung
Hasen mit einer dunkleren Farbe eher auffallen und daher von den Fressfeinden
70
der Hasen – insbesondere den Polar-Füchsen – leichter gefangen werden können.
Da dunklere eher als hellere gefressen werden, haben dunklere weniger
Nachkommen als hellere Hasen. Allmählich setzen sich in der Population Hasen
mit einem immer helleren Fell durch.
Das Interesse an der Zusammensetzung von Hasenpopulationen dürfte
wirtschaftsethisch eher unterentwickelt sein. Wirtschaftsethisch Interessierte tun
allerdings gut daran, sich den Unterschied zwischen ultimaten und proximaten
Erklärungen vor Augen zu halten. Das führt sie zu Fragen der folgenden Art:
Was sind die Bedingungen, unter denen sich ein moralisch motivierter Verzicht
auf nahe liegende („proximate“) monetäre Vorteile letztlich („ulitmat“) auszahlt?
Werden „am Ende“ (ultimat) jene sich durchsetzen, die jede sich bietende
(proximate) Chance ergreifen oder jene, die um langfristiger Interessenverfolgung auch Nachteile hinnehmen? Werden sich in der Population derer, die
unternehmerische Entscheidungen zu treffen haben, die Homines oeconomici
durchsetzen, die jeden proximaten Vorteil wahrnehmen, oder kann es
unternehmerisch von Vorteil und möglicherweise objektiv Profit steigernd sein,
gerade kein Homo oeconomicus zu sein?
Die Kernfrage lautet: „If Homo economicus (a company) could choose his (its)
own utility function would he (it) want one with a conscience?“ (Frank, R.
(1987), Klammer-Ergänzungen vom Verfasser)
Im Gegensatz zu einigen landläufigen Überzeugungen ist es keineswegs so, dass
sich, salopp gesprochen, Moral nicht lohnen kann. Intrinsisch von moralischen
Erwägungen motivierte Akteure können sehr wohl auf Dauer wirtschaftlich
erfolgreicher sein als Akteure, die in jedem Einzelfall dem kurzfristigen Gewinn
nachjagen. Tugend kann sich lohnen (vgl. ausführlich dazu Baurmann, M.
(1996)).
Dabei geht es zum einen um die Fähigkeit, aufgrund langfristiger Erwägungen
kurzfristigen Versuchungen widerstehen zu können. Wer diese Fähigkeit besitzt,
vermeidet es, Gelegenheiten auf Kosten eines anderen wahrzunehmen, wo das
interessen- insbesondere rufschädigend für ihn wäre. Hier ist die Tugend eher
eine Gehhilfe für die, deren rationale langfristige Interessenwahrung eine Stütze
braucht. Denn eigentlich hilft die Tugend nur dem Verstand dabei, gegen die
kurzfristig wirkenden Emotionen und Versuchungen das langfristige
Eigeninteresse durchzusetzen.
Es gibt aber auch eine über die Versicherung gegen die Schwächen der
menschlichen Natur hinausgehende Funktion der Tugend. Bei dieser geht es
71
darum, dass der Besitz echter Tugend für andere erkennbar ist und das Verhalten
der anderen durch diese Erkenntnis beeinflusst wird. Andere wissen, dass man
eine konstitutionelle Bindung besitzt, die für sie vorteilhaft ist und versuchen
daher mit dem gebundenen Individuum bevorzugt zu interagieren. Der
ehrenhafte Kaufmann hat sich an eine Kodex innerlich gebunden, der ihn auch
am versteckten und gänzlich unentdeckbaren Betrug hindert. Die Hinderung am
Betrug ist im Einzelfall gerade nicht zu seinem Vorteil. Man wird ihn aber als
Handelspartner suchen, wenn man ihn von anderen Kaufleuten, die nicht so
gewissenhaft sind, unterscheiden kann. Das und nicht der Verzicht im Einzelfall
gereicht dem ehrlichen Kaufmann zum Vorteil.
Zwar ist, im Gegensatz zu dem vorangehenden Fall der Versuchungsresistenz
das tugendhafte Verhalten als solches in dem Augenblicke, in dem es gezeigt
werden muss, nicht einmal langfristig direkt vorteilhaft. Es beinhaltet echten
Verzicht auf einen Vorteil, der wegen seiner unentdeckt (z.B. aus einer völlig
unentdeckbaren kleinen Unterschlagung) auch langfristig keine negativen
Folgen haben wird. Aber die Tatsache, dass andere den Besitz bestimmter
moralischer Orientierungen oder Tugenden erkennen können, führt zu
Verhaltensveränderungen bei den Nachfragern von Tugend. Dies kann als
Besitzer der Tugend oder als Anbieter dieser Eigenschaft vorteilhaft sein.
Um diese zunächst vielleicht kompliziert scheinenden Überlegungen genauer zu
verstehen, müssen wir das Verhältnis von ultimater Tiefenstruktur (bzw. der
Ebene, auf der sich Tugend auszahlt) und proximater Oberflächenstruktur (bzw.
der Ebene, auf der moralisch motivierte Entscheidungen eine Einbusse
darstellen) näher betrachten. Zum Einstieg eignet sich in besonderer Weise ein
einfaches spieltheoretisches Experiment zur „Phänomenologie“ moralisch
motivierten Verhaltens. Nachdem wir auf diese Weise die Oberfläche genauer
untersucht haben, werden wir dann nochmals versuchen, die tieferen Strukturen
besser zu verstehen.
1.2. Das Beispiel des Ultimatumspiels und der Besitz der Tugend
Neben dem bekannten Gefangenendilemma-Spiel dürfte das so genannte
Ultimatumsspiel heute das meist verwendete Bei-Spiel innerhalb der so
genannten experimentellen Ökonomik bilden (vgl. Güth, W., R. Schmittberger
and B. Schwarze (1982), Slonim, R. and A. E. Roth (1998)). Es wurde unter den
verschiedensten Bedingungen gespielt, um hohe und kleine Beträge, unter
72
Angehörigen von Naturvölkern, unter studentischen Spielern, als Zeitungsexperiment usw. Die Ergebnisse unterscheiden sich in interessanten Hinsichten,
sind jedoch im Kerngehalt ziemlich stabil. Sie stellen sich unter dem folgenden
grundsätzlichen experimentellen Design ein:
Ein sogenannter Zuteiler erhält einen Betrag (pie) in Höhe von, p. Man denke
konkret etwa an 10 €. Der Zuteiler darf beliebige ganzzahlige Aufteilungen (x,
y) mit x,y≥0 und x+y=10 vornehmen. Nachdem der Zuteiler seine Aufteilung
(x*, y*) vorgenommen hat, kann er sie nicht mehr verändern. Dem Empfänger
wird die Aufteilung (x*, y*) mitgeteilt und er kann entscheiden, ob er diese
annehmen will. Nimmt der Empfänger an, so erhält er den Betrag y* und der
Zuteiler den Betrag x*. Lehnt der Empfänger jedoch ab, so erhalten beide einen
Betrag von jeweils 0. Der Kuchen geht für sie verloren.
Das Spiel wird typischerweise unter Bedingungen der Anonymität jeweils genau
ein Mal zwischen den gleichen Partnern ohne weiteres Nachspiel gespielt. Dazu
kommunizieren die beiden Akteure etwa über Briefumschläge, die von einem
Raum in einen anderen getragen werden oder auch über Computer-Terminals.
Auf diese Details kommt es nicht wesentlich an. Wesentlich ist die Beobachtung,
dass selbst unter Anonymitätsbedingungen die Zuteilungen typischerweise mehr
als eine Einheit betrugen.
An sich sollte der Empfänger aber dann, wenn er völlig rational mit Bezug auf
seine zukünftigen Interessen handelt, unter Anonymitätsbedingungen jeden
Betrag y*>0, der ihm zugeteilt wird, akzeptieren. Der Zuteiler sollte dies unter
rationalen eigeninteressierten Akteuren antizipieren und nur einen minimalen
Betrag anbieten. Das widerspricht dem tatsächlich beobachteten Verhalten.
Minimale Beträge werden nur in Einzelfällen angeboten und dann auch
gewöhnlich abgelehnt. Häufig werden sogar weit höhere Beträge
zurückgewiesen. Das gilt sogar dann, wenn das Spiel nicht nur um 10 €,
sondern um Beträge gespielt wird, die in der Kaufkraft von mehreren
Monatslöhnen liegen. Bei dem Verstoß gegen die Gebote rein
eigeninteressierten zukunftsgerichteten Verhaltens handelt es sich somit weder
um eine Ausnahmeerscheinung, noch um etwas, das mit der Geringfügigkeit der
auf dem Spiele stehenden Interessen erklärt werden kann.
Der Zuteiler in dem Spiel muss dann, wenn er mehr als minimale positive
Beträge zuteilt, entweder selbst von einer inneren Motivation geleitet werden,
die mit Eigeninteressiertheit nicht übereinstimmt, oder er muss erwarten, dass
der Empfänger von Motiven geleitet wird, die von der Wahrung des eigenen
zukünftigen Vorteils abweichen (beides zugleich kann auch der Fall sein). Der
73
Empfänger, der einen positiven Betrag zurückweist, zeigt damit, dass ihm
andere Gesichtspunkte als der materielle persönliche Vorteil wichtig sind. Wenn
er positive Beträge insbesondere auch unter Anonymitätsbedingungen und dann,
wenn viel auf dem Spiele steht, zurückweist, bringt er eine innere moralische
Orientierung zum Ausdruck. Man spricht hier auch von einer intrinsischen
gegenüber einer extrinsischen Motivation. Das innere Motiv überwiegt unter
Umständen den äußeren Anreiz.
In Ultimatumspielen kommen entsprechende intrinsische Motive zum
Tragen. Der weit überwiegende Anteil solcher Experimente zeigt, dass die
Aufteilung (0.5 p, 0.5 p) vom Zuteiler vorgenommen wird und der Empfänger
diese praktisch immer annimmt. Werden jedoch Aufteilungen wie zum Beispiel
(0.7 p, 0.3 p) vorgenommen, dann kommt es in einer recht großen Anzahl von
Fällen zu einer Zurückweisung und beide Akteure gehen leer aus.
Erstaunlicherweise kann man auch beobachten, dass Aufteilungen wie etwa (0.2
p, 0.8 p) unter bestimmten Umständen abgelehnt werden.
Insgesamt geben die Ergebnisse zu erkennen, dass Menschen intrinsisch
motiviert werden durch bestimmte Vorstellungen davon, wie materielle Güter
inter-personal verteilt werden sollten. Sie lassen sich insbesondere von
Gerechtigkeitsvorstellungen und nicht nur vom eigenen Vorteil leiten. Jemand,
der in dieser Weise angeleitet ist, besitzt – jedenfalls wenn noch gewisse
Zusatzbedingungen erfüllt sind –, insgesamt die Tugend der Gerechtigkeit.
Diese Arten von Motivationen bilden zumindest die Grundlage entsprechender
Tugend. Der Empfänger im Ultimatumspiel bringt diese Tugend insbesondere
dann zum Ausdruck, wenn er Zuteilungen y>0 für sich als zu niedrig oder als zu
hoch ablehnt. In diesen Fällen geht es ihm darum, eine bestimmte Verteilung der
materiellen Vorteile sicherzustellen und nicht darum, seinen eigenen Vorteil zu
wahren.
Der Besitz der Tugend der Gerechtigkeit ist im Ultimatumspiel für den
Empfänger zunächst immer materiell nachteilig. Das gilt jedenfalls dann, wenn
das Spiel nur einmal und unter Anonymitätsbedingungen gespielt wird. Insoweit
kann sich Tugend nicht lohnen. Das gleiche gilt für einen Zuteiler, der es mit
einem rationalen Interessen orientierten Empfänger zu tun hat. Ein solcher
Zuteiler kann dadurch, dass er mehr als den minimalen positiven Betrag zuteilt,
nur verlieren. Wenn er sich an Gerechtigkeitsvorstellungen orientiert, hat das
zunächst nur Nachteile für ihn.
Die Sachlage ändert sich jedoch dann, wenn das Spiel mehrfach und/oder nicht
unter Anonymitätsbedingungen gespielt wird. Dann hat das, was man in einem
74
Spiel tut, Auswirkungen auf die Zukunft. Es gibt nicht nur das Spiel, sondern es
hat auch noch ein Nachspiel. Die Folgen für das Nachspiel müssen bedacht
werden. Insbesondere dann, wenn man mehrfach mit dem gleichen Akteur
interagiert, hat man den eigenen Ruf als gerechtes oder ungerechtes Individuum
etc. zu bedenken. Über diese Arten von Effekten, insbesondere die
Reputationseffekte, wird das gerechte Handeln Ausdruck der langfristigen
Wahrung des eigenen Interesses.
Die Tugend der Gerechtigkeit kann den Akteuren nur insoweit helfen, als sie die
Vernunftseinsicht in das, was das langfristige Eigeninteresse gebietet, unterstützt.
So könnte etwa jemand als Empfänger eine starke Versuchung spüren, einen
gegenüber seinen Gerechtigkeitsvorstellungen zu kleinen Betrag zu akzeptieren.
Es fällt ihm womöglich schwer, das Geld, das er für eine andere Verwendung
gut gebrauchen könnte, liegen zu lassen. Die Vernunft mag ihm zwar sagen,
dass es mit Bezug auf zukünftige Interaktionen der gleichen Art besser wäre,
dem Zuteiler zu signalisieren, dass er als Empfänger generell zu niedrige Gebote
ablehnen wird, doch er könnte den Betrag, der geboten wurde, im Augenblick
sehr gut gebrauchen. In diesem Falle hilft ihm eine emotionale Orientierung an
Normen der Gerechtigkeit und der Besitz emotional verankerten der Tugend der
Gerechtigkeit, seine langfristigen Interessen zu wahren. Genau Analoges gilt für
einen Zuteiler. Er könnte ebenfalls von der Versuchung übermannt werden, von
Gerechtigkeitsvorstellungen abzuweichen und gegen sein eigenes Interesse zu
wenig zu bieten. Das würde in der unmittelbaren Interaktion einen Nachteil
darstellen, weil es zur Ablehnung käme. Es würde aber auch möglicherweise
seinen Ruf für andere Arten späterer Interaktionen beeinträchtigen.
Wenn die Akteure, die die betreffenden Spiele durchzuführen haben, einander
frei suchen und finden können, ist es etwas anders. Dann kann es sein, dass die
Tugend nicht nur eine Gehhilfe für die Vernunft bildet, sondern der Besitz der
Tugend auf eine andere Weise vorteilhaft wird. Wenn man nämlich erkennen
kann, ob andere Tugenden besitzen, dann kann man nach den Tugendhaften als
Interaktionspartnern suchen. Akteure, die selbst tugendhaft sind und etwa im
Ultimatumspiel in der Rolle des Empfängers dazu neigen, zu niedrige Gebote
abzulehnen, haben einen starkes Interesse daran, einen tugendhaften Partner in
der Rolle des Zuteilers zu finden. Wenn Sie nun die Tugend beziehungsweise
das Vorliegen der Tugend bei betreffenden Partnern durch äußere Symptome
oder Signale feststellen könnten, dann werden sie, sofern sie sich die Partner
aussuchen können, nur mit denen interagieren, die die betreffende Signale
senden. Damit wird der Besitz der Tugend unter Umständen vorteilhaft, weil
andere sie erkennen können. Man erhält mehr Chancen zu wechselseitig
75
vorteilhafter Zusammenarbeit, wenn man tugendhaft ist (vgl. zu solchen
Argumenten in Simulationsstudien Schüssler, R. (1990), Vanberg, V. J. and R.
Congleton (1992)). Das gilt insbesondere auf Märkten, die daher besonders
günstige Anreize für die Entwicklung der Tugend setzen.
Selbstverständlich lassen sich Signale fälschen. Das Tierreich ist voll von
Beispielen des so genannten Mimikry’s. Warum sollte die spezielle Spezies
Mensch insoweit gänzlich verschieden sein? Tugend mag im übrigen auch in
verschiedenen Ausprägungen oder in verschiedenen Stärken auftreten. Sie mag
nur gegenüber bestimmten Individuen und nicht gegenüber allen Menschen
gleichermaßen wirksam sein ... und so weiter. Für den gegenwärtigen
Zusammenhang ist zunächst allein wichtig, dass man verstanden hat, auf welche
beiden Weisen innere Bindungen, die unmittelbar unvorteilhaft sind, dennoch
mittelbar von Vorteil für ihren Besitzer sein können:
1. Der Besitz einer inneren Bindungen kann uns dagegen schützen,
unmittelbaren Versuchungen in Situationen, in denen das für uns
langfristig von Nachteil wäre, aufgrund kurzfristiger Eindrücke
nachzugeben.
2. Der Besitz einer inneren Bindungen kann uns dann, wenn deren
Existenz für andere erkennbar ist, zu einem gesuchten Partner machen
und insoweit unsere langfristigen Interessen fördern.
1.3. Vorteilhaftigkeit von Bindungen
Das vorangehende nennt allgemein zwei Bedingungen, unter denen der Besitz
von Moral und Tugend sich für jemanden lohnen kann. Was für Individuen gilt,
gilt in analoger Weise auch für Unternehmen. Auch für Unternehmen als Ganze
gibt es Situationen, in denen die Mitarbeiter, die als Agenten des Unternehmens
Entscheidungen zu treffen haben, der Versuchung zu kurzfristiger
Orientierungen am materiellen Vorteil des Unternehmens erliegen können.
Ebenfalls kann es offenkundig für ein Unternehmen von Vorteil sein, wenn es
möglichen Geschäftspartnern innere Bindungen an bestimmte Standards im
weiteren Sinne moralischer Art signalisieren kann. Denn dann werden die
potentiellen Geschäftspartner sich gerade dieses Unternehmen für ihre Geschäfte
76
aussuchen. In solchen Fällen wird der Besitz der Moral, der Tugend oder die
Neigung zur Beachtung bestimmter ethischer Maßstäbe im praktischen Handeln
eines Unternehmens selbst zum Produktions- bzw. Vertriebsfaktor. Moral und
Tugend lohnen sich.
Die Rolle innerer (moralischer) Bindungen im Rahmen einer aus Eigeninteresse
zu übenden Selbstkontrolle wird häufig unterbewertet. Sie ist jedoch angesichts
der vielen Einzelentscheidungen und der mit diesen einhergehenden
Versuchungen, die wir als Privatpersonen, Unternehmer oder Angestellte zu
treffen haben, keineswegs unbedeutend. Derjenige, der es sich beispielsweise
zur Regel macht, seine Geschäftspartner nicht „über’s Ohr zu hauen“, muss
nicht in jedem Einzelfall überlegen, ob er nun eine goldene Gelegenheit vor sich
hat, bei der er unentdeckt und daher ungestraft einen einseitigen Vorteil für sich
herausholen könnte. Er erspart sich damit nicht nur den Aufwand, in jedem
Einzelfall zu prüfen, ob das Risiko, erwischt zu werden und den guten Ruf zu
verspielen, niedrig genug ist, um den einseitigen Ausbeutungsversuch lohnend
werden zu lassen. Er schützt sich auch gegen das Risiko, in einem der
Einzelfälle der unmittelbaren Versuchung aus emotionalen Gründen
nachzugeben, obwohl die langfristigen Interessen eher ein gegenteiliges
Verhalten gebieten würden (vgl. ausführlich Frank, R. (1992)).
Die Schwierigkeit, unmittelbaren Versuchungen aufgrund von deren zeitlicher
Nähe widerstehen zu können, hängt mit Verhaltensneigungen zusammen, die
tief in der menschlichen Natur verankert sind. Konkret werden die meisten
Menschen, wenn man ihnen beispielsweise im Juni eines Jahres zwei
Investitionsalternativen, die „am 24. Dezember 1000 €“ bzw. die „am 31.
Dezember 1050 €“ einbringen, vorlegen würde, die zweite Alternative wählen.
Die zweite erbringt eine sehr ordentliche Verzinsung für die zusätzliche Woche.
Wenn man die gleichen Personen jedoch am 24. Dezember fragte, würden sie
vielfach die erste Alternative wählen, obwohl eine 5% Verzinsung in
Wochenfrist ansonsten kaum jemals erreicht werden könnte (vgl. umfassend
auch Ainslee, G. (2002), ursprünglich Hume, D. (1739/1978), book III, 7).
Wenn jemand es vermag, sich an feste innere Regeln zu binden, dann kann er
womöglich solchen Versuchungen besser widerstehen. In vielen Fällen wird es
ihm möglicherweise sogar gelingen, aufgrund der festen Regelbindung
bestimmte Optionen gar nicht mehr wahrzunehmen. Soweit dies der Fall ist,
besteht auch keine Gefahr, in Versuchung zu geraten und die langfristigen
Interessen aufgrund emotionaler Faktoren nicht hinreichend in den
Entscheidungen zu berücksichtigen.
77
Die in dem vorangehenden Argument skizzierte Fristigkeit der
Interessenverfolgung ist von großer Bedeutung. Im Rahmen dieses Argumentes
dienen innere Regelbindungen als Instrument langfristiger Interessenverfolgung.
Sie schützen uns dagegen, zum Opfer von Rationalitätsmängeln zu werden.
Diese Funktion von Regelbindungen bildet einen guten Grund, in sich
moralische Tugenden aus eigenem Interesse zu entwickeln. Die Tugenden haben
nach dieser Sicht für einen emotionalen Versuchungen unterliegenden
Entscheider in etwa die gleiche Funktion wie der Mast des Ulysses für den
griechischen Helden. Die Gebundenheit hilft, die langfristigen Ziele ungeachtet
der Schwäche der eigenen Natur zu erreichen (vgl. dazu ergänzend in einem
konstitutionellen Kontext, auf den ich hier nicht eingehen kann, Brennan, H. G.
and H. Kliemt (1990)).
Es gibt über diesen traditionellen Grund für die Entwicklung von Tugenden
hinaus den anderen, zweiten, der nicht unmittelbar mit Rationalitätsschwächen
verknüpft ist. Es kann nämlich, wie bereits am Beispiel des Ultimatumspiels
aufgezeigt, auch auf einer höheren Ebene rational sein, in sich die Tugend zu
entwickeln, unmittelbare Chancen selbst dann nicht wahrzunehmen, wenn es
sich dabei um eine goldene Gelegenheit handelt, in der man nicht ertappt
werden kann. In dieser Situation wäre es rational, z.B. Chancen zur Ausbeutung
eines anderen wahrzunehmen, weil das Risiko der Entdeckung vernachlässigt
werden kann. Trotzdem gibt es einen tieferen Grund, sich auch hier zu binden.
Das ist überraschend, weil es gleichsam per definitionem in einer solchen
Situation unmittelbar und langfristig vorteilhaft ist, die sich bietenden Chancen
wahrzunehmen. Es muss zunächst aussichtslos scheinen, Moral und Interesse
auch im Falle solcher goldener Gelegenheiten in Übereinstimmung zu bringen.
Weil es sich um eine goldene Gelegenheit handelt, fallen das langfristige und
das kurzfristige Interesse auf der Seite der opportunistisch ungebundenen
Ausbeutungschance zusammen. Was könnte einen guten eigen-interessierten
Grund dafür darstellen, sich die Tugend zuzulegen, auch solche Chancen, deren
Wahrnehmung unter Berücksichtigung aller Kausalfolgen des Handelns rational
ist, nicht wahrzunehmen?
Der Witz einer Bindung besteht gerade darin, dass man auf die Wahrnehmung
eines Vorteiles aufgrund der Bindung verzichtet. Es ist insoweit zutreffend, dass
eine innere Bindung an moralische Prinzipien in Situationen, in denen es
rational wäre, die Chance wahrzunehmen, gegenüber der Fähigkeit die Chance
tatsächlich wahrzunehmen, von Nachteil sein muss. Dadurch, dass für andere als
den Akteur selbst das Vorliegen einer inneren Bindungen erkennbar ist, wird die
78
Bindung jedoch, wie wir sahen, u.U. dennoch vorteilhaft. Akteure, die ihre
eigene Bindungen glaubwürdig signalisieren können, werden als
Interaktionspartner von anderen bevorzugt werden. Sie werden von anderen
Akteuren für wechselseitig vorteilhafte Projekte der Zusammenarbeit
ausgewählt werden. Gebundene Akteure werden insgesamt mehr Erfolg haben
als Individuen, die ungebunden sind, weil Dritte mit ihnen und nicht den
ungebundenen Akteuren bevorzugt zusammenarbeiten.
Voraussetzung dafür, dass die gebundenen erfolgreicher als die nicht
gebundenen Individuen sind, ist es, dass man das Vorliegen echter gegenüber
nur vorgespiegelter Bindung feststellen kann. Die Möglichkeiten zur Täuschung
sollte man weder unter- noch überschätzen. Ohne dem an dieser Stelle
umfassend nachgehen zu können, dürften einige kursorische Überlegungen
ausreichen, um den Schluss zurückzuweisen, das echte innere Bindungen
aufgrund der Täuschungsmöglichkeiten generell nicht überlebensfähig sind,
sondern wie die dunkleren Hasen eliminiert werden würden. Es ist nicht
zwingend so, dass die Opportunisten diejenigen, die inneren Bindungen
unterliegen, verdrängen müssten. Dafür sprechen eine Vielzahl alltäglicher
Beobachtungen und auch Experimente (Da die vorangehende wichtige
Argumentation an dieser Stelle nur angedeutet werden kann, hier einige
Hinweise auf breitere und formal genauere Ausarbeitungen der Überlegungen,
vgl. ausführlich dazu Frank, R. (1992), die einführende ausführliche Übersicht
Güth, W. and H. Kliemt (2006) und ergänzend Güth, W. and H. Kliemt (1993),
Güth, W. and H. Kliemt (1994), Güth, W., H. Kliemt and B. Peleg (1999), Güth,
W. and H. Kliemt (2000), Berninghaus, S., W. Güth and H. Kliemt (2003), die
generelle Argumentation von Baurmann 1996 bleibt wesentliches
Hintergrundwissen).
1.4. Bindungen in Aktion
Zunächst zu den weniger alltäglichen Beobachtungen: Menschen springen in
reißende Flüsse um andere zu retten, sie opfern sich auf, um Schaden für viele
zu verhindern und Ähnliches mehr. Häufig mag dies aufgrund spontaner
Augenblicksentschlüsse geschehen. Insoweit könnte man kurzfristige
Rationalitätsmängel für das Auftreten dieser Phänomene verantwortlich machen.
Doch selbst im Falle von Spontanhandlungen lässt sich nicht bezweifeln, dass
die betreffenden Bindungen in dem jeweiligen Augenblick vorliegen und als
proximate Ursache verhaltenswirksam werden. Die betreffenden opferbereiten
79
Akteure handeln insbesondere keineswegs immer ausschließlich im Sinne einer
Wahrung des langfristigen Eigeninteresses. Die negativen Reputationseffekte
etwa, die sich ergeben könnten, wenn man keine heroischen Handlungen
vollzieht, dürften eher gering, die positiven, die bei Vollzug eintreten, dürften
kaum geeignet sein, eine rationale Rechtfertigung für das Eingehen großer
Risiken zu bieten (das gilt selbst dann, wenn man das Argument des
sogenannten Handicap-Prinzips einbezieht, wonach Tiere, die an sich für sie
selbst nachteilige Risiken und Nachteile eingehen, gerade dadurch einen Vorteil
in der sexuellen Selektion für sich erlangen, weil sie eine Fitness signalisieren,
die von den Sexualpartnern gesucht wird und weil auch dort das Handicap in
jedem Falle ein echtes ist, vgl. Zahavi, A. (1975), Zahavi, A. and A. Zahavi
(1998)).
Alles spricht dafür, dass gewisse innere Bindungen in diesen und ähnlichen
Fällen eine Rolle spielen. Dem steht nicht entgegen, dass die betreffenden
inneren Bindungen dann, wenn sich die entsprechenden Anforderungen
wiederholt stellen, allmählich ihre Wirksamkeit verlieren können und
vermutlich auch verlieren werden. Denn selbst dann, wenn Bindungen im
Einzelfall gleichsam koste es, was es wolle, wirksam werden können, wird das
wiederholte Auftreten kostenträchtigen Anforderungen regelmäßig zu einer
Erosion der betreffenden Verhaltensdispositionen zu Gunsten alternativer
Verhaltensweisen führen. Das Ausmaß, in dem Klatsch und Tratsch unter
Menschen gepflegt werden, bildet ebenfalls ein Indiz dafür, dass echte
Gebundenheit in menschlichen Populationen eine Rolle spielt. Wir würden uns
keineswegs in dem Maße, in dem dies tatsächlich festzustellen ist, für die normrelevanten Verhaltensweisen anderer interessieren, wenn wir nicht davon
ausgingen, dass die betreffenden Phänomene als Symptome tiefer liegender
Bindungen anzusehen sind. Denn wären sie nicht als Symptome für echte
Bindungen zu betrachten, dann würde es sich letztlich nicht lohnen, das
betreffende Verhalten nachzuhalten. Denn Klatsch und Tratsch trügen nur zu
einem kollektiven Gut bei, ohne dass der einzelne Akteur etwas davon hätte.
In einer Welt etwa, in der alle Akteure stets nur an der Maximierung des
langfristigen monetären Einkommens interessiert wären, würde es wenig
aussagen, wenn jemand in einer bestimmten Situationen unmittelbare Chancen
vergeben würde. Man wüsste, dass man am Ende auf eine Erklärung stoßen
müsste, die langfristigen Opportunismus beinhaltet. Man könnte allenfalls etwas
über die objektiven Determinanten der Handlungssituation lernen, jedoch nichts
über die inneren Motive des Akteurs. Der Homo oeconomicus classicus, der
strikt an monetärer Einkommensmaximierung interessiert ist und in jedem
80
Einzelfall rational nach Maßgabe der langfristigen Folgen entscheidet, lässt
keine Typenunterscheidungen zu. Der gebundene Typus existierte in
Wirklichkeit gar nicht. Demgegenüber leben wir in einer Welt, in der es
offenkundig sinnvoll ist, den Versuch zu unternehmen, sich über den Typ von
Interaktionspartnern zu informieren (bei Annahme rationaler Erwartungen
brauchen auch die berühmten „Gang of Four Argumente“, wonach man einen
Anreiz haben kann, so zu tun als sei man gebunden und sich entsprechend zu
verhalten, um zur eigenen Reputationsbildung beizutragen, die Annahme einiger
weniger echt gebundener Individuen; vgl. insbesondere Kreps, D., P. Milgrom, J.
Roberts and R. Wilson (1982) und allgemeiner Klein, D. B. (1997) grundlegend
zur Kritik Güth, W., W. Leininger and G. Stephan (1991)).
Es gibt Typen, die offenkundig aufgrund innerer Bindungen handeln und solche,
bei denen das nicht der Fall ist. Die gebundenen Akteure haben Eigenschaften,
die sie entweder als Kooperationspartner oder aber auch als mögliche Objekte
von Ausbeutungsstrategien attraktiv werden lassen. Alle nehmen deshalb ein
Interesse an Informationen über das Vorliegen der relevanten Typ-Eigenschaften.
Deshalb haben alle einen guten Grund, sich für Klatsch und Tratsch zu
interessieren. Denn Klatsch und Tratsch informieren nicht nur über
Verhaltensweisen, sondern indirekt auch darüber, auf welchen Typus innerer
Bindungen und Präferenzen das betreffende Verhalten vermutlich zurückgeht.
Sie sind daher große Stützen der Tugend.
Im übrigen sollte man sich klarmachen, dass es für Menschen aufgrund ihrer
emotionalen Natur recht schwierig ist, rational und kühl in jedem Einzelfalle zu
kalkulieren. Das Vorspiegeln von Tugend ist ein so schwieriger Prozess, dass es
häufig eine kostengünstigere Strategie sein wird, tugendhaft zu sein, als nur
tugendhaft zu scheinen. Man muss andauernd auf seiner Hut sein, wenn man nur
tugendhaft scheinen will, ohne es zu sein. Man verrät sich nur zu leicht etc.
Die Tatsache, dass wir häufig zu Selbsttäuschungen neigen, ist ihrerseits auf
eine etwas komplizierte Weise ein Indiz dafür, dass es schwierig ist, bestimmte
Eigenschaften vorzuspiegeln, wenn man nicht wirklich glaubt, diese zu besitzen.
Da der Besitz von Eigenschaften in bestimmten Situationen zu nachteilig sein
kann, um deren echten Erwerb noch lohnend werden zu lassen, hat sich
vermutlich die Fähigkeit entwickelt, sich selbst solange vorzutäuschen, dass
man bestimmten Normen bedingungslos folgt, bis eine allzu kostenträchtige
Situation auftritt. Dann wird man abweichen. Damit erhält man unter
Umständen einen tragfähigen Kompromiss aus Bindung und potentieller
Ausnahme-Ungebundenheit.
81
Eigentlich wissen es alle, dass bestimmte Regeln nicht um jeden Preis
eingehalten werden. Wenn man beispielsweise an die Unverletzlichkeit der
menschlichen Person und den überragenden Status des Individuums in einer
westlichen Rechtsordnung denkt, dann wird zwar die absolute Unverletzlichkeit
des Individuums proklamiert. Aber das ist letztlich nur bedingt glaubwürdig.
Man darf den einzelnen nicht zum Opfer des Nutzens der Gesamtheit machen.
Wenn beispielsweise zwei Leben gerettet werden können, indem man einen
Einzelnen opfert, dann wird man die Verletzung der Rechte des einzelnen nicht
für akzeptabel halten. Es geht nicht um die Zahlen, sondern darum, Rechte
einzelner nicht zu verletzen. Wir dürfen nicht einen opfern, um die zwei zu
retten. Wenn es allerdings um den Vergleich zwischen einem und 200
Individuen geht, dann fangen viele an zu zweifeln. Gehen wir von den 200
Individuen zu 2000 über, wird das Problem noch dramatischer und es wird noch
unglaubwürdiger, dass wir tatsächlich die Normen der Gerechtigkeit
bedingungslos einhalten werden.
Dennoch bestehen wir in der Öffentlichkeit darauf, die bedingungslose
Einhaltung von Normen zu fordern. Im öffentlichen Diskurs ist es selber eine
Norm, diese Norm zu unterstützen. Wir haben es mit einer so genannten MetaNorm zu tun. Deren Beachtung ist wichtig. Dennoch wäre es eine
gesellschaftliche Selbsttäuschung, wenn wir einen die bedingungslose
Beachtung bestimmter Normen auch in allen Extremfällen tatsächlich glauben
würden. Wir täuschen uns allerdings auch in einem solchen Falle nicht darüber,
dass wir bestimmte tugendhafte Dispositionen besitzen, sondern nur darüber,
dass wir diese bedingungslos anwenden werden. Wir glauben uns womöglich in
letzter Konsequenz selbst nicht, dass wir bestimmte Dinge koste es, was es
wolle, vollziehen werden. Wir glauben aber daran, dass wir auch ziemlich hohe
Kosten hinnehmen werden. Die Bereitschaft dazu unterstützen wir, indem wir
wenigstens öffentlich eine Moral für Heilige und Heroen proklamieren.
Sieht man von den wenigen echten Heiligen und Heroen ab, so ist das Ausmaß
unserer Opferbereitschaft am Ende tatsächlich nur begrenzt (zu den letzteren
Urmson, J. O. (1958), Heyd, D. (1982)). In der Begrenzung zeigt sich, dass es
Grenzen der Regelbindung gibt. Bis zu den Grenzen liegen aber durchaus echte
Regelbindungen vor. Und selbst dann, wenn moralische Orientierungen
zuverlässig nur unter relativ kleinen Kosten funktionieren würden, hätte das
nicht zur Folge, dass sie deshalb von geringer Bedeutung wären.
Kostenasymmetrien erlauben es nämlich, dass häufig große Kosten für
82
bestimmte Individuen nur mit kleinen Kosten für andere Individuen erzeugt
werden können (vgl. dazu ausführlicher Kliemt, H. (1986)).
Hierarchien in menschlichen Populationen beruhen auf ähnlichen
Orientierungen und Sachverhalten. Denn jede Form der Organisation nutzt
Kostenasymmetrieen aus. Lob und Tadel etwa können gewöhnlich von
Handlungsbeobachtern zu niedrigen Kosten für sich selbst verteilt werden,
zugleich aber für deren Empfänger von großem Gewicht sein (vgl. grundlegend
dazu Coleman, J. S. (1988), ergänzend Kliemt, H. (1993)). Ein klassisches
Beispiel dafür bietet die Rolle eines Richters, für den von seinem Urteilsspruch
typischerweise nichts, für die Betroffenen jedoch typischerweise viel abhängt.
Wir gehen davon aus, dass Richter bereit sind, kleine Kosten auf sich zu nehmen.
Die meisten von uns denken aber, dass auch ansonsten unparteiische Richter
unter massiven äußeren Anreizen positiver oder negativer Art (Bestechungen
oder Drohungen) beeinflussbar sein könnten. Das tut aber der Tatsache, dass die
Richter im Normalfall unparteiisch agieren, keinen Abbruch.
Es macht einen großen Unterschied, ob man in einem Rechtssystem lebt, in dem
sich die Richter – außer in Extremfällen – an den Regeln orientieren und eine
innere feste Bindung an diese Regeln besitzen oder ob man unterstellt, auch
Richter würden in jedem Einzelfall opportunistisch-rational nach ihrer je
eigenen Interessenlage entscheiden. Das gleiche gilt für die Angestellten eines
Unternehmens. Wenn diese stets jeden Einzelfall nach opportunistischen
Kriterien entschieden und niemals nach Regeln vorgingen, dann wäre die
Stabilität der Organisation bzw. des Unternehmens kaum erklärlich. Ohne die
Existenz echter Bindungen auf individueller Ebene kann man die Existenz
geordneter Regelsysteme auf kollektiver Ebene einfach nicht angemessen
erklären (politisch hat das bereits Hume verstanden und später Hart
ausgearbeitet vgl. Hume, D. (1985), insbes. iv, Hart, H. L. A. (1961), vgl. auch
Barry, N. (1981), Kliemt, H. (1985)). Die Existenz und Wirkungsweise von
Organisationen und Institutionen kann man verstehen, wenn man im echten
Sinne regelbefolgendes Verhalten auf Seiten der Individuen zulässt. Lässt man
es aber zu, dann hat man sowohl das klassische Modell des Homo oeconomicus
hinter sich gelassen, als auch die Möglichkeit im weiteren Sinne moralischer
Bindungen anerkannt.
Die Konsequenzen von alledem scheinen recht klar zu sein: Wenn wir von der
Existenz von Regelbindungen in unseren proximaten Verhaltenserklärungen
ausgehen, haben wir zwar das Standardmodell der ökonomischen Theorie
aufgegeben. Echte Tugenden und moralische Orientierungen spielen eine
83
systematische Rolle in unserem Weltbild. Interessenorientiertes Verhalten, dass
in jedem Einzelfall eine opportunistisch rationale, die eigene
Interessenbefriedigung maximierende Alternative wählt, ist nicht alles, wenn wir
uns die Welt und ihre Abläufe erklären wollen. Das bedeutet jedoch nicht, dass
wir nicht eine interessenorientierte Perspektive einnehmen könnten. Die Frage,
ob nicht die Regelbindungen auf einer ultimaten Ebene damit erklärt werden
können, dass deren Vorhandensein dem Träger der Bindungen nützt, ist eine
höchst sinnvolle, wenn nicht sogar die wichtigste Frage einer
moralpsychologisch informierten Moraltheorie (sie beantwortet zugleich die
Platonische Herausforderung, eines Rings des Gyges, der uns unter Wahrung
des äußeren Scheines der Tugendhaftigkeit erlauben würde, beliebige
Schandtaten im verborgenen zu begehen).
In den vorangehenden Erwägungen ging auch darum, den Nachweis zu führen,
dass die Bindung an bestimmte Regeln und das Entwickeln der entsprechenden
Tugenden im Interesse des Trägers dieser Bindungen und Tugenden sein kann.
Wir haben eine ultimate Erklärung dafür gegeben, dass das echte Vorliegen von
Bindungen und Tugenden selbst dann für den Träger nützlich sein kann, wenn er
nicht unter Rationalitätsmängeln und emotionalen Versuchungen leidet. Die
echte Bindung kann sich dann bewähren, wenn sie erkennbar ist. Ob eine solche
Erkennbarkeit tatsächlich vorliegt, kann man angesichts der vielfachen
Fähigkeiten zur Verstellung bezweifeln. Demgegenüber wurden jedoch einige
Plausibilitätsgründe dafür angeführt, dass das Vorliegen echter Tugend in
persönlichen inter-individuellen Beziehungen vermutlich mit so großer
Verlässlichkeit festgestellt werden kann, dass von deren Vorhandensein
ausgegangen werden darf. Insbesondere die vielen Bemühungen darum, das
Vorliegen echter Bindungen festzustellen, deuten daraufhin, dass sich der
Aufwand für jene, die diese Anstrengungen unternehmen, lohnen muss.
Umgekehrt bietet dies aber auch ein Indiz dafür, dass es sich lohnen wird, die
betreffenden echten Bindungen zu entwickeln. Wie bei allen Gleichgewichten
stützen sich die beiden Strategien wechselseitig aufgrund der
Interaktionsbedingungen.
Soweit Bindungen zum Profit beitragen, was sie nach den vorauf gehenden
Überlegungen vermutlich in hohem Maße tun, gibt es gute ökonomische Gründe
dafür, sie einzugehen. Es frag sich allerdings, in welchem Umfang auf
Konkurrenzmärkten diese Logik wirkt. Die Frage stellt sich, ob nicht der Markt,
indem er das Streben nach Profit im Konkurrenzkampf verlangt, die Tugend
zum Verschwinden bringen kann. Lohnt sie sich am Ende vielleicht doch nicht?
84
2. Profiterzielung als moralische Aufgabe?
Die meisten heutigen Vertreter der Wirtschaftsethik setzen sich mit einer
Position auseinander, die gern mit Milton Friedmans Namen verknüpft wird.
Typischerweise konzentrieren sie sich darauf herauszustellen, dass Friedman
gefordert hat, dass sich Unternehmen am so genannten „shareholder value“ zu
orientieren haben, um dann diese Auffassung umgehend als „zu
eng“ zurückzuweisen. Die übliche Sicht auf seinen Beitrag und die dahinter
stehenden moralischen und empirischen Überzeugungen wird jedoch Friedman
nicht gerecht. Zwar ist es zutreffend, dass Friedman die Unternehmensleitung
als einen (korporativen) Agenten 8 der Eigentümer ansieht. Die Besitzer des
Unternehmens haben das legitime Recht, die Unternehmensleitung dafür
verantwortlich zu machen, dass die Ziele der Eigentümer des Unternehmens
verfolgt werden. Aber es wäre verfehlt, Friedman deshalb zu unterstellen, er
würde den Wert moralischer Bindungen für die Interessenwahrung abstreiten.
Wenn seine Kritiker Friedman derartiges unterstellen, dann deshalb, weil sie im
Gegensatz zu Milton Friedman die zuvor geschilderten Funktionen und
Möglichkeiten moralischer Bindungen im Rahmen der langfristigen Interessenwahrung nicht richtig einschätzen. Moral kann profit-wahrend sein und soweit
sie es ist, wird sie im Rahmen einer Friedmanschen Sicht gefordert.
Es trifft zu, dass Friedman sich am klassischen Eigentumskonzept orientiert.
Solange die Eigentümer im wesentlichen an Profiten interessiert sind, haben sie
das Recht, die jeweilige Unternehmensleitung auf die Verfolgung des
Profitzieles zu verpflichten. Falls jedoch die Besitzer des Unternehmens
mehrheitlich beziehungsweise nach der jeweils satzungsgemäßen Superioritätsmehrheit der Auffassung sein sollten, dass beispielsweise Marktanteile oder aber
irgendwelche anderen aus Sicht der Eigentümer dem Profit übergeordneten
Ziele verfolgt werden sollten, so wären diese Zielsetzungen für die
Unternehmensleitung verbindliche externe Vorgaben, denen sie ihre eigenen
Zielsetzungen zu unterstellen hätte.
Da die Eigentümer die Unternehmensleitung prinzipiell auf nahezu beliebige
rechtskonforme Zielfunktionen als Teil eines Zielvektors festlegen könnten,
stellt sich unmittelbar die Frage, ob man gegenüber den Eignern als moralischen
Subjekten Argumente dafür vorbringen könnte, eine andere Zielfunktion als die
8
Hier steuert ein korporativer Akteur als Gremium einen größeren korporativen Akteur.
85
der Profitmaximierung zu wählen. Die meisten, die sich mit Wirtschafts- und
Unternehmensethik befassen, scheinen das für eine Frage zu halten, die man
(z.B. als ethischer im Gegensatz zu einem ökonomischen Berater der
Unternehmensleitung) positiv zu beantworten hat. Aus Sicht fast aller
Unternehmensethiker gibt es gute Gründe dafür, andere Ziele als die Mehrung
des Profits zu verfolgen. Die umsichtigeren unter ihnen werden tendenziell
anerkennen, dass die Erzielung von Profiten eine notwendige Bedingung für die
Verfolgung anderer Ziele ist. Sie wissen, dass das Unternehmen zunächst einmal
dauerhaft überleben muss, damit es die anderen ihm eventuell zu stellenden
Aufgaben erfüllen kann. Doch werden sie zugleich betonen, dass es dem
Profitstreben übergeordnete höhere Ziele auch des Wirtschaftens gibt.
Es lassen sich ungeachtet der Überzeugungen der meisten Unternehmensethiker
allerdings einige Argumente dafür vorbringen, dass es aus moralischen Gründen
wünschenswert und nicht nur entschuldbar ist, sich an der Zielsetzung des
Profits zu orientieren. Das ist nicht nur deshalb so, weil die Unternehmensleitung gegenüber den Eigentümern (meist Aktionären) die eine Orientierung am
Shareholder value wünschen, eine Verantwortung hat. Auch die Aktionäre
sollten möglicherweise nicht aus Eigeninteresse allein, sondern aus
übergeordneten moralischen Gründen ein solches Verhalten von ihrer
Unternehmensleitung verlangen. Denn das zuvor angeführte Argument, dass in
komplexen Marktwirtschaften niemand wissen kann, welche Aktionen das
Gemeinwohl am meisten fördern, gilt auch hier.
Ohne die Marktsignale wüssten die Akteure in einer dezentral gelenkten
Wirtschaft nicht, wie sie ihre Ressourcen einsetzen sollen. Die Profitsignale
sagen ihnen, was sie tun sollen. Wer Profite maximiert, orientiert sich dadurch
an der Bewertung der je eigenen Leistung durch andere. Es wird über der
egoistischen Anreizseite des Marktes immer vergessen, dass der Markt und die
Bereitschaft, den Marktsignalen zu folgen, auch diese andere Seite hat. Es sind
nicht die eigenen Werte und Ziele, sondern die Werte und Ziele anderer
vermittelt durch die Regeln des Marktes, die das am Profit orientierte Verhalten
steuern.
Unter freivertraglichen Marktbedingungen hat man kein Anrecht darauf, dass
die je eigenen Bedürfnisse von anderen Marktteilnehmern gestillt werden. Man
muss dazu erst einmal die Bedürfnisse der anderen befriedigen. Nur in dem
Maße, in dem man sich deren Wertungen unterordnet, erwirbt man ein Anrecht
darauf, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Nut soweit, wie man zur
86
Bedürfnisbefriedigung anderer beiträgt,
Bedürfnisbefriedigung zu unterstützen.
sind
diese
bereit,
die
eigene
Die Unterwerfung unter die Bewertung durch andere empfinden die meisten
Menschen als unangenehm. Marktgegner erklären zwar, dass sie gegen den
Markt sind, weil er den Egoismus prämiiert. Subjektiv ist das in den meisten
Fällen auch ehrlich. Dass man sich den Bewertungen durch andere zu
unterwerfen hat, ist aber gewiss ein ebenso starkes, wenn auch häufig nur
unbewusst wirkendes Motiv der Marktfeindschaft. Wer unterwirft sich schon
gern der Bewertung durch andere?
Denkt man an die heutige Wertschätzung von Evaluationen und ähnlichem,
dann sollte man die Evaluation durch Märkte noch höher schätzen. Die
Marktregeln und Märkte im allgemeinen haben augenscheinlich wesentliche
moralische Qualitäten. Kein einzelner Marktteilnehmer kann den anderen das
Geschehen diktieren (jedenfalls solange es keine monopolistischen Strukturen
gibt). Selbst Märkte mit Unvollkommenheiten führen, (wie z. B. die
Experimente von Vernon Smith zeigen; vgl. Smith, V. L. (1962), Smith, V. L.
(2000), Smith, V. L. (2003)) zu einer Maximierung der Summe aus
Konsumenten- und Produzentenrenten (Wohlfahrt). Das Gemeinwohl wird
insoweit durch Marktkonkurrenz und die Unterwerfung unter die anonyme,
nicht-persönliche Bewertung des Marktes gefördert.
Damit, dass man die Effizienz der Marktallokation und die gesamtwohlfahrtssteigernde Wirkung von Märkten auch in Gegenwart von MarktUnvollkommenheiten betont, hat man den Markt keineswegs endgültig
moralisch gerechtfertigt. Man hat aber ein starkes Argument für den Markt
vorgebracht. Denn dann, wenn man davon ausgeht, dass ein höheres Maß an
Bedürfnisbefriedigung generell einem niedrigeren Maß vorzuziehen ist, dann
gibt es einen guten Grund dafür, den zu verteilenden Güterkorb durch effiziente
Allokation der Ressourcen möglichst groß werden zu lassen. Die moralische
Grundnorm der Wohltätigkeit verlangt -- ceteris paribus --, dass man ein Mehr
an Gütern einem Weniger an Gütern vorzieht.
Das Argument, dass die Wahl von Profiten als Signalen zu einer den
alternativen Allokationsmechanismen überlegenen Steuerung der RessourcenAllokation führen, ist im übrigen weitgehend unabhängig vom Egoismus oder
Altruismus der jeweiligen Verhaltensmotivation. Zwar wird im allgemeinen das
Profitmotiv nahezu analytisch mit einem Egoismus in der Verfolgung des
Profizieles identifiziert. Doch man kann Profite als Steuerungsinstrumente
benutzen, ohne auf die eigeninteressierte Aneignung der Profite abzustellen.
87
Wie stark das Argument für die Profitorientierung in Allokationsentscheidungen
ist, sieht man gerade dann, wenn man sie von einer Orientierung am eigenen
Interesse trennt (vgl. zu diesem Vorschlag Carens, J. (1981)). Wenn Menschen
sich beispielsweise an der zentralen sozialistischen Maxime des „jeder nach
seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!“ richten wollen, dann
sollten sie auf jeden Fall auch ein Interesse daran haben, dass die Bedürfnisse
möglichst umfassend befriedigt werden können.9 Damit haben sie ein Interesse
daran, den Wert des Warenkorbes möglichst zu steigern. Der Nutzwert des
Warenkorbes wird aber nur dann maximal werden, wenn sich alle in jedem
Augenblick an den Effizienzsignalen zur Koordination des Wirtschaftens
orientieren. Der Markt liefert diese Signale.
Nehmen wir für den Augenblick einmal zur Vereinfachung des weiteren
Argumentes an, dass alle Menschen gleiche grundlegende Bedürfnisse haben.
Nehmen wir auch an, dass bei gegebenem Stand der technischen Entwicklung
nicht alle Bedürfnisse bis zur Sättigung befriedigt werden können. Wenn man
davon ausgeht, dass alle ein gleiches Anrecht auf die Befriedigung ihrer
Bedürfnisse haben sollen, dass ihnen also nach ihren Bedürfnissen gegeben
werden soll, während sie alle nach ihren Fähigkeiten und damit so viel und so
gut sie können zur Bedürfnisbefriedigung aller beitragen wollen, kann man ein
einfaches Marktmodell zur optimalen Umsetzung der sozialistischen Maxime
vorschlagen: Jedes Wirtschaftssubjekt müsste sich im Rahmen seiner
Fähigkeiten anstrengen, ein möglichst hohes Einkommen beziehungsweise
möglichst hohe Profite zu erzielen. Dadurch wäre gewährleistet, dass alle zu
allen Zeiten die Ressourcen ihren produktivsten Verwendungen zur Erstellung
des festen Warenkorbes, der jedem nach seinen Bedürfnissen zugeteilt werden
soll, zuführen.
Alle würden ein Zuteilungseinkommen unabhängig von ihrem Leistungsbeitrag
beziehen. Das nur nach Bedürfnissen bestimmte Einkommen, könnte ihnen
keine Informationen mehr darüber bieten, wie hoch die anderen ihre Leistungen
bewerten. Damit die Marktsignale zur effizienten Koordination des
Wirtschaftens weiter funktionieren, müssen weiterhin normale Profite und
Löhne etc. gezahlt werden. Es kann jedoch dafür gesorgt werden, dass das
gesamte Einkommen jeweils an die Allgemeinheit abgeführt wird. Diese
konfiskatorische Maßnahme wird keine negativen Wirkungen auf die Effizienz
des Wirtschaftens haben, wenn alle Beteiligten aus moralischen Gründen wie
Profitmaximierer agieren. Die Steuerungswirkung über Anreize entfällt. Sie
9
John Stuart Mills recht umfassende Diskussion der Maxime in seiner „Political Economy“, die auch die
Quellen nennt, aus denen sich Marx und Engels nach ihren Bedürfnissen bedient haben, ist zu wenig bekannt.
88
wird durch die moralische Verpflichtung, sich wie ein Profitmaximierer zu
verhalten, ersetzt. An die Stelle sogenannter extrinsischer Motivation durch
äußere Anreize tritt die intrinsische Motivation durch eigene innere Antriebe.
Die Informationswirkung der Marktsignale bleibt über Preise und Profite
erhalten, doch am Ende erhält jeder das gleiche.
Das vorangehende Argument verliert seine Gültigkeit nicht, wenn die Menschen
unterschiedliche Bedürfnisse haben. Diese müssten festgestellt und es müsste
dann festgelegt werden, in welchem Ausmaß sie jeweils zur Befriedigung
anstehen. Die sozialistische Maxime des „jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem
nach seinen Bedürfnissen!“ würde dann nicht nur auf der Beitragsseite, auf der
unterschiedliche Fähigkeiten zum Zuge kämen, sondern auch auf der
Befriedigungsseite zu unterschiedlichen – äußerlich ungleichen –
Behandlungsweisen führen. Diejenigen, die beispielsweise aufgrund von
chronischen Krankheiten dauerhaft gesteigerte Bedürfnisse aufweisen würden,
könnten in diesem Rahmen ohne weiteres zusätzlich versorgt werden. Eine
schematische Gleichheit der Bedürfnisbefriedigung ist keineswegs
Voraussetzung dafür, dass das Schema funktioniert. Man muss nur den Vektor
der zu befriedigenden Bedürfnisse kennen, um die Mechanismen des Marktes
wirksam werden zu lassen.
Nach dem vorangehenden Argument müsste sich eine Gesellschaft aufrechter
Sozialisten des Marktes bedienen. Fraglich ist allerdings, inwieweit das
vorangehende Argument Geltung besitzen kann, wenn Menschen nicht
ausschließlich moralisch motiviert sind. Diejenigen, die nur die Förderung des
Gemeinwohls in Sinn haben und deshalb ausschließlich Profite maximieren,
benötigen keine differentiellen Anreize, um sich für die richtigen Dinge im
richtigen Ausmaß anzustrengen. Sie handeln in der betreffenden Weise ohnehin
aus intrinsischer Motivation. Gibt man jedoch diese Prämisse auf und unterstellt,
dass Individuen auch wesentlich davon motiviert werden, dass sie sich über eine
Aneignung der Profite ein höheres Ausmaß an Bedürfnisbefriedigung
ermöglichen können, dann könnte sich die Situation verändern.
Wenn die Menschen ausschließlich aus dem moralischen Motiv heraus handeln,
das Gemeinwohl so stark wie möglich zu fördern, dann ist es moralisch legitim,
sie ausschließlich auf „uneigennützige Profitmaximierung“ festzulegen. Wenn
sie jedoch nicht völlig uneigennützig handeln, sondern sich die Profite privat
aneignen wollen, dann könnte dies dazu führen, dass man auch die Verfolgung
des Profitmotives anders bewertet.
89
Obwohl zweifelsohne einiges für eine solche Umbewertung sprechen könnte, so
sollte man nicht übersehen, dass ein zentrales moralisches Argument für den
Markt bestehen bleibt. Er fordert eine Bewertung durch Dritte beziehungsweise
durch deren Bedürfnis-Befriedigungswünsche und verlangt uns damit ab, die
Werte anderer zu berücksichtigen und zu respektieren. Die Maximierung des
Profils erfordert auch dann, wenn man sich den Profit aneignen und ihn nicht
mehr an die Allgemeinheit abführen will, dass man sich nach den anderen, den
Nachfragern der eigenen Leistungen richtet. Deren Wünsche sind
ausschlaggebend für die von ihnen gezeigte Zahlungsbereitschaft. Nicht die
Wünsche des Anbieters, sondern die des Nachfragers von Leistungen diktieren
das Geschehen.
Das Diktat der Nachfrager von Leistungen wird von denjenigen, die
Unternehmensleitungen die Verfolgung von moralischen Zielen nahe legen,
nicht – jedenfalls nicht ohne Einschränkungen – akzeptiert. Sie verlangen, dass
die Firma nicht nur aufgrund dieser Signale agiert, sondern als Anbieter und
auch als Nachfrager von Leistungen bestimmte moralische Orientierungen
zugrunde legt. Dadurch werden womöglich wichtige moralische Anliegen
gefördert. Allerdings darf man darüber nicht übersehen, dass man sich
gegenüber den einzigen verlässlichen Signalen dafür, was die Individuen
wirklich wollen, den Marktsignalen taub stellen muss. Auch das kann man
vertreten, aber muss sich bewusst sein, dass man zur ethischen Begründung
dieses Vorgehens, Argumente etwa von der Form der marxistischen
Entfremdungslehre benötigt. Mit solchen Argumenten ist es nämlich ethisch
plausibel möglich, die von den Individuen auf den Märkten selbst offenbarten
Wünsche und Neigungen nicht zu respektieren, sondern beispielsweise als
„falsche Bedürfnisse“ ethisch zu diskreditieren.
Die moralischen Schwierigkeiten, die sich aufgrund der Verfolgung ethischer
Orientierungen ergeben können, reichen jedoch noch weiter. Denkt man etwa an
Firmen, deren Wirtschaften unter das Ziel der Nachhaltigkeit gestellt wird, weil
die Nachfrager von Produkten der Firma dies wünschen, dann ist das zunächst
völlig marktkonform. Es wird aber Auswirkungen nicht nur auf das Verhalten
der Firmen als Anbieter, sondern auch auf das Verhalten der Firmen als
Nachfrager von Gütern haben. In der Regel wird unterstellt, dass diese
Auswirkungen ebenfalls „moralisch“ positiv sein werden, wenn die
Konsumenten aus moralisch positiv zu wertenden Motiven heraus zwischen
Anbietern diskriminierten. Dass die weiteren Folgen der moralisch motivierten
Diskriminierung selbst moralisch wünschenswert sein werden, ist allerdings
90
keineswegs selbstverständlich, mögen die Motive der Konsumenten auch noch
so hochherzig sein.
Die Nachfrage etwa nach „politisch korrektem“ Kaffee hat gewiss dazu geführt,
dass bestimmte Kaffeefirmen ihren Lieferanten Mindestabnahmepreise
garantieren, was zunächst einmal für die Lieferanten der betreffenden
Kaffeemengen einschränkungslos vorteilhaft zu sein scheint. Bei den Anbietern,
denen entsprechende Abnahmequoten, Abnahmepreise bzw. eine Kombination
aus beidem garantiert werden, kommt es zu einer Wohlfahrtsteigerung. Da diese
Anbieter jedoch mit anderen Anbietern von Kaffee in Konkurrenz stehen,
werden diese Konkurrenten letztlich geschädigt. Diese können nicht mehr um
die betreffende garantierte Nachfrage konkurrieren.
Nur eine vollkommene Monopolisierung des Kaffeemarktes insgesamt könnte
hier ausgleichend wirken und allen einen „gerechten Anteil“ garantieren. Eine
solche Monopolisierung würde zu höheren Kaffeepreisen beim Endverbraucher
führen. Ob sie allerdings nachhaltig zu einer Erhöhung der Erzeugerpreise
führen könnte, scheint überaus zweifelhaft zu sein. Entweder würde das
Monopol als Nachfragemonopol die Preise sogar drücken oder aber es müsste
bestimmter Abnahmequoten für bestimmte Anbieter definieren, ohne diesen zu
erlauben, die Ausbringungsmengen über die Garantienmengen hinaus zu
erhöhen und zu verkaufen. Wohin solche Strategien führen, kann man ausgiebig
am Beispiel des europäischen Agrarmarktes mit allen seinen fragwürdigen
Wirkungen studieren. Auch hier waren die Motive häufig hochherzig, auch hier
sind die Wirkungen allerdings alles andere als dazu angetan, ein ähnliches
System auf breiter Front zu empfehlen. Insbesondere die Schädigung der
Interessen von Agraranbietern aus der Dritten-Welt erscheint als eine von der
europäischen Agrarpolitik verursachte moralische Scheußlichkeit.
In der vorangehenden Argumentationsskizze fehlt eine genaue Ausarbeitung
solcher Aspekte wie der Frage nach einer angemessenen Berücksichtigung
moralischer Vorstellungen von Aktionären und manches andere von
wirtschaftsethischer Relevanz. Man darf die Skizze schon deshalb nicht
überbewerten. Sie dient allein dazu, bestimmte komplexe Zusammenhänge
exemplarisch zu verdeutlichten. Es geht um begriffliche beziehungsweise
konzeptuelle Probleme und nicht um Fragen direkter praktischer Umsetzung.
Dennoch dürften die vorangehenden Überlegungen ausreichen, um aufzuzeigen,
dass die Orientierung an Profiten und effizienter Allokation gerade auch aus
moralischen Gründen nicht ohne weiteres aufgegeben werden kann. Man bezahlt
einen moralischen Preis für eine zu naive Verfolgung moralischer Motive. Der
91
gute Wille und die Auffassung, auf der moralisch sicheren Seite zu sein,
entschuldigt nicht alles und insbesondere nicht die Vernachlässigung nüchterner
ökonomisch informierter Analyse. Die Motive mögen zwar im Sinne einer
alltäglichen Vorstellung vom moralisch Rechten einleuchtend sein, doch es ist
überhaupt nicht klar, ob sie auch bei einer genaueren wirtschaftsethischen
Betrachtung als moralisch gerechtfertigt erscheinen würden. Ein
Überlegungsgleichgewicht in solchen Fragen hätte allen diesen Einsichten
Rechnung zu tragen.
Nachdem wir zunächst einige Fälle betrachtet haben, um unsere Intuitionen
herauszukitzeln und im nächsten Schritt untersucht haben, in welchem Ausmaß
moralische Steuerung in der Realität möglich und präsent ist, wenden wir uns
nun Theorien zu, die eine solche moralische Steuerung menschlichen Verhaltens
gestalten wollen. Die nächsten Kapitel werden sich mit ethischen Theorien als
zusätzlichen Aspekten unserer Suche nach einem Überlegungsgleichgewicht
befassen. Sie gehen über die vorangehenden pragmatischen Argumente der
praktischen (oder angewandten) Ethik hinaus. Die allgemeinen ethischen
Theorien betreffen weit stärker die Festlegung des Ordnungsrahmens als die
Bestimmung einzelner Handlungen, die in diesem Rahmen vollzogen werden
sollen. Dennoch können sie vermutlich indirekt auch Auswirkungen darauf
entfalten, was wir im unmittelbaren Vollzug unserer wirtschaftlichen und
unternehmensbezogenen Praxis für richtig halten. Ethische Theorien können
keineswegs den Anspruch auf so genanntes Orientierungswissen einlösen, doch
wenn wir um sie wissen, können wir uns in der Praxis manchmal leichter
zurechtfinden. Wir können unser eigenes moralisches Urteil nicht zu Gunsten
der ethischen Theorie suspendieren. Bedürfen keineswegs einfach nachbeten,
was irgendwelche ethischen Theoretiker uns vorschlagen. Eine direkte grade zu
Ingenieur wissenschaftliche Anwendungen der Ethik scheidet zumal im
wirtschaftlichen Bereich aus. Dennoch kann es uns unter Umständen bei der
eigenen Orientierung in normativen Fragen helfen, grundsätzliche ethische
Theorien zu kennen. Einem solchen ersten kennen lernen dienen die
nachfolgenden Skizzen, wobei schon um der besseren Lesbarkeit und Kürze
willen, recht kräftig Akzente gesetzt und Vereinfachungen vorgenommen
wurden. Wie der Student vor dem Examen Mut zur Lücke zeigen muss, so
wurde auch hier viel Mut bewiesen. Trotzdem hat sich hoffentlich ein
einigermaßen ausgewogenes kritisches Bild ergeben. Der Leser wird
ausdrücklich aufgefordert, gegebenenfalls die Originalliteratur zu konsultieren,
um auch die vielfach ethik-kritische Sicht der nachfolgenden Zeilen kritisch zu
beleuchten.
92
IV. Allgemeine ethische Hintergründe
und Methoden der Wirtschaftsethik
Die nachfolgenden Überlegungen zur ethischen Theorie, sind für diejenigen, die
sich bereits mit Ethik befasst haben, teilweise wiederholenden Charakters. Die
Versatzstücke der aktuellen Ethik-Diskussion, die im weiteren präsentiert
werden, sind jedoch spezifisch darauf zugeschnitten, in eine eigenständige
Suche nach wirtschaftsethischen weiten Überlegungsgleichgewichten (WÜG)
einfließen zu können. Dabei wird auf eine enge Verbindung zur Theorie
rationaler Entscheidungen und zur Sozialphilosophie Wert gelegt.
1. Ethik und Entscheidung
Der Mensch nimmt seine Umwelt nicht nur als Beobachter wahr. Er handelt
auch, um sie zu verändern. Wie er sich zur Umwelt in seinem Handeln stellt,
ergibt sich daraus, was er über sie weiß, und daraus, was er zu erreichen
wünscht. Überzeugungen und Wünschen, Kenntnis darüber, wie die Weltabläufe
sein werden und Wünsche, wie sie sein sollen, dies sind die beiden
Grundfaktoren, die die Wahl von Handlungen bestimmen.
Kurz: Nach dem Grundmodell rationalen Handelns entscheiden wir uns für
eine Handlungsalternative im Lichte unserer Überzeugungen darüber, wie die
Welt beschaffen ist und unserer Wünsche darüber, wie sie beschaffen sein sollte.
Mit Aristoteles zu sprechen, können wir feststellen: Es gibt „zwei Teile der
Seele, den vernunftbegabten und den vernunftlosen. Nun soll der vernunftbegabte auf dieselbe Weise eingeteilt werden. Und zwar setzen wir voraus, dass
es zwei vernunftbegabte Teile gebe, einen, mit dem wir jene Wesen betrachten,
deren Ursprünge nicht so oder anders sein können, und einen anderen, mit dem
wir jene betrachten, die sich so oder anders verhalten können. … Der eine Teil
heiße nun der forschende, der andere der berechnende. Überlegen und
Berechnen ist nämlich dasselbe, und keiner überlegt sich Dinge, die sich nicht
anders verhalten können, als sie tun.“ (Nikomachische Ethik, Sechstes Buch,
1139 a 3- a13, Artemis-Ausgabe, O.Gigon)
Das „Berechnende ist“ für Aristoteles „Teil des Vernunftbegabten“ (Nikomachische Ethik, Sechstes Buch, 1139 a14, Artemis-Ausgabe, O.
93
Gigon). Das Vermögen zur „Berechnung“ setzen wir ein, um strategisch unsere
Ziele zu verfolgen. Diese Vernunftbegabung versetzt uns dazu in die Lage,
Kenntnisse und Wünsche mit Bezug auf das, was anders sein könnte, wenn wir
uns anders verhielten, miteinander zu verknüpfen. Wir „berechnen“ die
voraussichtlichen Folgen unseres Handelns und bewerten sie im Lichte unserer
Wünsche. So können wir als Menschen unser praktisches Verhalten
„vernünftig“ steuern.
Steht am Beginn der theoretischen Philosophie die Frage nach der Natur des
Erkenntnisapparates, so steht am Beginn der praktischen Philosophie die Frage
nach der Natur des Menschen als wollendes, fühlendes und wünschendes Wesen.
Aufbauend auf einer Konzeption von der menschlichen Natur oder doch
zumindest unter Berücksichtigung einer solchen Konzeption hat es die
praktische Philosophie mit „normativen“ Fragen des richtigen oder rechten
Handelns zu tun. Die Ethik ist ein Teil der praktischen Philosophie.
1.1. Entscheidungsverantwortung
Die Helden Homers haben für ihr Tun einzustehen, selbst wenn ihnen die Götter
in die Quere kommen und ihre Handlungsintentionen wirkungslos werden lassen.
"Die homerischen moralischen Prädikate werden nicht wie moralische Prädikate
in unserer Gesellschaft nur dann angewandt, wenn der Handelnde auch anders
hätte handeln können" (MacIntyre, A. C. (1984), 15). Für sie scheint eine Art
reiner „Erfolgshaftung“ charakteristisch zu sein. Wer einen anderen schädigt,
wird dafür verantwortlich gemacht, ob er nun anders handeln konnte oder nicht.
Er haftet, wie die Juristen sagen, für den Erfolg. Wenn etwa Person A die Person
B tötet, dann ist es bei reiner Erfolgshaftung unerheblich, ob dies vorsätzlich
oder etwa durch einen unabwendbaren Irrtum ohne alle Absicht geschah.
Verantwortet werden muss die Tötung als solche. A kann sich nicht
entschuldigen mit dem Verweis, den Handlungserfolg (die Handlungsfolgen)
nicht gewollt zu haben.
Als Bürger der vor-klassischen Welt Homers ist man tugendhaft, wenn man de
facto die Eigenschaften besitzt, die gesellschaftlich erwartet werden,
gleichgültig, ob man diese Eigenschaften aufgrund eigener freier Handlungen
und voraufgehender Entscheidungen erwarb oder nicht. Erst die klassische
Philosophie der Griechen (etwa um die Zeit Platons) gewinnt einen
unabhängigen, kritischen Standpunkt zu gesellschaftlichen Normen und
gesellschaftlich anerkannten Tugenden. Man setzt überdies Tugend nicht mehr
94
mit der de facto Funktionstüchtigkeit des Individuums gleich. Es geht nicht
mehr nur darum, die Eigenschaften aufzuweisen, die gesellschaftlich in der
Ausfüllung gesellschaftlicher Rollen erwartet werden.
Dem modernen Menschen des westlichen Kulturkreises erscheint es in
Fortsetzung der antiken Entwicklung nahezu als ein Gemeinplatz, dass man nur
dann von ethisch relevantem Handeln sprechen darf, wenn der Handelnde
Handlungsalternativen besitzt. Handlungsalternativen zu besitzen, setzt voraus,
dass der Handelnde mit einer mindestens zwei-elementigen Alternativenmenge
konfrontiert ist. Denn wo es keine Alternativen gibt, erscheinen ethische oder
moralische Überlegungen von vornherein als gegenstandslos. Ist diese
Voraussetzung nicht gegeben, so werden wir kaum solche ethisch zentralen
Konzepte wie etwa das der "Verantwortung" in Anwendung bringen wollen.
Wenn man keine Wahl hat, dann kann man auch nichts herbeiführen und damit
auch nicht verantwortlich sein. Für die Zuschreibung einer moralischen
Verantwortung für x scheint es erforderlich, dass man auch hätte anders handeln
können, so dass nicht-x eingetreten wäre.
Es ist aber nicht gesagt, dass unter den Handlungsoptionen auch solche waren,
die eine Zuschreibung von Verantwortung im relevanten Sinne erlauben. Man
muss sich beispielsweise fragen, ob ein einzelner Wähler mit seiner Stimme mit
dafür verantwortlich sein kann, dass eine bestimmte Partei B gewählt wird. Man
kann jedenfalls nicht sagen, der Wähler hätte dafür sorgen sollen, dass anstatt
Partei B lieber Partei A ans Ruder gekommen wäre. Er kann allenfalls dafür
verantwortlich zeichnen, seine Stimme für B abgegeben zu haben, nicht dafür,
dass B regiert.
Es scheint allgemein so zu sein, dass wir nur das sinnvoll als gesolltes Handeln
verlangen können, was auch gekonnt ist und dass wir nur dann jemanden für
Handlungsfolgen verantwortlich machen dürfen, wenn er in seinem Tun
zumindest entweder notwendig oder hinreichend für das Eintreten der Folgen
war.
Potentiell hinreichend für das Eintreten des Wahlsieges von Partei A ist, der
Wähler j dann, wenn z.B. von den beiden einzigen Parteien A, B unter der
einfachen Mehrheitsregel sowohl A als auch B genau N Stimmen haben. Der
einzelne Wähler kann dann die Wahl entscheiden. Indem er seine Stimme B gibt,
kommt es zum Sieg von B. Wenn noch andere Wähler bislang nicht abgestimmt
haben, ist seine Stimmabgabe allerdings nicht notwendig für den Sieg einer der
Parteien. Ein anderer könnten das ebenso bewirken. Wieviel Teilverantwortung
jemandem zukommt, wenn nur eine bestimmte geringe Wahrscheinlichkeit
95
dafür vorliegt, entweder eine notwendige oder eine hinreichende Bedingung zu
setzen, ist eine überaus interessante, aber auch schwierige Frage. Für einfachere
Fälle scheint ein sogenanntes Brückenprinzip zu gelten (vgl. dazu auch Albert,
H. (1968)): Sollen setzt Können voraus (oder kurz, „Sollen impliziert Können“).
Das vorangehende sagt uns zwar etwas darüber, wann wir für unser Tun
sinnvollerweise verantwortlich gemacht werden können. Es hilft uns aber relativ
wenig hinsichtlich der Beantwortung der Frage, was wir tun sollen, wenn wir
eine aus mehreren Alternativen zu wählen vermögen. Bereits die philosophische
Klassik stellt die ethische Theoriebildung in solchen Fällen in den Dienst kluger
Entscheidungsvorbereitung. Die moderne philosophische Diskussion hat sich
dazu zunehmend der Methoden der „Entscheidungslogik“ bedient. Bevor wir
uns einer entsprechenden Präzisierung des Modells rationalen (moralischen)
Entscheidens zuwenden, ist es nützlich, sich nochmals der Kerncharakteristika
des Entscheidungskonzeptes zu vergewissern.
1.2. Kerncharakteristika des Begriffes zu verantwortender
Entscheidungen
Verantwortung setzt Freiheit voraus. Allerdings ist nicht klar, welche Art der
Freiheit. Ob wir Menschen in dem fundamentalen Sinne frei sind, dass wir auch
anders entscheiden könnten, als wir entscheiden, darf hier dahingestellt bleiben
(nach wie vor besonders hilfreich hierzu Dennett, D. C. (1986)). Es könnte ja
durchaus sein, dass wir am Nachmittag für die CDU stimmen werden, wenn wir
am Morgen Bohnen gegessen haben und für die SPD, wenn es Erbsen waren.
Wer das wüsste, könnte uns am Morgen das eine oder das andere geben, um uns
zu einem entsprechenden Abstimmungsverhalten am Nachmittag zu bestimmen.
In einem gewissen Sinne wäre unsere Wahl damit „entschieden“. Dennoch
könnten wir immer noch glauben, wir müssten uns an der Urne entscheiden.
Dafür, dass wir uns sinnvoll selbst einer Entscheidung gegenüber sehen, reicht
es aus, dass wir äußerlich anders handeln könnten, den Zettel nämlich statt mit
dem Kreuz bei der CDU mit dem Kreuz bei der SPD zu verzieren, wenn wir uns
anders entscheiden würden. Wenn immer das der Fall ist und wir bewusst
wahrnehmen, dass wir auch anders handeln könnten, wenn wir uns anders
entschieden, stehen wir subjektiv vor einer zu verantwortenden Entscheidung.
Das vorausgesetzte Können ist hier ein Handeln-Können und nicht ein
Entscheiden-Können (wie wir handeln, mag durch die morgendlichen Bohnen
ungeachtet unseres subjektiven Gefühls, anders zu können, „entschieden“ sein).
96
Ein „verantwortliches Individuum“ handelt in einer solchen Situation nach
Vorstellungen davon, was es tun soll und was es durch sein Tun voraussichtlich
bewirken wird. Es handelt damit nach einem „mentalen Modell“ der
Entscheidungssituation, das den Akteur über die Alternativen und deren
voraussichtliche Folgen informiert. Damit eine Entscheidung im eigentlichen
Sinne vorliegt, ist es notwendig, dass dieses Modell der Entscheidungssituation (und auch die Situation, auf die das Modell sich bezieht)
zumindest einige Bedingungen erfüllt. Drei seien hier hervorgehoben:
a. Die Alternativenmenge A des Handelnden muss mindestens zwei sich
wechselseitig ausschließende Elemente ai und aj enthalten.
Diese Bedingung kann auf zwei Weisen verletzt werden:
a-1. Zum einen kann A aus nur einem Element bestehen. Dann hat man
keine Wahl. Die Durchführung der einzigen möglichen Alternative ist
zwangsläufig. Das Modell der Situation lässt keinen Raum für
Entscheidungen.
a-2. Zum anderen kann es sein, dass man das Problem so formuliert hat,
dass Alternativen aus A gemeinsam realisierbar sind, sich also nicht
wechselseitig ausschließen. In diesem Falle kann man das Modell der
Situation umformulieren, so dass sich wechselseitig ausschließende
Alternativen entstehen.
Angenommen die gemeinsam zu realisierenden, aber unterscheidbaren
Alternativen seien a und b. Diese beiden Alternativen müssen sich je für sich
durchführen lassen. (Andernfalls sollte man sie zu einer einzigen Alternative v
verbinden. Denn, da man beide nur gemeinsam realisieren könnte, würde die
Entscheidung über die eine stets die Entscheidung über die andere bestimmen.
Letztlich liegt in diesem Falle nur eine Entscheidung vor.) Sind die beiden
Alternativen a und b also sowohl getrennt als auch gemeinsam durchführbar,
dann kann man das Problem so formulieren, dass die Entscheidung zwischen
a1 := a&-b
("a und nicht b" bzw. nur a"),
a2 := b&-a
("b und nicht a" bzw. "nur b") und
97
a3 := a&b
("a und b zugleich") zu treffen ist.
Das
bedeutet,
dass
"eigentlich"
eine
zumindest
dreielementige
Alternativenmenge vorliegt, in die zumeist sogar noch die Alternative a4 := a&-b ("weder a noch b") aufzunehmen ist, so dass eine vierelementige Menge
von sich wechselseitig ausschließenden Alternativen entsteht. In der
Konstruktion einer Entscheidung unterstellen wir alle regelmäßig, dass der
Entscheider, sich aller Alternativen bewusst ist und deren wechselseitig einander
ausschließenden Charakter versteht.
b. Wir sprechen nur dann von einer "Entscheidung", wenn der Entscheider selbst
vor dem konkreten Entscheidungsakt nicht weiß, welche Alternative er in der
Entscheidung wählen wird und wenn er den Unterschied zwischen dem
Herbeiführen und dem Voraussehen von Folgen für sich macht.
Ein Außenstehender kann ohne Verletzung dieser Anforderung durchaus im vorhinein wissen, welche Entscheidung fallen wird. Es ist insoweit zulässig, dass
der Entscheidende in seiner Entscheidung grundsätzlich von Naturgesetzen
bestimmt wird, die ihrerseits seine Gehirnvorgänge lenken. Ein Allwissender
Dritter könnte alles dies wissen, voraussehen, was der Entscheider tun wird und
der Entscheider stünde (wie im Falle der von Erbsen bzw. Bohnen
vorbestimmten
Wahlhandlung)
dennoch
subjektiv
vor
einem
Entscheidungsproblem der hier beschriebenen Art. Der Entscheider selbst wird
in seiner Entscheidung über sich etwas "lernen", was er zuvor nicht wusste
(nämlich dass er die Entscheidung tatsächlich getroffen hat, obwohl er subjektiv
überzeugt war, auch anders entscheiden zu können). Andernfalls liegt keine
Entscheidung im eigentlichen Sinne vor. Denn dann könnte der Entscheider
etwa im vorhinein sagen, dass er x tun wird, aber nicht, dass er darüber
entscheiden wird, ob er x tun wird. Nicht er würde subjektiv die Entscheidung
herbeiführen, sondern „es“ würde mit ihm geschehen, dass er entscheidet und
handelt.
Selbst wenn der Entscheider selbst darüber gewisse Vermutungen hegt, wie er
entscheiden wird, zur subjektiven Seite der Entscheidungen gehört die
Vorstellung des "Auch-anders-Könnens" hinzu und sei sie auch nur ein
bloßes Produkt unserer Vorstellungs- und Einbildungskraft (also letztlich eine
Illusion). Andernfalls würde die für unsere Sprache und Weltorientierung
unerlässliche Unterscheidung von Entscheidung und Voraussage nicht mehr zu
treffen sein. Es ist sehr treffend, dass man in der englischen Sprache von
decision making redet. Denn Entscheidungen sind nicht „da“, bevor sie getroffen
98
werden. Sie werden erst gemacht, wenn der Entscheidungszeitpunkt da ist.
Deshalb können sie gerade nicht im wörtlichen Sinne „gefunden“ werden.
c. Eine Entscheidung im eigentlichen Sinne liegt nur dann vor, wenn die Alternativenwahl aufgrund von Überlegungen oder Urteilen getroffen wird.
Dies schließt keineswegs aus, dass man nicht durch vorgelagerte
Entscheidungen sich dazu entschließen könnte, die Alternativenwahl durch
einen Münzwurf zu bestimmen (oder sie vielleicht durch den morgendlichen
Bohnenverzehr vorzuentscheiden, wenn man denn durch Bohnen zum
zwanghaften Wähler der CDU würde). Genau und auch alltagstheoretisch
einsichtig wäre es, in diesem Falle von der "Delegation einer Entscheidung" an
einen "Mechanismus" zu sprechen. Dieser Delegation geht eine
Delegationsentscheidung
voraus.
Auf
diese
kommt
es
vom
Entscheidungsstandpunkt aus an. Denn nur sie kann als Entscheidung im
eigentlichen Sinne gelten. Ähnliches ist über die Befolgung von Routinen und
auch dann zu sagen, wenn man eine Entscheidung durch Delegation von einem
anderen Individuum treffen lässt.
Eine Entscheidung setzt also voraus, dass der Entscheider aufgrund bewusster
Überlegungen, ohne im engeren Sinne die eigene Entscheidungen voraussagen
zu können, unter mindestens zwei Alternativen wählen kann. Mit diesen drei
Kerncharakteristika des Entscheidungskonzeptes wird umschrieben, welchen
Bedingungen eine Entscheidung im engeren Sinne zumindest genügen sollte.
Wie bei den meisten praktisch relevanten Begriffen, gibt es neben diesem
Begriffskern einen sogenannten Begriffshof, in dem sich nähere und fernere
Verwandte des Kernbegriffs finden. In der angewandten Ethik, zu der auch die
Wirtschaftsethik zu rechnen ist, gilt das Augenmerk traditionell Entscheidungen
im engeren Sinne, die bewusst gefällt werden und dabei die genannten drei
Charakteristika aufweisen.
Die moderne Ethik ruht insoweit, als sie sich mit einer Untersuchung rationaler
Praxis befasst, auf dem gleichen Fundament rationaler Entscheidungstheorie wie
die moderne Wirtschaftswissenschaft. Werden in Deutschland BWL und VWL
als besonders ethikfern angesehen, dann ist das allein schon aufgrund der
gemeinsamen entscheidungstheoretischen Hintergründe irreführend.
Bevor wir uns mit der Ethik befassen, ist es allerdings nützlich sich an einige
Banalitäten aus dem Bereich formaler Entscheidungstheorie zu erinnern.
99
1.3.
Elementare Präzisierungen
Stellen Sie sich vor, Sie wollen von Frankfurt nach München. Sie können mit
dem Auto, dem Zug oder dem Flugzeug München erreichen. (Alternative
Transportmittel wie Fahrrad, Pferdekutsche, Motorrad, Dauerlauf seien
auszuscheiden.) In München kann entweder Nebel herrschen, Glatteis, beides
oder keines von beiden. Wie sollten sie sich entscheiden?
Wie Sie sich schließlich entscheiden sollten, hängt von vielem ab. In jedem
Falle aber sollten Sie, falls die Entscheidung wichtig ist, sich die
Entscheidungssituation genau klarmachen. Dazu müssen Sie ein Modell der
Situation entwerfen. In einem ersten Schritt kann man eine Liste relevanter
Variabler erstellen:
1. N: Es herrscht Nebel;
-N: Es herrscht kein Nebel.
2. G: Es herrscht Glatteis;
-G: Es herrscht kein Glatteis.
Die möglichen Weltzustände sind dann:
N&G,
N&-G,
-N&G,
-N&-G.
Diese Zustände entziehen sich, das sei angenommen, jeder möglichen
Beeinflussung oder Intervention durch den Entscheider. Der Entscheider glaubt,
das sei ebenfalls unterstellt, subjektiv, dass die Umweltzustände eintreten,
gleichgültig, was er unternimmt. Wenn jemand daran glaubt, dass man den
Wettergott durch Opfer gnädig stimmen kann, so muss er ein anderes Modell
der Situation wählen. Denn dann gehören die Wetterbedingungen nicht in die
Klasse jener Ereignisse, die er als Randbedingungen seines Handelns
hinzunehmen hat, sondern zu jenen, die er durch eigenes Tun zu beeinflussen
vermag und für die er dann auch potentiell verantwortlich ist.
Im vorliegenden Falle sei angenommen, dass der Handelnde davon ausgeht, das
Wetter nicht beeinflussen zu können. Die Möglichkeiten, durch eigenes Handeln
zukünftige Ergebnisse kausal zu beeinflussen, mögen sich auf die Wahl einer
Transportalternative beschränken.
Der Entscheider kann dann wählen zwischen
Au
Fahrt mit dem Auto
100
Zu
Fahrt mit der Bahn
Flu
Fahrt mit dem Flugzeug.
Wählt er die erste Alternative und trifft er auf Nebel und kein Glatteis am Zielort,
dann schreibt man für diese Kombination von eigenem Kausaleinfluss und dem
durch eigenes Handeln nicht kontrollierten Einfluss: Au (N&-G).
Dieser Ausdruck ist nichts anderes als der Name für das Ergebnis, das eintritt,
wenn man mit dem Auto fährt und auf eisfreies doch nebliges Wetter trifft.
Wie man handeln soll, hängt allerdings nicht nur von den erwarteten
Konsequenzen ab, die eintreten, wenn ein bestimmtes Handeln und bestimmte
davon unabhängige Umweltzustände auftreten. Die Wahrscheinlichkeit, mit der
Zustände eintreten, spielt ebenfalls eine Rolle. Die Wahrscheinlichkeiten für die
Umweltalternativen
lassen
sich
durch
die
folgenden
vier
„Abkürzungen“ angeben: P(N&G), P(N&-G), P(-N&G), P(-N&-G); dabei
unterstellen wir, dass das Eintreten der Umweltzustände unabhängig ist vom
eigenen Handeln.
Wer ein Modell einer Entscheidungssituation bildet, der wird also folgendes
leisten müssen:
1. Umweltzustände bestimmen. Im Beispiel W= {N&G, N&-G, -N&G, -N&-G}
2. Wahrscheinlichkeit P für jedes w ∈ W "schätzen". Im Beispiel P(N&G),
P(N&-G), P(-N&G), P(-N&-G).
3. Die Menge A der Aktionen bestimmen. Im Beispiel A = {Au, Zu, Flu}.
Allgemein ("physisch") beschreibbare Handlungen.
4. Eine Funktion F, die allen Paaren (a, w) mit a∈A & w∈W deren Ergebnisbeschreibungen zuordnet. (Bsp. F(zündeln, voller Tank)=Explosion).
5. Eine "möglichst" vollständige Liste von Kriterien Ki oder Gesichtspunkten
zur Bewertung der Ergebnisse mit K=(K1, K2,... , KN).
6. Eine durch Beiziehung von K erzeugte Ordnung R ("alles in K
zusammengenommen", „nach Abwägung aller Wertaspekte“ ist eine Alternative
y mindestens so gut wie x) auf der Menge aller Ergebnisse.
Nochmals zu Deutlichkeit: Handlungen sind nichts als Funktionen, die die
Umweltzustände in die Ergebnisse abbilden. Die Menge der Alternativen A,
101
unter denen man wählen kann, wird von Handlungen, nicht von Ergebnissen
gebildet. Das ist wichtig, da man zwar davon spricht, Ergebnisse zu wählen,
letztlich aber nur Handlungen wählen kann, die mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit zu Ergebnissen führen. Im Beispiel sind die Handlungen
als Funktionen gegeben durch Au, Zu, Flu. Die Ergebnisse entstehen aus dem
Zusammentreffen von Handlungen und handlungsunabhängigen Umweltzuständen. Zum Beispiel in F(Au, N&G) zeigt an, wie die Handlung Au auf
N&G treffend zu einem Ergebnis führt. Wenn man als einzelnes Individuum
hingegen CDU statt SPD wählt, dann hat man gewählt, für die CDU und nicht
für die SPD zu stimmen. Man hat aber keineswegs, durch die Stimmabgabe, das
Ergebnis verändert. Diese Konsequenz hat man nicht gewählt. Die Ergebnisse
werden dann nach den Kriterien Ki bewertet. Dadurch wird ggf. eine
Rangordnung erstellt. (So wie bei der Stiftung Warentest unter alternativen
Gütern eine Rangordnung etwa über ein Punkteverfahren ermittelt wird.)
Eine vollständige vereinfachte Entscheidungsmatrix, in der tabellenartig erfasst
ist, welche Resultate sich aus dem "Zusammentreffen" von Handlungen aus A
und Umweltzuständen aus W ergeben, ist im Falle der Flug-, Zug- und
Bahnreise die folgende:
Au
Zu
Flu
N&G
Au(N&G)
Zu(N&G)
Flu(N&G)
N&-G
Au(N&-G)
Zu(N&-G)
Flu(N&-G)
Tabelle 1
-N&G
Au(-N&G)
Zu(-N&G)
Flu(-N&G)
-N&-G
Au(-N&-G)
Au(-N&-G)
Flu(-N&-G)
Unter Einbeziehung von Funktionen p(.), die Wahrscheinlichkeiten für das
Eintreten von Umweltzuständen messen, und u(.), die den Nutzen der
Alternativen messen (entsprechend einer Rangordnung nach Stiftung Warentest),
erhält man sogleich eine Tabelle der folgenden Form:
Weltzustände /
Handlungen
Au
Zu
Flu
N&G
p(N&G)
u(Au(N&G))
u(Zu (N&G))
u(Flu(N&G))
N&-G
p(N&-G)
u(Au(N&-G))
u(Zu (N&-G))
u(Flu(N&-G))
Tabelle 2
-N&G
p(-N&G)
u(Au(-N&G))
u(Zu (-N&G))
u(Flu(-N&G))
-N&-G
p(-N&-G)
u(Au(-N&-G))
u(Zu (-N&-G))
u(Flu(-N&-G))
Der Term u(Au(N&G)) zeigt dabei an, wie der Entscheider nach seinen
Kriterien die Ergebnisse des Handelns bewertet. Man kann sich vorstellen, dass
zur Bestimmung eines einzelnen skalaren Wertes u Punkte für jedes der
Bewertungskriterien K1... KN vergeben werden. Im einfachsten Falle wird dann
102
aufaddiert und die jeweilige Gesamtpunktzahl festgestellt. Das ist etwa so wie
bei der Stiftung Warentest, die für jedes ihrer für einen Test relevanten Kriterien
Punkte feststellt und diese dann aufaddiert, um Punktsieger festzustellen. Bei
einer Zehnkampftabelle, die Punkte für die Einzelwettbewerbe enthält, werden
diese ebenfalls benutzt, um eine Punktzahl für eine Wettkampfleistung
festzustellen. Auch das wäre analog für das Vorgehen, das wir an den Tag legen,
wenn wir die viel-dimensionale Bewertung der Welt in einer Ordnung entlang
einer einzigen Dimension „u“ zusammenfassen. Wir nehmen weiterhin an, dass
die Punkte sinnvoll mit den Wahrscheinlichkeiten gewichtet und dann erneut
aufaddiert werden können. So, wie man bei einer Lotterie jeden Geldpreis mit
seiner Eintrittswahrscheinlichkeit gewichtet und dann aufaddiert.
Wenn man beispielsweise ein Los besitzt, das 10 Euro mit p(10)=0.1 und 100
Euro mit der Wahrscheinlichkeit p(100)=0.9 ergibt, dann wird man einen
Erwartungswert mit 10*0,1 + 100*0,9= 91 errechnen können. Eine Lotterie, die
mit p(0)=0.1 nichts bringt, mit p(100)=0.8 den Wert 100 und mit p(1000)=0.1
den Wert 1000, führt zu einem Erwartungswert von p(0)*0 + p(100)*100 +
p(1000)*1000= 0+100*0.8 + 1000*0.1 =180.
Ein Rationalentscheider, der sich am Erwartungswert des Nutzens orientiert,
kann in der Tabelle sogleich die Alternative mit dem höchsten
Erwartungsnutzen bestimmen. Er muss dazu nur die entsprechenden
Erwartungswerte ausrechnen und miteinander vergleichen. Die Wahl einer
optimalen Handlung entspricht dann der Wahl einer optimalen Lotterie. Bei
Existenz erwartungswerttreuer Nutzen- und Wahrscheinlichkeitsmaße erhält
man für die „Nutzen-Lotterien“:
EU(Ba)=
EU(Au)=
EU(Flu)=
u(Zu(N&G))*p(N&G) + u(Zu(N&-G))*p(N&-G) +
u(Zu(-N&G))*p(-N&G) + u(Zu(-N&-G))*p(-N&-G)
u(Au(N&G))*p(N&G) + u(Au(N&-G))*p(N&-G) +
u(Au(-N&G))*p(-N&G) + u(Au(-N&-G))*p(-N&-G)
u(Flu(N&G))*p(N&G) + u(Flu(N&-G))*p(N&-G) +
u(Flu(-N&G))*p(-N&G) + u(Flu(-N&-G))*p(-N&-G)
Durch die Wahl einer Alternative mit maximalem Erwartungswert ist unser Beispiel-Entscheidungsproblem im Grundsatz lösbar. Das scheint simpel genug, es
ist jedoch durchaus voraussetzungsreich, da beispielsweise die Existenz von
Nutzenfunktionen, mit denen man sinnvoll Erwartungswerte bilden kann, nicht
selbstverständlich ist. Wann darf man etwa nach Kriterien gewonnene Punkte
einfach aufaddieren und wann mit ihren Eintrittswahrscheinlichkeiten gewichten,
ohne die eigenen Sichtweisen zu verfälschen.
103
Ziel einer entscheidungstheoretischen Analyse wie der vorangehenden ist es,
jene Informationen bereitzustellen, die es erlauben, eine optimale Aktion a aus
der Menge der Alternativen A wohlinformiert zu wählen. Letztlich geht es damit
um die Konstruktion einer Ordnung unter den Aktionen a aus A und eine
nachfolgende Empfehlung (Gebot, Erlaubnis) ein optimales a auch "zu tun. Die
Frage "Was sollen wir tun?" stellt sich somit als Frage danach, wie wir die uns
rein physisch mögliche Kontrolle nach Maßgabe "unserer" Werte ausüben sollen
in einer Welt, die von Unsicherheiten und komplexen Zusammenhängen von
Handlungen und deren Folgen gekennzeichnet ist.
Wenn wir in einer solchen Welt die ethisch richtige Aktion ausschließlich nach
Bewertung der Folgen festlegen, so spricht man von einer
„konsequentialistischen“ Ethik. Wenn wir auch Eigenschaften der
Handlungen selbst mit einbeziehen, die sich nicht aus einer Bewertung der
Handlungsfolgen allein ergeben, dann spricht man von einer nicht-(nur)konsequentialistischen Ethik. Im weiteren wird zunächst nach einem im
weiteren Sinne konsequentialistischen Ansatz verfahren.
1.4. Entscheidungen und ethische Methodologie
Durch die entscheidungstheoretische Aufbereitung wird unser Augenmerk auf
die Liste folgender Faktoren gelenkt:
Faktenurteile: 1, 2, 3, 4.
Werturteile und -kriterien: 5, 6.
Eine Tabelle hilft uns, im einzelnen darzustellen, was ein rationaler Entscheider
tun muss, damit wir ihn als rational anerkennen können. Er muss nämlich
insbesondere in der Lage sein, zwischen dem, was er durch Handeln
beeinflussen kann und dem, was er dadurch nicht beeinflussen kann, zu
unterscheiden. An jeder Stelle der Konstruktion einer Entscheidungstabelle wie
der vorangehenden, wird dabei ein wesentlicher Schritt zu mehr ethischer
Klarheit gemacht. Man kann aus der Tabelle genau entnehmen, was Gegenstand
der Bewertungen ist, wo der Ort der Verantwortung liegt usw.
Alles, was in die Aufstellung der Tabelle selbst eingeht, scheint dem Einfluss
des Akteurs, der die Alternativenwahl vorzunehmen hat, entzogen. Eine
Ausnahme könnten insoweit nur die Bewertungskriterien K1...KN zu bilden. Mit
Bezug auf diese Kriterien sind nun zwei Fragen zu unterscheiden
104
1. Lässt sich erkennen, welche Kriterien K1...KN ein Entscheider anwenden
sollte?
2. Welche Kriterien K1...KN wendet der betreffende Entscheider de facto an?
Aus Binnenperspektive des ethisch verantwortlichen Entscheiders, der eine
solche Tabelle bilden will, um ein Modell seiner ethischen
Entscheidungssituation zu haben, formuliert
1’. Ist es eine Frage der Erkenntnis, welche Kriterien K1...KN ich als Entscheider
anwenden sollte?
2’. Welche Kriterien K1...KN akzeptiere ich als Entscheider de facto oder was
sind eigentlich meine gegebenen Wünsche, Werte oder Ziele?
Die besondere direkte Werterkenntnis, die viele Philosophen in Anspruch
nahmen, erscheint ungeachtet ihrer langen abendländischen Tradition
merkwürdig. Sollte es so etwas wie „ethische Gesetze“ geben, dann finden wir
diese nicht vor wie die empirischen Naturgesetze. Sie müssen gleichsam von uns
oder aus uns selbst kommen. Nach einer Sicht der Dinge erfinden wir die
ethischen Maßstäbe in der menschlichen Praxis. Sie sind Erfindungen zu kluger
menschlicher Interessenverfolgung
und nicht Erkenntnisse über die
Beschaffenheit der Welt, die herausgefunden werden. Nach einer anderen (vor
allem Kantischen) Sicht der Dinge, gibt es Maßstäbe der Vernunft, die vor aller
Erfahrung (a priori) sowohl in die Erkenntnis der Natur eingehen als auch in die
ethische Erkenntnis des moralisch richtigen. Eine solche Erkenntnis ist für die
praktische Vernunft in analoger Weise wie für die theoretische Erkenntnis der
Welt möglich insoweit wie es sich um eine Erkenntnis a priori handelt. So wie
laut Kant der menschliche Verstand die Welt nach den „aus ihm selbst
kommenden“ Kategorien von Raum und Zeit ordnet, so ordnet der menschliche
Verstand die Welt menschlicher Praxis nach apriori Prinzipien wie dem
kategorischen Imperativ. So wie Raum und Zeit für Kant der Erfahrung eine
Form aufprägen, so prägt die Forderung nach der Verallgemeinerbarkeit der
Maximen unseres Handelns (man soll nur wollen, was man für jeden ohne
Ansehung der Person wollen kann), der Welt ethischen Handelns ihre Form auf.
Die Moralphilosophie Kants ist, will man ihr wirklich gerecht werden, anstatt
ihr nicht nur eine oberflächliche Plausibilität zu verleihen, ziemlich
voraussetzungsreich. Ohne ein tieferes Verständnis des Gesamtansatzes Kants
und vor allem seiner Auffassungen von erfahrungsunabhängigen
Vernunftmaßstäben bleibt nur eine quasi-regel-utilitaristische Position (dazu
105
unten), wonach man die Verallgemeinerungsfähigkeit aller moralischen Urteile
sicherzustellen hat und jene Maßstäbe des Handelns verbindlich sind, deren
allgemeine Befolgung gute Folgen hätte. Darauf wird zurückzukommen sein.
Nach der anderen Auffassung geht es darum, diejenigen Kriterien K1...KN
anzuwenden, die der Entscheider de facto teilt. Was will er? Welche ethischen
Maßstäbe will er de facto anwenden? Ist es ihm wichtig, die Interessen anderer
zu berücksichtigen oder nicht? etc. Nachdem die Ziele Werte und Wünsche des
Entscheiders erkannt sind, werden sie dann in die Entscheidungsvorbereitung
einbezogen, um die Bewertung der Alternativen durchzuführen. Es ist allerdings
fraglich, ob wir unsere Ziele, Werte und Wünsche selbst ebenso einfach als
gegeben hinnehmen wie ein Dritter, der einfach nur empirisch feststellen kann,
dass wir bestimmte Werte haben. Wir müssen uns fragen, ob wir nicht bei der
Konstruktion unserer (mentalen) Entscheidungsmodelle bestimmte Wallakte
hinsichtlich dessen, was wir berücksichtigen wollen, durchführen.
Was unsere ethischen Maßstäbe anbelangt, haben wir womöglich eine Wahl.
Wir stehen insoweit wir die Maßstäbe unserer Bewertungen wählen können, vor
einem neuen Entscheidungs-Problem. Um die Wahl der Maßstäbe, die unsere
weiteren Entscheidungen bestimmen, zu analysieren, müssen wir in unseren
entscheidungstheoretischen Analysen eine Ebene höher steigen. Auf dieser
Ebene geht es nicht darum, dass die Ethik uns bei unseren Entscheidungen hilft,
sondern darum, über die Kriterien der Bewertung und Auswahl selbst zu
„entscheiden“. Wir müssen, jedenfalls in gewisser Weise, über die Ethik selbst
entscheiden. Dazu sind wiederum Maßstäbe nötig. Offenkundig droht ein
„Aufstieg ins Unendliche“ oder ein infiniter Regress, wenn man mit
entscheidungstheoretischen Modellen darüber zu befinden hat, welcher Art die
entscheidungstheoretischen Modelle ethischer Entscheidungen sein sollen. Man
müsste anscheinend eine Entscheidung über ein Entscheidungsmodell in einem
Entscheidungsmodell höherer Stufe treffen, zu dem es eines noch höherer Stufe
geben würde, zu dem es eines noch höherer Stufe gäbe usw.
Ein Regressproblem wie das vorangehende wird man vermeiden wollen. Ein
Verfahren zur Lösung dieses aber auch anderer Probleme von praktischethischer Bedeutung bildet das von John Rawls im Jahre 1951 in die moderne
ethische Debatte eingeführte „Entscheidungsverfahren für die normative Ethik“.
Es ist als allgemeines Argumentationsverfahren, das auf eine Kohärenz unseres
Urteilens abzielt, breit anwendbar. Das gilt insbesondere auch im
wirtschaftsethischen Bereich.
106
2. Rawls’ Entscheidungsverfahren für die normative Ethik
Es wird selten bestritten, dass man die „moralische Steuerung“ von Verhalten
wissenschaftlich untersuchen kann. Denn die Verhaltenssteuerung durch
moralische Vorstellungen ist selbst eine Tatsache, die wie andere empirische
Tatsachen mit den Mitteln der Wissenschaft beschrieben, erklärt und in ihren
Konsequenzen aufgeklärt werden kann. Problematischer ist die These, dass man
die Richtigkeit inhaltlicher moralischer Vorstellungen und nicht nur deren
Vorhandensein und Wirksamkeit wissenschaftlich beurteilen kann. Dass etwa
Herr Meier überzeugt ist, menschliches Leben müsse bereits im embryonalen
Stadium so geschützt werden wie im späteren personalen Stadium, ist eine
Tatsache, deren Vorliegen oder Nicht-Vorliegen mit den üblichen empirischen
Methoden geprüft werden kann. Wie Herr Meier gegebenenfalls durch
Sozialisationsprozesse und sein persönliches Umfeld zu der betreffenden
Überzeugung kam, lässt sich in gleicher Weise wissenschaftlich – etwa
entwicklungs- und sozialpsychologisch – untersuchen. Ob Herr Meier mit dem,
was er de facto vertritt, aber tatsächlich Recht hat, das ist eine
„normative“ Frage, die im Gegensatz zu deskriptiven Fragen möglicherweise
nicht wissenschaftlich – jedenfalls nicht im gleichen Sinne wissenschaftlich –
behandelt werden kann.
Eine „Moralwissenschaft“, die der wissenschaftlichen Begründung von
Normen bzw. Werten dient, kann es nach Meinung der sogenannten ethischen
Non-Kognitivisten nicht geben. Denn mögen das Akzeptieren von Werten und
das Befolgen von Normen auch Tatsachen sein, der Inhalt der Werte und
Normen selbst kann nach non-kognitivistischer Auffassung keinesfalls durch
Tatsachen allein gerechtfertigt werden. Normen und Werte stehen nach
Auffassung der non-kognitivistischen ethischen Skeptiker jenseits des Zugriffs
einer Wissenschaft, die sich der wertfreien Analyse von Tatsachen verpflichtet
sieht. Er kann beispielsweise erkennen, dass es tatsächlich so ist, dass eine hohe
Dosis von Barbituraten den Tod dessen bewirken wird, der diese Dosis zu sich
nimmt. Der Wissenschaftler kann wissenschaftlich voraussagen, dass der Tod
bei Barbiturateinnahme unter geeigneten Bedingungen eintreten wird. Er kann
sogar wissenschaftlich die „Zweck-Mittel“-Beziehung, „wenn man wünscht zu
sterben, dann nehme man Barbiturate der Dosis x zu sich“ ableiten. Ob sich
jemand umbringen will, dass kann er ebenfalls feststellen. Dass sich jemand
umbringen sollte oder dass er den Wunsch entwickeln sollte, zu sterben, kann
man, wenn überhaupt, nur mit Bezug auf höherwertige Normen begründen. Man
kann die tauglichen Mittel nennen, begründen, warum sie tauglich sind, aber
nicht in letzter Konsequenz begründen, warum sie verfolgen sollte. Die
107
Begründung von Normen und Werten stützt sich in diesem Sinne nicht auf Tatsachen.
Die Einsicht, dass letzte Werte und oberste normative Ziele womöglich nicht
durch Tatsachenerkenntnisse gerechtfertigt werden können, schließt allerdings
nicht aus, dass wir handeln. Auch derjenige, der davon überzeugt ist, dass wir
nicht wissen können, was letztlich moralisch rechtens ist, kann ohne weiteres
auf der Basis, dessen was er de facto erreichen will, handeln. Was die Wahl der
Mittel anbelangt muss auch er mit der Frage umgehen, wie er handeln soll. Aber
er kann sich auch allgemeiner fragen, was er eigentlich tun sollte. Er kann das
tun, ohne unterstellen zu müssen, dass man auf wahrheitsfähige Weise
herausfinden kann, was man tun soll. In Beantwortung dieser Frage kann ihm
die normative Ethik auch ohne Wahrheitsanspruch als ein System von
Empfehlungen darüber, was moralisch rechtens ist und was man aus
moralischen Gründen tun sollte, dienen. Hierin unterscheidet der NonKognitivist sich nicht von demjenigen, der als Kognitivist davon überzeugt ist,
die normative Ethik zum Gegenstand der Tatsachenerkenntnis machen zu
können. Aber der Non-Kognitivist muss zu seiner normativen Ethik auf andere
Weise als durch eine Tatsachenerkenntnis gelangen.
Wenn, was moralisch rechtens ist, nicht Gegenstand der Erkenntnis im üblichen
Sinne sein kann, dann verschiebt sich das Problem. Man kann nicht im Sinne
einer Tatsachenkenntnis wissen, was zu tun ist, und muss deshalb über die
Maßstäbe des Handelns entscheiden. Indem man über die Maßstäbe der
Entscheidung selbst noch entscheiden muss, scheint man sich in einem Zirkel
oder in einem infiniten Regress zu bewegen. Der Auflösung dieses Problems
dient das von John Rawls vorgeschlagene Entscheidungsverfahren für die
normative Ethik, das auf eine Parallelisierung von wissenschaftlichem und
ethischem Vorgehen abzielt (die wesentliche Literatur zum Thema findet sich in
Hahn, S. (1996, (2000)). Rawls lässt sich weitgehend vom Modell eines
einzelwissenschaftlichen Vorgehens leiten, das seine Aufgabe in der Aufstellung
allgemeiner Hypothesen, sowie ihrer Überprüfung am konkreten Einzelfall
durch kompetente Experimentatoren und Wissenschaftler sieht.
So wurde etwa die Einsteinsche Relativitätstheorie bei einer nach der
Veröffentlichung der Theorie eintretenden Sonnenfinsternis getestet, indem die
von der Theorie vorausgesagte Ablenkung des Lichtes durch Massen bestätigt
wurde. Die allgemeine Konzeption wurde so anhand von Einzelbeobachtungen
einem Test unterzogen. Der Physiker Pauly traf auf eine hartnäckige Anomalie
in der physikalischen Grundlagentheorie und postulierte einfach die Existenz
108
von Neutrinos, um die Theorie zu retten. Er hatte dabei ein sehr „schlechtes
Methoden-Gewissen“, da ihm die Annahme als reine ad hoc Strategie erschien.
Jahrzehnte später erhielten jene Experimentatoren, die Neutrinos nachwiesen,
dafür den Physik-Nobelpreis. Hätte man nachweisen können, dass Teilchen
dieser Art mit anderen allgemeinen Annahmen der Physik fundamental
unvereinbar sind oder hätte es einen Nachweis der Teilchen trotz vieler
Versuche nicht gegeben, dann wäre man letztlich dazu gezwungen gewesen, die
Neutrino-Hypothese aufzugeben. Der Wechsel zwischen den Ebenen der
allgemeinen Hypothesen und der speziellen Prüfungen mit dem Bestreben,
allgemeine Kohärenz zu erzielen, scheint charakteristisch für die
Naturwissenschaft zu sein. Da diese erfolgreich ist, warum sie nicht als Vorbild
für die philosophische Ethik benutzen?
Den allgemeinen Hypothesen der Einzelwissenschaften stellt Rawls allgemeine
normative Prinzipien gegenüber. Diese Prinzipien enthalten keine
Kennzeichnungen
von
konkreten
Individuen
oder
konkreten
Entscheidungssituationen. Sie beanspruchen vielmehr in Analogie zu allgemeinen Gesetzeshypothesen allgemeine Geltung für beliebige Individuen. In
gleich gelagerten Entscheidungssituationen unabhängig von Ort und Zeit der
Entscheidung, sollten die gleichen Maßstäbe Anwendung finden. Das Prinzip
etwa, alle Individuen gleichberechtigt in die Bestimmung eines Maßes für die
allgemeine Wohlfahrt eingehen zu lassen, gehört in diesen Kontext. Die
Maßgabe, dass alle gerechtfertigten gesellschaftlichen Institutionen den
Gesamtnutzen der Gesellschaft wahren sollen, ist eine andere orientierende
Feststellung allgemeiner Art. Sie sagt etwa über die Frage, ob die Steuern in
einer Gesellschaft progressiv oder linear anwachsen sollen, konkret noch nichts
aus. Dennoch bietet sie eine Orientierung dafür an, nach welchen Kriterien wir
in der Gestaltung des Steuerrechtes vorgehen sollen. Den konkreten EinzelfallBeobachtungen der empirischen Einzelwissenschaft werden konkrete Einzelentscheidungen gegenübergestellt. Wenn man aus einer allgemeinen Theorie ein
intuitiv völlig uneinleuchtendes Verhaltensrezept für einen konkreten Fall
ableiten kann, dann spricht das gegen die allgemeine Theorie. Wenn etwa die
Verhängung staatlicher Kriminalstrafen mit dem Argument vertreten wird, diese
würden von weiteren Straftaten abschrecken und wenn behauptet wird, dass nur
die Abschreckungswirkung zähle, dann könnte man daraus ableiten, dass man
ggf. auch unschuldige Individuen bestrafen sollte, um besonders große
Abschreckungswirkungen zu erreichen. Das scheint stark gegen die allgemeine
Abschreckungstheorie in unmodifizierter Form zu sprechen, weil es elementaren
Gerechtigkeitsurteilen im Einzelfall widerspricht.
109
In den Einzelwissenschaften geht es um ein Gleichgewicht der Überlegungen
allgemeiner wie spezieller Art. Die allgemeinen Prinzipien müssen mit den
Einzelbeobachtungen vereinbar sein und umgekehrt. Die einen sollen die
anderen stützen und nicht widerlegen. Das ist auch in der Ethik das Ziel:
Allgemeine und spezielle Überlegungen sollen vereinbar miteinander sein und
sich wechselseitig bestärken. Solange man jedoch nicht genauer charakterisiert,
welche Überlegungen überhaupt einbezogen werden müssen, ist mit der
Methode des Überlegungsgleichgewichtes wenig gewonnen. Die Methode
entbehrt ohne Urteilseingrenzung jeder Möglichkeit, die Ergebnisse
intersubjektiv zu verankern. Rawls ist sich dieses Problems bewusst. Genau
deshalb führt er das Konzept eines "wohldurchdachten Urteils eines
kompetenten Moralbeurteilers" als Abgrenzungskriterium ein.
2.1. Kennzeichen eines kompetenten Moralbeurteilers
a) (Von Rawls nicht ausdrücklich genannt) Es handelt sich um ein Individuum,
kein Gremium o.ä., keine Maschine etc.
Das Individuum verfügt über:
b) durchschnittliche Intelligenz,
c) durchschnittliche Kenntnis zu beurteilender Entscheidungssituationen und ist
dabei
d) 1. induktiv rational vorgehend, 2. Für und Wider wägend, 3. argumentationsoffen und revisionsbereit, 4. selbstkritisch gegenüber eigenen Vorurteilen; wobei
es
e) Einfühlungsvermögen in die Interessen und Lage anderer
zeigt.
Unparteilich und vernünftig soll ein kompetenter Moralbeurteiler sein. Ihm
werden insgesamt Eigenschaften abverlangt, die man völlig analog auch in
anderen Bereichen der Erkenntnisgewinnung voraussetzen würde. Ob ein
Moralbeurteiler als kompetent gilt, hängt nicht davon ab, welche Urteile er in
den ihm vorgelegten Situationen fällt. Deshalb sind grundsätzlich Urteile
beliebiger Art zugelassen. Es ist von der Kennzeichnung des kompetenten
Moralbeurteilers her insoweit nicht präjudiziert, was sich als Ergebnis des
110
Beurteilungsprozesses inhaltlich als Urteilsergebnis einstellen wird. Verlangt ist
allerdings, dass die Urteile wohlerwogen sein sollen.
2.2. Kennzeichen eines wohlerwogenen Moralurteils
a) Vom Ausfall des Urteiles hängen keine positiven wie negativen
Konsequenzen für den Beurteiler ab.
b) Der zu beurteilende Fall enthält einen realen Interessenkonflikt und ist nicht
allzu kompliziert gelagert.
c) Dem Urteil geht eine sorgfältige Situationsanalyse voraus; alle Standpunkte
werden berücksichtigt.
d) Das Urteil muss von einem Gefühl innerer Gewissheit begleitet sein.
e) Das Urteil muss intra- und intersubjektiv Bestand haben.
f) Das Urteil darf nicht aufgrund bewusster Anwendung allgemeiner Prinzipien
abgegeben, sondern muss intuitiv gefällt werden.
Die Kennzeichen des kompetenten Moralbeurteilers und der von ihm
abgegebenen wohldurchdachten Moralurteile führt Rawls zu seinem Konzept
der "Explikation" einer Klasse von Moralurteilen zusammen. An der Bildung
einer derartigen Explikation wirkt die Moraltheorie mit.
2.3. Begriff der Explikation bei Rawls
"Betrachte eine Gruppe kompetenter Beurteiler, die wohl- durchdachte Urteile
abgeben im Hinblick auf eine Gruppe von Fällen, die im täglichen Leben
vorkommen können. Dann ist eine Explikation dieser Urteile als eine Reihe von
Prinzipien definiert, deren verständige und konsistente Anwendung im Hinblick
auf die jeweils selben Fälle durch irgendeine kompetente Person Urteile ergibt,
die - zwar dem Vorgehen gemäß nicht intuitiv, sondern aufgrund einer
expliziten und bewußten Heranziehung der Prinzipien abgegeben nichtsdestoweniger Fall für Fall identisch mit wohldurchdachten Urteilen der
Gruppe kompetenter Beurteiler sind" (Rawls, J. (1951/1976), 132). Die
Explikation einer Klasse wohldurchdachter Moralurteile kompetenter
Moralbeurteiler ist somit nichts anderes als eine allgemeine Theorie, die alle
111
Urteile der Klasse aus allgemeinen Prinzipien erzeugt und dabei zu keinem
Schluss gelangt, der einem dieser Urteile widerspricht. Insoweit gleicht eine
Explikation der Axiomatisierung einer Theorie, in der ebenfalls alle wahren
Sätze der Theorie aus den Axiomen herleitbar sein müssen.
Allerdings ist diese Parallele nicht vollkommen. Für Rawls kann es durchaus
eine Korrektur von Einzelurteilen nach Maßgabe der in der Explikation
enthaltenen allgemeinen Prinzipien geben. Angestrebt wird ein
Überlegungsgleichgewicht aller speziellen und allgemeinen Überlegungen
kompetenter Moralbeurteiler. Dieses Gleichgewicht ist solange nicht erreicht,
wie es Widersprüche zwischen der Menge M der aus den allgemeinen Prinzipien
S=(S1, S2, ... , SN) mittels gewisser Schlussregeln und Randbedingungen
ableitbaren Einzelurteile und der Menge B wohldurchdachter Einzelurteile gibt.
Widersprüche lassen sich beheben, durch a) Revision der allgemeinen Prinzipien
b) Modifikation oder Aufgabe bestimmter Einzelurteile. Wenn diese
Modifikation glückt, stellt sich ein vorläufiges Gleichgewicht ein. Die
gewonnene Explikation hat bis auf weiteres Bestand. In Zukunft kann sich
jedoch
im
Lichte
neuer
wohlerwogener
Urteile
in
neuen
Entscheidungssituationen wiederum eine Revision zur Herbeiführung des
Gleichgewichtes als notwendig erweisen. "Die Ethik muß sich wie jede andere
Disziplin Schritt für Schritt voranarbeiten" (Rawls, J. (1951/1976), 138). Die
angestrebte Parallele zum Vorgehen der empirischen Einzelwissenschaften ist
offenkundig.
Wenn die Ethik in Rawls' Entscheidungsverfahren einen mit den empirischen
Wissenschaften vergleichbaren Methodenkanon gefunden hätte, dann wäre an
einer rationalen Ethikbegründung nicht zu zweifeln. Die Intersubjektivität der
ethischen Urteile wäre zumindest annähernd so gut abgesichert wie die der
Einzelwissenschaften. Es wäre dann möglich, Ethik in diesem Sinne
wissenschaftlich fortzuentwickeln und normative Vorschläge mit einem
vergleichbaren Rationalitätsanspruch und damit ebenso wie deskriptiv
empirische zu diskutieren. Das hätte sehr grundlegende und einschneidende
Konsequenzen. Deshalb ist es bedeutsam, die Parallele zu den Einzelwissenschaften zu prüfen.
2.4. Prüfung der Parallele (kann übersprungen werden bei erster
Lektüre)
I. Zur Parallele "kompetenter Moralbeurteiler" und "kompetenter
Einzelwissenschaftler".
112
a) Dass es letztlich auf Individuen, nicht Gremien ankommt, gehört zum Fundus
der Einzelwissenschaften. Hier hat man es letztlich mit der neuzeitlichen
Vorstellung des autonomen, Individuums als letztem Entscheidungssubjekt, sei
es nun in theoretischen, sei es in praktischen Fragen, zu tun.
b) Durchschnittliche Intelligenz und bspw. nicht angetrunken zu sein, wird vom
Einzelwissenschaftler ebenfalls verlangt.
c) Eine gewisse Erfahrung im Umgang mit der anstehenden
Entscheidungssituation scheint ebenfalls vom empirischen Wissenschaftler
verlangt zu werden. Insbesondere wird man von den Experimentatoren eine
gewisse Erfahrung verlangen. Experimentieren zu lernen, ist ein
Sozialisationsprozess, in dem primär eine Kunstfertigkeit und nur sekundär
Wissen vermittelt wird.
d) Die Einzelwissenschaften gehen nicht eigentlich induktiv vor, sondern
deduktiv prüfend und bestätigend bzw. verwerfend. Auch in der Ethik muss man
nicht nur induktive Verfahren im Auge haben, sondern kann auch deduktiv
konfirmierend vorgehen, indem man allgemeine ethische Prinzipien ebenso wie
Hypothesen der Wissenschaft "frei" erfindet und dann auf ihre Tragfähigkeit in
Einzelsituationen hin prüft. Diesem letzteren Aspekt trägt Rawls womöglich
nicht hinreichend Rechnung. Andererseits lässt sich das von ihm vorgeschlagene
Verfahren offenkundig mit dieser Erweiterung vereinbaren.
e) Das Einfühlungsvermögen in die Interessen und Lage anderer wird dem
Einzelwissenschaftler im allgemeinen nicht abverlangt, obschon selbst in diesem
Zusammenhang noch gewisse sozialwissenschaftliche Methodenvorstellungen
Anlass zu Zweifeln geben können. Da in manchen Ansätzen etwa der
sogenannten „verstehenden Soziologie“ oder auch der rationalen
Entscheidungstheorie ähnliches vorausgesetzt wird.
II. Zur Parallele von "wohldurchdachten Urteilen" und wissenschaftlichen "Basisurteilen"
a) Dass vom Ausfall eines Urteiles in den Einzelwissenschaften keine positiven
bzw. negativen Resultate für den Beobachter abhängen, ist einerseits trivial
richtig andererseits trivial falsch. Es ist trivial richtig insoweit, als der
Einzelwissenschaftler nicht unter der Drohung einer wissenschaftsexternen
Sanktionsinstitution steht. Das gilt jedenfalls unter Absehung von früheren
kirchlichen und heutigen totalitären Bestrebungen für alle Bereiche, in denen
113
man es mit Wissenschaft im eigentlichen Sinne zu tun hat. Es ist trivial falsch,
insoweit als jeder Wissenschaftler durchaus gewisse Wünsche und Interessen
mit Beobachtungs- und Prüfergebnissen verbindet. Er erhofft sich sicherlich
zeitweise geradezu fanatisch bestimmte Ergebnisse, um bestimmte Hypothesen
entweder zu bestätigen oder zu erschüttern. Die Konkurrenz anderer
Wissenschaftler hindert ihn jedoch daran, eigenen Wünschen nach Ruhm,
Anerkennung oder Karriere durch Manipulationen nachzuhelfen. Für und Wider
wägend, argumentationsoffen, revisionsbereit und selbstkritisch sollte zwar
jeder Wissenschaftler nach den offiziellen Normen der Wissenschaft sein. Und
viele Wissenschaftler sind dies alles vermutlich tatsächlich. Entscheidend am
Sozialsystem der Wissenschaft ist jedoch, dass es Mechanismen enthält, die
auch jene, die derartige Verhaltensnormen nicht internalisiert haben und damit
nicht aus eigenem Antrieb befolgen, dazu zwingt, sich weitgehend konform mit
diesen Normen zu verhalten.
Diese Feststellung gilt jedoch je mehr man sich dem sozial- und
geisteswissenschaftlichen Bereich nähert, mit immer stärkeren Abstrichen. Bei
Normentscheidungen wirkt der intersubjektive Zwang dazu, sich der
wissenschaftlichen Grundtugenden zu befleißigen, möglicherweise nicht mehr.
Es
ist
sogar
plausibel,
dass
der
soziale
Druck
der
im
erfahrungswissenschaftlichen Bereich gerade dazu führt, dass auch nonkonformistische Ansichten eine Chance erhalten, indem unabhängige
Prüfinstanzen installiert sind, im Bereich der Normurteile umgekehrt wirkt. Die
Kernfrage, ob ein Einzelurteil deskriptiven Inhaltes nicht doch in einem
grundsätzlichen Sinne verlässlicher und dem Druck intersubjektiv verankerter
Meinungen stärker entzogen ist als ein Norm- oder Werturteil stellt sich hier
erneut. In den empirischen Einzelwissenschaften scheint es tatsächlich so zu
sein, dass ein Individuum, das zu einem von den übrigen Urteilen abweichenden
Beobachtungsurteil kommt, eine gute Chance hat, das Urteil der anderen
Individuen zu revidieren, ohne auf allgemeine Prinzipien zu verweisen. Es reicht
aus, andere in vergleichbare Beobachtungssituationen zu versetzen, sie etwa die
gleichen Experimente durchführen zu lassen, während innerhalb des Bereiches
normativer Urteile die Revision typischerweise durch den Verweis auf die
Verletzung allgemeiner Prinzipien erfolgt. Aber auch hier würde Rawls noch
einwenden können, dass der Verweis auf neue praktische Problemerfahrungen
im normativen Bereich ebenfalls möglich ist. Ein neuer normativ relevanter Fall
taucht auf und fordert eine bestimmte intuitiv angemessene Lösung, die mit den
bisherigen allgemeinen Prinzipien nicht vereinbar ist. Dann wird auch hier der
Zwang
entstehen,
ein
neues
intersubjektiv
akzeptiertes
Überlegungsgleichgewicht herbeizuführen.
114
b) Auch die Wissenschaften interessieren sich nicht für bloß hypothetische Fälle
als Bestätigungs- oder Erschütterungsinstanzen und zeichnen einfache
Beobachtungssituationen als letzte Instanzen bevorzugt aus, sofern sie sich
darauf zu beschränken vermögen. Regelmäßig ist ihnen dies möglich, wobei
allerdings zu beachten ist, dass sie die mit theoretischen Termen formulierten
Hypothesen nur sehr indirekt durch Beobachtung prüfen und ihre
Beobachtungsergebnisse natürlich von vornherein im Lichte bestimmter
Theorien sehen. Auch der Einwand, dass die ethischen Beobachtungssituationen
ungleich komplexer gelagert seien als etwa naturwissenschaftliche, ist
angesichts der Komplexität etwa heutiger physikalischer Experimente als eher
fragwürdig zu betrachten. Weit schwerer wiegt hier der Einwand, dass die
Wissenschaft gerade nach Hypothesen sucht, die ungeachtet der Komplexität der
Anwendungssituation nur auf ein Minimum von Anwendungsvoraussetzungen
Bezug nehmen. Hier scheint die Ethik in der Tat in einer ähnlich schlechten
Situation zu sein, wie die heutigen empirischen Sozialwissenschaften.
Durchschlagende Prinzipien, die unter geringen Voraussetzungen ausnahmslos
zum Zuge kommen, ohne je gegen unsere konkreten Einzelfallurteile zu
verstoßen, scheint sie nicht zu besitzen. Es gibt viele Ausnahmen und
Sonderbedingungen.
c) Auch der Wissenschaftler versucht genau zu analysieren, ob nicht bestimmte
Beobachtungen durch spezielle äußere Umstände verursacht wurden, und wägt
verschiedene Interpretationsmöglichkeiten ab etc.
d) Das Vorliegen innerer Gewissheit wird im allgemeinen ebenfalls für direkte
Beobachtungen der Einzelwissenschaften unterstellt. Man überzeugt sich.
e) Dass ein Urteil intrasubjektiv und intersubjektiv Bestand haben sollte, gehört
selbstverständlich
zum
Glaubenselixier
jeder
Wissenschaft.
Die
Wiederholbarkeit von Beobachtungen ist zentral in allen wirklich erfolgreichen
Wissenschaften, weil sie die kompetitive Selbstüberprüfung der Wissenschaft
erlaubt. Die Wiederholbarkeit hat damit durchschlagende sozialorganisatorische
Konsequenzen auf den Wissenschaftsbe- trieb, die ihrerseits, die "Objektivität"
der Wissenschaft erzeugen.
f) Diese Bedingung könnte man sicherlich nicht für die Wissenschaften
aufrechterhalten, wenn man auch die Prüfung von Theorien durch Theorien
zulassen wollte etc. Andererseits sind ähnliche Prüfungsüberlegungen sicherlich
sinnvoll innerhalb des Rawlsschen Verfahrens zu integrieren. Mit seiner
Forderung nach umfassender Kohärenz zielt dieses Verfahren geradezu darauf
ab, derartige Überlegungen ebenfalls einzubeziehen.
115
Die
Parallele
zwischen
der
Anwendung
des
Rawlsschen
Entscheidungsverfahrens und dem Vorgehen der Einzelwissenschaften scheint
somit vor allem hinsichtlich der Anforderungen b und e an wohlüberlegte
Urteile zweifelhaft zu sein.
Den durch diese Zweifel umrissenen
Problemkomplex kann man als das spezifische Intersubjektivitätsproblem der
ethischen Theoriebildung bezeichnen. Mit dieser Bezeichnung soll keineswegs
von vornherein zum Ausdruck gebracht werden, dass die Wissenschaften in
dieser Hinsicht problemfrei wären, sondern zunächst nur, dass die Ethik vom
Problem womöglich mangelnder Intersubjektivität relativ stärker betroffen ist.
Ob hier ein prinzipieller Unterschied besteht, ist eine weitergehende Frage, die
einer gesonderten Untersuchung bedarf. Und selbst, wenn dies der Fall wäre,
müsste noch geklärt werden, ob eine Methode wie das Rawlssche
Entscheidungsverfahren für die normative Ethik nicht dennoch eine
gerechtfertigte Methode einer Ethik mit reduziertem Intersubjektivitätsanspruch
bilden könnte. Hinzu tritt als bislang missachtetes Problem die Frage, wie sich
Normen allgemeiner und spezieller Art überhaupt widersprechen und damit
aneinander korrigiert werden können. Denn es ist zwar logisch ausgeschlossen,
dass die deskriptiven Sätze A und –A („nicht A“) zugleich wahr werden, dass
jedoch Sätze wie "Tue A!" und "Tue -A!" sich in ähnlicher Weise gegenseitig
ausschließen, erscheint keineswegs als evident. Die Befehle können ja durchaus
zugleich bestehen. Wir wissen zwar, dass wir nicht beide zugleich erfüllen
können, doch die Befehle selbst können nebeneinander existieren, während es
unmöglich ist, dass es zugleich wahr ist, dass es zur Zeit t am Ort o regnet und
nicht regnet.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Parallele zwischen rationalem
einzelwissenschaftlichem und ethischem Vorgehen unvollkommen ist. Zugleich
ist es ein Ideal gerade des praktischen Ethikers vorzugehen, wie Rawls
vorschlägt.
116
3.
Utilitarismus, Rawls und Vertragstheorie
Die vorangehenden Überlegungen betrafen die Voraussetzungen dafür, Ethik
überhaupt zu betreiben und Forderungen moralischer Art zu erheben. Hinzu kam
die Frage nach den grundlegenden ethischen Rechtfertigungsmethoden oder
danach wie man rational mit normativen Fragen umgehen kann. Was inhaltlich
als richtig, gesollt etc. anzusehen ist, war bislang nicht Gegenstand der
Überlegungen. Solchen inhaltlichen Fragen wenden wir uns nun zu.
Grundsätzlich kann man eine normative Ethik auf drei Weisen begründen. Man
kann von Zielen oder dem, was (außermoralisch) wertvoll ist, ausgehen. Man
kann mit ursprünglichen Handlungs-Pflichten zu beginnen suchen. Man kann
schließlich von ursprünglichen moralischen Rechten seinen Ausgang zu nehmen
suchen. Dementsprechend ergeben sich:
1. Ziel-basierte
2. Pflicht-basierte
3. Rechte-basierte
normativ ethische Theorien.
Die erste Klasse enthält die teleologischen Theorien, die das ethisch Rechte
ausschließlich auf der Grundlage einer Konzeption vom außermoralisch Guten
oder Wertvollen zu bestimmen suchen. Die zweite Klasse umfasst alle im
weiteren Sinne deontologischen Theorien, die davon ausgehen, dass man das
ethisch Rechte teilweise unabhängig vom Guten oder Wertvollen erkennen bzw.
rational bestimmen kann. Zur ersten Klasse gehören partikularistische
interessenbasierte Theorien, die von herrschenden Konventionen und
Traditionen ausgehen und vor allem auch der klassische und nicht-klassische
Utilitarismus. Zu den deontologischen Theorien gehören in jedem Falle die
Kantische und jedenfalls nach der eigenen Selbsteinschätzung die ApelHabermassche Diskursethik. Die Theorie von Rawls nimmt in gewisser Weise
eine Mittler-Stellung ein. Was systematisch gilt, gilt für sie auch in der
vorliegenden Darstellung, die mit dem Utilitarismus beginnt, dann einige
Elemente der Rawlsschen Theorie behandelt und schließlich einige wenige
Bemerkungen zur Diskursethik und ihren quasi-kantischen Grundlagen macht.
117
3.1. Klassischer Utilitarismus
3.1.1. Hedonistische und andere Wertlehren
Wollen Sie lieber ein glückliches Schwein oder ein unglücklicher Sokrates sein?
Insbesondere die Gegner des Utilitarismus bedienen sich gern solcher
Suggestiv-Fragen. Im Gegensatz zu dem, was in der deutschen Folklore über
den Utilitarismus im allgemeinen verbreitet wird, handelt es sich dabei
allerdings keineswegs um eine „Ethik für Schweine“. Es ist nicht zutreffend,
dass mit dem Utilitarismus notwendig eine „hedonistische“, d. h. an der
unmittelbaren körperlichen Lust orientierte Sichtweise von dem, was in sich
wertvoll ist, verbunden werden muss. Es gibt diese Variante des Utilitarismus,
aber es ist dies nur eine unter verschiedenen Formen einer utilitaristischen Lehre
von dem, was im außermoralischen Sinne – also unabhängig oder vor einer
moralischen Bewertung – wertvoll ist.
Dass „Kegel zu schieben“ so gut sei, wie der Genuss dichterischer Werke,
sofern beide nur das gleiche Maß an Lust erbringen, ist zwar eine denkwürdig
„demokratische“ – jedenfalls anti-elitäre – Äußerung Jeremy Benthams, doch
nicht die Meinung aller Utilitaristen. Ein sogenannter „idealer Utilitarismus“,
wie ihn John Stuart Mill vertrat, würde für die Überlegenheit bzw.
Höherwertigkeit kultivierter Freuden wie des Genusses dichterischer Werke
gegenüber der Freude am Kegeln plädieren. Andere Utilitaristen sahen in der
Befriedigung menschlicher Präferenzen – was auch immer diese beinhalten
mochten – den ausschlaggebenden Wert. Nach dieser Sicht sollen die Menschen
bekommen, was sie wollen und die Welt ist umso besser, desto stärker die
Menschen
ihre
Präferenzen
in
ihr
verwirklichen
können
(Präferenzutilitarismus).
Die ausschlaggebende und für den Utilitarismus ganz allgemein kennzeichnende
Bedingung ist nicht die Wahl einer spezifischen Wertlehre, sondern eine
bestimmte Auffassung davon, was es heißt, verallgemeinerungsfähig zu urteilen,
und davon, worauf sich die verallgemeinerungsfähigen Urteile stützen sollen.
3.1.2. Prinzipien utilitaristischer Verallgemeinerung
Es geht den Utilitaristen darum, das Übergewicht außermoralisch oder
„natürlich“ „guter“ gegenüber natürlich „schlechten“ Folgen des menschlichen
Handelns zu maximieren. Die Utilitaristen akzeptieren, wenn es um die
Beurteilung des Handelns geht, strikt das Prinzip der Neutralität oder
118
Unparteilichkeit. Niemand soll mehr als ein anderer zählen und jeder so viel wie
jeder andere. Die Interessen von jedermann sind gleichermaßen zu
berücksichtigen. Diese Auffassung teilen Utilitaristen nicht nur untereinander,
sondern im wesentlichen mit allen neuzeitlichen Moraltheorien, die größeren
Einfluss gewinnen konnten. Der Utilitarismus trennt sich von anderen Formen
verallgemeinerungsorientierter Ethik dadurch, dass er der Unparteilichkeitsbedingung eine spezifische Deutung zukommen lässt.
Der Utilitarismus meint erstens, dass es bei der Bewertung des Handelns
letztlich nur auf die dadurch herbeigeführten Zustände und damit jeweils nur auf
die Konsequenzen des Handelns ankommt (Konsequentialismus). Und
zweitens geht es für den Utilitaristen bei der Bewertung von Konsequenzen
immer nur um die Auswirkungen auf Individuen. Nur das, was sich
„bei“ Individuen niederschlägt, ist bewertungsrelevant. Der Utilitarist unterwirft
sein eigenes Werturteil den „aggregierten“ Wertungen aller (was damit gemeint
ist, wird sich genauer in der konkreten Ausformung einer utilitaristischen
Position zeigen vgl. u.).
Will man die erwähnten Grundüberzeugungen der Utilitaristen als gesonderte
„Prinzipien“ erfassen, so kann man zum ersten auf das „Substitutionsprinzip“,
zum zweiten auf das „Äquivalenzprinzip“ und zum dritten auf das
„Individualprinzip“ zu sprechen kommen.
Das Substitutionsprinzip besagt, dass man in der Gesamtbewertung einer
Alternative die durch die Realisierung der Alternative erlangte Interessenbefriedigung (Präferenzerfüllung) eines Individuums A durch die Interessenbefriedigung (Präferenzerfüllung) eines Individuums B ersetzen (substituieren)
kann. Diese Substituierbarkeit ist für den Utilitaristen Ausdruck der Unparteilichkeit. Denn der Utilitarist meint, dass der Grad der Interessenbefriedigung
von Herrn A nicht deshalb mehr zählen kann als der Grad der Interessenbefriedigung von Frau B, weil Herr A Herr A und Frau B Frau B ist. Deshalb
darf und muss man nach utilitaristischer Auffassung eine Verringerung der
Interessenbefriedigung von Herrn A hinnehmen, wenn dadurch eine größere
Steigerung der Interessenbefriedigung von Frau B erreicht wird.
Das Äquivalenzprinzip besagt, dass es letztlich nicht darauf ankommt, ob
bestimmte Auswirkungen auf die Interessenbefriedigung von Individuen
dadurch eintreten, dass man handelt und so in den Weltverlauf kausal eingreift
oder dass man nicht handelt und etwas durch Unterlassen geschehen lässt. Wenn
Herr Meyer Herrn Schulze auf einer Klippe stehen sieht und Herr Schulze ist der
ärgste Feind von Herrn Meyer, Herr Meyer nun erkennt, dass Schulze im Begriff
119
steht, einen Schritt zurück zu tun, der ihn unweigerlich von der Klippe stürzen
wird, dann tötet Herr Meyer Herrn Schulze durch Unterlassung eines Warnrufes.
Nehmen wir an, dass Meyer bewusst den Ruf unterlässt, um Schulze die Klippe
hinunter segeln zu lassen. Dann ist die Tötung sogar intendiert. Für den
Utilitaristen ist dies letztlich gleichwertig mit einer Situation, in der Meyer vor
Schulze steht und ihm einen leichten „Stupps“ versetzt, um ihn die Klippe
hinunter zu stürzen bzw. wenn er Schulze anbrüllt „tritt zurück!“ und ihn
dadurch die Klippe hinunter befördert.10
Der Utilitarist akzeptiert neben dem Substitutionsprinzip und dem
Äquivalenzprinzip zum dritten das „Individualprinzip“. Für ihn geht es bei der
Bewertung von Weltzuständen letztlich darum, diese nach dem Maßstab der
Interessenbefriedigung der Individuen einzuschätzen. Er bildet seine Präferenzordnung über alle Weltzustände auf der Grundlage der individuellen Bewertungen oder Interessen, wie sie durch die Herbeiführung der Weltzustände
entstehen. Streng genommen besagt das Individualprinzip, dass für den Utilitaristen jede Bewertung ethischer Art eine Funktion der individuellen Betroffenheiten bzw. Bewertungen ist. Er unterwirft seine eigene ethische Präferenz
den Präferenzen aller; wobei ganz im Sinne der utilitaristischen Neutralitätsforderung die eigene Präferenz nur eine von vielen ist.11
Das Individualprinzip des Utilitarismus betrachtet im Prinzip jedes Individuum
als eine „Messstation“ für die Interessenbefriedigung dieses Individuums. Nach
dem Individualprinzip wird die insgesamt erreichte Interessenbefriedigung
(Präferenzerfüllung) aller Individuen als eine Funktion der individuellen
Interessenbefriedigungen (Präferenzerfüllungen) betrachtet. Individualistisch ist
ein solcher Ansatz insoweit, als er die Bemessungsgrundlage für das
Gemeinwohl bzw. das Wohl aller in der Wohlfahrt der Individuen sieht.
Kollektivistisch ist dieser Ansatz insoweit, als er als letzten ethischen Maßstab
10
Kurz, die Differenz von Handeln und Unterlassen bricht aus Sicht des Utilitaristen als wertungsrelevante
Distinktion zusammen. Allerdings kann man als Utilitarist auch einen weiteren Konsequenzenbegriff verwenden.
Danach ist die Tatsache, Konsequenzen einmal durch Wahl einer Option, die landläufig als Unterlassung gilt und
einmal durch Wahl einer Option, die wir als Handeln klassifizieren, herbeigeführt zu haben, Teil der
Konsequenzen dieser Wahl; zu diesen eher subtilen Punkten BROOME, J. (1991): Weighing Goods. Equality,
Uncertainty and Time. Oxford: Basil Blackwell.
11
Das hier anscheinend gegebene Problem eines infiniten Regresses oder der Zirkularität ist insbesondere dann
lösbar, wenn man genau zwischen den „ethischen“ Präferenzen, die sich erst aufgrund der utilitaristischen
Bewertung ergeben und den „natürlichen“ oder direkten Präferenzen unterscheidet. Der moralische Beurteiler
muss nach utilitaristischer Sicht das moralische Urteil ja aus den außermoralischen Bewertungen bilden. Seine
eigenen außermoralischen Bewertungen sind dann für die moralische Urteilsbildung ebenso unabhängig von den
Moralurteilen anderer gegeben wie die außermoralischen Bewertungen anderer vgl. HARSANYI, J. C. (1977):
Rational Behavior and Bargaining Equilibrium in Games and Social Situations. Cambridge: Cambridge
University Press, SEN, A., and B. WILLIAMS (1982): "Utilitarianism and Beyond," London: Cambridge
University Press.
120
das Wohl aller betrachtet (womit natürlich, das Problem des Bereiches von
„alle“ bzw. „jeder“ angesprochen wird).
Substitutions-, Äquivalenz- und Individualprinzip zusammen implizieren eine
spezifische Auffassung von der Bestimmung des Gemeinwohls und letztlich der
Ethik insgesamt. Die Maximierung des gesamten Nutzens aller ist
ausschlaggebendes Kriterium des ethischen richtigen. Die Annahme der
Substituierbarkeit der Interessenbefriedigung des einen durch die Interessenbefriedigung des anderen, die Norm der Unparteilichkeit, nach der jeder so viel
zählen soll wie der andere und keiner mehr als irgendein anderer, diese beiden
legen es nahe, sich ganz im Sinne des traditionellen Utilitarismus am Modell
einer „Summenbildung“ als Gemeinwohlkriterium zu orientieren.12
3.1.3. Kommensurabilität und interindividuelle Substituierbarkeit
Eine einfache Summenbildung geht allerdings von der „Kommensurabilität“ der
Nutzenmaße der Individuen aus und damit von einer sehr weitreichenden
Annahme. Um zu sehen, wie weitreichend diese Annahme ist, betrachte man das
Beispiel des Zehnkampfes. Im Zehnkampf werden die Ergebnisse der Athleten
nach einer Punktetabelle bewertet. Das Ergebnis des einzelnen Wettkampfes
lässt sich in objektiver Weise messen. Man kann beispielsweise im Hochsprung
feststellen, dass ein bestimmter Athlet 1,95 m hochgesprungen ist. In gleicher
Weise kann man mit einer Stoppuhr festhalten, dass dieser Athlet im 100 mSprint eine Zeit von 10,9 Sekunden erreicht hat. Will man diese beiden
Ergebnisse mit den Ergebnissen eines anderen Zehnkämpfers vergleichen, der
beispielsweise im Hochsprung 2,00 m hochgesprungen ist – also 5 cm höher als
der erste Athlet – und im 100 m-Lauf 11 Sekunden schnell war – also eine
Zehntelsekunde langsamer als sein Konkurrent –, dann kann man nur feststellen,
dass der eine in der einen Disziplin besser, in der anderen schlechter war als der
andere und der andere ebenfalls in einer Disziplin besser und in einer schlechter.
Wäre der zweite Athlet auch schneller gelaufen, also beispielsweise 10,8
Sekunden auf 100 Metern, dann wäre der Vergleich zwischen den beiden
hinsichtlich der beiden betrachteten Disziplinen einfach gewesen. Der eine wäre
12
Man kann hier Bezüge zu axiomatischen Charakterisierungen von „linearen Aggregationsfunktionen“ im
allgemeinen ebenso herstellen wie zu spezifischen axiomatischen Charakterisierungen sogenannter
Sozialwahlfunktionen mit utilitaristischen Eigenschaften; vgl. z.B. YOUNG, H. P. (1994): Equity. In Theory and
Practice. Princeton: Princeton University Press. oder SEN, A. K. (1982): Choice, Welfare, and Measurement.
Oxford: Oxford University Press, SEN, A. K., and B. WILLIAMS (1982): Utilitarianism and Beyond. Cambridge:
Cambridge University Press.).
121
in beiden Disziplinen besser als der andere und damit sicherlich vorzugswürdig
gewesen. Im vorliegenden Fall ist es jedoch so, dass der eine den anderen
einmal dominiert, während er einmal dominiert wird vom anderen.
Erst die Existenz der Zehnkampftabelle führt dazu, dass man dennoch einen
eindeutigen Vergleich zwischen den beiden Athleten herstellen kann. Entweder
ist der erste Athlet besser als der zweite oder der zweite Athlet ist besser als der
erste oder beide sind gleich gut nach Maßgabe einer solchen Punktetabelle. Das
gilt auch, ohne Dominanz in allen Hinsichten annehmen zu müssen. Die
Punktetabelle sagt uns, wie viel 5 cm im Hochsprung wert sind in
Zehntelsekunden im 100m-Lauf. Wie in der Umrechnung von internationalen
Währungen legt die Punktetabelle einen Umrechnungs- oder Verrechnungskurs
zwischen den verschiedenen Maßeinheiten fest. Sie sagt uns, wie viel in den
einheitlichen Punktmaßen die verschiedenen Disziplinmaße „wert“ sind.
Mit seinem Substitutionsprinzip geht der Utilitarismus letztlich davon aus, dass
eine Kommensurabilität zwischen den Werten von einzelnen Menschen in eben
solcher Weise besteht, wie es eine Kommensurabilität zwischen den Werten in
den Disziplinen des Zehnkampfes gibt. Diese Auffassung erscheint vielen
Philosophen als offenkundig absurd. Fraglich ist allerdings, ob nicht jede
ethische Position, die überhaupt zu einem übergreifenden Gemeinwohlurteil
kommen will, eine Verrechenbarkeit von Werten implizit voraussetzt und damit
ähnlichen Absurditätsrisiken ausgesetzt ist.
Wenn etwa im Fall von zwei Weltzuständen X und Y die Person A in X besser
gestellt wird als in Y und die Person B in Y besser gestellt wird als in X, dann
muss derjenige, der von einem übergeordneten Standpunkt aus sagen will, X sei
besser als Y in einer Ethik, die die individuellen Interessen berücksichtigt,
anscheinend die Interessenbefriedigung der beiden Betroffenen miteinander vergleichbar machen. De facto tut er dies jedenfalls dann, wenn er je einen der Zustände für alle verbindlich wählen sollte. Mag der Wählende über Interessenbefriedigungen auch überhaupt nicht sprechen, sondern möglicherweise nur über
eine intrinsische Vorzugswürdigkeit des einen gegenüber dem anderen Zustand,
entweder kommt es zu X oder zu Y und einer, entweder A oder B, hat de facto
das bessere Ende für sich.
Die traditionelle Ethik mag mit ihrer Verallgemeinerungsforderung insgesamt
im Glashaus sitzen. Doch lässt es sich nicht bestreiten, dass sich bestimmte
Konflikte im Utilitarismus mit besonderer Dramatik zeigen. Betrachten wir, um
dies genauer zu sehen, einige traditionelle solcher Probleme etwas näher.
122
3.1.4. Utilitaristische Politiken
Wenn die ethische Theorie niemals befolgt würde, dann bräuchte man sich auch
keine Gedanken darüber zu machen, was der Fall sein würde, wenn sie denn
befolgt würde. Man müsste sich insbesondere in einer folgenorientierten Ethik
keine Gedanken über die Folgen der Propagierung der Ethik selbst machen. In
einer folgenorientierten Ethik wie dem Utilitarismus ist diese Vernachlässigung
der Frage nach der faktischen Wirkung einer Theorie als Leitideologie einer
Gesellschaft allerdings noch fragwürdiger als in einer Ethik, die die Richtigkeit
des Handelns zumindest partiell unabhängig von den Handlungsfolgen
beurteilen will.
Wesentliche Teile der Diskussion um den Utilitarismus gehen von der Annahme
aus, dass der Utilitarismus als Leitideologie in der Gesellschaft wirksam sei und
untersuchen eine Welt, in der die Menschen und insbesondere die Politiker nach
utilitaristischen Prinzipien vorgehen. Man fragt sich typischerweise, was der
Utilitarismus in einer bestimmten normativen Frage von uns verlangen würde,
nimmt an, dass die utilitaristischen normativen Vorgaben perfekt befolgt würden
und untersucht dann die Konsequenzen bzw. Ergebnisse darauf hin, ob sie
akzeptabel scheinen oder nicht.13
Diese Fragestellung scheint insofern unangemessen, als sie die Unterscheidung
einer Rechtfertigung von Institutionen und Regeln auf der einen und
Handlungen unter Regeln nicht angemessen berücksichtigt. Die Regeln des
Versprechens etwa können utilitaristisch durch ihre Konsequenzen gerechtfertigt
sein, während ein einzelner Versprechensakt nur nach der Regel, dass man
Versprechen halten soll, beurteilt wird, ohne die Konsequenzen des einzelnen
Versprechensbruches bzw. der einzelnen Erfüllung des Versprechens
einzubeziehen (vgl. dazu im einzelnen Lahno, B. (1995)). Doch ungeachtet
dieser wichtigen Unterscheidung würde man im Normalfall annehmen wollen,
dass in einer Gesellschaft, in der man sich etwa auf eine utilitaristische
Rechtfertigung der grundlegenden Regeln und Institutionen beruft, der
Utilitarismus nicht nur als Theorie auf Institutionen Anwendung findet, sondern
selbst als Teil Leitideologe der Gesellschaft in die moralischen Praktiken des
Alltags Eingang findet und allgemeine Anwendung findet.
13
Die formale Entscheidungstheorie hat sich aus diesem Grunde mit der sogenannten Theorie-Absorption
befasst; d.h. wenn die Theorie selbst die Realität beeinflusst, wie kann die Theorie dem Rechnung tragen; vgl.
DACEY, R. (1976): "Theory Absorption and the Testability of Economic Theory," Zeitschrift für
Nationalökonomie, 36, 247-267, — (1981): "Some Implications of 'Theory Absorption' for Economic Theory
and the Economics of Information," in Philosophy in Economics, ed. by J. C. Pitt. Dordrecht: D. Reidel, 111-136.
123
Man kann mit einer gewissen Plausibilität sagen, dass eine ethische Theorie
bereits dann ethisch unangemessen sei, wenn ihre allgemeine Befolgung
schlechte Folgen hätte. Ebenso darf man womöglich eine Theorie nur dann für
potentiell annehmbar halten, wenn ihre allgemeine Befolgung zu annehmbaren
Ergebnissen führen würde. Es ist gewiss nicht verfehlt, die Methodologie des
kontrafaktischen Tests zunächst zu akzeptieren, um erst zu einem späteren Stand
der Überlegungen auf die an sich ziemlich bedeutende Frage faktischer
Wirksamkeit ethischer Theorie und die Unterscheidung zwischen der
Rechtfertigung von Institutionen und der Rechtfertigung einzelner Handlungen
erneut einzugehen (vgl. auch unten 4.1). Stellen wir uns also für das Folgende
einen Funktionsträger, einen „wohlwollenden Diktator“ vor, der die ethische
Theorie, die wir ihm vorschlagen, detailgetreu anwendet und betrachten wir
einige exemplarische utilitaristische Politiken unter dieser Voraussetzung. 14
Beginnen wir mit der utilitaristischen Verteilungspolitik.
3.1.4.1. Austeilende utilitaristische „Gerechtigkeit“
In das Konzept des „Gemeinwohls“ kann jedermann im wesentlichen das
hineinlesen, was er gerne realisiert sehen möchte. Diese willkürliche
Deutbarkeit des Gemeinwohlbegriffes, mag diesen für politische Zwecke
besonders brauchbar werden lassen. Für theoretische Zwecke ist es jedoch
durchaus fragwürdig, einen derart beliebig deutbaren Begriff verwenden zu
müssen. Eine Stärke des Utilitarismus besteht zweifelsohne darin, dass er dem
Begriff des Gemeinwohls eine festere Deutung gibt: Das Gemeinwohl besteht
darin, den Nutzen aller zu wahren – und zwar konkret die Summe des Nutzens
über alle Individuen. Man weiß beim Utilitarismus im Gegensatz zu anderen
ethischen (Verteilungs-)Theorien zumindest einigermaßen genau, worüber man
redet.
Für eine utilitaristische Theorie ist es unerheblich, wer der Empfänger von
Nutzen ist. Aufgrund des Substitutionsprinzips ist die Nutzenerfahrung eines
Individuums durch die Nutzenerfahrung eines anderen ersetzbar. Genau dieser
Sachverhalt wird ja durch die Summierung der Nutzenwerte einzelner
Individuen in einer Gesamtnutzensumme erfasst. Nimmt man nun hinzu, dass
wir im allgemeinen davon ausgehen, dass Bedingungen „abnehmenden
Grenznutzens“ vorliegen, dann ergeben sich sogleich gewisse Folgerungen für
eine utilitaristische Verteilungstheorie: Man stelle sich etwa vor, man habe sehr
14
Zur Kritik an der Annahme des wohlwollenden Diktators vgl. klassisch BUCHANAN, J. M. (1999): The Logical
Foundations of Constitutional Liberty. Indianapolis: Liberty Fund.
124
großen Hunger. Die erste Brotscheibe, die man erhält, wird im allgemeinen sehr
viel Nutzen stiften. Die Befriedigung, die man aus ihr ziehen kann, ebenso wie
der Beitrag zur Ernährung und Gesundheit, die sie zu leisten vermag, werden
besonders groß sein. Wenn jemand seinen Heißhunger gestillt hat, wird er
vermutlich spätestens ab der zehnten Brotscheibe das empfinden, was man als
abnehmenden Grenznutzen bezeichnen kann. Jede zusätzliche Scheibe Brot wird
ihm weniger Nutzen bringen und ihn schließlich sogar eher quälen als ihm
zusätzliches Vergnügen zu bereiten.
Es ist keineswegs unplausibel anzunehmen, dass über den gesamten Bereich
zusätzlicher Broteinheiten mit jeder Brotscheibe der zusätzliche Nutzen
abnimmt. Als ganz einfaches illustratives Zahlenbeispiel könnte man sich
vorstellen, dass die erste Scheibe Brot 10 Nutzeneinheiten stiftet, die zweite 9,
die dritte 8, usw. die zehnte hingegen überhaupt keinen Nutzen mehr für den
Konsumenten erbringt. Schließlich wird der Grenznutzen sogar negativ werden,
weil dem Konsumenten schlecht wird.
Wenn man sich vorstellt, dass man sich in der Rolle eines wohlwollenden
Diktators befindet, der für die Gesellschaft insgesamt eine „Allokation“ der
Güter finden soll, die den größten Nutzen stiftet, so wird man das sogenannte
„Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen“ zu beachten haben. Wenn jedes
Individuum dieser nicht gerade unplausiblen Annahme unterworfen ist, dann hat
das Folgen für die Art der Planung. Unter der zusätzlichen Voraussetzung, dass
interpersonelle Nutzenvergleiche möglich sind – eine Voraussetzung, die ein für
das gesamte Kollektiv entscheidender Planer unausweichlich machen muss –,
wird der Planer die gesellschaftlichen Ressourcen so verteilen, dass der
Grenznutzen bei jedem Individuum genau der gleiche ist.
Offenkundig kann unter Bedingungen der beliebigen Nutzensubstitution die
Nutzensumme nur dann maximiert werden, wenn jeder Empfänger von Nutzen
genau den gleichen zusätzlichen Nutzen aus einer weiteren Ressourceneinheit
ableitet. Denn zöge A aus einer zusätzlichen Einheit e einen höheren Nutzen als
B, der sie gerade erhält, dann sollte die Einheit e von B auf A umverteilt werden,
um eine Gesamtnutzensteigerung zu erzielen (es muss bei B weniger aufgegeben
werden, als man dafür bei A an zusätzlichem Gesamtnutzen erzielen könnte).
Umgekehrt, solange nicht jeder genau die gleiche Nutzenerfahrung aus einer
zusätzlichen Nutzeneinheit gewinnt, sollte man Ressourcen genau bei jenen
konzentrieren, die dadurch einen größeren Nutzen erfahren. Denn dadurch steigt
die Nutzensumme insgesamt am stärksten an. Nimmt man nun hinzu, dass nach
aller Plausibilität reiche Individuen aus einer zusätzlichen Gütereinheit, da sie
125
schon sehr viele Gütereinheiten besitzen, weniger Nutzen ziehen als arme
Individuen, so bringt das in etwa die Auswirkungen eines abnehmenden
Grenznutzens unter Bedingungen interpersonaler Vergleichbarkeit auf die
Nutzensummenmaximierung zum Ausdruck. Unter solchen Bedingungen wird
das Individuum mit geringem Wohlstand im allgemeinen der Empfänger
besonderer Förderung sein, weil bei diesem Individuum der anfallende
Grenznutzen voraussichtlich am größten sein wird.
Zwar ist es nicht logisch zwingend so, doch empirisch höchst plausibel, dass die
ärmeren Individuen im allgemeinen aus einer zusätzlichen Gütereinheit einen
höheren Nutzen ziehen werden. Ebenso wie im Falle des Beispiels des
Brotkonsums haben sie von den jeweiligen Gütern im allgemeinen weniger
konsumiert bzw. eine geringere Grundausstattung dieser Güter. Im Ergebnis
führt diese Überlegung dazu, dass die gesellschaftlichen Ressourcen bevorzugt
den ärmeren Individuen zugeteilt werden müssen, wenn ein wohlwollender
Planer im utilitaristischen Sinne das Gemeinwohl zu maximieren sucht. Denkt
man etwa an eine Welt, in der es neben öffentlichen Güterverteilungen auch
private Güterausstattungen gibt, dann wird die öffentliche Güterzuteilung
bevorzugt an jene gehen, die einen hohen Grenznutzen aus ihr ziehen.
Soweit bislang beschrieben, scheint der Utilitarismus aus Sicht des ohnehin
latent sozialistischen Alltagverstandes eine plausible Konzeption der Verteilung
des gesellschaftlichen Reichtums bzw. einer Austeilung jenes Anteiles des
Reichtums, über den die öffentliche Hand verfügt. Jedenfalls dann, wenn ein
wohlwollender Diktator Güter auszuteilen hat, scheint er einen guten Grund zu
einer Verteilung zu haben, die zum Ausgleich der Grenznutzen führt.
Mögliche Gegeneinwände liegen allerdings auch nicht fern. Wenn
beispielsweise ein Individuum A über einen weiten Bereich höhere Nutzen aus
jeder zusätzlichen Gütereinheit zieht als ein Individuum B, dann sollte das
Individuum A die zusätzlichen Einheiten erhalten. Vorausgesetzt, dass es eine
hinreichende Quantität des zu verteilenden Gutes gibt, garantiert die Annahme
vom schließlich abnehmenden Grenznutzen, dass tatsächlich an irgendeinem
Punkt das Individuum A einen geringeren Grenznutzen haben wird, als das
Individuum B, wenn es eine zusätzliche Gütereinheit erhält. Damit ist auch
garantiert, dass das Individuum B nicht gänzlich leer ausgeht. Nicht garantiert
ist jedoch, dass beide die gleichen Quantitäten erhalten.
Im Falle bestimmter schwerer Handikaps würden wir gerade annehmen, dass
diese Ungleichheit hochgradig plausibel und erwünscht ist. Der Benachteiligte
erhält besonders viel Aufmerksamkeit und Ressourcen, um seine Benach-
126
teiligung zu kompensieren. Wenn allerdings ein ohnehin schon wohlhabendes
Individuum besonders empfänglich für zusätzliche Gütereinheiten sein sollte,
dann müsste es diese zusätzlichen Einheiten erhalten, bis sein abnehmender
Grenznutzen schließlich soweit gefallen ist, dass andere mehr Nutzen aus einer
zusätzlichen Einheit ziehen können. Konkret gesprochen würde das heißen
können, dass der ohnehin schon Reiche noch mehr an Reichtum erhält, indem
der wirtschaftliche Planer ihm zusätzliche Ressourcen zur Verfügung stellt, um
den gesellschaftlichen Gesamtnutzen durch Förderung des Reichen zu
maximieren. Für „hedonistisch“ begründete Varianten des Utilitarismus ergibt
sich ein weiteres Problem daraus, dass die Glücksforschung zu zeigen scheint,
dass Menschen sich an ihre Situation anpassen. Wenn also jemand eine sehr
ernste Behinderung erleidet, so ist er in der Regel binnen kurzem soweit, dass er
seine Ansprüche an die neue Situation anpasst und dann relativ zu dieser
subjektiv ebenso glücklich ist wie zuvor, obschon seine Gesamtsituation
objektiv betrachtet viel schlechter ist. Vor diesem Hintergrund hätte der
hedonistische Utilitarist guten Grund, erst abzuwarten, wieweit sich Menschen
an Missgeschicke anpassen und erst dann Hilfe zu leisten, um das angemessene
Glücksniveau
auch
ohne
nachhaltige
Verbesserung
der
Lage
„preiswerter“ erreichen zu können.
Man muss hier genau unterscheiden zwischen der Frage, ob eine solche
Situation empirisch plausibel scheint und der Frage, ob man dann, wenn sie
tatsächlich vorliegt, in der entsprechenden Weise verfahren sollte. Die
Unplausibilität einer Verteilung durch öffentliche Hände zugunsten der ohnehin
Bessergestellten beruht möglicherweise zum großen Teil darauf, dass wir
einfach nicht glauben, dass die entsprechenden Bedingungen jemals vorliegen.
Wenn sie denn jemals vorlägen, dann wären möglicherweise einige von uns
auch bereit, eine entsprechende Umverteilung von „unten“ nach „oben“ zu
akzeptieren. Andere würden allerdings meinen, dass die Orientierung an der
Summe des Nutzens ethisch unannehmbar würde. Das würde vermutlich ebenso
im Falle der Anpassung der Ansprüche an Glücksniveaus gelten.
Die vorangehenden eher harmlosen Einwände erschöpfen keineswegs das Feld
möglicher Probleme einer austeilenden Gerechtigkeit utilitaristischer Art. Es
gibt eine Vielzahl weiterer Einwände, von denen einige nun zu besprechen sind.
127
3.1.4.2. Grundlegende Argumente gegen utilitaristische Umverteilung
Gegen den Utilitarismus ist auf vielfältige Weise argumentiert worden. Am
Ende laufen die meisten Argumente auf das Gleiche hinaus. Es wird aufgezeigt,
dass von der utilitaristischen Logik der Gemeinwohlorientierung her das Opfer
des Individuums für die Gesamtheit droht. Denkt man an das
Substitutionsprinzip, dann ist offenkundig, wie es zu dieser Gefahr kommen
kann. Klassische Einwände sind etwa der von der sozialen Interdependenz, der
von der so genannten Überlebenslotterie und der von der Bestrafung
Unschuldiger. In beiden letzteren Fällen wird aufgezeigt, dass die Maximierung
des Gesamtnutzens, der das Gemeinwohl repräsentiert, tendenziell darauf hinaus
läuft, keinerlei individuelle Rechte zu respektieren. Im ersten Fall geht es um
eine eher technische Schwierigkeit. Beginnen wir mit dem ersten Fall.
Individuen, die von vielen geliebt werden, sollten anscheinend nach
utilitaristischer Logik zusätzlich zu der Liebe, die sie ohnehin empfangen, auch
noch vom gesellschaftlichen Planer mit Ressourcen bedacht werden. Denn ein
von vielen geliebtes Individuum erfreut durch die Freude, die es selbst erfährt,
diejenigen, die dieses Individuum lieben, ebenfalls. Dieser Nutzen muss
berücksichtigt werden. Umgekehrt sollte ein Individuum, das von vielen
verachtet wird und dem viele möglicherweise schlechtes wünschen, tatsächlich
vom gesellschaftlichen Planer auch schlecht gestellt werden, da es anderen
Individuen eine Freude bereitet bzw. bei diesen Nutzen stiftet, wenn das
Individuum schlechter gestellt wird.
Solche Folgerungen dürften vielen unserer Intuitionen zuwider laufen. Wir
glauben, dass ein ethischer Planer die Dinge anders regeln sollte, um gerecht zu
sein. Das Problem der Interdependenz der Nutzen sollte daher so gelöst werden,
dass man die indirekte Nutzenstiftung nicht berücksichtigt. Das scheint
grundsätzlich machbar. Der Eindruck, dass der Utilitarismus gewissen ethischen
Grundintuitionen nicht gerecht wird, verstärkt sich allerdings sehr, wenn man
dramatischere Fälle betrachtet. Beginnen wir mit dem einer Bestrafung
Unschuldiger.
Man versetze sich 100 Jahre zurück und stelle sich vor, dass in irgendeiner
Kleinstadt im amerikanischen Süden eine weiße Frau vergewaltigt und ermordet
worden ist. Es gibt Indizien dafür, dass die Tat von einem Schwarzen begangen
wurde, doch man hat keinerlei Wissen darüber, welche Person der Täter sein
könnte. Der Mob rast. Schwarze werden durch die Strassen getrieben und es ist
für den ortsansässigen Sheriff vollkommen klar, dass bei den Ausschreitungen
am Ende mehrere Schwarze zum Opfer der Lynchjustiz werden müssen. Der
128
Sheriff entschließt sich daher, einen schwarzen Mitbürger willkürlich
herauszugreifen und ihn als den Mörder zu präsentieren. Der Sheriff weiß, dass
das die Menge beruhigen wird und so, durch das Opfer eines voraussichtlich
unschuldigen Einzelnen, mehrere ebenso unschuldige Menschen gerettet werden
können. Viele Leben sind wichtiger als eines für ihn und als guter Utilitarist
beschließt er, lieber den einen zu opfern, als die Ermordung mehrerer
hinnehmen zu müssen.
Wenn die Fakten tatsächlich so sind wie geschildert, dann scheint der
Utilitarismus tatsächlich die beschriebenen Konsequenzen zu haben. Aus Sicht
vieler ethischer Theoretiker macht das den Utilitarismus unannehmbar. Sie
beharren darauf, dass es in einer annehmbaren ethischen Theorie nicht möglich
sein darf, die Rechte eines Einzelnen beliebig denen der Allgemeinheit
aufzuopfern. Das scheint zunächst ein ziemlich plausibler Gegeneinwand zu sein.
Denn Rechte haben die zentrale Funktion, uns davor zu schützen, beliebig für
das Gemeinwohl aufgeopfert zu werden.
Andererseits muss man festhalten, dass es hier nicht um positiv-rechtliche
Anrechte geht, sondern darum, was ein Einzelner in einer Notsituation tun sollte.
Der Sheriff ist als Person gefragt, nicht als Funktionsträger, der auf die
Rechtsordnung zurückgreifen könnte. Die Rechtsordnung sagt klar, dass
Lynchjustiz nicht erlaubt ist. Aber der Sheriff sieht sich mit dem Problem
konfrontiert, den Rechtsbruch rechtskonform nicht, doch womöglich durch
eigenen Rechtsbruch sehr wohl verhindern zu können.
Wenn man sich vorstellt, dass man als Einzelner an einer Weiche steht, die man
jederzeit umstellen kann, so dass Züge von Gleis A auf Gleis B umgelenkt
werden, so könnte man mit dem folgenden bekannten philosophischen Problem
konfrontiert sein:
Auf dem Gleis A arbeitet ein einzelner Arbeiter. Auf dem Gleis B arbeiten fünf
Arbeiter. Ein außer Kontrolle geratener Schienenbus kommt auf die Weiche
zugerast. Die Weiche steht so, dass er unweigerlich auf das Gleis B fahren und
dort ebenso unausweichlich fünf Gleisarbeiter töten wird. Derjenige, der an der
Weiche steht und diese umlegen kann, hat die Möglichkeit, fünf zu retten, indem
er einen opfert.
Viele von uns würden annehmen, dass lieber der eine geopfert werden sollte als
die fünf. Dann stellt sich jedoch die Frage, warum der Sheriff in dem
amerikanischen Südstaat nicht auch den einen opfern sollte, um mehrere zu
retten.
129
Es stellt sich uns die Frage, ob wir die ethische Maxime, in derartigen
Situationen, immer so zu handeln, für richtig oder falsch halten würden. Wenn
wir beispielsweise im vorhinein nicht wissen, ob wir in der Lage des Opfers
oder der Geretteten sein werden, dann scheint es für uns besser zu sein, in einer
Welt zu leben, in der lieber mehr als weniger Menschen gerettet werden. Wenn
wir der keineswegs unvernünftigen Auffassung sind, dass die Sozialmoral der
Interessenwahrung der Betroffenen dient, dann scheint ein Moralsystem,
welches insgesamt die Interessen von mehr Menschen zu wahren vermag, besser
zu sein, als ein Moralsystem, welches zu einem geringeren Ausmaß der
Interessenwahrung führt. Mit dieser Betrachtung haben wir allerdings das Feld
der Kausalwirkungen einer Institutionalisierung einer bestimmten Ethik betreten.
Was das anbelangt, hat der Utilitarist einige gute Gegenargumente gegen den
auf seine Theorie des ethisch rechten geführten Angriff. Bevor wir diese
betrachten, ist es jedoch nützlich den dritten klassischen Gegeneinwand
anzuschauen.
Ein ganz ähnliches Argument wie das vorangehende kann nämlich auch im Falle
der sogenannten Überlebenslotterie für die zunächst wenig annehmbar
scheinende utilitaristische Lösung angeführt werden. Die Überlebenslotterie tritt
wie die meisten einschlägigen Beispiele in verschiedenen Varianten auf. Eine
der Varianten lässt sich wie folgt nacherzählen:
Ein Patient C ist zu einem Routine-Check up im Krankenhaus. Es stellt sich
heraus, dass er organisch völlig gesund ist und noch eine Lebenserwartung von
ca. 40 Jahren hat. Zur gleichen Zeit befinden sich die sterbenskranken Patienten
A und B im Krankenhaus. A kann nur überleben, wenn er ein Lebertransplantat
erhält und B, wenn er ein Herztransplantat bekommt. Es gibt keine andere
Möglichkeit, die beiden zu retten als dadurch, den Patienten C zu opfern. Opfert
man ihn, so werden die Patienten A und B, das sei angenommen, eine
Lebenserwartung von ca. 40 Jahren haben.
Wiederum scheint es klar zu sein, dass ein behandelnder Arzt einen guten
utilitaristischen Grund haben würde, den gesunden Herrn C zugunsten der
beiden Kranken zu opfern. Wie zuvor gilt im übrigen auch das Argument, dass
A, B und C in einer Situation, in der sie nicht wüssten, ob sie krank oder gesund
sein werden bzw. welche Rolle sie im späteren Leben einnehmen würden, einer
Regel, die zum Opfer der Interessen eines Einzelnen führt, zustimmen sollten.
Denn in einer Welt, in der in betreffenden Fällen Einzelne geopfert würden, um
Mehrere zu retten, wären die Überlebensaussichten jedes Einzelnen besser als in
einer Welt, in der entsprechende Opferregeln nicht existierten.
130
Man muss sich nach alledem davor hüten, bei den vorangehenden Beispielen zu
schnell auf die Unannehmbarkeit des Utilitarismus zu schließen. Denn die
Beispiele stehen für moralische Entscheidungen Einzelner in bestimmten
Situationen. Es geht darum, die jeweilige moralische Entscheidung im Einzelfall
zu betrachten. Der Utilitarist würde wie jeder andere vernünftige Mensch
zugeben, dass rechtliche Institutionen, die das Opfer Einzelner in derartigen
Fällen vorsehen, kaum rechtfertigungsfähig sein können.
Der vernünftige Utilitarist wäre wie jeder vernünftige andere Bürger
insbesondere der Auffassung, dass man sich davor hüten muss, Einzelnen so viel
Macht zu geben, dass sie über Leben und Tod beliebig entscheiden können. Die
Voraussetzung der Beispiele ist stets, dass der betreffende moralisch
Entscheidende in der Entscheidungssituation keine anderen Optionen besitzt,
dass er sich subjektiv vollkommen sicher ist und auch objektiv sein darf, dass
der Weltverlauf der unterstellte ist, dass er von dem Motiv beseelt ist, das
moralisch Rechte zu tun und nicht durch Missbrauch der eigenen
Entscheidungsgewalt Vorteile für sich oder die ihm nahe stehenden Individuen
herauszuholen usw.
Der vernünftige Utilitarist wird durchaus anerkennen, dass alle diese
Bedingungen typischerweise in der realen Welt praktisch niemals oder doch
zumindest niemals in eindeutiger Weise vorliegen. In der Regel sind die
moralischen Entscheidungsträger nicht nur von moralischen Ansprüchen beseelt
und versuchen nicht nur, nach der Logik einer idealen moralischen Theorie
vorzugehen, sondern haben alle möglichen Motive, unter denen das Motiv
moralischen Verhaltens nur eines bildet. Neben anderen Funktionen haben
rechtliche und moralische Institutionen gerade auch die, uns durch allgemeine
Regeln vor zu viel Vertrauen in unsere eigene moralische Urteilskompetenz im
Einzelfall zu schützen. Es geht nicht nur darum, dass wir lieber mit ruhigen
Nerven zum Routine-Check up gehen möchten, als stets befürchten zu müssen,
dass wir die Klinik nicht lebend verlassen. Es geht auch darum, dass wir als
Entscheidungsträger nicht jeweils von vielen Einzelentscheidungen überfordert
werden wollen. Die Bindung an allgemeine institutionelle Regelungen ist auch
utilitaristisch sinnvoll. Der Utilitarist kann die Notwendigkeit der Bindung
zugestehen wie jeder andere ethische Theoretiker und daher Institutionen
fordern, die strikte Regeln gegen das Opfer einzelner enthalten.
Im außer-institutionellen Bereich wird es hingegen bei eher utilitaristischen
Notfallprinzipien bleiben, wie wir sie ja auch tatsächlich in den
Notsandsparagraphen der entwickelten Rechtsordnungen finden. Der gute
131
Utilitarist wird sagen, dass institutionellen Verbote, Einzelne zu opfern, nicht
deshalb bestehen, weil es in sich falsch wäre, die Einzelnen zu opfern. Die
Moral oder auch die Rechtsordnung sollten institutionelle Regelungen enthalten,
die das Opfer Einzelner strikt verbieten, weil wir von uns selbst wissen, dass
unsere Einzelentscheidungen mit Erwartungs- und Motivationsunsicherheit
verbunden sind. Wir kennen nicht die Zukunft bzw. wir kennen sie nicht so
genau, wie es nötig wäre, um weitreichende Opferentscheidungen zu treffen
(Erwartungsunsicherheit) und wir können in der Regel nicht darauf vertrauen,
dass wir wirklich nur von „reinen“ moralischen Motiven in unserer
Entscheidung beseelt sein werden (Motivationsunsicherheit). Aus diesen, doch
auch nur aus diesen Gründen, sollten aus utilitaristischer Sicht unsere
moralischen und rechtlichen Institutionen strikte Regeln enthalten, die das Opfer
der Interessen Einzelner zugunsten der Interessen Mehrerer verbieten.
Der „clevere“ Utilitarist wird argumentieren, dass die Regeln aus den
vorangehenden Gründen und nicht deshalb installiert werden sollten, weil es in
sich richtig wäre, lieber viele als wenige zu opfern. Auf einer obersten
Moralebene werden die moralischen Institutionen ebenso wie die rechtlichen
Institutionen mit grundlegenderen Argumenten der Interessenwahrung
gerechtfertigt. Diese Argumente der Interessenwahrung rechtfertigen den
Vorrang für viele gegenüber wenigen. Der absolute Schutz des Einzelnen ist
demgegenüber immer nur eine abgeleitete institutionelle Regel. Während wir für
die fundamentale moralische Begründungsebene nur die Gemeinwohlwahrung
kennen, gibt es auf der nach gelagerten Ebene der Institutionalisierung eine
weiterreichende Bindung an institutionell-absolute normative Vorgaben.
Deshalb ist die Überlebenslotterie im Prinzip ein zwingendes Argument, ohne
auf der Ebene der konkreten institutionellen Regeln zu einer Aufweichung der
absoluten Verbote führen zu müssen. Der Utilitarist wir in diesem Dingen nicht
dem Wohlwollen eines noch so wohlwollenden Diktators vertrauen wollen. Die
institutionelle Einschränkung auf institutionell absolute Verbote ist aber etwas
ganz anderes als eine den institutionellen Fragen vorausgehende fundamentale
ethische Theorie.
Als reine ethische Theorie ist der Utilitarismus nicht offenkundig verfehlt. Die
vermutlich am besten entwickelten Varianten des Utilitarismus als oberster,
allen institutionellen Fragen vorausgehender Begründungstheorie, die auf John
Harsanyi zurückgehen, können von Anhängern des ethischen Universalismus
keineswegs ignoriert werden. Betrachten wir eine Skizze des Grundansatzes
von Harsanyi.
132
3.2. Entscheidungstheoretische Präzisierungen des Utilitarismus
3.2.1. Die Lotterie des Lebens
Folgt man Harsanyi, so muss man das Leben als eine Lotterie modellieren,
welche dem einen ein gutes, dem anderen ein schlechtes Los bescheren kann.
Die Qualität der Lose und die Verteilung der Lebenschancen wird wesentlich
von der Grundstruktur der Gesellschaft mitbestimmt. Diese Grundstruktur ist in
einer konstitutionellen Entscheidung wählbar. Die Sozialwissenschaft sagt uns,
wie wir die Grundstruktur beeinflussen können. Die Ethik sagt uns, welche
soziale Grundstruktur wir bevorzugen sollten – und Harsanyis Ethik vollzieht
dies auf utilitaristische Weise im Rahmen des folgenden Denkmodells.
Man stelle sich vor, dass von und für n Individuen i=1, 2, ..., n die
Grundordnung einer Gesellschaft zu wählen sei. Es gibt eine wohldefinierte
Menge verschiedener Grundordnungen G. Jedes gj ∈ G, j=1, 2, ..., r, hat jeweils
n gesellschaftlichen Positionen gj = {gj1, gj2, ..., gjn}. Der Ausdruck "gjk" steht
für die Position k in Gesellschaft j. Die Gesellschaften umfassen
Lebensperspektiven von der Putzfrau bis zum Generaldirektor, vom Gefängnisinsassen bis zum Präsidenten usw. – natürlich nur jene Positionen, die in der
betreffenden Gesellschaft existieren und für die Situation der Individuen in der
jeweiligen Gesellschaft ausschlaggebend sind.
Die Individuen sind über die Gesellschaften und die gesellschaftlichen
Positionen informiert. Doch kein Individuum weiß bei Abgabe seines
Moralurteiles über die Gesellschaften, welche Position es einmal einnehmen
wird, nachdem die Verfassung eingerichtet und damit die Gesellschaft gewählt
wurde. Der Akt der Wahl von Regeln vollzieht sich also „hinter dem Schleier
der Unkenntnis“ über die spätere Position. Er entspricht insoweit der Wahl einer
Lotterie mit unbestimmtem Ausgang. Damit setzt Harsanyi eine Idee von
William Vickrey – wie Harsanyi Nobelpreisträger in Wirtschaftswissenschaften
– um. Vickrey hatte bereits im Jahre 1948 ein Argument vorgeschlagen, das
später nicht nur von Harsanyi, sondern von vielen Sozialtheoretikern –
insbesondere von James M. Buchanan und John Rawls – benutzt werden sollte.
Harsanyi strebt an, ein intersubjektiv akzeptierbares, verallgemeinerbares
Werturteil über die Alternativen abzuleiten. Da er sich auf die Wertfragen als
solche beschränken möchte, schlägt er vor, zwei Annahmen zu machen. Zum
einen wird von ihm vorausgesetzt, dass die Individuen in ihren Urteilen sämtlich
133
von den gleichen empirischen Annahmen über zukünftige Weltverläufe unter
jedem gewählten Satz von Verfassungsregeln ausgehen. Was geschehen wird,
wenn man eher die eine als die andere Verfassung wählt, wird als einmütig
akzeptiert unterstellt. Zum anderen wird angenommen, dass alle Individuen
sämtlich zu einem unparteiischen Moralurteil kommen wollen, das die
Interessen jedes einzelnen gleich gewichtet. Das führt zu einer Gleichwahrscheinlichkeitsannahme, die für alle gleichermaßen expliziert, was
Unparteilichkeit in dem betrachteten Entscheidungskontext für sie überhaupt
heißt.
Bei Vickrey hieß es:
"If utility is defined as that quantity the mathematical expectation of which is
maximized by an individual making choices involving risk, then to maximize
the aggregate of such utility over the population is equivalent to choosing that
distribution of income which such an individual would select were he asked
which of various variants of the economy he would like to become a member of,
assuming that once he selects a given economy with a given distribution of
income he has an equal chance of landing in the shoes of each member of it.
Unreal as this hypothetical choice may be, it at least shows that there exists a
reasonable conceptual relation between the methods used to determine utility
and the uses proposed to be made of it." (Vickrey, W. (1948), 329)
3.2.2. Grobe Formalisierung der Lebenslotterie
Jede Gesellschaft gj ∈ G, j=1, 2, ..., r, kann unter den zuvor gemachten
Annahmen als eine Lotterie der Form
gj = {1/n, gj1; 1/n, gj2; ...; 1/n, gjn}
aufgefasst werden. Da r Gesellschaften zu betrachten sind, erhält man die
vollständige Liste aller Lotterien zu
g1 = {1/n, g11; 1/n, g12; ...; 1/n, g1n}
g2 = {1/n, g21; 1/n, g22; ...; 1/n, g2n}
.
…
.
…
gr = {1/n, gr1; 1/n, gr2; ...; 1/n, grn} .
134
Falls man unterstellt, dass der nicht-kontrollierbare Umwelteinfluss darin
besteht, eine bestimmte gesellschaftliche Position zugewiesen zu bekommen,
ergibt sich sogleich die folgende Darstellung des Entscheidungsproblems in
Tabellenform:
g1
g11
g12
...
...
g1n
g2
g21
g22
...
...
g2n
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
gr
gr1
gr2
...
...
grn
Tabelle 3
Die Gleichwahrscheinlichkeit jeder Position in jeder Gesellschaft für jedes
Individuum ist durch eine externe normative Bedingung für alle zu berücksichtigenden Positionen vorgegeben. Hat man es mit Entscheidern zu tun, die
Präferenzordnungen über den "Lotterie-Preisen" gji haben, die sich jeweils
(erwartungswerttreu) durch Nutzenfunktionen repräsentieren lassen, dann kann
man für jedes der Individuen i=1, 2, ..., n sofort eine entsprechenden Tabelle mit
Nutzenwerten
135
g1
ui(g11)
ui(g12)
...
...
ui(g1n)
g2
ui(g21)
ui(g22)
...
...
ui(g2r)
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
gr
ui(gr1)
ui(gr2)
...
...
ui(grn )
Tabelle 4
und den Erwartungsnutzen ui(gj) jeder Gesellschaft gj bilden. Diese
Erwartungsnutzenbildung entspricht etwa dem, was jemand tut, der den
Gelderwartungswert einer Lotterie ausrechnet, indem er die Preise mit den
Wahrscheinlichkeiten gewichtet. Also falls i unterstellt, mit seinen je eigenen
Präferenzen in jede der gesellschaftlichen Positionen jeder Gesellschaft mit
gleicher Wahrscheinlichkeit zu geraten, bildet et
ui(gj) = (1/n)* ui(gj1)) + (1/n)* ui(gj2)) + ... + (1/n)* ui(gjn)).
Nach dem bisherigen Argument wird der rationale Entscheider i jene
Gesellschaft gj individuell bevorzugen, die den höchsten Nutzenerwartungswert
bei Bewertung nach seinen eigenen Wertvorstellungen bietet. Falls mehrere
maximale Gesellschaften existieren, die alle den gleichen Nutzenerwartungswert
aufweisen, zeigt das eine Indifferenz des Entscheiders i an. Es ist gleichgültig,
welche von diesen Gesellschaften, die alle in seiner Präferenzordnung maximal
sind, gewählt wird. Es geht somit für den rationalen Entscheider bei der Wahl
von Regeln darum, eine Gesellschaftsform gj zu finden, die in seiner
Präferenzordnung ein maximales Element bildet und damit den maximalen
Nutzen bietet. Er verhält sich dann so, als ob er bei der Wahl von
gesellschaftlichen Grundregeln seinen Erwartungsnutzen in jeweiliger
Unkenntnis seiner späteren gesellschaftlichen Situation maximierte.
Harsanyi lässt es bei dieser Überlegung nicht bewenden. Es können ja immer
noch unterschiedliche i, j, i≠j, zu unterschiedlichen Maximierungsurteilen
136
kommen. Zwar ist jeder gleichermaßen um Unparteilichkeit bemüht, doch
gelangt nicht jeder zwangsläufig zum gleichen unparteiischen Urteil. Wirkliche
Unparteilichkeit verlangt nun nach Harsanyi, dass jeder für die Beurteilung der
jeweiligen gesellschaftlichen Position, in die er geraten könnte, genau die
Präferenzen zugrunde legt, die derjenige hätte, der in der Situation landen würde.
Nimmt man das an, so gelangt man nach gewissen formale Zusatzüberlegungen
zu dem für alle identischen vollständig unparteiischen Urteil darüber, welches
die beste Gesellschaft gj ist.
3.2.3. Unparteilichkeit und ihre Grenzen
3.2.3.1. Unparteiische Gemeinwohlförderung
Wir wollen, wie hier angenommen wurde, verallgemeinerungsfähige Urteile
abgeben und in unserem moralischen Diskurs geht es uns typischerweise um
solche Arten von Urteilen. Unparteilichkeit wird im übrigen nicht nur mit
Verallgemeinerung und dem Verallgemeinerungsanspruch der Urteile in
Verbindung gebracht, sondern auch mit einer distanzierten Haltung zum
Gegenstand der Beurteilung. Man ist unparteiisch, wenn man kein wirklich
eigenes Interesse in einer Sache hat. Ein Richter wird beispielsweise vor Gericht
als befangen abgelehnt, wenn er ein spezifisches Interesse an der zur
Entscheidung anstehenden Sache hat. Wir erwarten, dass gute Richter distanziert
sind. Sie wägen neutral die Pro- und Contraargumente der Parteien
gegeneinander ab. Die Parteien sind parteiisch, die Richter nicht.
Will man eine Entscheidung nun nach ethischen Maßstäben beurteilen, so
könnte man ein unparteiisches Urteil – entsprechend dem eines Mediators – zu
fällen versuchen. In diesem Urteil würde man gegeneinander abwägen, ob die
Gewinne der Gewinner die Verluste der Verlierer so stark und auf eine Weise
überwiegen, dass die "Politik" gerechtfertigt erscheint. Die utilitaristische
Vorgehensweise ist dann eine durchaus plausible Explikation dessen, was man
unter dem Gemeinwohl verstehen kann. Die Wahrung des allgemeinen Wohles
setzt danach voraus, dass man möglichst unparteiisch die Interessen von
jedermann gegeneinander abwägt und möglichst gut zu wahren sucht. Nach dem
vorgeschlagenen Modell versetzt man sich dazu fiktiv in Unkenntnis und wählt
hinter dem Schleier der Unkenntnis eine Alternative oder ein optimales Los.
137
3.2.3.2. Unparteilichkeit und Verhältnismäßigkeit
Es ist nach einer weit geteilten Intuition ethisch gefordert, immer dann
einzugreifen, wenn man durch ein kleines Opfer für einige einen sehr großen
Vorteil für andere realisieren kann. Umgekehrt wird argumentiert, dass selbst
beachtliche Vorteile einer Vielzahl von Individuen nicht rechtfertigen können,
einigen wenigen große Opfer zuzumuten.
Verhältnismäßigkeitsprinzipien setzen nicht notwendig darauf, dass man im
Schnitt genauso viel gewinnt wie verliert. Sie können allerdings im Sinne eines
generalisierten Versicherungsprinzips unter bestimmten Risikoannahmen stark
mit einem Prinzip durchschnittlich gleicher Gewinne und Verluste parallelisiert
werden. Das ist dann möglich, wenn man annimmt, dass jeder mit einer
geringen Wahrscheinlichkeit in die Gefahr geraten kann, einen großen Verlust
zu erleiden, der durch ein kleines Opfer eines anderen oder vieler anderer
kompensiert bzw. verhindert werden kann. Kleine Opfer und die Erhöhung der
Wahrscheinlichkeit dieser kleinen Opfer werden eingetauscht für die
Vermeidung massiver großer Verluste bzw. einer Reduktion der
Wahrscheinlichkeit für das Auftreten solcher Verluste.
Denkt man etwa an das deutsche Recht der unterlassenen Hilfeleistung, so sieht
man sogleich, dass derartige Intuitionen weit verbreitet und in unserer
Rechtsordnung mittlerweile fest verankert sind. Es wird dem Bürger auferlegt,
einem anderen Bürger, der ihm gänzlich fremd sein mag, zu helfen, wenn er mit
einem kleinen Opfer für sich selbst einen großen Verlust des anderen vermeiden
kann. Wir müssen nicht unser eigenes Leben riskieren, um einen anderen aus
Lebensgefahr zu retten, doch müssen wir unter Umständen in Kauf nehmen,
dass unser Eigentum verletzt wird oder dass wir ein paar unangenehme, relativ
harmlose Handgriffe auszuführen haben. Wir sagen, dass diese Handgriffe und
die Unannehmlichkeit zumutbar sind, weil sie zu einer starken Verbesserung
grundlegender Chancen anderer führen. Wer ein Kind retten kann, ohne sein
Leben zu riskieren, indem er in einen schmutzigen Teich steigt, dem ist das
zuzumuten.
Es scheint im ganzen so zu sein, dass an der Verallgemeinerungsfähigkeit
orientierte ethische Theorien letztlich darauf hinaus wollen, Parteilichkeit für
bestimmte Interessen als Ausdruck tiefer liegender verallgemeinerbarer
Interessen zu rechtfertigen. Die umgekehrte Strategie einer nicht weiter
begründeten Parteilichkeit für Unparteilichkeit wird weit weniger häufig ins
Auge gefasst. Sie ist jedoch keineswegs völlig von der Hand zu weisen. So kann
trivialer Weise jemand ohne weitere Begründung gleichsam „naiv“ parteilich
138
sein für Institutionen, die nach bestimmten Unparteilichkeitsnormen vorgehen.
Wer beispielsweise in einem westlichen Rechtsstaat aufgewachsen ist, der kann
durchaus aufgrund der Erfahrungen, die er in diesem Rechtsstaat gemacht hat,
parteiisch sein für diese Lebensform. Er hat möglicherweise eine starke
Präferenz für unabhängige Gerichte. Er hat möglicherweise auch eine starke
Präferenz für starke Bürgerrechte. Er kann darüber hinaus die in den politischen
Institutionen verankerten Normen interindividuellen Respektes internalisiert
haben. Diese Erfahrung und möglicherweise der Vergleich mit anderen
Lebensformen lässt ihn parteiisch sein für seine eigene Lebensform und die in
ihr verwirklichten Normen der Unparteilichkeit, ohne dass er diese Präferenz
selbst noch mit unparteiischen Urteilen begründet.
Man kann durchaus parteiisch für Unparteilichkeit etwa von Gerichten sein.
Man kann auch als Anhänger von Normen der Toleranz intolerant gegenüber
den Intoleranten sein. Man kann der Auffassung sein, dass die eigentliche
Toleranznorm die der Intoleranz gegenüber Intoleranten ist und nicht, das, was
man als „positive“ Toleranz bezeichnen könnte. Eine gewisse Parteilichkeit für
Werte, die in Politik umgesetzt werden wollen und dort letztlich politische und
rechtliche Unparteilichkeit beinhalten, ist moralisch möglicherweise nicht nur
erwünscht, sondern ein politisch höchst notwendiger Akt zur Unterstützung
bestimmter freiheitlicher Institutionen. Denn eine Ethik, die für Normen
interindividuellen Respekts Partei ergreift, ist möglicherweise darauf
angewiesen, dass man Parteilichkeit für diese Art von Werten zulässt und gerade
nicht auf verallgemeinerter Argumentation beharrt.
Wenn man diesen Schritt unternimmt, dann hat man das Feld einer
Ethikrechtfertigung, die fundamental von Allgemeinheitsansprüchen bestimmt
wird, verlassen. Denn man startet dann von einer ursprünglichen Parteilichkeit
für Unparteilichkeit und nicht von Verallgemeinerungsnormen. Konkret
bedeutet das, dass Anhänger westlicher sozialer und politischer Normen von
einer ursprünglichen Präferenz für diese Lebensweisen ausgehen, ohne
beanspruchen zu können, diese selbst noch sozialphilosophisch untermauern zu
können.
Es ist nicht klar, bis zu welchem Grade Ethiker bereit sein können, den
Verallgemeinerungsanspruch zugunsten einer solchen – kommunitaristischen –
Parteilichkeit für politische Unparteilichkeit oder grundsätzliche Rechte
aufzugeben, ohne das Feld der traditionellen Ethik zu verlassen. Die
sogenannten Gesellschaftsvertragstheoretiker versuchen typischerweise, nicht
einfach auf eine Parteilichkeit für die je eigenen Normen unparteiischer
139
Behandlung zurückzugreifen, sondern universelle Normrechtfertigungsansprüche für ihre Theorien aufrechtzuerhalten. Diese Bemühungen haben die
jüngere Sozialphilosophie geprägt. Das gilt vor allem auch für die Theorien von
Rawls
und
Habermas.
Diese
bilden
Konkurrenten
zum
Verallgemeinerungsdenken Harsanyis.
3.3. Rawlsscher Antiutilitarismus
3.3.1. Vor dem Wiederaufstieg der praktischen Philosophie
Die zuvor skizzierte im weiteren Sinne utilitaristische Konzeption von John
Harsanyi wird von John Rawls als vertragstheoretischer Utilitarismus
klassifiziert. Daran ist richtig, dass Harsanyi wie alle anderen sogenannten
Vertragstheoretiker das Konzept des Schleiers der Unwissenheit über die je
eigene Betroffenheit akzeptiert. Die moderne Sozialphilosophie wird in großen
Teilen von den Theorien des Gesellschaftsvertrages als direkten Gegenspielern
utilitaristischer Theorien bestimmt. Hier unterscheidet man zwischen den
sogenannten alten und den neuen Vertragstheoretikern. Die modernen oder
neuen Vertragstheoretiker sind zunächst einmal James M. Buchanan, Robert
Nozick, John Rawls. Für die Vielzahl anderer Theoretiker, die auch als
Anhänger der Gesellschaftsvertragslehre im weiteren Sinne anzusehen sind, sei
stellvertretend auf David Gauthier verwiesen. Mit einigem Recht könnte man
Jürgen Habermas ebenfalls zu den Vertragstheoretikern rechnen. Obschon er
dem Gedanken des Gesellschaftsvertrages grundsätzlich skeptisch gegenüber
steht, enthält seine Konzeption des idealen Konsenses wesentliche Elemente
einer "Zustimmungstheorie der Rechtfertigung" und damit ausschlaggebende
Aspekte der Gesellschaftsvertragstheorie. Zu den älteren neuzeitlichen
Vertragstheoretikern sind vor allem Thomas Hobbes, Immanuel Kant und John
Locke zu rechnen. Wiederum kann man mit Jean Jacques Rousseau für viele
andere stellvertretend einen weiteren Theoretiker des Gesellschaftsvertrages
hervorheben.
Der Wiederaufstieg der Gesellschaftsvertragslehre ist eigentlich rundherum
überraschend. Der Grund hierfür lag zunächst in der vernichtenden Kritik, der
man die Lehre vom Gesellschaftsvertrag unterzogen hatte. Ein anderer Grund
bestand darin, dass man gegenüber Ansprüchen auf rationale Begründbarkeit
moralischer Urteile extrem skeptisch geworden war. Das normativ ethische
Denken insgesamt schien aus Sicht der Philosophen in den fünfzig Jahren vom 1.
140
Weltkrieg bis etwa 1970 höchst problematisch zu sein und mehr mit Ideologie
als mit rationaler Begründung zu tun zu haben.
Für diese Sicht war zum einen die Auseinandersetzung um die rationale
Begründbarkeit moralischer Urteile in der Meta-Ethik (einer Theorie über die
Ethik), zum zweiten die Auseinandersetzungen um den Marxismus (sowie
verwandte Ideologien) und zum dritten die Beobachtung verantwortlich, dass die
unterschiedlichsten politischen Systeme Anspruch auf rationale philosophische
Begründung erhoben. Die verbrecherischsten Systeme taten dies ebenso wie
gemäßigte und akzeptable. Und alle fanden clevere Philosophen, die ihnen die
ideologische Begleitmusik auf häufig durchaus scharfsinnige Weise lieferten –
(auch Hitler und Stalin fanden ihre "philosophische" Entourage). Es schien, dass
letztlich wenig dafür sprach, dass sich in politischen Fragen ein Ausmaß
intersubjektiver Übereinstimmung erreichen ließ, das auch nur halbwegs mit
dem Ausmaß vereinbar war, in dem man über Sachthemen Einigkeit erzielen
konnte.
Für praktische Ziele zu kämpfen, das mochte sich aufgrund irgendwelcher
Ideale sehr wohl noch lohnen, die rationale Begründbarkeit dieser Ideale und
dieser Kämpfe schien jedoch ausgeschlossen. Ganz allgemein konnte man das
gleiche in der Ethik beobachten. Denn auch in der Ethik war der zuvor
selbstverständlich erhobene Anspruch auf umfassende rationale Begründbarkeit
in Zweifel geraten. Man traute sich nicht mehr, normative ethische Fragen, wie
die nach dem guten Leben mit rationalem Rechtfertigungsanspruch zu
behandeln. Man ging von der inhaltlichen normativ ethischen Fragestellung ab,
um sich Problemen der ethischen Sprache, der Moralpsychologie etc.
zuzuwenden. Wo in der Ethik der Übergang von der normativen und
inhaltlichen Ethik zur sogenannten Meta-Ethik erfolgte, da erfolgte analog der
Übergang von der politischen Theorie und Sozialphilosophie zur Analyse der
politischen Theorien. Konkret, man fragte nicht mehr, „wie sollen wir staatlich
oder nicht-staatlich miteinander leben?“, sondern, „wie reden wir darüber, wie
wir miteinander leben sollen und wie lassen sich, wenn überhaupt entsprechende
normative Urteile begründen?“ Das alles änderte sich mit dem Erscheinen von
John Rawls’ Buch „Eine Theorie der Gerechtigkeit“.
3.3.2. Die Situation bei Veröffentlichung der Rawlsschen Theorie
Die wesentlichen Elemente von Rawls Theorie waren in der Philosophie an sich
ohnehin bekannt. Durch Rawls selbst waren sie in einschlägigen Aufsätze schon
141
ca. 2 Jahrzehnte vor Erscheinen seines Hauptwerkes publiziert worden. Diese
Aufsätze hatten jedoch keineswegs die Aufmerksamkeit, die dem Buch
gewidmet wurde, gefunden. Da die Aufsätze überdies teilweise eher klarer und
überzeugender scheinen als das Buch, kann der Grund nicht darin gelegen haben,
dass die Aufsätze zu theoretisch und schwer verständlich waren, während erst
das Buch die Konzeption von Rawls in ihrer ganzen Breite und verständlicher
darlegte. Was also kann den Erfolg der Theorie erklären?
Die plausible Erklärung dafür, dass Rawls’ Buch „Eine Theorie der
Gerechtigkeit“ ein so überwältigender Erfolg beschieden war, liegt darin, dass
die Zeit für die Rawlssche Theorie erst „reif“ sein musste. Anders als etwa im
Falle von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, die weit eher aus sich heraus
aufgrund einer innerwissenschaftlichen Dynamik beachtlich sein können, bedarf
es für den Erfolg einer sozialphilosophischen Theorie externer Faktoren, zu
denen auch insbesondere ein geneigtes Publikum gehört. Die
Aufbruchstimmung der 60-er Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts half hier so
wie hundert Jahre früher die Zeichen eines industriellen Aufbruchs für den
Utilitarismus und fünfzig Jahre zuvor für den Sozialismus günstig standen. Zwar
wäre es verfehlt, Rawls einfach als den politischen Theoretiker der nichtmarxistischen (Alt-)68-er zu bezeichnen, doch wäre sein Erfolg ohne das
entsprechende politische Klima, welches ja nicht nur in der jüngeren Generation
zu einer Neubestimmung von Weltanschauungen führte, kaum denkbar gewesen.
In gewisser Weise ist Rawls’ „Theorie der Gerechtigkeit“ Bestandteil und
Ausdruck des kulturellen und ideologischen Aufbruchs.
Der 2. Weltkrieg lag in den 60-er Jahren so lange zurück, dass es nicht mehr
allein um dessen politische Ver- und Bearbeitung gehen musste, sondern an eine
zukunftsgewandte Neuorientierung gedacht werden konnte. Es gab Wirtschaftswachstum, es gab eine Zunahme des gesellschaftlichen Reichtums, es gab
"etwas zu verteilen". Die Frage, wie dies denn "gerecht" zu geschehen habe,
stellte sich jedenfalls für alle, die Verteilungsgerechtigkeit überhaupt als eine
Staatsaufgabe ansahen. Verteilungsgerechtigkeit wurde zudem auch deshalb zu
einem bedeutenden Thema, weil die Staatsquote in allen westlichen
entwickelten Industrienationen massiv gestiegen war. Dieses Anwachsen der
Staatsquote bedeutete auch, dass immer mehr Anteile des gesellschaftlichen
Wohlstandes de facto durch öffentliche Instanzen verteilt wurden. Indem man
immer größere Bereiche der Gesellschaft politisiert hatte, wurde auch die
Verteilungspolitik zunehmend bedeutsam. Verteilungsgerechtigkeit wurde
zwangsläufig zur Staatsaufgabe, weil man die Aufgaben des Staates so
ausgeweitet hatte, dass niemand ihm noch nachhaltig ausweichen konnte.
142
Die großen kollektiven Anstrengungen, die insbesondere der 2. Weltkrieg auch
für die liberalen Rechtsordnungen mit sich gebracht hatte, hatten gewiss dem
Gemeinschaftsdenken gegenüber dem bürgerlich-individualistischen Denken
Vorschub geleistet. Alle freien westlichen Staaten waren zu Wohlfahrtsstaaten
ausgeprägter Art geworden. Das galt sogar für die Vereinigten Staaten von
Amerika. Mögen diese auch aus europäischer Sicht immer noch gern als
"kapitalistischer wilder Westen" betrachtet werden, das Bestreben, Unterschiede
zwischen den Menschen durch Politik auszugleichen, war in den USA ebenso
wie in anderen Nationen spürbar. Man behandelte die Menschen nach
staatlichen Regeln zunehmend ungleich, um sie gleicher zu machen. Daraus
entstand ein zunehmendes Bedürfnis, das Konzept einer freiheitlichen und
zugleich sozial gerechten Ordnung und das für diese relevante
Gleichheitskonzept neu zu bestimmen.
3.3.3. Der Grundansatz von Rawls’ Gerechtigkeitstheorie
Rawls Theorie der Gerechtigkeit beansprucht eine Rechtfertigung für beides
zugleich zu sein: den liberalen Vorrang der individuellen Grundfreiheiten und
wohlfahrtsstaatliche fundamentale Umverteilung. Rawls tritt für den Primat
bürgerlicher Grundfreiheiten ein. Diese Grundfreiheiten sind für ihn anders als
für den klassischen Liberalismus nicht in natürlichen Rechten verankert, sondern
letztlich von der Gemeinschaft gewährte oder eingeräumte Privilegien. Jeder soll
die umfassendsten Freiheitsrechte, die – ganz kantisch – mit der gleichen
Freiheit aller anderen vereinbar sind, durch den Staat zuerkannt erhalten.
Letztlich ist es aber der Staat, der diese Rechte kreiert und durchsetzt.
Individuen haben diese Rechte nicht "vor" dem Staat. Sie bringen sie nicht mit
in den kollektiven Verbund des Staates ein. Das private Recht des einzelnen ist
letztlich ein öffentliches Recht, denn es sind der Staat bzw. die Allgemeinheit,
die das Recht durchsetzen. Auch die fundamentalen Bürgerrechte sind vom
Staat in Form der Rechtsordnung „produziert“.
Was für die negativen Abwehrrechte des klassischen Liberalismus gilt, gilt erst
recht für die sogenannten positiven Teilhaberechte, des modernen Sozialstaates.
Diese Rechte werden ebenfalls nicht aus einem vorgesellschaftlichen oder
vorstaatlichen Zustand in den vergesellschafteten staatlichen Zustand gleichsam
mitgebracht. Wenn der Staat verteilt, um Verteilungsgerechtigkeit zu erreichen,
dann geht es in der Regel nicht um Ansprüche, die den Menschen von Natur aus
zukämen, sondern es geht um Ansprüche, die erst durch die künstlichen
Mechanismen der gesellschaftlichen Zusammenarbeit entstehen.
143
3.3.3.1. Separatheit der Person als Kern der Vertragstheorie
Wer der Charakterisierung des Rawlsschen Ansatzes bis zu diesem Punkte
gefolgt ist und über keine vorherige Kenntnis des Rawlsschen Denkens verfügt,
der wird sich womöglich fragen, was denn das ganze mit der
Gesellschaftsvertragslehre und überhaupt dem Vertragsgedanken zu tun haben
kann. Diese Frage ist durchaus berechtigt. Denn die Bildung der Gesellschaft
durch freie vertragliche Zustimmung – etwa vergleichbar mit der Bildung eines
Vereins oder Klubs – spielt in Rawls Theorie keine Rolle. Insbesondere die Idee
einer aus Naturrechten abgeleiteten staatlichen Rechtsordnung, die gegenüber
vorherigen individualrechtlichen Positionen bloß derivativ ist, gehört zwar zur
klassischen Gesellschaftsvertragslehre, doch gewiss nicht in das Rawlssche
System. Es ist nicht überspitzt, im Falle von Rawls von einer
"Gesellschaftsvertragslehre ohne Vertrag" zu sprechen.
Eine Berührung mit klassischen vertragstheoretischen Überlegungen gibt es
dennoch. Denn auch im Rawlsschen Ansatz nimmt die theoretische
Rechtfertigung von individueller Autonomie und Zustimmung ihren Ausgang.
Rawls Theorie ist eine "Zustimmungstheorie der Rechtfertigung". Die Bildung
der Gesellschaft und des Staates werden zwar selbst nicht als Vertragsschluss
modelliert. Es wird aber die Rechtfertigungstheorie für die Gesellschaftsordnung
in einer Weise gebildet, für die das Element individuell-autonomer Zustimmung
konstitutiv ist.
Auf der Stufe der Rechtfertigung normativer theoretischer Urteile soll dem Ideal
des Respektes für Personen, das Rawls zu Recht für vertragstheoretisch hält,
Rechnung getragen werden. Auf dieser Stufe soll auch der entscheidende
Unterschied zum Utilitarismus angesiedelt sein. Wo der Utilitarist letztlich in
Verfolgung seiner eigenen Ideale neutraler unparteiischer Urteilsbildung das
Urteil des ethisch und moralisch Urteilenden gänzlich den individuellen
Einzelurteilen der je Betroffenen unterstellt, da besteht das repräsentative
Individuum von Rawls darauf, die "Separatheit der Person" auch gegen und
unabhängig von den Urteilen der vielen separaten Personen durchzuhalten und
zu respektieren.
Das Ideal der Separatheit der Person drückt sich für Rawls institutionell darin
aus, dass allen Individuen unverletzliche Grundfreiheiten oder Abwehrrechte
zuerkannt werden müssen. Mit Blick auf die Verteilung der Grundgüter der
Gesellschaft durch Teilhaberechte geht es um jedes Individuum gleichermaßen.
144
Dort, wo für den Utilitaristen die Annahme, dass man in jeder gesellschaftlich
möglichen Position mit der gleichen Wahrscheinlichkeit sein könne, den
natürlichen Ausdruck des Bemühens um Neutralität und Verallgemeinerbarkeit
bildet, da lehnt Rawls eine solche Quantifizierung des „Risikos“ ab. Er verlangt,
dass im Vergleich unterschiedlicher Gesellschaftsstrukturen jeweils
ausschließlich auf die Interessen der am schlechtesten gestellten Individuen
geachtet wird. Dies allein ist für ihn ein angemessener Ausdruck des Respektes
vor jedem der Individuen. Jede Person muss als Person geachtet werden. Auch
der schwächste und ärmste unserer Mitbürger (womöglich arm, unbegabt und
hässlich zugleich) verdient Anerkennung und Respekt seiner personalen
Interessen und das drückt sich darin aus, die Gesellschaft nach seinem
Wohlergehen zu beurteilen.15
Entscheidend für die Rawlssche Theorie ist es, dass der Moralbeurteiler eine
Person mit eigenen moralischen Vorstellungen ist, die ein Urteil vom
moralischen Standpunkt aus zu fällen wünscht. Die Rawlsschen Vorschläge, wie
man eine Theorie der Gerechtigkeit formulieren sollte, richten sich an einen
derartigen kompetenten Moralbeurteiler. Der Moralbeurteiler exerziert in der
Theorie durch, was – jedenfalls nach den Vorstellungen von Rawls – ein
rationaler kompetenter Moralbeurteiler tun sollte, wenn er die grundsätzlichsten
gesellschaftlichen Institutionen und den fundamentalen Staatsaufbau als ganzen
einer Beurteilung zu unterziehen wünscht. Die mögliche Willkür dieses
Verfahrens sucht Rawls durch ein sogenanntes "Entscheidungsverfahren für die
normative Ethik" einzuschränken.
3.3.3.2. Moralischer Standpunkt und moralisches Urteil kompetenter Moralbeurteiler bei
Rawls
So wie der Utilitarist seine Theorie nicht auf den einen Aspekt der
Verallgemeinerungsfähigkeit reduziert, so hat auch der moralische Standpunkt
des Rawlsschen Moralbeurteilers zusätzliche Eigenschaften. Der Rawlssche
Moralbeurteiler wünscht erstens Urteile zu fällen, die der Norm interpersonellen
Respektes Ausdruck verleihen. Denn sein moralischer Standpunkt ist davon
gekennzeichnet, dass er andere Individuen als separate Personen respektiert.
Zweitens bringt der Moralbeurteiler gewisse „inhaltliche“ Moralvorstellungen
15
Jedenfalls ist dies ein direkte normative Rechtfertigung der Rawlsschen Bevorzugung des sogenannten
Maximinprinzips, nach dem man das maximale Minimum mit der Wahl der Gesellschaftsform zu realisieren
sucht. Diese Art der Rechtfertigung ist im übrigen in jedem Falle einer Rechtfertigung vorzuziehen, die das
Maximinprinzip als Ausfluss der Rationalität in hoch riskanten Hoch-Kostensituationen sieht.
145
mit. Er ist mit gewissen Werten aufgewachsen und keineswegs vollkommen
geschichtslos. Als moralische Person ist der Rawlssche Moralbeurteiler drittens
– anders als der unparteiische Beobachter der utilitaristischen Theorie – von
seiner Theorie her nicht gezwungen, beliebige Präferenzen anderer Individuen
zu respektieren. Respekt meint Rawls, heiße nicht, dass man neutral akzeptieren
müsse, was die anderen wollen, gleichviel, was es denn sei. Und viertens gehen
in die Bildung des Urteiles auch externe Theorien ein, die die Urteilsbildung
systematisieren und gewisse zusätzliche Adäquatheitskriterien liefern.
Insbesondere die letzten beiden Aspekte nähren den Verdacht, dass das von
Rawls vorgeschlagene Verfahren entweder nur zu einer Zementierung je eigener
Vorurteile oder zur Zirkularität führen könne. Wenn man nämlich die
Präferenzen anderer Moralbeurteiler nach den eigenen bewerten darf, dann
scheint man die Voreingenommenheit für die je eigenen moralischen
Sichtweisen und Vorurteile methodologisch abzusegnen. Wenn man Theorien in
die Bildung der eigenen moralischen Sicht eingehen lässt, dann wird das
Ergebnis im Sinne der eingehenden Theorien vorgeprägt. Beide Einwände sind
zumindest prima facie nicht unberechtigt. Rawls glaubt jedoch gleichwohl, den
Einwänden begegnen zu können.
Andere zu respektieren, bedeutet für Rawls nicht, sich auf die Registrierung der
Wünsche der anderen ohne eigene Bewertung dieser Wünsche selbst zu
beschränken. Der Respekt vor der Separatheit von Personen schließt
insbesondere ein, dass Werte anderer, die dem inter-personellen Respekt direkt
zuwider laufen, vernachlässigt werden dürfen. Die Unparteilichkeit des
moralischen Standpunktes geht nicht soweit, dass sie ein Werturteil über die
Präferenzen anderer ausschlösse. Zugleich meint Rawls unter anderem, dass
man eine angemessene Moralkonzeption nur bilden könne, wenn man bereits
bestimmte Theorien darüber, was es überhaupt heißt, eine Person zu sein, in die
Theoriebildung eingehen lässt.
So wie das Konzept der Person selbst wesentlich von unserer Fähigkeit abhängt,
unsere eigenen Wünsche zu bewerten und beispielsweise auch den Wunsch
hegen zu können, andere Wünsche zu entwickeln, so kann der Rawlssche
Beurteiler auch Wünsche anderer einer Bewertung unterziehen. Die Gefahr, dass
bei einer solchen Vorgehensweise am Ende blanke Willkür herrscht, dass dem
vorgeblich neutralen kompetenten Moralbeurteiler einfach parteiisch die jeweils
subjektiven Präferenzen des Theoretikers untergeschoben werden, scheint
allerdings offenkundig. Rawls sucht dieser Gefahr dadurch zu begegnen, dass er
von einem lebenserfahrenen kompetenten Moralbeurteiler ausgeht, dem es um
146
eine unparteiische Urteilsbildung geht. Ein solcher Moralbeurteiler, meint Rawls,
kommt zwangsläufig zu einem Urteil über die Grundstruktur der Gesellschaft,
das einen Vorrang der Grundfreiheiten und eine Verteilung enthält, die den
schlechtest gestellten Bürger relativ am besten stellt (das ist letztlich der
Zusammenhang zu Rawls’ Entscheidungsverfahren für die normative Ethik, vgl.
oben 2.)
3.4. Entscheidungstheoretische Präzisierung der Rawlsschen
Verfassungswahl
Von Rawls wird angenommen, dass die Moralbeurteiler ihre Urteile über die
Verfassungsalternativen in Unkenntnis der eigenen Position in der Gesellschaft
und insoweit hinter dem von ihm so genannten Schleier des Nichtwissens bilden.
Jede Gesellschaft entspricht einem Los in der Lotterie des Lebens. Die
moralische Wahl entspricht einer Wahl zwischen Losen, bei der keiner weiß,
wie ihn das Los treffen wird oder welche Position er nachher einnehmen wird.
Die Annahme, dass Entscheidungen unter Unsicherheit über die eigene
Betroffenheit getroffen werden, bildet das Gegenstück zu der allgemeinen
moraltheoretischen Auffassung, dass moralische Urteile verallgemeinerungsfähig zu sein haben. Sie ist jedenfalls für denjenigen wohlbegründet,
der an einem auf Verallgemeinerungsfähigkeit abstellenden moralischen Diskurs
teilnehmen will. Für ihn ist diese Modellierung selbst ein Instrument kluger
Urteilsbildung, welches ihm das Auffinden entsprechender Urteile erleichtert.
Wenn rationale Individuen nicht sicher wüssten, ob sie in einer Gesellschaft
einmal Straßenkehrer oder Bankdirektor sein werden und wenn Straßenkehrer
die schlechteste gesellschaftliche Position ist, so würden sie nach Rawls allein
auf die Position des Straßenkehrers blicken. Allgemein konzentrieren sie sich
auf die schlechteste der gesellschaftlichen Positionen jeder der möglichen
Gesellschaften, die sie wählen könnten. Folgt man der ursprünglichen
Sichtweise von Rawls würden sie ihre Präferenzordnung unter verschiedenen
Gesellschaften gk,gj ∈G unter Vernachlässigung aller anderen Möglichkeiten
allein danach bilden, wie gut sie die schlechteste Position in der jeweils zur
Wahl stehenden Gesellschaft einschätzen: Sie würden die Gesellschaften nach
dem Kriterium beurteilen, welche das maximale Minimum bietet.
Nimmt man an, dass es insgesamt r verschiedene Gesellschaften gj ∈ G mit
jeweils n gesellschaftlichen Positionen gibt, die jeweils nach der absteigenden
147
Positionsnummer besser werden (niedriger nummerierte Positionen der gleichen
Gesellschaft sind besser als höher nummerierte), dann erhält man bei bewusster
Ausklammerung von Wahrscheinlichkeitsinformationen die "Lotterien"
g1 = { g11, g12, ..., g1n}, g2 = {g21, g22, ..., g2n}, ..., gr = {gr1, gr2, ..., grn}.
Hierbei ist etwa gr1 die beste Position der r-ten Gesellschaft und g22 die
zweitbeste Position der zweiten Gesellschaft etc. Unter den GesellschaftsLotterien wird eine Wertordnung einfach dadurch gebildet, dass die jeweiligen
n-ten Positionen (die "Minima" der jeweiligen gesellschaftlichen
Grundstrukturen) geordnet werden. Die Frage, ob gk besser als gj oder gj besser
als gk oder gk genauso gut wie gj gilt, reduziert sich auf die Frage, was für die
schlechteste Position gilt. Es fragt sich, ob aus Sicht des Beurteilers i
gkn Pi gjn oder gjn Pi gkn oder gjn Ii gkn gilt.
Dabei steht P für „wird strikt vorgezogen (präferiert)“ oder ist „besser als“ und I
für ist „ebenso gut wie“ oder wird „indifferent“ eingeschätzt. In der Tabelle
sieht das so aus, dass man nur auf die letzte Spalte zu blicken hat und sich unter
den Minima der Gesellschaften das maximale heraussucht.
g1
g11
g12
...
...
g1n
g2
g21
g22
...
...
g2n
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
gr
gr1
gr2
...
...
grn
Tabelle 5
Diese Problemreduktion erscheint – ungeachtet aller alltäglichen Risikoscheu,
die wir in fundamentalen Belangen an den Tag legen – alles andere als plausibel.
Warum sollte jemand nur auf die schlechteste Position einer Gesellschaft
blicken und alle anderen Informationen vernachlässigen? Der rationale
148
Entscheider sollte im Umgang mit Lotterien alle Informationen verwerten, über
die er verfügt. Es ist nicht einsichtig zu machen, warum auch kleinste Nachteile
der schlechtesten Positionen einer Gesellschaft nicht durch Vorzüge besserer
Positionen wettgemacht werden könnten. Bei Rawls wirkt sich eine
Besserstellung der Bessergestellten in einer Alternative g gegenüber g´ jedoch
nur dann auf die Präferenzordnung unter den Alternativen g, g´ aus, wenn alle
schlechtergestellten Individuen in beiden Gesellschaften gleich gut gestellt sind.
Wäre nämlich unter den schlechteren Positionen eine Ungleichheit der
Positionen vorhanden, etwa gik besser als g´ik, so müsste wegen der vorrangigen
Bewertung der Gesellschaften nach dem Wohlergehen der schlechter gestellten
Individuen g besser als g´ bewertet werden.
Die schlechteren Positionen machen ihren Einfluss auf die Einordnung
vorrangig geltend. So, wie bei der alphabetischen Ordnung von Wörtern die
vorderen Positionen der Buchstabenfolge zuerst Beachtung finden, gehen hier
die hinteren oder schlechteren gesellschaftlichen Positionen voran. Rawls nimmt
eine lexikographische Vorordnung der schlechteren gesellschaftlichen
Positionen vor.
Rawls hat sein Grundmodell in verschiedener Weise zu verteidigen versucht.
Mit einer gewissen Plausibilität kann man tatsächlich darauf verweisen, dass
sich der Respekt vor dem einzelnen Individuum im Vorrang der Grundfreiheiten
und darin ausdrücken sollte, dass man gerade auf die am schlechtesten gestellten
Individuen schaut. Es führt jedoch kein Weg an der Einsicht vorbei, dass die von
Rawls in seinem ursprünglichen Ansatz zugrunde gelegte Entscheidungstheorie
eher simplistisch anmutet. Das kann man von der zuvor skizzierten Theorie John
Harsanyis nicht behaupten, obwohl sie am Ende zu recht ähnlichen
Konsequenzen führt. Rawls würde allerdings darauf bestanden, dass seine
Theorie gerade einige der schwerwiegendsten Einwände gegen den Utilitarismus
vermeidet. Das ist jedoch dann, wenn man sein eigenes Modell ernst nimmt
keineswegs der Fall. Ein Beispiel mag ausreichen, um diesen Punkt zu
illustrieren.
3.5. Grenzen der Vertragstheorie
3.5.1. Die Gefährdung des interpersonellen Respektes durch die
Vertragstheorie
Wenn man einem gesunden Individuum mit zwei vollständig gesunden Nieren
eine der Nieren entfernt, dann beinhaltet das für dieses Individuum ein ziemlich
149
geringes zusätzliches Risiko. Die Gesundheitsgefährdung, die von dieser
medizinischen Maßnahme ausgeht, entspricht nach seriösen Schätzungen in
etwa der Gefährdung, die wir während unseres Arbeitslebens mit einer täglichen
Berufsfahrt zur Überwindung einer Distanz von 50 Kilometern auf uns nehmen.
Die zusätzliche Gefährdung ist gewiss nicht höher als die Gefährdung, die sich
durch Ergreifung eines gefährlicheren Berufes ergibt. Da das Leben mit einer
Niere im übrigen praktisch von gleicher Qualität für den Gesunden ist wie das
Leben mit zwei Nieren, so scheint das geringe Zusatzrisiko durch die
Ausstattung mit nur einer Niere nicht allzu bedeutsam. Das Leben ohne Nieren
als Dialysepatient ist hingegen von bedeutsamen Einschränkungen der
Lebensqualität und auch der potentiellen Lebensdauer geprägt. Dialysepatient zu
sein, ist ein schweres Los.
Hinter dem Schleier der Unwissenheit über das spätere Gesundheitsschicksal,
sollte jedermann angesichts dieser Ausgangslage es bevorzugen, wenn nicht nur
die Leichenspende von Nieren als obligatorisch angesehen, sondern sogar die
Lebendspende von Nieren im Falle des Nichtvorhandenseins von
Leichenorganen zur Pflicht gemacht würde. Jedes rationale Wesen sollte hinter
dem Schleier der Ungewissheit über das eigene Gesundheitsschicksal eine
entsprechende Regelung akzeptieren. Es scheint auch nicht völlig
ausgeschlossen zu sein, dass entsprechende Regelungen in Gesellschaften
durchgesetzt würden.
Für die obligatorische Leichenspende dürfte insbesondere auch in einem
Rechtsumfeld wie dem deutschen sehr viel sprechen (vgl. Hoerster, N. (1997)).
Denn wir kennen ein relativ ausgebautes System von Hilfspflichten und Strafen
für den Fall des Unterlassens der Hilfsleistungen. Damit erzwingen wir mit
strafbewehrten Regeln positives Handeln. Hilfeleistungen werden als zumutbar
und deren Unterlassung als strafbar – jedenfalls unter bestimmten Umständen –
angesehen. Unsere Gesellschaft kann damit recht problemlos zurechtkommen,
selbst wenn die betreffenden Regelungen, die im wesentlichen von den
Nationalsozialisten eingeführt wurden, manchmal weit zugunsten anderer in das
individuelle Leben eingreifen.
Ein Argument für derartige Regelungen scheint zu sein, dass ihnen hinter dem
Schleier der Unwissenheit über die eigene Betroffenheit, nahezu jedermann
zustimmen würde und sie im späteren Leben keine unzumutbaren Belastungen
für die Hilfeleistenden mit sich bringen. Die Spende einer Leichenniere
erscheint abgesehen von einigen weltanschaulichen Verzerrungen, die sich aus
bestimmten religiösen Auffassungen ergeben können, als relativ unbedeutend.
150
Man könnte daher recht gut argumentieren, dass jedermann einer solchen
Regelung rationalerweise zustimmen würde oder doch sollte. Die Tatsache, dass
einige Bürger aufgrund metaphysischer Überzeugungen meinen könnten, dass
eine Spende von Leichenorganen ihnen nicht zugemutet werden dürfe, bildet für
die libertären Versionen der Vertragstheorie allerdings ein Problem. Denn der
Respekt vor den weltanschaulichen Überzeugungen anderer scheint es nahe
zulegen, durchaus auch Auffassungen zu respektieren, die nicht auf rationale
Überzeugungen zurückgehen.
Genau hier wird der libertäre Vertragstheoretiker vielleicht im Gegensatz zum
politischen Libertären, der einfach für freiheitliche Institutionen eintritt,
argumentieren, dass die Fiktion eines vertraglichen Konsenses hilfreich ist. Er
wird sagen, dass die Institution einer Zwangsspende von Leichennieren so sehr
im Interesse aller liegt, dass ein Vertrag diesen Inhaltes unter rationalen
Individuen einmütig geschlossen würde (vgl. Kliemt, H. (1994)). Und
tatsächlich würden rationale Individuen einen solchen Vertrag schließen; wobei
allerdings der Grund für diese Voraussage einfach in der Gleichartigkeit der
Interessen liegt und man den Vertrag als solchen gar nicht zu bemühen braucht.
Wie Hume bereits wusste (Hume, D. (1777/1985), "Of the original contract",
deutsch Hume, D. (1976)), ist der Vertragsgedanke dann überflüssig bzw. leistet
wenig, wenn der einzige Grund für die Annahme, eine Zustimmung liege vor,
darauf zurückgeht, dass man ein gleich gelagertes Interesse aller diagnostiziert.
Aber das gleich gelagerte Interesse liegt tatsächlich vor. Warum also nicht eine
Spendenpflicht für Leichenspender annehmen? Über die Möglichkeit einer
Zwangsverpflichtung zur Blutspende im deutschen Recht ist ebenfalls mit guten
Gründen gestritten worden. Ein entsprechendes Ansinnen scheint im deutschen
Rechtsrahmen keineswegs von vornherein absurd. Die Leichenspende einer
Niere könnte man daher ebenfalls verpflichtend machen wollen (vgl. zur
Zumutbarkeit der Hilfeleistung Frellesen, P. (1980)).
Es scheint allerdings, dass man mit dem vorangehenden Argument auch die
Spende einer Niere durch einen Lebendspender als Hilfspflicht begründen
könnte. Die Lebendspende einer Niere ist zwar ungleich bedeutsamer als etwa
die bloße zwangsweise Blutspende durch einen Lebenden, doch bewegt sie sich
immer noch in einem Bereich, in dem keine dramatischen Einbussen an
Lebensqualität zu erwarten wären. Würden wir nicht dennoch sagen, es sei
absurd, eine solche Verpflichtung zu unterstellen?
In jedem Falle ist klar, dass hinter dem Schleier der Unkenntnis über die eigene
Betroffenheit der Erlass von Regeln, die eine Verpflichtung zur zwangsweisen
151
Hergabe einer Niere im Gegenzug für ein entsprechendes Hilfsversprechen
durch andere vorsehen, interessegemäß für jeden wären. Damit entsteht das
Problem, warum solche Regeln nicht in einer Zustimmungstheorie der
Rechtfertigung als legitimiert angesehen werden sollten. Sie liegen im Interesse
von praktisch jedermann und greifen – anders als das Opfer des eigenen Lebens
– nicht in einer Weise in unser Leben ein, die emotional von den Betroffenen
nicht bewältigt werden könnte. Es scheint daher so, dass ein Anhänger des
Gedankens vom fiktiven Gesellschaftsvertrag entsprechende Vorgehensweisen
für moralisch gerechtfertigt halten muss. Darüber hinaus sollte er es für legitim
halten, die betreffenden Institutionen in der Gesellschaft einführen zu wollen.
Wenn wir Anhänger der Gesellschaftsvertragslehre sind, wird uns ein moralisch
überzeugender Grund geboten, uns die Einführung der Institutionen
zwangsweiser Lebendspende zu wünschen. Viel mehr kann Moraltheorie nicht
leisten. Sie kann unseren Legitimitätsglauben und unsere Neigung, Dinge
moralisch zu befürworten bzw. zu kritisieren, anleiten. Wenn wir moralische
Vertragstheoretiker sind, dann führt uns unsere Moraltheorie dementsprechend
dazu, Institutionen, die Zwangsentnahme von Nieren bei Leichen- oder auch
Lebendspendern, zu befürworten. Im Rawlsschen Modell, das die schlechtest
gestellten Individuen vornehmlich betrachtet, sollte das erst Recht der Fall sein.
3.5.2. Systematisch irreführende vertragliche Gerechtigkeitstheorie
3.5.2.1. Scheinfreiwilligkeit
Aus dem vorangehenden kann man entweder den Schluss ziehen, dass wir uns
an eine entsprechende Reform gesellschaftlicher Institutionen oder dass wir uns
an eine Reform der vorherrschenden moraltheoretischen Auffassungen
heranwagen sollten. Im ersten Fall würden wir zu recht radikalen
Umgestaltungen realer Institutionen schreiten müssen. Es müsste zugelassen
werden, dass im Falle der Lebensgefährdung reale Verträge zur Lebensrettung
durch Risikoteilung akzeptiert werden. Es müssten u.a. bestimmte Akte, die
heute als "Tötung auf Verlangen" klassifiziert werden, aus diesem
Straftatbestand herausgenommen werden. Überdies müsste in den Fällen, in
denen die Verhältnismäßigkeit des Eingriffes in persönliche Rechte wegen der
relativen Geringfügigkeit des Opfers im Vergleich zum Gewinn als gegeben
erscheint, eine Institution der zwangsweisen Lebendspende von Nieren (und vor
allem auch Knochenmark) eingerichtet werden. Zumindest würde sich aus der
Vertragstheorie dafür ein Argument ergeben.
152
Wer meint, dass fiktive Zustimmung fiktiver Individuen reales Gewicht für die
Rechtfertigung
realer
Institutionen
und
zur
Rechtfertigung
der
Zwangsanwendung gegen reale Individuen haben kann, der muss die voran
gehenden Konsequenzen ziehen. Er rechtfertigt realen Zwang mit fiktiver
Zustimmung. Die Lehre vom Gesellschaftsvertrag legt bei Einbettung in eine
universalistische Ethik diese intuitiv ziemlich inakzeptable gesellschaftliche
Zwangsanwendung nachdrücklich nahe, da rationale Individuen hinter dem
Schleier des Unwissens über die eigene Betroffenheit entsprechende Verträge
schließen würden.
Wenn jemand demgegenüber den Vertragsgedanken nur als Heuristik
verstanden wissen will, die uns zeigt, dass bestimmte Institutionen bestimmte
moralisch erwünschte Eigenschaften haben können, dann bleibt immer noch die
aus Sicht jedes Anhängers realer Freiheit überaus unangenehme Tatsache, dass
die vertragstheoretische Einbettung von Institutionen fundamentaler
Zwangsanwendung in eine fiktive freiwillige Zustimmung eine gefährliche
Irreführung beinhaltet. Denn das, was gerade nicht auf reale vorauf gehende
Zustimmung der Betroffenen zurückgeht, wird verharmlost als etwas, das
möglicher oder vorstellbarer Weise durch Vertrag und Zustimmung zustande
gekommen sein könnte. Die Anwendung fundamentaler Zwangsgewalt in der
Gesellschaft wird damit durch die vertragstheoretische Fehlbeschreibung zum
Ausfluss fiktiver freiwilliger Zustimmungsakte geadelt und damit letztlich
entproblematisiert.
Was in der universalistischen Ethik vorgeblich dazu dient, die Notwendigkeit
einer Zustimmung jedes einzelnen und den Respekt vor seiner individuellen
Autonomie auszudrücken, wird latent subversiv für die praktische Sensibilität
gegenüber den höchst realen Eingriffen in die individuelle Autonomie aufgrund
hoher ethischer Ideale. Da das so ist, sollte man sich fragen, ob nicht der
Universalismus der Ethik als solcher das eigentliche Problem der normativen
Sozialphilosophie darstellt. Vielleicht muss man nicht nur den Utilitarismus und
die Gesellschaftsvertragslehre, sondern am Ende den gesamten ethischen
Universalismus los werden. In einem entsprechenden Reformprojekt der Ethik
müsste der meta-ethische Partikularismus auf den Schild gehoben und für
bescheidene Ansprüche hinsichtlich der Begründungsfähigkeit von Normen und
Institutionen plädiert werden. Die meisten Ethiker werden sagen, dass ihnen das
zuwenig ist. Sie wollen eine universalistische Gerechtigkeitslehre formulieren,
um mit gutem Gewissen fundamentale Zwangsgewalt anwenden zu können.
Damit versuchen sie als Gerechtigkeitsproblem zu verkaufen, was mit
Gerechtigkeit wenig zu tun hat.
153
3.5.2.2. Wo "Gerechtigkeit drauf steht", ist nicht immer "Gerechtigkeit drin"
Nehmen wir einmal an, ich hätte 100 Euro übrig. Ich könnte die Summe Geldes
dazu verwenden, meine Tochter ins Kino und anschließend in ein Restaurant zu
führen. Da ich meine Tochter noch nie ins Kino ausgeführt habe, wird sie einen
derartigen Akt von meiner Seite nicht erwarten. Wenn ich sie nicht ausführe,
dann kann ich also keine Erwartungen enttäuschen und sie insofern auch
keineswegs ungerecht behandeln. Da ich auch niemanden sonst – nicht einmal
mich selbst – in den letzten 20 Jahren ins Kino geführt habe, kann insoweit auch
keine Frage angemessener Ungleichbehandlung entstehen. Mir scheint, im
großen und ganzen wird niemand in einem Fall wie der Einladung zum
Kinobesuch auf die Idee verfallen, Fragen der Gerechtigkeit berührt zu sehen.
Nehmen wir nun an, ich würde überlegen, ob ich die 100 Euro vielleicht an eine
mildtätige Organisation wie etwa die Welthungerhilfe spenden sollte. Setzen wir
voraus, dass die Organisation, die ich ins Auge fasse, effizient wirtschaftet und
die Hälfte der 100 Euro tatsächlich in Form angekaufter Nahrungsmittel in
einem Drittweltland wirksam zur Bekämpfung der Not hungernder Kinder
einsetzt. Es sei ebenfalls vorausgesetzt, dass die Hilfsorganisation Hilfe im
wesentlichen für vorübergehende Notfälle leistet und in einer Form, die die
Anreize zur Selbsthilfe und zur Ausweitung der Agrarproduktion in den
betroffenen Ländern nicht reduziert.
Denkt man an die wirklich empörenden Bilder hungernder Kinder in
Drittweltländern, dann wird man den moralischen Wert einer derartigen Spende
nicht von der Hand weisen können. Es wird im Gegenteil eine universelle
Zustimmung finden, wenn man ein derartiges Hilfsverhalten für moralisch
lobens- und wünschenswert hält. Insoweit müssen wir ohne Frage davon
ausgehen, dass moralische Fragen mit dem Problem der Hungerhilfe
angesprochen sind. Da wir jeden Euro nur einmal ausgeben können, wirft damit
die Frage der Verwendung von 100 Euro, um den Kinobesuch mit
anschließendem Essen für meine Tochter und mich zu finanzieren, indirekt
moralische Fragen auf.
Benutzt man den Begriff des Schattenpreises für die nächst beste Verwendung
von Ressourcen, so kann man feststellen, dass der moralische Schattenpreis der
Verwendung von 100 Euro zur Finanzierung eines Kinobesuches und
anschließendem Essen mit meiner Tochter in dem nicht realisierten moralischen
Gewinn der Hilfe für die hungernden Kinder besteht. Da das Konzept des
154
Schattenpreises voraussetzt, dass man jeweils die beste nicht realisierte
Alternative betrachtet, sei hier vorausgesetzt, dass die Hilfe für die Hungernden
in der Dritten Welt tatsächlich die moralisch höchststehende Alternative darstellt.
Unter dieser Voraussetzung ist tatsächlich der moralische Schattenpreis der
Verwendung der 100 Euro für den Kinobesuch mit anschließendem Essen in
dem entgangenen moralischen Wert der Hilfe für die Dritte Welt zu sehen.
Nehmen wir nun einmal an, dass wir tatsächlich die 100 Euro spenden und
damit hungernden Kindern in der Dritten Welt helfen. In diesem Falle gibt es
ebenfalls einen moralischen Schattenpreis.16 Der moralische Schattenpreis der
Verwendung der Ressourcen für die Welthungerhilfe besteht darin, dass man
den Geldbetrag nicht mehr für die nächst beste moralische Alternative ausgeben
kann. Vor allem in einer Welt knapper Ressourcen, wo die Ressourcen zur
Verfolgung moralischer Projekte knapp sind, ist es unausweichlich so, dass
moralische Schattenpreise auftreten und moralisch wünschenswerte Projekte
miteinander konkurrieren. Darüber hinaus konkurrieren die Projekte
möglicherweise mit solchen, die als moralisch neutral anzusehen sind.
Was nun die Verfolgung alternativer Projekt anbelangt, muss man in einer Welt
knapper Ressourcen angesichts der bestehenden Budgetrestriktionen
Entscheidungen treffen. Man muss sich dafür entscheiden, ob man ins Kino
gehen soll, oder das Geld lieber für ein philanthropisches Projekt stiften möchte.
Man muss überdies darüber entscheiden, welches philanthropisches Projekt man
auswählen will. Es entstehen eine Vielzahl von durchaus schwierigen
moralischen Fragen durch diesen Zwang zu Alternativentscheidungen. Zugleich
wird man nicht voraussetzen dürfen, dass jedermann jederzeit umfängliche
Überlegungen zu Alternativen mit moralischer Relevanz anstellen wird. Eine
solche Annahme wäre sicherlich rundweg absurd. Dennoch werden alle
Menschen manchmal derartige Überlegungen anstellen. In solchen Fällen
werden sie nach Kriterien fragen, die ihnen bei einer moralisch verantwortlichen
Entscheidungsfindung helfen können.
Was das anbelangt, haben Philosophen wie insbesondere Rawls den Eindruck
erweckt, als sei nahezu jede moralische Frage, die die Ressourcenverteilung in
irgendeiner Weise beeinflusst, eine Frage der Gerechtigkeit bzw. der
Verteilungsgerechtigkeit. Das ist aber verfehlt. Selbstverständlich ist es
moralisch zwar wünschenswert, den Hungernden in der Dritten Welt zu helfen.
Es ist jedoch nahezu ebenso selbstverständlich, dass es sich in dieser Frage
kaum um eine Frage der Gerechtigkeit handeln kann. Wenn ich nicht die
16
Natürlich gibt es auch einen nicht-moralischen Schattenpreis, doch sei das hier dahin gestellt.
155
geringste soziale Beziehung mit den Kindern in der Dritten Welt besitze, wenn
ich keinerlei direkte Einflussnahme auf sie ausgeübt habe, wenn ich sie nicht
kenne, sondern nur von ihrem Leid als dem Leid anonymer Individuen weiß,
wie kann ich dann ungerecht handeln, wenn ich ihnen nicht helfe? Wenn die
Kinder über die Tatsache hinaus, dass ihnen meine Geldspende helfen würde,
keinerlei Anspruch auf meine Hilfe erheben dürfen, dann scheint es doch sehr
weit hergeholt, zu behaupten, die Gerechtigkeit verlange es, ihnen zu helfen.
Natürlich ist es wünschenswert, dass hungernden Kindern geholfen wird. Das
gilt jedenfalls nach praktisch jeder plausiblen Moraltheorie. Es ist moralisch
lobenswert, hungernden Kindern zu helfen, wenn dadurch nicht irgendwelche
Pflichten verletzt werden. Es ist möglicherweise sogar moralisch falsch, wenn
man ihnen nicht hilft, da die Unterlassung der Hilfeleistung eine Verletzung von
Forderungen der Moral bilden kann. Die Unterlassung der Hilfeleistung
gegenüber völlig unbekannten anonymen Individuen in der Dritten Welt als
einen Akt der Ungerechtigkeit zu bezeichnen, erscheint jedoch als absurd.
Ungerechtigkeit ist etwas anderes als moralische Unrichtigkeit. Etwas kann
unrichtig im Sinne einer moralischen Theorie sein, ohne deshalb ungerecht zu
sein. Handlungen können moralisch lobens- oder tadelnswert sein, ohne gerecht
oder ungerecht zu sein.
Selbst dann, wenn man angesichts der zuvor angesprochenen Fragen
moralischer Opportunitätskosten davon ausgeht, dass nahezu alle
Ressourcenallokation in der Gesellschaft indirekt moralische Probleme
aufwerfen wird, weil man die zur Verfügung stehenden Ressourcen eben jeweils
nur einmal nutzen kann, wird man doch von der These Abstand nehmen müssen,
dass es sich bei allen diesen Fragen um Fragen der Gerechtigkeit handelt. Weder
behandle ich meine Tochter gerecht oder ungerecht, wenn ich sie in dem zuvor
beschriebenen Fall nicht ins Kino führe, noch behandle ich die Hungernden in
der Dritten Welt gerecht oder ungerecht, wenn ich für die Hungernden nicht
spenden sollte. Das gleiche gilt für die umgekehrten Handlungen der Spende
bzw. des Kinobesuchs. Alle diese Fragen sind einfach keine Fragen der
Gerechtigkeit.
Dafür, dass es sich nicht um Fragen der Gerechtigkeit handelt, scheint
ausschlaggebend, dass eine spezifische Anspruchsgrundlage kontingenter Art
fehlt. Wo immer diese kontingente Anspruchsgrundlage herrühren mag, aus
einem Brauch, aus Verwandtschaftsbeziehungen etc., Theorien der
Gerechtigkeit können diese Anspruchsgrundlage selber jedenfalls nicht liefern.
Im engeren Sinne gerecht oder ungerecht wird etwas nicht allein dadurch, dass
156
irgendeine Theorie es als gerecht oder ungerecht bezeichnet. Dazu ist mehr
erforderlich.
Wenn zwei Leute ein gemeinsames Projekt verabreden, dann werden daraus
typischerweise Erträge und Lasten resultieren. Soweit die beiden eine
Aufteilung der Lasten und Erträge explizit vereinbart haben, verlangt jede
plausible Moraltheorie ebenso wie jede brauchbare Alltagsmoral, dass die
betreffenden Vereinbarungen grundsätzlich einzuhalten sind. Sofern es keine
expliziten
Verteilungsverabredungen
gibt,
können
gleichwohl
Gerechtigkeitsprobleme auftreten. Die beiden Individuen arbeiten eng
zusammen und verfolgen ein gemeinsames Projekt. Sie tun dies unter
bestimmten Erwartungen darüber, wie sich das Projekt entwickeln wird und
welche Erträge und Lasten daraus hervorgehen werden. De facto wird es so sein,
dass sie die in ihrer jeweiligen Bezugsgruppe bzw. Gesellschaft vorherrschenden
Gerechtigkeitsvorstellungen
bezüglich der Güter und Lasten aus der
Zusammenarbeit als gegeben unterstellen.
Ob diese unterstellten Gerechtigkeitsvorstellungen nach Maßgabe irgendeiner
Theorie der Gerechtigkeit als „gerecht“ im theoretischen Sinne angesehen
werden oder nicht, ist eine Sache, eine andere, bedeutendere, ist es, dass diese
Vorstellungen de facto vorhanden sind. Wenn die beiden Akteure de facto
bestimmte Vorstellungen mit in die Zusammenarbeit bringen und wenn sie
beispielsweise zu der Zeit, als sie die Zusammenarbeit eingingen, voneinander
wussten bzw. voneinander annehmen mussten, dass sie die betreffenden
Vorstellungen haben würden, dann begründen diese Vorstellungen Erwartungen,
die gerechtigkeitsrelevant sind. Das gilt ganz unabhängig von der Frage, ob die
betreffenden Vorstellungen der Kritik Stand halten und einer bestimmten
Theorie der Gerechtigkeit genügen können. Das Entscheidende ist, dass diese
Vorstellungen de facto vorhanden sind, nicht, dass sie gerecht oder ungerecht
genannt werden von irgendeiner Theorie der Gerechtigkeit.
Die Besetzung solcher Begriffe wie des Begriffes der Gerechtigkeit ist
keineswegs politisch unbedeutsam. Auf der anderen Seite geht es in der
Diskussion von Theorien der Gerechtigkeit letztlich nicht darum, einen
Monopolanspruch auf eine bestimmte Verwendung des Gerechtigkeitsbegriffes
anzumelden. Weit bedeutender ist es, bestimmte Phänomene, die sich durchaus
begrifflich trennen lassen, auch tatsächlich zu trennen. Es ist etwas anderes, ob
etwas nur nach einer Theorie der Gerechtigkeit als ungerecht oder gerecht
bezeichnet wird, oder ob etwas darüber hinaus etablierten Sichtweisen von dem,
was gerecht sei, entspricht bzw. widerspricht. Etablierte Sichtweisen, deren
157
Etabliertheit allgemein bekannt ist, geben zu bestimmten Erwartungen Anlass.
Diese Erwartungen bzw. das, was erwartet werden darf oder soll, sind letztlich
ausschlaggebend und nicht irgendwelche philosophischen Theorien der
Gerechtigkeit.
4. Habermas, Kant und der Diskurs
Habermas setzt dem Konzept der strategischen Rationalität das eines
verständigungsorientierten Rationalverhaltens entgegen. Zutreffend begreift
er strategische Rationalität als "Zweck-Mittel-Rationalität". Diese Art der
Rationalität ist für ihn aber nur eine „halbierte“ Vernunft, weil sie zwar gewisse,
nicht jedoch „tiefere“ (etwa emanzipatorische) Interessen des Menschen fördert.
Die Ausrichtung auf gegebene Zwecke, die durch optimale Wahl von Mitteln
verfolgt werden, reicht Habermas nicht aus. Man kann und muss aus seiner Sicht
über das Rationalverhalten eines Homo oeconomicus hinausgehen. Dem stehen
die Auffassungen jener gegenüber, die glauben, man komme mit strategischer
Rationalität in der Behandlung aller praktischen Fragen aus und solle auch so
verfahren, weil alle darüber hinausgehenden Ansprüche auf rationale
Rechtfertigung zumindest zweifelhafter als jene sind, die sich ausschließlich auf
"strategische" Zweckrationalität berufen.
Die Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern der so genannten
Diskursethik und jenen, die eine interessenbasierte Rechtfertigung von Normen
im Kontext strategischer Rationalität befürworten, hält zumal in Deutschland
schon seit langem an. Es wäre vermessen, diesen Disput an dieser Stelle
entscheiden zu wollen. Es scheint sinnvoller, eine eher vermittelnde Linie zu
verfolgen, die nicht die Gegensätze, sondern eher die Gemeinsamkeiten der
beiden Lager zumindest für praktisch-ethische Fragestellungen betont. Die
angewandte Ethik (applied ethics) versucht ja gerade eine Basis normativer
Argumente zu wählen, die von möglichst vielen akzeptiert werden kann. Es geht
um gemeinsame Schnittmengen von Wertüberzeugungen. Diese werden
wesentlich von bestehenden institutionellen Regelungen des Rechtes wie der als
Sitte institutionalisierten Moral geprägt. Wenn wir eine moralische
Entscheidung zu treffen haben, dann geht in unser Entscheidungsverfahren für
die normative Ethik alles das ein, was in unserem Umfeld de facto als moralisch
geboten gilt. Die Tatsache, dass eine Norm der Alltagsmoral oder des positiven
Rechts Geltung beansprucht, ist von hohem Anfangsgewicht. Erst nach
sorgfältiger Überlegung kann man womöglich einen Grund finden, sich auch
158
gegen diese positiven Geltungsansprüche zu wenden. Für die im „Alltag“ zu
erreichenden weiteren, über die herrschenden Alltagsnormen und –
überzeugungen hinausgehenden, Überlegungsgleichgewichte treten theoretische
Ansätze wie der einer Diskursethik (des Utilitarismus, der Vertragstheorie) nur
zu den vorherrschenden Normen als ein weiterer Gesichtspunkt hinzu. – Der
Diskursethik nähert man sich am besten, indem man zunächst erneut ihren
Hauptgegner einer Ethik in Kategorien strategischer Rationalität betrachtet.
4.1. Verständigungsorientiertes als strategisches Handeln und
umgekehrt
Eine wesentliche, wenn nicht sogar die wesentlichste Unterscheidung jeder
normativen Theorie aber auch jeder normgeleiteten menschlichen Praxis ist die zwischen der
Rechtfertigung oder Auswahl von Regeln auf der einen
und
Rechtfertigungen bzw. Wahl von Handlungen unter Regeln
auf der anderen Seite.
Beispiel: Wenn man die Satzung eines Vereins festlegt, dann wird man sich
fragen, welche Vor- oder Nachteile es hat, wenn die Entscheidungen des
Vereins von einem ermächtigten Vorstand gefällt werden. Man muss sich fragen,
ob man eine Regel erlassen will, wonach die Unvereinbarkeit der Mitgliedschaft
in dem Verein mit der Mitgliedschaft in bestimmten anderen Vereinen gefordert
wird. Bevor man einem bereits bestehenden Verein beitritt, wird man sich
fragen, ob man die Regeln des Vereins so akzeptabel findet, dass von der
persönlichen Interessenlage her unter den gegebenen Regeln mehr für als gegen
den Beitritt spricht. Sobald die Satzung des Vereins einmal erlassen ist, muss
man sich unter den bestehenden Regeln fragen, was diese verlangen. Nach den
bestehenden Regeln hat man nach dem Beitritt gewisse Pflichten.
Die Tatsache, dass bestehende Regeln etwas fordern, hat eine gewisse
Bindungskraft selbst dann, wenn die Regeln selbst uns wenig überzeugen. Wenn
man einem Verein in eigener Person freiwillig beitrat, dann ist es sogar so, dass
man in gewisser Weise der Satzung des Vereins und der Verbindlichkeit der
satzungsgemäßen Anforderungen zugestimmt hat. Man kann sagen, dass man
aufgrund eines „stillschweigenden Versprechens“ an die Vereinsregeln
gebunden ist. Wenn ein Mitglied eines Vereins, etwa überlegt, ob es einem
konkurrierenden Verein zugleich beitreten soll, dann zählt für das Mitglied des
Vereins die Tatsache, dass sein Verein ihm abverlangt, keine
159
Zweitmitgliedschaft in dem konkurrierenden Verein zu haben. Abgesehen davon,
dass das Mitglied dann, wenn die Sache herauskommt, womöglich aus dem
ursprünglichen Verein ausgeschlossen wird und damit negative äußere
Sanktionen hinzunehmen hat, wird es für das betreffende Mitglied häufig auch
aus innerem Antrieb von Bedeutung sein, dass es eine Pflicht, die der Verein
ihm aufgrund der Satzung auferlegt, verletzt. Es will seinen satzungsgemäßen
Pflichten nachkommen.
Die Pflichten einer Satzung, die besteht, haben ein gewisses Gewicht, allein weil
sie die Pflichten der bestehenden Satzung sind. Die Begründung, warum man
der Satzung gehorchen sollte, können dann entweder im Nutzen der Satzung als
ganzer oder in der Tatsache bestehen, dass man der Satzung aus freien Stücken
beigetreten ist. Wichtig ist, dass am Ende für die tägliche Praxis auf die
Begründung für Verpflichtung, der Satzung zu gehorchen, gar nicht mehr bzw.
nur in Ausnahmefällen zurückgegriffen wird. Die Pflichten einer Satzung gelten
als institutionelle Pflichten „prima facie“ oder „erst einmal“. Wer abweichen
will, ist begründungspflichtig. Die Beweislast liegt bei dem der abweichen, nicht
dem der folgen will. Das heißt nicht, dass er der Beweislast für eine
Abweichung nie nachkommen kann. Es bedeutet aber nur, dass er ethisch
verpflichtet ist, es sei denn er kann aus einer übergeordneten ethischen
Überlegung zwingende Gegenargumente finden.
Beispiel: Der Mauerschütze an der DDR-Grenze war nach DDR-Recht gehalten,
auf Republikflüchtige zu schießen. Dass er den „vaterländischen Schutzwall“ eher nach innen als nach außen durch Gebrauch der Schusswaffe zu
verteidigen hatte, war gewiss geeignet, die moralische Rechtfertigung der Regel
in Zweifel zu ziehen. Aber auch die Rechtsregeln von Absurdistan sind zunächst
einmal institutionelle Regeln, die, insoweit als sie de facto existieren, zunächst
rechtliche Geltung für sich beanspruchen können. Die institutionelle Pflicht zu
schießen, bestand insofern für den Grenzer. Und die Tatsache, dass sie als
Rechtsnorm auftrat hatte auch ein gewisses moralisches Gewicht, das er nicht
einfach vernachlässigen konnte. Aber er konnte sich selbstverständlich fragen,
ob er die Pflicht moralisch akzeptieren würde und sollte. Wenn er nicht dieser
Auffassung war, dann konnte ihn das womöglich dazu führen, lieber etwas
später oder etwas höher zu zielen als für das Erzielen eines Treffers bei einem
Fluchtversuch zuträglich war etc.
Wenn der Grenzer nicht bewusst daneben zielte, konnte man ihm das vermutlich
moralisch vorwerfen. Ob er – wie die Siegermentalität deutscher Gerichte, die
sich im Besitz höherer naturrechtlicher Einsicht sehen, es nahe legt – auch
160
rechtlich für sein Tun heute zur Verantwortung gezogen werden darf, ist selbst
eine moralische (und rechtliche) Frage, über deren Beantwortung heftig
gestritten wird. In diesem Streit wird man auf die Rechtfertigung der
Institutionen des Rechts (insbesondere der vormaligen DDR aber auch der
jetzigen BRD) eingehen müssen. Damit hebt man die Auseinandersetzung von
der Ebene der Frage, was bestehende Regeln und Institutionen verlangen, auf
die Ebene der Frage nach den Gründen für die Institutionen selber. Es geht um
die moralische Rechtfertigung der Regeln und nicht um die Rechtfertigung von
Handlungen unter bestehenden Regeln. Dabei spielt die Unterscheidung von
hypothetischen und kategorischen Imperativen eine weit kompliziertere Rolle
als gemeinhin unterstellt wird.
4.1.1. Hypothetische Imperative und institutionelle Pflichten
Die Auffassung, dass rationale Rechtfertigungen von Normen ausschließlich in
Form hypothetischer Imperative erfolgen können, ist so etwas wie das
Gegenstück (oder der normative Zwilling) zu der Auffassung, dass eine
Erklärung menschlichen Verhaltens auf der Basis strategischer Rationalität
(Zweckrationalität) allein möglich ist. Im Prinzip läuft im Rahmen „strategischer
Rationalität“ jede rationale Rechtfertigung praktischer Handlungsanweisungen
auf das gleiche Schema hinaus:
Wenn ein Adressat normativer Rechtfertigungen bestimmte Ziele,
Zwecke oder Werte de facto akzeptiert, dann ist es ein angemessenes
Mittel zu Erreichung dieser gegebenen Ziele, Zwecke oder Werte, eine
bestimmte Handlung durchzuführen bzw. eine bestimmte allgemeine
Handlungsregel zu akzeptieren.
Die Rechtfertigung ist hypothetisch in dem Sinne, dass sie nicht mehr gültig
wäre, wenn die Ziele, Zwecke oder Werte des Rechtfertigungsadressaten
fortfallen würden. Die spezielle Norm, die betreffende Handlung durchzuführen
bzw. die entsprechende Regel zu akzeptieren, lässt sich zwar im Sinne der
zugrunde liegenden Zweck-Mittel-Beziehung rechtfertigen. Aber sie ist auch
vollkommen davon abhängig, dass die Ziele, Zwecke oder Werte, auf die sie
Bezug nimmt, de facto vorliegen. Die Durchführung der Handlung ist
„strategisch“ sinnvoll. Sie ist rational, aber nur relativ („wenn“) dazu geboten,
dass bestimmte Ziele, Zwecke oder Werte des Rechtfertigungsadressaten
vorliegen.
161
Für die Ökonomik ist – daran sei nochmals erinnert – die (im engeren Sinne
meta-ethische) Prämisse von ausschlaggebender Bedeutung, dass sich
ausschließlich hypothetische Imperative kluger Interessenwahrung rational
rechtfertigen lassen (vgl. insbesondere natürlich Robbins, L. (1935), „alternative
means to given ends“ ... „about ends it must remain silent“). Diese Imperative
benennen die Mittel zur Erreichung von gegebenen, d.h. de facto akzeptierten,
Zwecken an. Rational gerechtfertigt ist eine Norm immer nur mit Bezug auf das
partikulare Interesse des Adressaten der Rechtfertigung der Norm: Wenn „Du“,
der Adressat, X willst, dann solltest du Y tun!
Die verfolgten Zwecke können beliebiger Art sein, egoistisch oder altruistisch,
ideeller oder materieller Natur etc. Entscheidend ist, dass sie de facto angestrebt
werden. Auch unter der Kategorie der Mittel kann man sich einen denkbar
weiten Kreis von Instrumenten vorstellen. Insbesondere die Durchsetzung bzw.
auch nur die Befürwortung der Durchsetzung bestimmter Normen als
institutioneller Regeln gegenüber Dritten gehört dazu. Die Einrichtung einer
Institution bzw. die Durchsetzung von deren Regeln kann auch ein Mittel zur
Erreichung der Ziele, Zwecke oder Werte des Rechtfertigungsadressaten sein.
Ein Beispiel hierfür ist etwa das folgende: Wenn Du überleben willst, dann hast
Du guten Grund, Dir die Durchsetzung von Mordverboten durch einen
staatlichen Rechtsstab zu wünschen. Aus dem gleichen Grund kann man einem
Adressaten von Rechtfertigungen gegenüber dartun, warum er guten Grund hat,
an der Weitergabe bestimmter moralischer Normen etwa in der Erziehung
entweder selbst teilzunehmen bzw. die Teilnahme anderer an diesen
Erziehungsprozessen zu loben und zu unterstützen. „Wenn Du das Ziel hast, in
einer Rechtsordnung westlicher Prägung zu leben, dann solltest Du dafür
eintreten, dass rechtsstaatlich orientierte demokratische Parteien unterstützt
werden!“ usw. sind weitere Beispiele solcher hypothetischer Imperative, die uns
strategisch anleiten, zu erhalten, was wir de facto anstreben.
Die vorangehenden Argumente legen dar, wie weit die Vorstellung von
„Mitteln“ zu gegebenen Zwecken gedeutet werden kann und muss. Damit die
Konzeption instrumenteller Rechtfertigung unserer sozialen Wirklichkeit
angemessen bleibt, müssen wir alles mögliche als Zwecke und Mittel zulassen.
Nicht nur Institutionen und deren Durchsetzung, sondern auch Akte der
Befürwortung und Unterstützung solcher Institutionen können als Mittel zur
Verfolgung unserer Zwecke, Ziele oder Werte gedeutet werden. Wir reden nicht
mehr über einfache Instrumente, wie den Schraubenzieher, den man als Mittel
benutzt, um bestimmte Ziele zu erreichen, entweder die Schraube einzudrehen,
162
ein Leiste aufzuhebeln oder aber auch jemanden durch einen gezielten Stich zu
verletzen. Es geht auch nicht um isolierte Handlungen, deren Durchführung
unsere Interessen als isoliertes Mittel fördert. Wir reden über komplexe
institutionelle Regelsysteme, an denen wir alle in verschiedenen Rollen
teilnehmen. Diese Regelsysteme kann kein einzelner von uns als ganze zu
Instrumenten seiner Interessenverfolgung machen.
Wenn deshalb im Zusammenhang mit diesen Regelsystemen von Zweck-MittelRationalität die Rede ist, dann muss sich diese in erster Linie auf unsere
Einstellungen und kann sich nicht direkt auf unsere Handlungen beziehen. Es
wird uns durch grundlegende Argumente womöglich klargemacht, dass die
Existenz bestimmte Institutionen und Regeln insgesamt unseren Interessen dient.
Wir haben deshalb guten Grund, uns zu wünschen, dass die betreffenden Regeln
und Institutionen existieren. Direkte Handlungsgründe werden uns auf diese
Weise aber nicht geliefert. Denn kein einzelner kann durch eine einzelne
Handlung dafür Sorge tragen, dass eine Norm wie beispielsweise ein
allgemeines Tötungsverbot in einer Gesellschaft institutionalisiert wird. Dazu
müssen viele Individuen zusammenwirken. Keiner von diesen vielen
zusammenwirkenden Individuen benutzt allein auf sich gestellt ein
„Instrument“...
Der Beitrag, den einzelne in gemeinsamem Wirken zu leisten haben, wird mit
dem übergeordneten Ziel gewöhnlich nur wenig zu tun haben. Der Informatiker,
der in einer Strafverfolgungsbehörde an Programmen arbeitet, denkt
trivialerweise in seinem Handeln keineswegs daran, dass er die Durchsetzung
eines allgemeinen Tötungsverbotes durch sein Tun fördert und dass die
institutionelle Verwirklichung des Tötungsverbots in seinem eigenen
übergeordneten Interesse ist. Er denkt vielleicht kaum jemals über
Verbrechensbekämpfung nach. Der Bankangestellte der Kredite vergibt, kann
sich fragen, ob er die Richtlinien für die Vergabe von Krediten, die in seinem
Institut gelten, für vernünftig hält. Er kann über den guten Sinn bestimmter
Regelungen anderer Meinung sein als die Personen, die die Regeln erließen und
nun in der Bank durchsetzen. Was immer er in diesen Hinsichten für Schlüsse
zieht, sie werden ihn in seinem Handeln nur indirekt beeinflussen. Denn die
Frage, ob die Richtlinien als ganzes vernünftig sind, ist eine andere als die Frage,
was die bestehenden Richtlinien von dem Angestellten verlangen und ob es für
ihn vernünftig ist, sich entsprechend zu verhalten.
Nahezu beliebig viele andere Beispiele für diese Distanzierung unserer Rollenpflichten von übergeordneten rechtfertigenden Zielen, Zwecken oder Werten
163
ließen sich formulieren. In den meisten Kontexten, in denen viele Individuen
zusammenwirken müssen, um ein kollektives Ergebnis zu verwirklichen, hat das
individuelle Handeln nicht nur keinen Bezug auf das übergeordnete Ziel, die
individuellen Beiträge sind für das kollektive Ergebnis auch je für sich
unerheblich. Es kommt gerade nicht auf jeden einzelnen Beitrag an. Der
Schleier der individuellen Insignifikanz (wer darüber mehr Informationen
wünscht, sei verwiesen auf Brennan, G. and L. Lomasky (1983, Brennan, H. G.
and L. E. Lomasky (1989), Kliemt, H. (1986)), hinter dem wir alle in großen
Gesellschaften handeln, schwächt die instrumentellen Beziehungen unserer
Handlungen zu den übergeordneten Zwecken.
Der einzelne Beitrag zum Umweltschutz etwa, den wir leisten, wenn wir Strom
sparen oder unnötige Autofahrten unterlassen, ist für das Ausmaß der
allgemeinen Umweltverschmutzung so insignifikant wie das einzelne Sandkorn
im Sandhaufen. Ob man ein Sandkorn mehr oder weniger auf den Haufen wirft,
es bleibt ein Sandhaufen. Kein einzelnes Sandkorn macht die Ansammlung von
Körnern zu einem Haufen, aber ohne die einzelnen Körner wäre der Haufen
nicht vorhanden. Insoweit kann niemand durch Hinzufügen eines weiteren
Sandkorns den Zweck verfolgen, durch dieses eine Korn einen Haufen zu
erzeugen. Dafür ist das Korn und die Handlung, es auf den Haufen zu werfen,
nicht instrumentell. Auf der anderen Seite sind viele derartige Handlungen
kollektiv hinreichend, um insgesamt als Instrument zur Erzeugung eines
Sandhaufens zu dienen. Ohne die vielen Körner wäre der Sandhaufen nicht da.
Strategisch rational ist es in solchen Situationen gewöhnlich, nach der Maxime
„wer Trittbrett fährt, kommt auch zum Ziel“ vorzugehen und von der eigenen
Beteiligung abzusehen.
164
Regelbefolgung
Fast alle
anderen
Etwa
fünfzig
Prozent
Fast kein
anderer
5
3
1
6
4
2
Ich folge
Ich folge
nicht
Tabelle 6: N-Personen PD
Ordnung der Ergebnisse aus Sicht des Zeilenspielers 6>...>1 und damit jedes
beliebigen der N Individuen, die sich in die Lage versetzen können, als einzelner
mit dem gegebenen Verhalten der anderen konfrontiert zu sein
Die Dominanz der Strategie, sich selbst nicht zu beteiligen, wenn vom eigenen
Verhalten kein Kausaleinfluss auf das Verhalten der anderen ausgeht, ist
eindeutig. Gleichgültig, was die anderen tun, es ist immer besser, sich selbst
nicht zu beteiligen. Selbst dann, wenn man ein solches Spiel mehrfach spielt,
kann kein einzelner anderer beobachten, wie alle anderen handeln. Er kann
keine bedingte Reaktion auf das Verhalten der anderen zeigen. Er kann z.B. sich
nicht sinnvoll vornehmen, wenn Person x nicht kooperiert oder die Regel nicht
befolgt, dann werde er in der nächsten Spielrunde auch nicht kooperieren, werde
aber kooperieren wenn x zuvor kooperiert hat. In diesem Sinne sind reziproke
Strategien die auf das Verhalten einzelner reagieren, nicht möglich (man denke
etwa an „wie Du mir, so ich Dir“ oder TFT „tit for tat“, welches sehr eingängig
ist, allerdings nicht alle schönen Eigenschaften hat, die Axelrod der Strategie in
seinem höchst anregenden, doch formal sehr unzuverlässigen Buch beilegte, vgl.
Axelrod, R. (1987)). Das Verhalten einzelner kann aus dem Gesamtergebnis und
auch nicht aus anderen Quellen abgelesen werden. Deshalb kann man es nicht
zur Bedingung von eigenen strategischen Aktionen machen. Der Sinn eines
eigenen Abweichens kann ebenfalls nicht aus der Handlung abgelesen werden.
165
Wenn man abweicht, dann muss das ja gerade nicht notwendig bedeuten, dass
man den anderen damit für eine vorherige Abweichung bestrafen will. In
Großgruppen, in denen das Beteiligungsverhalten einzelner Individuen nicht
beobachtbar ist, gibt es daher selbst bei wiederholter Interaktion wenig
Hoffnung, dass die Dominanz nicht kooperativer Strategien behoben werden
kann. Das Freifahrer-Problem ist damit durch strategisches Verhalten
anscheinend nicht behebbar.
Handlungen, wie die Beteiligung an einer Allgemeinen Wahl (zwar kein NPersonen Gefangenen-Dilemma, aber doch ein Beteiligungsproblem), der
Mülltrennung etc. vollziehen wir häufig dennoch aus innerer Überzeugung und
ohne strategische Erwägung der Folgen unserer je einzelnen Akte. Damit die
kollektiven Ergebnisse zustande kommen, ist eine nicht-strategische Beteiligung
aus innerem Antrieb erforderlich. Am Ende wird man den Phänomenen der
Beteiligung gewiss besser gerecht, wenn man sie als Ausfluss von
Überzeugungen beschreibt und nicht als Ergebnis strategischer
Interessenkalkulationen im Einzelfall. Die Überzeugungen werden ihrerseits in
Prozessen gesellschaftlicher Kommunikation grundlegend beeinflusst. In diesen
geht es nicht nur um Instrumente zur Verfolgung gegebener Interessen, sondern
in einem gewissen Sinne um die Formulierung der Interessen selber
beziehungsweise um die Formung von Präferenzen.
Es scheint klar, dass dem ethischen Diskurs im weiteren Sinne eine Rolle in der
Präferenzbildung zukommt. Denn in ethischen Auseinandersetzungen werden
Beiträge zur Formung unserer grundsätzlichen Überzeugungen geleistet. (Selbst
wenn diese Überzeugungen am Ende nur ausdrücken, was wir für das halten,
was unseren Interessen am besten dient, handelt es sich um Überzeugungen und
nicht um direkt handlungsrelevante Anweisungen.)
Darum, die Aufmerksamkeit auf die Formierung von Überzeugungen zu richten,
kommt nach den vorangehenden Überlegungen auch eine Ethik-Rechtfertigung
in hypothetischen Imperativen kluger Interessenwahrung nicht herum. Wenn sie
ein realistisches Bild von der Umsetzung des normativ Erwünschten in
gesellschaftliche Praxis entwerfen will, muss sie davon ausgehen, dass die
Menschen häufig in einer Weise handeln, die weit vom Modell instrumenteller
Rationalität entfernt ist. Es geht nicht um eine kausal wirksame unmittelbare
Umsetzung der „obersten“ Zwecke des Handelns. Der Unterschied zwischen
ethischen Positionen, in denen es darum geht, durch Kommunikation erst einmal
Präferenzen und Überzeugungen zu bilden und ethischen Auffassungen, die von
166
gegebenen Zwecken, Zielen oder Werten ausgehen, verwischt sich, wenn man
ein realistisches Bild menschlichen Handelns entwirft:
Damit die soziale Ordnung funktioniert, so wie wir es de facto
beobachten, muss es Individuen geben, die intrinsisch zu bestimmten
Handlungen ohne Zweckrationalität im engeren Sinne motiviert sind.
Überdies mögen die letzten Ziele, Zwecke oder Werte zwar als
gegeben vorausgesetzt werden, doch heißt das mit Bezug auf die
direkt handlungswirksamen Motive wenig. Diese Motive werden
womöglich nur aus dem Verpflichtungsgefühl gegenüber Normen
beruhen. Der Anhänger einer strategischen Rechtfertigung
gesellschaftlicher Institutionen auf der Basis der durch diese
Institutionen geförderten individuellen Interessen kann ohne weiteres
unter bestehenden Institutionen aus Pflicht und nicht aus strategischen
Motiven heraus handeln.
Ein triviales Beispiel bildet die Akzeptanz des Gebotes, Versprechen zu halten.
Man kann sich verpflichtet fühlen, Versprechen nicht zu brechen, ohne in jedem
einzelnen Falle, die Handlungsfolgen abzuwägen. Das einzige Motiv, das man
in einer Handlungssituation bewusst hat, ist die Vorstellung, es sei geboten,
Versprechen nicht zu brechen. Man denkt über den Nutzen der
Versprechensinstitution gar nicht mehr nach. Unter den direkten
Handlungsmotiven taucht die Einsicht in die Nützlichkeit der
Versprechensinstitution nicht auf. Insoweit gibt es keine Unterschiede zwischen
der tatsächlichen Wirkungsweise einer Institution wie dem Versprechen, wenn
man ihre Rechtfertigung das eine Mal konsequentialistisch und das andere Mal
pflichten- oder rechtsbasiert (deontologisch) ableitet. Auf der höheren Stufe, auf
der es um die Rechtfertigung der Institution geht, gibt es Unterschiede. Aber
diese betreffen weniger die konkreten institutionellen Pflichten bzw. deren
Inhalte als die Art der Ableitung und Rechtfertigung.
Der Inhalt von Überzeugungen wird in einem interessenorientierten Diskurs, der
sich allein auf die Bestimmung hypothetischer Imperative kluger
Interessenwahrung richtet, nicht an einem unabhängigen Maßstab, sondern nur
an den außermoralischen Konsequenzen geprüft. Aber die feste institutionelle
Regel, dass Versprechen, gehalten werden müssen, ergibt sich typischerweise in
beiden Fällen. Beim Konsequentialisten indirekt und beim NichtKonsequentialisten direkt aus der Einsicht in die „Vernunft der Regel“ (vgl.
dazu und zum vorangehenden insbesondere Brennan, H. G. and J. M. Buchanan
(1985)).
167
4.1.2. Nicht-konsequentialistische, insbesondere „transzendentale“ Rechtfertigungen von Pflichten
Die Zweck-Mittel-Rationalität sagt nichts darüber aus, ob die verfolgten Ziele
selber angemessen oder vernünftig sind. Wer nicht überleben will, der hat
womöglich auch kein Interesse an der Durchsetzung von Mordverboten. Wer
den Rechtsstaat ablehnt, für den ist es womöglich unvernünftig, demokratischrechtsstaatliche Parteien zu unterstützen. Relative zu solchen Einstellungen sind
die Gebote der instrumentellen Vernunft ziemlich klar. Den Einstellungen selbst
möchten viele Bürger und Philosophen gern mit Argumenten entgegentreten
können. Das gilt insbesondere für Apel und Habermas, deren Ansatz uns an
dieser Stelle stellvertretend für viele ähnliche ethische Intuitionen als
Anschauungsmaterial dienen kann. Die beiden wollen den vorerwähnten
Ansichten nicht nur politisch als Gegner entgegentreten können, sondern mit
dem Argument, dass es in sich unvernünftig sei, solche Ziele zu verfolgen. Das
bedeutet, dass man nach Auffassung von Habermas und Apel auch die letzten
Ziele, Zwecke oder Werte eines Rechtfertigungsadressaten noch argumentativ
und rational kritisieren können muss. Es gibt Gründe dafür, sie zurückzuweisen
und man kann sie nicht nur deshalb ablehnen, weil man de facto anderes will.
Am Ende zählt moralisch nicht nur die Fähigkeit oder Macht sich durchzusetzen,
sondern es zählen Argumente, während für den Anhänger einer bloß
instrumentellen Rechtfertigung von Institutionen am Ende auch moralisch der
Rekurs auf etwas außermoralisches und nicht-argumentatives übrig bleibt.
Wenn man in Anspruch nimmt, dass es Rechtfertigungen von Regeln und
Normen gibt, die ohne einen Bezug darauf, dass der Rechtfertigungsadressat de
facto Ziele, Zwecke oder Werte akzeptiert, rationale Gültigkeit beanspruchen
können, dann unterstellt man die Existenz von nicht-hypothetischen oder nichtstrategisch begründeten Imperativen auf oberster Rechtfertigungsebene. Da sie
nicht auf de facto gegebene Ziele, Zwecke oder Werte angewiesen, sondern von
solchen empirischen Bedingungen in ihrem Geltungsanspruch unabhängig sind,
teilen die dann noch möglichen Argumente ein, wenn nicht das zentrale
Merkmal kategorischer Imperative im Sinne Kants. Aufgrund der
Unabhängigkeit von Zielen, Zwecken oder Werten und der davon bestimmten
Konzeption des Guten handelt es sich zugleich in diesem engeren Sinne um
deontologische Ansätze.
Da das Begründungsprogramm von Karl-Otto Apel sich selbst ausdrücklich an
„transzendentales“ Denken anlehnt und Habermas in seiner Diskursethik auf
168
Apels Transzendental-Pragmatik zurückgreift, ist es nützlich, sich zunächst in
einer stark vereinfachten und vergröbernden Weise wenigstens bestimmte
Aspekte des transzendentalen Denkens Kants zu erschließen, um sich vor
diesem Hintergrund der Habermasschen Diskurs-Ethik zu nähern (eine
grundlegende und klar geschriebene Kritik des jüngeren transzendentalen
Denkens findet man in Albert, H. (2003)).
4.1.2.1. Eine Prise Kant
Nach Kant ist uns die Welt als Gegenstand unserer Erfahrung immer nur unter
Kategorien von Raum und Zeit zugänglich. Die Welt an sich, ohne derartige
„Beigaben“ liegt jenseits der Erfahrung (sie ist transzendent, nicht
transzendental). Wir können womöglich der Welt auch auf andere Weise
begegnen, nicht aber Erfahrungen in ihr bzw. von ihr machen. Das ist so, weil
Erfahrungen zu machen, aus Sicht Kants bedeutet, dass man die Kategorien von
Raum und Zeit zur Konstituierung des Erfahrenen heranzieht (etwa so wie man
eine 3-D-Brille aufsetzt, um eine dreidimensionale Bilderfahrung zu machen,
wenn man einen entsprechend präparierten Fernsehfilm betrachtet). So ähnlich
wie aus „Junggeselle“ folgt, dass der Betreffende unverheiratet ist, so folgt nun
aus dem Begriff „Erfahrung“, dass jede Erfahrung – alles, was unter den Begriff
fällt – durch vorausgesetzte Formen oder Kategorien von Raum und Zeit
zustande kommt. Diese Formen sind in dem Sinne transzendental, dass sie die
„Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung“ sind.
Ganz analog versucht Kant, seine Moralphilosophie und seinen kategorischen
Imperativ als rein formale oder vorausgesetzte Bedingungen allgemeinen
moralischen Urteilens und Handelns zu begründen. Daran und an der
unterschwellig benutzten Analogie zwischen a priorischen Erfahrungs- und a
priorischen Moralgesetzen (Gesetzen, die aller Erfahrung vorausgehen und als
Vernunftgesetze gänzlich unabhängig davon sind, was in der Welt vorgeht) ist
von je her und gerade auch in jüngerer Zeit Kritik geübt worden. Auf diese
Kritik ist an dieser Stelle nicht einzugehen. Denn Apel und Habermas vermeiden
die eher erkenntnistheoretisch motivierte Art der Kritik an diesen Aspekten des
Kantianismus in der Moralphilosophie, indem sie den „a priori“ vorausgesetzten,
der Erfahrung und der Moral vorausgehenden transzendentalen Faktoren eine
„transzendental-pragmatische“ oder „kommunikative“ Deutung geben.
169
4.1.2.2. Von Kant über Apel zu Habermas
Nach der transzendentalpragmatischen Sicht kann man dann, wenn man mit
anderen kommuniziert, gar nicht anders als bestimmte Voraussetzungen
„verständigungsorientierten“ Handelns zu machen. Man hat als Teilnehmer am
Diskurs „immer schon“ bestimmte Normen der Teilnahme und des
wechselseitigen Respektes akzeptiert. Da man das getan hat, kann man gar nicht
anders als die aus diesen Normen erwachsenden Pflichten zu akzeptieren –
gleichgültig, was man de facto sonst noch will. Wer kommuniziert, hat damit
nach Auffassung von Habermas und Apel „immer schon“ bestimmte Regeln
unterschrieben.
Das scheint zunächst nicht unvernünftig. Wer Poker spielen will, der akzeptiert,
indem er sich einer Poker-Runde anschließt, deren Regeln. Es hängt allerdings
sehr viel an der Deutung des Wortes „akzeptieren“. Wenn man der Sicht von
Apel, Habermas und ihren Anhängern folgt, dann ist es eine Voraussetzung der
Teilnahme an einem Diskurs, dass man bestimmte Normen nicht nur äußerlich
einhält, sondern „wirklich“ und damit aus innerer Überzeugung „akzeptiert“.
Das Letztere muss man, wenn man sich einer Poker-Runde anschließt, aber
gerade nicht vollziehen. Es reicht aus, dass der Pokerspieler die Regeln einhält.
Es ist für die erfolgreiche Teilnahme am Spiel nicht erforderlich, dass er sie auf
einer grundsätzlichen Ebene für richtig oder angemessen hält. Dass der
Pokerspieler die Regeln aus innerer Überzeugung akzeptiert, ist nicht gefordert,
um am Spiel im alltäglichen Sinne des Begriffs „teilnehmen“ zu können.
Nun kann man natürlich festlegen, dass im Gegensatz zu unserer alltäglichen
Verwendung von Termen „Teilnahme“ bedeutet, dass man bestimmte Regeln
nicht nur „äußerlich“ einhält, sondern auch „innerlich“ akzeptiert, indem man
sie sich zu eigen macht. In dieser Bedeutung von „Teilnahme“, kann man dann
trivialerweise am Diskurs nur teilnehmen, wenn man sich seine Normen
innerlich zu eigen macht. Sonst tut man nur so, als ob man teilnähme. Man
würde aber nicht in dem festgelegten Sinne von „Teilnahme“ teilnehmen.
Wenn man das starke Konzept von Teilnahme zugrunde legt, dann kann man
diese Form der Teilnahme nur unter echter Akzeptanz der
„Teilnahmebedingungen“ praktizieren, nichts zwingt jedoch dazu, diese und nur
diese Form der Teilnahme zu praktizieren. So, wie der Poker-Spieler einfach am
Spiel teilnehmen kann, ohne die Regeln für vernünftig zu halten oder sie in dem
starken Sinne zu akzeptieren, dass er sie sich selber aussuchen würde, wenn er
es könnte, so könnte man auch am gesellschaftlichen und ethischen Diskurs
„strategisch“ teilnehmen, ohne seine Regeln aus innerer Überzeugung zu
170
akzeptieren. Obschon es empirisch schwierig sein mag, sich zu verstellen (vgl.
dazu Frank, R. (1992), Baurmann, M. (1996)), scheint es möglich, dass man an
einem Diskurs teilnehmen kann, ohne sich wahrhaft auf ihn einzulassen. Es
reicht völlig aus, dass man „strategisch“ so handelt, als ob man grundlegende
Normen akzeptierte, ohne sie wahrhaft zu akzeptieren. Man tut so als ob, um in
dem Diskurs die eigenen Argumente zur Sicherung der eigenen Interessen
besser einsetzen zu können.
Man kann sich, so wie man sich aus Eigeninteresse wie ein selbstloser Helfer
geben kann, durchaus aus strategischen Interessen so verhalten, als ob man ein
verständigungsorientiert Handelnder wäre. Selbst wenn man sich „immer
schon“ äußerlich in einer bestimmten Weise verhalten muss, um am Diskurs
teilzunehmen, kann man „immer noch“ die äußeren Teilnahmebedingungen als
bloße externe Restriktionen beachten, ohne sie von einem internen Standpunkt
aus zu akzeptieren oder zu internalisieren.
Fragen nach dem Status letzter Begründungen sind von hohem theoretischen
Interesse. Deshalb muss die philosophische und meta-ethische Diskussion um
die transzendental-pragmatische Letztbegründung geführt werden. Für
praktische Zwecke sind derartige Diskussionen jedoch weit gehend irrelevant.
Ungeachtet
aller
Vorbehalte
gegen
die
Ansprüche
einer
transzendentalphilosophisch begründeten Unmöglichkeit nicht-strategischer,
kategorisch gerechtfertigter Akzeptanz bestimmter Normen des Diskurses, gibt
es einen plausiblen Kern der Diskurs-Theorie. Dieser Kern erschließt sich auch
jenen, die den transzendentalphilosophischen Fundamentalismus im
Begründungsdenken nicht akzeptieren wollen.
4.2. Diskurs-Ethik ohne transzendentale Begleitmusik
Praktische Normen vor allem einer Institutionalisierung von Verfahren der
Überlegung und Diskussion sind für praktisch-ethische Entscheidungen von
hoher Bedeutung. Die Aufmerksamkeit muss sich auf die Implementierung
„deliberativer Verfahren“ und die angemessenen Normen, die diesen zu Grunde
liegen sollen, richten. Diskussionen, an denen nicht nur einzelne Personen
„monologisch“
wie
etwa
am
ursprünglichen
Rawlsschen
Entscheidungsverfahren für die normative Ethik, sondern im inter-personalen
Dialog teilnehmen, können nicht nur große Anziehungskraft besitzen. Ihnen
scheint auch für Fragen der praktischen Ethik, wenn man diese einmal als
171
ethische Auseinandersetzungen in der gesellschaftlichen Praxis deutet, eine
besondere Bedeutung zuzukommen.
Das Augenmerk gilt Diskursen als gesellschaftlichen Regelsystemen oder
Institutionen. Welche Regeln benutzt werden, muss keineswegs allein diskursethisch begründet werden. Es geht jetzt um eine Alltagsmoral des praktischen
Diskurses und Institutionen die den Disput um moralische Fragen in geordnete
Bahnen lenken. Die Regeln für diese Alltagsinstitution können durchaus mit
folgenorientierten Argumenten begründet werden. Sie können mit vertragstheoretischen
beziehungsweise
utilitaristischen
Argumenten
ebenso
gerechtfertigt werden, wie man versuchen kann, sie direkt auf deontologische
Prinzipien wie einen kantischen kategorischen Imperativ oder aber
transzendental pragmatische Auffassungen zurückzuführen. Für die ethische
Theorie machen alle diese Unterscheidungen einen Unterschied, für die
tatsächliche Praxis moralischer Auseinandersetzung allerdings eher nicht.
Die „Praxis“ praktischer Diskurse unterscheidet sich von einer philosophischen
Theorie so genannter idealer Sprechergemeinschaften und deren fiktiven
Praktiken so, wie sich das reale Pokerspiel sich von einem nur vorgestellten
idealen Spiel unterscheidet. Reale praktischer Diskurse müssen sich nach realen
Regeln vollziehen. Es muss institutionalisiert werden, welche Regeln gelten
sollen und wer auf welche Weise an den Diskursen teilnehmen soll. Was das
anbelangt, scheinen die folgenden fünf Prinzipien als grundlegende
Orientierungen dienen zu können (vgl. Kettner, M. (1993); vgl. auch zu
allgemeinen Hintergründen Koller, P. (1992)).
1. Allgemeinheit der Teilnahme: Zum praktischen Diskurs sollen alle
kompetenten Moralbeurteiler zugelassen sein, sofern deren Interessen von der
Entscheidung betroffen sind, beziehungsweise betroffen sein werden. Das kann
natürlich nicht heißen, dass buchstäblich jedermann, der potentiell betroffen sein
könnte, gehört wird. Diese Möglichkeit scheidet schon deshalb aus, weil
bestimmte Personen erst in der Zukunft existieren werden und deren Interessen
ebenfalls betroffen sein können. Es muss aber versucht werden, so gut wie
möglich sämtliche Interessen und Auffassungen in der Diskurs-Situation
vertreten zu sehen.
2. Offenheit: Es obliegt den Teilnehmern des Diskurses allein, welche Arten von
Argumenten sie einbringen wollen. Sie sind insoweit autonom. Zugleich steht es
jedem der Diskursteilnehmer frei, das, was andere vorbringen, beliebig infrage
zu stellen. Interessen können allerdings als illegitim angesehen werden, wenn sie
172
als irrational erscheinen (wobei nicht recht klar ist, nach welchem Kriterium die
Irrationalität festgestellt werden soll).
3. Einfühlungsfähigkeit und –bereitschaft: Es wird von den Teilnehmern
erwartet, dass sie fähig und bereit sind, sich in andere Teilnehmer und deren
Lage zu versetzen. Zugleich wird verlangt, dass jeder Diskurs-Teilnehmer sich
von seiner eigenen partikularen Betroffenheiten soweit distanzieren kann, dass
er auf sich als einen gleichberechtigten Teilnehmer unter vielen schauen kann.
4. Wechselseitige Gleichanerkennung: Im Diskurs müssen die Teilnehmer von
Asymmetrien, die ihre Stellung außerhalb des Diskurses kennzeichnen mögen,
absehen wollen. Das generelle Prinzip, dass jeder für einen und keiner für mehr
als einen zählen möge, wird akzeptiert.
5. Wahrhaftigkeit: Im Diskurs legen die Teilnehmer ihre wahren Motive und
Absichten offen und verschleiern diese nicht strategisch, um im Diskurs etwas
zu erreichen.
Von den fünf genannten Annahmen her ist klar, dass in die Konstruktion der
Diskurssituation als solcher bereits starke substantielle normative Prämissen
eingehen. Sofern man sich diese Situation nur in der Theorie vorstellt, um aus
dieser Vorstellung oder diesem Denkmodell normative Folgerungen zu ziehen,
hat man einen Teil dessen, was man hinterher aus dem Modell ableitet, zu
Beginn in das Modell hineingesteckt. Auf der anderen Seite muss jede
substantielle ethische Theorie derartiges vollziehen. Der Utilitarismus
Harsanyi’s etwa nimmt an, dass jedes Individuum mit gleicher
Wahrscheinlichkeit in jeder gesellschaftlichen Position sein kann. Die Theorie
von Rawls unterstellt, dass die Individuen hinter einem Schleier der Unkenntnis
über die eigene Betroffenheit über Gesellschaften entscheiden und bestimmte
fundamentale Respektsnormen akzeptieren. Insoweit muss man auch der
Diskurstheorie bestimmte Grundvoraussetzungen einer moralischen Motivation
zugestehen. Damit gerät sie allerdings auch in die gleichen Probleme wie
insbesondere die Gesellschaftsvertragstheorien. Denn die Diskurstheorie
unterstellt einen fiktiven Diskurs fiktiver Individuen, die sich auf eine bestimmte
idealisierte Weise im Denkmodell begegnen. Dann zieht sie aus dieser rein
fiktiven Situation Konsequenzen für Normen, die in der realen Welt Geltung
besitzen sollen. Damit entstehen aber alle Probleme mangelnder
Verpflichtungskraft fiktiver oder fiktionsbasierter Argumentationen, wie wir sie
aus der Diskussion um die Gesellschaftsvertragslehre kennen.
173
Eine Möglichkeit, diese Probleme zu mildern, besteht darin, die fünf genannten
Bedingungen approximativ in der Realität zu realisieren. So kann man
beispielsweise eine heterogene Gruppe von Individuen zusammenbringen, um
diese exemplarisch einen Diskurs über ein relevantes moralisches Problem
führen zu lassen. Diese Gruppe würde dann stellvertretend für andere agieren.
Möglicherweise würde die Repräsentativität der Gruppe ausreichen, um die
Ergebnisse auch für unbeteiligte Dritte überzeugend werden zu lassen.
Die Nähe zur Gesellschaftsvertragslehre ist in jedem Falle offenkundig wenn
Habermas sagt (vgl. Habermas, J. (1983), 75):
Es muss „(j)ede gültige Norm der Bedingung genügen, dass die
Folgen und Nebenwirkungen, die sich jeweils aus ihrer allgemeinen
Befolgung für die Befriedigung der Interessen eines jeden einzelnen
(voraussichtlich) ergeben, von allen Betroffenen akzeptiert (und den
Auswirkungen der bekannten alternativen Regelungsmöglichkeiten
vorgezogen) werden können.“
Diesen Satz würden Theoretiker wie Rawls und insbesondere Buchanan sofort
unterschreiben. Wenn man die Bedingung, dass die Norm „akzeptiert werden
kann“, daran anbindet, dass die Existenz und Durchsetzung der Norm im
Interesse des betreffenden Individuums liegt, dann ist es schwer, einen
grundlegenden Unterschied zu der zustimmungstheoretischen Grundnorm jeder
Gesellschaftsvertragslehre auszumachen, dass am Ende nämlich die
Zustimmung jedes einzelnen entscheidend sei.
Dass Habermas hier im Gegensatz zu einer Konzeption der Vertragstheorie von
einer Argumentationsregel spricht, scheint unerheblich. Denn in dieser Regel ist
de facto nicht von Argumentation die Rede (vgl. dazu und zu vielen anderen
Aspekten kritisch und aufschlussreich Lumer, C. (1997)). Es geht auch nicht um
eine dialogische Regel, nicht einmal um Diskurs, sondern um ein Kriterium zur
Beurteilung von Normen. Dieses Kriterium steht dem Pareto-Kriterium sehr
nahe, wenn man voraussagt, dass die Bedingung, dass jedermann x gegenüber y
akzeptieren kann, bestimmt dann erfüllt ist, wenn die Interessen von jedermann
durch x besser erfüllt werden als in der Vergleichssituation y. Wenn man die
Voraussage, dass die Bedingung des Kriteriums erfüllt ist, an andere
Wertvorstellungen als individuelle Interessenerfüllung oder gar individuelle
Präferenzen knüpft, dann muss man letztlich die Begründunglast für diese
Wertvorstellungen auf sich nehmen. Ansonsten wäre es sinnvoll, die
Zustimmung real einzuholen. In diesem Falle, bedeutet die Formulierung, dass
jeder etwas akzeptieren kann, einfach, dass jedermann die betreffenden
174
Maßnahmen akzeptiert. Allerdings stellt sich hier wieder das pragmatische
Problem, dass man eben gerade nicht alle an den „runden Tisch“ holen und
grundlegende Fragen klären lassen kann. Die normative Reflexion und das
normative Theoretisieren über praktische Fragen kann man nicht gänzlich durch
Institutionalisierung von Diskursen in Diskussionszirkeln und dergleichen
einfangen. Man kann allerdings mit ein wenig Mathematik in einem
entscheidungstheoretischen Kontext etwas mehr über Konsensmodelle sagen,
die der Tatsache, dass real am Ende eines realen Diskurses immer ein Dissens
und praktisch niemals ein Konsens stehen wird, Rechnung zu tragen suchen.
Solche Modelle gehen über die praktisch-ethische Kernfrage, wie man mit dem
Rest-Dissens ethisch umgehen soll, nicht hinweg. Sie maskieren die Tatsache
des Dissenses nicht, indem sie diesen mit Hilfe von Fiktionen zum Konsens
„ehrenhalber“ umdeklarieren, sondern versuchen, Verfahren zu deren akzeptabler Findung vorzuschlagen. Diese Verfahren stehen zwar selber wieder unter
dem Vorbehalt, dass sie weitreichende Voraussetzungen machen müssen. Doch
bemühen sie sich wenigstens um Präzision und legen dabei die Voraussetzungen
offen.
4.3. Lehrer-Wagner-Modelle intersubjektiven Konsenses
In den Fällen, in denen, aus welchen Gründen auch immer, kollektiv gehandelt
werden muss oder soll, denkt man herkömmlicher Weise daran, Entscheidungen
durch Abstimmungsverfahren treffen zu lassen. Blindes Vertrauen in kollektive
Abstimmungsverfahren wie etwa das einfache Mehrheitsverfahren zu setzen,
erscheint jedoch nicht als allzu überzeugend. Dagegen, dieses Vertrauen zu
zeigen, sprechen nicht nur die Möglichkeiten von Zyklen in der
Entscheidungsfindung, sondern darüber hinaus auch die Tatsache, dass einfache
Abstimmungsverfahren individuell vorhandene Informationen in hohem Maße
vernachlässigen. In einer Mehrheitsabstimmung etwa können Individuen im
Prinzip immer nur mit "nein", "ja", "Enthaltung" reagieren. Das ist alles, was die
kollektive Abstimmungsmaschinerie verarbeiten kann.
Da man von einem vollständigen Konsens nicht ausgehen kann, steht man
anscheinend in nahezu allen kollektiv verbindlichen Entscheidungen vor dem
klassischen Problem von "Individuum und Gesellschaft", dem Problem der
unauflöslichen Spannung zwischen dem, was der Einzelne will, und den
Zumutungen, die er als Erfordernis kollektiven Zusammenlebens in Kauf
nehmen muss. Das nachfolgend skizzierte Modell weist einen Teilausweg aus
diesem Konflikt. Im Vergleich zu dem zuvor diskutierten Modell Harsanyis, das
175
nur einen ganz abstrakten Rahmen moralischer Urteilsbildung entwirft, befindet
es sich auf einer niedrigeren Abstraktionsebene, indem es aufzeigt, wie die
benötigten Informationen für ein "konsensfähiges Gemeinwohlurteil" überhaupt
gewonnen werden könnten. Zugleich behandelt es in aufschlussreicher Weise
das bei Harsanyi letztlich durch eine axiomatische Setzung erledigte Problem
der Konvergenz unterschiedlicher individueller Gemeinwohlurteile zu einem
einheitlichen, inter-individuellen Gemeinwohlurteil auf eine Weise, die zentrale
Grundanliegen der Diskursethik in die strategische Analyse individuellrationaler Urteilsbildung aufnimmt und sie konkretisiert.
4.3.1. Das Grundmodell von Lehrer und Wagner
Stellen Sie sich eine Gruppe J von Individuen vor, die gemeinsam handeln
müssen oder möchten und die dabei das in ihrer Gruppe vorhandene Wissen
"optimal" ausnutzen wollen. Um Ihre Vorstellungskraft noch etwas konkreter
anzuregen, können Sie sich einmal ausmalen, die Gruppe J betreibe eine
landwirtschaftliche Kooperative. Die Mitglieder von J müssen unter dem Risiko
unsicherer Marktchancen für die verschiedenen landwirtschaftlichen Produkte
darüber entscheiden, was sie anbauen. Insbesondere wissen sie vor der Entscheidung nicht mit Sicherheit, ob die Produkte, die sie anbauen, auf dem Markt
gefragt oder nicht gefragt sein werden bzw. welche Preise sie dafür erzielen
können. Von entscheidender Bedeutung für die Anbieter ist, ob der Markt für sie
"groß" sein wird, X, oder klein, XC. Die Größe des Marktes wiederum hängt von
der Nachfrage der Verbraucher aber auch davon ab, ob viele oder nur wenige
nicht zur Kooperative gehörige Entscheidungsträger – andere Individuen, andere
Kooperativen etc. – das gleiche Produkt anbauen werden.
Insgesamt werden sich alle diese verschiedenen Einflüsse in einer
Wahrscheinlichkeitsschätzung p(X) dafür, dass der Markt groß ist,
niederschlagen müssen; wobei p(XC)=1-p(X). Das wissen die Individuen aus J.
Es gilt zugleich, dass für i, j ∈ J die persönlichen Einschätzungen ungleich sein
können – und in der Regel zunächst auch sein werden. Was soll man aber
machen, wenn für zwei verschiedene Individuen i und j aus J gilt pi(X)≠pj(X)?
Soll man nach der Schätzung von i vorgehen, nach der von j, nach einem
Mittelwert oder wonach sonst? Soll man bei der Mittelwertbildung vielleicht die
Einschätzung durch j höher gewichten als die von i, weil etwa j der bessere
Experte ist? Wer aber soll wie feststellen, wer die besten Experten in einem
Kollektiv sind?
176
Eine einfache Mehrheitsentscheidung darüber, welcher von verschiedenen
vorgeschlagenen Wahrscheinlichkeitswerten p(X) der plausibelste ist, erscheint
als wenig sinnvoll. Man wird vielmehr wünschen, dass über einfache
Stimmenzählung hinaus, Informationen berücksichtigt werden. Nach Überlegungen die von dem Philosophen Keith Lehrer vorgeschlagen und von ihm
zusammen mit dem Mathematiker Carl Wagner ausgearbeitet wurden, kann man
die Berücksichtigung weiterer Informationen in einem konsensorientierten
Verfahren tatsächlich erreichen (vgl. ursprünglich Lehrer, K. and C. Wagner
(1981)). Am Beispiel des Entscheidungsproblems der landwirtschaftlichen
Kooperative J lässt sich das Vorgehen im Grundzug erläutern.
Nehmen wir an, alle Argumente und mitteilbaren Informationen sind nach
einem Meinungsbildungsprozeß in J ausgetauscht. Die Diskussionen der
Mitglieder des Kollektivs J wurden beendet, weil sich durch weitere
Diskussionen und weiteren Informationsaustausch zwischen den Beteiligten an
deren individuellen Wahrscheinlichkeitseinschätzungen nichts mehr ändert. Es
ist eine Art "diskursives Gleichgewicht" in dem Sinne erreicht, dass weitere
Kommunikation an den bestehenden Einschätzungen nichts ändert. Man könnte
auch sagen, der Grenzertrag weiterer diskursiver Aktivitäten der Teilnehmer sei
"Null". Sofern sich nicht ohnehin Einmütigkeit eingestellt hat, bringt eine
Fortsetzung des Diskurses einen Konsens nicht näher.
In dem Kollektiv J hat jeder nach dem Ende des Argumentations- und Informationsaustauschprozesses eine "Anfangsschätzung" pj(X) darüber, wie hoch die
Wahrscheinlichkeit von X nach seiner persönlichen Meinung ist. Diese
Schätzung steht am Ende des öffentlichen Diskurses. Jeder hat eine derartige
subjektive Schätzung auf dem Weg zum Kommunikationsgleichgewicht, den er
im Diskurs gemeinsam mit allen anderen beschritten hat, durch einen internen
Abwägungs- und Urteilsprozeß gebildet.
Die so gewonnenen Schätzungen der einzelnen Individuen fassen wir zusammen
zu einem n–tupel oder Profil p von Schätzungen mit
p = (p1(X), p2(X), ..., pn(X)).
Da nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern regelmäßig anzunehmen ist, dass
pi(X)≠pj(X) für i≠j gilt, weiß man mit Kenntnis von p noch nicht, welche
Schätzung für das Kollektiv verbindlich sein soll.
Lehrer und Wagner schlagen nun vor, das Endergebnis des Beratungsprozesses
als Anfangsinformation für einen weitergehenden Schritt in Richtung auf ein
177
einheitliches Ergebnis zu nutzen. Sie argumentieren, dass jeder der Beteiligten
nicht nur Informationen über die Sache selbst, sondern darüber hinaus auch über
die Beurteilungskompetenz der anderen Individuen aus J hat. Jeder hat eine
Schätzung darüber, wie zuverlässig die Einschätzungen der anderen sind. Jeder
kann jedem Kollektivglied einschließlich seiner selbst einen Anteil an der
Gesamtkompetenz des Kollektivs zuweisen.
Setzt man die Gesamtkompetenz des Kollektivs mit 100% an, dann hat jeder aus
seiner eigenen Sicht einen gewissen Anteil an dieser Urteilskompetenz. Das
erste Individuum etwa könnte sich – nach seiner eigenen Selbsteinschätzung –
selbst 90% der Urteilskompetenz zuerkennen, dem vierten und fünften jeweils
5% und die anderen für völlig inkompetent halten. Der zweite und der dritte
halten vielleicht nur sich selbst für kompetent, weisen sich damit ein Gewicht
von 100% zu und den übrigen einen Wert von 0%. Der Vierte wiederum mag
von sich selbst in dieser Frage überhaupt nichts halten. Er meint, völlig
inkompetent zu sein und weist sich selbst daher ein Gewicht von 0%, dem Urteil
des zweiten jedoch – wie dieser selbst – ein Gewicht von 100% zu etc.
Es liegt nahe, aus solchen Überlegungen heraus eine neue Wahrscheinlichkeitsschätzung gewinnen zu wollen, bei der jeder das Urteil jedes anderen mit
den von ihm selbst vergebenen Kompetenz-Gewichten versieht und zu einer aus
seiner eigenen Sicht besseren Schätzung aggregiert. Da klar ist, dass es immer
um die Wahrscheinlichkeitsschätzung für die gleiche Alternative X geht, lassen
wir den Hinweis auf X im folgenden fort und erhalten zunächst als vereinfachte
Notation:
p = (p1, p2, ..., pn) für das Profil von Anfangsschätzungen.
Die Kompetenzschätzungen sind nun Werte zwischen 0 und 1 (0% bis 100%),
die jedes Individuum jedem anderen zuweist. Solche Schätzungen werden von
jedem i∈J für jedes j∈J vorgenommen. Man erhält dann
qij:
die Einschätzung der Kompetenz von j durch das Individuum i.
Aus den von einem Individuum i abgegebenen Schätzungen kann man nun ein
n-tupel bilden mit
qi = (qi1, qi2, ..., qin).
In diesem n-tupel oder in dieser Liste hält das Individuum i fest, wieviel der im
Kollektiv J vorhandenen Gesamturteilskompetenz aus seiner persönlichen Sicht auf
178
jedes der Individuen j = 1, 2, 3, ..., n entfällt. Diese Gewichte müssen sich zu
100% addieren. Es muss also stets gelten:
n
∑ qij = 1.
j=1
Die qi = (qi1, qi2, ..., qin) lassen sich zu einer Tabelle oder Matrix Q
zusammenfassen mit
q11
q21
q31
q12
q22
q32
q13
q23
q33
...
...
q1n
q2n
qn-1 n-1
qn n-1
qn-1 n
qn n
...
qn1
qn2
...
qn3
Tabelle 7
Es scheint angemessen, Q als Matrix der wechselseitigen Achtung zu bezeichnen.
Diese Bezeichnung erinnert an die Interpretation der Tabelle: Würde das
Individuum i entlang der Zeile i blicken, so fände es dort genau jene
Urteilskompetenzen, die es den Individuen in J als Maß der Achtung zuordnet.
Entlang der Spalte j findet sich die Achtung, die das Individuum j von den
anderen empfängt.
Es sind natürlich ganz unterschiedliche Verteilungen der wechselseitigen
Achtung im Kollektiv J denkbar. In einem Kollektiv J von sechs Individuen
könnte etwa eine Matrix gegenseitiger Achtung Q1 auftreten, die die folgende
Gestalt hat:
Q1 =
Jedes Individuum achtet nur sich selbst und genau ein anderes Individuum aus J
"positiv". Das bedeutet, dass es neben positiver Selbstachtung der eigenen
Urteilskompetenz eine positive Achtung der Kompetenz anderer Individuen gibt.
Diese direkte positive Achtung anderer drückt sich darin aus, dass es i, j ∈ J gibt
mit i≠j und qij > 0.
179
Gewichtet ein Individuum i nun die Wahrscheinlichkeitsurteile aller mit den von
ihm selbst angenommenen Kompetenzgewichten und addiert die Ergebnisse
dieses Prozesses, so erhält i
p'i = qi1 * p1 + qi2 * p2 + , ..., + qin * pn
oder unter Verwendung des Summenzeichens
n
p'i =
∑ qij * pj
.
j=1
Man überlegt sich leicht, dass p'i ein Wert zwischen 0 und 1 sein muss, da sich
die q-Werte zu 1 summieren und zugleich 0≤pj≤1 für alle j∈J gilt.
Es liegt nahe, p'i als eine "neue" Wahrscheinlichkeitsschätzung von i zu interpretieren. Jedenfalls hat i guten instrumentellen Grund, sich diese gewichtete
Summe der alten Wahrscheinlichkeitsschätzungen als Wahrscheinlichkeitsschätzung zu eigen zu machen. Denn i lässt in p'i die Schätzung jedes
Kollektivgliedes j genau mit dem Gewicht eingehen, das i selbst jedem
Urteilenden aus dem Kollektiv (einschließlich seiner selbst) zubilligen möchte.
Die neue Wahrscheinlichkeitsschätzung von i ergibt sich daraus, dass i die
Anfangsschätzung des ersten entsprechend dessen Anteil an der Gesamturteilskompetenz des Kollektivs in seine eigene neue Schätzung einbezieht. Dem fügt
er die Wahrscheinlichkeitsschätzung des zweiten Individuums genau mit dem
Gewicht hinzu, mit dem er das zweite Individuum an der
Gesamturteilskompetenz des Kollektivs beteiligt sieht. In gleicher Weise fährt er
mit dem dritten, vierten usw. fort.
Mit der Abkürzung
qi * p := qi1 * p1 + qi2 * p2 + , ..., + qin * pn
erhält man
p'i = qi * p .
Da das Argument, das hier für i benutzt wurde, für jedes j aus J in gleicher
Weise gilt, erhält man sogleich die verbesserten Schätzungen p'j:
p'1 = q1 * p =
q11 * p1 + q12 * p2 + , ..., q1n * pn
p'2 = q2 * p =
q21 * p1 + q22 * p2 + , ..., q2n * pn
180
.
.
.
p'n = qn * p =
qn1 * p1 + qn2 * p2 + , ..., qnn * pn .
Man bildet, um wiederum eine einfache Abkürzung der Schreibweise
einzuführen, das "neue" Profil von Wahrscheinlichkeitsschätzungen somit nach:
p' =
Dafür kann man bekanntlich stenographisch kurz schreiben:
p' = Q*p
Es scheint nun ziemlich nahe liegend, im Ausgang von diesem neuen Profil p'
die gleichen Überlegungen, die zum Übergang von p zu p' führten, erneut
anzustellen. Jeder hat ja nun eine neue Schätzung der Wahrscheinlichkeit
vorgenommen, die er durch erneute Anwendung des Argumentes von der
Verbesserbarkeit seiner individuellen Schätzung verbessern kann. Dazu hat er
erneut alle Werte p' mit der Kompetenz, die er jedem zubilligt, zu gewichten.
Man erhält sofort:
p''1 = q1 * p' =
q11 * p'1 + q12 * p'2 + , ..., q1n * p'n
p''2 = q2 * p' =
q21 * p'1 + q22 * p'2 + , ..., q2n * p'n
…
p''n = qn * p' =
qn1 * p'1 + qn2 * p'2 + , ..., qnn * p'n .
Das heißt:
p'' =
=Q*p'.
181
Analog könnte man nun die Bildung von p''' nach Q*p'' verlangen usw. Es gilt
für eine beliebige Anpassungsrunde t:
pt+1 = Q*pt .
Man mag sich nun fragen, ob Q stets so beschaffen sein muss, dass pt+1 ≠ pt gilt.
Das ist offenkundig nicht der Fall. Beispielsweise könnte man es mit einem
Kollektiv reiner "Urteils-Solipsisten" zu tun haben, von denen jeder nur sich
selbst als Beurteiler ernst nimmt. Jeder "gibt" Achtung nur an sich selbst und
erfährt Achtung nur durch sich selbst. Man erhielte dann für alle i,j∈J:
qjj = 1 und qij = 0, falls i≠j.
Man sieht sogleich, dass dann für alle i∈J gelten muss:
p'i = 0 + 0 + ... + qii * pi + 0 + ... + 0 = pi .
Solche Individuen haben keinen Grund, irgend etwas an ihren Urteilen
angesichts der Urteile der anderen zu verändern. Der Anpassungsprozeß der
Urteile ist von Beginn an in einem "Grenzzustand". Die Urteile bleiben
gleichsam, wo sie sind. Von der Situationslogik der Überzeugungsbildung her
ist das möglich. Niemand wird von dieser Logik gezwungen, die Urteile anderer
in seine eigene Urteilsbildung einzubeziehen.
Plausibel ist eine solipsistische Urteilsbildung vor allem dann, wenn die
Individuen davon ausgehen, dass alle relevanten Informationen kommunizierbar
sind und ihnen somit im Kommunikationsgleichgewicht bereits zugänglich
gemacht wurden. Wenn sie jedoch davon ausgehen, dass nicht alle Informationen kommunizierbar sind, sondern wesentliche Teile des im Kollektiv J
enthaltenen Wissens "impliziter" Natur sind, dann scheint es plausibel, diesem
Faktum durch eine Nachkorrektur der Schätzungen Rechnung zu tragen, bei der
es qij mit i≠j und qij > 0 gibt.
Auch bei nicht-solipsistischer Urteilsbildung dieser Art ist es jedoch möglich,
dass die Urteile nach einigen Anpassungsschritten oder nach Erreichen der
Anpassungsrunde t "bleiben, wo sie sind", und damit insofern ein "neues"
Gleichgewicht erreicht wird. Man erhält dann für alle Anpassungen, die sich in
Runden r>t vollziehen:
pt+1 =Q*pt=pt
pt+2 =Q*pt+1=pt+1
pt+3 =Q*pt+2=pt+2 usw.
182
Umgekehrt gilt für die t vorangehenden Veränderungen offenkundig
p1 =Q*p
p2 =Q*p1=Q*(Q*p)
p3 =Q*p2=Q*(Q*(Q*p)) usw.;
wobei p1≠ p2 ≠ p3.
Der Ausdruck Q*(Q*(Q*p)) legt die Frage nahe, ob man nicht zunächst
Q*(Q*(Q)) bilden und dann das Ergebnis dieser Operation auf p anwenden kann.
Wenn der Prozess zum Stillstand kommt, dann muss das nach dieser
Betrachtung mit den Eigenschaften von Q zusammenhängen. Denn dann würde
ja gelten (Q*)*p = p; mit Q*:= Q*(Q*(Q*(…))).
Kommt der Anpassungsprozeß jemals zum Stillstand? (Stillstand bedeutet, dass
sich für "hinreichend großes" t zwischen pt und pt+1 "nichts" mehr verändert; d.h.
zu jeder beliebig kleinen Spürbarkeitsgrenze π für Veränderungen kann man ein
t finden, so dass diese Änderungsgrenze unterschritten wird.) Unter welchen
Bedingungen erreicht der Urteilsanpassungsprozeß ausgehend vom Kommunikationsgleichgewicht ein umfassenderes Urteilsgleichgewicht als Grenzzustand
und kann man ggf. etwas über die Eigenschaften dieses Zustandes aussagen?
4.3.2. Die Frage nach dem Grenzverhalten
Die Frage nach einem Grenzwert von pt lässt sich rein formal umfassend beantworten. Die Überlegungen sind jedoch nicht nur von rein formalem Interesse.
Die dabei zu benutzenden formalen Bedingungen haben vielmehr eine
aufschlussreiche inhaltliche Dimension. Es lohnt sich deshalb, diesen
Bedingungen etwas genauer nachzugehen.
Die Betrachtung der direkten positiven Achtung in Q erfasst bei nicht völlig
solipsistischen Individuen offenkundig noch nicht alle möglichen interindividuellen Bezüge positiver Achtung. Wenn nämlich das Individuum i das
Individuum j positiv achtet und j das Individuum k, so sollte man annehmen,
dass sich die positive Achtung, die j für k empfindet, auch i vermittelt und zwar
genau in dem Maße, wie i das Individuum j positiv achtet.
Man hat
qij > 0 ∧ qjk>0 und damit
183
qij * qjk>0.
Die Implikationen diese Sachverhaltes macht man sich am besten am konkreten
Beispiel deutlich. Dazu betrachte man nochmals
Q1 =
.
Die Beispiel-Matrix Q1 hat, was die direkten Achtungsbeziehungen anbelangt,
eine sehr interessante Eigenschaft. Es gibt nämlich eine geschlossene Kette
positiver Achtung, die jedes Kollektivglied mit jedem anderen verbindet:
(1, 2) → (2, 3) → (3, 4) → (4, 5) → (5, 6) → (6, 1) mit
q12 > 0 q23 > 0 q34 > 0 q45 > 0 q56 > 0 q61 > 0; d. h.
q12 * q23 * q34 * q45 * q56 * q61 > 0.
Wir nennen eine solche Kette auch eine Kette ausnahmslos positiven Respektes.
Wenn eine solche Kette ausnahmslos positiven Respektes alle Individuen eines
Kollektives erfasst, dann hat diese Tatsache weit reichende Konsequenzen.
Wenn nämlich eine derartige Kette in einem Kollektiv gebildet werden kann,
dann lässt sich beweisen, dass alle Individuen implizit auf die gleichen
Kompetenzurteile nach einem Prozess vollständiger Korrektur der eigenen
Urteile festgelegt sind.
Im Beispiel der Matrix Q1 sind diese Urteile gegeben durch die "Grenzmatrix"
*
Q1 =
.
184
Diese Grenzmatrix erhält man durch eine fortgesetzte Multiplikation der Matrix
Q1 mit sich selbst, also durch Bildung von Q1 * Q1 * ...* Q1.
Q1 =
→
*
Q1 =
.
*
Die Grenzmatrix Q1 ist das Ergebnis eines fortgesetzten Urteilsanpassungsprozesses, bei dem alle indirekten Urteilsbezüge ausgeschöpft werden. Dabei
werden allerdings zunächst nicht die Wahrscheinlichkeitsschätzungen der
Individuen angepasst, sondern erst einmal die wechselseitigen Einschätzungen
der Urteilskompetenz jedes einzelnen Beteiligten. Denn es werden durch
fortwährende Multiplikation die Elemente Q "miteinander" gewichtet.
Das läuft aufgrund der Eigenschaften der Matrizenmultiplikation formal auf das
gleiche hinaus. Es lässt sich jedoch inhaltlich ebenfalls plausibel machen: Wir
haben eine Einschätzung, wie gut jemand (einschließlich unserer selbst) darin ist,
ein bestimmtes Problem zu beurteilen. Zugleich haben wir eine Schätzung dafür,
wie gut er darin ist, die Kompetenz anderer in der Problembeurteilung einzuschätzen.
Es ist möglich, zunächst die Qualität von Individuen als Problemlösern von
deren Qualitäten als Auswählern von Problemlösern zu unterscheiden. Es kann
ja etwa jemand kein guter Fachmann für die Lösung eines Problems sein und
zugleich fähig dazu, fähige Problemlöser aufzufinden. (In allen Prozessen der
Delegation von Entscheidungen ergeben sich solche Fragestellungen; aber auch
dann etwa, wenn ein Richter einen Gutachter bestellt.) Man kann überdies die
betreffenden Argumente Stufe um Stufe weiter treiben und die Kompetenz in
der Beurteilung der Kompetenz zur Auswahl von Problemlösern betrachten usw.
Man erhielte die Kompetenz erster, zweiter, dritter usw. Stufe.
Es dürfte allerdings ziemlich klar sein, dass diese Kompetenzzuweisungen im
allgemeinen schon auf sehr frühen Stufen von Stufe zu Stufe unverändert
bleiben werden. Im allgemeinen werden wir davon ausgehen, dass die Fachleute
selbst die besten Fachleute zur Beurteilung anderer sind und zwar umso mehr, je
bessere Fachleute sie sind. Im folgenden wird aus Vereinfachungsgründen
angenommen, dass diese Kopplung so stark ist, dass die Kompetenzurteile aller
185
Stufen identisch sind. Durch diese Annahme wird solange nichts wesentliches
ausgeschlossen, wie wir davon ausgehen können, dass sich die
Kompetenzschätzungen höherer Stufe jedenfalls von einem bestimmten Punkt
an von Stufe zu Stufe nicht mehr voneinander unterscheiden. Denn dann sind
alle nachfolgend vorgetragenen Argumente nach einem Vorlauf von endlich
vielen Multiplikationen mit wechselnden Matrizen – die die unterschiedliche
Kompetenz auf verschiedenen Stufen erfassen – für die schließlich nicht mehr
veränderlichen Urteile und damit eine konstante Matrix Q anwendbar.
Unter der vereinfachenden Voraussetzung von auf allen Stufen identischen qij
kann man nun die Frage nach dem möglichen Grenzverhalten eines
Beurteilungsprozesses vom Lehrer-Wagner-Typ, wenn er denn "im Geiste" über
beliebig viele Stufen durchgeführt würde, wieder aufnehmen.
Es ergab sich in unserem Beispiel schließlich eine Tabelle von
Kompetenzurteilen, die lauter identische Zeilen enthält. Das bedeutet: Wenn
jeder Beteiligte die Kompetenzurteile aller Individuen des Kollektivs J in seiner
Beurteilung der Kompetenz anderer vollständig berücksichtigen möchte, dann
ist er implizit mit allen anderen auf das gleiche Kompetenzurteil festgelegt,
sofern es nur eine Kette ausnahmslos positiven Respektes gibt, die alle
Individuen erfasst.
Geht man, wie zuvor beschrieben, davon aus, dass sich die direkte positive
Achtung als indirekte positive Achtung "transitiv" weiter vermittelt, dann sollte
man vermuten, dass in einem Kollektiv wie dem durch Q1 charakterisierten
Kollektiv J jeder jeden indirekt positiv achtet. Die Kompetenzurteile jedes
anderen sollten in die eigenen Kompetenzurteile mit dem Maß eingehen, in dem
man den anderen jeweils für kompetent hält. Dabei sei nochmals betont, dass
niemand gezwungen ist, anderen einen positiven Anteil an der
Gesamtkompetenz zuzuweisen. Wenn er es jedoch tut, dann ist es uneinsichtig,
dies nicht in transitiver Weise zu vollziehen.
Überdies sollte klar sein, dass es verschiedene Ketten indirekter positiver
Achtung geben kann, die je zwei verschiedene Individuen miteinander
verbinden und so zu einer sich wechselseitig überlagernden "transitiven
Achtungsübertragung" führen können. Außer dem Individuum k kommen ja
noch alle anderen n-1 Individuen aus J als Vermittler in Frage. Die nachfolgende
Übersicht zeigt alle derartigen Brücken an:
186
i→
i→
i→
1
→k
2
→k
3
→k
...
i → n-1
→k
i→ n
→k
Tabelle 8
Eine andere graphische Illustration ergibt sich als
Graphik 1
Dabei sollte man beachten, dass auch die Kette i→i→k gebildet wird. Das
Individuum i gewichtet auch sein eigenes Kompetenzurteil mit der Kompetenz,
die es sich selbst zuerkennt. Das scheint durchaus folgerichtig, wenn auch etwas
ungewohnt zu sein. Die Kompetenzeinschätzungen erster Stufe werden von i
genau in dem Maße für die Bildung einer besseren Kompetenzeinschätzung
zweiter Stufe berücksichtigt, wie es von den Schätzungen erster Stufe verlangt
wird.
Es ist notwendig, alle Ketten positiver indirekter Achtung zweiter Stufe, die
zwischen i und k überhaupt existieren können, systematisch zu erfassen. Das ist
in sehr einfacher Weise möglich, indem man alle Produkte der Art qij * qjk (i
achtet j und j achtet k) bildet. Die gesamte positive indirekte Achtung zweiter
Stufe ergibt sich dann durch Aufsummierung aller dieser Terme zu:
qi1 * q1k + qi2 * q2k + qi3 * q3k + .... + qi n-1 * qn-1 k + qin * qnk
Man definiert
187
(2)
qik := qi1 * q1k + qi2 * q2k + qi3 * q3k + .... + qi n-1 * qn-1 k + qin * qnk
Unter Verwendung des Summenzeichens kann man dafür auch schreiben:
n
(2)
qik = ∑ qij * qjk
j=1
und unter Beiziehung der vorangehenden stenographischen Abkürzungen erhält
man
(2)
qik = qi* qk
d. h., man nimmt die Werte aus der i-ten Zeile und der k-ten Spalte von Q – der
Matrix direkter Achtung – und nimmt sie termweise miteinander mal, um die
Ergebnisse dann aufzusummieren. Die Interpretation dieser Vorgehensweise
liegt auf der Hand:
In der i-ten Zeile von Q stehen jene Werte, mit denen i jedes der Individuen j
direkt achtet. Entlang der k-ten Spalte steht die Achtung, die Individuum k von
allen Individuen j empfängt. Das Individuum i bezieht die Achtung, die k von
allen Individuen empfängt, genau in dem Maße ein, in dem diese von i Achtung
empfangen. Die Summe vermittelter Achtungszuweisungen ergibt einen korrigierten Wert der Achtung von k durch i. Die Korrektur kommt dadurch zustande,
dass i den Respekt, den k von anderen empfängt, genau in dem Maße in seinem
eigenen Respekt für k berücksichtigt, in dem i selbst die vermittelnden
Individuen (einschließlich seiner selbst) als Kompetenzbeurteiler respektiert.
Man kann nun wiederum ein n-tupel von korrigierten Einschätzungen der
Kompetenz anderer durch das Individuum i∈J bilden. Dieses n-tupel oder diese
Liste ergibt sich zu:
q
i (2)
(2) (2) (2)
(2)
(2)
= (qi1 , qi2 , qi3 ,..., qi n-1 , qin )
= (qi * q1, qi * q2, qi * q3, ..., qi * qn-1, qi * qn)
Fasst man alle diese Listen zusammen, so erhält man Q
(2)
=
188
(2)
q11
(2)
q12
(2)
q13
(2)
q21
(2)
q22
(2)
q23
(2)
q31
(2)
q32
(2)
q33
...
...
(2)
q1n
(2)
q2n
...
(2)
qn1
(2)
qn2
(2)
qn3
...
(2)
qn-1 n-1
(2)
qn-1 n
(2)
qn n-1
(2)
qn n
Tabelle 9
Diese Tabelle oder Matrix gibt die Achtungskoeffizienten zweiter Stufe an, die
um alle indirekten Achtungsbeziehungen und die entsprechenden Korrekturen
der Ausgangsurteile ergänzt wurde.
Mit diesem Verfahren kann man nun fortfahren und in gleicher Weise Q
bilden.
(3)
Wie man sogleich sieht, muss man jede Zeile der Matrix Q(2) mit jeder Spalte
der Matrix Q multiplizieren. Man erhält die i-te Zeile der neuen Matrix Q(3) ,
indem man die i-te Zeile der Matrix Q (2) nacheinander mit q1, q2, ..., qn
multipliziert.
Wenn man das für alle Zeilen nacheinander durchgeführt hat, ergibt sich in
abkürzender Matrizenschreibweise insgesamt die Matrix Q (3) , was man in
stenographischer auch schreiben kann als
Q(3) = Q(2)
*
Q.
Allgemein erhält man als Bestimmungsformel für die indirekte Achtung t+1-ter
Stufe
Q(t+1) = Q(t)
*
Q.
Wenn es einen Grenzwert dieses Matrizenanpassungsprozesses gibt, für den
Q* = Q* Q gilt, dann kann man diesen verwenden, um aus einer Liste von
Anfangsurteilen p sogleich p* zu berechnen. Man braucht dazu nur
auszurechnen: p*=Q* p .
189
Merke
Da man formal beweisen kann, dass eine solche Grenzmatrix existiert, wenn
Bedingungen ausnahmslos positiven Respektes vorliegen, weiß man auch, dass
die Elemente des Vektors p* untereinander alle gleich sein müssen. Das
bedeutet, dass man unter Bedingungen ausnahmslos positiven Respektes auf
einen impliziten Konsens schließen darf, der durch die Lehrer-Wagner-Analyse
gleichsam an's Licht geholt werden kann.
Das gewonnene generelle Ergebnis kann man nun auf unser Ausgangsproblem
der landwirtschaftlichen Kooperative anwenden. Wenn die Matrix Q die
Bedingung ausnahmslos positiven Respektes erfüllt, dann ist ein Konsens im
Kollektiv angelegt. Die Anfangsschätzungen pi(X) der Individuen mögen zwar
auseinander laufen. Wenn alle Beteiligten jedoch neben dem Wissen über die zu
entscheidende Frage auch sämtliches Wissen über die Urteilsfähigkeit der
Beteiligten einbeziehen wollen und wenn eine geschlossene Kette von
Achtungsbezügen existiert, dann ist jeder implizit, mag er sich dessen auch nicht
bewusst sein, mit jedem einig, mit welchem Gewicht die jeweilige Anfangsschätzung eines Individuums i in das kollektive Urteil eingehen soll. Das
anfängliche Problem, dass man nicht weiß, welchem Urteil man in der
kollektiven Urteilsbildung folgen sollte, ist gelöst. Eine Abstimmung ist nicht
erforderlich.
Es ist auch nicht so, das die Individuen einen Kompromiss eingingen. Sie
verfolgen jeder das Ziel einer möglichst guten kollektiven Urteilsbildung, die
von ihren eigenen Urteilen hinsichtlich der Kompetenz jedes einzelnen ausgeht.
Man kann im Ergebnis dem Urteil jedes einzelnen folgen, da jeder in
Ausnutzung aller Informationen zu der gleichen Gewichtung aller Urteile
kommt. Dieser Konsens entsteht auf eine individualistische Weise, da er sich
aus den separaten Anstrengungen jedes einzelnen, alle Informationen auszunutzen, ergibt. Der Konsens ist insoweit nicht-kollektiver Natur.
Die inter-individuell einmütige korrigierte Wahrscheinlichkeitsschätzung ergibt
sich einfach daraus, dass die Anfangsschätzungen jedes einzelnen Individuums
mit den Gewichten aus Q* multipliziert werden. Für die Zeilen von Q* gilt
q*j = q*i . Jeder gewichtet die Anfangsschätzungen jedes anderen mit den
gleichen Gewichten und kommt damit zum gleichen Ergebnis
q*i
*
*
*
p = pi (X) = pj (X) = q*j
*
p = p*(X).
190
Damit ist das ursprüngliche Problem auf eine konsensuelle Weise gelöst. Der
von allen in dem Wunsche, alle Informationen auszunutzen, zu akzeptierende
Wahrscheinlichkeitsschätzwert ist p*(X).
Wie wichtig für diese Lösung die Bedingung ist, dass alle Beteiligten eine
ununterbrochene Kette ausnahmslos positiven Respektes bilden, kann man der
Betrachtung der nachfolgenden Beispielmatrix Q2 entnehmen:
Q2 =
Es gilt mit gewissen Rundungsfehlern
*
Q2 =
.
Hier zerfällt das Kollektiv offenkundig in zwei in den Urteilen gänzlich
getrennte Unterkollektive, die intern jeweils übereinstimmende Auffassungen
haben.
Würde nun nur das fünfte Individuum beginnen, das erste positiv zu achten, und
ergäbe sich daraus etwa
Q´2
=
;
dann würde das Endergebnis wiederum zu einem allgemeinen Konsens führen
mit:
*
Q´2
=
.
191
Man sieht, dass schon kleine Änderungen im wechselseitigen Respekt zu großen
Veränderungen in den entstehenden Konsens-Gewichten führen können. Das ist
sicher eine Schwäche einer derartigen Modellierung, sollte aber nicht daran
hindern, der Modellentwicklung noch etwas genauer zu folgen, da die Figur
eines sich auf individualistischer Grundlage einstellenden Konsenses in jedem
Falle höchste Aufmerksamkeit verdient. In einem nächsten Schritt werden wir
dazu neben der Beurteilungsdimension und wechselseitigen Schätzungen der
Beurteilungskompetenz auch die Bewertungsdimension einzubeziehen haben.
Bei der kollektiven Entscheidung über ein gemeinsames Projekt spielt neben der
Urteilsbildung über den wahrscheinlichen Lauf der Welt bzw. über die Wahrscheinlichkeit alternativer Weltverläufe ebenso wie in der individuellen
Entscheidungsfindung die Bewertung der Ergebnisse eine entscheidende Rolle.
Wie sind die alternativen Weltzustände zu bewerten? Darüber scheint ein
kollektiver Konsens noch schwerer zu erreichen als über die empirischen
Schätzungen von Wahrscheinlichkeiten. Die von Lehrer vorgeschlagene
Modellierung bietet hier einige zusätzliche interessante Einsichten.
4.3.3. Die Interessen- oder Nutzendimension
Neben der Einschätzung der Wahrscheinlichkeit muss sich die
landwirtschaftliche Kooperative, deren kollektives Entscheidungsverhalten uns
hier als Beispiel und Illustration dient, auch ein Bild über die Wertdimension
machen. Ist es besser, bei einem "kleinen Markt" Frucht A anstelle von Frucht B
angebaut zu haben? Wie schneiden A und eine weitere Alternative C bei jeweils
kleinem und großem Markt im direkten Vergleich aus Sicht der Mitglieder ab
usw.? Welche Entscheidung dient dem Wohl der Kooperative am besten?
Mit der Bewertungsfrage stellt sich gegenüber dem Problem der Wahrscheinlichkeitsschätzung ein zusätzliches Problem ein. An zutreffenden Schätzungen
über die voraussichtlichen Zustände der Umwelt müssen alle in gleicher Weise
interessiert sein. Jeder hat ein Interesse daran, das Wissen jedes anderen soweit
wie möglich zu nutzen. Hinsichtlich der wertmäßigen Einschätzung der
Ergebnisse scheint jedoch die Harmonie der Interessen von vornherein geringer
zu sein. Nicht unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliches Wissen,
sondern Wertkonflikte liegen an der Wurzel etwaiger Uneinmütigkeit. Deshalb
muss es zunächst als wenig aussichtsreich erscheinen, diese Konflikte durch
zusätzliche Informationen auszuräumen.
192
Auf derartige Probleme reagieren philosophische Theorien gern, indem sie das
Konzept überpersönlicher Gemeinwohlurteile bemühen. Diese Urteile kommen
zustande, wenn sich der Urteilende auf den Standpunkt eines "unparteiischen
Beobachters" stellt und von dort aus eine Alternativenbewertung versucht. Das
Konzept des Gemeinwohls wirft jedoch ungeachtet seiner Beliebtheit in den
Reden der Politiker und den Theorien der Philosophen bereits bei ganz
oberflächlicher Betrachtung eine Unzahl von Fragen auf. Ist es überhaupt
sinnvoll, von einem gemeinen Wohl zu sprechen, das eigenständig neben dem
Wohl der Individuen existiert? Ist es nicht ebenso sinnlos, die Existenz eines
Gemeinwohls zu unterstellen, wie es abwegig erscheint, einem Kollektiv eine
Präferenzordnung zuzuschreiben, die das "Kollektiv hat"? Was sind relevante
Bewertungsdimensionen? Wie soll das jeweilige Urteil über das kollektive Wohl
gebildet werden? Welche Rolle soll für das Gemeinwohl das Wohl der
Individuen spielen? Soll es allein vom individuellen Wohlergehen der
Kollektivglieder abhängen oder können auch anderweitige Bewertungsdimensionen einbezogen werden? Gibt es Faktoren, die dazu geeignet sind,
individuelle Gemeinwohlurteile zu vereinheitlichen? usw.
Eine sorgfältige analytische Behandlung derartiger Fragen würde ein eigenes
Buch erfordern – wenn dazu ein Buch ausreichte. Im folgenden ist es allein
möglich, zu skizzieren und exemplarisch zu studieren, wie ein Modell wie das
von Lehrer und Wagner mit derartigen Fragen umzugehen sucht.
4.3.3.1. Gemeinwohlbezogene Nutzenurteile
In Lehrer-Wagner- ebenso wie in anderen noch zu skizzierenden Modellen,
kann die Frage, ob es denn nun tatsächlich so etwas wie ein Gemeinwohl gibt,
durchaus offen bleiben. Solange man annehmen darf, dass es jedenfalls
"individuelle Gemeinwohlurteile" gibt, ist von diesen auszugehen. Mag ihnen
auch eine fundamental irrtümliche Existenzannahme zugrunde liegen, diese
Urteile existieren jedenfalls und sie sind motivational wirksam. De facto geben
menschliche Individuen immer wieder Urteile über kollektives Handeln ab, für
die sie eine überpersönliche Geltung beanspruchen. In der Abgabe dieser Urteile
beanspruchen sie, über ihr persönliches Wohlergehen hinaus, das Wohl der
Gesamtheit im Auge zu haben.
Es ist durchaus möglich, dass die Individuen dabei mannigfachen
Selbsttäuschungen unterliegen. Partikuläre Individualinteressen werden sich
fortwährend in vorgeblich ausschließlich gemeinwohlorientierten Urteilen
niederschlagen. Die Tatsache jedoch, dass sich die partikulären Interessen als
193
gemeine Interessen "maskieren", sollte uns nachdenklich stimmen. Sie deutet
bereits darauf hin, dass die öffentliche Auseinandersetzung über kollektives
Handeln bestimmte Normen enthält und unter Bedingungen stattfindet, die eine
Berücksichtigung des Gemeinwohls verlangen. Es gibt erstens Anforderungen
der Öffentlichkeit, die eine nicht nur auf persönliche Interessen zurückgreifende
Begründung für die wertmäßige Einordnung der Ergebnisse kollektiven
Handelns erzwingen. Hinzu tritt zweitens, dass Kollektive sich immer wieder
externen Bewertungen der Ergebnisse ihres Handelns ausgesetzt sehen, die eine
einheitliche interne Bewertung durch die Kollektivglieder nahe legen.
Beides lässt sich wiederum am konkreten Beispiel der landwirtschaftlichen
Kooperative in elementarer Weise illustrieren: Die Diskussion über die
Anbauentscheidung in der Kooperative wird unter der Nebenbedingung
gemeinsamer Zielverfolgung geführt. Es würde im allgemeinen als "Stilbruch"
empfunden werden, wenn etwa ein Mitglied seine Vorschläge für kollektives
Handeln einfach damit begründen würde, dass bestimmte Maßnahmen seinen
persönlichen Interessen besser dienen als andere. Wer jemals an Sitzungen
irgendeines Gremiums mit kollektiver Entscheidungskompetenz teilgenommen
hat, wird die Erfahrung gemacht haben, dass der offen für die eigenen Interessen
argumentierende Teilnehmer, dadurch sein Interesse schädigt. Das Vorbringen
von erfolgreichen Argumenten mag zwar von persönlichen Interessen motiviert
sein, doch ist der argumentationsstrategische Wert dieser Argumente wesentlich
davon abhängig, dass sie in ihren Begründungen gerade nicht nur auf persönliche Interessen, auf das bloße Faktum, dass jemand etwas will, Bezug nehmen.
Wenn in der landwirtschaftlichen Kooperative über den Anbau des nächsten
Jahres entschieden wird, dann werden die Argumente dafür, bestimmte
kollektive Bewertungen vorzunehmen, deshalb immer wieder auf das "Wohl des
Ganzen" Bezug nehmen und damit als individuelle Gemeinwohlurteile auftreten
müssen, mag die Bezugnahme selbst auch letztlich anderweitig motiviert sein.
Diese Bezugnahme ist überdies wegen der externen Bewertungen, denen sich
das betreffende Kollektiv durch die Abnehmer auf den Absatzmärkten
konfrontiert sieht, weit weniger willkürlich, als man zunächst meinen mag.
Dadurch nämlich, dass der Erlös der Ernte der Kooperative insgesamt zufließt,
ergibt sich ein sehr starkes gemeinsames Interesse. Jedenfalls dann, wenn jeder
lieber mehr Einkommen als weniger erhält und wenn das Einkommen jedes
einzelnen wächst, wenn das kollektive Einkommen wächst, liegt insoweit eine
Interessenharmonie vor. Die kollektive Einkommenserzielung wird zu einem
kollektiven Gut der Kooperative, an dessen Bereitstellung alle weitgehend in
gleicher Weise interessiert sind. Da "Wohl und Wehe" der Kooperative
194
insgesamt und jedes der Mitglieder davon abhängen, wie erfolgreich die
Kooperative am Markt operiert, wünscht sich jeder ein möglichst erfolgreiches
Abschneiden im Sinne der externen Marktbewertung durch die späteren Käufer
der Güter der Kooperative. Insoweit haben alle Individuen einen Anreiz, in der
Urteilsbildung auf die gleichen, allen gemeinsam von außen vorgegebenen
Bewertungen abzustellen, die sich einfach aus den erwarteten Marktpreisen und
Umsätzen ergeben.
Trotzdem ergibt sich die kollektive Bewertung der Handlungsalternativen nicht
durch eine einfache Bestimmung des "monetären Erwartungswertes", da
insbesondere die Einstellung zum Risiko berücksichtigt werden muss. Hier
können nach wie vor gravierende inter-individuelle Unterschiede unter den
Kollektivgliedern bestehen. Selbst dann, wenn man eine zuverlässige Schätzung
für den zu erzielenden Erlös bei einem großen bzw. bei einem kleinen Markt hat,
muss der "Wert" des jeweiligen Erlöses in der kollektiven Werthierarchie
bestimmt werden. Das erfordert eine Beurteilung. Und das Ergebnis dieser
Beurteilung kann selbst dann inter-individuell verschieden sein, wenn alle
Individuen je für sich mit Abgabe des Urteiles nicht ihre persönlichen
Präferenzen, sondern ihre Einschätzung des Gemeinwohls zum Ausdruck
bringen wollen.
Selbst dann also, wenn jeder Beteiligte ausschließlich ein überpersönliches oder
unparteiisches Urteil bilden möchte, bleibt es möglich, dass die
überpersönlichen Urteile zwischen den Individuen variieren. Damit stellt sich
erneut die Konsensfrage.
4.3.3.2. Die Aggregation von individuellen Gemeinwohlurteilen
Wie zuvor ist es auch jetzt hilfreich, mit einer Kompetenzmatrix zu operieren.
Sei diese Matrix von individuellen Einschätzungen der Beurteilungskompetenz
in Wertbzw. Moralfragen mit M bezeichnet. (Zu unterscheiden von der Matrix
Q der Urteilskompetenz in Wahrscheinlichkeitsfragen.) Diese Matrix enthält in
der i-ten Zeile jene Werte, mit denen das i-te Individuum alle Individuen des
Entscheidungskollektivs einschließlich seiner selbst an der kollektiven
Gesamtkompetenz zur Fällung eines Gemeinwohlurteiles beteiligt sieht.
Individuen, die beispielsweise selbst an die Wahrheitsfähigkeit oder doch
zumindest die intersubjektive Prüfbarkeit von Gemeinwohlurteilen glauben und
ein möglichst gutes Gemeinwohlurteil bilden wollen, haben zunächst einmal
guten Grund, die das Gemeinwohl betreffenden Fragen in einem kollektiven
195
"Diskurs" auszudiskutieren. Sie werden das "Für und Wider" der Alternativen
solange erwägen, bis auf argumentativem Wege nichts mehr zu erreichen ist. Im
diskursiven Gleichgewicht des Gemeinwohldiskurses ist – wie zuvor im Falle
der Wahrscheinlichkeitsbeurteilung – durch weiteren Austausch von
Argumenten der Grenzertrag diskursiver Aktivitäten "gleich null".
Der Zustand des diskursiven Gleichgewichtes muss keineswegs ein Zustand des
Konsenses sein. Auch Individuen, die sämtlich darin übereinstimmen, ein
möglichst gutes Gemeinwohlurteil abgeben zu wollen, können weiterhin sehr
unterschiedliche Auffassungen darüber haben, worin das Gemeinwohl liegt. Sie
verfügen über unterschiedliche Kenntnisse und Urteilsfähigkeiten. Insbesondere
verfügen sie auch über "stille Kenntnisse", die nicht im Diskurs kommuniziert
werden können. Denn sie haben je eigene Erfahrungen und Einschätzungen.
Individuen, die alles dies wissen und zugleich wollen, dass ein möglichst gutes
kollektives Gemeinwohlurteil auf der Basis aller verfügbaren Informationen
gebildet wird, haben Grund, die Matrix M der inter-individuellen Bezüge in ihre
Betrachtungen einzubeziehen und den Versuch zu unternehmen, unter Einsatz
dieser Matrix jeweils zu einem verbesserten Urteil zu gelangen, das sie sich
dann als ihr Gemeinwohlurteil zu eigen machen.
Die Argumentation verläuft nun in genau analoger Weise wie zuvor. Ausgehend
von der Matrix M der Beurteilungskompetenz erster Stufe oder der Matrix
direkter Achtung für die Beurteilungskompetenz anderer wird eine Matrix M(2)=
M*M der Achtung zweiter Stufe gebildet usw. Sofern eine Grenzmatrix mit
M*=M* * M
existiert, ändert sich durch weitere Anpassungsschritte nichts mehr. Diese
Matrix gibt die "optimal" angepassten Werte der Individuen an. Wenn die
Matrix lauter gleiche Zeilen enthält, was wiederum genau dann der Fall ist,
wenn sich eine geschlossene Kette ausnahmslos positiver Achtung in einer der
Matrizen der Achtung t-ter Stufe bilden lässt, sind die Individuen in ihren
"Nutzenbewertungen" über den Alternativen auf eine gleiche Einschätzung
festgelegt. Man erhält aus den ursprünglichen Nutzeneinschätzungen der
Individuen ui(X) für die Alternative X die neuen konsensuellen Schätzungen
*
*
*
*
*
u*(X)= mi1 * u1(X) + mi2 * u2(X) + mi3 * u3(X) + ... + min-1 * un-1(X) + min * un(X)
*
*
*
*
*
= mj1 * u1(X) + mj2 * u2(X) + mj3 * u3(X) + ... + mjn-1 * un-1(X) + mjn * un(X),
196
die für alle i, j ∈ {1, 2, ..., n}=J identisch sind, da die Matrix M* lauter
identische Zeilen enthält.
Insgesamt kann man somit – bei Vorliegen ausnahmslos positiver Achtung
entlang der Beurteilungs- wie der Bewertungsdimension – unter Einbeziehung
der konsensuellen Wahrscheinlichkeitsurteile konsensuelle Werterwartungen
bilden nach:
p*(X) * u*(X).
Führt man derartige Prozesse für verschiedene kollektive Ergebnisse X1, X2, ...,
Xr durch, so kann man offenkundig für kollektive Lotterien L, welche als
Ergebnisse kollektiven Handelns gewählt werden, die konsensuellen
Erwartungswerte berechnen zu (auf die schwierigere Frage, wie hier zu sichern
ist, dass die p*-Werte sich wiederum zu "1" summieren, kann hier nicht
eingegangen werden):
EU(L)=p*(X1) * u*(X1) + p*(X2) * u*(X2) + ... + p*(Xr-1) * u*(Xr-1) + p*(Xr) * u*(Xr)
Für eine Lotterie L´ über den Preisen Y1, Y2, ..., Yk erhält man dementsprechend
EU(L´)=p*(Y1) * u*(Y1) + p*(Y2) * u*(Y2) + ... + p*(Yk-1) * u*(Yk-1) + p*(Yk) * u*(Yk).
Zu einem kollektiven Vergleich zwischen den Lotterien L und L´ gelangt man,
indem man einfach die Erwartungswerte von L und L´ miteinander vergleicht.
Dieser Vergleich zeigt an, wo in der "kollektiven Präferenzordnung" zwischen
Lotterien die Alternativen L und L´ jeweils ihren Platz haben. Ein kollektives
Handeln, das auf eine nach übereinstimmenden individuellen Gemeinwohlurteilen "beste" kollektive Handlung abzielt, besitzt damit ein klares Kriterium für
Bevorzugung: Jene kollektive Handlung ist zu wählen, die zu einer Lotterie mit
einem nach den "Konsenswerten" maximalen Erwartungswert führt.
Damit scheint man letztlich eine vollständige Analogie zwischen kollektiven
und individuell rationalen Entscheidungen hergestellt zu haben, ohne auf eine
genuin kollektive Entscheidung zurückgreifen zu müssen. Denn die kollektive
Entscheidung kommt einfach dadurch zustande, dass alle Individuen je für sich
eine gleichgerichtete Entscheidung befürworten. Das gilt jedenfalls dann, wenn
Bedingungen wie etwa die Existenz einer Kette ausnahmslos positiven
Respektes, und Zielgleichheit in dem Wunsch, ein möglichst gutes kollektives
Ergebnis zu erreichen, erfüllt sind. Diese Bedingungen müssen natürlich in der
Realität keineswegs erfüllt sein. Wenn sie jedoch erfüllt sind, so ergeben sich
197
unter gewissen Zusatzannahmen über die Achtungskoeffizienten höherer Stufe
die aufgezeigten Folgerungen über die Existenz eines impliziten Konsenses.
4.3.4. Einige abschließende Beobachtungen zu Lehrer-Wagner-Modellen
Das von Lehrer und Wagner vorgeschlagene Verfahren ist voraussetzungsreich.
Es setzt da an, wo uns die herkömmlichen Diskurs- und Konsenstheorien hinter
einem Schleier schöner Worte letztlich allein lassen. Denn dadurch, dass sie sich
darüber ausschweigen, wie es real zu einem Konsens kommen kann, wird das
Verhalten von Anhängern der Theorien des idealen Konsenses nicht
annehmbarer. Der fiktive Konsens, von dem sie reden, ist nur die Maskierung
einer Theoriebildung, die am Ende mit Konsens nichts zu tun hat.
Das Ideal des Konsenses werden die meisten unterschreiben. Natürlich ist es
wünschenswert, im Konsens zu handeln, wenn man denn einen Konsens haben
kann. Da man den Konsens aller, der in der Vertrags- ebenso wie in der
Diskurstheorie unterstellt wird, aber de facto nicht erreichen kann, muss man
etwas über die Frage sagen, was man denn tun will, wenn es am Ende eines
Diskurses keinen Konsens gibt. Wie geht es dann konkret weiter? Die Anhänger
von
Habermas
ebenso
wie
die
meisten
modernen
Gesellschaftsvertragstheoretiker behelfen sich mit dem Instrument eines fiktiven
Konsenses, wo von Konsens gerade keine Rede sein kann. Der fiktive Konsens
ist nur einer von fiktiven Individuen. Da die realen Individuen sich gerade nicht
im Konsens miteinander und auch nicht mit dem Inhalt des vorgestellten
Konsenses der vorgestellten, fiktiven Individuen befinden, wird ihnen oder doch
zumindest einigen von ihnen das, was man als Konsens bezeichnet, real
aufgezwungen.
Es ist keine Lösung des Problems des Zwangs, wenn man dessen Vorhandensein
einfach leugnet. Es ist sogar ziemlich unannehmbar, auf der Verschleierung der
Tatsache zu bestehen, dass notwendig gegen Willen oder Interessen einiger
gehandelt wird. Viel ehrlicher wäre es, einzugestehen, dass de facto in praktisch
allen Fragen von ethischem Belang, unterschiedliche Interessen ein Rolle
spielen und ein Konsens de facto gerade nicht erreicht wird. Es wäre nicht nur
ehrlicher, sondern würde zu einer besseren Theorie und vermutlich auch
besserer Praktiken führen. Das Prinzip, es solle
„(j)ede gültige Norm der Bedingung genügen, dass die Folgen und
Nebenwirkungen, die sich jeweils aus ihrer allgemeinen Befolgung für
die Befriedigung der Interessen eines jeden einzelnen (voraussichtlich)
198
ergeben, von allen Betroffenen akzeptiert (und den Auswirkungen der
bekannten alternativen Regelungsmöglichkeiten vorgezogen) werden
können,“
drückt zwar ein Ideal aus. Doch ist dieses Ideal so unerreichbar, dass es einer
Irreführung gleichkommt, wenn es als Norm zur Anleitung realer Praxis
propagiert wird. Individuen, die dieses Ideal unterschreiben, werden
typischerweise keinen realen Konsens darüber erreichen können, worüber sich
alle einig werden könnten und welche Normen von allen akzeptiert werden
könnten. De facto sind sie sich nicht einig und auch nicht darüber, was unter
idealen Bedingungen der Inhalt der Einmütigkeit sein sollte. Wie Diskurs- und
Konsenstheoretiker angesichts dieser desolaten Lage der Konsenstheorie zugute
halten können, dass sie für den Konsens und die Freiwilligkeit eintreten, ist
schwer nachzuvollziehen. Wenn sie den Zwang, den sie de facto legitimieren,
zur Freiwilligkeit ehrenhalber umdeuten, gewinnen sie nichts. Indem man
einfach einen fiktiven Konsens fiktiver Individuen erfindet, bringt man den real
stets bestehenden Dissens nicht zum Verschwinden.
Es ist gewiss ein ehrenhaftes ethisches Ideal, möglichst niemandem etwas
aufzuzwingen. Am Ende ist dieses schöne Ideal aber völlig unrealisierbar und
Handeln unter Bedingungen des Dissenses unvermeidbar. Ethik muss daher vor
allem damit befasst sein, Normen zu entwickeln, wie man verantwortungsvoll
mit dem Dissens umzugehen hat. Wer sich hier auf fiktive Einmütigkeit beruft,
ist nicht bereit, das ethische Kernpoblem zu akzeptieren. Er weicht ihm aus,
indem er die Notwendigkeit, im Dissens zu handeln, leugnet. Er verniedlicht das
Problem des Dissenses durch Einführung eines fiktiven Konsenses auf eine
Weise, die ein verantwortliches und bewusstes Umgehen mit dem ethischen
Kernproblem erschwert. Man muss de facto immer auch ohne Zustimmung und
unter Umständen gegen bestimmte Interessen anderer handeln. Es geht darum,
dies auf ethisch verantwortbare Weise zu tun.
Wer ethisches Handeln so darstellen will, als sei es ausschließlich konsensuell,
der erkennt die eigentliche ethische Verantwortung nicht an. Das LehrerWagner-Verfahren versucht aus dieser Situation gleichsam das beste zu machen.
Man sollte sich deshalb hüten, einem relativ konkreten Verfahren realer
Konsensbildung das explizite Anerkenntnis fehlenden diskursiven Konsenses
schlecht zu schreiben. Der große Vorzug von Lehrer-Wagner-Verfahren ist
deren explizite Anerkennung argumentativen Dissenses. Ausgehend von diesem
diskursiven Dissens suchen sie in einer Art formaler Mediation einen Ausgleich
vorzuschlagen. Was soll man bzw. was kann man noch tun, wenn man alle
199
Argumente ausgetauscht hat und immer noch kein Konsens erreicht ist? Gibt es
wirklich etwas, was gutwillige Teilnehmer an einem Diskurs „immer
schon“ akzeptiert haben und das man nun ausnutzen kann, um ihnen mit einem
Argument einen impliziten Konsens, der in den je eigenen Positionen angelegt
ist, nahe zu bringen?
Mit den Lehrer-Wagner-Modellen werden individuelle Wahrscheinlichkeitsund Gemeinwohlurteile abgeleitet, die die angenehme Eigenschaft haben, für
alle Individuen überein zu stimmen und insofern einen kollektiven Ausgleich
zwischen widerstreitenden individuellen Ansichten überflüssig zu machen
scheinen. Diese angenehme Eigenschaft wird allerdings durch einige heroische
Annahmen erkauft. So muss man etwa davon ausgehen, dass das Konzept von
Beurteilungsfähigkeiten beliebig hoher Stufe sinnvoll ist. Man muss annehmen
dürfen, dass man Individuen sinnvoll die Fähigkeit zuschreiben darf, den
Prozess "rationaler Deliberation" über beliebig viele Stufen voranzutreiben,
indem sie jeweils die Kompetenz zur Beurteilung der Kompetenz, zur
Beurteilung der Kompetenz etc. "imaginieren".
Da das Vorstellungsvermögen endlicher Wesen endlich ist, scheint diese
Voraussetzung zunächst ziemlich zweifelhaft. Im Falle der Modelle von Lehrer
und Wagner könnten Individuen, die von dem Grundgedanken des Modells
überzeugt sind, argumentieren, dass sie zwar selbst nicht in der Lage sind, den
betreffenden Prozess der Überzeugungsbildung über beliebig viele Stufen zu
durchlaufen. Zugleich könnten die Individuen jedoch davon ausgehen, dass es
sinnvoll ist, anzunehmen, dass die Kompetenzurteile höherer Stufe jenseits der
höchsten Stufe t, die sie sich unter einer Grundanstrengung ihrer
Einbildungskraft noch sinnvoll vorzustellen vermögen, in jedem Falle konstant
werden. Sie wissen dann aus der Analyse des Lehrer-Wagner-Modells, was sie
tun würden, wenn sie den Prozess unter Zugrundelegung der schließlich
konstanten Koeffizienten wechselseitiger Achtung als vollständig rationale
Wesen endlos durchlaufen könnten. Zugleich wissen sie jedoch auch, dass sie
selbst die endlose Wiederholung gar nicht durchzuführen brauchen. Sie können
diese dem Algorithmus, dem sie ihre Achtungskoeffizienten und ihre Anfangsschätzungen eingeben, überlassen. Auf diese "Eingebung" hin liefert der
Algorithmus, der dazu nur eines einfachen Computerprogrammes zur Matrizenmultiplikation bedarf (man könnte das Problem auch auf eine andere Weise
lösen; doch ist das hier nicht von Interesse), im günstigen Fall eine Matrix
konsensueller Werte bzw. gleich die interindividuell gleich lautenden und
insofern "kollektiven" Wahrscheinlichkeits- und Nutzenschätzungen. Diese
200
Werte machen sich die Individuen in ihrem Interesse an möglichst rationalem
Entscheidungsverhalten zu eigen.
Dort, wo es nicht nur um das, was in einer idealisierten Modellwelt rational
wäre, geht, würden beispielsweise sogleich Anreize entstehen können, die
eigenen Achtungskoeffizienten nicht "ehrlich" bekannt zu geben. Die
Voraussetzung des Modells, dass alle Beteiligten ein gleichgerichtetes Interesse
daran nehmen, "möglichst gute Urteile" über ein gemeinsames Ziel abzugeben,
wird in der Praxis häufig nicht erfüllbar sein. Überdies trägt diese Annahme
auch nicht der Möglichkeit Rechnung, dass Individuen davon ausgehen könnten,
dass Gemeinwohlurteile, selbst dann nicht sinnvoll sind, wenn sie von
Individuen abgegeben werden. Zwar wird durch die vorgeschlagene
Konstruktion die Annahme eines Urteiles, das vom Kollektiv als ganzem gefällt
wird, vermieden. Nicht vermieden wird jedoch die Voraussetzung eines
unparteiischen individuellen Urteiles über "Richtig und Falsch" in kollektiven
praktischen Angelegenheiten. Skeptiker könnten deshalb einwenden, dass es gar
nicht sinnvoll sei, neben den persönlichen Bevorzugungsurteilen, die die
Individuen ohnehin in Form ihrer persönlichen Präferenzen bilden, noch Urteile
von einem überpersönlichen Standpunkt aus einzuführen. Letztlich gehe es
immer nur um die strategische Verfolgung individueller Interessen. Das ist aber
schon deshalb verfehlt, weil unserer Überzeugungen davon, worin unser
Interesse liegt, ebenso wie unsere darauf aufbauenden Präferenzen nicht fest
gegeben, sondern im gesellschaftlichen Prozess der Kommunikation und
Interaktion geformt werden. Die Präferenzen sind nicht wirklich exogen,
sondern zum großen Teil endogen gegenüber den gesellschaftlichen
Institutionen.
201
V. Kurze Schlüsse
1. Loyalität und Widerspruch
Einerseits gibt es in unserer Kultur die christliche Tradition, wonach wir am
Ende nur dem eigenen Gewissen verpflichtet sein sollten. Andererseits muss
sich jeder von uns immer wieder mit seinen Urteilen dem Urteil anderer
unterordnen. Dem Ideal der moralischen Urteilsautonomie des einzelnen auf der
einen stehen die Notwendigkeiten der Bindung und Loyalität gegenüber
übergreifenden Normen auf der anderen Seite entgegen.
Loyalität gegenüber einem Wertsystem bedeutet wesentlich, dass man die
eigene Urteilsautonomie jedenfalls teilweise suspendiert. Selbst dann, wenn man
sich das letzte Urteil über die Legitimität von Anforderungen vorbehält oder
wenn man der Auffassung ist, dass man sich der moralischen Verantwortung für
sein eigenes Handeln auf letzter oder höchster moralischer Beurteilungsebene
nicht entziehen kann, wird man vorherrschenden Wert- bzw. Normsystemen
eine „prima facie“ Verbindlichkeit zuerkennen müssen.
Die Menschen handeln nicht nur als isolierte Individuen, sondern als Mitglieder
von Vereinigungen. Sie sind Mit-Täter im koordinierten Handeln korporativer
Akteure. Für ihr gemeinsames Handeln ist es erforderlich, dass sie den
Steuerungs-Signalen, die das Handeln koordinieren, folgen. Es scheint dazu
erforderlich zu sein, dass sie die Regeln nicht nur äußerlich beachten, sondern
sich die grundlegenden Werte der gemeinschaftlichen Institutionen als
Grundlage des gemeinschaftlichen Handelns zu eigen machen.
Große Parteien in politischen Demokratien benötigen beispielsweise ein
gewisses Maß an Parteidisziplin und damit letztlich Loyalität und
Legitimitätsüberzeugungen von Mitgliedern. Kein Rechtssystem kann
vernünftig arbeiten, wenn nicht die Mitglieder des Rechtsstabes bereit sind, ihre
eigenen Handlungspräferenzen zumindest teilweise den Vorgaben der
Rechtsordnung zu unterstellen. Sie müssen sich dazu dem Recht in der Haltung
nähern, erst einmal herauszufinden, was das System rechtlicher Normen
verlangt und nicht was in erster Linie sie selbst oder die von ihnen akzeptierten
ethischen Theorien für richtig halten. Der Pflicht zum Handeln nach bestem
Wissen und Gewissen, von der sich ein moralisch autonomer Akteur nie
freisprechen kann, geht die Pflicht voraus, erst einmal nach bestem Wissen und
Gewissen zu bestimmen, was die jeweils relevanten Normordnungen und hier
vor allem die Normordnung des Rechts verlangen.
202
Etablierte Normordnungen erlegen uns bestimmte prima facie Verpflichtungen
auf. Loyalität gegenüber den etablierten Normen müssen nicht alle Beteiligten
zu allen Zeiten in vollem Umfang zeigen, jedoch zu jedem Zeitpunkt müssen
hinreichend viele hinreichend einflussreiche Individuen sich so verhalten, wenn
eine funktionierende Normordnung insbesondere rechtlicher Natur existieren
soll. Die Angehörigen einer Wohlfahrtsorganisation etwa werden häufig auch
unterschiedliche persönliche Auffassungen darüber haben, welche Hilfsprojekte
vor anderen Priorität haben sollten. Am Ende werden sie ihre eigene
Urteilsautonomie in diesen Fragen Steuerungs-Signalen der Führung der
Wohlfahrtorganisation unterordnen müssen, wenn gemeinsames Handeln der
Wohlfahrtsorganisation möglich sein soll. Das gleiche gilt selbstverständlich
auch für solche korporativen Akteure wie Wirtschaftsunternehmen. Kein
Unternehmen kann erfolgreich agieren, wenn sich seine Mitarbeiter nicht bis zu
einem gewissen Grade den im Unternehmen gegebenen Steuerungs-Signalen
unterstellen und diesen eher als ihren eigenen (moralischen) Maßstäben folgen.
Es geht dabei gerade nicht nur um äußere Anreizes, sondern es bedarf einer
gewissen Identifikation mit den Unternehmenszielen selber, wenn wirklich
erfolgreich unternehmerisch gehandelt werden soll.
„Corporate governance“, so könnte man in freier Abwandlung der vielleicht
fundamentalsten Einsicht der politischen Philosophie sagen, „is based on
opinion only“ (vgl. Hobbes, T. (1682/1990), 16, Hume, D. (1777/1985), essay
iv). Nach dieser Einsicht, die die Grundlagen aller menschlicher Organisation
betrifft, sind die Legitimitätsüberzeugungen und die Loyalität der Mitarbeiter
ein zentraler Faktor der Unternehmensorganisation. Aufgrund solcher
Überzeugungen müssen Mitarbeiter häufig ihre eigene Urteilsautonomie
übergeordneten gemeinsamen Werten und Normen des Unternehmens loyal
unterstellen. Jedes Unternehmen steht vor der Aufgabe, diese Art von Loyalität
zu fördern und zu unterstützen. Der Zusammenhalt im Unternehmen gegenüber
anderen, konkurrierenden Unternehmen wird auf diese Weise gesichert und die
Abläufe im Unternehmen selbst werden durch Identifikation und Loyalität
offenkundig reibungsloser. Eigenständige wirtschaftsethische Überlegungen
einzelner Mitarbeiter müssen demgegenüber als störendes Element erscheinen.
Zunächst sind nur Vorteile einer loyalen Identifikation mit einem Unternehmen
ersichtlich. Kontraindikationen für die Pflege jener Mechanismen, die die
Loyalität und Identifikation mit Unternehmenszielen fördern, scheinen nicht zu
existieren. Auf den zweiten Blick, erkennt man jedoch unmittelbar, dass wie
alles im menschlichen Leben, auch die Loyalität und Identifikation mit
Gruppenzielen neben einer lichten eine Schattenseite aufweist. Gerade gut
203
funktionierende Unternehmen laufen die Gefahr, dass Mitarbeiter der jeweiligen
Führung oder dem Unternehmen als ganzem gegenüber einer zu weit gehende,
manchmal geradezu bedingungslose Loyalität zeigen. Das kann nicht nur
moralisch bedenkliche Folgen haben, sondern letztlich dem langfristigen
Interesse des Unternehmens widersprechen.
Hätte beispielsweise bei der Firma Enron jemand der Führung früh und
nachhaltig widersprochen wäre das Unternehmen vielleicht nicht in gleicher
Weise gewachsen, aber auch einer der größten Betrugsskandale der
Wirtschaftsgeschichte vermieden worden. Hätte in der prüfenden Firma Artur
Andersen sich jemand eher aus ethischen Gründen gegen die Kollaboration mit
Enron aufgelehnt, wäre es womöglich nicht zu den späteren Problemen
gekommen. Dazu hätte es aber, da einzelne Akteure gewöhnlich marginalisiert
werden, einer Kultur des legitimen Widerspruchs geben müssen. Auf der
anderen Seite kann man Unternehmen weder mit rebellischen Mitarbeitern, die
alle ihren je eigenen moralischen Sichtweisen und nur ihrem Gewissen folgen
wollen, führen, noch mit einer Unternehmenskultur, die zu sehr zum
Widerspruch ermutigt..
Man steht vor einem komplexen Gleichgewichtproblem, bei dem man
Unterordnung unter die Erfordernisse gemeinsamen Handelns mit einem
gewissen Maß an Widerspruchsbereitschaft kombinieren muss (vgl. klassisch
hierzu Hirshman, A. O. (1990)). Gut geführte Unternehmen müssen ebenso wie
gut organisierte Gesellschaften für Widerspruch bis hin zu „Illoyalitäten“ Raum
schaffen. Soweit das möglich ist, ohne die Funktionsfähigkeit der jeweiligen
Organisation zu gefährden, liegt die Einräumung solcher Spielräume im
Interesse des Unternehmens. Gleichwohl bleibt es eine delikate Aufgabe, hier
die Balance zwischen verschiedensten Anforderungen zu halten. Wir brauchen
als Unternehmen wie als Individuen immer beides, Loyalität und Widerspruch.
Wir benötigen die Fähigkeit zur Bindung und die Fähigkeit zu ungebundenem
Handeln. Das zeigt sich auch auf einer noch grundlegenderen Ebene, wenn wir
allgemein nach den Funktionen der moralischen Bindung fragen.
2. Ethik ist keine Ingenieurwissenschaft
Der vorangehende Bogen der Ethik ist weit gespannt. Man sollte ihn so wenig
wie andere Bögen überspannen. Ebenso sollte man die Geduld des Lesers nicht
überstrapazieren. Die entscheidenden Punkte lassen sich recht einfach
rekapitulieren. Von einer eher dem common sense verpflichteten Darstellung
204
und Diskussion spezifischer wirtschaftsethischer Probleme sind wir zu einer
Darstellung allgemeiner ethischer Theorien und Methoden übergegangen. Die
Frage, wie genau die allgemeinen ethischen Theorien und die praktischen
Probleme zusammenkommen, wurde nicht wirklich angegangen. Die Klammer
bildet letztlich die Methode des und die Suche nach dem Überlegungsgleichgewicht. Diese Suche muss jeder von uns für sich selbst, aber auch im Dialog
mit anderen unternehmen, um seinen eigenen argumentativen Bogen zu spannen.
Bei alledem kann mehr als der Versuch, sich über ethische Argumente zu
informieren und diese in die eigene Suche nach einer angemessenen Lösung
anliegender Probleme „kritisch und rational“ einzubeziehen, nicht erwartet
werden. Wir werden das Überlegungsgleichgewicht niemals erreichen, aber wir
müssen uns immer wieder auf die Suche danach machen. Das Ziel, aus der Welt
der Wirtschaft und der Welt insgesamt einen besseren Ort zu machen, wird
jedenfalls durch eigene Urteilsbildung weit mehr gefördert werden als das
wohlfeile Befolgen immer neuer Patentrezepte. Verantwortliches Handeln heißt
eben nicht, vorgegebenen Lösungen nachzufolgen, sondern solche Lösungen
selbst mit praktischer Klugheit unter Einbeziehung aller relevanten
Gesichtspunkte zu entwickeln. So wenig wie man Politik als soziale IngenieursAufgabe ansehen darf, so wenig darf man die Wirtschaftsethik als
Ingenieurwissenschaft zur Vorbereitung von Unternehmenspolitik betrachten.
An ihr können wir unsere Urteilskraft schulen, aber sie kann uns nicht sagen,
was wir tun sollen.
205
Literatur
AINSLEE, G. (2002): Break Down of the Will. Princeton: Princeton University
Press.
ALBERT, H. (1968): Traktat Über Kritische Vernunft. Tübingen: Mohr.
— (1978): Traktat Über Rationale Praxis. Tübingen: Mohr.
— (2003): Kritik Des Transzendentalen Denkens. Tübingen: Mohr Siebeck.
ARENDT, H. (2003): Ursprünge Und Elemente Totalitärer Herrschaft. München:
Piper.
AXELROD, R. (1987): Die Evolution Der Kooperation. München und Wien:
Oldenbourg.
BARRY, N. (1981): An Introduction to Modern Political Theory. London and
Basingstoke.
BAURMANN, M. (1996): Der Markt Der Tugend. Tübingen: Mohr.
BERNINGHAUS, S., W. GÜTH, and H. KLIEMT (2003): "From Teleology to
Evolution. Bridging the Gap between Rationality and Adaptation in Social
Explanation," Journal of Evolutionary Economics, 13, 385-410.
BÖHM, F. (1966): "Privatrechtsgesellschaft Und Marktwirtschaft," ORDO, 17,
75-151.
BRENNAN, G., and L. LOMASKY (1983): "Institutional Aspects of `Merit Goods`
Analysis," Finanzarchiv, N.F., 41/2, 183-206.
— (1985): "The Impartial Spectator Goes to Washington," Economics and
Philosophy, 1, 189-211.
BRENNAN, H. G., and J. M. BUCHANAN (1984): "Voter Choice: Evaluating
Political Alternatives," American Behavioral Scientist, 28, 185-201.
— (1985): The Reason of Rules. Cambridge: Cambridge University Press.
BRENNAN, H. G., and H. KLIEMT (1990): "Logo Logic," Journal of
Constitutional Political Economy, Vol. 1, No. 1, 125-127.
BRENNAN, H. G., and L. LOMASKY (1984): "Inefficient Unanimity," Journal of
Applied Philosophy, 1, 151-163.
BRENNAN, H. G., and L. E. LOMASKY (1989): Large Numbers, Small Costs Politics and Process - New Essays in Democratic Thought. Cambridge:
Cambridge University Press.
— (1993): Democracy and Decision. Cambridge: Cambridge University Press.
BROOME, J. (1991): Weighing Goods. Equality, Uncertainty and Time. Oxford:
Basil Blackwell.
BUCHANAN, J. M. (1999): The Logical Foundations of Constitutional Liberty.
Indianapolis: Liberty Fund.
CARENS, J. (1981): Equality, Moral Incentives, and the Market. An Essay in
Utopian Politico-Economic Theory. Chicago and London: The University
of Chicago Press.
206
CLIFFORD, W. K. (1974/1879): "The Ethics of Belief," in Readings in the
Philosophy of Religion. An Analytical Approach, ed. by B. A. Brody.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall Inc., 241-247.
COLEMAN, J. S. (1988): "Free Riders and Zealots: The Role of Social Networks,"
Sociological Theory, 6, 52-57.
DACEY, R. (1976): "Theory Absorption and the Testability of Economic
Theory," Zeitschrift für Nationalökonomie, 36, 247-267.
— (1981): "Some Implications of 'Theory Absorption' for Economic Theory and
the Economics of Information," in Philosophy in Economics, ed. by J. C.
Pitt. Dordrecht: D. Reidel, 111-136.
DANIELS, N. (1979): "Wide Reflective Equilibrium and Theory Acceptance in
Ethics," The Journal of Philosophy, LXXVI, 265-282.
DE JASAY, A. (1997): Against Politics: On Government Anarchy and Order.
London and New York: Routledge.
DENNETT, D. C. (1986): Ellenbogenfreiheit. Frankfurt: Anton Hain Verlag.
EUCKEN, W. (1948/1981): "Die Soziale Frage," in Grundtexte Zur Sozialen
Marktwirtschaft. Zeugnisse Aus Zweihundert Jahren Ordnungspolitischer
Diskussion, ed. by W. Stützel. Stuttgart-New York: Fischer, 329 ff.
FRANK, R. (1985): Choosing the Right Pond. Oxford: Oxford University Press.
— (1987): "If Homo Economicus Could Choose His Own Utility Function,
Would He Want One with a Conscience?," The American Economic
Review, 77/4, 593-604.
— (1992): Die Strategische Rolle Der Emotionen. Oldenbourg: Oldenbourg
Verlag.
FRELLESEN, P. (1980): Die Zumutbarkeit Der Hilfsleistung. Frankfurt/M.: Alfred
Metzner Verlag.
GÜTH, W., and H. KLIEMT (1993): "Menschliche Kooperation Basierend Auf
Vorleistungen Und Vertrauen.," in Jahrbuch Für Politische Ökonomie, ed.
by P. e. a. Herder-Dorneich. Tübingen: Mohr.
— (1994): "Competition or Co-Operation: On the Evolutionary Economics of
Trust, Exploitation and Moral Attitudes," Metroeconomica, 45, 155-187.
— (2000): "Evolutionarily Stable Co-Operative Commitments," Theory and
Decision, 49, 197-221.
— (2006): "Evolutionäre Spieltheorie in Der Ökonomik," in Evolution in
Wirtschaft Und Gesellschaft, ed. by P. Weise. Marburg: Metropolis, 61169.
GÜTH, W., H. KLIEMT, and B. PELEG (1999): "Co-Evolution of Preferences and
Information in Simple Game of Trust," German Economic Review, 1, 83110.
GÜTH, W., W. LEININGER, and G. STEPHAN (1991): "On Supergames and Folk
Theorems: A Conceptual Analysis," in Game Equilibrium Models. Morals,
Methods, and Markets, ed. by R. Selten. Berlin et al.: Springer, 56-70.
207
GÜTH, W., R. SCHMITTBERGER, and B. SCHWARZE (1982): "An Experimental
Analysis of Ultimatum Bargaining," Journal of Economic Behavior and
Organization, 3, 367-388.
HABERMAS, J. (1983): Moralbewusstsein Und Kommunikatives Handeln.
Frankfurt: Suhrkamp.
HAHN, S. (1996): "Überlegungsgleichgewicht Und Rationale Kohärenz," in Die
Eine Vernunft Und Die Vielen Rationalitäten, ed. by K.-O. Apel, and M.
Kettner. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 404-423.
— (2000): Überlegungsgleichgewicht(E). Prüfung Einer
Rechtfertigungsmetapher. Freibrug i.Br.: Karl Alber.
HARSANYI, J. C. (1977): Rational Behavior and Bargaining Equilibrium in
Games and Social Situations. Cambridge: Cambridge University Press.
HART, H. L. A. (1961): The Concept of Law. Oxford: Clarendon Press.
HAYEK, F. A. V. (1948): "Individualism: True and False," in Individualism and
Economic Order, ed. by F. A. v. Hayek. Chicago: University of Chicago
Press, 1-32.
— (1971): Die Verfassung Der Freiheit. Tübingen: Mohr.
HEGSELMANN, R. (1988): "Wozu Könnte Moral Gut Sein?," Grazer
philosophische Studien, 31, 1 ff.
HEGSELMANN, R., and H. KLIEMT (1997): "Moral Und Interesse," München:
Oldenbourg.
HEYD, D. (1982): Supererogation. Its Status in Ethical Theory. Cambridge et al.:
Cambridge University Press.
HIRSHMAN, A. O. (1990): Exit, Voice and Loyalty. Boston: Harvard University
Press.
HOBBES, T. (1682/1990): Behemoth or the Long Parliament. Chicago: Chicago
University Press.
HOERSTER, N. (1997): "Definition Des Todes Und Organtransplantation,"
Universitas, 52, 42-52.
HUMBOLDT, W. V. (1851/1967): Ideen Zu Einem Versuch, Die Grenzen Der
Wirksamkeit Des Staates Zu Bestimmen. Stuttgart: Reclam.
HUME, D. (1739/1978): A Treatise of Human Nature. Oxford: Clarendon.
— (1777/1985): Essays. Moral, Political and Literary. Indianapolis: Liberty
Fund.
— (1976): "Die Wertlose Fiktion Vom Gesellschaftsvertrag," in Klassische
Texte Der Staatsphilosophie, ed. by N. Hoerster. München, 163 ff.
— (1985): Essays. Moral, Political and Literary. Indianapolis: Liberty Fund.
JONES, E. L. (1991): Das Wunder Europa. Tübingen: Mohr.
KAHNEMAN, D., and A. TVERSKY (1984): "Choices, Values and Frames,"
American Psychologist, 39, 341-350.
KETTNER, M. (1993): "Scientific Knowledge, Discourse Ethics, and Consensus
Formation in the Public Domain," in Applied Ethics, ed. by E. R. Winkler,
and J. R. Coombs. Oxford: Blackwell, 28-45.
208
KLEIN, D. B. (1997): "Reputation," Ann Arbor: The University of Michigan
Press.
KLIEMT, H. (1985): Moralische Institutionen. Empiristische Theorien Ihrer
Evolution. Freiburg: Karl Alber.
— (1986): "The Veil of Insignificance," European Journal of Political Economy,
2/3, 333-344.
— (1991): "Das Denken in Ordnungen Und Die Möglichkeiten
Ordnungspolitischen Handelns," in Ordnung Und Freiheit. Symposium
Aus Anlaß Des 100. Jahrestages Des Geburtstages Von Walter Eucken
Am 17. Januar 1991, ed. by M. E. e. a. Streit. Tübingen: Mohr, 31-59.
— (1993): "Ökonomische Theorie Der Moral," in Ökonomische
Verhaltenstheorie, ed. by B.-T. Ramb, and M. Tietzel. München: Vahlen,
281-310.
— (1994): Virginia Virtue - Virginia Vice. Fairfax, Va.: Center for Study of
Public Choice.
— (1995): Solidarität in Freiheit. Freiburg und München: Karl Alber.
KOLLER, P. (1992): "Moralischer Diskurs Und Politische Legitimation," in Zur
Anwendung Der Diskursethik in Politik, Recht Und Wissenschaft, ed. by
K.-O. Apel, and M. Kettner. Frankfurt: Suhrkamp, 62-83.
KREPS, D., P. MILGROM, J. ROBERTS, and R. WILSON (1982): "Rational
Cooperation in the Finitely-Repeated Prisoners' Dilemma," Journal of
Economic Theory, 27, 245-252.
KYMLICKA, W. (1996): Moderne Politische Philosophie. Frankfurt: Campus.
LAHNO, B. (1995): Versprechen - Überlegungen Zu Einer Künstlichen Tugend.
München, Wien: R. Oldenbourg Verlag.
LEHRER, K., and C. WAGNER (1981): Rational Consensus in Science and Society.
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
LEVITT, S., and S. J. DUBNER (2006): Freakonomics. A Rogue Economist
Explores the Hidden Side of Everything. London et al.: Penguin.
LUMER, C. (1997): "Habermas' Diskursethik," Zeitschrift für philosophische
Forschung, 51, 42-64.
MACINTYRE, A. C. (1984): Eine Kurze Geschichte Der Ethik. Wiesbaden:
Athenäum.
MACKIE, J. L. (1985): Persons and Values. Oxford: Oxford University Press.
MCINTYRE, A. (1980): Eine Kurze Geschichte Der Ethik. Königstein: Athenäum.
RAWLS, J. (1951/1976): "Ein Entscheidungsverfahren Für Die Normative Ethik,"
in Texte Zur Ethik, ed. by D. Birnbacher, and N. Hoerster München: dtv.
— (1975): Eine Theorie Der Gerechtigkeit. Frankfurt: Suhrkamp.
ROBBINS, L. (1935): An Essay on the Nature and Significance of Economic
Science. London: Macmillan.
ROSENBERG, N., and L. E. J. BIRDZELL (1986): How the West Grew Rich. The
Economic Transformation of the Industrial World. New York: Basic
Books, Inc.
209
ROWLEY, C. K., R. D. TOLLISON, and G. TULLOCK (1988): "The Political
Economy of Rent-Seeking.," Boston, Dordrecht, Lancaster: Kluwer
Academic Publishers.
SCHNEIDER, L. (1967): "The Scottish Moralists on Human Nature and Society.,"
Chicago und London.
SCHÜSSLER, R. (1990): Kooperation Unter Egoisten. München: Oldenbourg.
SEN, A., and B. WILLIAMS (1982): "Utilitarianism and Beyond," London:
Cambridge University Press.
SEN, A. K. (1982): Choice, Welfare, and Measurement. Oxford: Oxford
University Press.
SEN, A. K., and B. WILLIAMS (1982): Utilitarianism and Beyond. Cambridge:
Cambridge University Press.
SLONIM, R., and A. E. ROTH (1998): "Learning in High Stakes Ultimatum
Games: An Experiment in the Slovak Republic," Econometrica, 66, 569596.
SMITH, V. L. (1962): "An Experimental Study of Competitive Market Behavior,"
Journal of Political Economy, 70:2 (April), 111-37.
— (2000): "Bargaining and Market Behavior," Cambridge: Cambridge
University Press.
— (2003): "Constructivist and Ecological Rationality in Economics," American
Economic Review, 465-508.
TULLOCK, G. (1993): "Rent Seeking," in Property Rights and the Limits of
Democracy, ed. by C. Rowley. Hants: Edward Elgar.
URMSON, J. O. (1958): "Saints and Heroes," in Essays in Moral Philosophy., ed.
by I. Melden. Seattle/London: University of Washington Press, 198 ff.
VANBERG, V. J., and R. CONGLETON (1992): "Rationality, Morality and Exit,"
American Political Science Review, 86, 418 ff.
VICKREY, W. (1948): "Measuring Marginal Utility by Reactions to Risk,"
Econometrica, 13, 319-333.
YOUNG, H. P. (1994): Equity. In Theory and Practice. Princeton: Princeton
University Press.
ZAHAVI, A. (1975): "Mate Selection - a Selection for Handicap," Journal of
Theoretical Biology, 53, 205-214.
ZAHAVI, A., and A. ZAHAVI (1998): Signale Der Verständigung - Das Handicap
Princip. München: Insel.