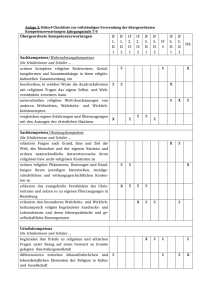„Diktatur des Relativismus“
Werbung

„Diktatur des Relativismus“? Die Individualisierung von Weltanschauungen und religiösen Überzeugungen 1 Gerhard Besier Kaum je hat die Rede eines deutschen Bundespräsidenten so heftige Kritik hervorgerufen, wie die von Christian Wulff am Tag der deutschen Einheit 2010. Der katholische Bundespräsident sprach von einer „christlich-jüdischen Leitkultur“ in Deutschland und rückte damit das Religiöse als Kategorie der Politik ins Zentrum staatsbürgerlichen Selbstverständnisses. Sind wir zuerst Bürger eines säkularen Staates, der Verfassung und Rechtsordnung dieses Landes verpflichtet, oder zuerst Christen, Juden oder Moslems – definiert durch unsere religiöse Kultur? Wulff hat – in Deutschland wie kurz darauf in der Türkei – nichts weniger getan, als die Rückkehr des Glaubens in die Politik zu proklamieren, wobei offen bleiben muss, ob ihm diese Konsequenz wirklich bewusst war. Was er, bzw. sein (eher mäßiger) Redenschreiber wohl auf jeden Fall intendierten, war ein Plädoyer für das Recht religiöser Minderheiten, ihre kulturelle Identität in einer anders geprägten Mehrheitsgesellschaft gleichberechtigt zu leben, ohne sich dadurch selbst auszugrenzen. Aber damit hat er eine im deutschen Grundgesetz verankerte Selbstverständlichkeit derart mit religiösen Überzeugungen verquickt, dass der falsche Eindruck entstehen musste, die Bundesrepublik Deutschland ruhe auf einer „christlich-jüdischen Leitkultur“, die freilich tolerant genug sei, auch Muslimen einen gleichberechtigten Platz in unserem Gemeinwesen einzuräumen. Aber diese Konstruktion widerspricht eben den Grundlagen unseres Staates. Dieser verlangt von seinen Staatsbürgern nicht mehr und nicht weniger, als dass sie – unabhängig von ihren persönlichen Überzeugungen – die geltenden Gesetze anerkennen und befolgen. Bürgerliche Loyalität heißt also nichts anderes als Gesetzestreue. Von einer allgemeinverbindlichen Gesinnungstreue ist nicht die Rede. Ja mehr noch: Der freiheitliche Staat kann und darf als Bedingung für den Bürgerstatus kein Wertbekenntnis verlangen. Er muss allerdings die Akzeptanz und die Befolgung der geltenden Gesetze fordern und im Falle von deren Übertretung in der Lage sein, solche Verstöße auch konsequent und effektiv zu ahnden. Wir haben also keine Republik der Gläubigen, und das Gerede von einer irgendwie religiös geprägten Leitkultur ist Unsinn – aus dem Munde mancher Politiker sogar gefährlicher Unsinn, denn unversehens gebrauchen diese Religion als eine Waffe im Tageskampf 1 Vortrag im Rahmen der Vorlesungsreihe 20 Jahre neue Bundesrepublik. Kontinuitäten und Diskontinuitäten an der TU Dresden am 29. 11. 2010. politisch-kultureller Auseinandersetzungen. Damit gefährden sie die Rechtsgleichheit der Bürger, denn sie machen diese abhängig von ihrer kulturellen Zugehörigkeit. Wer „unserer“, nämlich der „Christlich-jüdischen Leitkultur und Wertgemeinschaft“ nicht angehört, bleibt draußen vor und kann gar als „der Feind“ markiert werden. Um diese Konstruktion wirklich wasserdicht zu machen, wird die angeblich homogene „Wertegemeinschaft“ mit den bürgerlichen Grundrechten zu einer unauflöslichen Gemeinschaft verschmolzen, so dass der tatsächlich elementare Unterschied zwischen Verfassungsnormen und kulturellen Werten nahezu völlig verschwindet. Darin liegt der eigentliche Skandal dieser Leitkulturdebatte. Denn unter der Hand wird das formale Merkmal der Staatsangehörigkeit durch das Kriterium der kulturellen Zugehörigkeit ersetzt. Diese Sichtweise mündet in die meist auftrumpfende Feststellung, dass es einem Moslem gar nichts nutzt, wenn er einen deutschen Pass besitzt. Denn zu einem „vollgültigen“ Staatsbürger fehle ihm das „Eigentliche“ – die Mitgliedschaft in der „christlich-jüdischen Wertegemeinschaft“. Instinktiv bedienen damit Politiker ein sozialpsychologisch gut erforschtes, anthropologisches Grundphänomen: Das Bedürfnis von Menschen, Stereotypen zu bilden, das „Wir“ von den „Anderen“ zu unterscheiden und die gute Eigengruppe von der schlechteren Fremdgruppe abzuheben. Diese emotional aufgeladene, nie versiegende Quelle menschlicher Vorurteilsbildung sorgt für die innere Kohäsion einer Gruppe und lässt sich mit starker Rhetorik politisch leicht ausbeuten. Auf unseren Fall bezogen, bedeutet die Anwendung dieses Mechanismus aber gleichzeitig auch einen Angriff auf die Gleichheit aller „rechtmäßig in Deutschland lebenden Menschen“. Solche, die das als Leitkultur Proklamierte nicht teilen, würden in ihrem Anderssein nicht als gleichberechtigte Staatsbürger akzeptiert, sondern bestenfalls nur toleriert. Ein Verfassungsstaat jedoch, „der rund 20 Prozent seiner Bevölkerung gleiche staatsbürgerliche Rechte nur unter der Bedingung gewähren“ würde, „dass sie sich unauffällig integrieren, der verletzt seine eigenen normativen Grundlagen, die ihn verpflichten, das individuelle Recht auf Verschiedenheit und deren sichtbare Äußerung anzuerkennen.“ Die von interessierter Seite geschürte Angst der Deutschen vor „Überfremdung“ – was immer das heißt – führt dazu, dass man, in Ermangelung anderer Identitätskriterien, die jüdischchristliche Überlieferung zum Unterscheidungskriterium in einem imaginären Kulturkampf erklärt. Doch was meint eigentlich diese angeblich existente deutsche Wertegemeinschaft in einer längst säkularisierten Gesellschaft, in der die Lehren der etablierten Religionen allenfalls noch eine marginale Rolle spielen? Da dieser Sachverhalt allzu offenkundig ist, rekurrieren die Verkünder der christlichen Leitkultur – Politiker wie Bischöfe – erst gar nicht auf biblische Aussagen und daraus abgeleitete Lebensformen, sondern behaupten allen Ernstes, die deutsche „Rechtsstaatlichkeit verdanke sich dem christlichen Menschenbild“. Also nicht über die Bibel, sondern über den Umweg ihrer Wirkungsgeschichte soll die Verbindlichkeit christlicher Verhaltenslehren auch für nichtchristliche Bürger legitimiert werden. Aber diese Ableitung setzt eine Geschichtsklitterung voraus und setzt auf das kurze Gedächtnis der Menschen. Sie will vergessen machen, dass die katholische Kirche ihr eigenes Verhalten zu den universalen Menschenrechten erst vor fünfundvierzig Jahren geklärt hat, mit der Verabschiedung der Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“ am letzten Sitzungstag des Zweiten Vatikanischen Konzils. Vor 1965 galten andere Orientierungen, die man – sehr höflich – als demokratiefern charakterisieren könnte. Unvergessen ist Papst Leo XIII., der 1891 die Glaubens-, Rede-, Lehr- und Pressefreiheit mit der Begründung verwarf, es widerspreche der Vernunft, „dass das Falsche gleiches Recht haben soll wie das Wahre“. Zwischen 1810 und 1967 galt in der katholischen Kirche der so genannte „Antimodernisteneid“ Papst Pius‘ X., wonach jeglicher Versuch verurteilt wurde, die katholische Tradition mit dem neuzeitlichen Denken in Einklang zu bringen. Die Diener der Kirche mussten dem Teufelswerk von Demokratie und Menschenrechten entsagen. Selbst nach der mühsamen Anerkennung der Demokratie 1944 durch Pius XII. suchte der bis heute umstrittene Papst eine exklusive Bindung dieser Staatsform an das Christentum zu konstruieren. Bis in die Gegenwart dienen solche Verklammerungsstrategien dazu, die pluralistischen Demokratien an normativ-naturrechtlichen oder speziell kirchlich-katholischen Postulaten zu messen und so die offenen Gesellschaften religiös nachzujustieren. Es lässt sich auch kaum übersehen, dass es sich bei der Annäherung von katholischer Kirche und Demokratie nach 1945 um eine nachholende, den veränderten politischen Kräfteverhältnissen geschuldete Bewegung handelte, nicht um eine Neuorientierung aus eigener Kraft und Einsicht. Umso befremdlicher mutet es daher an, wenn ausgerechnet von dieser Seite ein gebrochenes Verhältnis des Islam zu den universalen Menschenrechten und dem Rechtsstaat beklagt wird. Letztlich hat die ins Kulturkämpferische überschießende WertegemeinschaftsRhetorik auf konservativer und kirchlicher Seite die Funktion, die abtrünnigen Wähler bzw. Kirchenmitglieder ins parteipolitische oder konfessionelle Gehege zurückzutreiben. Obwohl die Kirchen eine „stetige und beschleunigte Schrumpfung“ erleben, wie der katholische Staatsrechtler Christoph Möllers auf dem Deutschen Juristentag 2010 konstatierte, und damit ihr Anspruch, die Gesellschaft zu repräsentieren, ständig an Plausibilität verliert, beharren sie unvermindert auf einem besonderen Verhältnis gegenüber dem Staat und in der Gesellschaft und nehmen ihre Mission nicht immer auf glückliche Weise wahr. Ihr Anteil am Wecken eines panischen Gefühls unter den kulturell verunsicherten Deutschen beispielsweise, bald Fremde im eigenen Haus zu sein, soll die Menschen zu einer Art Bekenntnisbewegung treiben – im christlichen wie im nationalpatriotischen Sinne. Man suggeriert dem Staatsbürger, eine Orientierung an der Verfassung, den geltenden Gesetzen, dem Wirtschaftswachstum und Konsum reiche nicht mehr hin, um seine eigene Identität zu bewahren, ja man redet ihm förmlich eine Identitäts- und Sinnkrise ein, um ihm sogleich eine Therapie zu offerieren. Nebenbei gesagt handelt sich dabei auch um ein Ablenkungsmanöver von tatsächlich bestehenden Problemen – etwa, indem real existierende soziale Konflikte in unserer Gesellschaft kulturalisiert werden. Der im Oktober 2010 offen ausgebrochene Wertegemeinschaftsstreit köchelt freilich, in verschiedenen Variationen, schon seit Langem. Unter dem Stichwort „Relativismus“ ist einer seiner Protagonisten der deutsche Papst Benedikt XVI. Erst jüngst wieder, bei seinem Staatsbesuch in England und Schottland Mitte Oktober 2010, hat dieser Papst die offenen, pluralistischen Gesellschaften des Westens als „Diktaturen des Relativismus“ bezeichnet, in denen es frommen Christen immer schwerer gemacht werde, ihren Glauben öffentlich zu bekennen. Seit der Jahrhundertwende – genauer seit der Erklärung „Dominus Jesus“ vom August 2000 – überrascht Ratzinger einerseits damit, dass er das Aufklärungspotential des Christentums betont, aber andererseits vor allzu viel Rationalität, Relativismus und Dialogbereitschaft warnt. Der katholische Theologieprofessor Hermann Häring von der Universität Nijmegen meint, Ratzingers Denken gehe von einem „lebenslangen FreundFeind-Schema“ aus, das sich in Begriffen wie „Relativismus“, „Pluralismus“, „Subjektivismus“, „Eklektizismus, „Indifferentismus“ oder gar „metaphysischer Entleerung“ niederschlage. Viele Elemente dieses Kampfprogramms sind nicht neu. So hat bereits Pius IX. im Syllabus Errorum (Verzeichnis der Irrtümer) 1864 den Begriff „Relativismus“ gebraucht, um den Zeitgeist zu brandmarken, der den katholischen Wahrheitsanspruch in Frage stellte. Wie Ratzinger argumentiert, soll an einem Vortrag vom Frühjahr 2004 illustriert werden. Darin sieht der Theologe das „Missverhältnis zwischen technischem Können und moralischer Potenz“ als „die tiefere Gefahr unserer Stunde“. Vor diesem Hintergrund beklagt er den fehlenden Gottesbezug in der Präambel der europäischen Verfassung und ihr Nichteingehen auf die christlichen Wurzeln Europas. Darin offenbare sich der „Zynismus einer säkularistischen Kultur, die ihre eigenen Grundlagen“ verleugne. Die im Wesentlichen durch Freiheitsrechte definierte, das öffentliche Leben beherrschende radikale Aufklärungskultur führe aber zu immer mehr Diskriminierungsverboten und erweise sich damit als eigentlich freiheitsfeindlich. So werde man bald nicht mehr sagen dürfen, dass nach katholischem Verständnis „Homosexualität eine objektive Ordnungsstörung im Aufbau der menschlichen Existenz“ bedeute oder dass Frauen im Priesteramt nichts zu suchen hätten. Zu der säkularen Aufklärungskultur gehöre auch, dass Gott nichts im öffentlichen Leben und nichts mit den Grundlagen des Staates zu tun habe. Indem er sich von Gott emanzipiere, verleugne der Mensch jedoch seine historischen Wurzeln und beraube sich der Quellkräfte, aus denen er selber gekommen sei. Diese Selbstermächtigung des Menschen führe zu seiner Abschaffung, denn er übersehe, dass seine rationalistische Philosophie nur einen Teil seiner Vernunft ausdrücke. „Der zu Ende geführte Versuch, die menschlichen Dinge unter gänzlicher Absehung von Gott zu gestalten, führt uns immer mehr an den Rand des Abgrunds – zur Abschaffung des Menschen hin.“ Der Mensch trenne sich damit von der vernunftgemäßen Religion des Christentums und ihren Werten, die aus dem Ewigen kämen. Die Aufklärung sei christlichen Ursprungs, und das Zweite Vatikanische Konzil habe zur Versöhnung von Kirche und Moderne beigetragen. Der Glaube an den Schöpfergeist besage, dass die Welt aus der schöpferischen Vernunft (Logos) komme und nicht aus der Unvernunft. Ratzingers Angebot an jene, die den Weg zu Gott nicht finden könnten, gipfelt in der Erwartung, sie sollten „so leben und das Leben zu gestalten versuchen […], als ob es Gott gäbe.“ Als Ratzinger diesen Vortrag hielt, hatte er gerade die größte Genugtuung im Sinne seines Anspruchs erlebt. Der wohl international renommierteste nachmetaphysische Aufklärungsphilosoph unserer Zeit, Jürgen Habermas, hatte nämlich im Januar 2004 die Ansicht vertreten, der säkularisierte Bürger „dürfe weder religiösen Weltbildern grundsätzlich ein Wahrheitspotential absprechen, noch den gläubigen Mitbürgern das Recht bestreiten, in religiöser Sprache Beiträge zu öffentlichen Diskussionen zu machen.“ Und weiter: „Eine liberale politische Kultur kann sogar von den säkularisierten Bürgern erwarten, dass sie sich an Anstrengungen beteiligen, relevante Beiträge aus der religiösen in eine öffentlich zugängliche Sprache zu übersetzen.“ Schon ein paar Jahre zuvor, nämlich drei Wochen nach dem 11. September 2001, hatte Habermas in seiner vielbeachteten Frankfurter Dankesrede zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels für einen Brückenschlag zwischen dem säkularen und dem gläubigen Bürger plädiert. Für viele überraschend, forderte der damals schon 72 Jahre alte Philosoph, der sich selbst in der Nachfolge Max Webers als „religiös unmusikalisch“ versteht, von der säkularen Gesellschaft ein neues Verständnis von religiösen Überzeugungen, die mehr und etwas anderes seien als nur Relikte einer abgeschlossenen Vergangenheit, sondern eine „kognitive Herausforderung“ der Philosophie darstellten. Dennoch hatte Habermas keinen Zweifel daran gelassen, dass das demokratische Verfahren, wenn man es als Methode zur Erzeugung von Legitimität aus Legalität begreift, kein Geltungsdefizit enthalte, das etwa durch eine irgendwie religiös fundamentierte Sittlichkeit ausgefüllt werden müsse. Er geht mithin davon aus, „dass die Verfassung des liberalen Staates ihren Legitimationsbedarf selbstgenügsam, also von den kognitiven Beständen eines von religiösen und metaphysischen Überlieferungen unabhängigen Argumentationshaushaltes bestreiten kann.“ Die politische Meinungs- und Willensbildung der Staatsbürger entwickelt sich in der gemeinsam auszuübenden kommunikativen Praxis. Über die öffentlich ausgetragenen politisch-ethischen Diskurse kristallisiert sich aus den verfassungspatriotischen Bindungen und dem historisch-politischen Kontext eine kulturelle Wertorientierung heraus, deren Tragfähigkeit sich stets erneut bewähren muss. Was aber, wenn das einigende demokratische Band durch „eine entgleisende Moderne“ mürbe gemacht wird, wenn es zu einem „Abbröckeln der staatsbürgerlichen Solidarität“ kommt? Als Beispiele nennt Habermas die Märkte, die zunehmend Steuerungsfunktionen in Lebensbereichen übernähmen, die bis dahin „normativ, also entweder über politische oder über vorpolitische Formen der Kommunikation zusammengehalten worden“ seien. Er erinnert an den „staatspolitischen Privatismus“, an die fortschreitende „Tendenz zur Entpolitisierung der Bürger“, an die „schreienden sozialen Ungerechtigkeiten“ in einer zunehmend „fragmentierten Weltgesellschaft“. Soll sich angesichts dieser besorgniserregenden Entwicklung eine „zerknirschte Moderne“ in die Arme der Religion zurückflüchten, die – wie wir sahen – sich bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts sehr schwer tat „mit dem säkularen Denken von Humanismus, Aufklärung und politischem Liberalismus“? Habermas unterscheidet zwischen „der säkularen, ihrem Anspruch nach allgemein zugänglichen, und der religiösen, von Offenbarungswahrheiten abhängigen Rede.“ Die kognitive Urteilsenthaltung entspringe „aus der Achtung vor Personen und Lebensweisen, die ihre Integrität und Authentizität ersichtlich aus religiösen Überzeugungen“ schöpften. „Im Gegensatz zur ethischen Enthaltsamkeit eines nachmetaphysischen Denkens“ sensibilisierten religiöse Überlieferungen „für verfehltes Leben, für gesellschaftliche Pathologien, für das Misslingen individueller Lebensentwürfe und die Deformation entstellter Lebenszusammenhänge.“ Darum habe die Philosophie allen Grund, der Religion gegenüber Lernbereitschaft zu zeigen. Tatsächlich habe sie in der Vergangenheit den ursprünglich religiösen Sinn transformiert – etwa die Gottesebenbildlichkeit in die Menschenwürde. Der Verfassungsstaat in der postsäkularen Gesellschaft tue angesichts seiner Bedrohungen gut daran, sich auch weiterhin der religiösen Potentiale zu bedienen, „aus denen sich das Normbewusstsein und die Solidarität von Bürgern speist“. Habermas versteht die Säkularisierung der Gesellschaft als einen komplementären Lernprozess zwischen religiösen und weltlichen Mentalitäten. Als eine Voraussetzung für diese wechselseitige Reflexion der jeweiligen Begrenzungen nennt Habermas für die Religion einen Verzicht, den er – m. E. aus Mangel an Vertrautheit mit dem Milieu – für bereits historisch gegeben hält: Den Anspruch der Religion „auf Interpretationsmonopol und umfassende Lebensgestaltung“. Diesen Verzicht kann – zumal die Römisch-katholische Kirche – nicht leisten, wenn sie bei sich selbst und das heißt bei ihrer absoluten Wahrheits- und Heilsgewissheit bleiben will. Vielmehr handelt es sich bei ihren Dialogangeboten eher um immer neue strategische Finessen im Kampf um die geistige Vorherrschaft über die Menschen. So gründete der Papst im Oktober 2010 eine Vatikan-Behörde für Neuevangelisierung. Die Kirche müsse der „inneren Wüste“ insbesondere der westlichen Welt gegensteuern, die religiöse Gleichgültigkeit, Säkularismus und Atheismus hinterließen, heißt es in dem Erlass des Papstes. Globalisierung, Fortschritte in der Wissenschaft und Technik, die Mischung von Kulturen und Ethnien hätten für die Menschheit unleugbare Wohltaten gebracht, führt das Gründungsdokument des Papstes aus, aber sie seien auch mit einem „Verlust des Sinns für das Heilige“ verbunden. Der designierte Präsident der neuen Behörde, Erzbischof Rino Fisichella, ergänzte, der Relativismus werde zum Charakteristikum unserer Jahrzehnte. Gleichzeitig hätten Sekten Zulauf, die offenbar ein geistiges Vakuum füllten. Schon in „Dominus Jesus“ geißelte Ratzinger die irrige Idee, „dass alle Religionen für ihre Anhänger in gleicher Weise gültige Heilswege seien“ und dass die göttliche Wahrheit nicht verbindlich ausgesprochen werden könne. Beim Gottesdienst im Petersdom anlässlich der Eröffnung des Konklaves am 18. April 2005 warnte Ratzinger: „Es bildet sich eine Diktatur des Relativismus heraus, die nichts als definitiv anerkennt und als letztes Maß nur das eigene Ich und seine Wünsche gelten lässt.“ Am darauffolgenden Tag wählten die Kardinäle mit großer Mehrheit Ratzinger zum Papst. Die schroffe Formulierung hat in der katholischen Kirche selbst zu kontroversen Diskussionen geführt. Während die einen darauf verwiesen, dass der Papst den Relativismus als die Voraussetzung der modernen Demokratie anerkannt und die Wahrheit nur als Gut einer Gruppe innerhalb der pluralistischen Gesellschaft reklamiert habe, kritisierten andere, dass der Papst eine positive Bewertung der religiösen Vielfalt in heutigen Gesellschaften als relativistische Beliebigkeit betrachte, die keinen Glauben als wahr anerkenne. Eine dritte Gruppe schließlich bestärkte den Papst in seiner Verurteilung des gesellschaftlichen Relativismus. Es ist dieses Oszillieren, das unsere wachsame Aufmerksamkeit auf den Verlauf der Debatte lenken und unsere Teilhabe daran provozieren sollte. Als tagespolitischer Verschnitt des hier vorgestellten religiös-philosophischen Diskurses ist beispielsweise die Auseinandersetzung innerhalb der CDU zu verstehen. An ihrem wertkonservativen rechten Rand meldete sich nach den Septemberwahlen 2009 der „Arbeitskreis engagierter Katholiken in der CDU und CSU“ zu Wort, und ein „Manifest gegen den Linkstrend“ in der CDU machte Front gegen den vermeintlichen oder wirklichen „Sozialdemokratismus“ auf Seiten des Merkel-Flügels, wie er nach Wahrnehmung der konservativen Kritiker in der „Berliner Erklärung“ der CDU vom 15. Januar 2010 erneut zum Ausdruck gekommen sei. Im Jahr 2008 legte Hans Albert, der wichtigste Vertreter des Kritischen Rationalismus in Deutschland und ebenfalls ein Mitglied der Alterskohorte von Ratzinger und Habermas, eine kleine Streitschrift mit dem Titel „Joseph Ratzingers Rettung des Christentums. Beschränkungen des Vernunftgebrauchs im Dienste des Glaubens“ vor. Darin geht er auch auf den Dialog zwischen Habermas und Ratzinger vom Januar 2004 ein. Albert kritisiert an Habermas‘ Position, dass dieser den säkularen Bürger auffordere, sich der Religionskritik zu enthalten, während von einer entsprechenden Forderung an die Gläubigen keine Rede sei. Tatsächlich springt diese Ungleichgewichtigkeit ins Auge, denn die Vertreter religiöser Überzeugungen in Kirche und Politik üben regelmäßig scharfe Kritik an den Auffassungen areligiöser Staatsbürger und suggerieren deren Haltung als defizitär. Die nach dem britischen Vorbild gestaltete atheistische Buskampagne vom Sommer 2009 stieß beispielsweise auf heftige öffentliche Kritik. Nicht nur Bischöfe, sondern auch der Bundesinnenminister und andere Politiker trugen dazu bei, die Intention der Kampagne zu konterkarieren – nämlich ein Leben ohne Gott genau so positiv zu sehen wie ein Leben mit Gott und die moralische Diskreditierung der Gottlosen-Bewegung zu beenden. Auf der Website der Organisatoren heißt es: „Mit der Kampagne möchten wir öffentlich bekunden, dass eine nicht-religiöse, aufgeklärte Weltsicht eine positive Möglichkeit darstellt. Nichtreligiöse, Agnostiker und Atheisten sollen wahrnehmen können, dass sie nicht alleine sind, sie sollen mutiger werden, sich gegen religiösen Hochmut zur Wehr zu setzen und sich in die öffentliche Debatte einzumischen. Denn das Leben ohne einen Gott kann eine Bereicherung sein: angstfrei, selbstbestimmt, bewusst, tolerant und frei von Diskriminierungen.“ Besonders im südöstlichen Deutschland ist es im Zuge der verspäteten „geistig-moralischen Wende“ Helmut Kohls nach der deutschen Einheit gelungen, Menschen, die sich nicht zu einer der beiden Großkirchen halten, mit einem negativen Image zu belegen. Sie gelten als „wertelose“ Gesellen. Etwa in der pejorativen Beurteilung der humanistischen „Jugendweihe“ gegenüber dem bürgerlich-religiösen Passage- Ritus der Kommunion bzw. der Konfirmation kommt diese Ungleichgewichtigkeit im gesellschaftlichen Leben beredt zum Ausdruck. Der Theologe Ratzinger gesteht „Pathologien in der Religion“ ein, möchte aber gleichzeitig auch von den Philosophen das Eingeständnis hören, dass es „Pathologien der Vernunft“ gebe, „eine Hybris der Vernunft“, die nicht minder gefährlich, sondern in ihrer potentiellen Effizienz „noch bedrohlicher“ sei. Darum müsse „auch die Vernunft an ihre Grenzen gemahnt werden und Hörbereitschaft gegenüber den großen religiösen Überlieferungen der Menschen lernen“. Auf dieses Anliegen einer Grenzziehung, auf eine pragmatisch-friedfertige Kompetenzaufteilung, geht Habermas in seinem „nachmetaphysischen Denken“ positiv ein. Er teilt anscheinend Ratzingers Auffassung, „dass religiöse Überzeugungen Einsichten enthalten, die den Wissenschaften nicht zugänglich sind und die sich legitimerweise auch auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschungsresultate nicht kritisieren lassen [… und …] dass solche Einsichten für die vernünftige Gestaltung und die Stabilität der sozialen Ordnung unentbehrlich sind.“ Hier setzt Alberts Hauptkritik an. Er wirft Habermas eine unnötige Selbstbeschränkung philosophischen Denkens vor, wenn dieses den ihm fremden „opaken Kern der religiösen Erfahrung“ unberührt lassen soll und eine „strikte Grenzziehung zwischen Glauben und Wissen“ beachtet. Selbstverständlich gebe es seit jeher eine „Konkurrenz zwischen Weltbildern und religiösen Lehren, die die Stellung des Menschen im Ganzen der Welt zu erklären beanspruchen.“ Aber er widerspricht Habermas, wenn dieser behauptet, die verschiedenen Erklärungsansprüche ließen sich „auf der kognitiven Ebene“ nicht schlichten“ und man müsse sich daher einer solchen Debatte enthalten. Von der Antike bis zur Gegenwart, so Albert, hätten sich Philosophen kritisch-analytisch mit den metaphysischen Auffassungen und Ansprüchen der Religionen befasst. Eine „strikte Grenzziehung zwischen Glauben und Wissen“ wie sie Habermas vorschlage und eine daraus folgende, schiedlich-friedliche Kompetenzregelung wie sie auch Ratzinger und Hans Küng verträten, führe nur dazu, dass mögliche Widersprüche zwischen den als inkommensurabel dargestellten Bereichen unter den Teppich gekehrt würden. Albert bescheinigt Habermas „eine willkürliche Einschränkung des Vernunftgebrauchs […] wie sie im philosophischen Denken jedenfalls ungewöhnlich“ sei. Er wolle, sicherlich in „pragmatischer Absicht“, dem „Konflikt zwischen Wissenschaft und Religion aus dem Weg gehen“. Mit offensichtlicher Genugtuung erinnert Albert daran, dass im Rahmen des theologischen Denkens immer wieder dadurch Probleme aufgetaucht seien, „dass Glaubenswahrheiten durch Forschungsergebnisse der Realwissenschaften […] in Frage gestellt wurden […]“. Albert wirft Habermas vor, er rede „einer pragmatisch motivierten Beschränkung des Vernunftgebrauchs das Wort“ und opfere damit „die Suche nach Wahrheit […] dem Streben nach Konsens […].“ In Habermas‘ Denken dominiere das Konsensmotiv so stark, dass er mit seiner Argumentation sogar mittelbar den „mehr oder weniger verschleierten Fundamentalismus des deutschen Papstes“ stütze und dafür den Applaus der „politischen und medialen Prominenz“ entgegennehme, die „seit einiger Zeit ununterbrochen mit religiösen Parolen“ aufwarte. Damit sind wir wieder auf der Ebene der alltäglichen Lebenswelt angekommen. Hier begegnen uns tatsächlich weniger theologisch reflektierte, religiöse Überzeugungen, aber stattdessen viele religiöse, in sich höchst disparate und diffuse Haltungen. Zu den postmodernen Identitätskonstruktionen gehören auch religiöse Patchwork-Bildungen, über deren intellektuelle Substanz vermutlich nicht nur der Papst, sondern auch agnostische Philosophen verzweifelt den Kopf schütteln würden, wenn sie sich damit befassten. Jetzt ist wieder die Zeit der Märkte, und neben vielem anderen kann man beispielsweise auch wieder irgendwelche Steine kaufen, von denen magische, heilende Kräfte ausgehen sollen. Natürlich glaubt man nicht daran, aber vielleicht hilft es ja doch; schaden kann es jedenfalls nicht – übrigens auch ein Motiv für viele, weiterhin Kirchensteuern zu zahlen, ohne am Leben in den Kirchengemeinden aktiv teilzunehmen. Man ist mit seinem Obolus, ähnlich wie nach dem Abschluss einer Versicherung, einfach auf der sicheren Seite. Es scheint so, als ob Religion, oder jedenfalls religiöses Verhalten, ein soziales Grundphänomen menschlicher Existenz sei, wie viele Anthropologen meinen. Das Ärgernis unseres endlichen Lebens soll durch transzendente oder auch immanente Erlösungshoffnungen aufgehoben werden, der nicht minder ärgerliche, überall waltende Zufall im Verlauf wie in der Entwicklung menschlichen Lebens – in individueller Perspektive wie auch in der Spezies Mensch insgesamt – wird repariert durch das Modell eines planvoll handelnden Schöpfergottes. Da hilft es auch kaum, dass Evolutionsbiologen immer wieder auf die offenkundigen Dysfunktionen der vermeintlich göttlichen Schöpfung verweisen, auf die Zweck- und Richtungslosigkeit in der Evolution. Völlig unbeeindruckt von den präsentierten Forschungsergebnissen glauben über 40 Prozent der US-Amerikaner an kreationistische Vorstellungen, in Deutschland sind es immerhin 23 Prozent. Angesichts solcher Befunde erscheinen weder der Vernunftoptimismus der Kritischen Rationalisten, noch Ratzingers transzendentale Ganzheitskonstruktionen dem zu entsprechen, wie Menschen wirklich denken und handeln. Aber auch das „nachmetaphysische Denken“ Habermas‘ und sein Verlangen nach konsensuellen Lösungen gehen an der empirischen Wirklichkeit vorbei. Vielmehr konstruieren sich Menschen auf der Grundlage ihrer psychophysiologischen Dispositionen, ihrer Sozialisation und ihrer Lebensgeschichte ihre jeweils ganz eigenen Überzeugungsysteme – in der Regel ganz ohne Rücksicht auf deren innere Logik oder auf bereits vorgegebene dogmatische Gebäude. Diese Vielfalt unterschiedlicher Lebensstile, moralischer Grundhaltungen und religiöser Einstellungen – ein Signum moderner Gesellschaften – beunruhigt Politiker wie Kirchenleute gleichermaßen, weil sie um den inneren Zusammenhalt der Gesellschaft wie der Kirchen und natürlich auch um den Bestand ihrer eigenen Institutionen fürchten. Was ihnen – aber auch manchen anlehnungsbedürftigen, gehorsamsbereiten Zeitgenossen – fehlt, sind Übersichtlichkeit und klare Verhältnisse. Darum startet man immer wieder neue Kampagnen, um kollektive Überzeugungen und Glaubenssysteme zu implementieren und damit auch den vom Absterben bedrohten Einrichtungen neues Leben einzuhauchen. Nur ein kleines Beispiel: Ende Oktober 2010 formulierte der scheidende Parteivize, CDU-Landeschef und Katholik Jürgen Rüttgers, gewissermaßen als sein Vermächtnis: „Bürgerliche Politik heißt für mich eine Politik gegen postmoderne Beliebigkeit, gegen den Relativismus. Unsere Gesellschaft ist von diesem Relativismus bedroht.“ Vor dem Hintergrund der Ergebnislosigkeit dieser leeren Werterhetorik darf man mit Recht bezweifeln, dass Vorstöße wie die des Bundespräsidenten oder die Ratzingers an der Lustlosigkeit des Staatsbürgers etwas ändern, sich vorschreiben zu lassen, was er glauben soll. Unsere eifrigen Kultur- und Sinndienstleister in den Regierungen, in den Parteien wie sonst wo auf Kanzeln und Kathedern werden sich also damit begnügen müssen, dass wir uns auf die Verfassung und das geltende Recht als gemeinsame Grundlagen des Gemeinwesens verständigt haben – nicht mehr, aber gewiss auch nicht weniger. Eine öffentliche Moral zu inszenieren, wie Bischöfe und Politiker, meist Arm in Arm, das immer wieder versuchen, sorgt nicht für eine ethische Orientierung in der Gesellschaft, die es ganz ohne solche Anstöße ja faktisch gibt. Die längst ritualisierten Übungen unserer ethischen Vorturner stellen vielmehr deren Demokratiefähigkeit in Frage und fördern nur die Gleichgültigkeit der Bürger gegenüber jenen Götzen, denen sie an den Grundwerte-Altären der „christlich-jüdischen Leitkultur“ ihre verbalen Überzeugungsopfer darbringen sollen.