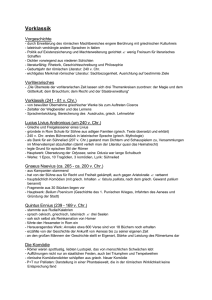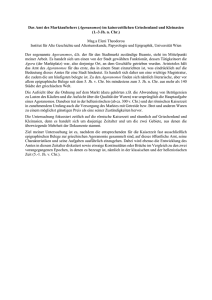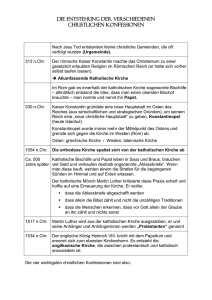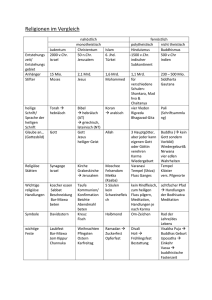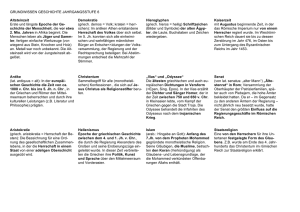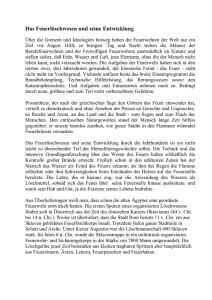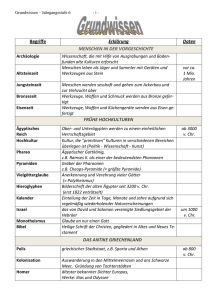Die griechische und römische Philosophie
Werbung

Die griechische und römische Philosophie | Mediencode 7595-43 Überblick Die Vorsokratiker und Sókrates Platon und die Akademie Aristóteles und der Perípatos Kêpos (Epikúr) Stoá Überblick Die griechische Philosophie markiert den Beginn der europäischen Philosophie und ist damit wissenschaftlich und kulturell wegweisend für das gesamte westliche Denken. Am Anfang (ca. 600–450 v. Chr.) stehen die ionischen Naturphilosophen, bei denen astronomische, physikalische und mathematisch-geometrische Forschungen die grundsätzliche Frage nach dem Wesen der Welt aufwerfen. Zusammen mit den Sophisten (ca. 450–400 v. Chr.), die den Menschen und das Zusammenleben mit anderen Menschen in den Mittelpunkt stellen, werden sie als »Vorsokratiker« bezeichnet. Diese Bezeichnung stammt allerdings nicht aus der Antike, sondern hat sich im 19. Jahrhundert durchgesetzt, als man in der Gestalt des Sókrates (griech. Betonung: Sōkrátēs, 469–399 v. Chr.) etwas einseitig und verklärend einen revolutionären Neubeginn des Denkens erblickte und alle Philosophen vor ihm unter diesem Oberbegriff zusammenfasste. Heutzutage wird jedoch auch Sókrates selbst der Bewegung der Sophisten zugerechnet, obwohl er einen eigenwilligen und subversiven Schlusspunkt dieser ersten europäischen »Aufklärung« darstellt. Mit Sókrates’ Schüler Plátōn (latinisiert Plato) und Aristóteles (griech. Betonung: Aristotélēs) erreicht die klassische griechische Philosophie ihren Höhepunkt (427–322 v. Chr.). Beide gründen eigene Schulen, Platon die Akademie und Aristóteles den Perípatos. In hellenistischer Zeit treten zwei weitere Schulen hinzu, der Kêpos, begründet durch Epikúr, sowie die Stoá des Zenon von Kition, während die Kyniker eher eine lose Gruppierung darstellen. Der Wettstreit all dieser Gruppen ist jedoch nicht annähernd so befruchtend wie zuvor die Werke ihrer jeweiligen Gründer, sondern führt in erster Linie zu polemischen Fehden. Im besten Fall entstehen Synkretismen, d.h. Kombinationen und Vermischungen. So ist die römische Philosophie fast durchweg von einer synkretistischen Aneignung der griechischen Philosophie gekennzeichnet. Auch das frühe Christentum setzt sich schöpferisch mit den Griechen auseinander, vor allem mit dem aus der Akademie hervorgegangenen Neuplatonismus. Im europäischen Mittelalter wird besonders das aristotelische Denken perzipiert und weiterentwickelt, teilweise auf dem Umweg über arabische Gelehrte. Auch nach den neuzeitlichen Paradigmenwechseln in der Philosophie durch Kant und Unikurs Latein © C.C. Buchners Verlag, Bamberg 2011 (BN 7595) 1 den deutschen Idealismus (Hegel, Fichte, Schelling) sowie die Phänomenologie (Husserl) blieb die griechische Philosophie eine Bezugsgröße: Namhafte Denker wurden durch sie entweder methodisch beeinflusst (wie Heidegger), zum Widerspruch herausgefordert (wie Popper, der Platon kritisiert) oder sie bezogen sie historisch ein (wie Bloch). In der Nachfolge von Sprachphilosophie (Wittgenstein) und Postmoderne (Deleuze) hingegen hat eine scharfe Trennung von »Philosophie« und »Philosophiegeschichte« stattgefunden. Mit ihr ging eine Archivierung der antiken Philosophen einher, v.a. aus der anglo-amerikanischen Perspektive der analytischen Philosophie. Im heutigen Zeitalter des Methodenpluralismus ist eine Auseinandersetzung mit den Griechen nur noch bei wenigen Philosophen wirksam, etwa bei Bernhard Waldenfels, Ursula Wolf, Karen Gloy und insbesondere Vittorio Hösle. Die Vorsokratiker und Sókrates Man nennt die ersten griechischen Philosophen »ionische Naturphilosophen«, weil die Vertreter aus Ionien, d.h. aus dem östlichen Bereich des griechischen Mittelmeeres, oder aus ionischen Kolonien stammten und weil der Ausgangspunkt ihrer Überlegungen die Beobachtung des Naturgeschehens war. Auch der allgemeinere Begriff Hylozoisten (griech. hýlē Stoff, zōé Leben) wird benutzt, weil diese Denker die Welt und ihre Ordnung (griech. kósmos) als belebt angesehen haben. Sie versuchten, die wesensmäßige Beschaffenheit der Welt (griech. phýsis, lat. natura rerum) zu ergründen. Besonders auffällig ist, dass sie nach einer arché (lat. principium) suchten, was teilweise eine Ursache oder ein Urprinzip, teilweise einen regelrechten Urstoff der Welt bezeichnen kann. Die ionische Naturphilosophie beginnt mit der Gruppe der sogenannten Milesier, die, wie ihr erster Vertreter Thales, sämtlich aus Milét in Kleinasien stammten. Thales (ca. 625–550 v. Chr.) betrieb in erster Linie astronomische und mathematische Studien (Satz des Thales). Er vermutete, die arché des Kosmos sei das Wasser. Für Anaximánder (ca. 610–545 v. Chr.) ist die arché hingegen ein nichtstofflicher, unbestimmbarer Ursprungsbereich, das ápeiron (das Unendliche). Alle Dinge entspringen bei ihrer Entstehung (génesis) dem ápeiron und kehren im Kreislauf des Lebens bei ihrem Vergehen (phthorá) ebendorthin zurück. Anaximénes (ca. 585–525 v. Chr.) fasst hingegen die Luft als arché auf; er versteht das Kalte als Verdichtung von Luft und das Warme als ihre Verdünnung. Mit dieser Verknüpfung von quantitativen und qualitativen Wechselwirkungen kann er als Vorbote des Materialismus gelten, den im 5. Jahrhundert v. Chr. Leukípp und besonders Demokrít als Lehre von den Atomen (griech. á-tomos un-teilbar) ausgestalten werden. Eine eigentümliche Sondererscheinung stellt die Schule der Pythagoreer im süditalischen Kroton dar. Ihr Schulhaupt Pythágoras (ca. 570–500 v. Chr.) stammte von der Insel Samos, scheint aber entscheidende Anregungen aus Ägypten empfangen zu haben. Er sieht in der Welt ein Harmonieprinzip, das sich auf Zahlenverhältnisse gründet. Pythágoras war nicht nur Philosoph, Mathematiker (Satz des Pythágoras), Astronom und Redner mit politischen Ambitionen, sondern in hohem Maße Mystiker und religiöser Führer. Unikurs Latein © C.C. Buchners Verlag, Bamberg 2011 (BN 7595) 2 Die Sprödigkeit der Quellen über ihn und seine Lehre führte rasch zur Legendenbildung, zumal seine Anhänger einer Geheimlehre anhingen und in strenger Abgrenzung von der Außenwelt lebten. Berühmt wurde die Formulierung, mit der sie die Autorität bestimmter Lehrsätze zu untermauern pflegten: »autós éphā« »Er selbst hat es gesagt!« Einen Wendepunkt stellen die Forschungen der sog. Eleaten dar. Innerhalb dieser Schule ist Parménides (ca. 540–480 v. Chr.) der mit Abstand wirkungsmächtigste Denker, der auf radikale Weise der Frage nachgeht, was eigentlich »Sein« (eînai) bedeutet. Parmenides zieht eine scharfe Trennlinie zwischen dem Seienden (ón) und dem Nichtseienden. Das Seiende ist ungeworden, unvergänglich, unbeweglich, außerdem ist es »Eines« (hén) und hat Kugelgestalt. Die empirischen Beobachtungen von Werden und Vergehen seien letztlich Täuschungen der Sinne. Mit dieser Seinslehre begründet er die philosophische Disziplin der Ontologie. Den mystisch-spekulativen Zug teilt Parmenides mit den Pythagoreern und später mit dem Platonismus. Heraklít von Ephesos (ca. 550–480 v. Chr.) ist berühmt für seine Aussprüche »Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen« (weil dieser sich ständig wandle), und »Alles fließt« (»pánta rheî«). Der früher als so evident erscheinende Gegensatz des Heraklit zur statischen Ontologie des Parmenides wird heute mehr und mehr in Zweifel gezogen, weil ungeachtet der zitierten Aphorismen beide Philosophen das Spannungsfeld zwischen Veränderlichem und Unveränderlichem erkunden. Zuletzt findet die Suche der Vorsokratiker nach einer arché ihren Schlusspunkt in den Anschauungen des Anaxágoras und des Empédokles. Anaxágoras (ca. 500–425 v. Chr.) meint, es gebe potentiell unendlich viele Urstoffe, aber die allem zugrundeliegende Wirkkraft sei ein Weltgeist, eine planvolle Vernunft (noûs). Empédokles (ca. 500–435 v. Chr.) entwickelte schließlich die Lehre von den vier Elementen (griech. stoicheîa) Wasser, Erde, Feuer und Luft, die bewegt werden von den Kräften Liebe und Hass (philótēs und neîkos). Um die Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. erscheint mit den Sophisten (»Lehrer für Expertenwissen«) eine regelrechte Gegenbewegung zu den ionischen Naturphilosophen und ihren schwer entscheidbaren, theoretischen Spekulationen. Die Sophisten wenden sich dezidiert dem Zusammenleben der Menschen zu, sie betonen die Relativität aller Urteile, sie erheben sogar die Möglichkeit entgegengesetzter Urteile zum menschlichen Grundprinzip. Auch die Religion betrachten sie als vom Menschen geschaffen. Mit dieser unumkehrbaren Distanzierung vom Mythos und von der Religion sind sie die ersten »Aufklärer« in der europäischen Geistesgeschichte, die entscheidende Grundlagen schaffen für die nachfolgenden Vorstellungen von positivem Recht, von Moralphilosophie und nicht zuletzt von der Wirkungsweise der Sprache. Ein Hauptvertreter dieser durchaus heterogenen Bewegung ist der Thraker Protágoras (490–411 v. Chr.) mit dem sog. »Homomensura-Satz«: »Der Mensch ist das Maß aller Dinge, der Seienden, dass sie sind, und der Nichtseienden, dass sie nicht sind.« Der Athener Sókrates (469–399 v. Chr.) hat in seiner äußerlichen Erscheinung besonders nachdrücklich das Bild geprägt, das man sich vom Typus eines antiken Philosophen macht. Mit seinem Ideal materieller Bedürfnislosigkeit wurde er später z.B. zum Idol der Kyniker, die »zynisch« äußeren Luxus verachteten – Diógenes von Sinope soll in einer Tonne gelebt haben. Dass Sókrates von seinen Mitbürgern zum Tode verurteilt wurde Unikurs Latein © C.C. Buchners Verlag, Bamberg 2011 (BN 7595) 3 und 399 v. Chr. den Schierlingsbecher trinken musste, wird mit Gottlosigkeit (Asebie) und Verführung der Jugend begründet, hatte aber wohl einen politischen Hintergrund: Sókrates unterhielt zuvor persönliche Verbindungen zur kurzen Schreckensherrschaft der »Dreißig« in Athen. Von der Lehre des Sókrates lässt sich kaum ein klares Bild gewinnen, da er keine Schriften hinterlassen hat. Er gewinnt seine Stellung in der Philosophiegeschichte durch seinen bedeutendsten Schüler Platon. Platon und die Akademie Für Platon (428–347 v. Chr.) war in jungen Jahren die Begegnung mit Sókrates das entscheidende Erlebnis. Er setzt den Lehrgedichten und Traktaten seiner Vorgänger eine grundlegend andere Darstellungsform entgegen: den Dialog. In fast allen seinen Werken lässt er Sókrates als Dialogpartner auftreten, und zwar meist als Protagonisten des Gesprächs. Da Sókrates selbst nichts Schriftliches hinterlassen hat, kann nicht genau bestimmt werden, in welchem Maße die literarische Figur des Sókrates mit dem historischen Sókrates übereinstimmt. Immerhin sind Dialoge und Erinnerungen noch eines weiteren Schülers des Sókrates überliefert, nämlich des erfolgreichen Schriftstellers Xénophon, eines gut gelaunten Hobbyphilosophen und Pferdenarren. Der Vergleich der beiden unterschiedlichen Sókratesporträts legt bei aller gebotenen Vorsicht den Schluss nahe, dass Platon die Lehre seines Freundes zwar nicht verfälscht, aber durchaus weiterentwickelt hat. Platons Werke, deren Datierungsreihenfolge umstritten ist, scheinen mit einer Art Erinnerungsliteratur an Sókrates zu beginnen, in der dem Lehrer ein Denkmal gesetzt wird und eine bestimmte Untersuchungsmethode vorgeführt wird: Sókrates verwickelt seine oft noch jugendlichen Gesprächspartner in grundlegende Fragen und macht ihnen deutlich, wie undurchdacht ihre Anschauungen sind. Wenn etwa der junge Euthýphrōn seinen eigenen Vater vor Gericht stellt, weil dieser durch Fahrlässigkeit den Tod eines Sklaven verschuldet hat, so wundert sich Sókrates über dieses ungewöhnlich »fromme« Verhalten, das Euthýphrōn für sich reklamiert, und fragt, was denn »das Fromme« eigentlich sei. Diese für uns selbstverständliche verallgemeinernde Substantivierung des Adjektivs »fromm« hin zu »das Fromme« (allgemein und schlechthin) ist das große sprachliche und gedankliche Ereignis in Platons Frühwerk. Niemand ist mit der Sprache vorher so umgegangen. Sókrates’ Gesprächspartner sind zunächst überfordert: Der junge Euthýphrōn antwortet spontan, fromm sei das, was er gerade tue. Auch die weiteren Definitionsversuche führen nicht zu einem überzeugenden Ergebnis. So enden diese Dialoge in einem Zustand der Aporíe (griech. aporíā Ausweglosigkeit), sind aber deswegen nicht etwa »ergebnislos«: Die jungen Gesprächspartner erleben eine Erschütterung ihrer vorgefertigten und undurchdachten Meinungen, sie erleben den Beginn eigentlichen Fragens. Solche Dialoge zeigen bereits entscheidende Wesenszüge platonischen Philosophierens: Das Denken entwickelt sich im Gespräch weiter. Alle Ergebnisse haben den Charakter des Vorläufigen. Und: Philosophieren vollzieht sich als gemeinschaftliches Erleben, als Lebensform. Sókrates verkündet keine Lehrsätze, sondern er vergleicht seine Rolle mit der eines Geburtshelfers Unikurs Latein © C.C. Buchners Verlag, Bamberg 2011 (BN 7595) 4 und nennt seine Vorgehensweise tiefsinnig-scherzhaft »Maieutik« (»Hebammenkunst«) bzw. auf der argumentativen Ebene »Dialektik« (etwa: »Wahrheitsfindung im Gespräch«). Dazu gehört sowohl die »Elenktik« (»Widerlegen« falscher Annahmen) als auch die »Protreptik« (»Hinführen« zu Alternativen). Zentraler Angriffspunkt der Elenktik ist die oberflächlichste der Wissensformen, die bloße Meinung (dóxa). Wer hingegen einen Gegenstand durchdacht hat, so dass er ihn rechtfertigen und anderen vermitteln kann (griech. lógon didónai), verfügt über die zweite Wissensstufe, die des gesicherten Fachwissens (epistémē). Die dritte und höchste Form des Wissens aber kann weder gelehrt noch erzwungen werden, sondern sie ereignet sich, wenn überhaupt, für den Philosophen wie ein unerklärliches Geschenk: die göttliche Weisheit (sophíā). Das bekannte Hauptwerk Platons ist die Politeíā (Staat, eigtl. Staatsverfassung), deren Untertitel das Thema bezeichnet: die Gerechtigkeit, verstanden als Balance zwischen den widerstreitenden Kräften in einem utopischen Idealstaat. Diejenigen, die die philosophische Erkenntnis erlangt haben, sollen im Staat herrschen – ein radikales Projekt, das Platon selbst im sizilischen Syrakus erfolglos den Machthabern nahezubringen versuchte. Die Gerechtigkeit (griech. dikaiosýnē, lat. iustitia) bildet zusammen mit der Weisheit (griech. sophíā, lat. sapientia), der Mäßigung (griech. sōphrosýnē, lat. temperantia) und der Tapferkeit (griech. andreíā, lat. fortitudo) den Katalog der sog. Kardinaltugenden, der später noch um die Frömmigkeit (griech. hosiótēs, lat. pietas) erweitert wurde. Platon verarbeitet das Gedankengut zahlreicher Vorsokratiker, etwa in seinem Dialog Phaídōn, in dem Sókrates vor seiner Hinrichtung Abschied von seinen Freunden nimmt. Die größten Impulse verdankt er jedoch Parmenides und den Pythagoreern, da er deren Hochschätzung des Zahlenprinzips ebenso teilt wie ihre Lehre von der Unsterblichkeit der Seele. Wenn nun die Seele unabhängig vom Körper existieren kann, ist die Vorstellung nicht mehr fern, dass das Sein nicht auf die materielle Welt beschränkt ist. Und wenn der Philosoph die Seele des Menschen für wichtiger als den Körper erachtet, dann liegt womöglich das eigentlich wichtige Sein sogar jenseits der empirischen Wirklichkeit. Platon erkennt dadurch hinter den Erscheinungen der Sinnenwelt jeweilige zugrundeliegende Urgestalten, die üblicherweise Ideen genannt werden. Platon selbst verwendet das Wort idéā eher selten, häufiger spricht er von dem eîdos (Urbild, Pl. eídē) oder – noch konsequenter – von den wirklich »seienden« Dingen (ta ónta). Nach Platons Ideenlehre ist jede Form des Lernens, also auch die Erkenntnis der Ideen, eine Wiedererinnerung (anámnēsis). Um verständlich zu machen, was er meint, bedient sich Platon zahlreicher Mythen und auch Gleichnisse. So erzählt z.B. in der Politeíā das sog. »Höhlengleichnis«, wie der Philosoph die trügerischen Eindrücke der Sinnenwelt hinter sich lässt, die Dinge in ihrem wahren Wesen erblickt – und anschließend zu den Menschen zurückkehren muss, die solches nicht erlebt haben. Ein viel beachtetes literarisches Meisterwerk unter Platons Dialogen ist schließlich das Sympósion (Gastmahl oder Trinkgelage), das dem Thema érōs (Verlangen) gewidmet ist. Ein Redewettstreit darüber gipfelt in einem Bericht des Sókrates über dessen Lehrerin Diotíma. Eros, so heißt es, sei weder im Liebenden noch im Geliebten, sondern er sei dazwischen (metaxý). Die Redewendung »platonische Liebe« hat übrigens hier ihren Ursprung und bezeichnet eine ideelle Liebe im Gegensatz zur körperlichen. Unikurs Latein © C.C. Buchners Verlag, Bamberg 2011 (BN 7595) 5 Platon gilt – ungeachtet seiner stets polarisierenden Wirkung – neben Kant als wirkungsmächtigster Philosoph überhaupt. Von A. N. Whitehead stammt das berühmte Bonmot, die europäische Philosophie bestehe lediglich aus »Fußnoten zu Platon«. Mit der Akademie schuf Platon um das Jahr 387 v. Chr. eine langlebige und wirkungsmächtige Institution völlig neuen Typs: Sie bot in Form einer Wohn- und Speisegemeinschaft den Mitgliedern, zu denen auch Frauen gehörten, kostenlos einen Ort, der ausschließlich dem gemeinsamen Leben und Forschen gewidmet war. In den fast tausend Jahren bis zu ihrer endgültigen Schließung durch Kaiser Justinián im Jahre 529 n. Chr. wirkten in ihr zahlreiche namhafte Gelehrte, vom jungen Aristóteles (s.u.) bis hin zu Proklos – nicht aber Plotín (205–270 n. Chr.), der bedeutendste Neuplatoniker – dieser wirkte in Rom. Die verschiedenen Phasen und Strömungen der Akademie lassen sich wie folgt zusammenfassen: In der ersten Phase, der Älteren Akademie, standen das ehrende Gedenken Platons (z.B. durch die ritualisierte Feier seines Geburtstages) sowie die Erklärung und Ergänzung seiner Werke im Vordergrund. Dennoch sind Offenheit und kontroverser Dialog auch hier durchgängig erkennbare Leitgedanken. Das zeigt sich beispielsweise daran, dass ein bedeutendes Mitglied, Herakleides Póntikos, früher nicht der Akademie, sondern fälschlicherweise der Schule des Aristóteles zugerechnet wurde – es war durchaus möglich, ja es wurde sogar als Gewinn bringend angesehen, wenn sich ein Akademiker intensiv mit anderen Strömungen befasste. Weitere Hauptvertreter dieser frühen Zeit waren Speusípp (Platons Neffe und Nachfolger) sowie Krates. Kennzeichen der zweiten Phase, der Jüngeren Akademie, ist die Rückbeziehung auf Sókrates und dessen Skepsis. Sie beginnt mit Arkesiláos und erreicht um 150 v. Chr. ihren Höhepunkt mit Karnéades. Der Neuplatonismus schließlich ist eine zeitlich, inhaltlich und regional zerklüftete Bewegung im Grenzbereich zwischen Philosophie, Theologie und Mystik. Aristóteles und der Perípatos Aristóteles (384–322 v. Chr.) stammte aus dem nordgriechischen Stageira und war der bedeutendste Schüler Platons. Er wurde nach Platons Tod (347 v. Chr.) Lehrer des makedonischen Prinzen und späteren Königs Alexanders des Großen. 334 v. Chr. gründete er in Athen seine eigene philosophische Schule, die man nach der Wandelhalle als Raum für die Lehrgespräche Perípatos nannte (griech. peripateîn umherwandeln). Von den Werken des Aristóteles sind nur die ursprünglich als Vorlesungsmanuskripte konzipierten Schriften erhalten. Die für die Öffentlichkeit publizierten und in der Antike wegen ihrer sprachlichen Eleganz viel gerühmten Dialoge sind hingegen verlorengegangen. Im Rahmen der griechischen Philosophie könnte man Aristóteles den großen Systematiker und Empiriker nennen. Anders als Platon suchte Aristóteles das eigentliche Wesen der Dinge nicht in einer Ideen-Welt außerhalb der empirischen Realität, sondern in den real existierenden Dingen selbst. Anstelle des platonischen Dualismus von empirisch wahrnehmbaren Gegenständen und den nur immateriell existierenden Ideen unterschied Unikurs Latein © C.C. Buchners Verlag, Bamberg 2011 (BN 7595) 6 Aristóteles zwischen Form (griech. morphé, lat. forma) und Materie (griech. hýlē, lat. materia), die aber beide notwendigerweise nur im Zusammenhang mit den Gegenständen selbst denkbar sind. Dieser starke Diesseitsbezug und das Interesse für die gegenständliche Welt führten dazu, dass Aristóteles im Bereich der Naturwissenschaften, der Zoologie, Botanik, aber auch der Politik, Geschichte usw. als erster antiker »Philosoph« groß angelegte Sammlungen von Daten sowie grundlegende Systematisierungen durchführte, wie sie auch in den modernen Wissenschaften üblich sind. Diese Tendenz zum Realismus ist auch kennzeichnend für die Staatslehre: Aristóteles interessierte sich anders als Platon nicht so sehr dafür, wie ein idealer Staat im Sinne einer Staatsutopie aussehen sollte, sondern legte eine umfassende Sammlung real existierender Verfassungen von Stadtstaaten an, die er analysierte und auswertete. Wie schon frühere Autoren unterschied er die Verfassungsformen Monarchie, Aristokratie und Demokratie, die wiederum auch Entartungsformen aufweisen konnten. Eine Wertung dieser Verfassungsformen nahm Aristóteles nicht vor. Aufgrund seiner Forschungen kam er aber zu dem Ergebnis, dass sich eine Mischverfassung im Sinne einer gemäßigten Volksherrschaft (»Politie«) als die stabilste erweise. Den Menschen definierte Aristóteles als ein von Natur aus soziales und zu staatlicher Gemeinschaft neigendes Wesen (griech. zôon politikón), was wiederum auf seinen empirischen Erfahrungen beruhte. Sinn und Zweck des Staates liegen nach Aristóteles darin, den Bürgern ein Leben in ethischer Vollkommenheit und persönlicher Unabhängigkeit zu garantieren. Ein wesentliches Merkmal aristotelischer und peripatetischer Philosophie ist neben der Tendenz zum Realismus auch das Prinzip der »goldenen Mitte« (griech. chrysê mesótēs, lat. aurea mediocritas). Im Bereich der Ethik und Pädagogik wird die ideale Handlungsnorm als das rechte Maß zwischen zwei Extremen bestimmt. So liegt die Tugend der Tapferkeit zwischen falscher Feigheit und falscher Tollkühnheit, die Großzügigkeit wird als das rechte Maß zwischen den Extremen des Geizes und der Verschwendungssucht definiert. Auch im Bereich der Affekte bzw. »Leidenschaften« plädiert Aristóteles für die goldene Mitte: Ganz anders als etwas später die frühen Stoiker lehnt er die Affekte wie Angst oder Lust nicht grundsätzlich ab, sondern sieht in der Mitte zwischen zügelloser Wollust und Abgestumpftheit das Ideal. Anders als Platon ging der Realist Aristóteles nicht davon aus, dass rechte Einsicht allein den Menschen zum richtigen bzw. tugendgemäßen Handeln führe. Stattdessen muss ethisch verantwortliches Handeln auch durch Erziehung gelernt und antrainiert werden. In Rom lehnte sich besonders Cicero vielfach an Aristóteles an: Er übernahm die Form des literarischen Dialogs zur Vermittlung philosophischen Gedankenguts und ließ sich auch in seiner Staatstheorie von Aristóteles beeinflussen. Der spätantike Philosoph Boëthius (480–524 n. Chr.) übersetzte später Teile des aristotelischen Corpus ins Lateinische und versuchte eine Synthese zwischen den Lehren von Platon und Aristóteles. Als die Araber das Byzantinische Reich allmählich eroberten, übersetzten sie die aristotelischen Schriften ins Arabische. In Spanien wurden diese arabischen Aristóteles-Schriften weiter ins Lateinische übersetzt, was zu einer großen Aristóteles-Renaissance im hohen Mittelalter führte: Besonders scholastische Theologen wie Thomas von Aquin (1225–1274) verbanden die Lehren des Aristóteles mit der Dogmatik der katholischen Kirche. Unikurs Latein © C.C. Buchners Verlag, Bamberg 2011 (BN 7595) 7 Kêpos (Epikúr) Kêpos (griech., Garten) ist das Stichwort, mit dem die Lehre Epikúrs bezeichnet wird. Denn zu seiner Schule gehört ein Lebensentwurf, der das Zusammenleben in einer Wohngemeinschaft mit einem zugehörigen Garten vorsieht. Epikúr (341–270 v. Chr.) stammte aus Samos und ließ sich schließlich in Athen nieder. In seinem »Garten«, dem Versammlungsort seiner Schüler, waren Anhänger aus allen Gesellschaftsschichten willkommen, auch Frauen, Ehepaare, Prostituierte und Sklaven. Epikúrs Denken kann in den Grundpositionen rekonstruiert werden, obwohl seine umfangreichen Werke nur fragmentarisch überliefert sind. Darin ist ein schmuckloser Stil erkennbar, der auf rhetorische Wirkung und Eleganz bewusst verzichtet. In seiner Naturphilosophie steht Epikúr in der Nachfolge von Demokrits Materialismus und geht davon aus, dass die Welt aus Atomen aufgebaut ist. Im Gegensatz zu Platon glaubt Epikúr, dass auch die Seele letztlich aus Atomen besteht – und ebenso sterblich ist wie der Körper. Götter gibt es, so Epikúr, aber sie sind sorglose Lebewesen, die sich nicht für die Menschen interessieren. Feindselig steht Epikúr den mathematischen Wissenschaften gegenüber, die er für unnütz hält. Worauf richtet sich also der gedankliche Fokus eines Epikuréers? Eindeutig auf das Diesseits, auf die begrenzte Lebenszeit, die jedem Menschen zur Verfügung steht und die mit größtmöglichem Lebensglück (griech. eudaimoníā) ausgefüllt werden sollte. Seine Ethik richtet Epikúr auf den Begriff der Lust aus (griech. hēdoné), was ihm in der Folgezeit Anfeindungen und Missverständnisse eingebracht hat. Denn Epikúr definiert Lust gerade nicht als Ausschweifungen, wie es der Begriff Hedonismus später suggeriert, sondern in erster Linie als innere Ruhe (ataraxíā) und Abwesenheit von Schmerz. In seiner persönlichen Lebensführung galt er als Asket. Epikúr sagt, dass schon dem Verhalten von Kleinkindern die natürlichen Bedürfnisse des Menschen abgelesen werden können, und zwar so eindeutig, dass sich jeder Beweis erübrige. Das, was der Körper will, ist: nicht frieren, nicht hungern, nicht dürsten. Das, was die Seele will, ist: nicht traurig sein und keine Angst haben. Seine Beschreibung des menschlichen Lebenszieles (griech. télos) besteht also aus negativen Bestimmungen. Obwohl Epikúr als Philosoph der Lust etikettiert wird, hat auch er sich eingehend mit der Frage der Gerechtigkeit beschäftigt. Gegenüber Platons Politeíā – sowie einem verlorengegangenen Hauptwerk des Aristóteles in vier Büchern über die Gerechtigkeit – bezieht Epikúr polemisch Stellung, indem er sowohl die Idee der Gerechtigkeit als auch jede Art von Naturrecht negiert. Für ihn basiert jede Form von Gesetzlichkeit auf Abmachungen der Menschen untereinander, die sich je nach Zivilisationsstand, Ort und Sachlage wandeln. Ein weiteres zentrales Thema ist für Epikúr die Freundschaft. Einerseits entsteht sie aus einem Bedürfnis nach Sicherheit, Ruhe und Lust, andererseits entwickelt sie sich, laut Epikúr, durch Gewöhnung zu etwas Selbständigem: Man hat Freunde, weil man mit ihnen glücklich ist. Epikúrs praktische Lebenshilfe und seine, für damalige Philosophen unübliche Toleranz gegenüber dem Volksglauben führte zu einer erstaunlichen Popularität und Verbreitung seiner Gedanken, aber auch zu klischeehaften Vorstellungen. So wurde das Motto »Lebe im Verborgenen!« (griech. »láthe biósās«) zum Inbegriff des Epikureísmus als einer individualistischen Lebenshaltung, die sich ins Private zurückzieht und keinen Beitrag für die Gemeinschaft liefert. Allerdings gibt es diverse Beispiele für Unikurs Latein © C.C. Buchners Verlag, Bamberg 2011 (BN 7595) 8 Epikuréer, insbesondere in römischer Zeit, die in diesem Punkt eine andere Lebenseinstellung zeigten. Überhaupt werden heute die Gemeinsamkeiten des Epikureísmus mit anderen philosophischen Richtungen wieder stärker betont: Das Sammeln von Hypothesen teilt Epikúr mit den Aristotelikern, die ethischen Nützlichkeitserwägungen mit den Sophisten und das Konzept der inneren Autonomie und Eudaimonie mit der konkurrierenden Stoá. Ein ambivalentes Verhältnis zu Epikúr hatten stets die römischen Eliten, denen sein Bekenntnis zur Privatheit und sein Lustprinzip suspekt war und die sich doch immer wieder davon angezogen fühlten. Ein bedeutender römischer Epikuréer war der Dichter Lukrez (ca. 97–ca. 56 v. Chr.), der in seinem unvollendeten Lehrgedicht De rerum natura in sechs Büchern einzelne Themen aus der Philosophie Epikúrs darstellt. Während in der Antike polemische Angriffe die Reputation des Kêpos nachhaltig beeinträchtigten, fand Epikúr in der Neuzeit begeisterte Fürsprecher in Karl Marx, der seine Dissertation über Epikúr schrieb, Nietzsche oder auch Albert Einstein. Stoá Die Stoa war in der römischen Oberschicht seit der ausgehenden Republik die angesehenste und beliebteste Philosophenschule. Dies liegt an dem hohen Stellenwert, den die virtus (Tugend) und das Engagement für Gemeinschaft und Staat sowohl in der Stoa als auch in der römischen Nobilität besaßen. Begründet wurde die Stoa von Zenon von Kition (ca. 336–264 v. Chr.), der in der »bunten (Markt-)Halle« (stoá poikílē) von Athen seine Vorlesungen abhielt. Weitere zentrale frühe Stoiker waren Kleanthes († 232 v. Chr.) und Chrysipp (ca. 281–208 v. Chr.). Deutlich unterschieden ist von dieser ersten Phase der älteren Stoa die mittlere Stoa mit ihren Hauptvertretern Panaítios (ca. 180–110 v. Chr.) und Poseidónios (ca. 135–51 v. Chr.), der wiederum auch eine Zeit lang Ciceros philosophischer Lehrer war. Wiederum eine teilweise neue Entwicklung stellt die späte Stoa in der römischen Kaiserzeit dar: Wichtige Vertreter in Rom sind der jüngere Seneca (ca. 4 v. Chr.–65 n. Chr.) und Kaiser Marc Aurel (121–180 n. Chr.). Ganz generell kann man die ältere Stoa als besonders rigoros in ihren Lehrsätzen charakterisieren. Dagegen war die mittlere Stoa stark von aristotelischen bzw. peripatetischen Vorstellungen – wie z.B. dem rechten Maß – beeinflusst. Die späte Stoa der Kaiserzeit kehrt wieder zum Rigorismus der älteren Stoa zurück. Wie auch bei den anderen hellenistischen Philosophenschulen steht ebenso bei den Stoikern die Frage nach dem glückseligen Leben (griech. eudaimoníā, lat. beatitudo) im Mittelpunkt der Philosophie. Zu erreichen ist dieses Ideal durch ein Leben »gemäß der Natur« (griech. homologouménōs tê phýsei zên, lat. secundum naturam vivere). Die eigentliche Natur des Menschen besteht nach stoischer Lehre in einem vernunftgemäßen Leben, denn die Vernunft (griech. lógos, lat. ratio) ist das entscheidende und unverlierbare Wesensmerkmal, das den Menschen von allen Lebewesen unterscheidet. Durch seine Vernunft hat der Mensch zugleich Anteil am Göttlichen, das in der Stoa als lenkende Weltvernunft definiert wird. Typisch für die Stoa ist ein pantheistisches Welt- Unikurs Latein © C.C. Buchners Verlag, Bamberg 2011 (BN 7595) 9 und Gottesbild, d.h. ganz anders als in der traditionellen griechischen und römischen Religion wird nicht die Existenz vieler personenhaft gedachter Götter angenommen, sondern der ganze Kosmos wird entweder als Gott definiert oder zumindest als vom göttlichen Geist durchdrungen gedacht. Alles Geschehen in der Welt ist nach stoischer Lehre von dieser lenkenden Weltvernunft als Schicksal (griech. heimarménē, lat. fatum) determiniert. Das Wirken der Weltvernunft ist zugleich von Fürsorge (griech. prónoia, lat. providentia) gegenüber dem Menschen und dem Kosmos bestimmt. Der Zweck philosophischer Beschäftigung liegt darin, den Menschen mithilfe des Gebrauches der ratio zur freiwilligen Annahme seines Schicksals anzuleiten. Die Philosophie vermittelt dem Menschen Einsicht in das Notwendige. Die Freiheit seines Willens besteht lediglich darin, das fatum freiwillig anzunehmen oder sich das Leben durch inneren Widerstand zu erschweren. Aufgrund dieser umfassenden Vorherbestimmung des menschlichen Schicksals und der pantheistischen Gottesauffassung erübrigt sich nach stoischer Auffassung auch der Kult für die Götter, da sich der göttliche Wille – anders als nach traditioneller antiker Vorstellung – nicht durch menschliche Akte nachträglich beeinflussen lässt. Auf der anderen Seite gehört zur Annahme des Schicksals auch die Verpflichtung zur Übernahme der vom Schicksal aufgetragenen Aufgaben, was z.B. politische, soziale oder gesellschaftliche Verpflichtungen – etwa durch die Übernahme von Staatsämtern – impliziert. Jeder Mensch ist verpflichtet, die ihm vom Schicksal zugewiesene Rolle im Leben auszufüllen. Ein weiterer zentraler Punkt der stoischen Lehre ist die Güterlehre: Als höchstes Gut wird die »Tugend« (griech. areté, lat. virtus) definiert. Die Tugend hat erreicht, wer »nach der Natur«, d.h. in vollständiger Übereinstimmung mit der Vernunft, lebt. Hierzu gehört auch die Einsicht in wahre und falsche Güter: Wahre Güter sind unverlierbar und notwendig zum Erreichen der Glückseligkeit im Sinne der inneren Autonomie; falsche Güter hingegen sind alle scheinbaren Wohltaten der fortuna (»zufallsbedingtes Schicksal«) wie Reichtum, Erfolg, Gesundheit u.a., weil sie die fortuna wieder fortnehmen kann. Diese scheinbaren Güter sind ebenso wie Schicksalsschläge (Misserfolg, Krankheit, Armut, Tod u.a.) für Erreichen oder Verlust der Tugend irrelevant, weswegen sie im Griechischen als adiáphora (Pl.; Sg.: adiáphoron irrelevant) bezeichnet werden. In der mittleren Stoa wurde unter peripatetischem Einfluss den Adiaphora ein gewisser Anteil am glückseligen Leben zugemessen, da die Peripatetiker ein Mindestmaß an Lebenssicherheit als notwendig für Glück ansahen. Die späteren Stoiker wie Seneca hingegen lehnten diese Aufwertung der Adiaphora ab. Mit der stoischen Güter- und Schicksalslehre hängt das Problem der Theodizee zusammen, d.h. die Frage, warum es guten Menschen schlecht und schlechten Menschen gut gehen kann, obwohl doch eigentlich ein fürsorgliches Schicksal (providentia) die Geschicke der Menschen lenkt. Nach stoischer Auffassung handelt es sich bei vermeintlichen Schicksalsschlägen dagegen lediglich um Adiaphora, die der virtus der guten Menschen nicht schaden, sondern als Härtetraining für die virtus verstanden werden können. Insofern kann gerade die wohlwollende providentia den Menschen besonders harte Schicksalsschläge schicken, um sie gegen das Wirken der fortuna zu immunisieren. Ein weiterer Störfaktor für das Erreichen der Glückseligkeit sind die Affekte bzw. »Lei- Unikurs Latein © C.C. Buchners Verlag, Bamberg 2011 (BN 7595) 10 denschaften« (z.B. Angst, Zorn, Schmerz, Trauer, Verliebtheit, Lust oder Gier). Diese Affekte behindern die Seelenruhe (lat. tranquillitas animi) und dürfen nach alt- und spätstoischer Auffassung daher von vornherein gar nicht zugelassen werden. Denn wenn sie erst einmal Eingang in die Psyche gefunden haben, lassen sie sich nicht mehr kontrollieren und setzen den Verstand außer Kraft, so dass kein vernunftbestimmtes Handeln mehr möglich ist. Ziel ist daher die völlige Affektlosigkeit bzw. »Apathie« (griech. apátheia). In der mittleren Stoa hatte Poseidónios hingegen unter aristotelischem Einfluss die Affekte nicht gänzlich verdammt, sondern lehrte lediglich deren Zügelung, damit man nicht von ihnen beherrscht wird. Stark beeinflusst von den Gedanken der mittleren Stoa war Cicero, was sich v.a. in seinem Werk De officiis (Vom pflichtgemäßen Handeln) – einer Bearbeitung eines Werkes von Panaítios – zeigt. Die Tugend- und Pflichtenlehre der Stoa spielen in Ciceros Dialogen eine wichtige Rolle, allerdings lehnt er den deterministischen Schicksalsglauben der Stoiker ab (z.B. in De natura deorum und De divinatione). Ein dogmatischer Stoiker war hingegen Seneca der Jüngere, der in seinen Briefen zur Ethik (Epistulae morales) und seinen philosophischen Dialogen mithilfe zahlreicher Beispiele eine Verbindung von stoischer Lehre und konkreter Lebenspraxis schaffen will. Stoisch beeinflusst sind auch die christlichen Kirchenväter der Antike: Sie übernehmen u.a. die Vorstellung von der göttlichen Natur des Menschen oder auch die Güterlehre, wonach alles Diesseitige (Erfolg wie Misserfolg) als für das Seelenheil irrelevante Adiaphora gedeutet wird. Bei dem Kirchenvater Augustinus und auch bei dem Genfer Reformator Johann Calvin hatte der stoische Determinismus eine bedeutende Nachwirkung in der Prädestinationslehre, d.h. der göttlichen Vorherbestimmung des Menschen entweder für die Verdammnis oder die Erlösung. Dagegen führten die pantheistischen Vorstellungen gerade bei einigen dem Christentum fernstehenden Humanisten und Philologen der frühen Neuzeit zu einer regelrechten Renaissance des Stoizismus (sog. Neostoizismus). Unter stoischem Einfluss stand vermutlich auch die Entwicklung einer Vorstellung von Menschenwürde und Menschenrechten in der Neuzeit, da die Stoiker schon die prinzipielle Gleichwertigkeit aller Menschen aufgrund der allen gemeinsamen göttlichen Natur annahmen. Unikurs Latein © C.C. Buchners Verlag, Bamberg 2011 (BN 7595) 11