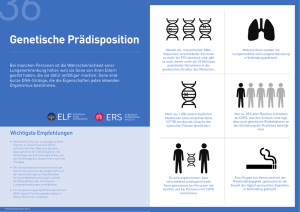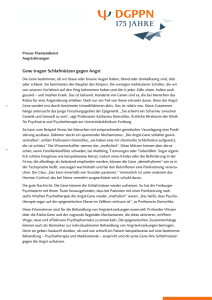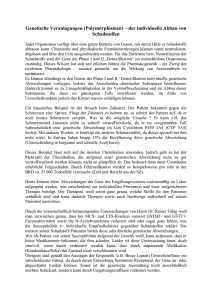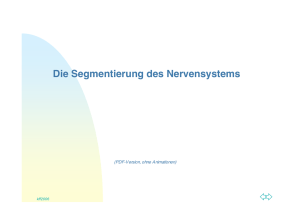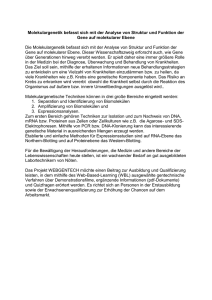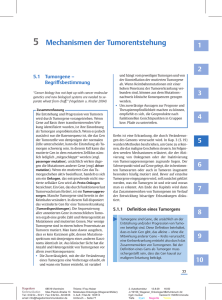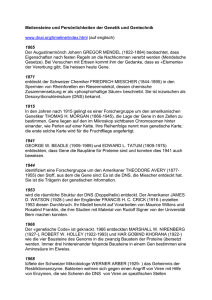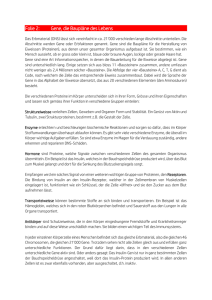Bedeutung der Gene nicht überschätzen
Werbung

W I S S E N S C H A F T Genetik und Psyche Bedeutung der Gene nicht überschätzen Die Entdeckung genetischer Einflüsse hat das Verständnis von psychischen Erkrankungen verändert. Weitere Forschungsarbeiten werden die Grundlagen für spezifische Therapien schaffen. D ie Genforschung hat in den letzten Jahren unser Verständnis von psychischen Erkrankungen revolutioniert. Für viele Phänomene, die bisher nur theoretisch beschrieben worden waren, sind biologische Grundlagen entdeckt worden. So konnte zum Beispiel der prägende Einfluss früher Kindheitserfahrungen nachgewiesen werden. Anhand von Tierversuchen zeigte sich, dass Stress, etwa durch mangelhafte Versorgung oder durch Trennung von der Bezugsperson hervorgerufen, das hormonelle System und damit die Entwicklung der neuronalen Verbindungen in ungünstiger Weise beeinflusst. Mythos von der „Macht der Gene“ Es kursieren verschiedene Mythen und Missverständnisse über die „Macht der Gene“. So wird häufig irrtümlich angenommen, dass ein einzelnes abnormes Gen für eine Krankheit verantwortlich ist. Tatsächlich ist meist eine große Anzahl von Genen dafür ausschlaggebend. Ein Gen ist auch nicht per se gut. „Es kann einerseits ein Risikofaktor für eine psychische Störung sein, andererseits aber auch eine Schutzwirkung haben“, sagt Prof. Dr. Dr. Hermann Faller vom Würzburger Institut für Psychotherapie und Medizinische Psychologie. Gene lösen zudem nicht per se Krankheiten aus. Sie sind lediglich eine Disposition, das heißt, das Erkrankungsrisiko ist erhöht, aber die Krankheit muss nicht zwangsläufig ausbrechen. Maßgeblich für Latenz oder Ausbruch einer Krankheit sind oft Umwelteinflüsse. PP Heft 2 Februar 2004 Deutsches Ärzteblatt Obwohl Zahlen bestechend sind, gibt es tatsächlich keinen festen Wert der Erblichkeit für eine Störung. Die Wahrscheinlichkeit, mit der beispielsweise ein eineiiger Zwilling von der gleichen Störung wie sein erkrankter Kozwilling betroffen ist, ist nicht absolut zu ermitteln. Vielmehr beziehen sich die Angaben auf die jeweilige Population, an der die Untersuchung durchgeführt wurde. Manchmal verändern sich die Werte auch durch kulturelle Einflüsse. Es handelt sich daher um Näherungswerte, an denen man sich im Einzelfall nur ungefähr orientieren kann. Über die Wechselwirkung von Umwelt und Genen weiß man teilweise noch zuwenig. Dennoch sollte man sich bewusst sein, dass sich Gene und Umwelt gegenseitig verstärken oder blockieren können. Die Kenntnis von einer genetischen Veranlagung reicht deshalb noch nicht aus, um den Einzelfall bewerten zu können. Dazu muss auch immer bekannt sein, wie ein Patient lebt und was er erlebt hat. Ein weiterer Mythos ist die Annahme, dass bei einer hohen Erblichkeit Umweltinterventionen nutzlos sind. Denn die Effektivität solcher Interventionen hängt allein von der Wirkungsweise eines Gens und nicht von der Höhe seiner Erblichkeit ab. So kann schon eine spezifische Ernährungsweise dazu führen, dass die Auswirkungen eines Gens nivelliert werden. Mit der Identifizierung von Krankheitsgenen wird schnell die Hoffnung auf effektive Therapien verbunden. Dazu zählt auch die Vernichtung des Gens. Dies ist praktisch jedoch kaum umzusetzen. Zur Untersuchung genetischer Komponenten von psychischen Erkrankun- PP gen werden verschiedene Verfahren eingesetzt. Zwei gängige Methoden der phänotypischen Genetik sind Zwillings- und Adoptionsstudien. Sie ermöglichen es, den Einfluss der gemeinsam geteilten Gene und der geteilten beziehungsweise nichtgeteilten Umwelt bei Geschwistern und Familienangehörigen festzustellen. Eine familiäre Häufung einer Erkrankung bei genetisch identischen oder genetisch ähnlichen Angehörigen wird als Beleg für einen genetischen Einfluss angesehen. Zur Klärung genetischer Faktoren werden außerdem molekulargenetische Methoden, insbesondere Kopplungsund Assoziationsuntersuchungen angewendet. Sie zielen darauf ab, spezifische Gene oder Genkonstellationen zu finden, die mit dem Auftreten einer psychischen Erkrankung assoziiert sind. Durch Kopplungsanalysen wird versucht, die Lage des Krankheitsgens auf dem Genom zu ermitteln. Dabei macht man sich das Phänomen zunutze, wonach zwei Gene manchmal überzufällig häufig miteinander vererbt werden. Ist die Lokalisation des einen Gens (Markergen) bekannt, kann es über die bisher unbekannte Lokalisation des anderen Gens (Krankheitsgen) Aufschluss geben. Bei Assoziationsuntersuchungen werden Rückschlüsse von einer Krankheit auf die beteiligten Gene gezogen. Assoziation bedeutet, dass eine Krankheit in einer nicht verwandten Population häufig zusammen mit einem bestimmten Genanteil (DNSSequenzvariante) auftritt. Die DNSSequenzvariante kann, muss aber nicht, mit der Krankheit in Zusammenhang stehen. Bipolare Störungen: Erhöhtes Risiko für Angehörige Durch diese Methoden ist heute bekannt, dass so gut wie alle psychischen Erkrankungen eine genetische Grundlage haben, so zum Beispiel die affektiven Störungen. Familienstudien belegen, dass erstgradig Verwandte von Patienten mit einer bipolar affektiven Störung ein deutlich erhöhtes Risiko haben, ebenfalls zu erkranken. Bei eineiigen Zwillingen beträgt dieses Risiko 40 bis 70 Prozent, bei anderen Verwand- 71 PP W I S S E N S C H A F T ten immerhin fünf bis zehn Prozent. „Zur Entstehung der Krankheit tragen mehrere Gene mit unterschiedlicher Stärke bei“, meint Prof. Dr. Marcella Rietschel von der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Bonn. Bei Angehörigen ersten Grades von unipolar Erkrankten ist das Risiko um mindestens 15 Prozent gesteigert. Auch bei der Entstehung von Angsterkrankungen sind genetische Faktoren beteiligt. Ihr Einfluss auf die Entstehung der Panikstörung wird auf 35 bis 48 Prozent geschätzt. Darüber hinaus treten auch Phobien, posttraumatische Belastungsstörungen und die generalisierte Angststörung familiär verstärkt auf. Die bisherigen Untersuchungen belegen einen deutlichen, aber nur mäßig ausgeprägten Einfluss genetischer Faktoren, deren Natur noch weitgehend ungeklärt ist. „Bisher sind nur begrenzte Aussagen über die Rolle spezifischer Loci oder Gene in der Entstehung der Erkrankung möglich“, betonten Priv-Doz. Dr. Jürgen Deckert und Katharina Domschke von der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Münster. Zur familiären Häufung und Erblichkeit von Zwangsstörungen liegen nur spärliche Befunde vor. „Ein genetischer Einfluss ist anzunehmen, er scheint bei Zwängen jedoch geringer zu sein als bei anderen psychischen Störungen“, betonte Prof. Dr. Wolfgang Maier von der Universität Bonn. Schizophrenie tritt familiär besonders häufig auf und hat damit ebenfalls eine belegte genetische Komponente. Die Wahrscheinlichkeit für Angehörige schizophren erkrankter Geschwister oder Eltern, ebenfalls zu erkranken, liegt bei eineiigen Zwillingen bei 46 Prozent, bei zweieiigen Zwillingen bei 14 Prozent, bei Geschwistern bei 13 Prozent und bei Kindern von Erkrankten bei 12 Prozent. Das Erkrankungsrisiko in der Allgemeinbevölkerung beträgt hingegen ein Prozent. Der Erbgang ist unklar. Gene, die für Schizophrenie verantwortlich sein könnten, wurden bisher noch nicht eindeutig identifiziert. Alkoholabhängigkeit tritt familiär relativ häufig auf. „Die Wahrscheinlichkeit für Angehörige ersten Grades von 72 Alkoholabhängigen, selbst zu erkranken, ist um das Drei- bis Vierfache höher als das der Allgemeinbevölkerung“, sagt Dr. med. Petra Franke, Oberärztin an der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Bonn. Monozygote Zwillinge haben ein zehnfach erhöhtes Risiko. Es gilt als gesichert, dass die familiäre Übertragung der Alkoholabhängigkeit ein polygenetisches Geschehen ist. Inzwischen wurden vier klar umschriebene Genorte ausgemacht. Daneben spielen Nachahmung und häusliches Milieu eine Rolle. Genetische und Umgebungsfaktoren werden als etwa gleichbedeutend angesehen. Auch andere Suchtformen wie Drogen- oder Nikotinsucht scheinen auf genetischen Grundlagen zu beruhen. So legen etwa Zwillingsstudien die Existenz einer familiär geteilten Vulnerabilität zum Drogenmissbrauch nahe. Bei der Heroinabhängigkeit ist der genetische Einfluss am stärksten, beim Konsum von Haschisch sind Familie und Umgebung hingegen bedeutsamer als der genetische Faktor. Einfluss von Umweltfaktoren bleibt wichtig Die Entdeckung genetischer Einflüsse hat das Verständnis von psychischen Erkrankungen verändert. Weitere Forschungsarbeiten werden Grundlagen für spezifische Therapien schaffen. Allerdings sollte die Bedeutung der Gene nicht überschätzt werden. Bisher hat nur selten eine genetische Forschung einen höheren Einflussanteil als 50 Prozent der Gene demonstrieren können. Damit bleibt der Einfluss von Umweltfaktoren wichtig. Die altbekannte Debatte um den Einfluss von Umwelt und Vererbung ist damit nicht überflüssig, sondern kann in Zukunft immer differenzierter geführt werden. Dr. phil. Marion Sonnenmoser Literatur 1. Berger M: Psychische Erkrankungen. 2. Auflage. München: Urban & Fischer 2004. 2. Beutel ME: Neurowissenschaften und Psychotherapie. Psychotherapeut 2002; 1: 47: 1–10. 3. Faller H: Verhaltensgenetik. Psychotherapeut 2003; 2: 48: 80–92. 4. Köhler T: Biologische Grundlagen psychischer Störungen. Stuttgart: Thieme 1999. 5. Psychoneuro 2003; 29 (4). Referiert Ältere Angstpatienten Therapie und Ablauf modifizieren A ngststörungen zählen zu den häufigsten Störungen im höheren Lebensalter. Ältere Menschen werden öfter als jüngere vorwiegend medikamentös behandelt, vor allem mit Antidepressiva und SSRI. Welche nichtmedikamentösen Verfahren effektiv sind, prüften jetzt zwei Wissenschaftler von der Universität Bergen. Sie werteten 15 Studien aus, an denen 495 Patienten teilnahmen und bei denen 20 verschiedene Verfahren eingesetzt wurden. Die Verfahren wiesen eine Effektstärke von .55 auf. Das bedeutet, dass eine Psychotherapie älteren Menschen helfen kann, Ängste abzubauen. Ohne Behandlung zu bleiben und auf Spontanheilung zu hoffen, ist hingegen die schlechtere Wahl. Wie lange die Therapieeffekte andauern, darüber können die Forscher keine einheitlichen Aussagen treffen, da die Studien in diesem Punkt kaum vergleichbar waren. „Einige Studien weisen jedoch darauf hin, dass die Therapieerfolge auch nach zwölf Monaten noch nachweisbar waren“, so die Forscher. Die Studien geben außerdem Aufschluss über einige Besonderheiten, die hinsichtlich älterer Angstpatienten beachtet werden müssen. So sind Therapie und psychosoziale Versorgung älteren Menschen oft weniger zugänglich, da sie stärker an Haus und Wohnort gebunden und weniger mobil sind. Das muss bei der Erstellung eines Behandlungsplans berücksichtigt werden. Es zeigte sich außerdem, dass die Behandlung in Gruppen wirksamer ist als Einzelsitzungen. Die Therapie älterer Angstpatienten erfordert es zudem, dass Verfahren und Abläufe modifiziert und ms angepasst werden. Nordhus IH, Pallesen S: Psychological Treatment of LateLife Anxiety: An Empirical Review. Journal of Counseling and Clinical Psychology 2003; 71: 4: 643–651. Inger Hilde Nordhus, Department of Clinical Psychology, University of Bergen, Christiesgt. 12, N-5015 Bergen, Norway, E-Mail: [email protected] PP Heft 2 Februar 2004 Deutsches Ärzteblatt