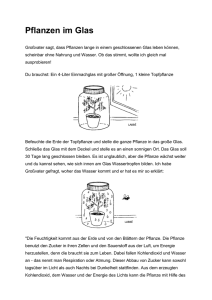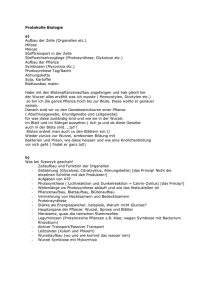botanik – ubrm 1.semester
Werbung

BOTANIK – UBRM 1.SEMESTER 1. Chemische Grundlagen Pflanzliches und tierisches Leben basiert in der Regel auf - Wasser - Organischen Verbindungen: Moleküle, aufgebaut aus Kohlenstoff, zusätzlich Sauerstoff und Wasserstoff enthalten; weitere häufige Elemente: Schwefel, Stickstoff, Phosphor, Kalium, Calcium, Magnesium Prinzipiell besteht pflanzliches leben nur aus sehr wenigen chemischen Elementen 1.1. Häufige Moleküle Die häufigsten Moleküle in Pflanzenzellen sind: - Zucker: Saccharide z.B. Glucose (Traubenzucker) - Aminosäuren: z.B. Histidin - Nucleinbasen: z.B. Thymin - Lipide: z.B. Phosphatidylcholine Sie sind in lebenden Organismen entweder als Monomere (Einzelmoleküle) oder als Oligo- und Polymere (Makromoleküle) vorhanden. Funktion und Charakter verändern sich in Polymeren beträchtlich. Sie erfüllen vielfältige Aufgaben: - Gerüstsubstanz (Zellulose, Lignin) - chemische Schutzhülle (Cutin, Suberin) - Informationsspeicher (Nucleinsäuren) - Biokatalysatoren/Enzyme (Proteine, Nucleinsäuren) 1.2. Proteine …sind beispielsweise Ketten aus Aminosäuren (Polypeptide), die durch die chemischen Eigenschaften, aber v.a. durch ihre räumliche Struktur unterschiedliche Funktionen erfüllen. - Monomere: einzelne Aminosäure (z.B. Histidin) ketten sich auseinander (Kondensation) zu einer Primärstruktur - Polymer: Polypeptid (z.B. Kette aus Aminosäure) bilden Sekundärstrultur (alpha Helix) aus und falten sich anschließenden zu einer räumlichen Tertiärstruktur Bildung eines Funktionsfähigen Proteins (z.B. Peroxidase) In vielen Fällen lagern sich mehrere Protein-Einheiten zu einer Quartärstruktur zusammen. Bsp: ATPase (dient der Fixierung chemischer Energie auf ATP) 2. Evolution 2.1 Beginn Vor ca. 4.4-3.5 Milliarden Jahren erste zellähnliche Gebilde (Protobionten) im Archaikum, vermutlich in kleinsten Hohlräumen eisenhaltiger Minerale, die abgeschlossene Reaktionsräume bilden, in denen sich Biomoleküle und einfache Strukturen bilden können. Es fehlte allerdings Sauerstoff erste Lebewesen waren deswegen anaerob. 2.2 Systematik Diversifizierung - Mutation: ungerichtete („zufällige“) genetische Veränderung im Zuge der Fortpflanzung - Selektion: evolutive Besetzung bestimmter passender ökologischer Nischen schlimmstenfalls: Aussterben Ökologische Nische ist kein räumlicher Begriff, sondern die Gesamtheit aller Umweltfaktoren (Licht, Temperatur, Boden, Wasser, Konkurrenten, etc.) Systematik (Taxonomie) entspricht einem menschlichen Grundbedürfnis, die ungeordnete Vielfalt seiner Natur zu ordnen und zu verstehen. - Phylogenie berücksichtigt die zeitliche Dimension sie entfernt sich damit von willkürlichen künstlichen Systemen und nähert sich einem natürlichen System 2.3 Artbegriff - - Morphologische Art: (taxonomische Art) phänotypische Merkmale ermöglichen Abgrenzung zur Nachbarart Nominalistische Art: nur Individuen, die Art ist vom Menschen konstruiertes Denkmodel Phylogenetische Art: Folge von Vorfahren/Nachkommen Populationen einer Abstammungsgemeinschaft mit endlicher Existenz. Beginnt durch Trennung von der Ausgangsart durch Errichtung reproduktiver Barrieren und endet mit der Aufspaltung oder Extinktion Biologische Art: Fortpflanzungsgemeinschaft aus untereinander kreuzbaren Populationen 3. Die pflanzliche Zelle 3.1. Aufbau Die pflanzliche Zelle ist umgeben von einer Zellwand, die eine stützende Funktion hat. Sie enthält Tüpfel (Poren) um den Stoffaustausch zwischen den Zellen zu ermöglichen. Dann folgt die Zellmembran, sie grenzt die Zelle ab und kontrolliert den Stoffaustausch. Zellorganellen einer Pflanzenzelle: - Chloroplasten: betreiben Photosynthese - Endoplasmatisches Reticulum (ER): raues (mit Ribosome) und glattes (ohne), bildet Membrane und andere Stoffe z.B. Fette, bildet Transportwege im Plasma - Golgi Apparat/Dictyosomenstapel: aus mehreren Golgi-Körpern, erzeugt Stoffe, stellte Stoffe (vom ER erzeugt) fertig - Mitochondrium: betreiben Zellatmung - Mikrotubuli - Ribosome: bauen Proteine (Eiweiß) auf - Vakuolen: Zellsaftraum, Speicherung von versch. Stoffen z.B. Wasser mit Kristallen - Zytoplasma Zellkern - Kernhülle - Kernpore - Kernplasma: Karyoplasma - Nucleolus: Kernkörperchen, bildet die Ribosomen Kompartimierung durch Biomembran: Schaffung getrennter Reaktionsräume 3.2. Osmose Bedingt durch selektive Permeabilität. Normalerweise folgen Stoffkonzentrationen dem Konzentrationsgradienten und gleichen sich schließen aus (Diffusion). Die Zellmembran verhindert diesen Ausgleich durch Diffusion. Da nur Wasser die Membran passieren kann, strömt solange Wasser nach, bis die Konzentration annähernd ausgeglichen ist. Systeme wie das ER und die Dictyosomenstapel sind Orte der Stoffsynthese. Aus Biomembran abgeschnürte Vesikel dienen dem Stofftransport. 3.3. Desoxyribo Nuclein Acid – DNA Träger der Erbinformation Genetischer Code dargestellt durch Abfolge der Nucleotidbase (Adenin, Thymin, Cytosin, Guanin) in Dreiergruppen (Tripletts) Nur einer der beiden Doppelstränge wird in der Zelle als Informationsquelle genutzt (codogener Strang), der andere jeweils komplementär ergänzt (Komplementärstrang). Immer gleiche Paarung der 4Basen (C-G/A-T) gewährleistet konsistente Information. 3.4. Transkription Kopieren der Information der DNA in RNA Die Packung der DNA im Chromatinfaden wird lokal gelockert, der codogene Strang wird durch das Enzym RNA-Polymerase in eine mRNA (messenger RNA) kopiert. RNA= RiboNucleinAcid – Base Uracil statt Thymin 3.5. Prozessierung der mRNA Vermittelt durch Enzyme und andere, spezielle RNAs mRNA wird vor Verlassen der Zellkerns verändert (Kappe aus Guanin zum Schutz, PolyASchwanz) Nichtcodierende Bereiche (Introns) werden herausgeschnitten, codierende (Exons) aneinandergefügt SPLEISSEN 3.6. Translation Vor Verlassen den Zellkerns – „Übersetzung“ der genetischen Information in Proteine Geschieht in den Ribosomen: bestehen aus 2 Untereinheit und fügen sich für die Proteinsynthese temporär zusammen mRNA gleitet durch ein Ribosom, Codons (Tripletts) werden in Aminosäuren übersetzt. Die transfer (t)RNA schafft die passende Aminosäure an die wachsende Proteinkette. Im Ribosom gibt es 3 tRNA Bindungsstelle (A,P,E Stelle) mit versch. Funktione (Anlieferung, Übertragung, „Entlassung“). Zu jedem Codon passt nur eine bestimmte Aminosäure. 3.7. Zellorganellen - Chloroplasten: Orte der Photosynthese, doppelte Biomembran, Thylakoidstapel (Granum), Stroma hervorgegangen aus Endosymbionten - Mitochondrien: doppelte Biomembran in Falten (Cristae) gelegt - Cytoskelett: verantwortlich für die Bewegungsvorgänge in der Zelle - Zellplasma: Cytoplasma, Karyoplasma, dicht gepackt mit Inhaltsstoffen verschiedenster Zusammensetzung Self-Assembly-Systeme aus globulären Einzelproteinen, die sich zu Röhren (Mikrotubuli) oder fadenförmigen Filamenten (Aktin) zusammenlagern - Zellwand: Streutextur der Fibrillen, pektinreich, dehnbar, bei Verlauf des Zellwachstums werden die Fibrillen auseinandergezogen. Neue Zellwandschichten werden an der Innenseite aufgelagert (pektinarm, starr: Sekundärwand). Wechselwirkung zwischen der Ausrichtung der Mikrofibrillen und der Wachstumsrichtung. Isodiametrische Zellen haben zufällig angeordnete Mikrofibrillen, das Wachstum erfolgt kugelförmig. Prosenchymatische Zellen haben parallel angeordnete, das Wachstum erfolgt daher gleichmäßog, „eckig“. - Vakuole: In der Vakuole herrscht durch Flüssigkeit ein Turgordruck, der die Blätter aufrecht hält. 3.8. Einzelligkeit - Vielzelligkeit Typische Einzeller: Euglenophyta, Cyanobakterium Beginnende Spezialisierung innerhalb einer Kolonie z.B. Kugelalge Volvox, jede Zelle ist aber nach wie vor zu eigenständigem Leben fähig. Vielzelligkeit bringt zahlreiche Vorteile - Konkurrenz: größere Organismen können mehr Nährstoffe erschließen - Risikostreuung: eine tote Zelle bei einem Einzeller bedeutet das Ende des Organismus, bei einem Vielzeller ist es jedoch mehr oder weniger egal - Spezialisierung: Ausbildung mehrerer funktionaler Zelltypen ermöglicht die Erfüllung von mehreren versch. Aufgaben - Etablierung: mehr Energie kann in die Fortpflanzung investiert werden Nachteile: - Wachstumsphase bis zur Reproduktionsfähigkeit dauert länger, deshalb „verwundbarer“ in Jugendstadien - Besser Lebensbedingungen und mehr Ressourcen notwendig 3.9. DNA Replikation Topoisomerase entwindet die DNA, Helicase spaltet den Doppelstrang in die Einzelstränge. DNAPolymerase ergänzen die Stränge von 5`zum 3`Ende, Replikation in Gegenrichtung erfolgt nur stückweise durch Okazakifragmente (Folgestrang) 3.10. Mitose häufigste Form der Kernteilung (Karyokinese) bei der aus einem Zellkern zwei Tochterkerne mit gleichem Erbgut entstehen - Prophase: Kondensation der DNA zu Chromosomen, Auflösung der Kernhülle, Aufbau des Spindelapparates aus Mikrotubuli, - Metaphase: Spindelapparat fertig, Anordnung der Chromosome entlang der Metaphasenplatte in der Mitte der Zelle - Anaphase: Trennen und Auseinanderziehen der Chromatide (Tochterchromosome) - Telophase: Zerfall des Spindelapparates, Dekondensation der Chromosome, Bildung der Kernhülle, Beginn der Cytokinese - Cytokinese: eigentliche Zellteilung, eine neue Zellmembran- und wand wird gebildet. 3.11. Zellkommunikation …ist für komplexe Organismen notwendig. Wie bei der Kugelalge Volvox über Plasmabrücken, sind alle Zellen einer Pflanze über Kommunikationsverbindungen unmittelbar verbunden zum sogenannten Symplasten. Dies geschieht über Plasmodesmen. 3.12. Organisationsformen vielzelliger Pflanzen - Thallus: einfache Formen; wenig differenziert z.B. Blasentang, Brunnenlebermoos Kormus: deutliche Gliederung in Spross, Wurzel und Blätter, Gruppe der Gefäßpflanzen (Kormophyta/Tracheophyta) umfasst Farne und Samenpflanzen z.B. Wurmfarn, Zerreiche 4. Gewebe Differenzierung ist einer der Vorteile von Vielzelligkeit. Je mehr Zellen vorhanden sind, desto mehr unterschiedliche Zelltypen können gebildet werden, die untersch. Aufgaben wahrnehmen und dem Gesamtorganismus nützen. Gewebe sind Zusammenschlüsse vieler Zeller gleichartiger Gestalt/Funktion. 4.1. Bildungsgewebe (Meristeme) Sind praktisch unbegrenzt teilungsfähig durch ihren embryonalen Charakter. Die Zellen durchlaufen permanent den Zellzyklus. Sie sind meist isodiametrisch (annähernd rund), mit nur einer dünnen Primärwand sowie unentwickelte Plastiden (Proplastiden). Die Vakuole ist winzig, der Zellkern ist Verhältnis groß und aktiv. In Gefäßpflanzen befinden sich 2. Arten von Meristemen: - Apikale (spitzenständige): in Spross und Wurzel, zuständig für Längenwachstum - Laterale (seitlich verlaufende): Dickenwachstum Sämtliche Gewebe leiten sich (in)direkt von apikalen Meristemen ab. Das Kambium geht aus dem Apikalmeristem hervor und bildet die Stranggewebe. Das Korkkambium bildet sich als sekundäres Meristem bei langlebigen Pflanzen. 4.2. Dauergewebe Entstehen aus Meristemen durch differenzielle Genaktivität. Abhängig von der Lage einer Zelle im Pflanzenkörper führen chemische Signale zum Ablesen untersch. DNA Regionen – die Zellen entwickeln sich dadurch in untersch. Richtungen. Man unterscheidet verschiedene Arten von Dauergewebe. 4.2.1. Parenchym (Grundgewebe): im ausdifferenzierten Zustand sind Parenchymzellen lebend, dünnwandig und reich an Zellzwischenräumen (Interzellularen). Sie können sich meistens wieder zu Meristemzellen zurückdifferenzieren. Intezellularen können auf untersch. Weise entstehen: - schizogen (Mittellamellen [Pektin] zwischen den Zellen werden durch Enzyme aufgelöst) - lysigen (gesamte Zellwand/Zelle durch Enzyme aufgelöst) - rhexigen (Zellen werden durch Wachstumsvorgänge zerrissen) dadurch entstehen spezifische Formen. Parenchyme können versch. Aufgaben übernehmen: - Speichergewebe (v.a. in unterirdischen Speicherorganen z.B. Kartoffel), - Assimilationsgewebe (Blättern), - Aerenchym (Belüftungsgewebe z.B. Flatter Simse), - Wasserspeichergewebe (in Spross und Blättern sukkulenter Pflanzen z.B. Aloe Vera) 4.2.2. Stützgewebe Zur Stabilisierung benötigen Landpflanzen bei zunehmender Größe besondere Festigungsund Stützgewebe. Zwei Gewebetypen gewährleisten durch verdickte Zellwände die Festigungen: Kollenchym und Sklerenchym. Sklerenchym weisen rundum stark verdickte Zellwände mit zusätzlichem Holzstoff (Lignin) verholzt. Im ausdifferenzierten Zustand sind die Zellen tot. Sie sind meist annähernd isodiametrisch: Steinzellen (Sklereiden). Sie verleihen Samen- und Fruchtschalen große Härte und Druckfestigkeit z.B. Vogelkirsche, Walnuss, Hasel Sie können jedoch auch prosenchymatisch (langgestreckt) sein und bilden dann Sklerenchymfasern. Das sind lange, schlanke Zellen, die in Bündeln oder Strängen auftreten und eine hohe Biege- und Zugfestigkeit besitzen z.B. in Stängeln, Halmen, Stämmen. Bei Gefäßpflanzen sind sie längsten Zellen (bis zu 50cm). Je nach Verholzung weicher oder härter. Aus einigen Pflanzen bilden sie Rohstoffe für Textile oder Seile z.B. Ramie, Flachs, Hanf, Sisal. In der Wachstumsphase ist die Festigkeit jedoch hinderlich, da die Gewebe noch flexibel sein müssen. Deswegen besitzen Kollenchyme nur Primärwände, die auch nur lokal verdickt und im ausdifferenzierten Zustand noch lebend sind. Sie stützen v.a. sich noch entwickelnde Pflanzenteile, können aber auch im adulten Zustand noch vorhanden sein. 4.2.3. Strang- und Leitgewebe Kleine und einfache Pflanzen (Moose, Algen) decken ihre Wasserversorgung durch Diffusion und Kapillarwirkung. Ihre Zellen sind an wechselfeuchte (poikilohydre) Bedingungen angepasst z.B. Haarmützenmoos, Luftalge. Höhere Pflanzen (Tracheophyta) vertragen kein Austrocken, sie brauchen eine gleichmäßige (Homoiohydre) Wasserversorgung. Das Leitgewebe versorgt die Organe konstant mit Wasser und ermöglicht viel größere Organismen. Axial (Längsrichtung der Sprossrichtung) ausgerichtete Gewebe dienen der Festigung und dem Stofftransport. Es gibt Xylem (Stofftransport von Wasser, mineralische Stoffe von Wurzel zu Blättern), Phloem (Stofftransport von Photosynthesenprodukten von Blättern zu Wurzeln). Sie sind in Leitbündeln untersch. Gestalt angeordnet. Zwischen Xylem und Phloem mit ihren unterschiedlichen Zelltypen befindet sich das Kambium (Meristem. XYLEM - Tracheiden: langgestreckte Einzelzellen, Verbindung durch Tüpfel, tot, verholzt, dickwandig, Wassertransport und Festigung, Wassertransport über Tüpfel. In Nadelhölzern ist dies der einzige Zelltyp, der im Xylem Wasser leitet - Tracheen/Gefäße: lange Gefäße aus Einzelzellen, Verbindungswand durchbrochen, effizientere Wasserleitung, Tüpfel zwischen Gefäßen, tot, verholzt, Wassertransport. Bei Angiospermen und einigen Farnen - Beide stehen durch Unterdruck durch Kapillarkräfte und Transpirationssog. Damit sie nicht kollabieren sind sie verholzt und ausgesteift. Ring- und schraubenförmige Verdickungen ermöglichen während des Zellwachstums Dehnung. Netzförmig und allseitig ausgesteifte Leitelemente mit Tüpfel werden nach dem Längenwachstum ausgebildet. - Xylemparenchym: unverholzt oder verholzte, lebende Zellen, keine Festigungsfunktion, Stoffspeicherung, v.a. im Holzstrahlen, z.B. bei Tanne - Xylemfasern: bei Angiospermen, schmale, lange, spitz zulaufende Einzelzellen, tot, dick verholzte Zellwand, kleine Tüpfel, nur Festigungsaufgabe und kein Transport PHLOEM - Siebröhren und Geleitzellen: physiologische Einheit aus 2 Zelltypen, die durch ungleiche Teilung entstehen, Siebröhrenglieder verlieren mit der Zeit den Zellkern, Ribosome und Vakuole, sie sind nicht mehr zur Proteinsynthese fähig und werden von ihren Geleitzellen über Plasmodesmen gesteuert und ernährt. - Phloemparenchym: lebende, Stoffspeicherung, wichtige Rolle bei Beladung und Entladung der Siebröhren mit Assimilaten - Phloemfasern: sklerenchymatische, dickwandige Zellen, untersch. Stark verholzt, nur Festigungsfunktion für dünnwandige Siebröhren 4.2.4. Abschlussgewebe: Epidermis Die oberirdischen Pflanzenkörper (Sprossachse, Blätter, Blütenteile, Früchte) werden im primären Zustand (Jugendzustand) werden von der Epidermis bedeckt. Seine Hauptaufgaben sind Regulation von Verdunstung und Gasaustausch, mechanischer und chemischer Schutz, Schutz vor UV Strahlung; außerdem: Ausscheidung, aktive Abwehr gegen Fressfeinde Die Zellen grenzen lückenlos (ohne Interzellularen) aneinander und bilden eine einschichtige Zelllage. Sie sind oft eng verzahnt, normalerweise keine Chloroplasten. Die Außenwände sind häufig verdickt v.a. an trockenen Standorten. Die Oberfläche ist von der Cudicula, einem Überzug aus Cutin und Wachsen, überzogen. Manchmal ist noch ein kristalliner Wachsfilm (epicuticulares Wachs) aufgelagert. Sie schützt vor Austrocknung. Darunter liegende Zellwand ist die Cuticularschicht. Durch starkes Flächenwachstum können Cuticularfalten entstehen, sie vermindert die Benetzbarkeit: Wassertropen rollen ab. Bei Regen haben die ablaufenden Wassertropfen eine reinigende Wirkung haben. Pilzsporen und Schmutzteilchen werden weggewaschen: LOTUS EFFEKT z.B. Lotusblume. Hauptaufgabe der Epidermiszellen ist also v.a. das Abschotten der Pflanze nach außen. Gasaustausch ist aber lebensnotwendig, das kann aber nicht beliebig erfolgen. Deswegen gibt es Spaltöffnungen, so genannte Stomata, die regelbar sind. Die Schließzellen enthalten Chloroplasten. Sie haben ungleichmäßig verdickte Zellwände. Dadurch werden Formveränderungen ermöglicht, die sich bei Änderung des Turgors auf den Grad der Spaltöffnungen auswirken. Weitere Sonderbildungen sind Trichome (Haare). Sie entstehen durch das Auswachen einzelner Epidermiszellen und sind unterschiedlich gestaltet, deswegen haben sie auch verschiedene Funktionen. - Wasserabgabe: bei Haaren aus lebenden Zellen bei sehr feuchten Standorten durch Vergrößerung der Oberfläche oder Spezialaufgaben z.B. Ausscheidung von Stoffen. Früh absterbende, lufterfüllte Haare kommen häufig bei Pflanzen trockener Standorte vor, sie setzen die Wasserabgabe herab. - Anemochorie: Verbreitung der Samen durch Wind mithilfe von Flughaaren (einfache Schlauchhaare) z.B. Weide, Baumwolle - Verdunstungsschutz: dichter Filz aus toten Etagenhaaren schützen vor starker Verdunstung durch Verringerung der Windgeschwindigkeit, außerdem schützen sie vor zu starker Erwärmung durch Sonnenstrahlung z.B. Kleinblüten-Königskerzen - Schutz: vor Fressfeinden durch Drüsenhaare, die versch. Stoffe z.B. ätherische Öle ausscheiden. Sie weisen eine kugelige Drüsenzelle an der Spitze des Stiels auf, die bei Berührung platzt und den Inhalt injiziert (Brennhaare!). Sie finden sich aber auch bei Duft- und Gewürzpflanzen v.a. bei Lippenblütler (Thymian, Salbei). Inhaltsstoffe sind häufig: Histamin, Ameisensäure und verursachen Schmerz und Schwellung. 4.2.5. Andere Abschlussgewebe Rhizodermis ist das primäre Abschlussgewebe der Wurzel, sie dient v.a. der Wasseraufnahme durch Vergrößerung der Oberfläche durch lebende Wurzelhaare. Sie ist dünnwandig und ohne Cudicula oder Spaltöffnungen. Periderm, auch genannt Borke, ist ein sekundärer Abschlussgewebe, das die Epidermis und Rhizodermis nach einiger Zeit ersetzt. Es ist ein mehrschichtiges Gewebe, dessen Zellen im Zuge der Differenzierung absterben. Es wird von einem Lateralmeristem, dem Korkkambium, gebildet. Nach außen gibt es mehrere Lagen Zellen ab, deren Wände mit Schichten aus Suberin (Korkstoff) und einem wasser- und gasdichtem Biopolymer verstärkt werden. 4.2.6. Idioblasten ...sind Zellen(gruppen), die sich von den umliegenden Gewebe durch Funktion/Form unterscheiden z.B. Trichome, Stomata. Häufig auch Kristallidioblasten, in deren Vakuole Kristalle aus Calciumoxalat liegen. Sie dienen u.a. als Fraßschutz, da sie Schleimhäute reizen. z.B. bei Wachsblume, einige Kakteen 4.3. Pflanzengruppen Zu Spermatophytina (Samenpflanzen) gehören Nacktsamer (Gymnospermen) - Nadelbäume (Coniferopsida), - Ginko-artige (Gingkoopsida), - Palmfarne (Cycadopsida) Und Bedecktsamer (Angiospermen) - Primitive Zweikeimblättrige (Magnoliidae) - Höher entwickelte Zweikeimblättrige (Eudikotyle) - Einkeimblättrige 5. Spross Kormus kann als die Anpassung des Lebens an Land verstanden werden. Er teilt sich in Blätter, die für den Stoffwechsel der Photosynthese zuständig sind oder auch für Fortpflanzung, Spross und Wurzel zur Verankerung in der Erde. 5.1. Primärer Spross Der Spross, Keimblätter und Wurzel sind bereits im Embryo im Samen angelegt. Bei der Keimung dringen sie aus dem Samen, wobei immer zuerst die Wurzel (rasche Wasserversorgung) hervordringt. Wenn der Spross an die Erdoberfläche dringt bilden sich ein Apikalmeristem, mehrere Blattanlagen (Blattprimordien), Seitenknospen und erste Blätter. Die eigentliche Aufgabe des Spross ist es anfangs noch das Meristem vor Austrocknung zu schützen. 5.1.1. Entwicklung Die Entwicklung und Differenzierung erfolgt systematisch. - Apikalmeristem, Protoderm, Prokambium und Grundmeristem - Stranggewebe und Kambium, Epidermis, Mark und Rinde - Sekundäres Dickenwachstum, Korkkambium (Phellogen) 5.1.2. Anordnung der Gefäßbündel (Leitbündel) die Anordnung der Leitbündel ist für das sekundäre Dickenwachstum von großer Bedeutung. Bei Dikotylen (Zweikeimblättrigen) und bei Gymnospermen (Nacktsamern) befinden sich die Leitbündel nur in einem Ring angeordnet am Rande des Stammes. Zwischen Xylem und Phloem befindet sich das Kambium, diese Anordnung nennt sich kollateral offene Leitbündel mit Kambium. (das Phloem außen). Bsp: Hahnenfuß Bei Monokotylen (Einkeimblättrigen) sind die Leitbündel über den gesamten Stamm verteilt, zwischen Phloem und Xylem befindet sich kein Kambium. Das nennt sich kollateral geschlossene Leitbündel. So wie z.B. bei Mais. Unter Einkeimblättrigen haben v.a. Palmen und Süßgräser große Leitbündel, die Tracheen sind mit bloßem Auge erkennbar. 5.2. Sekundärer Spross Der primäre Entwicklungsstand bleibt fast allen ein bis zweijährigen, sowie Monokotylen zeitlebens erhalten. Z.B. Acker-Hornkraut, Schwarzer Nachtschatten, Gelbstern Langlebigere Pflanzen haben jedoch das Problem, dass das Längenwachstum bei gleichbleibendem Spross Grenzen unterliegt. Das Leitgewebe kann nur eine begrenzte Menge an Biomasse mit Stoffen versorgen, mechanische Stabilität begrenzt das Höhenwachstum. Die Lösung liegt im sekundären Dickenwachstum. - Vermehrung des Leitgewebes für bessere Versorgung - Mehr Blattmasse kann gebildet und versorgt werden - Mehr Stabilität durch breite Sprosse und Festigungsversorgung des Leitgewebe - Mehr Wachstum in die Höhe möglich, mehr Licht, mehr Photosynthese Zusätzlich geschieht eine Veränderung im Kambium. Zusätzlich zum Kambium in den Leitbündel (faszikular) wird Parenchym in einer ringförmigen Zone rückdifferenziert zum (interfaszikularen) Kambium. Dadurch kann neues Gewebe gebildet werden: Phloem nach außen (sekundärer Bast), und Xylem nach innen (sekundäres Holz). 5.2.1. Bast – sekundäres Phloem Kambiumzellen bilden dieselben Zelltypen axialer Leitgewebe wie im primären Phloem: Bastfastern (Sklerenchym), Axialparenchym und Siebröhren und Geleitzellen. Bei Nacktsamern (Nadelbäumen) allerdings Siebzellen mit Geleitzellen ohne Siebplatten, sondern nur mit Siebfeldern. 5.2.2. Holz – sekundäres Xylem Kambiumzellen bilden dieselben Zelltypen axialer Leitgewebe wie im primären Holz: Tracheen und Tracheiden, Holzfasern (Sklerenchym), Axialparenchym. Bei Nacktsamern jedoch nur Tracheiden. 5.2.3. Strahlen Zunehmender Sprossdurchmesser bringt ein neues Problem: Verteilung der Stoffe muss auch von außen nach innen gewährleistet sein. Bildung eines zusätzlichen Systems: Bastund Holzstrahlen 5.2.4. Periderm, Borke Periderm als sekundärer Abschlussgewebe ersetzt die Epidermis. Durch seine Imprägnierung mit keimhemmenden Stoffen (Phenole, Gerbstoffe) und die permanente Regeneration von innen sehr widerstandsfähig. Sie werden immer wieder neu im Bast gebildet (Tiefenperiderme), die obere Schicht wird abgestoßen, es kommt zur Borkenbildung. Je nach Anlage entstehen gattungsspezifische Borkenmuster. - Ringelborke: Tiefenperiderme als geschlossene Zylinder parallel zur Stammoberfläche z.B. Birke, Kirsche - Streifenborke: Tiefenperiderme durch Parenchymstreifen unterbrochen z.B. Weinreibe, Waldrebe - Schuppenborke: Tiefenperiderme bogenförmig angelegt z.B. Kiefer, Platane 5.3. Transport im Holz Transport von Wasser und Nährsalzen erfolgt in der Pflanze über große Entfernungen und gegen die Schwerkraft. Ein wichtiger Antrieb dafür ist die Transpiration in den Blättern: das durch Verdunstung entwichene Wasser wird dem Xylem entzogen und erzeugt einen Sog, der Wasser nachzieht. Das ist ein rein physikalischer Vorgang, der keinerlei Energieaufwand für die Pflanze erzeugt. Nach der Transpirationsheorie sorgen Adhäsions- und Kohäsionskrafte des Wassers dafür, dass der Wasserfaden im Leitgewebe nicht abreißt. Transportgeschwindigkeiten sind unterschiedlich je nach Aufbau: Tracheiden (Weißtanne) 1m/h, kleinlumige Tracheen (Rotbuche) 1-6m/h, großlumige Tracheen (Bergulme) max. 44m/h, sehr groß lumige Tracheen (Waldrebe) 100m/h. Die höher entwickelten Laubhölzer haben eine bessere Leitfähigkeit durch weitlumige Gefäße, sie sind aber dafür auch anfälliger gegen Luftembolien (Kavitation). Das sind Eintritte von Luft ins Leitsystem, entweder durch Verletzung oder Frost. Sie bewirken ein Abreißen des Wasserfadens, das Gewebe füllt sich mit Luft. Nadelhözer benutzen Holztüpfel als Rückschlagventile. Die Tüpfelschließhaut besitzt einen verdickten Mittelteil (Torus) der bei Sog an die Tüpfel gezogen wird. Er verhindert somit das Ausbreiten der Luft. Sie sind entwicklungsgeschichtlich älter, geringere Leitfähigkeit durch englumige und nur über Tüpfel passierbare Tracheiden. Dafür sind sie gegen Lufteintritte resistenter. 5.3.1. Transport im Bast Transport von Assimilaten im Phloem erfolgt aktiv und bedarfsgesteuert – from source to sink. Source: jedes photosynthetisch aktive Gewebe (Blätter, primärer Spross) Sinks: alle photosynthetisch inaktiven Gewebe v.a. Meristem, Blüten, Früchte, Wurzeln Transportmechanismus ist ein Druckstrom, der durch das Beladen der Siebröhren mit osmotisch aktiven Substanzen (Zucker) verursacht wird SOURCE (QUELLE) - Geleitzelle gibt Zucker in Siebröhren ab (Beladung) - Osmotische Konzentration steigt - Wasser wird angesaugt - Druck steigt TRANSPORT DURCH DRUCKAUSGLEICH SINK (SENKE; VERBRAUCHER) - Geleitzelle nimmt Zucker aus Siebröhren auf (Entladung) - Osmotische Konzentration sinkt im Leitelement - Wasser wird abgegeben - Druck sinkt 5.4. Sprossmorphologie Am höchsten Punkt sitzt die Endknospe (Apex, Terminalknospe), wo ein Blatt aus dem Stiel wächst befindet sich ein Nodus (Blattknospen). Seitenknospen sind Stellen wo prinzipiell Knospen wachsen könnten. Die Abstände zwischen diesen nennt man Internodium. Normalerweise liegt die Länge der Abstände im cm Bereich. Es können aber auch bei derselben Pflanze Abweichungen auftreten: Kurztriebe sind Seitentriebe mit verkürzten Internodien. Die ansetzenden Blätter stehen dicht gedrängt. Bei Pflanzen mit Kurztrieben bezeichnet man die Triebe mit normaler Internodienlänge als Langtriebe. Einige Obstgehölze z.B. Vogelkirsche blühen und fruchten nur an Kurztrieben (Fruchtholz). 5.5. Sprossmetamorphosen 5.5.1. Stolonen (Ausläufer) Oberirdische Kriechsprosse mit stark verlängerten Internodien, sie dienen der vegetativen Vermehrung z.B. Kriechender Günsel, Gänse-Fingerkraut, Gartenerdbeere 5.5.2. Rhizome Unterirdische Kriechsprosse als Speicher- und Überdauerungsorgane. Blätter sind zu Schuppenblättern reduziert. Z.B. Topinambur, Wiesenlieschgras, Gartenschwertlilie 5.5.3. Sprossknolle Sprossachse gestaut (Internodien verkürzt) und stark verdickt, dient als unterirdisches Speicherorgane z.B. Kartoffel, Kohlrabi 5.5.4. Zwiebel Sprossachse extrem gestaucht, von fleischigen Blättern umhüllt, dient als Speicherorgane z.B. Küchenzwiebel 5.5.5. Windesprossen Hauptspross stark verlängert und berührungssensitiv, führt Wickelbewegungen durch, dient der Stabilisierung, oft zusätzlich mit Klimmhaaren z.B. Hopfen 5.5.6. Sprossranke Seitensprosse stark verlängert und berührungssenstiv, führen Wickelbewegungen durch, dienen der Stabilisierung z.B. Salatgurke, Weinrebe 5.5.7. Sprossdornen Seitenspross verholzt und zugespitzt, meist blattlos, Abwehr von Fressfeinden z.b: Sanddorn | Unterschied Dorn – Stachel: Dorn mit Leitgewebe, Stachel ist eine Epidermisemergenz ohne Leitgewebe 5.5.8. Stammsukkulenz Sprossachse verdickt und wasserspeichernd, oft ergrünt, Blätter oft zu Dornen oder Schuppen reduziert, Spross übernimmt die Aufgabe der Photosynthese und Wasserspeicherung z.B. Kaktusgewächse, Wolfsmilchgewächse 5.5.9. Flachsprosse Sprossachse abgeflacht und ergrünt, Blätter oft zu Dornen oder Schuppen reduziert oder fehlend, Spross übernimmt die Aufgabe der Photosynthese, Phyliokladien (Kurztriebe blattartig) und Kladodien (Langtriebe blattartig) 6. Wurzel 6.1. Primäre Wurzel Die primäre Wurzel liegt meistens unterirdisch, dient zur Verankerung und Stabilisierung und zur Versorgung der Pflanze mit Mineralstoffen und Wasser. Im Vergleich zum Spross hat sie also ähnliche Aufgaben, die auch durch ähnliche Strukturen gewährleistet werden. Bei der Keimung tritt immer zuerst die Keimwurzel aus dem Samen um die Wasserversorgung zu sichern. Durch die im Samen gespeicherten Nährstoffe (Reservestoffe) ist der Beginn der Photosynthese und das Austreiben der Keimblätter erst einmal nachrangig. Die Unterschiede zum Spross bestehen im Aufbau: eine Wurzelhaube schützt das Meristem und Wurzelhaare sichern die Wasseraufnahme. Hinter der Wurzelhaube und dem Apikalmeristem folgt eine Teilungszone, anschließend eine Streckungszone. Erst danach wachsen Wurzelhaare. 6.1.1. Wurzelentwicklung und –wachstum KALYPTRA Die Wurzelhaube wird vom Apikalmeristem abgegliedert. Ihre Zellen schilfern laufend ab, zusätzlich werden große Mengen an Schleim abgesondert. Das erleichtet der Wurzel das Durchdringen des Bodens und schützt das Meristem, denn ohne das Meristem könnte die Wurzel nicht mehr weiterwachsen. DIFFERENZIERUNGSZONE/WURZELHAARZONE Hier erhalten die Zellen ihre endgültige Funktion: Auf dem Protoderm differenziert sich die Rhizodermis, die Wasser und Mineralstoffe aus der Bodenlösung aufnimmt. Sie unterscheidet sich deutlich von der Epidermis eines Sprosses: dünnwandig, ohne Stomata, keine Chloroplasten. Einzellige Wurzelhaare wachsen in den Boden und vergrößern die Oberfläche zur Wasseraufnahme. Sie sind Auswüchse der Rhizodermis, nur in dieser Zone ist der Wuchs der Wurzelhaare möglich. Bei Absterben der Haare muss die Wurzel weiterwachsen um die Versorgung zu gewährleisten. Bei einem Querschnitt erkennt man, dass Xyem und Phloem in der Wurzel als radiäres Leitbündel angeordnet sind. Das Leitbündel umgibt das Perikambium (Perizykel), das später für die Seitenwurzelausbildung zuständig sein wird. Es folgt die Epidermis und die Wurzelrinde. Dieser Aufbau bewirkt das spätere Seitenwurzeln erst die Wurzel von innen nach außen durchdringen müssen. Sie können dafür an jeder beliebigen Stelle der Wurzel endogen gebildet werden. 6.1.2. Endodermis Die Endodermis reguliert die Stoffaufnahme. Einige Bodenmineralien sind unverträglich für die Pflanze und werden deswegen nicht ins Xylem eingeschleust z.B. Aluminium, Silizium, Calcium. Diese selektive Aufnahme ist genetisch fixiert und beeinflusst stark ökologisches Verhalten, so wächst z.B. der Rhododendron auf Kalkböden schlecht, aber in sauren Moorbeeten besonders gut. Die Pflanze kann die Aufnahme aber nur in ihren lebenden Zellen steuern, die Summe dieser Zellen (die durch Plasmodesmen zusammenhängen) nennt man Symplast. Summer der nicht lebenden Pflanzenteile (Zellwände, Interzellularen): Apoplast, sie können nicht kontrolliert werden. Wasser mit ungelösten Stoffen kann, bei Eintritt in die Wurzel, eigentlich ungehindert den unkontrollierten apoplastischen Weg nehmen. Die Endodermis zwingt das Wasser dann aber auf den symplastischen Weg, es ist sozusagen eine „Innenhaut.“ Das erfolgt über den Caspary’schen Streifen, das ist ein Gürtel aus wachsartiger Substanz, der in die Zellwand eingelagert ist. Er blockiert die Kapillarwirkung der Zellwand, alles Wasser muss nun durch den Protoplasten. 6.1.3. Zentralzylinder Radiäres Gefäßbündel im Zentrum: Xylem und Phloem sind strahlig angeordnet und ohne Markstrahlen (im Gegensatz zum Spross). Zweikeimblättrige und Nacktsamer sind oligarch also mit wenigen Bögen. Einige wenige Xylemstränge, die in der Mitte zusammenstoßen. Einkeimblättrige sind in der Regel polyarch, mit vielen Bögen. Viele Xylemstränge die in der Mitte nicht zusammenstoßen. 6.1.4. Exodermis Sie umfasst mehrere oder eine Zellschichten unmittelbar innerhalb der Rhizodermis. Nach Absterben der kurzlebigen Rhizodermis bildet sie das Abschlussgewebe in den älteren Teilen der Wurzel. Die Zellwände verkorken (Suberin) und verringern möglichen Wasserverlust. Durch die Suberinisierung der Zellen bietet die Exodermis auch einen besseren Schutz gegen Infektionen durch Mikroorganismen. 6.2. Sekundäre Wurzel Wenn kein sekundäres Dickenwachstum einsetzt (v.a. bei monokotylen Pflanzen), wird die Endodermis zu einer sekundären (Suberinlamelle) und schließlich zu einer tertiären (Celluloseschicht) Endodermis mit Stützfunktion. Bei den meisten Dikotylen und Gymnospermen setzt sekundäres Dickenwachstum auch in der Wurzel ein. Zwischen Xylem und Phloem bildet sich ein Kambium, auch Teile des Perizykels werden meristematisch. Sekundäres Xylem und Phloem bilden sich mit Holz- und Baststrahlen aus. Das Perizykel bildet ein Periderm, alle außerhalb liegenden Gewebe werden zerrissen bzw. abgestoßen. 6.3. Wurzelhals Das ist der unterste Teil des Hypokotyls, sozusagen ein „Adapter“ zwischen kollateralem Leitbündel des Sprosses und radiären Leitbündel der Wurzeln. 6.4. Wurzelsysteme Die Wurzel hat, ebenso wie der Spross, ein arttypischen Wachstums- und Verzweigungsmuster. Eine Faustregel: Meist entspricht die Größe des Wurzelraums (der Rhizosphäre) unter der Erde der Ausdehnung des oberirdischen Sprosses. Zwei wichtige Grundtypen - Allorhizes Wurzelsystem: Dikotyle, Nacktsamer; die Keimwurzel bleibt erhalten und bildet Seitenwurzeln - Homorhizes Wurzelsystem: bei Monokotylen; Keimwurzel stirbt bald ab, und wird doch sprossbürtige Wurzeln ersetzt. 6.5. Wurzelmetamorphosen 6.5.1. Wurzelbrut, Wurzelsprosse Ähnlich wie bei den Sprossausläufern werden hier oberflächlich wachsende Wurzeln zur vegetativen Vermehrung genutzt z.B. Schlehdorn 6.5.2. Wurzelranken Ähnlich den Spross- oder Blattranken, dienen Kletterpflanzen als Verankerung, sehr selten z.B. Vanille 6.5.3. Haftwurzeln Sprossbürtige Wurzeln (Adventivwurzeln), dienen der Verankerung bzw. Kletterhilfe z.B. Efeu 6.5.4. Wurzeldornen Parallele Entwicklungen (Analogien) zu Sprossdornen, kommen bei einigen epiphytischen Pflanzen (Aufsitzerpflanzen) in den Tropen vor z.B. Ameisenpflanze 6.5.5. Speicherwurzeln Starkes sekundäres Dickenwachstum führt zur Ausbildung gleichmäßig oder nur lokal verdickter (Wurzelknollen) Speicherorgane z.B. Süßkartoffel (Seitenwurzeln zu Knollen verdickt), Schwarzwurzel (Hauptwurzel gleichmäßig verdickt) 6.5.6. Rüben Speicherorgane, in deren Bildung die Wurzel und min. ein anderer Organteil (Hypokotyl, Spross) mit einbezogen ist z.B. Rote Rübe, Futterrübe, Zuckerrübe, Karotte, Petersilie: Wurzel und Hypokotyl; Sellerie: Wurzel, Hypokotyl und Spross 6.5.7. Brettwurzeln und Wurzelsenker z.B. FlatterUlme, Ficus 6.5.8. Stelz- und Atemwurzeln Mangroven 6.5.9. Luftwurzeln Bei epiphytischen Orchideen. Rhizodermis wird umgebildet zu einem mehrschichtigen, Wasser speichernden Schwammgewebe 7. Lebensformen Spross- und Wurzelorgane können sich also auf unterschiedliche Weise entwickeln. Berücksichtigung findet dies z.B. in der Klassifizierung von Lebensformen, die sich nach Gesatlt der Sprossachse und Lage der Überdauerungsorgane (Knospen) richtet. - - - - - Phanerophyten: Verholzte, mehrjährige Pflanze (Bäume, Sträucher), meist mit starken sekundären Dickenwachstum. Tragen ihre Überdauerungsknospen höher als 30cm über dem Boden, außerhalb einer schützenden Schneedecke. Z.B. Zerreiche, Holunder, Schwarzföhre Auch Plamen werden als Bäume klassifiziert, obwohl sie einkeimblättrig (kein sekundäres Dickenwachstum) sind. Stabilität wird durch primäres Dickenwachstum erreicht. Das Apikalmeristem wächst zuerst in die Breite und dann wächst der Spross in die Höhe. Chamaephyten: verholzte, mehrjährige Zwergsträucher. Überdauerungsknospen liegen typischerweise unter 30cm, werden also von einer Schneedecke geschützt z.B. Heidelbeere, Steinrössl, Besenheide Hemikryptophyten: Stauden: krautige, zwei oder dreijährige Pflanzen, Überdauerungsknospen liegen nah an der Oberfläche z.B. Löwenzahn, Roter Fingerhut Geophyten: Stauden, Überdauerungsknospen liegen unter der Erdoberfläche, meist in Zwiebeln oder Kriechsprossen (Rhizome) z.B. Gelbstern, Buschwindröschen, DuftSalomonsiegel Helophyten: Stauden, Knospen befinden sich meist unter Wasser oder in wassergesättigten Sedimenten. Spross und Blätter allerdings in der Luft z.B. SumpfSchwertlilie, Bitter-Schaumkraut, Schilf Hydrophyten: Stauden, Alle Organe befinden sich unter oder im Wasser z.B. Seerose, Wassernuss, Laichkraut Therophyten: Fallen aus dem Schema heraus, da sie keine Überdauerungsknospen besitzen. Sie wachsen, blühen, fruchten und sterben in einer Saison: Einjährige Pflanzen z.B. Hybrid Gänsefuß, Vogelknöterich, Kornblume, Adonisröschen 8. Blatt 8.1. Blattentwicklung Die Seiten eines Apikalmeristems weisen sogenannte Blattprimordien aus. Aus diesen wachsen dann Blätter. Aus einem Blattprimordien wächst, je nach Art, entweder ein einziges Blatt mit Oberblatt, Blattstiel und Blattgrund oder Blätter mit Seitenfiedern. Das oberste Blatt nennt man in diesem Fall Endfieder, die Zwischenräume zwischen den Blättern Rachis. Die Proportionen von Ober- bzw. Unterblatt schwanken sehr stark nach Pflanzenart und Blatttyp. Bei einigen Pflanzenfamilien z.B. Süßgräsern, bildet das Unterblatt eine Blattscheide z.B. Hühnerhirse. Je nach Ausprägung der Wachstumstätigkeit in der Blattentwicklung entsteht eine Vielzahl untersch. Blattformen, deren Gestalt genetisch fixiert ist. 8.2. Blattstellung Die Anordnung der Blätter erfolgt keineswegs beliebig, sondern unterliegt genetischen Regeln. - Gegenständige (dekussierte) Blattstellung: an jedem Knoten sitzen zwei, meist sich überkreuzende Blätter (kreuzgegenständig) z.B. Schwalbenwurz, Purpur Enzian - Wirtelige: an jedem Knoten min. drei Blätter z.B. Waldmeister, Goldfelberich - Wechselständig (alternierende): an jedem Knoten nur ein Blatt, wobei auch die Richtung dieser einzelnen Blätter geregelt ist. Die Anordnung erfolgt bestimmten mathematischen Regeln: Rosettenpflanze: Nodium für Nodium nach oben z.B. Mittlerer Wegerich Diese Spiralen nennt man Figunacci Spiralen. Das kann man z.B. bei der Kiefer sehen, die Zapfenschuppen sind umgebildete Blätter. - Fraktal: zusätzlich kann es sein, dass fraktale Formen vorkommen: kleinere Strukturen bilden größere Strukturen, die den kleinen jeweils ähnlich sieht z.B. Roter Sonnenhut, Romanesco. 8.3. Blattfolge - Hypogäische Keimung: die Keimblätter (Kotyledonen) kommen nicht aus der Erde, die Epikotylen bilden keine Blätter aus z.B. Gartenbohne - Epigäische Keimung: Keimblätter kommen aus der Erde und betreiben Photosynthese, Epikotylen bilden Blätter aus. Die Niederblätter sind auf Unterblatt reduziert, oft schuppenförmig z.B. Duft Salomonssiegel. Knospenschuppen sind ebenfalls auf Unterblätter reduziert und schuppenförmig. Sie dienen als Verdunstungsschutz v.a. im Mittelmeerraum. Emikryptophyten: Knospen noch über Erdoberfläche. Bei der Kirsche sind Knospenschuppen und Laubblätter über Zwischenformen verbunden Hochblätter sind mehr oder weniger auf Unterblätter reduziert, manchmal blumenblattartig z.B. Blumen Hartriegel, Großblüten Braunelle. Sie haben v.a. eine Anlockungsfunktion, allerdings betreiben sie nur wenig Photosynthese. Fruchtblätter (♀), Staubblätter (♂), Kronblätter und Kelchblätter dienen der sexuellen Fortpflanzung. Die Blüte ist eine Sonderbildung der Sprossachse mit für die sexuelle Fortpflanzung spezialisierten Blättern. Blütenbildung beendet außerdem das Sprosswachstum an dieser Stelle (Apikalmeristem bildet als letztes Fruchtblätter und verbraucht sich dadruch). 8.4. Heterophyllie Bedeutet Verschiedenblättrigkeit. Z.B. Juvenil und Adultblätter bei Efeu. Im Juvenilstadium klettert der Efeu mit Haftwurzeln dem Licht entgegen. Die Blätter haben die typische Efeuform, und von hellerer Farbe. Im Adultstadium bilden sie keine Haftwurzeln mehr aus, Blüten werden produziert und die Änderung der Blätter (dünkler, rundere Form) ist irreversibel. Beim Wasser Hahnenfuß gibt es Schwimmblätter und Tauchblätter. Die Schwimmblätter an der Wasseroberfläche betreiben Photosynthese. Die Tauchblätter betreiben Gasaustausch und bewirken den Auftrieb, deswegen ist der Wasser Hahnenfuß im Wasser oft nicht verankert. 8.5. Blattanatomie 8.5.1. Aufbau eines bifazialen Laubblattes Das oberste Schicht des Blattes besteht aus einer Cudicula (Verdunstungsschutz) und einer Epidermis. Im Mesophyll befindet sich unterhalb der Epidermis das Schwammgewebe, in dem viele Chloroplasten sind. Die Zellen stehen dicht aneinander. Es ist der Hauptort der Photosynthese. Darunter befindet sich das Schwammparenchym, es dient v.a. der Blattbelüftung. Die Zellen sind locker, mit vielen Interzellularen angeordnet. Das Blatt wird durchzogen von Leutbündelscheiden mit Xylem und Phloem. An der Unterseite des Blattes befinden sich wieder Epidermis und Cudicula, mit einem entscheidenden Unterschied: es sind Spaltöffnungen (Stomata) im Blatt um den Gasaustausch zu gewährleisten. - Bifaziales/dorsiventral, hypostomatär: das Palisadenparenchym befindet sich an der Oberseite, Stomata und Schwammparenchym an der Unterseite, der häufigste Blatttyp - Invers bifazial/dorsiventral, epistomatär: Palisadenparenchym an der Oberseite, durch einige Atemhöhlen unterbrochen. Stomata an der Oberseite, Schwammparenchym an der Unterseite z.B. Seerose (Wasserpflanzen) - Äquifazial: Palisaden-, Schwammparenchym und Stomata an allen Seiten, durch Atemhöhlen unterbrochen z.B. Mistel - Unifazial: Blattoberseite reduziert, Unterseite nimmt die gesamte Blattoberfläche ein, mit Palisadenparenchym und Stomata z.B. Schnittlauch Bei Farnen und Nacktsamern verläuft die Nervatur getrenntläufig z.B. Ginkgo, Hirschzungenfarn. Die Blattnerven teilen sich und sind nicht verbunden. Zweikeimblättrige sind in der Regel netznervig, die Nerven sind untereinander verbunden z.B. Berg-Ahorn Einkeimblättrige sind parallelnervig, die Nerven verlaufen parallel z.B. Mais Die Leitbündel werden im Blattstiel als arttypische Blattspuren sichtbar. An den Blattnarben können sie als Bestimmungsmerkmal genutzt werden. Besonders ausgeprägt sind sie z.B. bei Götterbaum und Walnuss sichtbar. 8.6. Gaswechsel Hat eine wichtige Bedeutung für Stomata und Photosynthese. Die Atemgase werden für zwei wichtige Stoffwechselwege benötigt - CO2 für Photosynthese: Aufbau von Kohlenhydraten - O2 für Zellatmung: Verdauung von Kohlenhydraten und Energieerzeugung, überschüssiger Sauerstoff wird ausgeatmet , ebenso wie Wasserdampf. 8.6.1. Stomata Regulation Durch Osmose wird Kaliumchlorid eingesaugt, dadurch steigt der Turgordruck, die Zelle verbiegt sich und der Spalt öffnet sich. Wenn der Turgordruck wieder sinkt, schließt sich die Stomata wieder Verschiedene Regelungen bestimmen ob die Stomata sich schließt - Wassersättigung der Pflanze: bei Wassermangel geschlossen (ein paar Stunden kein Problem, langfristig kann es zu einem Problem werden) - CO2 Konzentration in der Luft: bei geringerer Konzentration geöffnet (wenn die Pflanze zu selten Photosynthese betreiben kann, verhungert sie) - Licht: geöffnet bei Bestrahlung mit Licht einer bestimmten Intensität (Photosynthese ist nur bei Licht sinnvoll) - Circadianer Rhythmus: bei Nacht geschlossen (Photosynthese nur bei Tag sinnvoll, die Tageslänge ist ca. konstant) 8.7. Photosynthese Dient dem Zweck des Aufbaus energiereicher organischer Verbindungen. Sie findet in den Chloroplasten statt. Die Lichtreaktionen sind membrangebunden, sie finden an den Thylakoid Membranen in den Chloroplasten statt. Dunkelreaktionen sind löslich und finden im Plasma der Chloroplasten statt. 8.7.1. Lichtreaktion Sie beruht auf dem Zusammenspiel von Pigmenten (Chlorophyll a, Chlorophyll b, Cytochrome, Carotinoide) und Protein-/Enzymkompexen. Chlorophylle besitzen ein N-haltiges Ringsystem (Porphyrin-Ringsystem) mit Magnesium als Zentralatom und eine lange Kohlenwasserstoffkette. Es sind zwei Formen des Chlorophylls an der Photosynthese der höheren Pflanzen beteiligt: Chlorophyll a und Chlorophyll b. Sie unterschieden sich durch eine einzige Seitengruppe am Ringsystem. Carotinoide dienen teils der Adsorption von Lichtenergie, teils als Antioxidantien, die Sauerstoffradikale abfangen. Chlorophyll adsorbiert Licht im roten und blauen Wellenlängen-Bereich. Grünes Licht wird reflektiert, deswegen erscheinen Blätter grün. Die Lichtreaktion nutzt die elektromagnetische Energie von Licht um energiereiche Verbindungen (ATP und NADPH) zu gewinnen, sowie dem Aufbau eines energiereichen Gradienten von H+ Ionen zwischen den Thylakoidmembranen und dem Stroma. 8.7.2. Lichtunabhängige Reaktion Ist eine Kohlenstofffixierung im Plasma Stroma des Chloroplasten im sogenannten Calvin Zyklus. ATP wird zu ADP umgewandelt, das Enzym RUBISCO (Ribulose-, 1,5-bisphosphatCarboxylase-Oxygenase) ist das wichtigste und häufigste. Traubenzucker (Glucose) wird aufgebaut. Rubisco hat die Eigenschaft zu carboxylieren (Kohlenstoff zu binden) und zu oxygenisieren (zu CO2 veratmen), bei niedrigen Kohlenstoff Konzentrationen in der Pflanze (geschlossene Stomata) ist das ein Problem. Sogenannte C4-Pflanzen trennen nun die RuBisCo räumlich von der Kohlenstofffixierung - Im Schwammparenchym wird das CO2 auf das C4 Molekül Malat (Apfelsäure) übertragen (Enzym: PEP Carboxylase) - Transport der Substanz in die Zellen der Bündelscheide und Aufkonzentrierung - Weiterverarbeitung durch RuBisCo Der C3 Weg der Kohlenstofffixierung: CO2 wird mit dem Enzym RuBisCo gebunden, zerfällt zu 2 C3 Molekühlen. Der C4 der Kohlenstofffixierung: CO2 an Molekül mit 3C gebunden organische C4Säure in Bündelscheiden transportiert, dort wird CO2 freigesetzt und wie bei C3 mit RuBisCo gebunden. Man erkennt C4 Pflanzen an ihrer Kranzanatomie (kreisförmige Anordnung der Mesophylzellen um die Leitbündel) Vorteile der Aufkonzentrierung des Kohlenstoff durch RuBisCo ist, dass C4 Pflanzen auch bei niedrigen CO2 Werten Photosynthese betreiben können, dh. Auch wenn die Stomata oft geschlossen sein müsste. In trockenen und heißen Gebieten sind sie wesentlich effizienter, in kühleren Klima sind sie durch den hohen Energieaufwand aber benachteiligt z.B. Mohrenhirse, Zuckerrohr CAM WEG (CRASSULACEAN ACID METABOLISM) CO2wird an eine organische C4 Säure gebunden, die Trennung von Calvin Zyklus und CO2Konzentrierung ist aber nicht räumlich sondern zeitlich. Nachts (geringere Verdunstung) öffnen sich die Stomata und CO2wird gebunden. Das Zwischenprodukt (Malat) wird in der Vakuole zwischengespeichert. Tagsüber schließen sich die Stomata, das CO2 wird aus dem Malat freigesetzt und in den Calvin Zyklus eingeschleust. Das ist eine Anpassung an trockene Gebiete. Malat ist osmotisch aktiv, deswegen geht CAM meist mit Wasserspeicherung (Sukkulenz) einher. Sie ist v.a. bei Vertretern der Dickblattgewächse zu finden z.B. Weißer Mauerpfeffer, Alpen Hauswurz, Geldbaum. Aber auch einige Kulturpflanzen verwenden CAM: z.B. Ananas, Sisal Agave, Kaktusfeige 8.8. Primäre Pflanzenstoffe Darunter versteht man für die Pflanze lebensnotwendige Substanzen. Z.B. - direkte Ausgangsprodukte der Photosynthese (Mono- und Disaccharide), - daraus gebildete Substanzen, die im Energiestoffwechsel gebraucht werden (Oligo- und Polysaccharide, Fette, Proteine), - Ballaststoffe bzw. Gerüstsubstanzen (Pektin, Cellulose, Hemicellulosen) Davon unterscheiden wir sekundäre Pflanzenstoffe, die verschiedene Funktionen (z.B. Toxine als Schutz vor Fressfeinden) für die Pflanze erfüllen, aber nicht unbedingt lebensnotwendig sind - Phenolische Verbindungen (z.B. Lignin) - Isoprenoide (z.B. Terpene, ätherische Öle) - Alkaloide (z.B. Coffein, Nicotin) - Nicht proteinogene Aminosäure) 8.8.1. Kohlenhydrate (Saccharide) Organische Verbindungen, die Produkte der Photosynthese darstellen oder aus ihnen zusammngesetzt werden z.B. Glucose (Traubenzucker) ist ein Monosaccharid (Einfachzucker). Es ist das Produkt der Photosynthese und wichtigster Grundbaustein höhermolekularer Kohlenhydrate. Disaccharide sind aus zwei Einfachzuckern zusammengesetzt. Häufigstes Disaccharid ist Saccharose (Rohrzucker), eine häufige Transportform von Zucker in der Pflanze. Alle Pflanzen lagern gewisse Mengen an Reservestoffen ein, um in Zeiten ohne Photosyntheseaktivität zu überleben. Problem dabei ist allerdings, dass Mono- und Disaccharide für den Sofortgebrauch geeignet sind, aber nicht für dauerhafte Stoffspeicherung. Sie sind nämlich osmotisch aktiv und beeinflussen den Wasserhaushalt des Protoplasten. Es gibt 2 Lösungsmöglichkeiten: - Zucker werden in der Vakuole gelagert (z.B. Zuckerrübe) - Zucker werden zu höher molekularen Einheiten verbunden, die geringes osmotisches Potenzial besitzen Oligo- und Polysaccharide sowie Fett Oligosaccharide bestehen aus drei bis zehn Einfachzuckern, Polysaccharide sind aus über zehn bis zu vielen Tausend zusammengesetzt. Inulin ist ein relativ kleines Polysaccharid (bis zu 100Fructose Moleküle). Es dient v.a. als Reservestoff in Wurzeln und Sprossknollen der Korbblütler. Es wird teilweise als Stärkeaustauschstoff für Diabetiker genutzt, ist allerdings unverdaulich. Z.B. vorhanden in Tpinambur und Zichorie Stärke ist das wichtigste Reserve Polysaccharid und besteht aus mehreren Hundert Glucosemolekülen. Glucose ist das Produkt der Photosynthese, es wird in den Chloroplasten als primäre Stärke zwischengespeichert und wird in der Transportform Saccharose mobilisiert. Es wird von den Blättern in die anderen Organe transportiert, es wird in den Speicherorganen, in speziellen Plastiden ohne Chlorophyll eingelagert (Amyloplasten). Sie lagern so viel ein, bis sie schließlich platzen können. Stärkekörner entstehen. In ihnen entstehen durch abwechselnde Auflagerung von amorpher und kristalliner Stärke konzentrisch abgeordnete Schichten. Stärke lässt sich durch Jod durch Blaufärbung nachweisen. Durch die Schichtung sind die Körner lichtbrechend, in polarisiertem Licht erzeugt das charakteristische Polarisationskreuze. Auch die Gestalt der Stärkekörner ist spezifisch. 8.8.2. Proteine Als Reservestoffe sind sie v.a. im Samen wichtig um die junge Pflanze zu versorgen, sie wird in Form von amorphen Aleuronkörnern gespeichert. Schmetterlingsblütler also z.B. Gartenbohne speichern Eiweiß und Stärke in denselben Zellen der Keimblätter. Getreide hingegen speichert Stärke und Eiweiß in untersch. Geweben 8.8.3. Fette Wie das Aleuron (Speichereiweiß) sind sie v.a. in Samen zu finden. Sie haben höchste Energiedichte und binden kein Wasser. Sie sind entweder flüssig in Gestalt kleiner Tröpfchen oder fest. Z.B. Kokospalme speichert Fett im Samen 8.9. Zellatmung Atmung bei Pflanzen bedeutet im Grunde dasselbe wie bei Tieren: Freisetzung der chemischen Energie (ATP) aus organischen Verbindungen (v.a. Kohlenhydrate) unter Sauerstoffverbrauch. Ort der Atmungsprozesse sind v.a. die Mitochondrien. Im wesentlichen gibt es vier Teilprozesse - Glykolyse: im Zellplasme - Oxidative Decarboxylierung - Citrat Zyklus - Atmungskette 8.10. Blattmetamorphosen 8.10.1. Anpassung an Lichtverhältnisse: Sonnen- und Schattenblätter Sonnenblätter: kleiner, dicker, Palisadenparenchym ist mehrschichtig, weniger Interzellularen im Schwammparenchym, Epidermis leicht verdickt, Stomata leicht eingesenkt Anpassung an höhere Lichtstärke und Temperatur (Verringerung der Transpiration) Schattenblätter: größer, dünner, Palisadenparenchym einschichtig, mehr Interzellularen im Schwammparenchym, Epidermis weniger verdickt, Stomata leicht erhöht 8.10.2. Xeromorphie: artspezifische Anpassung an Trockenheit Als Beispiel: Salbeiblättrige Zistrose. Epidermis ist stark verdickt, Stomata leicht eingesenkt, Transpiration wird durch tote Haare erschwert 8.10.3. Hygromorphie: artspezifische Anpassung an Feuchte Als Beispiel: Lungenkraut. Epidermis dünnwandig, papillös, Stomata herausgehoben, Transpiration durch lebende Haare erhöht 8.10.4. Speicherblätter z.B. Zwiebel, Knoblauch, Türkenbundlilie 8.10.5. Blattranken z.B. Blattfiederranken, Gartenerbse, Rankenplatterbse 8.10.6. Blattdornen z.B. Berberitze, oder Scheinakazie mit Nebenblattdornen 8.10.7. Scheinstämme durch Blattscheiden z.B. Banane. Blattgrund stabilisiert die Sprossachse und täuscht einen Baum vor 8.10.8. Blattsukkulenz Wasserspeicherung im Blatt, gepaart mit extremer Xeromorphie 8.10.9. Humus- und Wasserspeicher z.B. Tilandsien: überlappen Blätter, bilden Wasserzisterne, Saughaare nehmen dieses Wasser auf; Geweihfarne: anliegende Urnenblätter fördern Humusablagerung, halten Wurzeln feucht; Urnenpflanze: bietet Ameisen Lebensraum, diese tragen Humus ein und düngen Pflanze mi Ausscheidungen, Sprossbürtige Wurzeln wachsen in die Urnen ein 8.10.10. Fallen Besonders in Lebensräumen mit sehr geringem Stickstoffvorkommen nützlich (Mooren), bessere Versorgung durch Fressen von Tieren v.a. Insekten (Insectivorie). Gleitfallen: z.B. Kannenpflanzen: die gesamte Blattspreite ist zu einer Gleitfalle umgewandelt, die mit Verdauungsflüssigkeit gefüllt ist. Die Photosynthese wird vom Blattstiel übernommen Klappfallen: z.B. Venusfliegenfalle: Zuklappen bei Berührung von zwei Härchen Klebefallen: z.B. Mittlerer Sonnentau, Alpen Fettkraut Saugfallen: z.B. Wasserschlauch 9. Fortpflanzung und Vermehrung 9.1. Vermehrung Ist ein Grundbestreben/mechanismus lebender Organismen. Sie ist die Voraussetzung für jegliche Evolution, denn nur wo Informationen weitergegeben wird, können auch Mutationen Informationen verändern. Diese Mutationen sind die Grundlage für Selektion und von Anpassung an sich ständig verändernde Lebensbedingungen (ökologische Nischen). „Aus eins mach zwei, mach vier, mach acht, mach sechszehn“ Einfachster und ursprünglichster Weg die Individuen zahl zu vermehren. DNA-Replikation und anschließende Längs- oder Querteilung der Zelle. Bakterien erreichen dadurch eine unglaublich hohe Vermehrungsrate: ein Individuum mit der Teilungsrate von 30Minuten kann innerhalb von 24 Stunden 48 Generationen hervorbringen und damit über 291 Billionen Individuen. Bakterien als Prokaryoten sind mit dieser Strategie äußerst erfolgreich. Auch einzellige Eukaryoten gehen diesen Weg, wenn auch mit geringeren Reproduktionsraten als Bakterien. Ungefähr vor etwa 2-3 Milliarden Jahren taucht ein neues Konzept auf: anstatt „aus eins mach zwei“, tritt plötzlich „aus zwei mach eins“. Praktisch alle lebenden eukaryotischen Organismen sind zu sexueller Fortpflanzung fähig, viele Organismen beherrschen jedoch die vegetative (klonale) Vermehrung gar nicht mehr. Der Vorteil liegt klar bei der kürzeren Zeit um sich den Bedingungen anzupassen. Positive und vorteilhafte Merkmale können schneller und effektiver weitervererbt werden. Klonale Interferenz wird vermieden. Bei der klonalen Vermehrung gibt es beispielweise die Merkmalskombination „ab“, gleichzeitig tauchen die vorteilhaften Mutationen „aB“ und „Ab“ auf. „Ab“ stellt sich aber als stärker heraus und „aB“ stirbt aufgrund von Konkurrenzdruck aus. Die gesamte Population ist bald mit den Merkmalen „Ab“ geprägt. Erst später entsteht die Kombination „AB“, die nun eine doppelt vorteilhafte Merkmalskombination besitzt. Bei der sexuellen Vermehrung treten wieder „Ab“ und „aB“ ungefähr gleichzeitig auf. Die beiden vorteilhaften Merkmale können aber schneller weitervererbt werden durch Paarung und Kombination der beiden „besseren“ Linien. Die Konsequenz dieser Kombination aus genetischem Material versch. Entwicklungslinien ist v.a. die schnellere Anpassung an neue Nahrungsressourcen, Krankheitserreger und Parasiten und generell sich veränderte Umweltbedingungen. Einige dieser Vorteile werden auch von Bakterien genutzt – sie können durch Konjugation zumindest Teile ihrer DNA (Plasmide) austauschen. 9.2. Meiose Die Fusion ganzer Zellen in der sexuellen Fortpflanzung der Eukaryoten führt jedoch dazu, dass bei jeder Fusion plötzlich doppelt so viel DNA in der Zelle vorliegt. Das wäre schon nach wenigen Generationen nicht mehr handbar, es muss also eine Reduktion folgen Meiose (Reduktionsteilung). In einer diploiden Zelle (in den meisten Organismen) liegt ein doppelter Chromosomensatz vor. Eine hälfte vom mütterlichen, eine vom väterlichen Organismus. Jede Hälfte trägt untersch. Ausprägungen (Allele) derselben Gene. Gen ist meistens 1 codierender Bereich für 1 Protein, aus Exons und Introns. Die Reduktion der DNA erfolgt während der Meiose, der Reduktionsteilung. Sie entspricht grob einer zweifachen Mitose, aber mit drastischen Unterschieden. Bei der Meiose werden jeweils ein Chromosomenpaar vom Vater und der Mutter durch den Spindelapparat getrennt, so dass jeweils zwei homologe Chromosome zusammen sind. Bei Überlagerungen kann in der späten Prophase bzw. in der Metaphase 1 das Crossing Over stattfinden: mütterliche und väterliche Genome werden durch Überlagerung, Abtrennung und Wiederanlagerung rekombiniert. Das ermöglicht eine wesentlich größere Vielfalt und mehr Kombinationsmöglichkeiten als bei der Mitose. In der Anaphase werden die homologen Chromosome getrennt. In der Telophase 1 bzw. in der Prophase 2 entstehen zwei unterschiedliche Tochterzellen. In der Metaphase 2 beginnt der Spindelapparat die Chromosome in einzelne Chromatide zu trennen. Dieser Vorgang ist in der Anaphase 2 abgeschlossen. In der Telophase 2 entstehen nur vier unterschiedliche Tochterzellen mit jeweils einem haploiden (einfachem) Chromosomensatz. Ergebnis der Mitose: 2 Zellen mit halben Chromosomensatz Ergebnis der Meiose: 4 Zellen mit halben Chromosomensatz und rekombinierter DNA 9.3. Vererbungsmuster Die Allele (Merkmalsausprägungen) einzelner Gene können nach unterschiedlichen Mustern an die Folgegeneration weitergegeben werden. Die bekanntesten finden sich in den Mendelschen Regeln. Diese definieren, nach welchen Mustern Genvarianten auf Nackommen übertragen werden - Uniformitätsregeln: die Nachkommen von homozygoten Eltern (beide Allelen des jeweiligen Elternteils sind gleich) sind im Phänotyp (der Merkmalsausprägung also z.B. Aussehen) gleich - Aufspaltungsregel: Die Nachkommen dieser heterozygoten Generation wiederum spalten sich nach bestimmten Mengenverhältnissen in Merkmalsgruppen auf. - Unabhängigkeitsregel: Untersch. Merkmale werden unabhängig voneinander vererbt. Auch zwischen versch. Erbgängen (dominant-rezessiv, intermediär) wird unterschieden. Die Mendel’schen Regeln treffen nur zu wenn… - Genau ein Gen einem Merkmal entspricht. Bei einer Vielzahl von Merkmalen trifft das nicht zu. - Die Gene weit genug voneinander entfernt auf den Chromosomen liegen (und durch ein Crossing Over zwischen Chromosomen wechseln kann) - Die betreffenden Gene im Zellkern liegen. Mitochondriale und v.a. Plastidengewebe werden klonal vererbt und unterliegen anderen Mechanismen. Daraus schließt man eine eingeschränkte Anwendbarkeit in besonderen Fällen. 9.4. Gameten und Paarungstypen Die bei der Meiose gebildeten haploiden Zellen heißen Gameten und stellen sexuelle Vermehrungseinheiten dar. Ihr Verschmelzungsprodukt ist die Zygote. Gameten sind bei untersch. Pflanzengruppen versch. Gestaltet und repräsentieren untersch. Evolutionäre Entwicklungsstadien. 9.4.1. Isogamie ´Gameten sind beide gleich gestaltet und beweglich. Es gibt keine äußeren Unterscheidungsmerkmale, deswegen wird männlich und weiblich nur willkürlich zwischen + und – entschieden. 9.4.2. Anisogamie Gameten sind untersch. Groß und beide beweglich. Die größeren Gameten sind weiblich, die kleinen männlich (bzw. werden als solche bezeichnet) 9.4.3. Oogamie Gameten sind deutlich untersch. Groß. Nur die kleineren (männlichen) sind beweglich, die größeren (weiblichen) verbleiben an der Mutterpflanze. 9.5. Generationswechsel Diploide Organismen produzieren haploide Gameten durch Meiose Gameten verschmelzen zu einer diploiden Zygote Zygote wächst zu einem diploiden Organismus aus Aber: bei Pflanzen gibt es noch einen Schritt dazwischen - Diploide Organismen (Sporophyten) produzieren haploide Meiosporen - Diese Sporen paaren sich nicht, sondern dienen der vegetativen Vermehrung - Die Meiosporen wachsen zu einem haploiden Organismus (Gametophyt) aus. - Erst der Gametophyt erzeugt (durch Mitose) die haploiden Gameten - Gameten verschmelzen zu einer diploiden Zygote - Zygote wächst zu einem diploiden Organismus aus Dieser Generationswechsel zwischen haploider Generation (Gametophyt) und diploider Generation (Sporophyt) findet sich in versch. Ausprägungen bei allen Pflanzen. Beide Generationen können in engem physiologischen Zusammenhang stehen oder selbstständige Organismen sein. Aufgrund ihrer untersch. Gestalt hielt man manchmal den Sporophyten und den Gametophyten für untersch. Pflanzen. Z.B. bei Grünalge, Haarmützenmoos, 9.5.1. Samenpflanzen (Spermatophyten) gehören zu den Kormophyta, bilden also Wurzeln, Spross und Blätter. Zu ihnen zählen die Nacktsamer (Gymnospermae) und die Bedecktsamer (Angiospermae). Sie besitzen eine besondere Art des Generationenwechsels: der Gametophyt ist auf nur wenige Zellen reduziert und kann nur – ganz im Gegensatz zu den Moosen – durch den Sporophyten am Leben erhalten werden. Zusätzlich bilden sie eine Besonderheit, um die nächste Generation von Sporophyten zu schützen und zu versorgen: den Samen. Im Samen kann die junge Pflanze (junge Sporophyt) verbreitet werden, sie kann ungünstige Bedingungen überdauern und wird meist durch Nährgewebe versorgt 9.6. Blüten Die Blüte ist eine Sonderbildung der Sprossachse für die mit sexueller Fortpflanzung spezialisierten Blätter. Blütenbildung beendet das Sprosswachstum an dieser Stelle (Apikalmeristem bildet als letztes die Fruchtblätter und verbraucht sich dadurch). Blüten sind extrem vielfältig, da sie extremen Selektionsdruck unterliegen: an ihnen entscheidet sich ein Großteil des Reproduktionserfolges und damit die Weitergabe von Genen. Grundsätzlich besteht jede Blume aus Kronblättern, die die Fruchtblätter (Makrosphorophylle) mit den Samenanlagen und der Placenta, sowie das Staubblatt (Mikrosphorophyll) mit der Anthere umgibt. Wo Staub- und Fruchtblatt aufeinander treffen liegt die sogenannte Blütenachse/boden. Die Kronblätter ihrerseits werden um diesen Blütenboden mit Kelchblättern umgeben, dann erst folgt die Sprossachse. Dieses Grundschema kann auf jede erdenkliche Weise abgewandelt werden, als Ausdruck auf den Lebensraum einer Pflanze. Alle Blütenteile können vervielfacht vorkommen, oder völlig fehlen. Auch Verwachsungen zwischen gleichen oder versch. Blütenteilen kann vorkommen. Um diese Diversität fassen zu können, wurde mit Blütendiagrammen und Blütenformeln eine normierte Beschreibungsmöglichkeit des Blütenbaus geschaffen. 9.6.1. Brassicaceae – Kreuzblütler, Kohlgewächse Es gibt eine 2teilige Narbe und damit 2 Fruchtblätter, 4 Kelchblätter [K 4] , 4 lange und 2 kurze Staubblätter [S 2+4], 4 Blütenkronblätter [B 4], und der oberstständige Fruchtknoten ist aus 2 verwachsenen Fruchtblättern [F 2] (weibliche Anteile) aufgebaut. Zusätzlich gibt es Narbe und Griffel. Daraus ergibt sich die Blütenformel: +K 4 B 4 S 2+4 F2 (+ steht für die Symmetrie der Kelchblätter) 9.6.2. Rosaceae – Rosengewächse Gefiederte Kelchblätter oder ein Außenkelch werden nicht berücksichtigt. 4 Kelchblätter [K 4], 5 Staubblätter [S 5], 5 Blütenkronblätter [B 5]. Der Fruchtknoten ist bei der Rose unterständig und aus zahlreichen Fruchtblättern aufgebaut. Die weiblichen Blütenanteile sind sehr variabel [F 1-∞+ Daraus ergibt sich die Blütenformel: *K 5 B 5 S 5 F 1- ∞ 9.6.3. Fabaceae – Schmetterlingsblütler Die Blüte besitzt Fahne und Flügeln, und Schiffchen aus 2 verwachsenen Blütenblättern. 5 Kelchblätter [K 5], Die Staubblätter sind bis auf das obere zu einer Röhre verschmolzen [S (9)+1], 3+(2) Blütenkronblätter [B 3+(2)]. Der oberständige Fruchtknoten wird aus einem Fruchtblatt aufgebaut und liegt in der Staubfadenröhre [F 1] Daraus ergibt sich die Blütenformel: ↓K 5 B 3+(2) S (9)+1 F 1 9.6.4. Orchidaceae – Knabenkrautgewächse, Orchideen Alle 6 Blütenkronblätter sind blütenblattartig dh. Ein Perigon. [P 3+3]. Zusätzlich besitzt sie eine Lippe (Labellum) und eine Blütenachse. Staubblätter, Griffel und Narben sind zu einem Säulchen (Gynostemium) verwachsen [S 2 F(3)]. Der unterständige Fruchtknoten ist aus 3 verwachsenen Fruchtblättern aufgebaut. [F(3)] Daraus ergibt sich die Blütenformel: ↓P 3+3 *S 1-2 F(3)] 9.6.5. Asteraceae – Korbblütler Der Blütenstand (das Körbchen) setzt sich aus unzähligen Einzelblüten zusammen. Die Kelchblätter können fehlen oder wie beim Löwenzahn einen „Fallschirm“ (Pappus) bilden: [K]. Die 5 Blütenkronblätter sind untereinander und mit 5 Staubblättern zu einer Röhre verwachsen. [B (5) S(5)] Die 5 Staubblätter sind zu einer Röhre verschmolzen [S (5)].Der unterständige Fruchtknoten wird aus 2 Fruchtblättern aufgebaut: [F 2] Daraus ergibt sich die Blütenformel: ↓K ∞ *B (5) S(5)+ F(2) 9.6.6. Poaceae - Süßgräser Die Narbe ist federig um den Blütenstaub aus der Luft aufzufangen. Die 2 Hüllspelzen umschließen das 2blütige Ährchen, sie gehören nicht zu den Blättern. Zu jeder Blüte gehört außerdem eine Vor- und eine Deckspelze. Es gibt 2 Schwellkörper (Lodiculae). 3 Staubblätter [S (3], 3+(2) Blütenkronblätter [B 3+(2)]. Der oberständige Fruchtknoten wird aus 2 Fruchtblättern aufgebaut: [F 2] Daraus ergibt sich die Blütenformel: Deckspelze 1 Vorspelze 1 S 3 F(2) 9.7. Samen Im Samen kann die junge Pflanze (der junge Sporophyt) verbreitet werden und die Pflanzenart kann neue Areale besiedeln, und sie kann ungünstige Bedingungen überdauern. Im Samen wächst die Zygote zum Embryo heran, einer mehr oder weniger vollständigen Minipflanze. Alle anderen Samengewebe (Samenschale, Nährgewebe) werden von der Mutterpflanze gebildet. 9.8. Früchte Früchte sind die Produkte umgewandelter Fruchtblätter und sind nur bei Angiospermen (Bedecktsamern) zu finden. Sie schützen und ernähren die Samen während der Entwicklung. Je nach Ausprägung der Fruchtformen sind sie auch in die Art der Ausbreitung involviert. Das Fruchtblatt/die Fruchtblätter wandelt sich in der Samen- und Fruchtentwicklung zum Perikap, der Fruchthülle um. Diese besteht aus drei Schichten, die jeweils trocken/verholzt oder saftig sein können. (Exokarp, Mesokarp, Endokarp) Bei Öffnungsfrüchten wir der Same aus der Frucht entlassen und stellt selbst die Ausbreitungseinheit dar. Z.B. Balq, Hülse, Schote, Spaltkapsel, Porenkapsel, Deckelkapsel. Bei Schließfrüchten bleibt der Same in der Frucht eingeschlossen, die Frucht selbst die Ausbreitungseinheit z.B. Beere, Steinfrucht, Nuss, Spaltfrucht, Bruchfrucht, Achaene, Karyopse. Es werden auch Sammelfrüchte gebildet, die aus einzelnen Fruchtblättern hervorgehenden Früchte werden durch das Gewebe der Blütenachse miteinander verbunden z.B. Sammelbalgfrucht, Apfelfrucht, Sammelsteinfrucht, Sammelnussfrüchte. Fruchtverbände gehen aus ganzen Blütenständen, also vielen Einzelblüten samt Sprossgewebe, hervor z.B. Tilia, Ananas, Morus, Dorstenia, Ficus 9.9. Ausbreitungstypen Sowohl Früchte, als auch Samen sind entsprechend versch. Strategien angepasst um neue Lebensräume zu erschließen. 9.9.1. Autochthone Pflanzen Autochthone Pflanzen nehmen die Sache „selbst in die Hand“ und kommen ohne die Hilfe anderer Lebewesen aus - Barochore nutzen die Schwerkraft, die Frucht/Same wird aus großer Höhe herab geworfen z.B. Eiche, Buche - Ballochore breiten die Samen direkt selber aus. Die Frucht entwickelt große innere Spannungen, entweder durch Austrocknung oder stark erhöhten Turgordruck und schleudert den Samen mehrere Meter weit weg. Z.B. Springkraut, Spritzgurke - Anemochore nutzen den Wind zur Verbreitung. Distanzen von mehreren Metern bis zu hundert Kilometern sind erreichbar. Unterschiedlichste Fruchtformen sind an diese Ausbreitungsart angepasst, auf untersch. Weise z.B. Ahorn, Löwenzhan 9.9.2. Zoochore Pflanzen Nutzen Tiere um sich auszubreiten - Endozoochore verlocken Tiere durch saftige Früchte (Beeren, Steinfrüchte) ihre Samen zu verschlucken und in ihrem Körper weiter zu transportieren. Doppelter Vorteil: die Samen werden verbreitet und bekommen ihren Dünger (Kot) mitgeliefert - Exozoochore bilden markante äußere Strukturen an ihren Samen/Früchten, die sich an Tierfell oder Federn haften. - Myrmekochorie ist eine Zwischenform. Früchte/Samen tragen eiweiß- oder fettreiche Anhängsel, die Ameisen verlocken, sie in ihre Bauten zu tragen. Die Anhängsel werden verspeist, die Pflanzen können auskeimen. Blastochorie hat mit sexueller Vermehrung hingegen nichts zu tun. Es handelt sich um vegetative Vermehrung der Pflanze durch Ausläufe, Zwiebel, Brutknollen etc. Generll können alle diese Ausbreitungstypen fließend ineinander übergehen oder ergänzen z.B. Ringelblume benutzt Anemochorie und Exozoochorie; Brombeeren verbreitet sich endozoochor über die Früchte und blastochor über die Ausläufer. 10. Reize und Reaktionen Umweltfaktoren bestimmen letztendlich das Überleben eines pflanzlichen Organismus. Abiotisch: Wasser, Licht, CO2, Temperatur und Klima, Nährstoffe Biotisch: Fressfeinde, Parasiten, Krankheitserreger, Konkurrenten Wie tierische Organismen müssen Pflanzen als in der Lage sein, Reize aus der Umwelt aufzunehmen und darauf adäquat zu reagieren. Aber: Pflanzen haben weder Nerven noch Gehirn. Die Wahrnehmung von Licht, Schwerkraft und Temperatur ist essentiell für die Pflanze, beginnend mit der Keimung. So trivial es auch klingen mag - Spross und Blätter müssen wissen in welcher Richtung Sonnenlicht verfügbar ist - Wurzeln müssen wissen, wo sich der Boden befindet - In Jahreszeiten müssen Pflanzen wissen, wann die Vegetationsperiode beginnen kann 10.1. Licht Wahrnehmung von Licht in der Pflanze durch Lichtrezeptoren. Diese werden, ähnlich wie Photosynthesepigmente, durch Licht bestimmter Wellenlänge chemisch verändert und lösen somit ein Signal aus. Phytochrome sind proteinbasierte Pigmente im Cytoplasma aller Pflanzen und Cyanobakterien, die hellrotes und dunkelrotes Licht unterscheiden können und einen reversiblen Lichtschalter bilden. Die beiden Formen, die Hellrot (R=660nm) und Dunkelrot (FR=730) absorbieren, werden v.a. durch Bestrahlung mit der jeweiligen Wellenlänge ineinander abgewandelt. Bei Dunkelheit erfolgt ein langsamer Rückbau zur hellrot-sensitiven Form. Das Phytochrom dreht sich quasi um, es wandelt sich bei Dunkelheit langsam um. Die durch Hellrot aktivierte Form ist biologisch aktiv. Sie wandert in den Zellkern und löst dort Signalkaskaden aus, die die Transpiration spezifischer DNA-Bereiche aktivieren. Phytochrom dient über diesen Mechanismus der Wahrnehmung von - Sonnenlicht bei der Keimung: Samen von Lichtkeimen sind an eine nur sehr dünne Bedeckung mit der Erde angepasst und können dickere Erdschichten oft gar nicht durchdringen. Sie keimen nur, wenn sie ausreichend Licht über das Phytochrom wahrnehmen. Der Keimungsversuch mit Salat ergab, dass die Keimung dann ausgelöst wird, wenn entweder Tageslicht verfügbar ist, oder die letzte Bestrahlung durch Hellrot erfolgt. - Bestandesschatten: Chlorophyll filtert die hellroten Lichtbestandteile heraus, die sonst das dunkelrote Licht aktivieren würde, während das dunkelrote Licht hier überwiegt. Samen von Lichtkeimern beenden ihre Samenruhe unter diesen Bedingungen nicht. Bereits gekeimte Pflanzen etiolieren (vergeilen) bei Dunkelrot-Überschuss bzw. bei Hellrot Mangel: ergrünen (Chlorophyll Synthese), Blattentwicklung sind stark verzögert, - Internodien verlängern sich stark Sparstrategie um aus dem Dunkel ans Licht zu kommen Der Tageslänge: Tageslicht hat einen hohen Hellrot Anteil und aktiviert das Phytochrom. Während der Nacht wird es langsam inaktiviert. Pflanzen in Regionen mit Jahreszeitenklima dient diese Tages- bzw. Nachtlängen Erkennung der Anpassung der Jahreszeiten. Markant ist etwa die Ausprägung von Kurztag- und Landtagpflanzen bei der Blühinduktion. Allerdings ist die Nachtlänge weit wichtiger als die Tageslänge. Je nach Pflanze liegt die kritische Nachtlänge zwischen 10 und 12 Stunden. Bei Unterschreitung dieser Zeit beginnen die Prozesse. Die Wahrnehmung der Jahreszeiten über die Tageslänge in Kombination mit Wahrnehmung der Temperatur hat Folgen für das Vorbereiten auf die vegetationslose Periode: Knospenbildung beginnt, Laubfall wird eingeleitet, Frosthärte wird aufgebaut Der Wahrnehmungsmechanismus für Temperatur ist noch nicht im Detail bekannt. Vor kurzem zeigte sich, dass Temperaturveränderungen direkt die Genaktivität regulieren, indem sich DNA-Histon-Komplexe verändern. Offensichtlich nimmt also das Chromatin selbst die Temperatur wahr. Es gibt auch Rezeptoren für blaues Licht, die andere lichtgekoppelte Reaktion auslösen unter anderem Cryptochrome und Phototropine. Diese proteinbasierten Pigmente sind ebenso wie die Phytochrome für die De-Etiolierung (Das Verhindern/Beenden von Etiolierung) und die Wahrnehmung jahreszeitlicher Rhythmik verantwortlich, aber auch für - Phototropismus: Wachstum der Pflanze zum Licht - Öffnen der Stomata bei Lichteinstrahlung - Ausrichtung der Chloroplasten zum Licht durch das Cytoskelett - Wahrnehmung der Tagesrhythmik (Tag/Nacht Zyklen) 10.2. Schwerkraft Wird bei Pflanzen durch ähnliche Mechanismen wahrgenommen wie bei Tieren: durch Partikel, die durch ihr Gewicht nach unten gezogen werden und durch Druck Reize auslösen (Statolithen). Bei Pflanzen sind dies aber stets mikroskopisch kleine Partikel innerhalb von Zellen. Häufigstes Prinzip: Körner aus Statolithenstärke in der Wurzelhaube (Statoblasten) drücken auf das Endoplasmatische Reticulum und lösen dadurch Wachstumsreize aus (Gravitropismus). 10.3. Bewegung Pflanzliche Bewegungen können in mehrere große Gruppen unterteilt werden: - Plasmabewegung durch das Cytoskelett - Hygroskopische Bewegungen durch Quellen oder Austrocknung - Taxien (Bewegung des gesamten Organismus) - Nastien (innerhalb eines vorgegeben Bewegungsspielraums, unabhängig von der Richtung der Reizes) - Tropismen (Bewegung mit Bezug zur Richtung des Reizes) Je nach auslösendem Reiz sind Taxien, Nastien und Tropismen mit entsprechender Vorsilbe versehen: - Photo – Licht - Chemo – Substanzen - Thermo – Temperatur - Thigmo-/Seismo - Hydro – Wasser Berührung/Erschütterung - Gravi – Schwerkraft Taxien und Tropismen können positiv (zum Reiz weg) stattfinden, entweder genau in Richtung des Reizes (ortho-) oder in einem bestimmten Winkel zum Reiz (plagio-). Bsp: negativ orthogravitrop: genau entgegen die Richtung der Schwerkraft 10.3.1. Plasmabewegung Für intrazelluläre Plasmabewegungen nutzt die Pflanze ihr Cytoskelett. Involviert sind Mirkotubuli, Aktinfilamente und Motorproteine. z.B. Verschiebung von Cytoskelett Elementen gegeneinander; Verlagerung von Zellorganellen Die Verlagerung von Chloroplasten erfolgt je nach Lichtangebot - Bei geringem Lichtangebot: Chloroplasten bieten dem Licht ihre Breitseite, sie sind gleichmäßig verteilt - Bei (zu) hohem Lichtangebot: Chloroplasten bieten dem Licht ihre Schmalseite, ordnen sich entlang des Plasmalemmas an. Ziel ist es oxidative Schäden zu vermeiden durch freie O2Radikale (Photoinhibition). 10.3.2. Hygroskopische Bewegungen Dieser Typ von Bewegung erfolgt durch reversible Wasseraufnahme (Quellen) oder – abgabe (Austrocknen) und ohne Energieaufwand. Er kann auch von toten Geweben ausgeführt werden z.B. Samenausbreitung bei Kiefer; „Selbsteinpflanzung“ bei Reiherschnabel 10.3.3. Taxis/Taxie Die Bewegungsrichtung ist organisch vorgegeben: die Bewegung wird durch den Reiz nur ausgelöst. Öffnen und Schließen der Blüten von Tag blühenden Pflanzen ist positiv photonastisch. Der Lichtreiz an der Oberfläche führt zu deren Streckungswachstum (Öffnen der Blüte), sein Abnehmen zu Streckungswachstum an der Unterseite. Die Wahrnehmung erfolgt v.a. über die Blaulichtrezeptoren Cryptochrom und die Phototropine z.B. Carl Linnaeus Blumenuhr Einige Pflanzen öffnen und schließen die Blüten thermonastisch z.B. Gänseblümchen, Schwalbenwurz-Enzian Schlafbewegungen bei Schmetterlingsblütlern werden exogen photonastisch geeicht, setzten sich aber auch ohne Lichtreiz fort: endogene circadiane Rhythmyik Thigo- und Seismonastie können Abwehrreaktionen sein, um Fressfeinden weniger Angriffsfläche zu bieten. Reizleitung erfolgt bei diesem Bewegungstyp nicht nur chemisch, sondern auch elektrisch. Ähnlich den Nerven bei Tieren breiten sich Aktionspotenziale über das ganze Blatt aus. Bei der Mimose (Sinnespflanze) klappen die Blattgelenke bei Turgorverlust nach unten. Auch die Bewegungen bei Insetivoren (Sonnentau, Venusfliegenfalle) erfolgen thigmo- und seismonastisch Bei der Berberitze ist die Thigmonastie in die Pollenverbreitung involviert. Bei einer Berührung an den Staubgefäßen, schnappt diese nach innen und drückt dem Insekt den Pollen auf den Kopf. 10.3.4. Tropismen Positiver Phototropismus kennzeichnet die meisten Sprossachsen, das Wachstum zum Licht. Dieser Mechanismus wurde bereits von Charles Darwin, anhand von Getreide Koleoptilen untersucht. Koleoptile: spezielle Umbildung des Keimblattes bei Gräsern, erfüllt Schutzfunktion für das Primärblatt. Durch Versuche mit versch. Spektralfarben ist inzwischen geklärt, dass nur der blaue Spektralanteil einen Effekt hat. Phototropismus wird durch das Cryptochrom System vermittelt. Gravitropismus ist in Spross- und Wurzelspitzen anzutreffen. Wurzeln sind positiv orthogravitrop und zusätzlich meist photoatrop (nicht auf Licht reagierend) oder negativ phototrop. Test um Gravitropismus zu beweisen sind z.B. Lageänderung der Pflanze, Zentrifugation, Experimente in der Schwerelosigkeit und permanente Rotation in beliebiger Richtung. Thigmotropismus haben wir bei den Ranken eig. Schon kennengelernt. 10.4. Reizleitung und Botenstoffe Bei Temperaturreizen verändert sich die DNA (bzw. Chromatin) unmittelbar. Bei Thigmonastien werden die Reize teilweise durch elektrische Potenziale weitergeleitet. Die meisten Wachstumsvorgänge werden jedoch durch Phytohormone vermittelt und weitergeleitet. Wie auch bei tierischen Organismen sind Hormone auch bei Pflanzen Signalgeber: es sind kleine Moleküle, die zwischen Zellen und Geweben Informationen weiterleiten und an ihrem Zielort bestimmte Prozesse (Signalkaskaden) auslösen. 10.4.1. Phytohormone: Auxin von augere = wachsen Versuche von Darwin & Darwin zeigten, dass Belichtung zu Zellstreckung an der beschatteten Seite führt und dadurch zu einer Krümmung ans Licht und nur die Spitze der Koleoptile Licht wahrnimmt. Boysen-Jensen fand zusätzlich heraus, dass offenbar ein Signal von Koleoptilspitze nach unten gesandt wird, dass das Wachstum auslöst, und dass dieses Signal einen Gelatinblock durchdringen kann, jedoch einen mineralischen (Glimmer-)block jedoch nicht. Went schließlich konnte zeigen, dass die Substanz, die er nun „Auxin“ nannte, auch von einer auf dieanderen Pflanze übertragen werden konnte. Je nachdem, wo und wie er die Substanz aufbrachte, konnte er die Krümmung selbst beeinflussen. Auxin verursacht v.a. Streckungswachstum in Koleoptilen, Sprossachsen und Wurzeln. Es wird in Apikalmeristem synthetisiert und von dort in den Rest der Pflanze transportiert. In der Wurzelspitze bewirkt es die Wachstumsvorgänge des Gravitropismus, in der Sprossspitze die des Phototropismus. Es fördert die Bewurzelung. In der Pflanze wird es im Parenchym transportiert, aber v.a. im Phloem vom Spross-Apex abwärts (basipetal). Im Spross verursacht Auxin außerdem die Apikaldominaz: das oberste Apikalmeristem hemmt alle weiter unten liegenden mehr oder weniger im Austreiben. Die Hemmung wird geringer, je weiter eine Seitenknospe vom Apex entfernt ist (Stoffgradient). Die Apikaldominanz ist bei untersch. Pflanzenarten untersch. Stark ausgeprägt. Ohne Apex treiben die Seitenknospen aus. Im Pflanzenbau werden Auxine als Bewurzelungshormon für Stecklinge genutzt. Synthethische Varianten werden aber auch als Herbizide eingesetzt (Auxin Überdose töten Dikotyle durch Erschöpfung) und spielten als Entlaubungsmittel auch eine unrühmliche Rolle im Vietnamkrieg. 10.4.2. Phytohormone: Gibberelline Wurde 1935 als Stoffwechselprodukt des Reises befallenden Pilzes Gibberella fujikurai entdeckt. Befallene Reispflanzen produzieren verrückte Sämlinge, die zu hoch wachsen und unter dem eigenen Gewicht zusammenbrechen. Die Substanz ist aber ebenso Teil des natürlichen Hormonstoffwechsels von Pflanzen. Gibberellina sind v.a. Keimungshormone. Sie fördern aber auch Blattaustrieb, Streckungswachstum und Blüten- und Furchtbildung. Gibberelline wird auch von Samen produziert, kernlose Trauben werden deswegen mit Gibberelline besprüht. Im Zuge der Industrialisierung der LW wurden in den 1940er Jahren zwergwüchsige Weizenmutanten gezüchtet, die nur wenig auf Gibberelline ansprechen. Der Kornertrag stieg knapp um das Sechsfache, weil die Pflanzen nun weniger Ressourcen in Spross- und Blattmasse investieren. 10.4.3. Phytohormone: Cytokinine Syntheseorte sind v.a. die Wurzelspitzen (Cytokin wird im Xylem nach oben transportiert), aber auch allgemein Meristeme und junge Gewebe. Cytokinine sind Jugendhormone, denn sie verhindern - Seneszenz (Alterung) von Organen, sowie die Synthese des damit verbunden Alterungshormone Ethylen; - fördern und regeln das Teilungswachstum und die Balance zwischen Zellteilung und Zelldifferenzierung; - fördern den Knospenaustrieb Das Verhältnis Auxin:Cytokinin bestimmt über die Apikaldominanz. In der Gewebekultur (Regeneration von Pflanzen aus Zellkulturen oder Gewebeteilen im Labor) entscheidet das Verhältnis von Auxin zu Cytokinin darüber, welche Organe v.a. regeneriert werden. Nur Cytokinin: Sprossbildung, ohne Hormone: unverändert; Auxin und Cytokinin: Knallausbildung; nur Auxin: Wurzelbildung 10.4.4. Phytohormone: Abscisinsäure Verhindert Wachstum ebenso wie das vorzeitige Keimen von Samen (sie erzeugen Dormanz) und ist damit gegenspieler der Gibberelline. Erst wenn sie abgebaut ist, kann Keimung erfolgen. Es wird bei Wasserstress freigesetzt und bewirkt das Schließen der Stomata. 10.4.5. Phytohormone: Jasmonsäure Neben Funktionen in der Blattentwicklung und in der Förderung von Alterungserscheinungen ist Jasmonsäure v.a. bei Stresshormon bei Verwundung und Krankheiten. Es löst die Produktion von Protease Inhibitoren aus, Enzymen die die Eiweißverdauung pflanzenfressender Tiere blockieren. 10.4.6. Phytohormone: Ethylen Ein gasförmiges Pflanzenhormon. Auf die Sprossachse und die Wurzel hat es die Wirkung dass - Längenwachstum wird gehemmt - Verdickung der Wurzel und der Sprossachse - Gravitropismus deaktiviert wird und Wurzel und Spross sich krümmen In kleinen Mengen wird es produziert, wenn Spross oder Wurzel auf Hindernisse stoßen und um sie herum wachsen müssen. Außerdem: Alterungs- und Reifungshormon, es löst bei Blättern die Seneszenz und Blattfall aus. Es führt zu Frucht- und Samenreife und wird dann selbst von den Früchten produziert (selbstverstärkender Prozess). Im internationalen Handel mit Früchten wird die Etyhlenproduktion durch CO2 als Schutzgas blockiert. Erst am Zielort erfolgt die Begasung mit Ethylen. Ansonsten würde die Reifung sehr schnell erfolgen. 11. Stress 11.1. Stressoren ABIOTISCH Physikalische Chemische Lichtmangel Wassermangel Lichtüberschuss, UV-Strahlung Sauerstoffmangel Hitze Sauerstoffradikale Kälte und Frost Luftschadstoffe Mechanische Belastung Nährstoffmangel Verwundung Salz Schwermetalle Herbizide BIOTISCH Pflanzenkonkurrenz Pflanzenfresser Symbiosepartner Pathogene (Pilze, Bakterien) 11.1.1. Resistenz Definiert Strategien, mit denen Pflanzen ungünstige Bedingungen überstehen - Optimumsbereich: keine Resistenz nötig - Toleranz durch physiologische Anpassung übersteht die Pflanze die Einwirkung des Stress - Vermeidung die Pflanze weicht dem Stress aus, räumlich oder zeitlich - Restitution geschädigte Teile werden ersetzt v.a. bei Dysstress 11.2. Temperaturstress 45° 35-45° 15-35° 5-15° •Dystress •Wachtumsstop, programmierter Zelltod •Eustreß •induzierte hs-Toleranz, HSp-Synthese, verlangsamtes Wachstum •Optimum •optimales Wachstum und Entwicklung mit Blütenbildung und Fruchtreifung •Eustreß •verlangsamtes Wachstum, Einstellung der Blütenbildung, Kältekonditionierung 11.2.1. Kälte Kälte stresst die Pflanze durch Verlangsamung des Metabolismus, Verlust der Elastizität in den Biomembranen, Verlust der Funktion der Biomembran. Frost stresst die Pflanze durch Gefrieren des Wassers im Apoplasten, Dehydrierung der Zellen, Konzentration des Protoplasmas, Zerstörung der Biomembranen. - Bei kältetoleranten Pflanzen: erworbene Kälteresistenz durch Einbau ungesättigter Fettsäuren in den Biomembranen dadurch bleibt die Membran bis weit unter 40° flüssig und funktionsfähig - Frostintolerante Pflanzen sterben durch intrazellulare Eisbildung. Die Zellorganellen werden durch Eiskristalle zerrissen - Frosttolerante Pflanzen verlagern die Eisbildung in den Apoplasten: Symplast bleibt eisfrei, wird aber stark dehydriert Kälteresistenz ist nicht nur artspezifisch, auch innerhalb einer Pflanze sind Organe und Gewebe unterschiedlich widerstandsfähig. Bsp: Kaffeepflanze wurde nach 36St Kühlung Schädigungen versch. Gewebe und Organe ermittelt, v.a. Wurzeln, Knospen, chloroplastische (kranke) Blätter, Kambium und die Embryonen in den Samen wurden schwer geschädigt, während Holz und Bast sowie gesunde Blätter kaum betroffen waren. Isolation: durch dicke Borke oder abgestorbene Blätter z.B. Senecio Arten in Kenya besitzen mehrere tausend Blätter pro Wuchsmeter als Isolation Wuchshöhe steht teilweise ebenfalls in Zusammenhang mit Temperatur. Bodennah sind die Temperaturen durch die Sonnenstrahlung auf den Boden immer höher. Die Unterschiede können bis zu 10° ausmachen. So sind z.B. Gänsehöhe (40cm) und Latschenkiefer (1-3m) als Chamaephyten bzw. Nanophanerophyten zusätzlich durch die Schneedecke vor hoher Verdunstung geschützt, während die Schwarzföhre (bis50) keinen solchen Schutz genießt. 11.2.2. Hitze Weißfilzige Behaarung setzt die Verdunstung stark herab, reflektiert aber ebenso Licht: Überhitzung des Blattes und oxidativer Stress werden verhindert. Bei der Silberlinde sind die Blätter nur unterseits silbrig-filzig behaart, bei Starklicht und Hitze werden die Unterseiten nach außen gedreht. 11.3. Strahlungsstress 11.3.1. Lichtmangel Mangel an photosynthetisch aktiver Strahlung führt zum Verhungern der Pflanze. Sie reagiert auf Lichtmangel durch Anpassung wie - Etiolierung - Verzögerter/ausbleibender Keimung - Ausbildung von Schattenblätter - Erschließen einer zeitlich begrenzten Nische: Frühjahrsgeophyten wickeln ihren gesamten Reproduktionszyklus ab, bevor die Laubbäume über ihnen austreiben…den Rest des Jahres verbringen sie als Knollen/Zwiebeln/Rhizome. 11.3.2. Lichtüberschuss Photosynthese weist eine Sättigungskurve auf: ein Mindestmaß an Licht ist notwendig um die CO2 Produktion der Zellatmung zu kompensieren (=Kompensationspunkt). Ab einer bestimmten Lichtmenge kann der Photosyntheseapparat der Chloroplasten aber keine zusätzliche Lichtenergie mehr verarbeiten (Sättigungspunkt). Besonders aus der Lichtreaktion der Photosynthese gehen nun große Mengen hochreaktiver Sauerstoffradikale hervor, die durch Oxidieren Zellbestandteile schädigen – es kommt zur Photoinhibition und schließlich zur Nekrose. Starklichtschäden durch Radikale können zu verbrannten Blättern führen. Gegenmaßnahmen ähnlich wie bei Hitze - Reflexion durch Haarfilz - Ausbildung von Sonnenblättern - Produktion von Anthocyanen: v.a. bei jungen Blättern (rötlich) - Drehen der Blätter aus der Sonne - Starklichstellung der Chloroplasten Die Farbstoffe filtern einen Teil der photosynthetisch aktiven (Rotlicht)Strahlung ebenso wie einen Teil des UV-Lichts und fungieren somit als Sonnenschutz 11.4. Trockenstress Tritt unter versch. Bedingungen auf - Hitze - Salzstress - Oft gemeinsam mit Strahlungsstress - Frost: durch Entzug flüssigen Wassers Häufigste Anpassungen zielen auf Vermeidung von Trockenstress: - Blatt- oder Sprosssukkulenz: Wasserspeicherung - Xerophyllie: übersteigerte Sonnenblätter - C4 Weg der Photosynthese Spezielle Wurzelsysteme dienen der effizienten Aufnahme von Wasser: intensive Bewurzelung (Wurzelfilz) bei Gräsern, extensive aber tiefergehende Wurzeln zum Erschließen tiefliegender Wasserreserven. Viele sukkulente weisen ein stark verzweigtes oberflächennahes Wurzelsystem auf, es kann bei Niederschlägen Wasser in großen Mengen aufnehmen. Blattfall vor der trockenen Jahreszeit (gemäßigte Zonen: Winter; mediterranes und subtropische: Sommer) ist ein äußerst wirkungsvolles Mittel zur Vermeidung von Trockenstress Therophyten vermeiden Trockenheit durch Abwesenheit, sie investieren nicht in Überdauerungsorgane oder ähnliches, sondern überdauern als Samen 11.5. Salzstress - Hohe Salzkonzentrationen im Bodenwasser (v.a. Meeresküsten) haben ein sehr niedriges osmotisches Potenzial und entziehen den Pflanzen Wasser. Außerdem ist Natriumchlorid in großer Menge toxisch. Physiologische Toleranz nur in geringen Mengen möglich, meistens Vermeidungsstrategien. Sukkulenz: Salzverdünnung durch Wasserspeicherung Transportunterbrechung: in der Wurzel (endodermis) und andere Gewerbeteilen v.a. in den Mangroven Ausscheidung durch spezielle Absalzdrüsen oder Salzhaare z.B. Strandflieder Ausscheidung durch Abwerfen von versalzten Pflanzenteilen z.B. Strand Wegerich Allerdings nicht nur in Küstengebieten. Für landwirtschaftliche Produktionsflächen in ariden Klima ist die Bodenversalzung ein immer größer werdendes Problem. 11.6. Biotische Stressoren Pflanzen treten in einem Ökosystem mit einer Vielzahl von Organismen in Wechselwirkung. Trophiestufen und Nahrungsnetze sind dabei nur ein kleiner Teil der Geschichte. RäuberBeute-Interaktionen als Trophiestufen dargestellt: je trophischer Ebene sind nur etwa 2-24% der Energie der vorigen Stufe verwertbar. Je länger eine Nahrungskette, desto weniger der ursprünglich gebunden Energie ist verfügbar. Antibiosen sind Interaktionen, die für einen der beteiligten Partner von Nachteil sind: Allelopathie, Konkurrenz/Interferenz, Räuber-Beute-Interaktion, Parasitismus Symbiosen sind Interaktionen, die für min. einen Partner von Vorteil sind und nicht schädigen: Allianz, Mutualismus, Eusymbiose. All diese Formen sind durch fließende Übergänge verbunden, und oft ist es schwer herauszufinden, welcher Partner tatsächlich wie viele oder gar mehr Vorteile daraus zieht. 11.6.1. Antibiosen: Konkurrenz Jeder Organismus hat für sich genommen spezifische Ansprüche, die für optimales Wachstum erforderlich sind. Diese Ansprüche (autoökologische Potenz) gelten aber nur im Labor. Im Zusammenleben mit anderen Pflanzen, Konkurrenten, entscheidet die Konkurrenzkraft der jeweiligen Pflanzen darüber, wo sie sich schlussendlich durchsetzen können (synökologische Potenz). Hohenheimer Grundwasserversuch: Abgeschrägtes Beet (variable Wasserversorgung des Bodens) wurden mit Streifen versch. Grasarten besät: jede Art in Reinkultur, sowie ein Streifen mit Mischkultur. Bei der Einzelaussaat haben alle 3 Pflanzen eine ähnliche Höhe gewählt, bei der Mischkultur haben sie sich unterschiedlich (je nach Konkurrenzstärke) ausgebreitet, wobei der Glatthafer überwog. Bsp: Naturpark Leiser Berge: Robinie in Symbiose mit Bakterien die Stickstoff bearbeiten, düngen ihren eigenen Boden, nur Pflanzen die an viel Stickstoff angepasst sind, können noch um die Robinie herum wachsen 11.6.2. Antibiosen: Allelopathie Besonderer Mechanismus in der Konkurrenz: Arten beeinflussen das Wachstum anderer Arten direkt negativ, um sich Konkurrenz vom Leib zu halten. Z.B. Walnuss: Früchte und Blätter bilden große Mengen eines Hydrojuglon-Glukosids: die Substanz wird vom Regen in den Boden gewaschen und mikrobiell umgebaut. Sie wirkt dann als Hemmstoff für Pflanzenkeimung. Im Traufbereich von Wallnussbäumen ist der Unterwuchs gehemmt und damit potenzielle Konkurrenten. Purpur-Salbei: in der amerikanische Sierra Nevada. Pflanze gibt Monoterpene an die Athmosphäre ab, die über Tau nachts in den Boden gelangen, wirken dort als Keimungshemmer. Aber bei großer Hitze führt die Terpene zu Selbstentzündung und Buschbränden. Keimhemmung fällt weg, und Gräser sowie Salviensamen keimen aus. 11.6.3. Antibiosen: Parasitismus Parasitische Pflanzen sind auf andere Arten angewiesen, mit denen sie in physiologischem Zusammenhang stehen und denen sie durch Entzug von Ressourcen Schaden zufügen. - Holoparasiten: beziehen Wasser, Nährsalze und organische Substanz vollständig vom Wirt und betreiben auch keine eigene Photosynthese mehr - Hemiparasiten: ziehen zumindest Wasser und Nährsalze von ihren Wirten, manche Photosyntheseprodukte. In jedem Fall sind sie aber selbst photosynthetisch aktiv. Sie sind über Haustorien (umgebildete Wurzeln) mit ihren Wirten verbunden und zapfen dort entweder nur das Xylem oder auch Xylem und Phloem an. Misteln: Samen endozoochor durch Vögel verbreitet, Keimpflanze treibt statt Keimwurzeln ein Haustorium durch die Baumrinde ins Xylem. Als Hemiparasit betreibt die Mistel selbst Photosynthese, zapft vorwiegend Wasser und Nährsalze des Wirtes an. Starker Mistelbefall kann Bäume stark schädigen. Seide war in Zeiten der Flachskultur ein gefürchteter Schädling, gewinnt besonders im Biolandbau wieder an Bedeutung. Blattloser Holoparasit, der Xylem und Phloem des Wirtes anzapft. Besonders die Familie der Sommerwurzgewächse (Orobanchaceae) umfasst auch in Mitteleuropa viele Halb- und Vollparasiten z.B. Wachtelweizen, Klappertopf, Augentrost. Einige davon sind von großer wirtschaftlicher Bedeutung als Parasit von Kulturpflanzen. Sommerwurz v.a. auf Schemtterlingsblütlern, kann zu enormen Ernteausfällen führen. 11.6.4. Symbiose: Allianzen, Mutualismen Bei Allianz (Protokooperation) und Mutualismen sind die beiden Partner nicht zwingend aufeinander angewiesen, profitierten aber von der Wechselwirkung. Phytohormone als Botenstoffe: die flüchte Jasmonsäure dient nicht nur als Stresshormon, sondern alarmiert auch benachbarte Pflanzen. Z.B. Akazie: Beschädigung provoziert Jasmonsäure und in der folge Bittersäure, Blätter werden bitter. Signal provoziert auch Bitterstoffsynthese in benachbarten Akazien, bei Eintreffen der Giraffe ist sie bereits bitter. Gasförmiges Ethylen ist auch ein Botenstoff für Tiere. Anlockung v.a. fruchtfressender Säugetiere zur endozoochoren Samenverbreitung durch charakteristischen Obstgeruch. Wird erst freigesetzt, wenn die Samen im Inneren der Frucht reif sind. Generell gehören die Verbreitungswege über Endo-und Exozoochorie zu den Mutualismen. Wachtruppen: die Ameisenpflanze in Papua-Neu Guinea bietet Ameisen in ihrem Spross Lebensraum, diese düngen die Pflanze mit ihren Ausscheidungen und beschützen sie vor Herbivoren; die Büffelhorn-Akazie in Mittelamerika bietet Wohnhöhlen in Inneren der hohlen Nebenblattdornen, mit Nektardrüsen für die adulten Ameisen, eiweißreiche beltian bodies als Futter für Larven, und bekommt dafür umfassenden Schutz. Die Ameisen knabbern sogar aufkeimende Pflanzen, die ihrer Heimatpflanze bedrohlich werden könnte, ab. 11.6.5. Eusymbiose: Wurzelknöllchen Mehrere Gattungen von Stickstoff fixierenden Bakterien (Rhizobium) gehen Symbiosen mit den Wurzeln von Schmetterlingsblütlern ein. Die Knöllchenbildung verursacht im Inneren Sauerstoffmangel unter dem die Reduktion von Stickstoff zu Ammoniak erst ablaufen kann. Gegenleistung der Pflanze ist die Versorgung der Rhizobien mit Photosyntheseproduktion. Eine der wirtschaftlich wichtigsten Symbiosen in der Anwendung als Gründüngung. 11.6.6. Eusymbiose: Mykorrhiza = „Pilzwurzel“, häufigste und wichtigste Symbiose für Pflanzen. Über 80% der Landpflanzen leben in Mykorrhiza. Häufigste Form: Endomykorrhiza: Pilzfäden (Hypen) dringen in die Wurzelrinde ein und perforieren ihre Zellen. Vesikel und Arbuskeln (verzweigte Strukturen) der Pilzhypen stellen engsten physiologischen Kontakt her. Pilzpartner: Arten der Glomeromycota, einer eigenständigen Pilzgruppe ohne bekannte sexuelle Vermehrungsstadien. Sie sind weitgehend auf Pflanzenpartner angewiesen. Pflanzenpartner sind nahezu alle Landpflanzen, inklusive Kulturpflanzen. Die Hypen bilden ein dichtes Geflecht in der und um die Wurzelrinde, dringen aber nicht ein. Bildung von Wurzelhaaren wird unterbunden. Ektomykorrhiza: meist bei Waldbäumen. Pilzpartner sind hier v.a. Schlauch und Ständerpilze fast alle bodenlebenden Waldpilze (auch Speisepilze) sind Mykorrhizabildner. NUTZEN: Der Pilz vergrößert die adsorbierende Fläche der Pflanzenwurzel um einen Faktor von mehreren Hundert und wird im Gegenzug mit organischer Substanz versorgt. Bei Orchideen ist diese Symbiose ins Extreme getrieben: ihre Samen enthalten anstatt Embryonen mit Speichergewebe nur rudimentäre Zellgruppen. Eine Keimung ist erst nach Infektion mit symbiotischen Pilzen und Nährstoffversorgung durch sie möglich. Einige Orchideenarten sind zu einer parasitischen Lebensweise übergangen und schmarotzen zeitlebens auf dem Pilz. 11.6.7. Eusymbiose: Flechten Extrem enge Symbiose aus Pilzen und Grünalgen, mit eigenständiger Morphologie und Physiologie. Die Gestalt wird vom Pilzpartner bestimmt. Sie pflanzen sich überwiegend vegetativ über Bruchstücke fort. 11.6.8. Eusymbiose: Bestäubung Ist ein Sonderfall von Koevolution und Symbiose. Vertreter versch. Pflanzen- sowie Tiergruppen haben sich jeweils aneinander angepasst. Außerdem: ein Bestäuber ist üblicherweise fähig, sich von mehreren Pflanzenspezies zu ernähren, im Gegenzug werden die meisten Pflanzen von mehreren versch. Tierarten besucht und bestäubt. Im Normalfall werden Nahrung (Nektar, Pollen) gegen reproduktive Gefälligkeiten getauscht. Die australische Hammerorchidee: hat einen besonderes Lebenszyklus, die Blüte ahmt ein paarungsbereites Weibchen nach und sendet dieselben Pheromone aus. Bei der australischen Rollwespenart schlüpfen die flugfähigen Männchen vor den Weibchen. Die flugunfähigen Weibchen schlüpfen, klettern auf Halme und locken die Männchen mit Pheromonen zur Paarung. 11.6.9. Eusymbiose: Landwirtschaft? Im Prinzip ebenfalls eine symbiotische Beziehung. Einerseits absolute Abhängigkeit des Menschen von Kulturpflanzen, andererseits wurden diese Pflanzen erst durch menschliche Eingriffe geschaffen, und sie sind meist auch nicht mehr ohne den Menschen reproduktionsfähig.