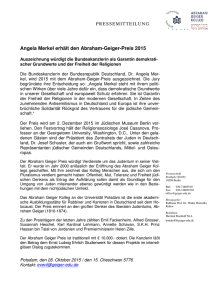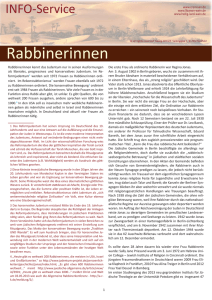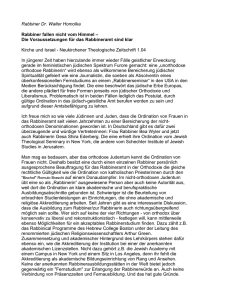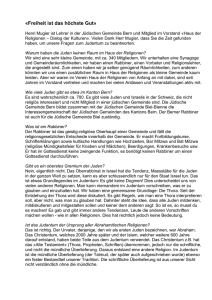Kescher - Jüdische Liberale Gemeinde Köln
Werbung

Kescher A B R A H A M G E I G E R KO L L E G … hat sich einer der Rabbinerstudenten, die am 14. September in Dresden ihre Smicha erhalten haben, zum Motto gewählt. Hillels Appell aus den „Sprüchen der Väter“ bekam bei der ersten Rabbinerordination hier zu Lande seit 1940, zu der wir zusammen mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland und der Dresdner Jüdischen Gemeinde eingeladen hatten, eine ganz eigene Bedeutung. „Religion wie überhaupt Traditionen sind für die mentale Verfasstheit unserer Gemeinschaft unerlässliche Quellen der Lebensenergie“, sagte Charlotte Knobloch, die Präsidentin des Zentralrats. „Und Dank der Ordination kommen wir unserem Ziel wieder ein Stück näher, jüdisches Leben in all seinen Facetten in den jüdi- schen Gemeinden zu etablieren.“ Das genau war auch das Anliegen Abraham Geigers (1810-1874): „Aus dem Judentum heraus die Judenheit neu und frisch belebt zu gestalten.“ Seine Hoffnung, die er schon als Student um 1830 formulierte, kann unser Kolleg erfüllen: "Wenn doch einst ein jüdisches Seminar an einer Universität errichtet würde, wo Exegese, Homiletik und für jetzt noch Talmud und jüdische Geschichte in echt religiösem Geiste vorgetragen würde; es wäre die fruchtbarste und belehrendste Anstalt!“- es braucht aber weiteres Engagement, um durchzusetzen, was für Geiger das Ziel aller seiner Bemühungen war: „Die Gleichberechtigung des Judentums mit den anderen Konfessionen.“ 1 KKesche r Informationen über liberales Judentum im deutschsprachigen Raum Wenn nicht jetzt, wann dann? 1 4. Jahrgang | H e r b s t 2 0 0 6 | Tischri 5767 Kescher 2 4. Jahrgang | Ausgabe 1 ABRAHAM GEIGER KOLLEG Durch Erforschung des Einzelnen zur Erkenntnis des Allgemeinen, durch Kenntnis der Vergangenheit zum Verständnis der Gegenwart, durch Wissen zum Glauben Abraham Geiger (1810 - 1874) Präsident Oberrabbiner Prof. Dr. Walter Jacob Senat Prof. Dr. Ernst Ludwig Ehrlich Prof. Dr. Paul Mendes-Flohr Prof. Dr. Wolfgang Loschelder Rabbiner Dr. W. Gunther Plaut Rabbiner Dr. John D. Rayner CBE* Kuratorium Dr. Josef Joffe (Vorsitzender) Adina Ben-Chorin Leslie F. Bergman Rabbiner Dr. Albert H. Friedlander OBE* Rabbiner Dr. David J. Goldberg OBE Rabbiner Prof. Dr. Arthur Hertzberg* Rabbiner David Hoffmann Lord Joffe CBE György Konrád Stuart Matlins Baroness Neuberger DBE Wolfgang M. Nossen Prof. Dr. Elizabeth Petuchowski Harold Sandak-Lewin Prof. Dr. Julius H. Schoeps Max Warburg Rabbiner Dr. Mark L. Winer Direktorium Rabbiner Dr. Walter Homolka Prof. Dr. Admiel Kosman Rabbiner Drs. Edward van Voolen Rabbiner Dr. Tovia Ben-Chorin IMPRESSUM Kescher: Informationen über liberales Judentum im deutschsprachigen Raum Newsletter des Abraham Geiger Kollegs Kescher: hebräisch: Verbindung, Kontakt Titelbild: Julius Kornick, Porträt Abraham Geiger (1874), © Stiftung Stadtmuseum Berlin Herausgeber Abraham Geiger Kolleg gGmbH Postfach 120852, 10598 Berlin Tel: (030) 31800 587, Fax: (030) 31800 586 [email protected] www.abraham-geiger-kolleg.de Redaktion / V.i.S.P. Hartmut G. Bomhoff Gestaltung: Thomas Regensburger Druck: Oktoberdruck AG, Rudolfstraße 1-8, 10245 Berlin Auflage: 1.000 Exemplare ISSN-Nr.: 1861-4469 Grußbotschaft ZUM JÜDISCHEN NEUJAHRSFEST ROSCH HASCHANA 23. UND 24. SEPTEMBER 2006 Berlin, im September 2006 In diesen Tagen begehen unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger das Neujahrfest. Dazu sende ich von Herzen alle meine guten Wünsche. Beim Jahreswechsel gehen die Gedanken zurück und man lässt noch einmal das Geschehene Revue passieren. Ein trauriges Ereignis hat die ganze jüdische Gemeinschaft in Deutschland getroffen: Der Tod Paul Spiegels, des geschätzten und liebenswürdigen Präsidenten des Zentralrats der Juden, hat eine große Lücke gerissen. Mit Paul Spiegel ist eine markante und unverwechselbare Stimme verstummt, eine Stimme der Vernunft und der Zivilcourage. Bei der Trauerfeier in Düsseldorf habe ich seine Entscheidung, nach dem Krieg wieder nach Deutschland zu gehen und hier zu leben, als einen Ausdruck des Vertrauens und der Hoffnung bezeichnet. Dieses Vertrauen bleibt auch ein immerwährender Auftrag, jüdisches Leben in Deutschland zu schützen und zu stärken. Ein schönes und bewegendes Zeichen der Hoffnung ist für mich, dass vor einigen Tagen in Dresden die erste Rabbinerordination in Deutschland seit 1942 stattfand. Das ist ein bedeutendes Ereignis – und das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Selbstverständlichkeit und zu einer größeren Unbefangenheit jüdischen Lebens in Deutschland. Wenn wir jetzt unseren Blick nach vorn richten, dann denke ich vor allem an die bevorstehende Einweihung der neuen Synagoge in München am kommenden 9. November. Die neuen jüdischen Gebetshäuser, die einen Platz im Herzen unserer Städte einnehmen, sind für die ganze jüdische Gemeinschaft ein Fest und ein deutliches Signal dafür, dass die jüdischen Gemeinden lebendig sind, dass sie wachsen und gedeihen. Ich weiß, dass viele jüdische Mitbürger mit Sorge nach Israel schauen und sich bang fragen, wie die politische Entwicklung weitergeht. Mit Sorge aber beobachten sie auch manche Reaktionen in Deutschland. Für mich und für alle, die Verantwortung tragen in unserem Land, bleibt klar, dass Deutschland um seine besondere Verantwortung für Israel weiß, dass wir an der Seite Israels stehen. Ministerpräsident Olmert hat ausdrücklich darum gebeten, dass sich deutsche Soldaten an der Friedensmission im Südlibanon beteiligen. Wir werden das tun – und wir werden das als Freunde Israels tun. Ich wünsche allen Bürgern, die das jüdische Neujahrsfest begehen, Tage der Besinnung und der Freude. Gesundheit und Glück sollen sie durch das Jahr 5767 begleiten. Horst Köhler Bundespräsident Kescher 3 Foto © Ralf Bäcker | Zentralrat „Das Wunder von Potsdam“ titelten die Zeitungen im In- und Ausland, als sie über unsere ersten drei Absolventen berichteten. Ein Wunder? „Nach dem Holocaust war es für viele nicht vorstellbar, dass in Deutschland jemals wieder jüdisches Leben aufblühen würde." So urteilt Bundespräsident Horst Köhler in seinem Grußwort anlässlich der Ordination des Abraham Geiger Kollegs am 14. September 2006. Mehr als sechs Jahrzehnte nach der Zerschlagung der Berliner Hochschule für die Wissenschaft des Judentums sind jetzt kurz vor den Hohen Feiertagen wieder die ersten Rabbiner in Deutschland ordiniert worden. An der Feier des Zentralrats der Juden in Deutschland und des Abraham Geiger Kollegs in der Dresdner Synagoge nahmen hochrangige Vertreter aus Politik, Gesellschaft und den Religionsgemeinschaften teil. Brandenburgs Ministerpräsident Platzeck (SPD) würdigte die Amtseinführung als „Meilenstein in der deutschjüdischen Geschichte“. Die Rabbiner-Ausbildung am Potsdamer Abraham Geiger Kolleg sei „ein wichtiger Schritt für die Renaissance des Judentums in Deutschland“. „Ein starkes Zeichen für jüdisches Leben in Deutschland“ nannte die Bundesbildungsministerin Dr.Annette Schavan (CDU) den bewegenden Gottesdienst direkt im Anschluss. „Es ist aber auch ein Signal für glaubende Menschen in unserem Land generell. Wir Juden, Muslime und Christen sind alle Mitglieder der großen abrahamitischen Religion und in solch einem Gottes- „Das Wunder von Potsdam“ DIE ERSTE RABBINERORDINATION SEIT DER SCHOA IST EIN ZEICHEN FÜR DIE ERNEUERUNG JÜDISCHEN LEBENS uns froh“, sagte der Vizepräsident des Zentralrats, Dr. Dieter Graumann, bei der Pressekonferenz in Dresden. „Wir dürfen aber nicht den Boden unter den Füßen verlieren“. „Die Gemeinden hungern nach Rabbinern“, so Graumann weiter. dienst wird einem deutlich, was das heute bedeutet. Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen: Die jüdischen Gemeinden können aus ihren Reihen heraus Seelsorger motivieren, sich einem neuen Auftrag zu stellen.“ Unsere ersten drei Absolventen stammen aus Deutschland, Tschechien und Südafrika. Der Präsident des Abraham Geiger Kollegs, Rabbiner Walter Jacob, sprach bei der Ordination von einem „wunderbaren Tag“, über den sich Deutschland und Europa freue. Er hoffe, dass die Rabbinerausbildung zum Aufbau eines neuen Judentums in Deutschland beitrage. Die Ordinationsfeier sei ein „Festtag“ und „macht Wir haben also einen großen Schritt nach vorne getan, und das aus eigener Kraft. Ob die Hoffnungen berechtigt sind oder trügen, wird wesentlich von zwei Faktoren abhängen: zum einen müssen sich die strukturellen Beziehungen zur Universität Potsdam konsolidieren, zum anderen benötigen wir dringend die Unterstützung des Sitzlandes Brandenburg und der Kultusministerkonferenz. Erst eine institutionelle Förderung kann das Abraham Geiger Kolleg in seinem Bestehen sichern. Sonst war es nur ein Traum. „L'shana tova u'mevorechet“ Rabbiner Dr. Walter Homolka Rektor des Abraham Geiger Kollegs an der Universität Potsdam 4 Kescher 4. Jahrgang | Ausgabe 1 JÜDISCHES LEBEN Streiter für ein großes Judentum „Wir wollen positive ZUM 200. GEBURTSTAG VON SAMUEL HOLDHEIM EINE NEUE GEDENKTAFEL ERINNERT AN DIE Samuel Holdheim (Kempen bei Posen 1806 Berlin 1860) brillierte früh in seinen talmudischen Studien, fand aber erst allmählich Zugang zur allgemeinen Bildung. Nach Studien in Prag und Berlin war er zunächst als Rabbiner in Frankfurt/Oder tätig, bevor er im August 1840 Generalsuperintendent beziehungsweise Landesrabbiner von Mecklenburg-Schwerin wurde. Währens seiner siebenjährigen Amtszeit dort machte er sich mit Schriften wie Über die Autonomie der Rabbinen und das Princip der jüdi- schen Ehe (1843) und Über die Beschneidung Zunächst in Religiös-Dogmatischer Beziehung (Schwerin and Berlin, 1844) einen Namen. Holdheim sprach sich für eine entschiedene Umgestaltung der religiösen Praxis aus, indem er die Halacha von ihren nationalen und rechtlichpolitischen Elementen zu befreien suchte, also von jenen Bestimmungen, die über den religiösen Bereich hinausgehen und eine vollständige Integration der Juden in das jeweilige Staatswesen verhindern. Holdheim hatte und nahm Anteil an der rechtlichen Emanzipation der Juden und predigte am 14. November 1846 am Schabbat Chaije Sarah zu „Die religiöse Aufgabe in dem neuen Vaterland bei Gelegenheit der Befreiung der Israeliten Mecklenburg-Schwerins von der Abgabe des Schutzgeldes“. 1847 folgte Dr. Samuel Holdheim dem Ruf der neugegründeten Jüdischen Reform-Gemeinde zu Berlin, deren Mitglieder 1845 ihren Ruf nach positiver Religion formuliert hatten. In Berlin versuchte Holdheim den Schabbat als Ruhetag auf den Sonntag zu legen. Während er im deutschsprachigen Raum außerhalb seiner Berliner Gemeinde nur begrenztem Einfluss hatte, im moderateren liberalen deutschen Judentum umstritten war und bald zum Zerrbild geriet und als Häretiker abgestempelt wurde (laut Heinrich Graetz hatte „das Judentum seit Paulus von Tarsus nicht einen solchen inneren Feind erlebt“), hat das klassische Reformjuden– tum in Nordamerika viele seiner Vorschläge zur Kultusreform in die Tat umgesetzt - dort gilt er bis heute als „our Holdheim“. Er wurde im August 1860 in der Ehrenreihe des Jüdischen Friedhofes in der Schönhauser Allee in Berlin bestattet; die Trauerrede hielt Rabbiner Dr. Abraham Geiger. Im April 2001 hat eine internationale Fachtagung sich auf Einladung des Duisburger Salomon Ludwig Steinheim-Instituts jenseits von Apolgetik und Polemik mit dem Leben, dem Werk und Wirken von Samuel Holdheim befasst und bewiesen, dass sein tief wirkender Geist auch heute noch Stoff zur fruchtbaren Auseinandersetzung bietet, vielleicht auch zur Neuaufnahme dessen, was er einst so radikal verfocht. Es gilt, Holdheim auch als Katechet, Prediger und Ethiker in seiner Auseinandersetzung mit dem Zeremonialgesetz und der Gottesdienstreform neu zu lesen. Seine Gedanken zu Der Religiöse Fortschritt im Deutschen Judenthume (Leipzig, 1840), Vorträge über die Mosaische Religion für Denkende Israeliten (Schwerin, 1844) oder Vorschläge zu einer Zeitgemässen Reform der Jüdischen Ehegesetze (Schwerin, 1845), bieten nach wie vor Diskussionsstoff und belegen, dass Holdheim kein Häretiker war, sondern ein verständiger Erneuerer des Judentums. Noch rechtzeitig zum Ende des Holdheim-Jahres 2006 soll im November beim Verlagshaus Brill in Leiden und Boston der Tagungsband Redefining Judaism in an Age of Emancipation. Comparative Perspectives on Samuel Holdheim (1806-1860) erscheinen, herausgegeben von Christian Wiese. Hartmut Bomhoff „Misstraut den Grünanlagen!“, mahnte der Journalist Heinz Knobloch immer wieder mit Blick auf die Leerstellen im Berliner Stadtbild, an denen einst Synagogen standen und jüdisches Leben pulsierte. In der Johannisstraße in BerlinMitte fehlt es sogar an diesem Grün, und auf dem weiten Parkplatz erinnerte bislang nichts daran, dass sich hier von 1854 an die Synagoge der Jüdischen Reformgemeinde zu Berlin befand: ein klassizistischer Bau mit über tausend Plätzen, der noch vor der nahen Neuen Synagoge als zweites jüdisches Gotteshaus in Berlin errichtet worden war. Auch das 150jährige Jubiläum verstrich letztes Jahr unbemerkt von Öffentlichkeit und Feuilletons, und es ist der Initiative des Reiseunternehmens milk & honey tours um Gabriele Noa Lerner zu verdanken, dass seit dem 22. Januar ein Denkzeichen samt Foto, Bauzeichnungen und zweisprachigen Informationen auf die im zweiten Weltkrieg zerstörte Synagoge aufmerksam macht. Dass der für das Gedenktafelprogramm zuständige Bezirksverordnete Volker Hobrack trotz eisiger Kälte gut achtzig Gäste begrüßen konnte, zeigt, wie lebendig die Erinnerung an den sogenannten Tempel ist, dessen reiche Musiktradition Professor Andor Izsák (Europäisches Zentrum für Jüdische Musik in Hannover) auf anschauliche Weise am Flügel vergegenwärtigte. Die eigentliche Gedenktafel übergab dann der Bezirksbürgermeister Joachim Zeller zusammen mit dem 85jährigen Peter Galliner der Öffentlichkeit. Sein Vater Dr. Moritz Galliner war einer der Repräsentanten der Re– formgemeinde gewesen und hatte sich 1942 zusammen mit seiner Ehefrau angesichts der bevorstehenden Deportation das Leben genommen. Zeitgemäßes Judentum Rabbiner Dr. Walter Homolka, Vorstandsmitglied der World Union for Progressive Judaism, erinnerte an die Anfänge der Reformgemeinde, an den von dreißig Mitgliedern der Jüdischen Gemeinde unterzeichneten Aufruf vom April Kescher 5 Religion!” JÜDISCHE REFORM-GEMEINDE ZU BERLIN Foto © privat 1845: „Die erstarrte Lehre des alten Judentums und unser Leben sind für immer auseinander gewichen. Mit den veralteten Formen droht auch der ewige, heilige Kern des wahren Judentums verloren zu gehen. Wir aber wollen Glauben im Einklang mit der Empfindung unseres Herzens, wollen positive Religion, wir wollen Judentum im Geist der Heiligen Schrift als Zeugnis göttlicher Offenbarung.“ Die Historikerin Dr. Simone Ladwig-Winters hat in ihrer Monographie Freiheit und Bindung, die Foto © Milk & Honey Tours 2004 beim Berliner Verlag Hentrich & Hentrich erschien, die Geschichte der Reformgemeinde nachgezeichnet. Unter den über zweitausend Gemeindemitgliedern fanden sich viele Angehörige der besseren Berliner Gesellschaft, darunter die Verlegerfamilie Mosse; zu ihren Rabbinern beziehungsweise Predigern zählten so bedeutende Persönlichkeiten wie Sigismund Stern und Samuel Holdheim, Julius Oppenheimer oder Wilhelm Klemperer. Studiendirektorin Jael Botsch-Fitterling sprach in ihrem Grußwort als Repräsentantin der Jüdischen Gemeinde zu Berlin auch davon, dass die Reformgemeinde stets Schrittmacherin bei der Emanzipation der Frau innerhalb der jüdischen Gemeinde war. Frau Stadtrat Bianca Hamburger war spätestens ab 1928 gewähltes Vorstandsmitglied der Gemeinde, und am 19. August 1928 stand in der Johannisstraße mit Lily H.Montagu, der damaligen Londoner Präsidentin der World Union for Progressive Judaism, erstmals in Deutschland eine Frau auf der Bimah gener Verein gelöscht und in die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland eingegliedert. Andreas Nachama erinnerte auch an den beschämenden Umgang mit den verbleibenden Angehörigen der Reformgemeinde: Als die Neue Synagoge in der Oranienburger Straße 1940 von der Wehrmacht requiriert worden war, wurde der Tempel in der Johannisstraße renoviert und zu Pessach 1942 als liberale Synagoge geweiht. Der zionistisch orientierte Rabbiner Dr. Max Nussbaum setzte mit seiner Predigt den Schlussstrich unter die Geschichte der Reformgemeinde, in dem er feststellte, dass in dieser feierlichen Stunde die „Umwandlung eines Gotteshauses in eine Synagoge“ vollzogen werde. „Wer den Faden der Tradition zerreißt, stellt sich außerhalb des Stroms jüdischen Lebens“, hielt er den Reformern, die auf eine bald hundertjährige Tradition zurücksahen, in ihrem eigenen Haus vor. Nachama endete mit der deutschsprachigen Übertragung des „El Male Rachamim“, das sein Sohn Alexander dann in der herkömmlichen Weise vortrug. Selbstbehauptung Homolka gab ebenso wir Rabbiner Dr. Andreas Nachama zu bedenken, dass das Programm der Reformgemeinde und ihre liturgischen Neue– rungen nicht immer auf die Gegenliebe jüdischer Zeitgenossen stiess. Die Gemeinde erstrebte „die Entwicklung des Judentums und die Ausgestal– tung seiner Einrichtungen im Geiste der heutigen Kultur und im Einklang mit den Ergebnissen wissenschaftlicher Erkenntnis“ und zeigte damit, so Nachama, vielen eine Alternative zum Abfall vom Judentum auf. Von 1933 an bemühte sich die Reformgemeinde ganz bewusst um Solidarität mit allen Verfolgten jüdischer Herkunft, leistete noch mehr Sozialarbeit als zuvor und bot mit Schulgründungen all den Lehrern und Kindern Obhut, die aus den staatlichen Schulen entlassen wurde. Ende November 1939 wurde die Gemeinde als eingetra- Dass diese Gedenkfeier im Media Center stattfinden konnte, ist Investorenvertreter Karl Heinz Marschmeier von der Johannishof Projektentwicklung GmbH zu verdanken. Das Tochterunternehmen der FUNDUS-Gruppe erschließt das Areal; wie es allerdings Eigentum von FUNDUSChef Anno August Jagdfeld geworden ist, bleibt offen. Simone Ladwig-Winters geht davon aus, dass sich nach Krieg und Schoa kein formaler Rechtsnachfolger mit Ansprüchen auf das Grundstück fand; die Grundbücher waren aber auch für sie nicht einsehbar, und so nimmt die neue Bebauung ihren Lauf. Der zweihundertste Geburtstag des Reformers Samuel Holdheim (1806 - 1860) aber dürfte dieses Jahr noch manchen Anlass zur Auseinandersetzung mit der Geschichte der Jüdischen Reformgemeinde zu Berlin geben. Hartmut Bomhoff 6 Kescher 4. Jahrgang | Ausgabe 1 links: S.E. William R. Timken Jr., Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika Fotos unten: Rabbiner Dr. Homolka mit Dr. Gideon Joffe und Peter Sauerbaum (Jüdische Gemeinde zu Berlin) Botschafter Timken mit Nicholas Werner und Natalia Huneke Rabbiner Dr. Chaim Z. Rozwaski im Gespräch Der östereichische Botschafter, Dr. Christian Prosl, mit Sue Timken und Francis Karsh Fotos © Margrit Schmidt “Diversity and Pluralism” Mr. Ambassador, Dear Mrs Timken, Dear Miss Karsh, I extend a most cordial welcome to you to this reception which we give in your honour. We are very glad that you and your family took the time to meet representatives from various walks of life related to the religious diversity of our country. The World Union for Progressive Judaism is proud to host this reception in your honour. We represent some 2 Million Jews around the globe. 1.5 Million of those are U.S. citizens and members of the Union of Reform Judaism in America. After the Nazi years in Germany we owe it largely to the United States of America that Germany is a democratic member of the world family. Judaism in general and Progressive Judaism in particular are grateful for the religious freedom which enabled Jews in America to develop and flourish under the wings of the U.S. constitution. You, Mrs. Timken have - I believe - grown up in Cincinnati. This city is closely connected to the Hebrew Union College, our renowned rabbinical school which has given refuge to many European Jewish scholars during World War II. Leo Baeck, the great German Jewish leader, has lived and taught in Cincinnati. He learnt to appreciate the particular relationship between a neutral government and the various religious faiths of U.S. citizens. Division of State and religions have been the ultimate creed of Leo Baeck who saw Judaism as the victim of a Germany that had long thought of itself as a „Christian State”. Today, you will still find traces of this history in our society. However, we are well on the way to accept diversity and pluralism as a great asset rather than a strenuous demand. I may thank the U.S. embassy for having always given its support to our claim that all strands of Judaism have to be treated equally here in this country. It is your success that we are well into the process of achieving this. So many different representatives are here this afternoon to personally welcome you in our country and get to know your wife and daughter: members of parliament, representatives of Judaism, the Evangelical Church of Germany and Islam, officials of the federal administration, the media and last but not least the American Jewish Committee as an organization which should make you feel at home. I will introduce you to all of them a little later. For now please feel welcome. You are among friends. Ansprache von Rabbiner Dr. Walter Homolka (Executive Board Member, World Union for Progressive Judaism) anlässlich des Empfangs der WUPJ zu Ehren des amerikanischen Botschafters William R. Timken Jr. im Hotel Kempinski Bristol in Berlin. Kescher 7 Aufbruch ins 21. Jahrhundert EUROPA-TAGUNG DER LIBERALEN JUDEN IN HANNOVER von Hartmut Bomhoff „Das liberale Judentum ist wieder in Deutschland angekommen“, sagt Dr. Jan Mühlstein (München), der Vorsitzender der Union progressiver Juden in Deutschland, am Rande der Europa-Tagung der vor achtzig Jahren gegründeten World Union for Progressive Judaism (WUPJ) Mitte März in Hannover. Als diese weltweit größte religiöse Organisation im Judentum, die heute bald zwei Millionen Mitglieder in über vierzig Ländern vertritt, 1997 erstmals nach fast siebzig Jahren wieder zu einer Konferenz in Deutschland lud, fand dieses Treffen in München im Schatten der Geschichte statt: Hitler, Dachau und Leni Riefenstahl kamen den ausländischen Teilnehmern in den Sinn, und für die damalige Vorsitzende der European Region der WUPJ, Ruth Cohen, war das gemeinsame Kaddisch einer der berührendsten Momente der Tagung. Das wieder auflebende liberale Judentum in Deutschland war seinerzeit noch ein zartes Pflänzchen und vielen Anfeindungen ausgesetzt, und wenngleich die Tagung damals auch einen Akzent gegen das viel beschworenen „Ende der Diaspora“ setzen wollte, so schien jüdisches Leben schien viel Historie und wenig Zukunft zu haben. Inzwischen hat sich die jüdische Gemeinschaft hierzulande konsolidiert: es geht längst nicht mehr um die Frage, wie Juden denn trotz Diskriminierung und Schoa wieder in Deutschland leben können, nein, es geht darum, was zu tun ist, damit die jüdische Gemeinschaft hier ihr Judentum leben Mendelssohn Zentrum in Potsdam zu danken, dass er mit seinem Eröffnungsvortrag über „Das (nicht) angenommene Erbe“ auch Licht in dieses Dunkel gebracht hat. Sein eigentliches Thema war die Debatte zur deutsch-jüdischen Erinnerungskultur; sein Vortrag wurde aber zum Psychogramm der jüdischen Gemeinschaft hierzulande. „Ob Reste des deutsch-jüdischen Erbes in Deutschland fortexistieren können“, fragt Schoeps, „hängt sicher auch davon ab, ob die Deutschen in ihrer Mehrzahl bereits sind, sich dieses Erbes anzuneh- men.“ In den USA ist das in Deutschland entstandenen liberale Judentum mit Namen wie Abraham Geiger und Leopold Zunz sowie der Synagogalmusik von Louis Lewandowski und einer bestimmten Synagogalarchitektur als angenommenes Erbe Bestandteil der deutsch-amerikanischen Kultur der Gegenwart geworden; in Deutschland ist der Einfluss der „Union progressiver Juden“, die in der Tradition von Abraham Geiger und Leo Baeck steht, zur Zeit noch gering, schließt Schoeps, „was sich aber in der Zukunft sehr schnell ändern könnte.“ Baecks gern zitiertes Verdikt aus der Nachkriegszeit, „Für uns Juden aus Deutschland ist eine Geschichtsepoche zu Ende gegegangen“, auf das auch Schoeps zu sprechen kam, muss also revidiert kann. Die Union progressiver Juden hat bereits zwanzig Mitgliedsgemeinden und ist seit kurzem mit zwei liberalen Landesverbänden im Zentralrat der Juden in Deutschland vertreten. Die Integration russischsprachiger jüdischer Zuwanderer ist eines ihrer größten Anliegen, und ihre Aufbruchstimmung und ihr Selbstbewusstsein kamen auch im Motto der hannoverschen Europa-Tagung zum Ausdruck: „Building Progressive Jewish Communities in the 21st Century“. Dass einhundertsiebzig Delegierte aus ganz Europa, aus Kanada und den USA, Südafrika und Israel - unter ihnen der neue Vorsitzende der World Union, Steven M. Bauman aus Kalifornien, und ihr Präsident Rabbiner Uri Regev aus Jerusalem - nach Hannover gekommen waren, spricht für Neugier und Wertschätzung, aber auch für Gemeinschaftssinn. In Workshops, Vorträgen und Schiurim wurde diskutiert; wie jüdische Tradition mit moderner Weltanschauung in Einklang zu bringen ist Besonderes Augenmerk galt dabei zeitgemäßem Marketing, Fundraising und internationaler Vernetzung, Jugendarbeit und religiöser Erziehung. „Eine anregende Mischung aus Familientreffen, Kontaktbörse und Gremienarbeit“, befand die Vorsitzende der hannoverschen Liberalen Jüdischen Gemeinde, Ingrid Wettberg, als Gastgeberin der Tagung und bedauerte lediglich, dass viele Themen mangels Zeit nur angerissen werden konnten und dass die Teilnehmergebühren für junge Erwachsene und finanziell schlechter gestellte Zuwanderer einfach zu hoch waren. Aber auch trotz dieser Hürden war die Resonanz so groß wie nie. Eine ganz eigene Atmosphäre erlebten die Delegierten beim Kabbalat Schabbat in den Räumen der vor gut zehn Jahren gegründeten hannoverschen Gemeinde, die inzwischen über fünfhundertdreißig Mitglieder aus vierzehn Ländern zählt - eine Vielfalt, die sich im Gottes– dienst in einer Melange aus ganz unterschiedlichen Traditionen und Melodien widerspiegelt. „Zeh Hayom Asah Adonay, Nagilah Venismechah Voh“, rief der charismatische Landesrabbiner von Mecklenburg-Vorpommern, der inzwischen 79jährige Rabbiner William Wolff, in seiner mitreißenden Predigt aus, „Dies ist der Tag, den Gott uns zum Feiern geschaffen hat!“. Wolff spannte einen Bogen von der Geschichte zur Zukunft und formulierte die Rahmenbedingungen für ein lebendiges liberales Judentum in Deutschland, für ein Judentum jenseits der Friedhöfe; er verwies insbesondere auf die anstehende Rabbiner– ordination des Abraham Geiger Kollegs im Herbst als „ein Ereignis, das Geschichte für viele kommende Generationen schreibt“. Dass der Schabbatmorgengottesdienst den Gemeinde– mitgliedern stets präsent bleiben wird, ist dem fast neunzigjährigen Rabbiner Hermann E. Schaalman aus Chicago zu verdanken. Der gebürtige Münchner war nach Hannover gekommen, um der Gemeinde eine kostbare Torarolle zu übergeben, die über zweihundert Jahre alt sein dürfte und ursprünglich wohl aus Bayern oder Böhmen stammt. Foto © Johannes A. Seidler 8 Kescher 4. Jahrgang | Ausgabe 1 ANGELA MERKEL TRAF DIE SPITZE DER WUPJ IM BUNDESKANZLERAMT Der Vorsitzende der World Union for Progressive Judaism, Steven M. Bauman (Kalifornien) traf am 4. April 2006 in Berlin mit Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zusammengetroffen. Mr. Bauman wurde begleitet von den Rabbinern Uri Regev (President) und Dr. Walter Homolka (Member of the Executive Board). Der Generalsekretär des Zentralrats der Juden, Stephan J. Kramer, und Katarina Seidler vom Vorstand der Union progressiver Juden in Deutschland nahmen ebenfalls an der Begegnung teil. Das Gespräch fand in guter Atmosphäre statt. Im Mittelpunkt des Austausches standen das liberale Judentum weltweit und seine Situation in Deutschland. Die Bundeskanzlerin unterstrich das Anliegen der Bundesregierung, dass wieder jüdisches Leben mit seinen vielfältigen Traditionen und Strömungen in Deutschland wächst. Die Bundeskanzlerin drückte ihre Freude darüber aus, dass am 14.9.2006 in der Neuen Synagoge Dresden durch das Abraham Geiger Kolleg die ersten drei Rabbiner seit 1942 in Deutschland ordiniert würden. Dies sei ein bedeutsames Zeichen des Vertrauens in die deutsche Gesellschaft. Die Gesprächspartner waren sich darin einig, dass die 2005 begonnene Integration des liberalen Judentums in den Zentralrat der Juden wesentliche Erfolge erzielt hat. Steven Bauman und Stephan Kramer bedankten sich bei der Bundeskanzlerin für ihre klare Haltung in der Iran- TREFFEN IM LEO-BAECK-HAUS Zu einem ersten intensiven Gedankenaustausch kamen am 19. März Spitzenvertreter des Zentralrats der Juden in Deutschland und der World Union for Progressive Judaism in Berlin zusammen. Am Gespräch nahmen Rabbiner Uri Regev als geschäftsführende Direktor der Union, die damalige Zentralrats-Vizepräsidentin Charlotte Knobloch, der neue Vorsitzende der Union, Steven M. Bauman, und Zentralrats-Vizepräsident Dr. Salomon Korn (v.l.) teil. „Ich kam mit der Hoffnung nach Deutschland, auf Verständnis für die Probleme und Sorgen der liberalen Juden zu stoßen. Diese Hoffnung hat sich mehr als erfüllt. Ich verlasse Deutschland mit neuen Freunden", fasste Bauman die Begegnung zusammen. Die Vielfalt in der Einheit sei für das jüdische Leben in Deutschland heute wichtiger denn je, waren sich die Teilnehmer am Ende einig. Foto © privat Kontroverse und bestärkten sie in ihrer partnerschaftlichen Unterstützung für den Staat Israel. Vorangegangen waren Ende März bereits Gespräche der WUPJ mit Mitgliedern des Bundeskabinetts, darunter Bundesinnenminister Dr. Wolfgang Schäuble, und Bundesaußenminister Dr. FrankWalter Steinmeier, sowie Mitgliedern des Deutschen Bundestags und dem Bundesvorsitzenden der SPD, Matthias Platzeck. Thema war hier die finanzielle Absicherung des Abraham Geiger Kollegs als einzige Rabbinerausbildungsstätte im deutschsprachigen Raum. Die World Union und der Zentralrat der Juden vertreten ein Modell der Mischfinanzierung zwischen Bund, Ländern, Zentralrat und der Leo Baeck Foto © Bundespresseamt Foundation. Kescher 9 Foto © Margrit Schmidt „Berufen, Segen für die Welt zu sein“ ABRAHAM GEIGER PREIS 2006 AN KARL KARDINAL LEHMANN Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Karl Kardinal Lehmann, erhielt am 20. März den Abraham Geiger Preis 2006. Offenheit, Mut, Toleranz und Gedankenfreiheit als Ertrag der Aufklärung sollen damit als Grundlage für den Umgang von Juden miteinander ebenso gewürdigt werden wie in den Beziehungen mit dem nicht-jüdischen Umfeld. Der Abraham Geiger Preis wurde im Jahre 1999 anlässlich der Gründung des Abraham Geiger Kollegs und ist mit 5.000 Euro dotiert - dieses Jahr wurde der Betrag von Frau Lotte Schwarz Kardinal Lehmann spontan verdoppelt. Mit Karl Kardinal Lehmann setzt sich die Reihe großer Preisträger fort. Im Jahr 2000 erhielt Susannah Heschel den Abraham Geiger Preis für ihr Buch „Der jüdische Jesus und das Christentum“. Im Jahre 2002 wurde der jüdische Religionsphilosoph Emil Fackenheim der Preis für sein philosophisches Lebenswerk verliehen. 2004 wurde Alfred Grosser als Verteidiger des Erbes der Aufklärung geehrt. Kardinal Lehmann stiftete sein Preisgeld der neu gegründeten Leo Baeck Foundation. In der Begründung der Jury hieß es zur Auszeichnung: „Wir wollen damit im Geiste von Nostra Aetate und eingedenk des 40. Jahrestages einen vorbildlichen katholischen Kirchenführer auszeichnen und damit die Erfolge des katholisch-jüdischen Gespräches hervorheben. Vor allem gilt es, Kardinal Lehmanns langjähriges Eintreten für Toleranz und Freiheit des Denkens zu würdigen, ebenso wie seine Entschlossenheit für das Gespräch mit dem Judentum: im intellektuellen Austausch als Hochschullehrer, aber auch durch ein religiöses Miteinander über Jahrzehnte hinweg. Mit Kardinal Lehmann wünschen wir uns, „dass wir uns gelassener kritische Dinge sagen lassen können, die bisher nicht in dieser Form möglich waren. Wir wünschen uns gegenüber wachsender Säkularisierung eine gemeinsame intensive Auseinandersetzung zur Gottesfrage.“ Die Preisverleihung fand in der Bayerischen Vertretung statt. Gastgeberin war Staatsministerin Emilia Müller. Wir bringen an dieser Stelle Auszüge aus der Laudatio von Professor Ernst Ludwig Ehrlich (Basel). Wenn das Abraham Geiger Kolleg Kardinal Karl Lehmann den diesjährigen Preis verleiht, so ist dies in der Beziehung zwischen dem Judentum und der katholischen Kirche weit mehr als ein äußeres Zeichen mit Bedeutung. Ein solches Ereignis geht für beide Religionen in die Tiefe ihrer jeweils eigenen Existenz. Kardinal Lehmann hat in zahlreichen Äußerungen eine Verbundenheit mit dem Judentum bezeugt, wie sie auch nach dem Konzil nicht überall zu finden ist, weder auf jüdischer noch auf katholischer Seite. Der Kardinal hat wiederholt mit großer Klarheit festgestellt, dass das Judentum das Fundament des Christentums darstellt, denn so heißt es bei ihm: „Die Kirche hat ihre Wurzeln im Judentum und ist mit dem Judentum bleibend innerlich verbunden, wie keine andere Religion. Wenn Christen die Treue Gottes zu seinem auserwählten Volk bestreiten, zerstören sie die Grundlage ihres eigenen Glaubens, der auf die Treue des Vaters Jesu Christi, des Gottes Israels, baut.“ Daher ist es für Kardinal Lehmann selbstverständlich, dass die Mission nicht auf Juden angewandt werden kann. Es wäre wichtig, dass Juden erkennen, dass es heute keine judenmissionarischen Aktivitäten der katholischen Kirche mehr gibt. Diese waren früher ein Hindernis im Dialog zwischen den beiden Religionen. Inzwischen wurden diese Texte einer differenzierten Betrachtung unterzogen und in den historischen Entstehungskontext eingeordnet. […] Als einer der ganz wenigen katholischen Persönlichkeiten von Rang ist es Kardinal Lehmann, der über das Versagen und die Schuld der damaligen Kirche deutliche Worte gefunden hat. Ich verhehle nicht zu sagen, dass Kardinal Lehmann nicht nur das Versagen einzelner Christen beklagt, sondern auch der Kirche als Institution. Das mag für viele schmerzlich sein zu hören, aber es ist die leidvolle Wahrheit, die Juden erfahren haben, als sie dem Untergang geweiht waren. Im Übrigen sieht er in der Vorstellung von der: ‘Absolutheit des Christentums’ eine Gefahr, weil dadurch einerseits ein Dialog verhindert wird und anderseits die Gefahr einer zeitlosen Systematisierung erhöht wird. […] Zu den Aufgaben, die uns gemeinsam gestellt sind, gehört auch die Gottesfrage nach Auschwitz. Kardinal Lehmann sagt dazu: „Gerade so kommen wir auch gemeinsam zu einem Gespräch über den Sinn von Religion heute.“ Wir leben gemeinsam in Europa. In seiner Rede über die Grundlagen Europas stellt der Kardinal fest: „Es braucht eine neue Identität Europas.“ Sie darf nicht nur im politischen Bereich oder in der Übereinstimmung wirtschaftlicher Interessen bestehen. Diese mögen gewiss wichtig sein und dem Zusammenwachsen in der politischen und ökonomischen Dimension dienen, dennoch darf die geistig-spirituelle und ethische Identität Europas nicht vernachlässigt werden. Wir haben nämlich die Quellen für eine ethische Gestaltung Europas. Sie finden sich in der biblischen Ethik unserer beiden Religionen. Diese ist stets die geistige Grundlage gewesen, auf der in den Jahrhunderten weiter gebaut wurde. Keine unserer beiden Religionen kann ohne eine, wie auch immer entwickelte, biblische Ethik leben: Abgesehen davon, ist der Humanismus Europas durch diese Ethik inspiriert worden. Es ist ein hoffnungsvolles Zeichen - gerade für die Juden, für die die Ethik in ihrem religiösen Mittelpunkt steht -, dass die katholische Kirche heute eine moderne Soziallehre anbietet, die, wie es scheint, auch ein Mittel gegen die Säkularisierung ist. Jüdische Ethik und katholische Soziallehre können dem kommenden Europa eine Hilfe sein, weil sie konkret die Menschen ansprechen und auf diese Weise etwas für ein neues, würdiges Europa beitragen. Lassen Sie mich mit einem Text schließen, den das Zentralkomitee der deutschen Katholiken im Jahr 2005 veröffentlicht hat: „Dabei müssen wir zum einen das Gedenken an die Schoa wach halten und es in der vierten Generation nach dem zweiten Weltkrieg einwurzeln. Wir haben an die Ursachen, auch an den innerkirchlichen Antijudaismus, zu erinnern, die zur Schoa führten. Zum anderen wird sich unsere Arbeit stärker darauf richten, die Bewegung von Christen und Juden aufeinander zu in Zukunft stärker auf die gemeinsame Verantwortung für unsere gefährdete Gesellschaft und Welt zu konzentrieren. Dafür nimmt uns auch die nachdrückliche Einladung von Papst Johannes Paul II. in Pflicht, die er vor 25 Jahren in Mainz ausgesprochen hat: ‚Juden und Christen sind als Söhne (und Töchter) Abrahams berufen, Segen für die Welt zu sein'. Wir hoffen, auch die Muslime, die sich ebenfalls auf die Abrahamskindschaft berufen, für diese Verpflichtung zu gewinnen. Möge der Herr der Geschichte unser Vorhaben segnen!“ 10 Kescher 4. Jahrgang | Ausgabe 1 „Wie Sterne in der Nacht” ABRAHAM GEIGER UND LEO BAECK ALS WEGBEREITER DES JÜDISCH-KATHOLISCHEN DIALOGS von Karl Kardinal Lehmann „Noch nie hat mich eine Anerkennung und Auszeichnung so überrascht, wie die Verleihung des Abraham-Geiger-Preises. Um so größer ist mein Dank an alle, die diese Entscheidung getroffen haben. Ich denke in erster Linie an das AbrahamGeiger-Kolleg an der Universität Potsdam und ihren Rektor, Rabbiner Dr. Walter Homolka. Was diese Verleihung für mich bedeutet, will ich gerne in dem hier vorgesehenen Rahmen zur Sprache bringen. I. An erster Stelle steht der Name des Mannes, nach dem der Preis benannt ist. Abraham Geiger, geboren am 24. Mai 1810 in Frankfurt a.M. und gestorben am 23. Oktober 1874 in Berlin, ist vor allem für seine Bemühungen bekannt, dem im 19. Jahrhundert entstehenden Reformjudentum Gestalt zu verleihen. Aufgewachsen in einer orthodoxen Familie erhielt er eine traditionelle talmudische Ausbildung. Während seiner Ausbildungszeit, vor allem an der Universität Bonn, verstärkte sich bei ihm eine Tendenz zur stärkeren Auseinandersetzung des Judentums mit der Moderne. Dies bedeutete für ihn keine Zurückweisung des vorausgegangenen Judentums, sondern eine Wiederentdeckung ursprünglicher Tendenzen. Diese sah er im Monotheismus und in seiner Ethik. Während der Grieche den Geist der Philosophie in die westliche Zivilisation eingebracht habe, hätten die Juden dem Abendland den „religiösen Geist“ geschenkt, der dem Ethos eine feste Grundlage gegeben habe. Zugleich war er der Überzeugung, dieser lebendige Glaube habe im Lauf der Jahrhunderte durch die Strenge der talmudischen Konzentration auf das Gesetz an Kraft eingebüßt. Das Getto, das durch die Intoleranz der Christen den Juden auferlegt wurde, habe diese Grundhaltung fixiert. Es ist bekannt, wie Abraham Geiger entsprechende Grundhaltungen bereits in der Auseinandersetzung zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern erblickt hatte. Geiger war überzeugt, dass die Pharisäer die Bibel im Geist ihrer Zeit ausge- legt, die Sadduzäer aber sich im Buchstaben der Bibel verfangen hätten. Abraham Geiger hat mit Entschiedenheit in der Liturgie die deutsche Sprache bevorzugt. Bei aller schroffen Art, z.B. in der Kritik der Speisegesetze, hat er jedoch immer auch wieder eine maßvolle Haltung zur eigenen Tradition eingenommen. „Innerhalb der Reformbewegung war Geigers Position gemäßigt, vermittelnd zwischen den radikaleren Bestrebungen Samuel Holdheims und Kaufmann Kohlers einerseits und den von Zacharias Frankl und Heinrich Graetz vertretenen konservativen, protonationalistischen Gruppierungen andererseits.“ 1 Schließlich aber war Abraham Geiger ein überaus fähiger Historiker, der neue Impulse in die Erforschung des rabbinischen Judentums, aber auch für die Anfänge des Christentums brachte. Seine Bedeutung geht jedoch noch darüber hinaus. Erst kürzlich sind die Arbeiten, die den Einfluss der rabbinischen Literatur auf den Text des Korans nachweisen, neu veröffentlicht worden.2 Nach seiner Überzeugung war der Islam nicht das Produkt christlich-häretischer Gruppen, sondern ein Produkt des Judentums. Das Judentum und nicht das Christentum stellt das Fundament der westlichen Zivilisation dar. Jesus war für Abraham Geiger ein liberaler Pharisäer. Nach seiner Überzeugung hat Jesus keinen neuen Gedanken ausgesprochen. Er hob nichts aus dem Judentum auf. Das Christentum begann erst, als Paulus den vorbildlichen Monotheismus in Jesu Wort und Werk durch die Übernahme des hellenistischen Denkens verdunkelte. Wie immer man heute diese Aussagen beurteilt, jedenfalls hat Abraham Geiger der Jesusforschung, gerade auch im Zusammenhang des zeitgenössischen Judentums, große Impulse gegeben, an denen nicht nur die Forschung heute, sondern auch der jüdisch-christliche Dialog3 zu arbeiten hat. Abraham Geiger ist eine ausgesprochene Gründerfigur, die viele Anstöße gegeben hat. Dies gilt besonders auch für die Wirkung seines Gebetbuches, das weltweit zur Grundlage für die Liturgie der Reformgemeinden wurde. Er war fest davon überzeugt, dass das Judentum sich voll der Auseinandersetzung besonders mit der Moderne stellen muss, um überleben zu können. Ganz gewiss hat ihn dieser Mut zur Bewahrung durch schöpferische Auseinandersetzung zu einem großen Gestalter des Reformjudentums gemacht. So war es konsequent, dass er nach langen Schwierigkeiten,Verdächtigungen und Hindernissen 1871 einen Ruf an die Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in Berlin erhielt. Heute gibt er dem Nachfolge-Kolleg mit Recht seinen Namen. Abschließend möchte ich Rabbiner Leo Trepp zitieren: „Es muss betont werden, dass Geiger voll und ganz hinter seinen Reformen steht, die er für die Juden als (über) lebensnotwendig ansieht … Geiger ist ein begeisterter Jude, seine Reformen sollen dem Ziel dienen, die Kraft des Judentums zu erneuern und Juden von Übertritten zurückzuhalten.“4 II. Das Abraham Geiger-Kolleg und der Abraham Geiger-Preis sind vielfältig mit dem Namen eines der größten Rabbiner und Gelehrten verbunden, nämlich Leo Baeck, geboren am 23. Mai 1873 in Lissa (Provinz Posen) und gestorben am 2. November 1956 in London. Albert Friedlander hat ihn als „Paradigma des deutschen Judentums im 20. Jahrhundert“ bezeichnet. Es kommt ihm in seiner Zeit zwischen dem Wilhelminischen Kaiserreich und der Nazi-Diktatur in vieler Hinsicht eine überragende Bedeutung zu, und zwar als Rabbiner, Wissenschaftler und schließlich auch als ein Seelsorger in der politischen Verfolgung vieler Menschen. Sein Werk „Das Wesen des Judentums“ hat ihn, vor allem durch die Auseinandersetzung mit Adolf von Harnacks „Das Wesen des Christentums“, zu einem herausragenden Interpreten und Vermittler eines modernen, selbstbewussten Judentums gemacht. Die glänzende Apologie des jüdischen Glaubens Kescher Unten: Rabbiner Uri Regev (Jerusalem), Präsident der WUPJ, bei seiner bewegenden Ansprache. Karl Kardinal Lehmann mit der Bayerischen Staatsministerin und Gastgeberin Emilia Müller und der Staatsministerin im Bundeskanzleramt Hildegard Müller. Dr. Josef Joffe, Kuratoriumsvorsitzender des AGKs, mit Stifter Karl-Hermann Blickle. Der Vizepräsident des Zentralrat der Juden in Deutschland, Dr. Dieter Graumann, bei seinem Grußwort. Fotos © Margrit Schmidt hat der jüdischen Minderheit - gegen die Versuchung zur Konversion und den Druck des Antisemitismus nicht nur kulturelles Selbstbewusstsein vermittelt, sondern das Judentum auch durch den Hinweis auf seine religiöse wie ethische Überlegenheit zur „Religion der Zukunft“ erklärt. Dieser Grundtext des jüdisch-liberalen Selbstverständnisses im 20. Jahrhundert will begründen, warum das Judentum so eine große geschichtliche Macht in der Weltgeschichte geworden ist und daraus nicht mehr wegzudenken ist. Es ist keine partikularistische so genannte Gesetzesreligion, sondern ein zutiefst universalistischer Glaube. „Im Zentrum der jüdischen Religion steht weder das Dogma noch die religiöse Innerlichkeit, sondern die sittliche Tat als Antwort auf Gottes im Gebot offenbarten Willen, der auf Gerechtigkeit in der Welt zielt.“ Man hat manchmal die Konzentration des Judentums auf die Bewährung im Leben bei Leo Baeck zu sehr als eine Ausblendung des Spirituellen missdeutet. Er weiß aber sehr wohl um die notwendigen Dimensionen der Andacht und des Gebetes, die Beachtung des Schabbats und der Feiertage und um alle Formen gelebter Religiosität. Er war freilich vom Vertrauen auf die Erfüllbarkeit des Willens Gottes geprägt. Darum endet „Das Wesen des Judentums“ mit einem flammenden Aufruf zu seiner „Erhaltung“. Es geht um die Bewahrung jüdischer Identität, aber auch um das exemplarische Vorleben des sittlich-religiösen Ideals, auf dem allein diese Identität beruht. „Und so war in der Tat das Judentum gewesen, um so allein weiterhin zu sein: das Unantike in der antiken Welt, das Unmoderne in der modernen Welt. So sollte der Jude als Jude sein: der große Nonkonformist in der Geschichte, ihr großer Dissenter. Dazu war er da. Um dessentwillen musste der Kampf für die Religion ein Kampf um diese Selbsterhaltung sein. Kein Gedanke der Macht war darin, er wäre der Widerspruch dazu gewesen - nicht Macht, sondern Individualität, Persönlichkeit um des Ewigen Willens, nicht Macht, sondern Kraft. Als Kraft in der Welt lebt das jüdische Dasein und Kraft ist Größe.“5 Diese Größe hat Leo Baeck in ganz besonderer Weise bewiesen, als die dunkelste Zeit der deutschen Geschichte kam. Im Januar 1943 wurde Leo Baeck selbst nach Theresienstadt deportiert, wo er sich ganz auf seine seelsorglichen Aufgaben konzentrierte. Bis zur Befreiung 1945 half er durch zahlreiche Vorträge zur Stärkung des Überlebenswillens der Häftlinge. Es war eine einzigartige Form des Widerstands gegen die Inhumanität der Nazis. Dort schrieb er auch - immer wieder überarbeitet, darum erst 1955 veröffentlicht - das Buch „Dieses Volk. Jüdische Existenz“. Es 11 handelt sich um eine Erzählung des Weges des jüdischen Volkes durch die Geschichte, die sich des erlittenen Leides schmerzlich bewusst ist und dennoch mit einem Kapitel endet, das den Titel trägt „Die Hoffnung“. Diese Aussage ist für ihn nur möglich, weil er glaubt, dass der Bund Gottes mit seinem erwählten Volk kraftvoll fortdauerte. Sein Leitmotiv lautete: „In einem Bunde, der alle Völker in sich schließt, steht dieses Volk auf Erden“. Es ist darum konsequent, dass Leo Baeck eine kaum überschätzbare Bedeutung hat in der Geschichte des Judentums im 20. Jahrhundert. Dabei habe ich hier gar nicht von seinen zahlreichen repräsentativen Aufgaben nach dem Krieg gesprochen, als er bis zu seinem Tod in London lebte. Sein großer Biograf Albert H. Friedlander schreibt: „Leo Baeck war für mich von Anfang an die zentrale Gestalt, die mein Verständnis vom Judentum entscheidend beeinflusste … Zeuge geworden, wie die deutschen Juden in die tiefste Hölle hinabstiegen. Mehr als nur Lehrer und Akademiker …“7 Er war und blieb ein Stern in der Nacht. So kann Leo Trepp schreiben: „Leo Baeck (1873-1956) hat sich durch seine Standhaftigkeit und seinen Mut in der Nazizeit einen unvergänglichen Platz in der jüdischen Geschichte erworben.“8 So ist es auch konsequent, dass der Zentralrat der Juden in Deutschland seit 50 Jahren den Leo Baeck-Preis vergibt, der Sitz des Zentralrates „Leo Baeck-Haus“ heißt und wir nun auch die Errichtung der Leo BaeckStiftung begehen, die wesentlich zur Stützung des Abraham Geiger-Kollegs beitragen soll.“ 1 Susanna Heschel, Der jüdische Jesus und das Christentum. Abraham Geigers Herausforderung an die christliche Theologie, Berlin 2001, S. 246 2 Vgl. Was hat Mohammed aus dem Judenthum aufgenommen? Mit einem Vorwort hrsg. von F. Niwöhner, Berlin 2005 (Original: Wiesbaden 1833); vgl. dazu die ausführliche Besprechung „Jüdische Quellen des Korans. Eine philologische Pionierarbeit aus dem 19. Jhd.“ von A. Kilcher, in: Neue Züricher Zeitung, Nr. 193 (20.8.2005), S. 47 3 Vgl. dazu seit den Anfängen: E. L. Ehrlich, Und der christlich-jüdische Dialog, hrsg. von R. Vogel, Frankfurt 1984 4 Leo Trepp, Geschichte der dtsch. Juden, Stuttg. 1996, S. 153 5 Christia Wiese, „Leo Baeck“, in: Lexikon jüdischer Philosophen, Stuttgart 2003, S. 330 6 Leo Baeck, Das Wesen des Judentums, Wiesb. o.J., S. 291 f. 7 A. H. Friedlander, Das Ende der Nacht. Jüdische und christliche Denker nach dem Holocaust, Gütersloh 1995, S. 137 f. 8 Leo Trepp, a.a.O., S. 216 Die vollständige Rede des Vorsitzenden der Deutschen Bischofkonferenz, Karl Kardinal Lehmann, ist mit Unterstützung des Zentralrats der Juden in Deutschland gedruckt worden. Die 36seitige Broschüre (deutsch/englisch) kann gegen Zusendung eines frankierten Briefumschlages DIN B5 (Euro 1,45) kostenlos beim Abraham Geiger Kolleg angefordert werden. Kescher 12 Für lebendiges Judentum Brandenburgs Innenminister Jörg Schönbohm bei der Übergabe der Stiftungsurkunde an Rabbiner Dr. Walter Homolka Die Leo Baeck Foundation konnte dank der enormen Großzügigkeit einer aus Berlin stammenden jüdischen Stifterin, die heute in Liechtenstein zu Hause ist, eingerichtet werden. Inzwischen gibt es Zustiftungen unter anderem vom Zentralrat der Juden in Deutschland. Weitere Informationen unter www.leo-baeck-foundation.org. 4. Jahrgang | Ausgabe 1 Im November 2006 jährt sich der fünfzigste Todestag von Leo Baeck (1873 - 1956), eines der bedeutendsten Vertreter des deutschen Judentums. Leo Baeck hat sich zeit seines Lebens stets um ein der Tradition verbundenes Judentum in der Moderne, die Ausbildung von Rabbinernachwuchs an der Berliner Hochschule für die Wissenschaft des Judentums und um den Dialog mit dem Christentum, dem Islam und den anderen Religionen bemüht. Die Leo Baeck Foundation wird aus Anlass seines 50. Todestages errichtet. Sie soll durch die Förderung des Abraham Geiger Kollegs als Nachfolgerin der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in Berlin das Judentum in Europa festigen und ausbauen sowie eine Perspektive des interreligiösen Dialogs schaffen. Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Beschaffung von Mitteln für das Abraham Geiger Kolleg in Potsdam zur Verwirklichung seiner steuerbegünstigten Zwecke, durch die Vergabe von Stipendien und die Förderung interreligiöser Projekte und Aktivitäten. Die Leo Baeck Foundation ist eine rechtsfähige Stiftung des Bürgerlichen Rechts nach dem Stiftungsgesetz für das Land Brandenburg (StiftGBbg) vom 20. 4. 2004 (GVBl. I S. 150) mit Sitz in Potsdam. Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. “I am impressed with the creation of the Leo Baeck Foundation dedicated to supporting rabbinical training in Germany and interfaith work. I hope your endeavours meet with success. My husband and I look forward to hearing more about the progress of the Leo Baeck Foundation”, schreibt Baecks Enkelin Marianne Dreyfus. Der Stiftungsrat wurde durch Stiftungsbeschluss vom 16.12.2005 als Organ der Stiftung errichtet. Er berät und unterstützt den Vorstand. Volker Beck MdB . Generalleutnant Johann Georg Dora, Stv. Inspekteur der Bundeswehr . Prof. Dr. Ernst Ludwig Ehrlich, Ehrenvizepräsident B'nai B'rith Dr. Dieter Graumann, Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland . Dr. Friedemann Greiner, Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing . Ioan Holender, Direktor der Wiener Staatsoper . Rabbiner Prof. Dr. Walter Jacob, Pittsburgh . Rabbiner Harry Jacobi, London . Karl Kardinal Lehmann, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz . Landesrabbiner a.D. Prof. Dr. Nathan Peter Levinson . Prof. Dr. Wolfgang Loschelder, Rektor der Universität Potsdam Prof. Dr. Christoph Markschies, Präsident der Humboldt Universität Berlin . Dr. Jan Mühlstein, München Studiendirektor Heinrich Olmer, Mitglied des Direktoriums des Zentralrates der Juden in Deutschland Thomas Rachel, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung Prälat Dr. Stephan Reimers, Bevollmächtigter der EKD bei Bund und Europa . Fürstlicher Justizrat Dr. Peter Ritter, Vaduz . RA Katarina Seidler, Mitglied des Direktoriums des Zentralrats der Juden in Deutschland . Prof. Dr. Shimon Shetreet, Hebrew University of Jerusalem, Israelisches Kabinettsmitglied von 1992 - 1996 . Dr. Max Stadler MdB Max Warburg, M.M.Warburg & CO, Hamburg Dr. Dieter Wiefelspütz, MdB . Rabbiner William Wolff, Landesrabbiner von Mecklenburg-Vorpommern Leo Baeck Werke – Sonderausgabe Hrsg. von Albert H. Friedlander, Bertold Klappert, Werner Licharz und Michael A. Meyer Walter Homolka und Elias H. Füllenbach OP Leo Baeck – Eine Skizze seines Lebens 6 Bände mit insgesamt ca. 2.865 Seiten / kartoniert im Schuber 96 Seiten / zahlreiche sw-Fotos / gebunden mit Schutzumschlag € 198,00 (D) / € 203,60 (A) / SFr 313,00 ISBN-10: 3-579-08008-3 / ISBN-13: 978-3-579-08008-6 Preisgünstige Sonderausgabe zum 50.Todestag von Leo Baeck GÜTERSLOHER VERLAGSHAUS € 15,95 (D) / € 16,40 (A) / SFr 29,10 ISBN-10: 3-579-06429-0/ISBN-13: 978-3-579-06429-1 Kescher „Ich bin der Ewige, Dein Gott, Du sollst“ LEO BAECK ZU EHREN: STUDIENTAGE DES ABRAHAM GEIGER KOLLEGS 2006 Am 2. November 1956 starb in London Rabbiner Leo Baeck, einer der bedeutendsten Denker des deutschsprachigen Judentums im 20. Jahrhundert. Sein intellektueller Rang, seine moralische Integrität und sein hohes Ethos machen ihn bis heute zum Vorbild. Baeck wird insbesondere für sein beispielhaftes Auftreten während der nationalsozialistischen Verfolgung erst in Berlin und dann in Theresienstadt, aber auch für seine versöhnliche Haltung gegenüber Nachkriegsdeutschland verehrt. Sein theologisches Werk tritt dabei leicht in den Hintergrund. Leo Baeck (1873 - 1956) hat nicht nur das „Wesen des Judentum“ in Abgrenzung zum Christentum definiert, sondern sich als liberaler Gemeinderabbiner und als Midrasch-Dozent an der Berliner Hochschule für die Wissenschaft des Judentums immer wieder mit Fragen jüdischer Existenz befasst, mit jüdischer Erziehung ebenso wie mit halachischen Details. Das Abraham Geiger Kolleg lud bereits zu Baecks Geburtstag am 23. Mai zu einer internationalen Tagung in die Europäische Akademie in BerlinGrunewald ein. Mit Unterstützung der Leo Baeck Foundation und des Bundesministeriums des Inneren wurde vier Tage lang über Werk und Wirkung des großen Rabbiners diskutiert, der schon 1933 befunden hatte, dass die Geschichte der Juden in Deutschland im Sinne eines kulturellen Miteinanders zu Ende wäre, von 1948 an aber mehrfach die Bundesrepublik und die wieder erstehenden jüdische Gemeinschaft besuchte. Baeck betonte auch nach der Katastrophe immer wieder, dass hier jüdische Gemeinden bestehen müssten, solange Juden in Deutschland leben würden. Diese Gemeinden sollten so gut wie möglich sein und dürften sich nicht von der jüdischen Welt draußen abgeschrieben betrachten. „Die Idee bleibt, um in neuen Formen weiterzuwirken“, schreibt Baeck 1946. Bei den Berliner Studientagen zum Thema Leo Baeck: Rabbinical and Philosophical Approaches diskutierten Rabbiner und Historiker, Religionswissenschaftler und Philosophiedozenten über Baecks Werk und seine Impulse für unsere Zeit. Unter den Tagungsteilnehmer fanden sich neben Mitgliedern der Allgemeinen Rabbinerkonferenz und Studenten des AGKs auch Mitglieder der jüdischen Gemeinde zu Berlin, darunter Ernst Cramer. Den Konferenzauftakt der Tagung mache ein Vortrag des Baeck-Schülers Ernst Ludwig Ehrlich (Basel): „Leo Baeck, der Mensch und sein Werk.“ 13 „So wie Rabbi Abraham Geiger, nach dem dieses Kolleg benannt ist, bezog Leo Baeck seine religiöse Inspiration besonders von den hebräischen Propheten. Dem Juden, der sich an die prophetische Tradition hielt, so glaubte Baeck, ist es unmöglich, mit dem Bösen Kompromisse zu schließen. Das göttliche Gebot räumt ethischem Opportunismus keinen Platz ein. Baecks Gott gebietet; sein Gott, so schrieb er, gäbe keine Ratschläge. Der Jude ist immer zuerst seinem Gott verantwortlich und erst danach seinen Mitmenschen.“ Michael A. Meyer Foto © Margrit Schmidt „Wir sind fortschrittliche, liberale Juden“, sagte Baeck einmal,“ nicht um des liberalen Judentums willen, sondern um des Judentums als einem großen Ganzen willen. Liberales Judentum kann seine Stärke nur inmitten des ganzen Judentums haben, inmitten klal Jisrael. Wir wollen keine Partei sein, keine große oder kleine, sondern eine Bewegung; keine Sekte, sondern eine Kraft innerhalb des Judentums. Das liberale Judentum sollte das lebendige Gewissen des Judentums sein. Aber wir müssen auch immer wissen, dass der jüdische Standpunkt erst durch die große Geschichte geworden ist, die Geschichte der Offenbarung und des Geistes. Judentum hat seine geschichtlichen Wurzeln, es ruht auf der Tradition. […] Verständnis und Ehrfurcht sollen das Wesen des Liberalen Judentums ausmachen. Jüdisches Lernen und das Wissen um den Bund zwischen Israel und seinem Gott sind die beiden Aufgaben, die dem Judentum unserer Tage gestellt sind.“ Ernst Ludwig Ehrlich Foto © Marianne Dreyfus Rabbiner Dr. Walter Homolka begrüßt Professor Dr. Ernst Ludwig Ehrlich Foto © Margrit Schmidt 14 Kescher 4. Jahrgang | Ausgabe 1 Dr. Eric Jacobson, Senior Lecturer an der Roehampton University in London, sprach über Baeck und die Frage „Was ist das Eigene?“. An seiner Seite Professor Dr. Michael A. Meyer (Cincinnati), Dr. Carsten Wilke (Düseldorf) und Hella Schapiro (Berlin). Rabbinerin Dr. Dalia S. Marx (Jerusalem) verglich in ihrem Vortrag „Liturgy Composed on the Brink of Catastrophe“ Leo Baecks Kol Nidre-Aufruf von 1935 mit einem Gebet von Rabbi Meir Ben Yitzhak von 1095. Rechts: Dr. Esther Seidel, Dozentin für Jüdische Philosophie am AGK. Sie befasste sich mit Baecks Überlegungen zu Offenbarung und Individualität: „Ich bin, der ich bin. Du sollst!“. Rabbiner Dr. Samuel K. Joseph (Mitte) schlug in seinem Vortrag „Contemporary Challenges to Liberal Jewish Education in the Diaspora“ einen Bogen von Baecks Wirken in unsere Gegenwart. Der Professor für Jüdische Erziehung und Leadership Development am Hebrew Union College war diesen Jahr als „2006 Walter Jacob Jubilee Fellow“ Gastdozent des AGKs und zusammen mit seiner Ehefrau Dori in Berlin. Shana tova - Happy New Year American Friends of the Union of Progressive Jews in Germany, Austria, and Switzerland Supporting the Abraham Geiger College - A Rabbinic Seminary for Central and Eastern Europe Walter Jacob, President, Pittsburgh, PA - Hanna Gruen, Secretary, Pittsburgh, PA - Mahnaz Harrison, Treasurer, Pittsburgh, PA Fae Asher, San Francisco, CA - Raphael Asher, Walnut Creek, CA - A. Stanley Dreyfus, New York, NY - Alfred Gottschalk, Cincinnati, OH - Joshua Haberman, Washington, DC - Robert A. Jacobs, Havre de Grace, MD - Wolli Kaelter, Long Beach, CA - Ralph P. Kingsley, Adventura, FL - Selene Letichevsky, Pittsburgh, PA - Peter Loewenberg, Los Angeles, CA - Michael A. Meyer, Cincinbati, OH - Lore Metzger, Coconut Creek, FL - Ruth Nussbaum, Sherman Oaks, CA - Elizabeth Petuchowski, Cincinnati, OH - W. Gunther Plaut, Toronto, ON, Canada - Herman Schaalman, Chicago, IL 15 „Die Pflicht und die Kraft des Suchens“ LEO BAECK ÜBER DIE ROLLE DES RABBINERS IN SEINER GEMEINDE „Es ist eine bedeutungsvolle Stunde, in der hier ein neuer Abschnitt in der Geschichte einer Gemeinde, ein neuer Abschnitt im Leben eines Mannes beginnt. Wohl in keinem Berufe und auf keinem Platze wird durch die Verbindung des Mannes mit dem Lebensgebiete seiner Arbeit so sehr eine Schicksalsgemeinschaft geschaffen, wie durch die Verbindung, welche diese Stunde einleiten will. Das Schicksal des Rabbiners ist seine Gemeinde, und ein Geschick der Gemeinde wird ihr Rabbiner. Es ist eines Geschickesgemeinschaft, weil sie beide, Rabbiner und Gemeinde, auf dem gleichen Boden stehen, nebeneinander und nicht unter- oder übergeordnet und darum ineinandergeordnet, füreinander verantwortlich. Unsere Religion, wie sie in unseren Gemeinden verwirklicht werden soll, kennt nicht den Unter– schied zwischen Geistlichen und Laien, sie gewährt niemandem eine höhere Stellung im Gotteshaus. Stufen führen zur Kanzel hinauf, doch sie führen nicht über die Gemeinde empor. Der Rabiner steht nicht über der Gemeinde und auch nicht neben ihr, sondern er steht in ihr. Es ist das Ideal unserer Religion, daß - um mit den Propheten zu sprechen - die ganze Gemeinde aus Gottesgelehrten bestände, die Gemeinde gewissermaßen eine Gemeinde von Rabbinern. Es st so das Ideal. Aber bis diese verheißenen, diese paradiesischen Tage kommen, ist es das Erfordernis, - hier, wie ja in anderem auch - dass das, was alle sein und leisten sollen, sein besonderes Amt auch habe. Und in dieser Berufsbil– dung liegt dann ei Problem, von dem diese Stunde eindringlich zu dem Nachdenkenden spricht, das Problem, welches darin gegeben ist, dass leicht ein Zwiefaches geschehen könnte. Zunächst, dass der Rabbiner sich als der Vertreter der Religion fühlen könnte und nicht bloß als der, der er sein soll, als den immer lernenden Lehrer, als den durch das Lernen Lehrenden, dass er wie von einem hohen Platze und darum mit beruhigtem Herzen zur Gemeinde spräche und sein Herz ihm nicht mehr in Sorgen und Fragen pochte, dass er den Abstand zwischen Ideal und Wirklichkeit nicht mehr ganz empfände. Und das andere, das Problem für die Gemeinde, dass sie, wenn ein Rabbiner in ihrer Mitte ist, nun meine, dass die Sorge für die Religion erfüllt sei, weil einer da sein, welcher den Aufgaben und Lehren der Religion seine Tage widmen solle, dass das Amt des einen allen den anderen ihre Pflicht abnehme, diese Pflicht, Stunden der Andacht und Weihe zu haben, diese Pflicht, die Offenbarung der Daseinstiefen, die der Alltag überdeckt, zu vernehmen. Hiervon will diese Stunde sprechen. Sie will daran mahnen, dass Gemeinde und Rabbiner immer wieder einander finden, indem sie ihre Aufgaben als eine gemeinsame begreifen. Dass sie diese Gemeinsamkeit erkennen, um einander zu finden. Das ist die Schicksalsgemeinschaft, in der sie verbunden sind. Doppelt gilt dies - wenn dieses Wort gesagt werden darf - in einer liberalen Gemeinde. In unserem Judentum ist immer wieder die Pflicht und die Kraft des Suchen er– fahren worden. Wir haben nie fertige Menschen sein wollen, mit fertigen Antworten. Zumal in dem Jahrhundert, das hinter uns liegt, in dem unsere Gemeinschaft aus einer alten Enge in eine neue Weite geführt worden ist, ist dieses Gebot des Suchens eine Aufgabe geworden Und in der Geschichte dieses Suchens hat der Liberalismus und hat in ihm dieses Gemeinde den besonderen Platz. Wir stehen hier auf historischem Boden. Männer der Vorhur, Männer des Mutes zu neuen Wegen haben diese Gemeinde geschaffen. Neue Formen der alten Andacht Wir wissen, wie tief wir mit dem Geschichtlichen verwachsen sind. Wir wissen es, dass unsere Jahrtausende mehr bedeuten als die Jahrzehnte. Wir wissen es, dass wir diese Jahrtausende nicht hingeben dürfen für die Jahre und Tage. Aber gerade aus dieser Kraft der Verwurzeltheit in den Jahrtausenden darf das Suchen erwachsen, das Suchen insbesondere auch nach neuen Formen der alten Andacht, nach neuer Gestaltung unseres alten Gottesdienstes, ein Suchen, wie es durch diese Gemeinde geschichtliche Bedeutung gewonnen hatte. Aber es ist doch so - und in jeder Stunde, in der hiervon gesprochen wird, ist auch das auszusprechen - es ist doch so, dass das Wort „Liberalismus“ bisweilen einen ironischen Klang gewinnt. Denn auch die Gleichgültigsten, Fernsten und Fremdesten nennen sich, sofern sie überhaupt etwas sein wollen, „Freisinnige“ und „Liberale“. Aber das ist dann der Freisinn, der mit Unfruchtbarkeit geschlagen ist, weil er immer nur weiß, was er nicht glaubt, nicht tut und nicht besitzen und nicht leisten will, aber nie die stetige Kraft und die Treue verwirklicht, die allein im „Ja“, in der Verwirklichung der Ideale und der Pflichten sich offenbart und dadurch allein sich zu bewähren vermag. Es ist schwerer, weit schwerer, Rabbiner in einer liberalen Gemeinde zu sein, als einer konservativ gerichteten zuzugehören. Es ist viel schwieriger, weil das Suchen meist schwieriger ist als das ruhige Festhalten, die Frage an die Geschichte und aus dem Geschichtlichen hervor meist schwieriger als die Antwort aus der geschichtlichen Habe und aus dem Besitzesbewusstsein heraus. Schicksalsgemeinschaft in ganz besonderem Sinne ist es daher, wenn hier heute Gemeinde und Rabbiner den Bund miteiander schließen. Ein neuer Abschnitt einer Geschichte,, der Verwirklichung einer Aufgabe will beginnen. Ein „Ja“ soll gesprochen sein in dem Willen zu schaffenden Suchen, zur opferfähigen Arbeit des Weges, zu unserem lebendigen, starken Juden– tum, zu der Thora und den Geboten, ein „Ja“, in welchem Gemeinde und Rabbiner immer wieder zueinander gelangen werden. Nicht von Verspre– chungen und Verheißungen sollte darum diese Stunde erfüllt sein. Nur Gott, der Ewige, darf verheißen, - er, der Ewige, weil er ewig ist. Für uns vergängliche Menschen, für uns Wesen der kurzen Jahre bedeutet versprechen: beginnen, und beginnen heißt schaffen, und schaffen heißt sich einsetzen, sich selber hingeben. Eine Stunde solchen Beginnens und dadurch eine geschichtliche soll diese Stunde sein. Möge darum diese Stunde eine gesegnete sein! […]“ Aus: „Feier der Amtseinführumg des Herrn Rabbiners Dr. Benno Italiener im Israelitischen Tempel zu Hamburg am 8. Januar 1928“ Foto @ Bernd Neumann 16 4. Jahrgang | Ausgabe 1 A LETTER FROM AMERICA Foto © HUC An Out-Of-Touch Chief Rabbinate by Rabbi David Ellenson Since its inception, the State of Israel has invested the Orthodox Chief Rabbinate with legal authority over all matters of personal status for Jews. The right to be married or divorced as a Jew in Israel has been exclusively under the control of the Chief Rabbinate. While Reform and Conservative converts to Judaism have had certain rights extended to them as Jews under the secular Law of Return, the privilege of marriage in Israel is not one of them because the Chief Rabbinate has always refused to recognize conversion to Judaism conducted under nonOrthodox rabbinic auspices as legitimate. Controversy has now flared up over the recent decision of the Chief Rabbinate to expand this policy by refusing to extend recognition of conversions conducted even under Orthodox auspices to all but a select few Orthodox rabbinical courts in the United States. While the Orthodox Rabbinical Council of America has responded with alarm to this decision and has entered into discussion with the Chief Rabbinate for a reversal of this stance, the fervently Orthodox newspaper The Jewish Press has hailed the decision of the Chief Rabbinate as an attempt to establish a “gold standard” for conversion. Some observers might look upon this whole episode as nothing more than another chapter in the history of internecine struggles for hegemony within the Orthodox world. After all, the stance of the Chief Rabbinate towards persons converted by Orthodox rabbis is hardly unprecedented in modern Jewish history. Early in the 20th century, Eastern and Central European Orthodox authorities ranging from Rabbis Nathan Widenfeld and Chaim Ozer Gordzinski to Rabbi Dov Baer Kahana Shapiro retroactively annulled the conversions of a number of individuals converted to Judaism under Orthodox rabbinical auspices. The rationale that supported this stance is reflected in a ruling that Rabbi Moshe Feinstein issued in 1950 concerning the Jewish status of a woman converted under Orthodox auspices. Rabbi Feinstein underscored the importance of classical Jewish law attached to the demand that all converts to Judaism affirm an “acceptance of the yoke of the commandments.” This last requirement indicated that conversion to Judaism meant that a gentile who was formerly obligated to observe the Seven Noahide Commandments (basic laws of morality that Jewish tradition holds are incumbent upon all human beings) alone was now required to observe the 613 commandments imposed upon every Jew. For Rabbi Feinstein, this last stricture not only served as the sine qua non that defined the authenticity of a conversion; it constituted the sole substantive definition of conversion to Judaism. Rabbi Feinstein therefore contended that the non-observance of the mitzvot by this woman subsequent to her conversion meant that she was insincere when she orally pledged to observe the commandments. Consequently, he stated that she was not a convert at all and that she remained a gentile. The fact that an Orthodox rabbinical court had presided over the conversion was irrelevant. Rather, what was crucial was a sincere acceptance of the “yoke of the commandments” as demonstrated by adherence to an Orthodox way of life. If the proselyte did not behave accordingly, even if she were converted under Orthodox auspices, “her conversion would be as nothing.” Rabbi Feinstein was unwilling to accept any other standard for conversion. The stance Rabbi Feinstein adopted is surely a defensible one from the viewpoint of Jewish law. However, it is hardly the only one that is acceptable and it does reflect a stringent expansion of Jewish law in an area where retroactive annulment of conversions has been rare. The predominant explanation for this stringent direction in Jewish law can be found in a sociological judgment that reflects an embattled position that Rabbi Feinstein and other rabbis felt they occupied as they struggled to preserve Judaism from the forces of dissolution that they regarded as threatening their view of Jewish tradition in the modern world. Chaim Herzog, the late former Israeli Chief Ashkenazi rabbi, articulated the stance that motivated these men when he wrote, “In our day Jews are sinners. To our sorrow, many of these sinners among the people Israel are leaders of our community, even leaders of our nation. What therefore does it mean in an era such as ours for a gentile to pledge that he or she accepts the commandments of Judaism when so many born Jews do not observe. All conversions in our day fall in a category of doubt. Converts threaten to destroy the vineyard of the Lord - the household of Israel.” The recent decision of the Israeli Chief Rabbinate to reject the acceptance of conversions performed under Modern Orthodox auspices - even if eventually reversed must be seen as a further episode in this line of stringent fervently Orthodox response to the modern situation. This pronouncement reflects an ever-increasing polarity that exists between the Chief Rabbinate and fervently Orthodox Judaism on the one hand and the rest of the Jewish world on the other. These rabbis feel they must protect Judaism against the “ destructive elements” these forces threaten to unleash, and they must be vigilant against these uncommitted Jews. Due to the central role that Israel occupies in the life of world Jewry, such an increasingly restrictive policy direction on the part of the Chief Rabbinate constitutes more than an episode of Orthodox denominational infighting. Rather, this decision publicizes a state-sanctioned rabbinate that is increasingly out of touch with the broad diversity of Jewish life as it is lived by millions of Jews worldwide today. The Talmud teaches that a decree should not be issued for the community that a majority of Jews cannot abide. The Chief Rabbinate has violated this dictum and in issuing this decision has presented a portrait of a state-supported constricted Judaism to the rest of the world. This is a disservice to us all. Rabbi David Ellenson is president of Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion. Anzeige Dresdner Kescher 18 Durch Wissen zum Glauben ABRAHAM GEIGER: BEGRÜNDER DER RABBINERAUSBILDUNG IN DEUTSCHLAND von Hartmut Bomhoff Die Approbation („Smicha“) eines Lehrers und Richters mit der Verleihung des Titels „Rabbi“ erfolgte in der jüdischen Tradition ursprünglich durch Handauflegen: dadurch sollte der Schüler zum Teil einer von der Offenbarung am Sinai ununterbrochenen Traditionskette werden. Eine Rabbinerordinierung im heutigen Sinne gibt es erst seit der Institutionalisierung der Rabbinerausbildung Mitte des 19. Jahrhunderts, die im wesentlichen auf den Appell Abraham Geigers (1810-1874) zurückgeht, eine jüdisch-theologische Fakultät als „dringendes Bedürfnis unserer Zeit“ einzurichten (1836). „Es hat sich Alles mehr nach den einzelnen Individualitäten, nach den Umständen gebildet“ beschrieb Geiger die damalige Situation. Tatsächlich lebte das vormoderne jüdische Bildungskonzept, wonach das Rabbinat keine Berufskarriere sein sollte, bis zu Geigers Zeit fort. Seine Forderung nach einer verbindlich organisierten Verbindung von rabbinischen und akademischen Studien anstelle individueller und oft autodidaktischer Bildungswege bedeutete ein Umdenken. Das talmudische Studium stand traditionsgemäß entweder ganz im Dienste der religiösen Praxis (lo ha-talmud ha-iqar, ella ha-ma'asseh, „nicht die Theorie, sondern die Praxis ist das Wesentliche“) oder war Selbstzweck (torah lishemah), und wer einmal zum Rabbiner ordiniert war, durfte im Sinne einer Traditionskette selbst Rabbiner ausbilden und diplomieren. Geiger selbst hatte sein Doktordiplom an der Universität Marburg erworben und sein Rabbinerzeugnis vom dortigen Rabbiner Moses Salomon Gosen erhalten. Zu einer Zeit, nachdem die zyklisch reproduzierbaren Curricula der Talmudschüler an der herkömmlichen Jeschiwot nicht mehr genügten und bevor die Seminare in Breslau und Berlin neue anboten, lernten die jungen Rabbiner voneinander die verschiedenen Lösungen ihres Bildungsproblems. Es fehlte an einer Koordination der Bildungsgänge und Denkweisen von Jeschiwa und Universität: "Wenn doch einst ein jüdisches Seminar an einer Universität errichtet würde, wo Exegese, Homiletik und für jetzt noch Talmud und jüdische Geschichte in echt religiösem Geiste vorgetragen würde; es wäre die fruchtbarste und belehrendste Anstalt!“, forderte Geiger deswegen noch als Student. 1835 legte er dann den ersten Band seiner „Wissenschaftlichen Zeitschrift für jüdische Theologie“ vor, die er mit dem Aufsatz „Das Judentum unserer Zeit und die Bestrebungen in ihm“ eröffnet. Aufgabe sei es, „das Überkommene mit den Anforderungen der Gegenwart“ zu vereinen. Bereits in diesem ersten Band gelangt er zur Auffassung von der Entwick- 4. Jahrgang | Ausgabe 1 lungsfähigkeit des Judentums. Im zweiten Band veröffentlicht er seinen Aufsatz „Die Gründung einer jüdisch-theologischen Facultät, ein dringendes Bedürfnis unserer Zeit“. Geiger konstatiert, dass die herkömmliche Ausbildung in Form kritiklosen Talmudstudiums für die neue Zeit unzureichend sei, es den Gemeinderabbinern aber an Muße wie an zeitgenössischen Schriften fehle, um sich Wissen „im Geiste der jetzigen Bildung“ anzueignen; an den Universitäten wiederum werde angehenden Rabbinern nichts geboten, was sie auf ihren Beruf vorbereiten könnte. Geigers Bereitschaft, alle Texte mittels wissenschaftlicher Methoden zu lesen, also auch die Torah, unterscheidet ihn von konservativen Zeitgenossen wie Zacharias Frankel oder Samuel David Luzzatto. Der liberale Geiger erkennt aber bei aller Kritik an der Orthodoxie den Wert von Tradition und befürwortet nur diejenigen Veränderungen, die den traditionellen Rahmen wahren. Er hält die Speisegesetze ein und wendet sich gegen den Prediger der Reform-Gemeinde zu Berlin, Samuel Holdheim, der meint, dass auch unbeschnittene Juden als vollwertige Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft zu betrachten seien. Anders als Holdheim auf der einen und die Austrittsorthodoxie auf der anderen Seite sieht Geiger in seiner moderaten Haltung stets die Chance, eine Spaltung des Judentums zu verhindern. Abraham Geiger verspricht sich von seinem Wechsel vom engen Wiesbaden, wo er seine erste Anstellung als Gemeinderabbiner fand, in eine Großstadt auch wesentliche Impulse für die Etablierung des liberalen Judentums. Am 28. August 1837 schreibt er an Joseph Dernburg: „Es fehlt uns ein Rabbiner in einer großen Gemeinde mit großer persönlicher Würde und imponirender Energie, der den intelligenten Theil der Gemeinde für sich zu gewinnen weiß und mit diesem nun ohne Furcht Massen über den Haufen stürzt.“ Aber auch in Breslau wird Geigers Hoffnung auf die Errichtung einer jüdisch-theologischen Fakultät enttäuscht. Zunächst wird sein Gesuch um einen Lehrstuhl für Jüdische Literatur an der Philosophischen Fakultät in Breslau im Februar 1850 abgelehnt. 1854 wird das konservative Jüdisch-Theologische Seminar unter der Leitung von Zacharias Frankel (1801 - 1875) eröffnet. Die konservativen Nachlassverwalter und Kuratoren ziehen aber Geigers Kandidatur für eine leitende Position am neu zu gründenden Seminar gar nicht erst in Betracht, und er muss in der Breslauer Zeitung lesen, dass der Dresdner Rabbiner Kescher 19 Foto © Margrit Schmidt Preußen“ vom 23. Juli 1847 auch die Stellung der Synagogengemeinden, die nun staatskirchenrechtlich anerkannt werden, neu geregelt. Mit dem neuen Parochialzwang und der neuen Verwaltungsstruktur stehen ab 1856 Orthodoxie und liberales Judentum innerhalb der IsraelitenGemeinde zu Breslau gleichberechtigt nebeneinander. Abraham Geiger hat so Anteil an der Ausformung der Einheitsgemeinde, die als Ortsgemeinde unter einem administrativen Dach unabhängige Kultusverbände mit eigenen Rabbinaten und Institutionen vereint. Foto © Stiftung Stadtmuseum Berlin Dr. Frankel für die Anstaltsleitung gewonnen worden ist: für Geiger „ein wirklich tiefer Schmerz, den der Betroffene während seiner Breslauer Tätigkeit niemals verwand“, wie sein Sohn schreibt. Im selben Jahr erstellt Geiger das erste wirklich liberale Gebetbuch, das der Auffassung der nichtorthodoxen Mehrheit entspricht und in seinen Neuerungen moderat genug ist, um für fünfundachtzig Jahre zur Grundlage aller künftigen Siddurim zu werden, einschließlich des so genannten Einheitsgebetbuchs von 1929. Für Geiger klärt sich in Breslau sein Verhältnis zur Reformbewegung. Er lehnt den Ruf der neu gegründeten Berliner „Genossenschaft für Reform im Judenthum“, ihr Prediger zu werden, ab und erklärt auch mit Blick auf die Forderungen der Breslauer Reformfreunde, dass er unter jeder Bedingung auch nur den Schein einer Spaltung der Gemeinde vermeiden will und sich nicht dazu entschließen kann, als Rabbiner eines Teils zu erscheinen; er plädiert für eine Einbindung aller in die bestehende Gemeinde, nicht für die Schaffung eigener Strukturen. Auftrag des liberalen Judentums ist es laut Geiger, die Glaubensgemeinschaft von den letzten Resten einer Volksgemeinschaft loszulösen und zur sittlichen Vernunftreligion zu machen Er wird so zum Fürsprecher einer Fortentwicklung des Judentums: für Reformen der Gebräuche bei Wahrung des historischen Kerns. Er verwahrt sich aber gegen Abbau und Liquidation und ist der schärfste Gegner des 1842 in Frankfurt am Main gegründeten „Reformvereins“ radikaler Laien. Erneuerung bedeutet für Geiger „nicht also jenes blindes reformatorische Treiben, durch welches das Äußere vielleicht aufgestutzt wird, das Innere kalt und leer bleibt, sondern das Bemühen, aus dem Judentum heraus die Judenheit neu und frisch belebt zu gestalten.“ Während seiner Breslauer Amtszeit wird mit dem „Gesetz über die Verhältnisse der Juden im Königreich Abraham Geiger nimmt schließlich einen Ruf nach Berlin unter Vorbehalt an. Nach wie vor fehlt es an einer Ausbildungsstätte für Rabbiner und Gelehrte im liberalen Geist, als Rabbiner Joseph Aub im Oktober 1868 in der Neuen Synagoge in Berlin eine Gedenkrede zum hundertsten Geburtstag von Israel Jacobson hält: „Heute an dem Tage des Gedächtnisses unseres Jacobson lasset uns den Entschluß fassen, in ernster und warmer Theilnahme und Hingebung die Mittelaufzubringen zur Erhaltung unseres LehrerSeminars und zur Gründung einer theologischen Pflanzschule.“ Erst nach Ende des deutsch-französischen Kriegs erfüllt sich schließlich Abraham Geigers Lebenstraum: die Kommission zur Beratung der Lehrerwahlen tritt am 29. November 1871 an ihn heran und lädt ihn zur Mitwirkung an der geplanten Lehranstalt ein. Am 8. Mai 1872 eröffnet die Hochschule für die Wissenschaft dank des Engagements von Moritz Lazarus und eines Legats von Bankier Moritz Meyer ihre Pforten und wird so zur ersten zentralen Einrichtung des liberalen Judentums weltweit. Geiger, der als einer der vier Dozenten zum ersten Rektor bestimmt worden war, hält bei der von Musikdirektor Louis Lewandowski geleiteten Einweihungsfeier den Festvortrag. Zehn Studenten sind in der Matrikel eingetragen, und die Vorlesungen beginnen im Haus an der Spandauer Brücke 8. Abraham Geiger stirbt am 23. Oktober 1874 in seiner Wohnung in der Rosenthaler Straße 40 an den Folgen eines Hirnschlags, kurz vor Beginn seines sechsten Semesters an seiner Hochschule, für das er bereits eine Vorlesung über „Stellung, Lehrinhalt und Aufgabe des Judentums in der Gegenwart“ angekündigt hatte. Was das Ziel aller seiner Bemühungen war, hat Geiger ein gutes Jahr vor seinem Tod formuliert: „Die Gleichberechtigung des Judentums mit den anderen Konfessionen.“ Aus: Hartmut Bomhoff: Abraham Geiger, Durch Wissen zum Glauben, Jüdische Miniaturen, Band 45, Verlag Hentrich & Hentrich, Teetz 2006 „Die Welt ist zu klug geworden, als dass ihr der bloße Name der Juden gehässig sein sollte. Man ist darin einstimmig, dass Türken, Juden, Heiden usw. als Menschen anzusehen sind, so bald sie nur gegen ihre Nebenmenschen rechtschaffen handeln“ (E. Veitel Ephraim) Lernen & Lehren EPHRAIM-VEITEL-DOZENTUR FÜR HOMILETIK AM ABRAHAM GEIGER KOLLEG EINGERICHTET Zu Ehren des Abraham Geiger-Preisträgers 2006 haben wir aus Mitteln der Ephraim-Veitel-Stiftung von 1803 eine Dozentur für Homiletik eingerichtet, die den Namen ihres Stifters tragen soll. Mit der Wahrnehmung der Lehre ist Prof. Dr. Heinz-Günther Schöttler, Professor für Predigtlehre an der Universität Bamberg, betraut worden. Der Berliner Hofjuwelier und Philantroph Ephraim Veitel Ephraim (1729 - 1803), ein früher Vertreter der jüdischen Emanzipation, bestimmte 1795 in seinem Testament 33.333,- Taler für eine wohltätige Stiftung. Die Ephraim-Veitel-Stiftung von 1803 ist wahrscheinlich die älteste und vielleicht sogar einzige jüdische Stiftung in Deutschland, die trotz der Verfolgung jüdischer Institutionen im Dritten Reich bestehen blieb. Während des Nationalsozialismus kam der - inzwischen schon stark reduzierte - Kapitalertrag der auf staatlichen Druck in „Stiftung von 1803“ umbenannten Einrichtung nichtjüdischen Bürgern zu Gute, insbesondere „jungen Leuten in Ausbildung“. Inzwischen trägt die Stiftung wieder den Namen ihres Gründers und engagiert sich in seinem Sinne. Ziel der Stiftung nach ihrer erneuerten Satzung ist es, „Bestrebungen und Vorhaben, die der Verständigung und dem Zusammenleben von Menschen jüdischer und anderer Konfession dienen“ zu unterstützen. „Dazu ist die Dozentur für Homiletik, gehalten von einem katholischen Professor an einem jüdischen Kolleg zur Ausbildung von Rabbinern, hervorragend geeignet“, betonte die Bonner Rechtsanwältin Juliane Doose (Foto li.) als Stiftungsvertreterin. 20 Kescher 4. Jahrgang | Ausgabe 1 Zur Belebung des jüdischen Gottesdienstes von Abraham Geiger (1860) Im Jahre 1849 arbeitete Abraham Geiger für die Gemeinde Breslau eine Programmschrift Grundzüge und Plan zu einem neuen Gebetbuche aus, die er elf Jahre später unter dem Titel Notwendigkeit und Maß einer Reform des jüdischen Gottesdienstes. Ein Wort zur Verständigung einem weiteren Leserkreis zugänglich machte. Aus dieser Abhandlung geben wir einige Auszüge allgemeineren Inhalts wieder, beginnend mit dem Schluß des Vorwortes, das am 13. September 1860 verfaßt wurde: „In mir selbst hat sich auch seit der Zeit nichts geändert; die tiefe Überzeugung von der Notwendigkeit eines entschiedenen, aber auf historischer Grundlage verbleibenden Fort–schritts hat sich in mir nur befestigt. Die trübe Zeit hat meine Entschiedenheit nicht gebrochen, das reifere Alter den Jugendmut nicht gelähmt, aber auch der Fortschritt in wissenschaftlicher Erkenntnis meine innige Anhänglichkeit an dem ganzen reichen Entwicklungsgang des Juden– tums, an allen Erzeugnissen der vergangenen Jahrhunderte nicht geschwächt. Und so hoffe ich, dass, was in mir zu einer befriedigenden Verschmelzung und Innigkeit sich eint, auch in die Gesamtheit als lebendige Überzeugung eindringe zur gemeinsamen Verherrlichung des einzigen Gottes. Das Bedürfnis, dem Gottesdienst nicht bloß äußerlich eine ansprechende Gestalt zu geben, sondern auch seinen Inhalt mit den jüdischen Anschauungen der Gegenwart in Einklang zu bringen, wächst von Tag zu Tag. Unser Gottes– dienst ist - legen wir das Geständnis ab, so traurig es auch klingen mag - zum großen Teil unwahr oder zu einem gedankenlosen Werkdienst geworden. Die Gedanken und Gefühle, welche in den Gebeten niedergelegt sind, finden bei den meisten nicht denjenigen Anklang, welcher allein die Weihe und den segenspendenden Einfluß des Gebetes bedingt. Die Sprache, in welcher der Gottesdienst abgehalten wird, verstehen die meisten Besucher des Gotteshauses nicht mehr, eine oft zu lange Zeitdauer desselben ertötet die Andacht derer, welche ihm vollständig beiwohnen, während sie den größten Teil veranlasst, das Gotteshaus früher zu verlassen, und noch andere Übelstände, welche, aus den Verhältnissen des Lebens herrühren, tragen immer mehr zur Verödung des Gotteshauses bei. Die ästhetische Form und die Predigt können, trotzdem dass ihnen allgemein die erbauende Kraft zuerkannt wird, diesem Übel nicht ganz abhelfen. Es müssen umfassendere Mittel angewendet werden. Dennoch wird die Heilung der Gebrechen nicht in einer vollständigen Neugestaltung gesucht werden dürfen. Die Kraft der religiösen Lebensäußerung liegt nicht bloß in dem individuellen Gefühl, sondern vorzüglich in dem lebendigen Zusammenhang des Einzelnen mit einer auf gleicher Grundlage stehenden Gesamtheit, in dem festen Anhalt an einer großen, erinnerungsreichen Vergangenheit, und in der Freudigkeit, mit der aus solch einer Vergangenheit in eine frische Zukunft hinübergeleitet wird. Jede einzelne jüdische Gemeinde ist ein Glied der gesamten Judenheit, sie muß in ihren Einrichtungen das Ganze in sich darstellen, wenn auch mit einzelnen, ihrer Individualität angemessenen Nüancierungen; eine jede Zeit im Verlaufe des Judentums bildet ein Moment in der Geschichte desselben, und die Gegenwart kann sich ebenso wenig von der Vergangenheit gänzlich losreißen wie das einzelne Glied von dem ganzen jüdischen Körper, ohne Schaden ans sich selbst u leiden. Ein solches Wurzeln in der Vergangenheit ist nicht die Macht der toten Gewohnheit, es ist die Wirkung der lebendigen Idee, welche gleichmäßig alle Zeiten mit ihrem Saft durchströmt, und wenn sie zu verschiedenartigen Entwicklungen führt, doch nicht eine voreilige Verletzung ihrer Bildungen gestattet. Wenn auf irgendeinem Gebiet, so ist namentlich auf dem religiösen das Verfahren der Reform allein segenbringend, die Revolution nur geeignet, allen Lebenskräften ein gefährliches Siechtum beizubringen. Wohl hat sich auch auf dem jüdisch-religiösen Gebiet die traurige Erfahrung wiederholt, dass die Reform zur Zeit, das sie genügt hatte, verweigert und dadurch um ihren friedlich veredelnden Einfluß gebracht worden ist, so dass die Gegenwart zu einer plötzlichen, unruhigen Umgestaltung gedrängt wird; wohl kann daher die jüdisch-religiöse Reform nicht jenen ruhigen, gleichmäßigen Schritt wandern, der befestigt, ohne zu erschüttern, der Befriedigung bringt, ohne zu verletzen. Die jüdisch-religiöse Reform muß - sie kann nicht anders, wenn sie einer Entwicklung sich erfreuen will - mit der vollsten Energie sich erfüllen, sie muß sich darauf gefasst machen, dass Zögernde und Bedenkliche, Beschränkte und bloße Gewohnheitsmenschen sich von ihr lossagen, und sie muß es der Allgewalt des Lebens überlassen, diese erst später zu ihr zurückzuführen. Dennoch aber und gerade deshalb muß sie mit der größten Umsicht die vorzunehmenden Schritte erwägen und dem Drang der Gegenwart nicht die Verbindung mit der Vergangenheit, den individuellen Empfindungen nicht den Zusammenhang mit der Gesamtheit opfern. Die Reform der Geschichte Eine solche Reform ist keine Halbheit, wie man so gerne alles das benennt, was nicht einseitig einem beliebig aufgestellten Grundsatz huldigt und alles Widerstrebende ohne Erbarmen beseitigt. Es ist die vielmehr die Reform der Geschichte, der wir alle als Organ dienen; schöpfend aus der Vergangenheit, spenden wir Nahrung der Zukunft, bereiten wir uns vor zum schöneren Ziel, an den überkommenen Gütern uns erfreuend, erhöhen wir ihren Wert für die Gegenwart. Ich verkenne nicht die schwierige Aufgabe, welche ein Wirken in diesem Sinne auferlegt; es setzt die Innigkeit des religiösen Gefühls, die Herrschaft der religiösen Idee und zugleich den wirklich engen Zusammenhang mit der Geschichte des Judentums voraus. Aber sollten jene ganz verkommen, die Klänge aus dieser ganz verklungen sein? Was die edelste Blüte nicht nur des menschlichen Herzens, sondern auch des menschlichen Geistes isz, kann nicht verwelkt sein. Die Geschichte des Judentums ist so lebensfrisch, sie hat so viele Setzlinge und Sprösslinge auch im gegenwärtigen Leben, dass sie, von dem Geröll gereinigt, ihre Macht nicht eingebüßt haben kann. Es ist unbestreitbar, dass die Überfüllung unseres Gottesdienstes mit Gebeten, welche teils ein schnelles Wegsprechen derselben, teils eine sehr lange Dauer des Gottesdienstes zur Folge hat, hauptsächlich zur Entfernung der Andacht aus 21 dem Gotteshause mitwirkt. Die Beseitigung der ihrem Inhalt nach ungeeigneten Gebete und Gebetstücke, so wie die Abkürzung anderer im Ausdruck werden allerdings das Maß verringern, aber noch immer nicht in dem wünschenswerten Grade. Zur Befriedigung des unabweislichen Gebotes, die Zeitdauer auf das angemessene Maß zurückzuführen, bietet uns jedoch die Heilung eines anderen eingeschlichenen Übelstandes das geeignetste Mittel. Man hat nämlich die Wieder– holung desselben Gebetstückes in demselben Gottesdienst nicht gescheut und nicht bedacht, dass so kurz hintereinander sich wiederholende Aussprüche mit gleichen Worten unmöglich den andächtigen Eindruck beim Betenden oder Hörenden erzeugen können, dass sie vielmehr nur ermüden und aus Kernsprüchen Gewohnheitsformeln machen. Bei dem Verlesen des Abschnittes aus der Thora spricht ein jeder der dazu Gerufenen diesselben Lobsprüche beim Hinzutreten und beim Abtreten, diese werden daher mindesten drei-, häufig achtmal wiederholt, während in der alten zeit bloß derjenige, welcher uerst aufgerufen wurde, den Spruch nach dem Verlesen rezitierte (Mischna Megilla IV, 1 und 2). Das eine Sünden– bekenntnis am Versöhnungstage wird neunmal, das andere gar elfmal an einem und demselben Tage gesprochen; das Gefühl der Reue wird dadurch nicht geweckt, vielmehr ertötet. Solche ermüdenden Wiederholungen müssen notwendig entfernt werden. Aber auch außerdem hat man sich nicht erschöpfen können in der Aufnahme an sich schöner Bibelstellen, die aber nicht in ununterbrochener Aufeinanderfolge rasch hergesprochen, sondern in zeitweiliger Abwechslung mit Bedacht erwogen, ihre erbauliche Kraft zu bewähren imstande sind. Ist es möglich, diese ganze Masse nur mit einiger Andacht zu begleiten? Ein einzelnes Stück, das mit den anderen abwechselte, mit Ruhe und Würde vorgetragen, ist imstande, fromme Empfindungen zu wecken; ale zusammen, sich überstürzend, ertöten eine jede Empfänglichkeit des Gemüts. Überall, bei jedem Anfang, jedem Schluß, jeder scheinbaren Pause, sind ganze Psalmen oder einzelne Psalmen eingefügt worden, wohl in guter Absicht, aber mit sehr geringer Einsicht. Bei dem Gebet ist das Zuviel gefährlicher als das Zuwenig; in das Wenige legt der Betende seine ganze fromme Empfindung, sollte sie auch nicht ihren vollen Ausdruck in den ihm entgegengebrachten Worten finden, das Übermaß verwirrt ihn und stumpft ihn ab. Durch die vorzunehmenden Abkürzungen wird nicht bloß das rechte Maß erreicht, sondern es lässt sich auch eine heilsame Mannigfaltigkeit bewirken, indem mit diesen Bibelstücken abgewechselt, den einen Sabbat dieses, den andern jenes vorgetragen wird. Noch ein Moment des Gottesdienstes, welches an sich als belehrendes von großer Wichtigkeit ist, ist gleichfalls durch das gefährliche Übermaß nur übermüdend und geisttötend geworden; es ist dies der Vortrag aus der Thora. Bereits ist durch die Einrichtung des dreijährigen Zyklus eine angemessenere Verteilung bewirkt, doch ist auch diese Umgestaltung noch nicht ganz ausreichend. Auch für die Festtage müssen die Ab– schnitte verkürzt werden; sie enthalten gewöhnlich neben dem, was sich auf das bestimmte Fest bezieht, vieles nicht mit dem Tag in Verbindung Stehende, was daher auszuscheiden ist. Dadurch wird die Zeitdauer verkürzt, und der Gottesdienst gewinnt an Abrundung. Wir würden nimmer zu einer wohlgerundeten Gestaltung desselben gelangen, wenn wir nicht den Mut und den Willen haben, das Störende mit fester Hand zu entfernen. Über die Form des Gottesdienstes ist im Ganzen wenig zu sagen, die gehörige Erwägung des Einzelnen unter Zuziehung von Sachverständigen mit Berücksichtigung der der Gemeinde zu Gebote stehenden Mittel ist hier entscheidend. Im allgemeinen lässt sich nur als Grundsatz aufstellen, dass den Regeln der Kunst entsprechende Choralgesänge mit einfachen Gesängen, bei welchen die ganze Gemeinde sich beteiligt, womöglich mit Orgelbegleitung, Rezitative von seiten des Vorbeters, deutsche vom Rabbiner vorzutragende Gebete mit Responsorien, bei denen die Gemeinde mit tätig ist, und stillen Gebeten abzuwechseln haben. Die Festtage werden sicherlich, wenn sie in immer würdigerer Weise gefeiert werden, einen großen Teil der Gemeinde im Gotteshaus versammeln, aber den Sabbaten traue ich diese Kraft nicht zu, es wird immer ein verhältnismäßig kleiner Teil bleiben, der dem öffentlichen Gottes– dienst beiwohnt, selbst wenn dieser allen Bedürfnissen zu entsprechen geeignet ist. Hier ist es besonders, wo der Reform das verhängnisvolle „Zu spät!“ zugerufen wird. Hätte man in dem von uns vorangegangenen Zeitalter mehr die Anforderungen des Geistes und des Herzens beachtet und sich nicht an das Überlebte mit verschlossenen Augen angeklammert, hätte man den Denkenden den Gottesdienst nicht ganz gleichgültig gemacht, ja verleidet, es würde vielleicht der Zug des Herzens mächtig genug gewesen sein, dass man sich totz manchem Hindernis der Teilnahme am Gottesdienst dieser Tage nicht entschlagen hätte. Nun hat der Strom des Lebens die Dämme überflutet. Keine Klage und kein Tadel wird es vermögen, ihn wieder in sein altes Bett zurückzuführen; die Erwachsenen ergeben sich dem Geschäftsverkehr, die Jugend besucht die Lehranstalten, und das Gotteshaus muß sich auf einen kleinen festen kreis und zufällige Besucher beschränken. Ich bin weit entfernt, diese Tatsche zum Nachteil des Sabbats und seines Gottesdienstes gebrauchen zu wollen; noch immer lebt er nicht bloß in der Geschichte des Judentums, sondern hat auch seine mächtigen Wurzeln in der Gegenwart, und mag er auch nicht mehr der früheren Beachtung sich erfreuen, so ist es darum doch nicht wohlgetan, ihn der ihm gebliebenen Weihe zu entkleiden. Die sprachliche Einrichtung bietet offenbar den schwierigsten Punkt in der ganzen neuen Behandlungsweise des öffentlichen Gottesdien– stes und wird wahrscheinlich am wenigsten geeignet sein, die volle Befriedigung der verschiedenen Richtungen zu erwirken. Hier ist aber besonders die Anforderung berechtigt, dass ein jeder etwas von seinen Gewohnheiten und Lieblingswünschen der Förderung des Ganzen zum Opfer bringe. Mögen die einen bedenken, dass es ihre Pflicht ist, dahin mitzuwirken, dass das Gotteshaus der Jugend nicht ganz verschlossen bleibe, und die anderen, dass sie das ältere Geschlecht nicht aus demselben vertreiben.“ Foto © Bernd Neumann 22 Kescher 4. Jahrgang | Ausgabe 1 ZUM 100. GEBUR T S TAG VON ROBER T RAPHAEL GEIS Die Stellung des Rabbiners in der Gemeinde von Robert Raphael Geis (München 1932) Haben die letzten Jahre das Gesicht unserer Gemeinde ganz wesentlich verändert, stärker noch macht sich der Wandel der Zeit beim Rabbiner, seinen Aufgaben und seiner Stellung in der Gemeinde bemerkbar. Wie weit ist doch der Weg vom alten Raw, der als Richter und Lehrer sein Amt versah, über den „Kauscherwächter“ der jüdischen Aufklärungszeit und den am christlichen Theologen orientierten jüdischen Geist– lichen bis zum Rabbiner unserer Tage, wieviel Hoffnung auf Anpassung und Angleichung, Glaube an das Ende alten Judenschicksals wirkten da bestimmend mit und erwiesen sich als „trügerische Hoffnung“? Der Rabbiner steht heute mitten im Gemeindeleben. Einmal wohl, weil man alles leid, das einem widerfahren ist, als jüdisches leid empfindet, die vielen fragen, die sich einem aufdrängen und für die man keine Lösung weiß, als jüdische Fragen einem bewusst werden, und man in dem Rabbiner den jüdischen Menschen sucht - oft einen schwere Belastungsprobe für den Träger dieses Amtes. Zum andern, weil keiner heute Zeit für seine Mitmenschen hat, jeder mit seinen Nöten vollauf beschäftigt ist, und man einen Menschen sucht, der sich nicht versagt, der bereit ist zum Hören, und das ist so selten geworden, dass es häufig von Menschen schon verwechselt wird mit Helfen. So gibt es kein Gebiet des Lebens mehr, auf dem nicht der Rabbiner beratend oder entscheidend zum Eingreifen veranlaßt wird: Handle es sich um Auswanderung oder Berufswahl, um Wirtschaftsberatung oder Schiedsgerichte, um rein menschliche Dinge oder um Fragen, die an das Gebiet des Nervenarztes grenzen. Es versteht sich von selbst, dem Rabbiner fehlen sehr häufig die notwendigen wissensmäßigen Voraussetzungen, er muß also in ständiger Fühlung mit den Leitern der der Wohlfahrtsarbeit, mit Wirtschaftsberatern, Juristen und Ärzten sein. Bei einer so weitreichenden Ausdehnung der Arbeitsgebiete wird natürlich der Rabbiner als Prediger und Kasualredner mehr in den Hintergrund treten. Aber das bleibt gar nicht allein eine Frage des Zeitmangels, sondern der gewichtigeren Frage nach dem Sinn der predigthaften Rede. Die Zeiten, da der Rabbiner als Prediger den letzten meist höchst notdürftigen Zusammenhalt zwischen jüdischen Menschen und jüdischer Gemeinschaft herstellte, sind vorbei. Das alte Judenschicksal, das wieder über uns gekommen ist, hat da mehr vermocht als die besten Kanzelreden. Und das Reden des Rabbiners ist heute nur noch insoweit sinnvoll, als es zum Lernen bereit macht oder schon wieder Lernen ist. Freilich verspüren wir gerade hier die Schwere der Rückkehr und, wie problematisch das Lernen von entwurzelten und sorgenvollen Menschen ist. Trotzdem verliert die Forderung nach Lernvorträgen und Schrifterklärungen anstelle von Predigten nicht an Bedeutung, und sie wird wohl am ehesten verstanden werden und müsste eigentlich gestützt werden durch junge Menschen. Damit berühren wir das problematischste Arbeitsgebiet des Rabbiners: die Jugendarbeit. Man hat das Schlagwort des Jugendrabbiners zu einer Zeit geprägt, da das Fiasko in der Jugendarbeit schon deutlich für den, der sehen wollte, zu erkennen war. Schuld daran trägt nicht nur die areligiöse Haltung der Mehrheit unserer Jugend, bestimmt durch die höchst dürftige Beziehung von Rabbiner und Jugend durch die Tatsache, dass alles menschliche Mühen und Wirken nicht mehr von Mensch zu Mensch geht, sondern eine Angelegenheit von Kollektiven geworden ist, und die Jugend-Bünde eine kollektivistische Gemeinschaft darstellen, die mit der Gemeinde, deren Vertreter der Rabbiner bis heute geblieben ist, sehr wenig gemein hat. Eine Annäherung ist nicht möglich durch jugendliches Sichgebären, sondern allein auf der Ebene gemeinsamen Lernens, wozu die jüdische Schule neue Mög– lichkeiten bieten könnte. Freilich dürfte der Rabbiner dann über den vielen Aufgaben, die ihm gestellt werden, die wichtigste Forderung, die auch heute noch für ihn gilt, nicht vergessen: das Lernen. Nur aus dem Lernen kann ihm jene Sicherheit und Autorität werden, deren er für die ständige menschliche Inanspruchnahme bedarf, nur durch intensives Sichversenken in vergangenen Zeiten unserer Geschichte die Geduld zum gläubigen Warten in der Wirrnis unseres Judenlebens; nur so kann er auf Dauer seiner wichtigsten und schwierigsten Aufgabe gerecht werden: Lehrer zu sein. Die Stellung des Rabbiners in der Gemeinde ist wieder so umfassend geworden, dass man versucht wäre, von dem Wiedererwachen einer jüdischen Einheit, die keinen Lebensbezirk außer acht lässt, alles und alle umfaßt, zu sprechen. Wir dürfen uns nicht täuschen. Auch hier - wie bei so vielem - haben wir es nicht mit einer wirklichen Umkehr, sondern mit einer menschlichen Not und Ausweglosigkeit zu tun. Es liegt nicht nur an dem Rabbiner, aber doch gerade angesichts der Gemeinden in Deutschland recht entscheidend bei ihm, ob aus Not wirkliche Gemein– schaft werde, aus einer Flucht in die jüdische Gemeinde ein Neuaufbau alter jüdischer Werte. Nachgelassenenes Manuskript, um 1932, aus: Dietrich Goldschmidt (Hrsg.): Leiden an der Unerlöstheit der Welt. Robert Raphael Geis 19061972, München 1984. Foto © Susanne Geis Kescher „A New Chapter in German Jewish History“ ANSPRACHE ZUR AKADEMISCHEN ABSCHLUSSFEIER 23 Kescher 24 4. Jahrgang | Ausgabe 1 „Intellectually Rigorous, Scholary, And Open” ANSPRACHE ZUR AKADEMISCHEN ABSCHLUSSFEIER by the Reverend Rabbi and Right Honourable Baroness Neuberger D.B.E. Foto © Her Majesty's Stationery Office Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ich fühle mich tief bewegt und geehrt bei diesem historischen Ereignis anwesend zu sein. Es ist ein durchaus historisches Ereignis. Denn bis zum heutigen Tag sind keine Rabbiner in Deutschland ordiniert worden - seit mehr als sechzig Jahren. Heute feiern wir eine Errungenschaft die bis vor Kurzem noch unvorstellbar war: den erfolgreichen Aufbau eines neuen Rabbinerseminars in Deutschland , and die Ordination der ersten, von diesem Kolleg ausgebildeten Rabbiner in Anwesenheit wichtigster Vertreter eines neuen, liberalen Deutschland. Dies ist eine schillernde neue Stufe in der Entwicklung eines neuen, und neu fruchtbaren deutschen Judentums. Diese Feier ist für mich um so bewegender, weil sie auch eine ganz persönliche Bedeutung hat. Hierzu verrate ich Ihnen etwas zu meiner Person: ich mag Mitglied des britischen Oberhaus sein, bin aber eigentlich von Seiten meiner beiden Eltern deutsch-jüdischer Abstammung. Meine Großeltern väterlicherseits stammten aus Frankfurt am Main - sie kennen ja alle den Spruch: Wie kann ein Jud NICHT aus Frankfurt sein - und sie gehörten beiden Flügeln der dortigen Orthodoxie an. Der Austrittsgemeinde gegründet von Samson Raphael Hirsch, der mit seiner Touro im Derech Eretz die ganze deutsche Orthodoxie bis zur Vernichtung prägte, und andererseits der hauptsächlich orthodoxen Einheitsgemeinde. Dass ihre Enkeltochter die zweite Liberale Rabbinerin in Europa wurde, beweist, wie unberechenbar der Umgang Gottes mit seinen menschlichen Geschöpfen ist. Diese Frankfurter Großeltern sind schon im Jahre l906, kurz nach ihrer Heirat, nach England ausgewandert, wo mein Großvater bei einem Onkel arbeitete, der eine Londoner Filiale der Bank seiner Familie gründete. Obwohl keine Rothschilds, waren meine Vorfahren Frankfurter Bankiers. Als Kind hat mein Vater, mit Nachnamen Schwab, beinahe all seine Sommerferien bei seinen Großeltern in Frankfurt verbracht. Viele seiner Verwandten, auch seine Großmutter mütterlicherseits, sind dann wäh- rend der Judenvernichtung umgekommen. Meine Mutter ist 1937 aus Deutschland ausgewandert ohne Schulabschluss - und hatte eine Einreiseerlaubnis nach England nur als Dienstmädchen. Dennoch ist es ihr gelungen, ihren Bruder ein Jahr später nach England nachzuholen. Ein nichtjüdischer Lehrer ihres Bruders hatte sie in England angerufen, um ihr zu sagen, es wäre höchste Zeit, ihren Bruder zu retten. Nur drei Tage vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs sind schließlich ihre Eltern ebenfalls in England angekommen, nachdem meine Mutter mit Müh und Not das nötige Geld von Freunden und Bekannten gesammelt hatte, Geld das hinterlegt werden musste, als so genannte Garantie für ihre Eltern. Als kleines Kind habe ich Schwäbisch mit meinen Großeltern mütterlicherseits gesprochen. Ich beherrsche die deutsche Sprache leider nicht genügend, um Sie und mich, weiter damit zu quälen, und werde das, was ich heute zu sagen habe, auf Englisch vorbringen. Trotzdem fühle ich mich noch immer sehr Deutsch. Und ich betrachte Teile von Süddeutschland immer noch irgendwie als meine Heimat. When my mother was dying, five years ago, hav– ing only been back to Heilbronn am Neckar once since the War, she kept talking about going home. “Mummy, you are home…” I said, as she lay dying in her apartment in London. “Ach, no”, she said, “I mean home, I mean Heilbronn.” She may have left it 64 years earlier, but it was still home. And as her school friends came one by one in her last years to see her from Heilbronn, and as she recalled the great kindnesses done for her parents after they had left, she felt homesick. For, quite unlike the norm, all her father's friends who had been with him in prisoner of war camp in France in the First World War had gone into their apartment, packed everything up, and sent it to England. After my grandparents had settled in London, in temporary accommodation, they were surprised to receive package after package, large container of furniture after large container of furniture, well after the start of the war, all sent by grandfather's old friends and drinking companions. No Nazis, these men, but old friends who were appalled by the turn of events, and remained friends of my grandparents until the end of their lives. So I feel quite German, though born and bred in London. As someone who feels distinctly that I am, in some sense, a German Jew, there can be no greater pleasure than to see this rebirth of Jewish life, this reaffirmation of Germany as home to one of the world's significant Jewish communities. It cannot be like it was before- of course it cannot. But we have here a college, born out of the Enlightenment, born out of the German reform movement, strongly affected by the scientific study of Judaism, the Wissenschaft des Judentums' movement- newly established, here with its first rabbis graduating today and being ordained tomorrow. The whole non-orthodox movement in Judaism has its origins here in Germany. Though it is at its peak in the United States, Reform, Liberal and Conservative Judaism have made great inroads in other parts of the Jewish world, Britain, France, now Italy, Argentina, Brazil, Switzerland, Denmark, and now the former Soviet Union and increasingly in Germany. It was in Germany that the great phrase “Deutsche Bürger Jüdischen Glaubens” was first invented. It was the emphasis on being German citizens of the Jewish faith that led to the idea that modern Reform congregations would use that title- the synagogue where I grew up in London is the West London Synagogue of British Jews … Judaism, more than a faith, became equated with faith. This was the contrast, almost the counter attack, to those Jews who converted to Christianity in the late eighteenth and early nineteenth centuries here in Germany to achieve their education and preferment in whatever field of endeavour they had chosen. The list is endless, but Heinrich Heine is always cited as the epitome of that, not to mention Felix Mendelssohn's father, and I could carry on and on about these people … It was, of course, Moses Mendelssohn, grandfather of the composer, who had first thought Jews should read the Bible in German and not in Hebrew. It was of course Moses Mendelssohn who Kescher 25 Foto © Margrit Schmidt began that great process of the Jewish enlightenment here in Germany, translating the Hebrew Bible into German, arguing for a new and different approach to faith. It was that thinking, that opening of closed doors, pulling back the shutters, opening the curtains, letting in the light, that led to that most creative period of all, the one which people describe as the period of German Jewish symbiosis, when scholarship, both secular and religious, met, where art, literature, music and the cultural life in general flourished, German and Jewish, the one inspiring the other- from the novels of Lion Feuchtwanger, my forebear, to the scholarship of Gerschon Scholem. From the philosophy of Walter Benjamin to the great art history of Aby Warburg, Ernst Gombrich, Fritz Saxl and Gertrude Bing. From the educational achievements of Kurt Hahn at Salem to the extraordinary art of Lyonel Feininger or Max Liebermann, Herman Struck and Ludwig Meidner, to name but a few. And the list goes on and on. There was something about the German Jewish symbiosis which allowed talent to flourish, and a certain form of scholarship to be established. And then it ended, abruptly. But now we have a new college, with its superb faculty. We have keen students, who will serve in Germany, Central Europe and the FSU. Perhaps we will once again see that extraordinary German Jewish symbiosis. Perhaps once again, with these new rabbis, this rebirth, we will see talent spring forth and a capacity for cultural and intellectual endeavour to find a modus vivendi with a religious life that is not orthodox, but is demanding. Perhaps this time those of great talent will not simply rebel against the strictures of orthodoxy of a narrow variety, but will come to an accommodation with their Jewish tradition. The Judaism they will be offered by those trained here at Abraham Geiger College will be intellectually rigorous, scholarly, and open. Their cultural life will perhaps be influenced by their Judaism, or even, if we are fortunate, suffused with it. It is too early to say... let us only recognise that this is a new beginning, with a new generation of rabbis to serve the new Germany and the FSU. They carry a distinguished history, and they inherit that German Jewish symbiosis that flowered so amazingly in the century before the last war. Can they - in their way- reinvent it? Can they - in their turn - make Germany's Jews great again, and can they encourage a particular kind of thought and experiment and excitement? The early signs are promising. So we need to think about what these new rabbis will need to function in the modern world, here in Germany, in Central Europe, in the FSU, or further afield. First, they must be scholarly. Germany produced some of the greatest rabbinic scholars before the war. Amongst our own non-orthodox colleagues there were towering figures such as John Rayner, formerly Hans Rahmer, and the revered Ignaz Maybaum. Scholarship- being able to stand firm by knowing both the traditional way to read and interpret the texts and by applying modern scholarly techniques to them, as my revered teacher Rabbi Dr Louis Jacobs, who passed away earlier this year, did - is essential. The modern rabbi must know what she or he is talking about, and must have one area of scholarly expertise at the very least. But that would not be enough. They also need to have an understanding of other faiths. Here in Germany they need to be able to work with people of other faiths, with Christians of all denominations, with Muslims in a growing Muslim community. They cannot be lazy about this, or disinterested- in the new Germany, no rabbi can possibly ignore the requests for a Jewish presence, or in any way fail to explain, speak, be a representative, encourage, comfort and otherwise be a mover and shaker in the interfaith world. Like the late lamented Rabbi Dr Albert Friedlander, like Rabbis Nathan Peter Levinson and Henry Brandt, they need to make their interfaith work a key part of what they do. They need to know something of other faiths, as much as they need to talk about Judaism, and they need to be prepared to engage with other people of different faiths with a level of intensity and excitement that brings insight to all involved. But that is not enough. The modern rabbi needs to add to that the capacity to each about Judaism more widely. Not exactly interfaith, but speaking on the radio, teaching in schools and colleges, being an exponent of Jewish teaching and Jewish values far wider than the Jewish community itself. There is a hunger 'out there' for a sense of values, for a sense of spirituality. In Germany particularly, where the Nazi past recedes ever more rapidly into the distance, there is a desire to hear from Jews. In Germany particularly, in large parts of which there have been no Jews for 70 years or more, these new rabbis have an enormous representative role to play. These new rabbis have to teach Judaism within their communities. But they will also need to teach beyond their communities, generalising where they can, firm in their values, and explain to the wider community who they are and what they stand for. It is not an unusual thing to ask. In the United Kingdom, Rabbi Lionel Blue has been a leading radio personality over many years, cultivating Jewish humour as a way into Jewish learning and understanding. The late lamented Rabbi Hugo Gryn was equally loved as a radio personality, and others are joining them in explaining, representing, and rejoicing in their Judaism. But the rabbi is not usually facing outwards. Any rabbi worth his or her salt also has to build up his or her congregation. And here, in Germany, building up congregations when so many of the members are émigrés from the FSU, knowing little about their Jewish roots, is a major task. It is painstaking, tough work. Teaching, encouraging, enthusing, building communities that are vibrant and fun, where people rejoice in their Judaism and learn much. It is hard work, and my colleague and friend Rabbi Willy Wolff is carrying it out in Rostock and Schwerin in north eastern Germany, giving new communities a chance to rebuild German Jewish life, but speaking Russian, though German born, for the community are all from the FSU. Yet it is growing, it has a chance. In the UK there are many examples, but one that stands out is Rabbi Andrew Goldstein, in 26 Kescher 4. Jahrgang | Ausgabe 1 Foto © Margrit Schmidt Northwood & Pinner. He started there as a student rabbi. His son is now his rabbinic colleague there, and a tiny community has grown to be one of London's largest and most significant, nonorthodox congregations. That's the model we should look to. They are scholarly, enthusiastic, welcoming, have a key role in the wider community, and they all feel, under that inspirational rabbinic leadership, that everyone has a part to play, some work to do, some more to learn. Without that community building, there can be no community. And the modern rabbi has to learn how to do it - by charisma, of course, but also by sheer hard work. And a part of that is learning to be a real communal rabbi, the pastor, who is with his community in the bad times as well as the good. German Jewry had an extraordinary example of that in Rabbi Dr Leo Baeck, who stood by his community and went with them to the concentration camp. No-one is expecting that - but a willingness to be there, to bring comfort, to support, to enthuse, is the very minimum a modern rabbi will need. And then there is the rabbi as politician, playing a variety of roles. Here in Germany it lies partly in talking about Jews, Judaism, and sometimes Israel in the wider community. Israel and the Middle East has led many rabbis to a form of politics they perhaps did not want to get into. In my own country, Rabbi David Goldberg is a known critic - though by no means always - of Israeli attitudes and politics. He speaks and writes publicly, against what many Jews in the community want him to say. But that is the other rabbinic political role- to be true to oneself and one's principles, often Jewish principles. And the politics can also be about other matters- racism, for instance, or discrimination against any particular group. Rabbis for Human Rights have stood up for the Roma as well as for the Palestinians. Political rabbis fight the cause of the oppressed wherever they are, citing the Exodus from Egypt, from oppression to freedom, as their reason for campaigning as they do. And no modern rabbi can neglect those skills, or the need - sometimes - to be seen to be publicly involved in such a campaign. And then there's the tough, often dull business of being the manager, running, organising, the congregation. Often the only full time employee, the young rabbi finds he has to do everythingfrom painting the walls to running the religion school, from choosing the music to representing the Jews of his town at some interfaith service. The rabbi has to be a manager - of people, of time, of energy. He has to work out how to make a congregation work, and how much help he or she needs. It is no easy task, and rabbinic training rarely prepares you for it. The rabbi has to make everything work, and enthuse others to help, and then manage what they do. It's a key skill, poorly recognised, because it seems such a small part of a rabbi's life. And then lastly there is the role that everyone expects a rabbi to play, the role of spiritual leader. In an increasingly secular world, for most of us, the rabbi is seen as someone who holds timeless values, whose insight into the life of the soul is profound, whose understanding of the spiritual life is great. And yet many young rabbis will not really have an understanding of what is meant by all this. It is the years of experience working with the sick and the dying, the years of experience managing a difficult congregation and suddenly getting an insight into something above and beyond, that really gives one the spiritual awareness. You cannot teach spirituality. You can only learn to feel it. And in everything else our young rabbis are going to have to do, with that long list of what they will need to be, spiritual leader is the hardest. For that spirituality is hard to define and even harder to pass on. It comes by example, by moments of insight. Those who knew Rabbi Dr Leo Baeck always say that one had a sense of the spiritual in being near him. Those who have been in the same room as Nelson Mandela say the same. You feel touched, as if a hand has stroked you and made you come alive. Most of our young rabbis cannot do that. But they can give their communities the chance to think like that and experience the spiritual. They can give people times of quiet, of meditation. They can show them the spirituality that comes of doing good deeds for others in the community. They can show the insights they acquire in their pastoral work. And that is the most we can ask of them. For our new rabbis are to be spiritual leaders, scholars, managers, politicians, teachers, enthusers, interfaith activists, pastors, and community builders. We ask an enormous amount. The amazing thing is that we will get most of it, and we will grow to be proud of a new generation of German rabbis, scholarly, committed, building the new German Jewry, the new Russian Jewry, the new eastern European Jewry. Multi tasking, multi talented, and very very committed. What a great privilege it is for us to see them take on this role here in Dresden. That role is greater, more challenging, and more demanding of their personal resources in intellect and character than it has ever been in Jewish history. We ask of them that from today they pioneer a new chapter in German Jewish history, a chapter that will enrich the entire world Jewish community, and also strengthen and enrich the already vibrant liberal, integrated multicultural society that is the new Germany. It is an awesome task, and for it we humbly ask God's blessing upon them and upon all of us who are pledged to support them. May they have the strength and courage to face what they are taking on, and may they, and we, be blessed in the work they will undoubted carry out for all of us. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich sehr herzlich für ihre gütige Aufmerksamkeit. Kescher 27 „Erneuerung und Versöhnung“ GRUßWORT VON RABBINER DR. ALFRED GOTTSCHALK Demütig und mit besonderer Freude nehmen wir an dieser historischen und tief bewegenden Zeremonie teil. Es ist ein aufregender Moment in dem das liberale Judentum eine Erneuerung erfährt durch die Verleihung der Smicha, der Weihe, einer neuen Generation von Rabbinern. Dieses Ereignis ist ein Teil jenes Lebenselixiers, das unseren Glauben auch in den schmerzhaftesten Momenten unserer Geschichte am Leben erhalten hat. denten des Hebrew Union College-Jewish-Institutes of Religion zu überbringen. Rabbiner Professor David Ellenson, ein Gelehrter der sich der Herausforderung der Moderne für die traditionelle deutsch-jüdische Gemeinschaft widmet, empfahl, dass ich als Rektor und als ehemaliger Präsident des Hebrew Union College-Jewish-Institute of Religion anlässlich dieses historischen Moments sein persönliches “Mazal tov“ sowie das unserer Institutionen überbringen sollte. schen religiösen Lebens. Einerseits sollte es Juden erlaubt sein, an der Moderne teilzuhaben, andererseits musste der Apostasie Einhalt geboten werden. Die Hauptaufgabe der Graduierten des Geiger-Kollegs scheint heute darin zu liegen, die deutschen juden zu erziehen oder umzuerziehen im Sinne der grundlegenden Normen des jüdischen Glaubens und zwar im Kontext des aus den Flammen entrissenen und wiedergeborenen Volkes, „muzal mi'esh“. In ihrem schrecklichen Ausmaß hat die Schoa die bedeutende aschkenasische Gemeinde zerstört. Durch diese Vernichtung wurden Institutionen, die das jüdische Leben gefördert hatten, ausgelöscht. Eine dieser Institutionen war die bedeutende Hochschule für die Wissenschaft des Judentums. Sie ist wiedergeboren im heutigen Geiger Kolleg und auf diese Weise wird an den Geist der vergangenen Hochschule angeknüpft. Es werden wieder Rabbiner und Gelehrte für eine ebenso wiedergeborene jüdische Gemeinde ausgebildet, die nicht nur auf eine bedeutende Geschichte zurückblickt, sondern ihren Blick auch auf eine viel versprechende Zukunft richtet. Als jemand, der 1939 aus Deutschland geflohen ist und als Zeuge des Horrors der Kristallnacht, fühle ich eine besondere Verbindung zu diesem bedeutenden Versuch der Erneuerung und Versöhnung und füge meine eigenen Glückwünsche denen von Rabbi Ellenson an. Ich hatte das Privileg, an dieser großartigen Fakultät zu studieren, und noch als Student am Hebrew Union College war ich Hörer bei Rabbiner Dr. Leo Baeck. Sein Text behandelte „W'ohavto l'reachoh k'mocha“, „Du Sollst Deinen Nächsten lieben wie Dich selbst.“ Ich werde seine kurze, aber kraftvolle Predigt nie vergessen. Er hatte viel zu sagen, jedoch ohne Bitterkeit und Ärger. Trotz all dem, was er durchlitten hatte, zeigte er ausschließlich Liebe und Besorgtheit. Das heutige jüdische Volk mit seiner multi-ethnischen Ausprägung von Glaubenssätzen, Gebräuchen und Traditionen stellt eine große Herausforderung dar. Denken wir daran, dass Israel existiert, an seinen stetigen Einfluss auf uns zeitgenössische Juden. Es stellt uns vor die permanente Aufgabe, unsere besten religiösen, ethischen und politischen Erfahrungen zu integrieren. Rabbiner werden über das „Wesen des Judentums“ weiterdiskutieren. Was für eine großartige Möglichkeit, die unseren neuen Rabbinern gegeben wurde, unsere herrliche religiöse Tradition zu lehren und zu erweitern, sei es im Speziellen oder universalistisch. Abraham Geiger lehrte - und wir rückversichern uns heute in seinem Geiste, - dass Israel „am segulah“ist das einzige Volk, ausgestattet mit einem Geschenk. Durch die Religion wird es zum passenden Instrument, um das Menschliche und das Göttliche zu vereinen. Aber dieses besondere Geschenk, das Gott dem Volk israel gegeben hat, bedeutet auch eine Verpflichtung, solange die Welt nicht am Ende der Tage, „acharit ha'yamim“, angelangt ist. Erinnern wir uns an Rabbi Yochanan Ben Zakkai, der kurz vor Jerusalems Zerstörung die römischen Eroberer um einen scheinbar bescheidenen Gefallen bat: „Ten li Yavneh w'Chakmecha“. „Gebt mir Yavneh - die Yeshiva - und ihre Gelehrten. Verschont sie!” flehte er. Rom willigte aus eigennützigen Motiven ein. Yavneh und seine Gelehrten bewahrten die jüdische Lehre und gaben sie an die damals bestehenden jüdischen Gemeinschaften weiter. Die Yeshiva gab das Heilmittel jüdischen Lebens, die Torah, von einer Generation an die nächste weiter. Ich bete darum, dass das Geiger Kolleg und seine Gelehrten, Rabbiner und Lehrer, diese Yavneh weiterführen und in ihren Studenten eine Leidenschaft und Liebe für die jüdische Lehre und den Dienst am jüdischen Volk erwecken werden. Ich empfinde es als eine persönliche Ehre und ich bin stolz darauf, heute hier zu sein, um die Glückwünsche der Gemeinschaft aus Lehrern und Stu- An den Präsidenten des Geiger-Kollegs, Rabbiner Dr. Walter Jacob, ein von mir hoch geschätzter großer Erbauer, ein besonderer Kollege und Freund, an den Direktor, Rabbiner Dr. Walter Homolka, einem brillanten Verwalter der Fakultät, an Direktorium, Senat und Kuratorium, an alle diejenigen, die die Idee des Geiger-Kollegs haben Wirklichkeit werden lassen, ist ein herzlicher Dank gerichtet! Es war ein schwieriger Weg und eine große Herausforderung das GeigerKolleg bis zu diesem Punkt zu bringen - zu diesem besonderen Moment in seiner noch jungen Geschichte. Abraham Geiger hätte dieser neuen Aufgabe ausdrücklich entsprochen, da er in seiner Zeit das Judentum im Geist von Ben Zakkai umgestaltete. In Geigers Zeit kreisten die Schlüsselfragen um eine notwendig gewordenen Reform des jüdi- Geiger lehrte uns, dass das Christentum und der Islam, abgesehen von grundlegenden Differenzen, viel Wesentliches aus dem Judentum in sich aufgenommen haben. Trotzdem bleibt die Notwendigkeit eines prophetischen Israels bestehen. Israels Aufgabe besteht darin der Welt die Doktrin vom puren Monotheismus zu predigen mithilfe einer Gemeinde von Gläubigen, die die Einheit Gottes preisen und die Einheit der ganzen menschlichen Familie. Foto © Margrit Schmidt 28 Kescher 4. Jahrgang | Ausgabe 1 „Ze Hayom Assa Adonai Nagila w’nissmecha wo“ DIES IST DER TAG, DEN GOTT UNS ZUM FEIERN GESCHAFFEN HAT! Dr. Tomás Kucera (36) hat sein Studium der Biochemie in Tschechien und Deutschland mit Promotion abgeschlossen. Nach einem Forschungsaufenthalt in den USA ging er für zwei Jahre an das Pardes Institut in Jerusalem. 2002 wurde er am Abraham Geiger Kolleg angenommen und kam zum Wintersemester 2003/2004 nach Berlin. Seit den Hohen Feiertagen 2005 hat er eine halbe Stelle in der Liberalen Jüdischen Gemeinde Beth Shalom in München inne. Zuvor war er bereits in Göttingen, Hameln und Hannover tätig gewesen. Seine wissenschaftliche Abschlussarbeit am Abraham Geiger Kolleg befasst sich mit „Abortion in the Jewish Sources“. Anfang November wird er in sein Amt als Rabbiner der Liberalen Jüdischen Gemeinde Beth Shalom in München eingeführt. Daneben wird er künftig auch regelmässig in Prag tätig sein. Daniel Alter (47) hatte bereits Jüdische Studien an der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg studiert und diese Ausbildung mit einem M.A. abgeschlossen, als er im Wintersemester 200172002 sein Studium am Abraham Geiger Kolleg aufnahm. Im Juni 2005 hat er seinen obligatorischen Israelaufenthalt mit einem Studienjahr am Pardes Institut in Jerusalem beendet. Seither arbeitete er als Rabbinerstudent in den Jüdischen Gemeinden Delmenhorst und Oldenburg. Thema seiner wissenschaftlichen Abschlussarbeit ist „Tsa'ar Baalei Chajim Das Verbot der Grausamkeit zu Tieren“. Am 17. September wurde Daniel Alter in Oldenburg in sein Amt als Rabbiner eingeführt. Der gebürtige Nürnberger ist zusammen mit seiner Ehefrau Hannah und den beiden Töchtern von Berlin nach Norddeutschland umgezogen. Malcolm Matitiani (38) absolvierte nach der Hochschulreife in Kapstadt das „Mechinah“Programm an der Hebräischen Universität in Jerusalem. An der University of South Africa studierte er von 1993 bis 1996 Judaistik und Hebräisch. Sein Studium schloss er mit einem B.A. ab. Darauf folgte ein B.A. Honours in Hebräischer Bibel und im Fach „Dead Sea Scrolls“ an der University of Cape Town sowie der M.A. in Jüdischen Studien. Am Abraham Geiger Kolleg wurde er im Wintersemester 2001/2002 zugelassen. Seine Praktika absolvierte er an der Manchester Reform Synagogue (GB) sowie der Northwood & Pinner Liberal Synagogue (GB). In seiner wissenschaftlichen Abschlussarbeit hat sich Malcolm Matitiani mit „The Rabbinic Attitude to Intermarriage as Reflected in Midrashic Literature“ auseinandergesetzt. Er wird nun nach seiner Ordination vom Februar 2007 an als Rabbiner der tausend Familien zählenden liberalen Gemeinde Temple of Israel in Kapstadt amtieren. Fotos © Ralf Bäcker | Zentralrat Buchempfehlung JÜDISCHE KUNST UND KULTUR VON EDWARD VAN VOOLEN Dieses reich illustrierte Buch beleuchtet den jüdischen Beitrag zu den bildenden Künsten der letzten 2000 Jahre. Jedes Bild erzählt eine faszinierende Geschichte über eine der ältesten Kulturen der Welt. Bilder und Texte geben dem Leser einen einzigartigen Einblick in ein vielseitiges und lebendiges Judentum, das unterschiedlichsten Themen oftmals mit frischem Humor begegnet. Entgegen der weit verbreiteten Ansicht, dass den Juden die bildliche Darstellung biblischer Szenen verboten sei, haben sie immer wieder Kunstwerke für sakrale und weltliche Zwecke geschaffen. Historische Wandgemälde, mittelal- terliche Manuskripte und moderne Kunstwerke sind aufschlussreiche Zeugen dieser von und für Juden geschaffenen Kunst. Das Buch geht auf die Suche nach den jüdischen Aspekten der Werke bekannter Künstler wie Chagall, Modigliani, Pissarro, Barnett Newman oder Richard Serra und präsentiert diese im Kontext ihrer jüdischen Herkunft von einer völlig neuen, überraschenden Seite. 192 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag, 139 farbige Abbildungen, 30 x 24 cm. ISBN: 3-7913-3653-3 | EUR 49.95 Kescher 29 Rektor der Universität Potsdam geehrt PROFESSOR DR. WOLFGANG LOSCHELDER WIRD EHRENSENATOR Foto © Margrit Schmidt Der 1940 in Rom geborene Verwaltungsrechtler, zu dessen Forschungsschwerpunkten das Öffentliche Dienstrecht und das Staatskirchenrecht zählen, wurde am 13. September anlässlich der Rabbinerordination in Dresden ausgezeichnet. Professor Dr. Loschelder ist Mitglied des Stiftungsrates der Leo Baeck Foundation, der Trägerstiftung des Abraham Geiger Kollegs. In den Jahren von 1999 bis 2006 hat er wesentlich dazu beigetragen, dass sich die Zusammenarbeit zwischen unserem Rabbinerseminar und der Universität Potsdam zu einem erfolgreichen Modell entwickelte. Sichtbare Zeichen dafür sind der Kooperationsvertrag vom 23. November 2002 und die Integration des Kollegs als An-Institut am 18. November 2004. Bisherige Ehrensenatoren des Abraham Geiger Kollegs sind Rabbiner Dr. W. Gunter Plaut (Toronto), Prof. Dr. Paul MendesFlohr (Jerusalem), Prof. Dr. Ernst Ludwig Ehrlich (Basel) und der 2005 verstorbene Rabbiner Dr. John D. Rayner C.B.E.. 30 Kescher 4. Jahrgang | Ausgabe 1 „So singet uns von Zions Sang!“ KLEINE GESCHICHTE DER SYNAGOGALMUSIK „Wenn die Geschichte des Judentums einstens in späteren Tagen all die Namen ihrer verdienten Glaubensmitglieder verzeichnet, so wird in goldenen Lettern auch hell und rein erstrahlen der Name Louis Lewandowski.“ Auch wenn sich die Vorhersage des früheren Berliner Oberkantors Aron Friedmann (1855 - 1936) nicht erfüllt hat: die mehrstimmigen hebräischen Gebetsgesänge für Orgel, Solisten und Chor, die Louis Lewan– dowski (1821 - 1894) geschaffen hat, sind heute in aller Welt verbreitet. Der Name dieses Kompo– nisten mag vielen unbekannt sein, doch seine Melodie zum „Ma towu“, also zu jenen biblischen Versen, mit denen der tägliche und der Schabbatgottesdienst beginnen, ist wohl allen vertraut und hat längst auch in orthodoxen Kreisen Einzug gehalten. Die Synagogalmusik, für deren Erneuerung der Name Lewandowski steht, hat ihre Wurzeln in den liturgischen Gesängen der Leviten im Jerusalemer Tempel; ein Nachhall ihrer Vortrags– weise findet sich in den Tropen der Toralesung wieder, aber auch in den gregorianischen Gesängen und um christlichen Gebetsrezitativ. Bis ins 19. Jahrhundert hinein wurde die psalmodierende, melismatische Vortragsweise, in der der Chasan als Vorbeter seiner Gemeinde den Gottesdienst gestaltete, in der Regel nur mündlich weitergegeben. In der Spätantike und im Mittelalter finden sich somit kaum Hinweise auf die religiöse Poesie, die in den Synagogen gesungen wurde. Einer der wenigen uns namentlich bekannten Sänger war der syrisch-jüdische Dichter Romanos, auch „Melodos“, der in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung über tausend Lieder verfasst haben soll, die auf Bibelversen beruhten. In den jüdischen Gemeinden, die im Mittelalter auf der iberischen Halbinsel bestanden, wurden die Pijutim - so die hebräische Bezeichnungen für diese poetischen Einschaltungen in die Liturgie - oftmals zu arabischen Versmaßen und Melodien gesungen. Diese Gesänge müssen auch unter Christen so beliebt gewesen sein, dass es Priestern und Studenten von der Kirche untersagt wurde, sich in jüdischer Lehre und jüdischem Singen unterrichten zu lassen; einer der bedeutendsten jüdischen Gelehrten seiner Zeit, Jehuda HeChassid, verbot wiederum seinen Glaubensgenossen, den Christen hebräische Melodien beizubringen oder ditionellen Melodien, die er in der Alten Synagoge in der Heidereuthergasse vorfand oder von aus dem Osten zugewanderten Chasanim übernahm, im klassischen Stil nieder und führte dabei eine freie Orgelbegleitung ein. Seine Bearbeitungen für Chöre weisen Parallelen zu den Oratorien und Chorwerken von Felix Mendelssohn-Bartholdy auf und trugen ihm bald die Bezeichnung „Mendelssohn der Synagogalmusik“ ein. Lewandowskis Hauptwerke sind Kol Rina Utefilla (1871), Toda Wesimra für vier Solisten und Orgel (1876 - 1882) sowie 18 Gottesdienst-Psalme für Kantor, Chor und Orgel letztere hatte der Königlich Preußische Musikdirektor kurioserweise „Sr. Majestät dem Könige von Bayern Ludwig II. in tiefster Ehrfurcht zugeeignet“. sich deren Gesänge anzueignen. Das früheste Fragment eines hebräischen Pijut, das uns überliefert ist, stammt von einem normannischen Edelmann aus Apulien, Jean Drocos, der 1102 zum Judentum übergetreten war, fortan „Obadya ha-Ger“ hieß und sich in Bagdad niederließ. Seine Melodie weist Anklänge an gregorianische Gesänge und an die orientalische Mikrotonik auf. Der erste Jude, der sich in der europäischen Musikgeschichte einen Namen als Komponist machte, war jedoch Salomone Rossi Ebreo (ca, 1570 - 1630), der Gründer der herzoglichen Hofkapelle von Mantua. In seinen ganz dem italienischen Zeitgeist verpflichteten religiösen Gesängen wollte er „die Lieder König Davids nach allen Regeln der musikalischen Kunst verherrlichen und ausschmücken.“ Salomone Rossi, der die synagogale Tradition mit dem Musikgeschmack seiner Epoche verband, ist in vielfacher Weise mit den beiden großen Erneuerern der Synagogalmusik des 19. Jahrhunderts verwandt, mit Salomon Sulzer und Louis Lewan– dowski. Sulzer (1804 - 1891) war als Kantor der beuen Synagoge von Wien der erste, der die bislang eindimensionalen Gesänge mit Regeln von Tonsatz und Kadenz, Harmonik und Kontrapunkt verband und erweiterte. Sein Ziel war es, jüdische Tradition mit zeitgenössischen Formen zu verbinden; dabei setzte er sich der heftigen Kritik altfrommer osteuropäischer Juden aus. Lewandowski führte Sulzers Werk, namentlich sein „Shir Zion“, in Berlin fort. Er schrieb die tra- Die Reform der Synagogalmusik ging in Europa im Zuge der Aufklärung mit der Erneuerung des jüdischen Gottesdienstes sowie mit neuen Formen der Synagogalarchitektur einher. Das Bedürfnis nach mehr Erbauung und nach einer Ästhetisierung des Gottesdienstes, das zunächst im Königreich Westfalen, in Hamburg, Leipzig und Berlin, bald aber auch im österreichischen Teil von Galizien auftrat, führte zu einer neuen Gottesdienstordnung, die sich an sefardischen Vorbildern, aber auch am allgemeinen Zeitgeist orientierte. Anstelle des gleichzeitigen individuellen lauten Gebetssingsangs, wie es in aschkenasischen Synagogen und Stibelach üblich war, trat ein organisiertes Singen unter Leitung eines geschulten Kantors, das mit Chor und Orgel begleitet wurde; der Gemeindegesang beschränkte sich nunmehr auf einige Gebete unisono. Bis dahin war in den meisten Synagogen mit symbolischen Bezug auf König David allenfalls Harfenmusik üblich gewesen; Orgelmusik war zwar nicht grundsätzlich verboten, galt aber seit der Zerstörung des Tempels im Jahre 70 vielen als unstatthaft. Dem Chasan standen im Gottesdienst allenfalls ein Bass und ein Knaben–sopran, ein „Singerl“, zur Seite, um seine Phrasen zu begleiten oder zu variieren. Gerade weil die Einführung der Orgel mit traditionellen talmudischen Leitsätzen in Verbindung zu bringen war, wurde sie in Mitteleuropa und in den USA zum Gegenstand erbitterter Diskussio– nen. Nicht die veränderte Liturgie, sondern die Kescher 31 Kantorin Mimi Sheffer (hier bei der Havdala) leitete Anfang des Jahres ein Liturgie-Seminar des Abraham Geiger Kollegs im neuen Gemeindezentrum der Israelitischen Kultusgemeinde Foto © privat Bamberg. Orgel wurde schließlich zum Prüfstein dafür, ob sich eine Synagogengemeinde als orthodox oder aber liberal definierte. Reformer wie Israel Jacobson (1768 - 1828) verwiesen zu Recht darauf, dass bereits der Tempel in Jerusalem über eine Art Orgel verfügt hatte; im Talmud (Arachin 10b - 11 a) wird denn auch von der sogenannten Magrepha berichtet, einem Instrument, dessen zehn - nach anderer Lesart auch tausend - Töne über den Ölberg hinweg bis nach Jericho zu hören waren. In Frankreich und Italien war es im 19. Jahrhundert gar nicht erst zum Orgelstreit gekommen, denn dort hatte das Instrument auch in orthodox ausgerichteten Synagogen seinen Platz: In der Rue de la Victoire, dem Sitz des französischen Großrabbiners, war Orgelbegleitung vor vierzig Jahren noch gang und gäbe - und wer weiß heute schon, dass der Schabbat in der Prager Altneuschul bereits um 1678 mit Orgel– klängen empfangen wurde? Wer sich mit der Geschichte der Synagogalmusik beschäftigt, muss feststellen, wie haltlos auch die Meinung ist, Orgelmusik in der Synagoge verbiete sich allein schon deshalb, weil es sich um unstatthafte Nachahmung christlicher Gottesdienstformen handelte. Der Nestor der deutschen Rabbiner in der Bundesrepublik, Peter Nathan Levinson, hat stets darauf hingewiesen, dass der Talmud lehrt, dass jeder würdige Brauch, wo immer er auch zu finden ist, von Juden übernommen werden darf (Berachot 28 b und Sanhedrin 39 b). Dazu gehört auch das Orgel–spiel, das die „Kawanah“, Andacht und religiöse Einkehr, fördert - so wie auch die Übertragung vieler Gebete in die Landessprache, die Aufgabe antiquierter oder sinnentleerter Formeln und die regelmäßige Predigt in liberalen Synagogen zu Verständnis, Konzentration und Anteilnahme der Gemeinde beitragen. Besonders in den Synagogengemein– den der Großstädte, in denen sich Beter ganz unterschiedlicher Herkünfte zusammenfanden, galt der altfromme Stil schon aus akustischen Gründen als nicht länger zeitgemäß. Man folgte nunmehr dem liberalen Ritus und pflegte die neue Musikkultur: so hatte die 1867 fertig gestellte liberale Münchner Hauptsynagoge eine besonders kompakte Orgel mit 1500 Pfeifen und 25 Registern. Das Beispiel machte auch in Osteuropa Schule, etwa in der um 1840 samt Orgel errichteten Brody-Synagoge von Odessa, wo David Nowakowsky (1848 - 1921) als Kantor und Komponist wirkte. Im Verlauf der vergangenen zweihundert Jahre ist jüdische liturgische Musik zu einer wirklichen Bereicherung der Musikkultur geworden. Die vielfältigen gegenseitigen Einflüsse und Anre– gungen zeugen von der bürgerlichen Emanzipa– tion der Juden ebenso wie vom Wiederaufleben der jüdischen Kultur als gleichberechtigter Bestandteil des europäischen Geisteslebens. Ein frühes Beispiel für solch gegenseitige Bereiche– rung ist Franz Liszt, der an der Orgel der Budapester Dohány-Synagoge musizierte. Die Kantate, die Beethoven zur Eröffnung des Wiener Stadttempels schreiben komponieren sollte, blieb noch ungeschrieben; der Protestant Max Bruch (1838 - 1920) komponierte aber 1880 sein bekanntes „Kol Nidre“, der Katholik Maurice Ravel (1875 - 1937) „Kaddish“ und „Hebräische Volkslieder“, und auch Strawinskij und Prokofjew schufen Beiträge zur „hebräischen“ oder „jüdischen“ Musik. Der Dessauer Kantorensohn und Busoni-Schüler Kurt Weill (1900 - 1950) wiederum schöpfte mit Kompositionen wie sein Kiddusch gleich Ernest Bloch, Arnold Schönberg und Leonord Bernstein aus der eigenen jüdischen Tradition; Herbert Fromm (1905 - 1995), der aus Kitzingen stammt und in die USA emigrieren konnte, gilt als wichtigster Komponist für Synagogalmusik des 20. Jahrhunderts, ist aber hierzulande so gut wie unbekannt. Nicht nur Komponisten, auch Kantoren haben immer wieder bewiesen, dass sie in Chasanut und allgemeiner Musikkultur gleichermaßen zu Hause sind: der Berliner Kantor Abraham Jacob Lichtenstein (1806 - 1880) war ein gefeierter Tenor, der auch in christlichen Oratorien sang und Max Bruch auf die jüdische liturgische Musik aufmerksam machte; Oberkantor Israel Alter, der bis 1935 an der hannoverschen Synagoge tätig war, feierte auf der Opernbühne Erfolge. Joseph Schmidt (1904 1942), der mit Arien und Schlagern wie „Ein Lied geht um die Welt“ ein Millionenpublikum begeisterte, hatte seine Karriere als Chasan begonnen und amtierte in der Berliner Reform-Gemeinde und zur Eröffnung der liberalen Synagoge Prinzregentenstraße 1930 in Berlin. Heutzutage ist es in der mehrheitlich liberalen jüdischen Welt selbstverständlich, dass auch Frauen als ausgebildete Kantorinnen in Gottesdiensten wie Konzerten Chasanut zu Gehör bringen. Hartmut Bomhoff 32 Zions Töchter von A bis Z Pauline Bebe, isha. Frau und Judentum Kescher nun die eher traditionelle Lesart ausmacht: dass für die jüdische Orthodoxie beispielsweise keine fortschreitende Offenbarung denkbar ist und die mündliche Tora Mose bereits am Sinai gegeben worden sein soll, wird erst auf Seite 207 in einer Fußnote angemerkt, ist aber doch wesentlich für die Auseinandersetzungen zwischen orthodoxen und liberalen Juden in Folge der europäischen 1983 gab die amerikanische Religionswissenschaftlerin Susannah Heschel mit ihrer Textsammlung On Being a Jewish Feminist: A Reader einen nachhaltigen Impuls für die Auseinandersetzung mit der Lebenswirklichkeit jüdischer Frauen und der Ausformung einer jüdisch-feministischen Theologie. Auch Pauline Bebe Buch Isha (hebräisch für „Frau“) hat das Ziel, „die Betrachtung der Persönlichkeiten aus Bibel und Talmud und die Auseinandersetzung mit frauenrelevanten Themen aus einem anderen Blickwinkel vorzunehmen“. Die Rabbinerin einer liberalen jüdischen Gemeinde in der Ile-de-France setzt dem Text- und Selbstverständnis des traditionellen Judentums, in dem „Klal Jisrael“ (die Gemeinschaft Israels) für sie quasi die Einheit von Männern unter Ausschluss der Frauen bedeutet, feministische und religiös-liberale Perspektiven entgegen. Ihr Buch ist 2001 bei Calmann-Levy als Dictionnaire des femmes et du judaisme erschienen, und der deutschsprachige Titel Enzyklopädie soll auf die der Toleranz und Aufklärung verpflichteten französische Schule der Enzyklopädisten verweisen. Tatsächlich ist Isha aber keine umfassende Enzyklopädie, sondern eine lexikalisch angelegte Auswahl von knapp einhundert alphabetisch angeordneten Artikeln, die von „Abigail“ bis „Zippora“ reicht und Porträts von Frauengestalten aus Bibel und Talmud, Beiträge zu Ritus und Religionsgesetz und zeitgenössische Fragestellungen umfasst. Zu diesen „Frauen betreffende Themen“, wie es im Klappentext heißt, gehören Ehe und Scheidung, lesbische Beziehungen, Empfängnisverhütung und Abtreibung, Erbrecht oder auch Sexismus und Sprache. Frankozentrischer Blick Die begrenzte Auswahl und die alphabetische Abfolge der Beiträge haben zur Folge, dass verwandte Begriffe wie Heirat, Ehe und Scheidung im Buch unverbunden bleiben und auch diejenigen Frauengestalten und biblische Episoden, die diesen Themenkreis illustrieren könnten, für sich alleine stehen. Für Leser, die mit dem Judentum in seiner ganzen Vielfalt nicht vertraut sind, erschließt sich aus der liberal-feministischen Perspektive Pauline Bebes nicht immer, was denn Pauline Bebe kommt zugute, dass sie nicht nur populäre Gestalten wie Königin Esther anführt, sondern auch die eher unbekannte Prophetin Noadja oder Zelophchads Töchter, aus deren Geschichte sie eine„umgekehrt sexistische Einstellung“ der Rabbinen herausliest. Die Autorin will mit den herkömmlichen Denkmustern aufräumen, wenn sie daran erinnert, dass die Prophetin Hulda in ihrem Lehrhaus Männern die Tora auslegte; sie erwähnt aber Aufklärung. Pauline Bebe schöpft aus antiken wie aus modernen Quellen, aus der biblischen Erzählung ebenso wie aus rabbinischen Responsen, doch wenn sie sich auf talmudische Traktate bezieht, ist für Laien nicht nachvollziehbar, welche Textstellen aus dem Baylonischen Talmud sie damit eigentlich zitiert. Wer sich für allgemeine Fragen des jüdischen Rechts in Zusammenhang mit Traditionskritik interessiert, findet in Isha detaillierte Beschreibungen und interessante Denkanstöße; bei Detailfragen muss man aber weiterhin auf die Encyclopedia Judaica oder auf Fachliteratur zurückgreifen. 4. Jahrgang | Ausgabe 1 nicht, dass die biblische Prophetin und Richterin Debora im französischen Mittelalter immerhin als diejenige galt, die die Richter Israels einst in Halacha, im Religionsgesetz, unterwiesen hatte. Schade auch, dass sie auf die Darstellung historischer Frauengestalten verzichtet, die in der aktuellen Diskussion immer wieder als Rollenmodelle dienen, etwa Rivka Tiktiner, Glückel von Hameln oder Bertha Pappenheim - Frauen, die im Sinne Susannah Heschels dazu beigetragen haben, ein lebendiges Judentum zu schaffen und zu erhalten. Irritierend ist in der deutschen Übersetzung der prinzipiell frankozentrische Blick der Autorin. Mit Blick auf die Feier der religiöse Mündigkeit von Mädchen als Bat Mizwa berichtet Pauline Bebe etwa von Gruppenzeremonien des französischen Konsistoriums und davon, dass die Reformbewegung in Deutschland 1846 beschloss, das Alter der religiösen Volljährigkeit auch für Mädchen auf dreizehn Jahre festzulegen - „doch eine rituelle Beteiligung der Mädchen ist höchst unwahrscheinlich.“ Tatsächlich ist eine derartige Zeremonie in Berlin aber bereits für 1817 belegt. Die deutsche Übersetzerin Caroline Bechhofer hat versucht, diesem Manko mit eigenen Ergänzungen zu begegnen, lässt es dabei aber an Sachkenntnis und Genauigkeit fehlen. Die examinierte Berliner Religionslehrerin und spätere Rabbinerin Regina Jonas wird in ihrer Rückübersetzung aus dem Französischen beispielsweise zur „Professorin für Religion“. Isha weist eine recht umfangreiche Bibliographie auf, doch die Literaturangaben bleiben leider unausgewogen und unvollständig, und was gänzlich fehlt, ist ein Sach- und Namensregister, mit dem dieses Buch vom Kaleidoskop zum gebräuchlichen Nachschlagewerk hätte werden können. Fazit: ein ambitioniertes Buchprojekt, das wissenschaftlichen Anforderungen in seiner eklektischen Auswahl nicht genügen kann. Die deutsche Fassung krankt deutlich daran, dass der Verlag und seine Übersetzerin dem Projekt nicht gewachsen waren. Hartmut Bomhoff Kescher 33 Fotos © Margrit Schmidt Ein Seder mit gleich fünf liberalen Rabbinern fand dieses Jahr in der Synagoge Hüttenweg statt: Rabbiner Dan Bridge (Seattle), Rabbiner Dr. Walter Homolka (Berlin), Rabbiner Richard Lampert (Sidney) und Rabbiner Jeemy Milgrom (Jeusalem) waren der Einladung der Betergemeinschaft Sukkat Schalom gefolgt. Rabbiner Dr. Andreas Nachama leitete den Sederabend, begleitet von Kantor Alexander Nachama. Zum 12. Mal trafen sich Mitte Juli Mitglieder aus liberalen jüdischen Gemeinden bei der Jahrestagung der Union progressiver Juden in Berlin-Spandau. Wie immer mit dabei die Studenten und Dozenten des Abraham Geiger Kollegs. Kantor Dmytro Karpenko referierte auf Russisch zu „Musik im Gottesdienst“ - die große Zahl von Zuwanderern unter den gut 200 Tagungsteilnehmern war auch Ausdruck der erfolgreichen Integrationsarbeit und des Miteinanders in den liberalen Gemeinden. Solidarität für Israel. Am 31. Juli hatte die Liberale Jüdische Gemeinde Hannover zu einer Spendenaktion für das Leo Baeck Education Center in Haifa aufgerufen, um so zumindest einen kleinen Beitrag in der dramatischen Kriegssituation zu leisten. Im August waren dank des Engagements der rührigen Gemeindemitglieder schon über EUR 5.000,- an Soforthilfe eingegangen. Die Gemeinde beteiligte sich am 10. August auch an einer Foto © Michel Eram Solidaritätskundgebung auf dem hannoverschen Opernplatz. „Es gibt viele Wege, jüdisch zu sein“, lautete das Motto des diesjährigen Sommer-Machanes von „Jung & jüdisch junior - Netzer“. Achtzig Chanichim aus ganz Deutschland, aber auch aus Belgien, Costa Rica und Österreich nehmen an der zweiwöchigen Jugendfreizeit in Tirol teil. Die rabbinische Betreuung lag bei Dr. Tom Kucera (Abraham Geiger Kolleg). Themenschwerpunkt war: „Toleranz und Akzeptanz“. Daneben standen wie immer Ausflüge und Freizeitangebote auf dem Programm. Foto © Adi Weichselbaum LIBERALES JUDENTUM IM HERZEN JAFFAS „Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand erhalten“: das Zitat aus den Sprüchen Salomons ist auch die Devise der Initiatoren der Mishkenot Daniel in Jaffa, die am 18. Juni unter der Schirmherrschaft von Shimon Peres der Öffentlichkeit übergeben wurden. Das 12-Millionen-Dollar-Projekt der dynamischen liberalen jüdischen Gemeinde von Tel Aviv, Beit Daniel, soll vom Herbst an im Zeichen von Tikkun Olam als Kulturzentrum und Begegnungsstätte dienen: als Forum für Araber und Juden, Neueinwanderer und Alteingesessene, sozial schwache und eher etablierte Israelis. Ein Gästehaus mit 200 Betten steht auch ausländischen Besuchergruppen offen. Das Stifterehepaar Gerald und Ruth Daniel konnte die Zeremonie, an der neben Vizepremier Peres und dem Präsidenten der amerikanischen Union for Reform Judaism, Rabbiner Eric H. Yoffie (Photo) auch Tel Avivs Bürgermeister Ron Huldai und die Führungsspitze der World Union für Progressive Judaism teilnahmen, aus Krankheitsgründen nur per Live-Schaltung verfolgen. Ruth Daniel, die 1922 als Ruth Feilchenfeld in Berlin geboren wurde und 1933 ins damalige Palästina auwanderte, starb am 22. Juni in Sarasota in Florida. Foto © Ilana Nesher 34 Kescher I. Römische Konsultation zum Jüdischen und Kanonischen Recht Vom 9. - 11. Oktober findet an der Universitat Gregoriana in Rom mit Unterstützung des Bundesinnenministeriums die erste internationale Konferenz zum Vergleich von Jüdischem und Kanonischem Recht statt. Bislang gab es noch keinen Versuch, im Kontext des interreligiösen Dialogs den für beide Religionsgemeinschaften so bedeutenden Bereich des Rechts auf wissenschaftlicher Basis vergleichend zu bearbeiten. An der Organisation beteiligt sind neben dem Abraham Geiger Kolleg an der Universität Potsdam das Münchner Klaus-Mörsdorf-Studium für Kanonistik, die Päpstliche Universität Gregoriana sowie die Päpstliche Universität Santa Croce. Unter den Referenten sind Prof. DDr. Joaquin Llobell (Rom), der Primas von Ungarn, Peter Kardinal Erdö (Budapest), Rabbiner Prof. Dr. Shimon Shetreet (Jerusalem), Rabbiner Prof. Dr. 4. Jahrgang | Ausgabe 1 Elliott Dorff (Los Angeles) und Rabbiner Dr. Mark Winer (London) sowie von der Tel Aviv University die Professoren Menachem Fisch und Menahem Lorberbaum. Von deutscher Seite nehmen u.a. Prof. Dr. Admiel Kosman (Potsdam), Prof. Dr. Heinz-Günther Schöttler (Bamberg) und Rabbiner Jonah Sievers (Braunschweig) teil. Themen sind unter anderem Gesetzgebung und Normfindung, Rechtsinterpretationen im Kanonischen Recht und in rabbinischen Codices und Responsa, aber auch Fallstudien zur Feuerbestattung, zum Territorialprinzip, zum rechtlichen Status der Frau oder zum Verhältnis von Kirche und Staat. Auf dem Programm stehen auch eine Begegnung mit Papst Benedikt XVI., ein Empfang in der Deutschen Botschaft beim Vatikan sowie anlässlich des Laubhüttenfestes ein Abend in einer römischen Sukka. Das Tagungsprojekt, zu dessen Schirmherren auch Karl Kardinal Lehmann, Professor Cesare Mirabelli und Rabbiner Uri Regev zählen, soll 2007 fortgesetzt werden. Aus Tiefen rufe ich Dich, Ewiger GEDANKEN ZU VERSÖHNUNGSTAG von Prof. Dr. Ernst Ludwig Ehrlich (Riehen) Zwei wichtige Fragen, über die erste deutsche Rabbinerversammlung im Juni 1844 in Braunschweig abstimmte, waren das Kol Nidre-Gebet am Vorabend des Versöhnungstages sowie der Judeneid. Ersteres galt als rein legalistische Formel und als Hindernis, da es von Nichtjuden oft als Indiz dafür begriffen wurde, dass sich Juden pauschal ihrer Versprechen entziehen. Nicht nur liberale Gemeinden erklärten das Kol Nidre für unwesentlich: selbst ein so unerschüttlicher Verteidiger der Orthodoxie wie Samson Raphael Hirsch entfernte es während seiner Amtszeit in Oldenburg aus der Liturgie seiner Gemeinde. In vielen liberalen Gemeinden wird stattdessen bis heute zur vertrauten Kol Nidre-Melodie von Louis Lewandowski der 130. Psalm angestimmt, der ja bereits im alten Palästina zu Beginn des Versöhnungstages vorgetragen wurde. Wir bringen anlässlich des bevorstehenden Versöhnungstages auf S. 35 eine Betrachtung von Professor Dr. Ernst Ludwig Ehrlich zu diesem Psalm. Kescher Wenn wir den Psalm 130 auslegen, so wissen wir nichts über das Schicksal des Beters. Es ist daher ein Psalm, der auch in unsere Situation passen oder in Zukunft uns angehen könnte. “Aus Tiefen rufe ich Dich, Ewiger, Ewiger, höre auf meine Stimme, es seien Deine Ohren aufgetan, der Stimme meines Flehens.“ Der Psalmist spricht hier in der Ichform, es ist also kein Gebet eines Kollektivs. Wir können in die Stimmung dieses Beters gelangen, Gott möge unser Gebet erhören. Wenn wir überhaupt noch beten können, beten wir so zu Gott, wie es hier heißt. Aber unser Beten wird durch etwas beeinträchtigt, was im Psalm als “Sünden“ bezeichnet wird. “Wenn Sünden Du bewahrst, wer könnte, Ewiger bestehen?“ Was ist das eigentlich “Sünde“? Es gibt Menschen, die in einem Sündenbewusstsein befangen, gefangen, verstrickt sind. Es gibt andere, die sich ihre menschlichen Vergehen, die ja auch ein Verschulden Gott gegenüber sind, kaum bewusst machen. Es ist nicht leicht, die richtige Mitte zu finden, zwischen einem Schuldbewusstsein und dieser Art, von sich jede Schuld abzuschieben, immer Recht haben zu wollen, gereizt zu reagieren, wenn einem Schuld oder Mitschuld vorgehalten wird. Der Psalmist sagt es, selbst wenn manche es nicht wahrhaben wollen: Niemand kann vor Gott bestehen. Niemand. Mit dem Hinweis auf die allgemeine Schuld-Verfallenheit des Menschen appelliert der Beter an Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Er tut dies in einer scheuen, eher indirekten Art. Er macht kein Recht geltend, bittet nicht einmal um Gnade. Nur von ferne rührt er die Geheimnisse Gottes an. Wir alle wissen um unsere Schuld. Die Frage des Psalmisten lautet: “Wer könnte vor Gott bestehen?“ Das ist auch eine politische Frage. Wir alle können vor Gott nicht bestehen. Das kann uns vor Schwarz-WeissMalerei bewahren, auch vor Verteufelung des jeweiligen politischen Gegners. “Fürwahr, bei Dir ist Vergebung, dass man Dich fürchte.“ Deshalb wollen wir etwas mit Religion zu tun haben. Damit wir das Gefühl erhalten, wir können neu anfangen, unsere Schuld sei vergeben. Wir werden zwar leider keine neuen Menschen, aber eine Last sei von uns genommen. “Bei Dir ist Vergebung.“ Der Nachsatz stört uns gewiss … „dass man Dich fürchte“. Religion ist eine schlechte Sache, wenn sie mit Angst zu tun hat. Ich halte nichts davon, dass man sich vor Gott fürchten soll. Mir scheint viel eher, es sei angebracht, dass wir uns vor unseren eigenen Untaten fürchten sollen, vor dem, von dem wir wissen, dass es nicht gut ist, und wir tun es dennoch. Angst in der Religion und vor Religion ist ein altes Thema. Angst steht in Wahrheit quer zur Religion, Angst tötet Religion. Wer aus Angst meint, etwa eine Neuerung würde dazu führen, dass das ganze Gebäude zusammenfiele, hat einen sehr engen Begriff von Religion. Angst hat mit Enge zu tun. Anderseits gilt aber was einst Kierkegaard gesagt hat: “Wer sich mit dem Zeitgeist vermählt, wird schnell Witwer.“ Auch hier haben wir die rechte Mitte zwischen Tradition und dem zu finden, was wir als moderne Menschen nachvollziehen können. Angst führt in die Neurose, Religion jedoch soll uns freimachen. “Ich hoffe, Ewiger, es hofft meine Seele, und seines Wortes harre ich, meine Seele auf meinen Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, die Wächter auf den Morgen.“ Hoffnung. Wenn wir überhaupt nicht mehr hoffen könnten, vermöchten wir nicht mehr zu leben. Unsere biblischen Religionen sind in einzigartiger Weise Religionen der Hoffnung. Wir leben in einer Spannung zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Die Vergangenheit, so schicksalsschwanger sie auch sein mag, enthält eine ungeheure Größe. Man verfolgte Juden im Grunde ja nicht, weil sie nichts taugten, sondern weil die Bibel den andern die Maßstäbe gegeben hat, nach denen sie nicht leben wollten, und wir leider ja oft auch nicht leben. Aber wir sind immerhin diejenigen, die einmal die Worte vom Sinai in die Welt gesetzt und verbreitet haben die Zehn Worte -‚ mit denen die Welt von Anfang an so viel Mühe hatte. Es sind die Lehren der Ethik, es ist das Liebesgebot aus dem 3. Buch Mose, Kap. 19, Vers 18. Wir haben es nicht gepachtet, wir wünschten nur, alle würden es ein wenig mehr anwenden, wenn sie sich schon darauf berufen. Auch wir sollten uns heute mehr darauf berufen und es auch mehr anwenden. Das biblische Liebesgebot hat auch etwas mit Hoffnung zu tun und schließlich hat es dann Jesus in die Mitte seiner Botschaft gesetzt. “So harre Israel auf den Ewigen, denn bei dem Herrn ist die Liebe und viel bei ihm Erlösung.“ 35 Das ist der Rat, den uns der Psalmist gibt, uns diesem einen Gott zuzuwenden und anzuvertrauen. Was wird über ihn ausgesagt: Bei ihm ist “chesed“, das Wort meint Gnade, Liebe, Huld. Und etwas anderes behauptet der Beter: Gott sei unser Erlöser. Bei Gott ist die Liebe und die Erlösung. Was heißt hier in diesem Zusammenhang des Psalmes “Erlösung“? Doch offensichtlich die Befreiung von all dem, was uns jeweils bedrückt. Darauf hoffen wir, und das ist das Gebet des Psalmisten. Und dann wendet sich der Beter an das Volk: “Ja, er wird Israel erlösen, von allen seinen Sünden.“ Das ist ein großes Wort. Nachdem der Beter versucht hat, mit sich selbst ins Reine zu kommen, bittet er, nein, hat er fast die Gewissheit, Gott möge das Volk von seinen Sünden erlösen. Und die Erlösung ist hier und heute, das Freiwerden von der Last der Sünden. Wenn manchmal von der Erlösung geredet wird, so ist darin etwas Vages enthalten, es ist ein Begriff für eine ferne Endzeit, jedenfalls etwas, das wir nicht mehr erleben werden. Hier wird uns hingegen sehr deutlich gesagt, was wir heute nötig haben, worum es eigentlich geht: Wir möchten frei werden von unserer Schuld, die jeder als Einzelner hat. Und wir erfahren hier, dass das keine Utopie sein muss, nichts, was in ferner Zukunft geschieht, sondern bei dem wir zumindest helfen können, etwas - und das ist die Paradoxie -‚ was gewiss von der Gnade Gottes abhängt und zugleich jedoch vom eigenen Willen, nicht mehr zu sündigen. So nehmen wir die Gewissheit mit uns, wir mögen Gott um Vergebung unserer Sünden bitten. Wir schließen alle in diese Bitte ein, entsprechend dem Gebet jenes chassidischen Rabbis, der einmal sagte: „Herr, erlöse uns, willst Du es nicht, erlöse die andern“; denn der chassidische Rabbi wusste, dass wenn sie erlöst sein würden, wäre auch von uns eine Last genommen. Sie sind leider bisher genauso wenig erlöst, wie wir selbst. Aber wir beten in dieser Stunde in der Gewissheit des Psalmisten: “Denn beim Ewigen ist die Liebe und viel Erlösung ist bei ihm. Und er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden.“ anzeige sal. oppenheim