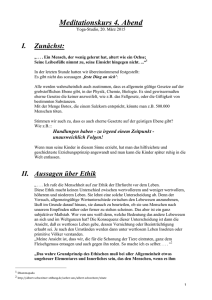PDF-Download - Zentrum für Medizinische Ethik
Werbung

Zentrum für Medizinische Ethik MEDIZINETHISCHE MATERIALIEN HEFT 121 DAS ULMER MODELL MEDIZINETHISCHER LEHRE SEQUENZIERTE FALLDISKUSSION FÜR DIE PRAXISNAHE VERMITTLUNG VON MEDIZINETHISCHER KOMPETENZ (ETHIKFÄHIGKEIT) Gerlinde Sponholz, Gebhard Allert, Frieder Keller, Diana Meier – Allmendinger, Helmut Baitsch Dr. rer. biol. hum Dr. med. Gerlinde Sponholz, Abt. Rechtsmedizin, Universität Ulm 1 Dr. med. Gebhard Allert, Abt. für Psychotherapie und Psychosomatische Medizin, Univ. Ulm, Prof. Dr. med. Frieder Keller, Sektion Nephrologie, Universität Ulm Dr. med. Diana Meier - Allmendinger, Psychiatrische Klinik, CH-Rheinau Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Helmut Baitsch, Abt. Medizinische Genetik, Universität Ulm cand. med. Andreas Uhl, Arbeitskreis Ethik in der Medizin cand. med. Claudia Lensing, Arbeitskreis Ethik in der Medizin DAS ULMER MODELL MEDIZINETHISCHER LEHRE Gerlinde Sponholz, Gebhard Allert, Frieder Keller, Diana Meier – Allmendinger, Helmut Baitsch: Sequenzierte Falldiskussion für die praxisnahe Vermittlung von medizinethischer Kompetenz (Ethikfähigkeit) 1. Lernziel Ethikfähigkeit 2 2. Die Fallmethode und die sequenzierte Fallstudie 7 3. Evaluation, Rückblick und Ausblick 25 Exkurs 1: The moral event (Pellegrino) 27 Exkurs 2: Kommunikative Ethik (Apel, Habermas, Benhabib) 30 Exkurs 3: Dewey und die Folgen: „Learning by doing” und “Clinical Pragmatism” 32 Exkurs 4: Kommunikative Ethik: 25 Stimmen von Lernenden 33 Andreas Uhl, Claudia Lensing: Perspektiven und Gedanken zur medizin-ethischen Ausbildung 1. Gedanken zur medizinethischen Ausbildung 2. Arbeitskreis Ethik in der Medizin der Universität Ulm 3. Fallbeispiel 4. Erfahrungen und Fazit 41 45 48 51 Herausgeber: Prof. Dr. phil. Hans-Martin Sass Prof. Dr. med. Herbert Viefhues Prof. Dr. med. Michael Zenz Zentrum für Medizinische Ethik Bochum Ruhr-Universität Gebäude GA 3/53 44780 Bochum TEL (0234) 32 22750/49 FAX +49 234 3214 598 Email: [email protected] Internet: http://www.ruhr-uni-bochum.de/zme/ Der Inhalt der veröffentlichten Beiträge deckt sich nicht immer mit der Auffassung des ZENTRUMS FÜR MEDIZINISCHE ETHIK BOCHUM. Er wird allein von den Autoren verantwortet. Schutzgebühr: Bankverbindung: € 6,00 Sparkasse Bochum Kto.Nr. 133 189 035 BLZ: 430 500 01 ISBN 3-931993-02 2 DAS ULMER MODELL MEDIZINETHISCHER LEHRE SEQUENZIERTE FALLDISKUSSION FÜR DIE PRAXISNAHE VERMITTLUNG VON MEDIZINETHISCHER KOMPETENZ (ETHIKFÄHIGKEIT) Gerlinde Sponholz, Gebhard Allert, Frieder Keller, Diana Meier – Allmendinger, Helmut Baitsch EINLEITUNG Medizin- "Ethik ist.... nicht ein 'Fach' wie die Physik oder die Jurisprudenz, in denen Experten verbindliche Auskunft und entsprechende Anweisungen geben können. Sie ist offen und darin verwundbar, dass ihre Begründungen 'weich' (logisch geurteilt) und auch vielfältig sind und vor allem, dass im Grunde alle verantwortlichen Menschen eingeladen sind, mitzureden. Genauer gesagt, darf und soll bei der Medizinethik mitreden, wer 1. zumindest eine klare Kenntnis der anstehenden Sachfragen hat (was auch ohne Medizinstudium durchaus möglich ist), 2. die ethische Reife besitzt, verantwortungsvoll und vorurteilsfrei ein komplexes ethisches Problem (eines Patienten, einer Gesetzgebung, einer Forschungsplanung u.ä.) anzugehen, 3. bereit ist, für die Folgen seiner ethischen Entscheidung voll einzutreten und die Verantwortung dafür zu übernehmen" (Ritschl. 1996). Diese Sätze, von Ritschl (1996) formuliert, könnten als eine übergeordnete Programmatik für unsere Ulmer Lehr-Lern-Konzeption angesehen werden. Der Arbeitskreis "Ethik in der Medizin" der Universität Ulm führt seit 1989 im Ausbildungsprogramm des Medizinstudiums Lehrveranstaltungen durch mit dem Thema "Ethik in der Medizin im ärztlichen Alltag" (Allert, 1994). Diese Seminare gehören nicht zum Pflichtprogramm des Studiums, dennoch nimmt mehr als ein Drittel der Studierenden schon des ersten Studienjahres derzeit an ihnen teil. Die Probleme und Konflikte der modernen Medizin werden von den von uns befragten Ärztinnen und Ärzte im Praktikum sowie gleichermaßen von den Studierenden der Medizin wahrgenommen: 95 % der befragten Ärztinnen und Ärzte im Praktikum (n>420) geben an, dass sie regelmäßig mit ethischen Konfliktsituationen konfrontiert sind; und mit annähernd der gleichen Häufigkeit antworten Studierende der Medizin (n>650) der Universitäten Heidelberg, Mainz und Ulm, dass sie im ärztlichen Alltag ethische Entscheidungskonflikte regelmäßig zu erwarten haben. Wir müssen uns fragen, ob die jetzt schon als Ärzte tätigen Kolleginnen und Kollegen angemessen auf die Problem- und Konfliktlösung vorbereitet worden sind, die Antwort auf diese Frage muss uns Lehrende beschämen: über 75 % der von uns befragten Ärztinnen und Ärzte im Praktikum geben an, dass sie in ihrem Studium und gleichermaßen während ihrer bisherigen ärztlichen Tätigkeit nicht gelernt haben und auch 3 nicht entsprechend angeleitet worden sind, angemessen problemlösend mit diesen Entscheidungskonflikten umzugehen (Sponholz et al. 1991, 1994 und 1997). Diese Defizite in unserer ärztlichen Aus- und Weiterbildung sind längst bekannt (vgl. hierzu Heister 1987 sowie den Sammelband "Ethik in der Medizin" herausgegeben von Schlaudraff 1987). Sie werden seit Jahren angemahnt, die kritischen Stimmen werden immer zahlreicher: Wissenschaftsrat (1992), Murrhardter Kreis (Robert Bosch 1995) und Ärztekammern (1996) äußern sich zum Teil fordernd, immer kritisch auf die Defizite hinweisend. Dennoch halten sich unsere Ausbildungsstätten an die notorisch rückständigen Ausbildungsordnungen, in denen Pflichtveranstaltungen zur Ethik in der Medizin nicht vorgesehen sind (siehe 7. Novelle der ÄAppO). Glücklicherweise gibt es an einigen Universitäten (und es werden immer mehr) Ansätze, dieses Defizit zu beheben (siehe hierzu beispielhaft die Artikel von v. Engelhardt, Heubel, Wiesemann, Schwarz, alle in einem Themenheft zu Unterrichtsmodellen zur Ethik in der Medizin 1994 erschienen, sowie Frewer 1993 u. 1994). Dabei wird eine Vielfalt von didaktischen Modellen eingesetzt, die Akzeptanz von Seiten der Studierenden ist recht unterschiedlich. Insgesamt zeichnet sich eine Tendenz dahingehend ab, dass praxisnahe und fallorientierte Arbeit in kleinen Gruppen die Methode der Wahl darstellt; diese Tendenz entspricht der internationalen Entwicklung. 1. LERNZIEL ETHIKFÄHIGKEIT Der Begriff "Ethikfähigkeit" wird von Fuchs (1987) formuliert in einem Vortrag anlässlich der Konferenz "Medizinische Ethik - wie funktioniert denn das?", eingeladen von der Evangelischen Akademie Loccum; diese Tagung bedeutete insofern einen Markstein, als mit ihr in Deutschland zum ersten Mal, weitaus später als in der Mehrzahl der übrigen europäischen Länder und vor allem in den USA (zum Stand in den USA, siehe auch Allert, 1989), die Fragen und Probleme der Aus- und Weiterbildung des Querschnittbereiches Ethik in der Medizin grundlegend diskutiert wurden. Einleitend greift Seidler in seinem Geleitwort diesen Begriff implizit auf indem er formuliert: "Lernen und Erfahren ethischer Probleme in der Medizin beruhen daher auf der Fähigkeit des einzelnen, diese wahrzunehmen und gewissensfähig zu werden. Alle am Patienten Handelnden ....müssen rechtzeitig dafür sensibel gemacht werden." Seidler fährt dann im kritischen Hinblick auf die LehrLernsituation in Deutschland resümierend fort: "... die entsprechenden Informations- und Ausbildungsstrukturen dafür zu finden, ist eine in der bundesdeutschen Situation noch ungelöste und schwierige Aufgabe". "Erziehung zur Ethikfähigkeit. Verantwortung für die medizinische Ausbildung" überschreibt Fuchs seinen Artikel mit deutlicher Akzentuierung der konkreten Aufgaben, die 4 sich den Institutionen und der in ihnen Lehrenden stellt. Der dann folgende Text enthält zwar keine systematische Auflistung dessen, was in dem Konstrukt "Ethikfähigkeit" detailliert an Wissen (knowledge), an Fertigkeiten bzw. Fähigkeiten (skills) und Einstellungen, Werten (attitudes, beliefs, values) enthalten sein soll. Doch finden sich im Text an vielen Stellen (S. 28-30) entsprechende Begriffe und Formulierungen, die als Lernziele zu verstehen sind: Erklärung, Verantwortung und Herausforderung des eigenen Wertesystems der Studierenden; das Denken in komplexen Zusammenhängen; Förderung der Analyse- und Entscheidungskompetenz; genannt werden des weiteren als konkrete Lernziele das Einüben affektiver und kognitiver Fähigkeiten und Fertigkeiten wie aufmerksames Beobachten, hellhöriges Aufnehmen, einfühlsames Verstehen von Ängsten und Sorgen der Patienten, Nutzung des ärztlichen Gesprächs als diagnostisches und therapeutisches Instrument, Fähigkeit Verantwortung zu übernehmen, Umgang mit der eigenen Hilflosigkeit. Implizit vertritt somit Fuchs wie wohl die Mehrzahl der Autoren des Tagungsberichtes die Auffassung, dass es nicht Aufgabe und Ziel der Ethikausbildung sei, den Studierenden eine theoretische Moralphilosophie zu vermitteln; Ziel müsse es vielmehr sein, eine praxisorientierte und praxisnahe Förderung medizinethischer Kompetenz in Gang zu setzen und zu trainieren, wobei unterstellt wird, dass im Grunde jeder Studierende die Voraussetzungen hierfür mitbringt. Auch andere Autoren beschreiben das Lernen in Bezug auf Medizinethik als vielschichtigen Faktor, der in der medizinischen Aus- und Fortbildung geübt werden muss. Kahlke u. Reiter-Theil (1995) regen an, die Studierenden für die Ethik zu sensibilisieren, eigenständiges Orientieren sowie Entscheidungs- und Handlungskompetenz zu vermitteln. Sass (1996) beschreibt die vielfältigen Wege und Hilfsmittel wie Medizinethik in die Ausund Fortbildung der Ärzteschaft integriert und durchgeführt werden kann; er nennt hier als unverzichtbar unter anderem die Fallstudien. Die von vielen Autoren geforderten Fähigkeiten, die im Rahmen des Ethikunterrichtes vermittelt werden sollen, sind auch in anderen Fachbereichen als sog. Schlüsselqualifikationen beschrieben (vgl. hierzu Kaiser 1992). DIE FÄLLE UND IHRE ERZÄHLUNGEN Eine 75jährige Dame wird während eines Besuchs bei einer eng befreundeten Nachbarin plötzlich bewusstlos. Die Nachbarin benachrichtigt telefonisch den Notdienst. Dieser trifft schon nach 7 Minuten ein; die Patientin ist weiterhin bewusstlos, sie atmet flach. Was ist zu tun? Wie geht es weiter? 5 So könnte, in kürzester Form, eine Fallgeschichte formuliert sein, die ein Notarzt als Referent in einem Ethikseminar vorträgt; es könnte auch ein sog. paper-case sein, der in seiner scheinbaren Unkompliziertheit eine schnelle Entscheidung fordert, zu der etwa in einer mündlichen Prüfung eine solche ad-hoc-Entscheidung vom Prüfling erwartet und provoziert wird. Diese Fallgeschichte kann auch anders erzählt werden: Die besonderen Umstände, die bekannte Vorgeschichte; die erreichbaren oder nicht erreichbaren Angehörigen; die angeblich irgendwo liegende Patientenverfügung; das Reden mit der Freundin über das Sterben und die dem Sterben vorausgehenden besonderen Umstände, das darüber vorhandene Wissen und Nichtwissen; der erreichbare (oder nicht erreichbare) Hausarzt; die vorhandenen und die neu erhobenen Befunde, die Diagnosen und Prognosen; die kontroversen Meinungen darüber, was zu tun und was zu unterlassen sei. Nach jeder Frage, deren Antwort eine Entscheidung erfordert - etwa nach der Entscheidung des Notarztes eine Behandlung einzuleiten und den Transport in die Klinik zu veranlassen - immer dann beginnt eine neue Geschichte mit neuen Fragen, Problemen und neuen Personen, die an den folgenden Entscheidungen beteiligt sind. Solcherart sind die Erzählungen über die Fälle, wie sie zum Alltag der Patientinnen und Patienten, der Ärztinnen und Ärzte, der Pflegekräfte und nicht zuletzt den Angehörigen in der Klinik und in der Arztpraxis gehören (siehe hierzu Hunter 1991). Dann sind auch die Klinikverwaltungen mittelbar an vielen dieser Entscheidungen und ihren Folgen beteiligt, die Versicherungsunternehmen als die Finanzierungsquellen, letztlich auch die Arzneimittelhersteller und - distributoren, kurz: der ganze medizinisch-industrielle Komplex hat mittelbaren und unmittelbaren Einfluss auf die Entscheidungen der Patienten, ihren Angehörigen, der Ärzte und Pflegenden, der Verwaltungen und Organisationen. Allen diesen Entscheidungen gehen immer Abwägungsprozesse voraus, sie laufen in der alltäglichen Praxis mehr oder (meist?) minder bewusst und rational ab. In diese Abwägungsprozesse gehen medizinische Fakten und ihre Bewertung sowie die Auswahl/Selektion und Bewertung naturwissenschaftlichen Wissens ein; persönliche Wertvorstellungen aller Beteiligten, aber auch institutionelle sowie gesellschaftliche und allerlei Standesnormen werden mehr oder weniger bewusst in die Entscheidungsprozesse verwoben (vgl. hierzu beispielhaft Allert et al. 1998). ÜBER DIE KOMPLEXITÄT DER FÄLLE UND ENTSCHEIDUNGSSITUATIONEN Erinnert werden wir angesichts der komplexen Mehrdimensionalität solcher Entscheidungsstrukturen an die hellsichtige Diagnose, die Jonsen (1994) formuliert hat: "...in moral discourse, problems are not at all like the elegantly clean lines of a mathematical 6 problem. They are rather messy concoctions of many details, some salient, others obscure, but all calling for attention. A moral problem is rather like a detective story in which the details, the facts of the case, are crucial." (S. 16). Die Struktur der dann anschließenden Prozesse einer ethischen Analyse und Entscheidungsfindung beschreibt Jonsen mit milder Ironie anhand dieser Detektivmetaphorik wie folgt: "The great detectives of fiction rarely invoke principles; they stalk clues. At the end, however, they can, sometimes with wondrous ingenuity, relate the clues to principle. Thus, the problem of clinical ethics is how to view the principles in the light of the multiple details of particular cases." (S. 16). Viel spricht dafür, dass die hier von Jonsen angesprochene Komplexität medizinischer und medizin-ethischer Entscheidungen und Entscheidungsprozesse im Verlauf individueller Krankengeschichten den allgemeinen und nicht den Sonderfall beschreibt. Insbesondere aber ist zu erwarten, dass die Entwicklungen der modernen Medizin, wie sie in den letzten Jahren zu beobachten sind, diese Komplexität nicht nur noch vergrößern werden; die Vermutung ist realistisch, dass diese Zunahme an Problemkomplexität sehr viel eher die Regel als die Ausnahme sein wird. Es wird, so zeichnet es sich ab, eine Komplexität sein, in der die Zahl der nicht nur denkbaren sondern auch schon realisierbaren Entscheidungsmöglichkeiten zunimmt (jetzt schon erkennbar zugenommen hat); die Ziele und die Wege zu diesen Zielen werden vielfältiger, kontroverser und mit unterschiedlichen, häufiger unscharf erkennbaren Werten und Risiken verbunden sein. Die Teilnehmer an diesen Entscheidungsprozessen werden in Abhängigkeit von ihren individuellen Wertkonzepten (diskursiv oder monologisch, intentional oder unbewusst) nicht nur unterschiedliche Ziele und unterschiedliche Wege zu diesen Zielen wählen können; sie werden auch in diesen Entscheidungsprozessen interagieren, ihre Interaktionen werden bestimmt sein von rationalen und irrationalen Erfahrungen, von Ängsten, Sympathien und Antipathien, von Vorurteilen, Zynismen, Abwehrmechanismen, Niederlagen und Versagen, geglückten und missglückten Entscheidungen - ganz generell von Lernerfahrungen aus früheren und vielleicht sehr frühen Begegnungen mit komplexen Problemen und Entscheidungsdilemmata. Cohen, March und Olsen (1972) haben schon früh nachgedacht über die von ihnen so genannte organisierte Anarchie in solchen komplexen und unübersichtlichen Entscheidungssituationen, sie schlagen hierfür ein sehr bildhaftes Modell vor: "... one can view a choice opportunity as a garbage can into which various kinds of problems and solutions are dumped by participants as they are generated. The mix of garbage in a single can depends on the mix of cans available, on the labels attached to the alternative cans, on what garbage is currently being produced, and on the speed with which garbage is collected and 7 removed from the scene" (S. 2). (Gute Literaturübersicht über "Decision Making and Problem Solving in Nursing" bei Baumann und Deber (1989); dort auch Erörterung des Garbage-CanModel in medizinischen Entscheidungsprozessen; vgl. hierzu auch Roth (1995) im Kapitel Problem-Solving in Garbage Cans (S. 104) sowie Olsen (1973)). Das Garbage-Can-Model finden die Autoren vor allem in solchen Organisationen realisiert, in denen die Entscheider häufig wechseln, in denen die Interessen der jeweils wechselnden Entscheider variieren und/oder mehr oder minder undurchsichtig sind und den Entscheidungsprozess mitbestimmen, in denen hierarchische Abhängigkeiten eine wesentliche Rolle im Entscheidungsprozess spielen, in denen die Zielvorstellungen individuell stark variieren, die Entscheidungen unter Zeitdruck getroffen werden müssen, die Zahl der Variablen (Fakten, Ziele, Interessen, Interessenten, Werte usw.) undurchsichtig ist. Cohen et al. finden diese Merkmalskonstellation, die typisch ist für das Garbage-Can-Model, vor allem in Universitäten und ihren Gremien realisiert. Baumann und Deber orten das Garbage-Can-Model: "In medicine and nursing this model has potential application to critical care, which indeed characterized by busy employees in a fluid situation and by considerable uncertainty." (S. 3). Das Garbage-Can-Model reduziert Komplexität mehr oder minder unkontrolliert; es begegnet uns noch immer und auch immer wieder in der alltäglichen ärztlichen/klinischen Praxis. Mehrfach war es in unseren Seminaren ein lehrreiches Beispiel dafür, welche Folgen die Vernachlässigung nicht erkannter oder scheinbar unwichtiger Details haben kann. Die sequenzierte Fallanalyse mit ihrer betont aktiven Beteiligung der Lernenden folgt der Konzeption, wie sie bildhaft Jonsen formuliert hat, wenn er die komplexe moralische Problematik vergleicht mit einer Detective Story, in welcher die Vielzahl der Details und der Fakten entscheidend ist: die Lernenden portionieren und linearisieren die verwickelten Einzelheiten und die komplexen Strukturen des Falles, indem sie in einzelnen analytischen Schritten diskursiv jede Sequenz bearbeiten und dabei ihr eigenes Wertsystem reflektierend in Bezug setzen zu den erkennbaren oder vermuteten Wertsystemen der Patienten, Ärzte, Pflegekräfte, Angehörigen usw. Widersprüche und Unsicherheiten der Situation und der Bewertungen werden hierdurch offen gelegt, sie beeinflussen damit nicht mehr unerkannt den Entscheidungsprozess. Hilfreich ist bei diesem analytischen Lernprozess zum einen die betont supportive und zugleich zurückhaltende Assistenz der Lehrenden. Bewährt hat sich als technische Hilfe in diesem sequenzierten Lernprozess neben den allen Beteiligten ausgehändigten Materialien auch der Bochumer Arbeitsbogen (Sass, Viefhues 1988) vor allem deshalb, weil er mit seiner Fülle von Fragen den analytischen Prozess fördert und aufzeigt, dass medizinethische und 8 medizinisch-naturwissenschaftliche Fragen zusammengehören (siehe hierzu auch Seedhouse, 1998). In der Anwendungspraxis erweist es sich deshalb als sinnvoll, entsprechend der Sequenzierung des Falles mehrfach den Schritt von den medizinischen Fakten zur ethischen Bewertung zu wiederholen. Denn wie oben schon mehrfach betont, müssen in der Regel in einem Fall nach jeder wichtigen Entscheidung die neuen medizinischen Fakten erneut bewertet werden, "nach jeder Entscheidung beginnt eine neue Geschichte" (Luhmann 1996). Sehr verkürzt könnte somit eines unserer zentralen Lernziele dahingehend beschrieben werden, dass das Garbage-Can-Model in seiner verallgemeinernden Form des "Schnellschusses aus der Hüfte" lernend abgelöst wird durch ein Entscheidungsmodell hoher Komplexität, das wir im internen Jargon das "messy concoctions" oder "Detektiv-Modell" genannt haben. 2. DIE FALLMETHODE UND DIE SEQUENZIERTE FALLSTUDIE "Hierbei bearbeiten Lerner einzeln oder in Gruppen in Akten rekonstruierte Praxisfälle, um sich Wissen über die betreffende Praxis anzueignen und ihre Urteils- und Entscheidungsfähigkeit auszubilden" (Flechsig, 1996, S. 63). Diese allgemeine Definition, dem entsprechenden Kapitel aus seinem kleinen Handbuch didaktischer Modelle vorangestellt, enthält Lernziele, die auch für die von uns erprobte "sequenzierte Fallstudie" zutreffen: Aneignung von Wissen und Ausbildung der Urteils- und Entscheidungsfähigkeit. Flechsig gliedert das Modell nach mehreren Schnittlinien auf; wir verwenden dieses Gliederungsschema im folgenden Text und erweitern die Inhalte, da die von uns entwickelte sequenzierte Fallstudie zum einen den Lernzielkatalog erweitert und, damit zusammenhängend, sowohl im Setting als auch im Ablauf das klassische Modell der Fallmethode variiert (siehe hierzu auch die bei Flechsig auf S. 68 und 69 erwähnten Varianten). DIE DIDAKTISCHEN PRINZIPIEN DER SEQUENZIERTEN FALLSTUDIE SIND • Praxisnahes Lernen, d.h. Lernen an konkreten Beispielen, die nicht aus Akten (z.B. geschriebenen Krankengeschichten) entnommen sind, sondern von unmittelbar Beteiligten vorgetragen werden; • Lernen, mit komplexen Sachverhalten umzugehen: Erkennen und Analysieren der Komplexität/der "messy concoctions....." Ordnen und zeitliche Abfolge des Entstehens der Komplexität rekonstruieren 9 • Problemlösendes Lernen, d.h. Lernen an Beispielen mit offenen Entscheidungsalternativen • Lernen im Diskurs mit anderen Lernenden LERNAUFGABEN BEI DER SEQUENZIERTEN FALLSTUDIE Die Lerner werden dazu animiert und angeleitet, • im Diskurs miteinander schrittweise Probleme und Entscheidungsnotwendigkeiten zu erkennen und zu formulieren, • Optionen, Entscheidungen und Lösungen für die jeweilige Situation zu finden, zu begründen und zu präsentieren, sowie • im Zusammenwirken mit den Fallreferenten die vorgeschlagenen/gefundenen Lösungen und Entscheidungen mit den tatsächlich getroffenen Entscheidungen zu vergleichen. KOMPETENZEN Die sequenzierte Fallstudie ist zunächst auf die Entwicklung von eher unspezifischen Handlungs- und Entscheidungskompetenzen gerichtet; hinzu kommen ethik-spezifische, aber auch mehr unspezifische Kompetenzen, wie die schon eingangs ausführlicher erörterte Ethikfähigkeit, die ihrerseits ein komplexes Konstrukt von ethik-unspezifischen und ethikspezifischen Kompetenzen darstellt (hierher gehören u.a. die Reflexion über das eigene Wertsystem und die Fähigkeit, über das eigene und die Wertsysteme der Anderen zu kommunizieren). Spezielle Sachkompetenzen (u. a. Methoden des Umgangs mit rechtlichen Normen und Vorschriften, mit Standesnormen, mit unterschiedlichen ethnischen und religiösen Wertsystemen) müssen von Fall zu Fall angesprochen werden. DIE SEQUENZIERTE FALLSTUDIE ALS DIDAKTISCHES MODELL GLIEDERT SICH WIE FOLGT: Die Vorbereitungsphase umfasst folgende Schritte: • Die Suche nach einem Fallreferenten, der aus seinem Arbeitsbereich einen passenden Fall präsentieren kann. Als Fallreferenten kommen Ärztinnen, Ärzte, Pflegekräfte, gelegentlich auch Studierende höherer Semester, Seelsorgerinnen/Seelsorger sowie Patientinnen/Patienten in Frage. Der Aufbau eines Netzwerkes von Referenten, die schon mehrfach diese Rolle übernommen haben und die bereit sind, mehr oder minder regelmässig zur Verfügung zu stehen, erleichtert die am Anfang meist zeitaufwendige Suche. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass der Aufbau eines derartigen Netzwerkes etwa 10 drei bis vier Jahre erfordert. Eine weitere wichtige Erfahrung hängt eng damit zusammen: erfahrene Referentinnen/Referenten wirken ihrerseits im jeweiligen Arbeitsbereich in Richtung einer Veränderung des Arbeitsklimas, z. B. auf der Station. • In der Vorbesprechung ca. zwei Wochen vor dem Seminartermin wird mit den jeweiligen Fallreferenten der Fall und das Prozedere detailliert besprochen. Besprechungspunkte sind insbesondere die eingehende Erörterung des Falles und seiner Präsentation, die Vereinbarung der Spielregeln und der Aufgaben: der Referent ist Berichterstatter, nicht Dozent und Prüfer, er/sie gibt keine Werturteile ab über den Fall, urteilt nicht über Aussagen/Wertungen/Verhalten der Studierenden. Spielregeln gelten für alle Teilnehmenden; sie werden mit den Fallreferenten in der Vorbesprechung und mit den Seminarteilnehmenden zu Beginn eines Seminars diskutiert; wir erbitten ihre Zustimmung, manchmal erinnern wir während des Seminars an die Spielregeln, aber nur sehr selten ist dies erforderlich. Dies sind die Spielregeln: Jede Person wird respektiert, Jede/jeder hat gleiche Rechte. Es können jederzeit Fragen gestellt werden, es gibt keine „dummen“ Fragen. Bei der Falldiskussion am Fall bleiben! Zuhören können. Für den Fallreferenten gilt zusätzlich: Nicht dozieren, nicht abfragen! Keine vorschnellen Werturteile äußern. Die Moderatoren bemühen sich um Geduld und Aufmerksamkeit. Nicht tadeln! Die Referenten werden ersucht, den Fallbericht in einem betont narrativen Stil zu präsentieren, abstrakte Verkürzungen und Vereinfachungen des Falles sollen vermieden werden, desgleichen formale Strukturierungen, mit denen der Fallreferent den Studierenden die Analyse erleichtern will. Die Referenten werden vorab unterrichtet über den formalen und zeitlichen Ablauf und über die Rolle der Moderatoren (s. u.). • In die Vorbereitungsphase gehören auch die Besetzung und die Einweisung der übrigen Rollen: Moderatoren, Hilfskräfte, teilnehmende Beobachter und Gäste sowie die technischen Vorbereitungen: Bereitstellen/Anfertigung der Arbeitsmappe (s. Anhang), 11 Vorbereitung der Räume und der Technik (Raumreservierung, Bestuhlung im Kreis, Tageslichtprojektor, Tafel, Namensschilder und Bewirtung, Vorbereitung der Evaluationsbögen usw.). • Im weiteren Sinne gehört zur Vorbereitungsphase auch das Moderatorentraining; die Rolle der Moderatoren sei hier in Kürze beschrieben: Es hat sich als zweckmäßig erwiesen, dass zwei Moderatoren das Seminar begleiten. Ihre Aufgaben sind vielfältig: ständige begleitende Aufmerksamkeit, stets supportives Verhalten; die Moderatoren regen an, ohne direktiv zu sein; sie organisieren unaufdringlich die Redefolge, sie sind besorgt um einen angst- und "herrschaftsfreien" Umgangston; sie mischen sich nicht in die Sachdiskussion ein, sie halten Distanz und sind zugleich immer in das Geschehen eingebunden, sie sind kognitiv sowie affektiv wach und präsent. Im Zusammenwirken mit den Seminarteilnehmern unterbrechen sie den Fallreferenten in seinem Bericht an solchen Stellen, an denen Entscheidungen bzw. Konflikte erkennbar sind; sie unterbrechen den linearen Ablauf dann, wenn Entscheidungen zweckmäßigerweise in kleineren Gruppen diskutiert, Optionen definiert und Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln sind. Derartige Unterbrechungen sind auch dann sinnvoll, wenn der Teilnehmerkreis in seiner Mitwirkung sich stark asymmetrisch entwickelt, wenn einige Teilnehmer im Diskurs stark dominieren und andere Teilnehmer sich daraufhin betont zurückhalten. Außerdem stehen die Moderatoren als Ethikexperten zur Verfügung, wenn Seminarteilnehmer solche Auskunft einfordern. Als Antwort werden etwa folgende Fragen an die Lernenden zurückgegeben: um welche Konflikte handelt es sich, welche Entscheidungen stehen an, welche Handlungsoptionen gibt es? Wer muss entscheiden und wer soll an den Entscheidungen mitwirken? Was sind die Wünsche und die Willensäußerungen der Patienten, der Angehörigen, des Pflegeteams, des Ärzteteams, welche Prinzipien/Regeln usw. sind tangiert? Hierbei hat es sich als sehr zweckmäßig erwiesen, dass die Lernenden in ihren Arbeitsunterlagen, die jedem von ihnen ausgehändigt wurden, auch den Bochumer-Arbeitsbogen vorfinden; die obigen Fragen und eine Fülle weiterer derartiger Fragestellungen sind in diesem Arbeitsmittel enthalten. An geeigneter Stelle des Diskurses wird auf dieses Hilfsmittel verwiesen. Die Moderatoren sind besorgt, dass der Diskurs immer wieder auf den konkreten Fall bezogen wird und Abschweifungen ins Allgemeine alsbald zurückgeführt werden auf den konkreten Fall; den Moderatoren sind die Lernziele präsent, sie lenken den Diskurs im- 12 plizit, manchmal auch explizit auf diese Lernziele hin. Dabei achten sie darauf, dass sie soweit wie immer möglich nondirektiv bleiben. • Festzulegen sind vorab die Teilnehmerzahl und der Zeitumfang: Eine maximale Gruppengröße von insgesamt 20 Personen sollte nicht überschritten werden. Darin sind enthalten ein bis zwei Fallreferenten (Ärzte, Schwestern, Patienten usw.), ein bis drei Moderatoren und maximal 15 Teilnehmer/Teilnehmerinnen. Der Zeitumfang sollte nicht zu knapp bemessen werden. Als zweckmäßig hat sich erwiesen, an einem Wochenende (Freitagabend und Samstagvormittag) insgesamt acht bis neun Stunden bereitzuhalten, in denen zwei Fälle bearbeitet werden. Für eine sequenzierte Fallstudie sind 3 bis 3 ½ Stunden zu veranschlagen. Geübte Gruppen, die schon mehrfach derartige Fälle bearbeitet haben, kommen mit 2 bis 2 ½ Stunden aus, wenn der Fall nicht ungewöhnlich kompliziert gelagert ist. Die Durchführungsphase lässt sich grob gliedern in drei Phasen, die nicht nur einmal aufeinander folgen, sondern vielmehr in einem zirkulären Prozess sich mehrfach wiederholen: In den Rezeptionsphasen bearbeiten die Lerner das Fallmaterial, interpretieren den Fall und beschaffen sich zusätzliche Informationen; in Interaktionsphasen werden ggf. kleinere Lerngruppen gebildet mit unterschiedlichen Aufgaben und mit unterschiedlichen Rollen; Lösungsmöglichkeiten werden durchgespielt und kritische Entscheidungsdiskurse können in improvisierten Rollenspielen geführt, Optionen definiert und probehalber Entscheidungen gefällt werden. In der Bewertungsphase werden die einzelnen Lösungen aus den Kleingruppen vorgestellt und diskutiert; am Ende dieser Phase wird die konkrete Lösung des Falles vom Fallreferenten vorgestellt und im Plenum erörtert. ROLLEN DER LERNER Die Lerner, in erster Linie sind dies die Studierenden, versetzen sich in diesem didaktischen Modell immer wieder in die Rolle von real handelnden Personen bzw. Entscheidungsträgern, wobei sie wissen, dass sie von den Zwängen sowie von der Verantwortung realer Handlungsträgerschaft entlastet sind. Lerner müssen dabei in der Lage sein, komplexe Zusammenhänge zu überblicken und sich selbständig Informationen zu beschaffen. Wichtig erscheint uns vor allem im Nachhinein, dass auch die Fallreferenten und die Moderatoren Lerner waren und sind; in diesem Sinne ist etwa die Rückmeldung einer Fallreferentin zu bewerten, die einmal bemerkte, dass sich auf ihrer Station etwas verändert habe, seit sie in den Seminaren mit den Studierenden intensiv ihre Problemfälle diskutierte. 13 Zusammenfassend gibt das nachfolgende Schema einen abstrakten Überblick über Struktur und Ablauf einer sequenzierten Falldiskussion, rekonstruiert aus einem Ethikseminar mit Erstteilnehmern. Begrüßung der Teilnehmenden, Vorstellung der Veranstalter, des Fallreferenten und des Arbeitskreises “Ethik in der Medizin” der Universität Ulm. Die Anredeformen werden vereinbart, Namensschilder und Arbeitsmappen für die Teilnehmenden werden ausgeteilt. Erläuterungen zum Ablauf des Seminars: zeitlicher Ablauf, struktureller Ablauf. Die Spielregeln, die für das Seminar gelten sollen, werden besprochen. Kurze Einführung in die Ethik mit Hilfe der Arbeitsmappe, die jeder Teilnehmer in Händen hat: Definition, Konfliktfelder in der Medizin, Hinweis auf ethische Prinzipien, Tugenden, Pflichten, Einführung in die Komplexität der Fälle, Interessenskonflikte in der konkreten Entscheidungssituation. Erläuterung der Hilfsmittel zur Analyse und Lösung von medizinethischen Konflikten (Bochumer Arbeitsbogen usw., befinden sich in der Arbeitsmappe). Chronologische Fallvorstellung durch den Referenten. Unterbrechungen durch die Teilnehmenden zur Klärung von Verständnisfragen. Erste Entscheidungssituation in der Fallgeschichte. Unterbrechung der Fallvorstellung durch die Moderatoren. Situationsanalyse, unter Verwendung der Arbeitsmappen: - Klärung der medizinischen Sachfragen. - Klärung der medizinethischen Sachfragen und Konflikte. Diskussion der ersten Entscheidungssituation. - Erarbeitung der bekannten Sichtweisen und Beurteilungen der am Fall beteiligten Personen. - Erarbeitung der Sichtweisen und Beurteilungen der Teilnehmenden. - Entwicklung von Entscheidungsoptionen. - Begründung der Optionen und Versuch der Konsensfindung. (Je nach Gruppenkonstellation und Diskussionsfreude der Teilnehmenden wird diese Phase in Kleingruppen durchgeführt, die Ergebnisse werden der Gesamtgruppe vorgetragen oder mit Hilfe eines kurzen Rollenspiels vorgestellt.) Bericht des Fallreferenten, wie im konkreten Fall an dieser Stelle entschieden wurde. 14 Diskussion der getroffenen Entscheidung, Begründung der Entscheidung. Fortsetzung der Fallvorstellung durch den Referenten. Unterbrechung durch die Teilnehmenden zur Klärung von Verständnisfragen. Je nach realem Fallverlauf kann die Fallgeschichte in mehrere solcher Sequenzen aufgeteilt werden. Entscheidungssituation am Ende des Falles Situationsanalyse: - erneut Klärung der medizinischen Sachfragen. - erneut Klärung der medizinethischen Sachfragen Diskussion der Entscheidungssituation. - Die im Fall schon getroffenen Entscheidungen werden retrospektiv nochmals durchleuchtet und ihre Bedeutung für die jetzige Situation durchdacht. - Entwicklung von Entscheidungsoptionen, Begründung der Optionen und Versuch der Konsensfindung. (Je nach Gruppenkonstellation und Diskussionsfreude der Teilnehmenden wird diese Phase in Kleingruppen durchgeführt, die Ergebnisse werden der Gesamtgruppe vorgetragen oder mit Hilfe eines kurzen Rollenspiels vorgestellt.) Bericht über den aktuellen Stand oder über den Ausgang des Falles. Besprechung der eigenen subjektiven Betroffenheit. Analyse und Diskussion der im Fall getroffenen Entscheidung. Beurteilung des Fallverlaufs und der im Fall getroffenen Entscheidungen anhand von ethischen Prinzipien, Normen und einer Folgenabschätzung (Schema: The moral event v. Pellegrino). Zusammenfassung der Problematik durch die Moderatoren. Evtl. Vertiefung der Spezialproblematik (z.B. Sterbehilfe oder Informed Consent). Abschlussbemerkungen der Teilnehmenden, des Referenten und der Veranstalter. EINE REALE FALLDISKUSSION Im Rahmen des Projektes "Ethik in der Medizin in frühen Phasen des Medizinstudiums", gefördert vom Ministerium für Wirtschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg, wurde das Modell der sequenzierten Falldiskussion für Studierende der Medizin weiterentwickelt. Dabei wurde die folgende Falldiskussion in einem Wochenendseminar während des Sommersemesters 1995 durchgeführt: 15 Da es sich in diesem Seminar um eine Gruppe von Erstteilnehmenden handelte, wurde das Seminar mit einer Einführung begonnen; im nachfolgenden Ablaufprotokoll wird auf die Darstellung der Einführung verzichtet. Die Falldiskussion wurde mitprotokolliert, das ursprüngliche Protokoll wurde zur besseren Lesbarkeit überarbeitet, gekürzt und anonymisiert. Beginn der Fallvorstellung durch den Fallreferenten: Die Moderatoren beobachten aufmerksam das Gruppengeschehen und regeln die Wortmeldungen. Fallreferent Studierende Der Fallreferent ist seit 4 Jahren Assistenzarzt in der Inneren Medizin. Seit 2 Jahren ist er auf einer onkologischen Station. Er wurde vor 6 Monaten zu einer konsiliarischen Beratung in die Chirurgische Klinik gerufen. Ein Patient, 45 Jahre alt, wurde dort wegen heftiger Hüftgelenkschmerzen operiert und es wurde ein entdifferenziertes Rhabdomyosarkom am Oberschenkel in der Nähe des Hüftgelenks festgestellt. Das Rhabdomyosarkom ist ein bösartiger Tumor, der vom Muskelgewebe ausgeht; "entdifferenziert" bedeutet, dass dieser Krebs den ursprünglichen Muskelgewebszellen nicht mehr sehr ähnlich ist. Vor 10 Jahren hatte der Patient Schmerzen in der Hüfte. Es wurde eine Zyste im Hüftgelenkskopf festgestellt, die operativ entfernt wurde. Ca. 5 Jahre war der Patient schmerzfrei, dann traten wieder Schmerzen auf. Der Hausarzt diagnostizierte eine massive Abnutzung im Hüftgelenk und überwies den Patienten in eine orthopädischen Klinik. Dort wurde ein künstlicher Hüftgelenkskopf eingesetzt. Die Vorerkrankungen steht in keinem Zusammenhang mit der jetzigen Erkrankung. Die Zyste befand sich im Knochengewebe und die Operation wurde am Oberschenkelknochen durchgeführt. Das Rhabdomyosarkom entstand im Muskelgewebe, somit aus einem anderen Gewebetypus. Zwischenfrage zum Krankheitsbild “Was ist ein Rhabdomyosarkom?" Mehrere Fragen zur Krankengeschichte Zwischenfragen, ob die Vorerkrankungen Risikofaktoren für die jetzige Erkrankung sein können. In der Chirurgischen Klinik wird nun an den Fallreferenten die Frage gestellt, ob der Patient zu einer Chemotherapie in die Internistische Abteilung verlegt werden könnte. Unterbrechung der Fallvorstellung und Strukturierung der Diskussion durch die Moderatoren: - Abklärung der medizinisch naturwissenschaftlichen Fragen. - Analyse der medizinethischen Befunde - Entwicklung und Begründung einer Entscheidung. 16 Fallberichterstatter Studierende Der Patient hat nach der Operation bei anschließender Chemotherapie und Bestrahlung eine 20%ige Heilungschance. Er hat ein Risiko von 80 %, dass er ein Rezidiv bekommt und nicht geheilt wird. Aus dieser Risikogruppe, die ein Rezidiv entwickeln, leben nach 5 Jahren noch 30 %. Die Nebenwirkungen einer Chemotherapie sind Übelkeit, Haarverlust, Infektionsanfälligkeit, Durchfall, Schädigung der Schleimhäute. Diese Nebenwirkungen können sehr mild verlaufen, jedoch auch sehr heftig, sie können zum Tod des Patienten führen. Dies ist vor der Chemotherapie nicht voraussagbar. Bei Nichtbehandlung wird der Patient in nächster Zeit versterben. Der Patient hat bereits Lymphknotenmetastasen in der Leiste und im kleinen Becken. Die onkologische Station ist eine Spezialabteilung für Krebserkrankungen und hat den höchsten Standard für Krebspatienten zu bieten. Fragen zur Prognose des Patienten. Der Fallreferent hat die Information von seinem Kollegen aus der Chirurgie, dass der Patient aufgeklärt sei und sieht somit keinen Grund, den Patienten über seinen Kenntnisstand zu befragen. In der ersten Begegnung mit dem Patienten wird über die Verlegung in die Innere Medizin diskutiert. Der Patient ist zuversichtlich, obwohl er Schmerzen nach der Operation hat und die Wunde schlecht heilt. Über die Familie wird zu diesem Zeitpunkt nicht gesprochen. Der Patient möchte so schnell wie möglich eine Therapie. Fragen zum Kenntnisstand Patienten über seine Erkrankung. Fragen zu Nebenwirkungen sowie Chancen und Risiken der Chemotherapie Fragen zur Tumorausbreitung Fragen zur technischen Ausstattung und Erfahrung der Mitarbeiter der Klinik. des Fragen zur psychischen Verfassung des Patienten Fragen zum familiären Umfeld. Fragen zum Wunsch des Patienten Allgemeine Zustimmung zur Verlegung mit den Argumenten: - Empfehlung der Experten Patientenwunsch - Spezialzentrum Gruppenmeinung: einzige Überlebenschance für den Patienten Bedingungen für die Verlegung wurden nicht gestellt. Für die Chemotherapie wurde von der Gruppe jedoch gefordert, dass der Patient vor der Durchführung vollständig aufgeklärt wird, eventuell auch seine Angehörigen. Die Entscheidung erfolgt zum Wohl des Patienten, im Interesse des Patienten und der Ärzte, jedoch muss das Risiko der Chemotherapie in Kauf genommen werden. 17 Die Moderatoren leiten zur Fortsetzung der Fallschilderung über. Fallberichterstatter Der Patient wird nach Rücksprache mit den Oberärzten der chirurgischen und internistischen Stationen in die Innere Medizin verlegt. Ab diesem Zeitpunkt ist der Fallreferent der behandelnde Arzt. Es erfolgt am Tag der Verlegung ein ausführliches Gespräche mit dem Patienten. Er ist sehr aufmerksam, kann sehr differenziert seine Wünsche darstellen und weiß um die Risiken der Chemotherapie. Jedoch will er zu diesem Zeitpunkt nur an seine Heilung glauben. Die Chemotherapie wird angeordnet und kann nun am gleichen Tag schon beginnen. Studierende Frage, ob der Patient nun über seine Erkrankung vollständig aufgeklärt wurde. Die Moderatoren unterbrechen die Fallschilderung für intensiven Diskurs in der Gruppe. Der Patient ist verheiratet und hat zwei Kinder (12 und 14 Jahre alt) Seine Ehefrau war am Tag der Verlegung noch nicht beim Patienten und somit dem Behandlungsteam nicht bekannt. Der Patient nimmt von einem Heilpraktiker Medikamente ein, die keinen Einfluss auf die Chemotherapie haben. Es werden keine weiteren Behandlungsalternativen angeboten, da nach Prüfung der neuesten Literatur, für diesen Patienten eine Chemotherapie die beste Chance bietet. Die Station lehnt die zusätzlichen Medikamente vom Heilpraktiker nicht ab. "Viele Patienten nehmen bei einer Krebserkrankung zusätzlich Vitamine oder homöopathische Mittel." Fragen und Diskurs zu folgenden Themen: Warum Entscheidung zur Chemotherapie so schnell? Gibt es Alternativen? Wieviel Bedenkzeit hatte der Patiert? Wurde die Familie einbezogen? Fragen zum familiären Umfeld des Patienten. Fragen zu Möglichkeiten der Alternativmedizin Frage zur Akzeptanz des Behandlungsteams. Über die Aufklärung und Zustimmung des Patienten zur Chemotherapie erfolgte eine längere Diskussion. Konsens in der Gruppe zu: Behandlung nur mit Zustimmung des Patienten. Dissens in der Gruppe: Radikalität der Aufklärung, Verschweigen von Tatsachen, Hoffnungen zerstören. Skepsis in der Gruppe über Fähigkeiten der Ärzte, gute Aufklärungsgespräche zu führen. 18 Zeitdruck in der Klinik. Einige Gruppenmitglieder würden die Therapie erst nach einer gemeinsamen Rücksprache mit dem Patienten und der Ehefrau beginnen. Begründung: Kenntnisstand des Patienten muss nochmals überprüft werden “hat er alles verstanden?”. Voraussetzung zum Informed Consent. Fortsetzung der Fallschilderung. Fallberichterstatter Studierende Der Patient willigt sofort in eine Chemotherapie ein, am Abend nach der Verlegung aus der Chirurgischen Klinik wird mit der Chemotherapie begonnen. Die Ehefrau des Patienten kommt am nächsten Tag in die Klinik. Der Patient hat ausdrücklich gewünscht, dass seine Frau aufgeklärt und in alle Entscheidungen mit einbezogen wird. Sie jedoch konnte an diesen ersten Tagen nicht über die Erkrankung ihres Mannes reden, sie war so betroffen, dass sie die ganze Zeit über weinte. Die Moderatoren unterbrechen die Fallschilderung und regen eine Diskussion an. Sie beziehen die Arbeitsmappe ein und geben einige Fragen zur Bewertung und Beurteilung an die Gruppe zurück. Diskussion um die Rolle von Angehörigen: Wieviel können Angehörige verkraften, haben sie ein Recht auf Nichtwissen? Haben sie eine Pflicht zum Beistand? Wer ist jetzt in dieser Situation alles Patient? Die Ehefrau beruhigt sich langsam, ist nunmehr mit der Behandlung voll einverstanden. Zwischen Patient und Ehefrau finden lange Gespräche statt; das Behandlungsteam hat keine Kenntnis über den Inhalt der Gespräche. Die Chemotherapie verursacht beim Patienten kaum Nebenwirkungen, er kann sogar nach einigen Tagen aufstehen. Das erste Etappenziel war die Chemotherapie und danach "nach Hause gehen". Das Therapieziel insgesamt ist zu dieser Zeit die Heilung des Patienten. Frage ob das Ärzteteam in die Gespräche einbezogen waren. Kommentar: Recht auf Privatsphäre der Patienten. Am zweiten Wochenende auf der Station gibt es einen Zwischenfall. Der Fallreferent hat dienstfrei und war verreist. Am Montag ist der Patient nicht auf der Station, eine Krankenschwestern informiert das Ärzteteam, dass der Patient am Wochenende verlegt wurde. Er hatte hohes Fieber entwickelt 19 und wurde wegen der Notwendigkeit einer engmaschigen Betreuung auf eine Aufnahmestation verlegt. Die Entscheidung trifft der diensthabende Oberarzt. Dieser kennt den Patienten nicht. Nach der Vormittagsvisite werden Informationen eingeholt und auf eine Rückverlegung gedrängt, die am späten Vormittag auch erfolgt. Der Patient ist niedergeschlagen und er zweifelt an der Kompetenz der Klinik; er sagt dem Arzt (Fallreferent), der inzwischen wieder den Dienst aufgenommen hat, man habe ihm (bei der Visite?) gesagt, "dass bei ihm alles umsonst sei". In der Akte war vermerkt, dass die Chemotherapie am Wochenende abgesetzt wurde und eine Weiterführung für nicht sinnvoll angesehen wurde. Frage, wer die Entscheidung getroffen hat. Unterbrechung des Fallberichts durch die Moderatoren, da einige Gruppenmitglieder Empörung äußerten. Die Moderatoren regen die Analyse der Situation an. Fallberichterstatter Der Fallreferent sucht den Oberarzt alsbald auf. Die Rücksprache findet auf dem Flur statt, sie ist emotional aufgeladen. Eine ruhige Aussprach ist nicht möglich, Vorwürfe kommen von beiden Seiten und die Gesprächspartner trennen sich im Streit. Studierende Diskurs Streites. über mögliche Formen eines Frage nach den Beweggründen der Entscheidung dieses Oberarztes. Die Argumente von Seiten des Oberarztes: der Patient ist schwerkrank, er kann nicht mitentscheiden, die Situation war kritisch, die Behandlung der Infektion stand im Vordergrund, Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidung zur Chemotherapie wurden ausgesprochen, der Fallreferent bekommt zu hören, dass er "wohl um jeden Preis therapieren wolle". Frage nach Einbeziehung des Patienten Diskussion über Struktur des Gesprächs mit dem Oberarzt, Herausarbeitung der verschiedenen Argumente von Oberarzt, betreuendem Arzt und Patient. Unterschiedliche Sichtweisen und Interpretation von ethischen Prinzipien: Wohl des Patienten, im Interesse des Patienten und seine Autonomie, Schadensvermeidung, Wahrhaftigkeit und Vertrauen. Informationen nochmals zu den Heilungs- 20 chancen und zur unterschiedlichen Bewertung der Chancen durch den diensthabenden Oberarzt, durch den Patienten und durch das Behandlungsteam. Herausarbeitung der Gründe die den Fallreferenten veranlassten emotional zu reagieren: Verletzung der Kollegialität, seine Kompetenz wurde angezweifelt, das Handeln des Oberarztes entsprach nicht seinem Arztbild, das Vertrauensverhältnis zum Patienten wurde gestört durch den Oberarzt (dies ärgerte ihm am meisten). Gemeinsame Reflexion der Gruppe und des Fallreferenten über diese Situation. Pause von 20 Minuten Zusammenfassung der Ergebnisse und Kommentare durch die Moderatoren zu den Konfliktsituationen im Fall. Dann Fortsetzung des Fallberichts Fallberichterstatter Studierende Nach Rücksprache mit seinem Kollegen (Stationsarzt) und dem zuständigen Oberarzt aus dem Behandlungsteam wird die Entscheidung (Abbruch der Chemotherapie) rückgängig gemacht und die Fortsetzung der Chemotherapie für den Abend geplant. Mit dem Patient wird für den Nachmittag ein ausführliches Gespräch vereinbart, das dann auch zwischen dem Fallreferenten und dem Patienten stattfindet. Der Patient ist zuerst sehr empört, er beruhigt sich im Laufe des Gesprächs wieder. Insgesamt ist dieses Gespräch sehr offen und kooperativ; der Patient entwickelt seine Ziele und Wünsche, der Patient will weiterhin eine Maximaltherapie auch mit dem Risiko von Zwischenfällen, er drängt auf eine Fortsetzung der Chemotherapie; er möchte die Hoffnung noch nicht aufgeben, bei Zwischenfällen will er wiederbelebt werden, er will nur auf dieser Station behandelt werden und nur im Notfall auf die Intensivstation verlegt werden. In der Patientenakte werden die Wünsche des Patienten deutlich vermerkt. Die Chemotherapie wird wieder angesetzt. Frage nach der Weiterführung der Chemotherapie. Frage zur Betreuung des Patienten Frage, ob sich der Patient beschwert hat. Bemerkung: "Der Zwischenfall hat letztendlich auch einiges geklärt." Nach dem ersten Behandlungszyklus wird festgestellt, dass der Tumor auf die Behandlung nicht angesprochen hat; das Tumorwachstum ist unter der Therapie sogar fortgeschritten und es haben sich zusätzlich Metastasen im Gehirn 21 gebildet. Die Heilungschance, auch durch eine veränderte Chemotherapie, ist nun äußerst gering geworden. Der Patient wird hierüber voll aufgeklärt. Der Fallreferent erklärt das Prinzip der zweiten Chemotherapie. Je nach Zustand und nach häuslicher Betreuung kann der Patient zeitweise oder ganz nach Hause entlassen werden. Frage, ob es noch eine Heilungschance gibt . Frage, ob noch eine weitere Chemotherapie durchgeführt werden kann? Frage, ob der Patient nach Hause gehen kann? Frage, wer entscheidet, ob eine Chemotherapie durchgeführt wird. weitere Unterbrechung der Fallschilderung durch die Moderatoren. Die Frage wird an die Gruppe weitergegeben. Strukturierung der Diskussion mit Hilfe der Arbeitsmappe. Anregung, die Äußerungen und Bewertungen zu begründen. Fallberichterstatter . Studierende Diskurs in der Gruppe über Betroffenheiten und Entscheidungskompetenzen: Patient: ist betroffen, Selbstbestimmung Arzt: Fachexperte. Chefarzt: Fachexperte und Verantwortlicher für die Station. Ehefrau: sie ist ebenfalls betroffen, trägt einen Teil der Folgen. Jurist: kennt die Richtlinien (war in der Gruppe sehr umstritten). Pflegekräfte (wurden erst auf Anregung der Moderatoren einbezogen): sie kennen den Zustand des Patienten besser als der Arzt. Seelsorger: (war in der Gruppe umstritten) sollte nur auf Wunsch des Patienten einbezogen werden. Konsens in der Gruppe, dass der Patient zu diesem Zeitpunkt entscheiden soll. Der Patient und seine Ehefrau wünschen eine weitere Chemotherapie. Der Patient hat immer noch Hoffnung und sein sehnlichster Wunsch ist, nach Hause zu gehen. Stationsärzte, Oberarzt und Pflegekräfte sind eigentlich gegen eine weiter Chemotherapie. Die Heilungschancen sind zu gering, die Nebenwirkungen zu hoch. Sie geben aber zu bedenken, ob dem Patienten die “letzte Chance” nicht doch gegeben werden sollte. Konsensfindungsprozess vorgeschlagen: gemeinsames Gespräch mit Patient, Ehefrau, Stationsärzte, Pflegekräfte und Chefarzt. Alle haben gleiche Rechte und alle Informationen sollen allen zugängig sein. In der Klinik hat ein solches Gespräch nicht stattgefunden. Da der Patient sehr gedrängt hat 22 und das Behandlungsteam dem "jungen Patienten" helfen wollte, wird die Therapie eingeleitet. Zuvor werden noch die Kosten mit der Verwaltung geklärt Kommentar: Die Verwaltung hat hier kein Mitspracherecht. Eine erhitzte Debatte entsteht über Ressourcenallokation: Konsens in der Gruppe “Sparen in diesem konkreten Fall ist unmoralisch". Die Moderatoren verweisen auf zwei Bereiche (Ethikkomitees und Ressourcenallokation), die nach der Falldiskussion nochmals vertieft werden sollen. Sie lenken die Gruppendiskussion auf die Fallarbeit zurück. Fallberichterstatter Die zweite Chemotherapie erbringt eine subjektive Besserung beim Patienten. Er hat weniger Schmerzen und die Schwellung am Oberschenkel geht zurück. Zahl und Größe der Metastasen haben jedoch zugenommen. Der Patient und seine Ehefrau sind über jeden Befund voll informiert. Die Ehefrau hat im Behandlungszeitraum mehr und mehr die Entscheidungen mitgeprägt. Beide sind über die Ergebnisse der zweiten Chemotherapie enttäuscht. Bei einem Gespräch mit dem Fallreferenten wünscht der Patient nun eine weitere dritte Chemotherapie. Studierende Frage: ob noch eine weitere Chemotherapie möglich ist. Unterbrechung der Falldarstellung durch die Moderatoren. Anregung, die Situation zu analysieren und die Vorentscheidungen miteinzubeziehen. Klärung der medizinischen Fragen und Klärung der medizinethischen Sachverhalte. Fallreferent Eine weitere Chemotherapie könnte technisch durchgeführt werden, doch sie beinhaltet keine reelle Überlebenschance für den Patienten. Der Wohnort des Patienten ist weit entfernt von der Klinik und es ist Schulzeit. Die Kinder sind nur am Wochenende zu Besuch, sie werden nie in die Gespräche über die Behandlung miteinbezogen. Die Ehefrau will noch nicht aufgeben. Sie wünscht für ihren Mann eine weiter Chemotherapie. Dies entspreche auch den Einstellungen und Wünschen des Patienten. Studierende Frage nach den Kindern Frage nach der Position und Rolle der Ehefrau Diskussion in der Gruppe: Wie und wer kann mit dem Patienten sprechen? Welche Rolle kann die Ehefrau haben? Sollte das Thema Sterben angesprochen werden? Konsens in der Gruppe, dass je ein bis zwei Personen vom Ärzte und Pflegeteam mit der Ehefrau und dem Patienten reden sollten. Es sollte, nach Meinung der Gruppe, keine weitere Chemotherapie durchgeführt werden, da das 23 Wohl des Patienten nun neu gesehen und mit ihm definiert werden muss. Die Sterbephase zu akzeptieren war ein dringliches Anliegen der Gruppe. Das Behandlungsteam überlegt sich in dieser Phase, ob es für die Familie besser ist, wenn der Patient in eine heimatnahe Klinik verlegt wird: Alle im Behandlungsteam sind sich nunmehr einig, keine weitere Chemotherapie durchzuführen, man will noch warten, bis der Patienten soweit ist, dies zu akzeptieren. Diese Diskussion ist geprägt von der Sorge um den Patienten und seine Familie. Die Belastung für die Familie ist durch die Entfernung der Klinik zum Wohnort sehr groß. Bei einer heimatnahen Klinik könnten weitere Familienmitglieder und vor allem die Kinder den Patienten häufiger besuchen. Die Versorgung zuhause wird von der Ehefrau und dem Patienten abgelehnt, sie haben Angst vor Komplikationen. Medizinisch kann der Patient in der heimatnahen Klinik sehr gut versorgt werden. Der Fallberichterstatter bringt zögerlich das Argument, dass die Klinik eine Spezialklinik sei und viele Patienten einen Platz brauchen. Dieser Patient braucht diese Art von Maximalversorgung nicht mehr. Nach einem langen Gespräch willigen letztendlich der Patient und die Ehefrau in die Verlegung in eine heimatnahe Klinik ein. Der Fallreferent hat die Verlegung organisiert. Er verabschiedet sich vom Patienten, was ihm nicht leicht fällt, da es so endgültig ist. Die Verlegung erfolgte vor zwei Wochen. Der Fallreferent hat bis heute keine weitere Nachricht vom Patienten; er hat mit der Klinik vereinbart, dass sie ihn über den weiteren Verlauf informieren werden. Fragen, ob diese Diskussion hinter dem Rücken des Patienten stattfand und warum der Patient nicht in der Klinik bleiben kann. Frage: kann der Patient nach Hause gehen. Frage nach der optimalen Versorgung des Patienten. Die Gruppe ist gegen eine Verlegung. Begründungen: der Patient möchte in der Klinik bleiben, der Patient kennt die betreuenden Menschen und hat Vertrauen zu ihnen, Sterbebegleitung in einer vertrauten Umgebung. Kommentare: Schwierigkeiten in der Entscheidungsfindung, da keine eindeutig gute Lösung zu finden ist. Die Komplexität der Entscheidung wird erkannt. Die Moderatoren ermuntern die Studierenden, ihre spontanen Gedanken zu äußern. Frage an die Runde, was sie am meisten beeindruckt bzw. nachdenklich gemacht hat. Nach dieser Phase der Entlastung werden die Äußerungen gesammelt und strukturiert. Eine Gesamtanalyse des Fallverlaufs wird in der Gruppe durchgeführt. Informationen zu Bereichen, die in der Falldiskussion zurückgestellt wurden ( hier z.B. über klinische Ethikkomitees, Ressourcenallokation, Sterbebegleitung) werden nun eingebracht. 24 Diese Fallbesprechung wurde von zwei studentischen Hilfskräften (Elke Kohler und Michael Strößler) protokolliert; ein Zeitraster von 5 Minuten war vorgegeben. In vorgefertigte Protokollbögen und Tabellen wurden die Gesprächsinhalte und die Teilnehmer eingetragen, die den jeweiligen Gesprächsbeitrag geliefert haben. Bei der Auswertung des Protokolls wurden die Gesprächsinhalte nach folgenden Gruppen und Zeitabschnitten klassifiziert: Fallvorstellung, Fragen und Antworten, Steuerungsanteile, Zusammenfassungen, Konfliktlösungsbeiträge. Grobes Zeitraster des Ablaufs: die Einführung vor der eigentlichen Falldiskussion dauerte 20 Minuten. Der Zeitbedarf für die Fallschilderung beanspruchte insgesamt 40 Minuten, die Unterbrechungen und Diskussionen sind in dieser Zeit nicht mitgerechnet. Die Diskussion innerhalb der Gruppe und die zugehörigen Erläuterungen und Beiträge von Seiten der Moderatoren nehmen mit 125 Minuten den größten Umfang ein. Einschließlich einer Pause von 20 Minuten dauerte die Fallbesprechung somit 3 1/2 Stunden. VERTEILUNG DER WORTMELDUNGEN Studierende: insgesamt 71 Einzelwortmeldungen, darüber hinaus 5 Diskussionsrunden, deren Redebeiträge nicht im einzelnen registriert wurden. 22 Fragen beziehen sich allgemein auf die Medizin, 24 Fragen speziell auf die Medizinethik; 25 Beiträge betrafen Vorschläge und Anmerkungen zur Konfliktlösung. Die 63 Redebeiträge der Fallreferenten verteilen sich wie folgt: 7 mal Beginn bzw. Weiterführung der Fallschilderung, 47 Antworten auf Fragen, 5 Gegenfragen, 4 Statements. Die 44 Redebeiträge der beiden Moderatoren gliedern sich wie folgt: 28 Steuerungsbeiträge, 5 Zusammenfassungen, 3 Beiträge allgemein zu Ethiktheorien, 8 Beiträge zur Ethik bezogen sich unmittelbar auf den Fall. Anzahl, Art der Redebeiträge und Zeitanteil der Studierenden sprechen für eine hohe studentische Aktivität bei der Fallbearbeitung: alle Studierenden haben geredet. Wie immer beteiligten sich einige Studierende stärker als andere, doch gab es keine starke Asymmetrie derart, dass einer kleinen Gruppe von “Aktiven” eine große Gruppe von “Passiven” gegenüberstand. Der Fallreferent hatte zwar viele Fragen der Studierenden zu beantworten; die Zahl seiner Wortmeldungen ist jedoch geringer als die der Studierenden, allerdings war seine Redezeit pro Wortmeldung höher als die der Studierenden: die Fallschilderung als solche und die zum Teil umfangreichen Antworten zum Krankheitsbild und zu möglichen Therapieformen haben absolut und relativ viel Zeit beansprucht. 25 Die Moderatoren waren in erster Linie mit der Steuerung des Diskurses befasst. Sowohl ihre Anzahl der Redebeiträge als auch ihre Gesamtredezeit im Rahmen der Falldiskussion (die Einführung mit der Erläuterung der Spielregeln nicht gerechnet) liegen deutlich unterhalb der Beiträge der Studierenden. 3. EVALUATION, RÜCKBLICK UND VORAUSSCHAU Eine Woche nach dem Wochenendseminar wurden an die 13 Studierenden (2. bis 6. Semester) Evaluationsbögen ausgegeben; neun der Teilnehmenden haben ihre Bögen wie vereinbart vier Wochen später ausgefüllt zurückgegeben. Ihre Auswertung ergibt in Kürze Folgendes: der Fall wurde von den Studierenden verstanden, der komplizierte medizinische Sachverhalt hat sie nicht überfordert; die Konfliktsituationen waren gut nachzuvollziehen; besonders gut gefallen hat die offene und angstfreie Atmosphäre während des ganzen Seminars; Kritik wurde nicht geäußert; die Studierenden waren positiv überrascht über diese für sie neue Lehrveranstaltung. Alle Teilnehmenden geben an, dass sie über die Inhalte und das Seminar mit anderen Menschen gesprochen haben, alle wollen im folgenden Semester wieder an einem Seminar teilnehmen. Die Lernziele “Sensibilisierung für ethische Fragen” und “Motivierung” scheinen gut erreicht zu sein. Die aktive und engagierte Teilnahme am Diskurs sowie die Ernsthaftigkeit, mit der die Studierenden die bestmöglichen Lösungen für den Patienten suchten, sprechen für diese Bewertung. Der vorgestellte Fall stammt aus dem Jahr 1995. Zu dieser Zeit war eine über vier Jahre dauernde Experimentierphase schon abgeschlossen, in der Lehr-Lern-Konzepte experimentell erprobt und einzelne Elemente dieser Konzepte mehrfach überprüft und verändert wurden. In dieser Phase waren uns die kritischen Rückmeldungen der Studierenden von unschätzbarem Wert; nicht wenige dieser Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die damals ihre ersten Semester des Medizinstudiums absolvierten, haben die Entwicklung unseres LehrLern-Modells über Jahre hinweg aktiv begleitet, zuletzt als Tutoren und Moderatoren. Inzwischen sind sie Ärztinnen und Ärzte, Doktoranden mit einem medizin-ethischen Thema und vereinzelt sogar Fallreferenten aus eigener ärztlicher Tätigkeit. Einen wesentlichen Teil der Erfahrungen in der Experimentierphase (1989-1993) haben wir mit unseren Seminaren im Rahmen der AiP-Fortbildungen gesammelt; über dieses seinerzeit singuläre Modell haben wir berichtet. Die überaus positiven Erfahrungen waren aber für die Schriftleitung der Zeitschrift "Ethik in der Medizin" Anlass, in einer redaktionellen Fußnote leise Zweifel anzumelden hinsichtlich der positiven Bewertungen durch die teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte (Sponholz et al. 1991). Inzwischen liegen weitere Untersuchungen/Berichte über AiP-Fortbildungen vor, die methodisch der Ulmer 26 Konzeption entsprechen und die gleichermaßen von einer großen Akzeptanz sprechen (KleinLange und Schlaudraff, 1997 sowie Neitzke 1998). Nach Abschluss der Experimentierphase, in der die Grundformen unserer Seminare entwickelt wurden, beginnt 1994 das Projekt "Ethik in der Medizin in frühen Phasen des Medizinstudiums", gefördert durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg. Zeitlich parallel erfolgten Befragungen von Studierenden der Universitäten Heidelberg, Mainz und Ulm zu ihren Einstellungen, die sie zu Beginn des Studiums zum großen Thema "Ethik in der Medizin" haben (Sponholz et al. 1997). Die Ergebnisse waren insofern überraschend, als erste Befragungen von Ulmer Studierenden, die ja schon Erfahrungen mit Ethikseminaren gemacht hatten, im Wesentlichen bestätigt wurden durch die Aussagen der Heidelberger und Mainzer Medizinstudenten. Ein zentrales Ergebnis ist wohl, dass über 90 % der Befragten den Bereich "Ethik in der Medizin" als wichtig für das Studium einschätzen. Dieses Ergebnis widerlegt schlagend die häufig gehörte Meinung, Studierende der Medizin seien überwiegend an der Ethik uninteressiert. Ein weiteres wichtiges Ergebnis dürfte sein, dass die Mehrzahl der Befragten ein studienbegleitendes Angebot von Lehrveranstaltungen mit medizin-ethischer Thematik wünscht. Die hohe Akzeptanz unserer Seminare spricht nunmehr wohl dafür, dass es gar nicht auf das "ob", sondern auf das "wie" ankommt, wie also Ethik im Medizinstudium vermittelt wird (Sponholz et al. 1995). Seit 1994 sind nunmehr über 80 Seminare mit über 1000 Teilnehmern in dem vorgestellten Grundmuster durchgeführt worden: Die "Fälle" sind jeweils neu, berichtet von einem Stamm erfahrener Referentinnen und Referenten, der kontinuierlich erweitert wird. Die Moderatoren gehören überwiegend zu der Kerngruppe des Arbeitskreises, den Autoren dieses Berichts, sie werden ergänzt durch erfahrene und im Moderatorentraining geschulte Studierende und Pflegekräfte. Durch diese Variabilität der Akteure ergeben sich von Fall zu Fall und von Seminar zu Seminar durchaus erwünschte Modifikationen, die aber das Grundmuster, wie es inzwischen entwickelt wurde, nicht entscheidend verändern. Auch einige Erfahrungen, nicht zuletzt gestützt auf die ständig weitergeführte Evaluation, haben im Detail zu Modifikationen geführt (so wurde etwa das Reihumabfragen, das anfangs einige Male geübt wurde, als regelwidrig im Hinblick auf die Spielregeln des "herrschaftsfreien" Diskurses schnell wieder aufgegeben). Zu den zentralen Erkenntnissen gehört die Forderung, dass derartige Seminare zwingend studienbegleitend durchgeführt werden müssen. Diese Forderung wird immer wieder auch von den Studierenden erhoben, die diesen Wunsch dadurch unterstreichen, dass sie mehrfach an Seminaren teilnehmen. Entsprechend bietet der Arbeitskreis regelmäßig 27 neben den Seminaren für Erstteilnehmer auch solche Seminare an, die sich an Fortgeschrittene wenden. In diesen Seminaren ist der Ablauf insofern modifiziert, als die Einführung wesentlich verkürzt werden kann, die Rolle der Moderatoren vereinfacht sich wesentlich. Das Modell der sequenzierten Fallstudie haben wir inzwischen auch auf unser klinisches Ethikforum angewendet. Dort werden katamnestisch Fälle von betroffenen Ärztinnen/Ärzten, Pflegekräften und anderen klinisch Tätigen diskutiert. Das Modell ist generalisierbar und hat sich als flexibel anwendbar bewährt (Keller 1998). Parallel zu den Seminaren wurde in informellen Gesprächsrunden und individueller Arbeit die Analyse der Seminare und ihrer Evaluation sowie die theorieorientierte Durchführung der Konzeption fortgesetzt; die eigenen Lernprozesse sind ein "Work in Progress". Die folgenden vier Exkurse reflektieren einige dieser Inhalte unseres fortgesetzten Lernens; sie sind gewissermaßen Schnittlinien im hyperkomplexen System der Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens einer Ethik in der Medizin: Exkurs I behandelt "The moral event" von Pellegrino als ein didaktisches Hilfsmittel, um sich im Dickicht der Theoriekonzepte anhand eines konkreten Falles zurechtzufinden. Exkurs II geht ausführlicher ein auf die Weiterentwicklung der Diskursethik (Apel, Habermas) durch Benhabib. Exkurs III verknüpft pädagogisches Denken Deweys, wie wir es mit dem "Learning by doing" in unseren Seminaren praktizieren, mit dem ebenfalls mit Dewey begründeten klinischem Pragmatismus nach Fins, Miller und Bacchetta, 1998. Exkurs IV zitiert beispielhaft 25 Äußerungen aus Evaluationsbögen von Seminaren, die im Sommersemester 1994 und Wintersemester 1994/1995 stattgefunden haben; die Äußerungen sind mit dem Fokus "Kommunikative Ethik" ausgewählt. Dieser Begriff wird im Fragebogen nicht als Item verwendet; vielmehr wird nur sehr allgemein danach gefragt, was "am Seminar gefallen" habe. Die Äußerungen bleiben unkommentiert, die Interpretationen wollen wir der narrativen Phantasie der Leser dieses Berichtes überlassen. DER ERSTE EXKURS The moral event: Pellegrino Gelegentlich werden wir gefragt, welche philosophische Theorie wir den Studierenden vermitteln; der Unterton der Frage ist meist unüberhörbar: Zuerst müsse eine stringente Theorie der Ethik vorhanden sein als Grundlage jeglicher medizin-ethischer Praxis; die Begriffe müssten geklärt sein, um darüber reden zu können, was z. B. Autonomie sei, was richtig und falsch, gut und schlecht, Verantwortung für was und wen und gegenüber wem und warum und wie begründet. So und ähnlich haben wir Fragen und Meinungen im Ohr. Der 28 leicht kritisch abfällige Unterton, den die Frager gelegentlich anklingen lassen, provoziert dann auch in gespielter philosophischer Attitüde statt einer Antwort eine Gegenfrage etwa der Art: Wie viele Medizinstudierende haben Sie denn in Ihrer akademischen Laufbahn bislang unterrichtet, mit dem Ziel, deren Ethikfähigkeit hinreichend gut auszubilden? Wurden diese Lehrveranstaltungen angemessen evaluiert? Solche Diskurse (wenn es überhaupt welche sind) nehmen nach derartigem Fragenaustausch in aller Regel ein schnelles Ende. Doch der Hintergrund, vor dem sich solch akademisches Geplänkel abspielt, ist unter theoretischen und vor allem unter praktischen Aspekten zu bedeutsam, als dass er leichthin übergangen werden könnte. Zum einen geht es tatsächlich um die allgegenwärtige Problematik der Theorie-Praxis-Relation im Allgemeinen (Medizinethik und ihre Begründungen im Gesamtgefüge aller Ethiken) und im Besonderen (im Kontext etwa dieses Berichtes über die Lehr-Lern-Konzeption des Ulmer Arbeitskreises). Zum anderen sind damit so schwerwiegende Probleme angesprochen wie die Formulierung von Lernzielen und die noch schwerer wiegende Frage, wie und mit welchen Mitteln und Verfahren diese Lernziele erreicht werden können. Diese Fragenkomplexe sind nun in der Tat bislang noch kaum ausformuliert, noch weniger im Diskurs bearbeitet, kaum je in der Realität experimentell angegangen und erprobt/geprüft. Die betont narrativ und kasuistisch angelegte Lehr-Lern-Praxis der Ulmer Schule folgt nicht (kann nicht folgen!) einer einzigen theoretischen Ethikkonzeption; sie ist z. B. nicht primär utilitaristisch orientiert oder der Tugendethik allein verpflichtet. Auch die vier Prinzipien der mittleren Ebene (Beauchamps und Childress, 1989), so brauchbar sie wegen ihrer unstreitigen Allgemeingültigkeit auch sind, können nicht die differenzierte Vielfalt des "Falles" in seiner jeweiligen Einzigartigkeit befriedigend abbilden (vgl. hierzu auch die Diskussionen in DuBose, Hamel, O´Connell. A Matter of Principles (eds) 1994). Bei der Suche nach passenden Modellen, die unserem Konzept eines narrativen Pragmatismus entgegenkommen (s. hierzu auch Benhabib, 1995, und Fins et al., 1996, 1997, 1998, auf die wir in diesen Exkursen noch ausführlicher eingehen werden), schien uns das von Pellegrino (1995) entworfene Schema "The moral event" besonders hilfreich. Wir benutzen es als ein didaktisches Hilfsmittel, indem wir uns bei der Analyse eines "Falles" orientierend fragen (hierzu verwenden die Moderatoren gerne die Formulierung "Jetzt lehnen wir uns einmal zurück"), an welchem Ort des Schemas, in welcher ethischen Theoriekonzeption, in welcher Begriffswelt usw. wir uns bewegen, wie und wo das konkrete moralische Ereignis (the moral event) zu orten ist. The Moral Event Agent Theories virtue Foci character intention desire choice will accountability caring Act deontology right good duty rule maxim Circumstance particularizing theories caring for this person or group in this place, time, etc. narrative, culture uniqueness of the person experience "situation ethics" casuistry Aus: Pellegrino E. D.: Toward a Virtue-Based Normative Ethics for the Kennedy Institute of Ethics Journal 5/3: 253-277, 1995 Consequence teleology outcomes harms/goods pain/pleasure utility calculus Health Professions. Beispielhaft lässt sich dies an folgendem Fall zeigen, der auch insofern recht instruktiv ist, als bei seiner sequenzierten Bearbeitung in einem Seminar die Bedeutung und 29 das Gewicht der diagnostizierten Fakten und Merkmale, Prinzipien und Tugenden sich mehrfach wandeln. HIERARCHIE, VORBILD UND MEDIZINETHIK Eine Studentin berichtet in einem Wochenendseminar folgendes Erlebnis: Am Beginn einer Famulatur an der Klinik X in der Stadt Y wird sie von den beiden Ärzten der Station, auf der sie bei der Famulatur arbeiten soll, über den Chefarzt aufgeklärt: er sei cholerisch, neige zu Wutausbrüchen, es sei nicht ratsam, ihm zu widersprechen. Einige Tage später erlebt sie ihn bei der sog. Chefvisite zusammen mit den beiden Kollegen (Oberarzt und Stationsarzt) bei einer Patientin, die aufgrund einer Trigeminusneuralgie an starken Schmerzen leidet. Der Chefarzt erkundigt sich nach dem Befinden. Die Patientin berichtet, dass sie weiterhin starke Schmerzen habe. Auf die Frage, ob sie denn die Medikamente genommen habe, antwortet Frau M., dass sie die Medikamente regelmäßig einnimmt und trotzdem noch sehr starke Schmerzen hat. Der Chefarzt macht Frau M. Vorhaltungen, es sei unmöglich, dass sie weiterhin Schmerzen haben könne, er wirft Frau M. vor, es treffe nicht zu, dass sie das Medikament genommen habe. Frau M. fühlt sich ungerecht behandelt; sie beginnt zu weinen, nachdem der Chefarzt sie lautstark der Lüge bezichtigt. Die Visite wird abrupt beendet. Ärzte und Famulantin verlassen das Krankenzimmer. Kurze Zeit später, nach Beendigung der Visite, geht der Stationsarzt zusammen mit der Famulantin zurück zu Frau M. um sie wegen des Vorfalls zu trösten. Im Diskurs in der Seminargruppe werden zunächst besonders hervortretende Charakteristika (z. B. Aspekte der Tugendethik, bezogen z. B. auf den Chefarzt) in ihrer Bedeutung relativiert und kompliziert durch tugendethische Zuschreibungen auf andere Beteiligte (Oberarzt, Stationsarzt, Famulantin): Wie mutig sollen und können sie sein? Wie tief sitzt die Scham? Wie deutlich kann Empörung geäußert werden? Im weiteren Diskurs, nachdem die Famulantin die Erzählung des Falles weitergeführt hat, treten neue Aspekte in den Vordergrund: Die Frage, "Wer ist betroffen?" lenkt die Aufmerksamkeit der Seminarteilnehmer zunehmend mehr auf die Patientin, wenngleich in unterschiedlicher Weise im Vergleich mit den vier anderen Beteiligten. In diesem Diskurs werden Aspekte der Prinzipienethik angesprochen: Autonomie, Vertrauen, Wahrhaftigkeit, Schaden vermeiden, Gutes tun. Fragen werden gestellt, wie die seelische Verletzung der Patientin wieder geheilt werden kann, ob Heilung überhaupt möglich sei; was muss (soll) ich tun, wenn ich in eine solche Situation (noch) einmal kommen würde? Was kann ich tun, welche Konsequenzen hätte ich zu erwarten? Wir kommen damit auf einen konsequentialistischen Ansatz zu sprechen. In einer neuen Schnittlinie sprechen wir über die Entscheidungen, die in diesem Fall tatsächlich getroffen worden sind und die hätten getroffen werden können; dem ersten Einwand, es habe ja gar keine Entscheidungen gegeben, wird im Diskurs sofort entgegnet, dass mehrfach Entscheidungen getroffen worden sind, wenngleich stillschweigend und nicht diskursiv: stillschweigend, allenfalls nonverbal durch Blickkontakte Einvernehmen herstellend, wird vom Oberarzt, dem Stationsarzt und der Famulantin entschieden, dass keine Intervention erfolgen soll/darf, dass also geschwiegen werden soll und in dieser gespannten Situation auch eine nonverbale Reaktion nicht tunlich sei. Daraus entwickelt sich nun ein neuer Diskurs im Seminar; sein Thema lautet: wäre nicht doch, angesichts der massiven Kränkung der Patientin durch den Chefarzt, eine Intervention notwendig, im Interesse der Patientin? Wer aber könnte (mit welchem Risiko?) intervenieren, wem ist ein Risiko (welches Risiko?) zuzumuten? Mit anderen Worten: Wer hat angesichts der Abhängigkeitsverhältnisse hinsichtlich seiner Handlungsmöglichkeiten in der gegebenen Situation das höchste/höhere Risiko, d. h. mit welchen Folgen hat er/sie objektiv und oder subjektiv zu rechnen, wenn er/sie (in welcher Form?) interveniert? Wir hätten zu nahezu allen diesen Fragen unterschiedliche Antworten finden können mit unterschiedlichen Handlungsoptionen, jede nachfolgende Entscheidung hätte zu neuen Problemen, Optionen, weiteren Konsequenzen geführt. 30 Wir brechen an dieser Stelle das Beispiel ab; das verblüffende Ergebnis des Diskurses, mehrfach auch in Rollenspielen erprobt und variiert, wird an anderer Stelle veröffentlicht. Es möge genügen darauf hinzuweisen, dass die Beteiligten an diesem Diskurs offensichtlich jenen wichtigen Schritt getan haben, auf den es uns in diesem Exkurs beispielhaft ankommt: Das Beispiel zeigt, dass die große Mehrzahl der Fälle des medizinischen Alltags mehrere (oft sogar viele) Facetten aufweist, die wir als moralische/ethische Ereignisse interpretieren müssen, wenn wir den Fall, was zwingend notwendig ist, nur sorgfältig genug analysieren. Das Schema "The moral event" von Pellegrino können wir dazu als didaktisches Hilfsmittel/Instrument benutzen, wenn wir wissen wollen, wo und in welchem System ethischer Theorie die von uns beobachteten Konflikte zu orten sind. Diese Form synoptischer und differenzierender Analysen hat das Ziel, die Vielfalt und bisweilen Einzigartigkeit der beobachteten Phänomene besser zu verstehen. Dass dieses Lernziel wenigstens ansatzweise erreicht worden ist, möge daraus erschlossen werden, dass der Fall "Alexandra" noch heute, Jahre später, immer wieder von den damals beteiligten Studierenden (die heute schon als Ärzte tätig sind) im Gespräch erinnert wird. Zum Thema "Vorbild" sei abschließend nur noch angemerkt, dass das vor allem in der früheren Literatur über das Lehren und Lernen des Gegenstandes "Ethik" immer wieder bemühte Modell des guten oder schlechten Vorbildes (vgl. hierzu in der neueren einschlägigen Literatur Hufnagel, 1993) in unseren Seminaren eine auffallend seltene Rolle spielt; darüber wird an anderer Stelle zu berichten sein. DER ZWEITE EXKURS Kommunikative Ethik: Apel, Habermas, Benhabib Seyla Benhabib setzt sich in ihrem Aufsatz "Im Schatten von Aristoteles und Hegel" (deutsch: 1995) konstruktiv mit Apel's Strategie der Letztbegründung und mit Habermas´ Strategie eines "schwachen transzendentalen Arguments" auseinander. Die von dieser Autorin in kritischer Weiterentwicklung formulierte kommunikative Ethik sehen wir sowohl in ihrer philosophischen Begründung als vor allem in ihrer pragmatischen Ausformulierung als wichtigen theoretischen Hintergrund und als praktische Leitlinie unseres eigenen Lehrens und Lernens. Einige Zitate aus dem Werk Seyla Benhabib's mögen hierzu einen Einblick vermitteln; sie sind mit wenigen Kommentaren versehen. Die Zitate sind der Aufsatzsammlung "Selbst im Kontext" (1995) entnommen; die Seitenzahlen beziehen sich auf die deutsche Ausgabe. Eine zentrale Aussage: "Kommunikative Ethik nimmt gedanklich gewaltlose Strategien zur Lösung von Konflikten voraus, sie ermutigt Problemlösungen auf der Basis von Kooperation und Assoziation" (S. 66). "In einem solchen Dialog bringt man die eigenen Vorannahmen in das Gespräch ein, modifiziert sie entsprechend der Antwort des Anderen, formuliert neue Fragen und so fort." (S. 287). Im folgenden Text spricht Benhabib mit den Argumentationsregeln einige in der Kommunikativen Ethik wichtige Verfahrensgrundsätze an, wie wir sie in unseren Seminaren als "Spielregeln" mit den Seminarteilnehmern vereinbaren: "Natürlich unterliegen praktische Argumentationen einigen Beschränkungen - etwa der Gleichheit und symmetrischen Verteilung der Chance, Diskussionen und Debatten in Gang zu bringen u.s.f. - die man als "deontologisch" bezeichnen kann. Es handelt sich dabei um grundlegende Argumentationsregeln, die ein faires Ergebnis gewährleisten sollen, in dem sie für ein faires Verfahren sorgen. In diesem Sinne unterliegt in der Kommunikativen Ethik das "Gute", auf das sich die Teilnehmer einer praktischen Argumentation möglicherweise einigen, einer Einschränkung durch das "Richtige", d. h. durch die Bedingungen fairer Argumentation und fairer Debatte" (S. 297). Deshalb, so fährt Benhabib fort, bleibt die Kommunikative Ethik notwendig eine deontologische Theorie; im Gegensatz zu Habermas handelt es sich jedoch um eine "schwache deontologische" Auffassung, was bedeutet, "Dass Fragen der Gerechtigkeit ebenso 31 wie Fragen des guten Lebens, Normen so gut wie Werte einer diskursiven Debatte unterzogen werden können, dass sie in einem fortwährenden Gespräch geprüft werden können, das nicht einen Konsens aller erstrebt, sondern eine Verständigung erreichen will" (S. 297). Wir begegnen hier der in unseren Seminaren recht regelmäßig auftretenden Phase im Diskurs mit den Studierenden, wenn sie uns (die Lehrenden) fragen, was denn nun in diesem Fall, in dieser speziellen Konfliktsituation das Gute, das Richtige sei. Wir antworten, es sei nicht unsere Aufgabe (und auch nicht unsere Kompetenz), diese Entscheidung allein zu treffen; vielmehr müssen wir uns gemeinsam im Diskurs darüber verständigen, was hier und jetzt, in diesem Fall und in dieser speziellen Entscheidungsproblematik das Gute, das Richtige sei; nicht immer aber gebe es darüber Konsens. Benhabib sieht sich in dieser Unsicherheit nicht beunruhigt: "Ich halte weder das Nebeneinander vieler verschiedener Auffassungen vom Guten, mit denen wir in einer entzauberten Welt zu leben haben, noch den Verlust der letzten Gewissheit in der Moraltheorie für einen Grund zur Beunruhigung." Sie begründet dies wie folgt: "Eine moderne Moraltheorie kann uns höchstens einige sehr allgemeine Kriterien an die Hand geben, mit deren Hilfe wir uns der eigenen Intuitionen hinsichtlich der grundlegenden Werthaftigkeit bestimmter Handlungsweisen in der Integrität bestimmter Werte versichern können" (S. 85). An anderer Stelle (in: Über das Urteilen und die moralischen Grundlagen der Politik im Denken Hannah Arendts, 1995) formuliert Benhabib praxisnäher: "Je mehr Perspektiven verschiedener Menschen wir in unser Verständnis einer Situation einbauen können, um so eher werden wir deren moralische Relevanz und ihre moralische Bedeutung erkennen können, um so eher werden wir in der Lage sein, die möglichen Beschreibungen unserer Handlungen durch andere richtig einzuschätzen. Und schließlich: je eher wir im Stande sind, den Standpunkt anderer einzunehmen, um so lebhafter werden wir uns die narrative Geschichte anderer vorstellen können." Wir können an dieser Stelle eine Brücke schlagen zum ersten Exkurs, in dem die etwas polemische Frage gestellt war, welche ethische Theorie wir den Studierenden vermitteln. Nunmehr können wir diese Frage dahingehend umformulieren, welches philosophische Gerüst wir unserem Lehren und Lernen zugrunde legen: wir arbeiten mit einer Form der Kommunikativen Ethik, wie sie Apel und Habermas ausformuliert haben und wie sie dann von Seyla Benhabib weiterentwickelt wurde. Dabei möchten wir mit Benhabib den Anschluss an die hinter uns liegende Moderne nicht vermissen: "Zu den Hinterlassenschaften der Moderne, die wir heute zwar neu überdenken, aber nicht 'in die Vergangenheit hinab versenken' sollten, zählt der moralische und politische Universalismus mit seinen gegenwärtig 'altmodisch', ja geradezu suspekt erscheinenden Idealen der Achtung vor dem Menschen als Menschen; der moralischen Autonomie des Einzelnen; der ökonomischen und sozialen Gerechtigkeit und Gleichheit; der aktiven Teilnahme am demokratischen Prozeß; der größtmöglichen bürgerlichen und politischen Freiheit, soweit sie mit den Prinzipien der Gerechtigkeit vereinbar ist; der Bildung menschlicher Gemeinschaften auf der Grundlage von Solidarität." (S. 8) (Siehe zur kommunikativen Ethik auch Ott 1993). Der vierte Exkurs wird einigen Aufschluss darüber geben, wie die Lernenden das Lernen einer Kommunikativen Ethik beurteilen. DER DRITTE EXKURS Dewey und die Folgen: "Learning by Doing" und "Clinical Pragmatism" Es wird berichtet, das Buch "How we Think" (1910) von Dewey (1859-1952) sei über Jahrzehnte hinweg das einflußreichste Buch an den amerikanischen Hochschulen für Lehrerbildung gewesen. Deweys Hoffnung aber, das reformierte Schulwesen bilde den Ausgangspunkt für die Herbeiführung einer demokratischen Gesellschaft, schwindet im Alter: "Es ist meines Erachtens unrealistisch anzunehmen, dass die Schulen eine Hauptagentur zur Produktion des geistigen und moralischen Wandels werden können, die zur Herbeiführung 32 einer neuen gesellschaftlichen Ordnung notwendig wird", schreibt der fast 80jährige Dewey (Schreier 1991). Dennoch: Seine Maxime des "Learning by Doing", wohl aus den Jahren um die Jahrhundertwende, also vor drei Generationen formuliert, hat heute gleichermaßen wie damals seine Gültigkeit. Dies gilt auch und gerade für die Ausbildung der künftigen Ärzte, nicht zuletzt in Deutschland. Die Auseinandersetzung um eine neue Approbationsordnung, die nun schon seit Jahren in einem Prinzipienstreit zwischen Reformern und Traditionalisten nahezu in einer Agonie verharrt, läßt sich an dieser Maxime messen: Die Reformvorschläge des Wissenschaftsrates (1992), des Murrhardter Kreises (1995), des Berliner Reformstudienganges (Burger und Scheffner,1993), aber auch die aus der Lehrpraxis erwachsenen Modelle, wie Ethik in der Medizin gelehrt und gelernt werden kann - im Kern und im Detail folgen sie der Dewey´schen Maxime des "Learning by Doing". Die Projektmethode und die Arbeit an Fällen, von Dewey sozusagen neu erfunden (zur Historie siehe Frey 1996, dort Übersicht), müssen heute nicht mehr um ihre Legitimation kämpfen; dass sie sich in der alltäglichen Praxis medizinischer Ausbildung und in den Ausbildungsordnungen noch immer nicht allgemein durchsetzen können, ist wohl nicht besseren pädagogischen Wissens, sondern eher dem Fächeregoismus und der Angst vor dem Verlust von Privilegien anzurechnen. Vielleicht war es für die Berichterstatter des Ulmer Ethik-Lehr-Modells sogar von Vorteil, dass sie ihre Konzeption abseits von Fächeregoismus und kleinlichem Streit um Kompetenzen und Zuständigkeiten entwickeln und erproben konnten, gewissermaßen im Stillen und doch auch in offener Konkurrenz zu dem herkömmlichen Frontalunterricht und dem Pauken von abfragbarem Wissen. Die große Akzeptanz bei Studierenden gleichermaßen wie bei den Lehrenden sorgte schnell für das Bekanntwerden dieses Modells über die engeren Grenzen hinaus; Gäste aus anderen Universitäten, Lernende und Lehrende, haben erfahren, daß das "Learning by Doing" auch und gerade für den fächerübergreifenden Querschnittsbereich einer Ethik in der Medizin unverzichtbar ist: die Beteiligten an diesem Prozess lernen gemeinsam das Handeln, wie ethische Konflikte im Diskurs entschieden werden (s. hierzu den zweiten Exkurs). Der ethische Diskurs stellt so etwas dar wie kommunikatives Handeln. "Clinical Pragmatism" nennen Fins, Bacchetta und Miller (1996 - 1998) ihre Methode des Lösens moralischer/ethischer Probleme, die inspiriert ist durch die Philosophie von John Dewey: "Clinical pragmatism treats moral rules and principles as hypothetical guides that identify a range of reasonable moral choices for the deliberations of patients, families, and clinicians." Die Autoren beziehen sich dabei auch auf Moreno (1995), der im Hinblick auf komplexe Entscheidungen bei ethischen Konflikten die Frage stellt: "How is moral consensus possible and how do small groups help create or distort consensus processes?". In ihrem Aufsatz "Clinical Pragmatism: John Dewey and "Clinical Ethics" (1996) greifen Miller, Fins und Bacchetta auf eine frühere Maxime Dewey's zurück: "... we see Dewey's basic social ideal of democracy as a way of life as an orienting perspective for the reform of clinical practice, both with respect to the clinician-patient (or surrogate) dyad and various institutional dimensions of health care. The pragmatic method of inquiry and problem-solving and the democratic model represent the two pillars of an approach to clinical ethics that we call ´clinical pragmatism´" (S. 29). In den Conclusions ihres den "clinical pragmatism" begründenden Artikels gehen die Autoren kurz auf Aspekte der Ausbildung ein; und mit den nachstehenden Sätzen leiten wir über zu dem von uns erprobten Modell des Lehrens und Lernens, das wir mit dem vorliegenden Aufsatz ausführlicher vorstellen: "Dewey saw education as a major instrument of social reform. We will examine how clinical pragmatism can be taught to medical and nursing students and to clinicians with the aim of integrating ethics into clinical practice." (S. 51). Wir kehren zurück zum ersten und zweiten Exkurs; dort haben wir das "Learning by Doing" beschrieben, wie wir es dem Pädagogen Dewey folgend in den Seminaren mit den 33 Studierenden zusammen üben. Im klinischen Pragmatismus (Clinical Pragmatism nach Fins et al.) ist der Philosoph und Ethiker Dewey, Mitbegründer des Amerikanischen Pragmatismus, die richtungweisende Leitfigur. Das Ulmer Modell des Lehrens und Lernens einer pragmatisch orientierten medizinischen Ethik verbindet nun das pädagogische Erbe Dewey's mit dem Modell einer kommunikativen Ethik, wie sie von Seyla Benhabib aus der Diskursethik von Apel und Habermas entwickelt wurde. Beiden, Benhabib und Dewey, ist gemeinsam die fundamentale "Achtung vor dem Menschen als Menschen" (Benhabib) und die soziale Gerechtigkeit und Gleichheit sowie das Ideal der "Democracy as a way of life" (Dewey). Diesen Idealen fühlen auch wir uns mit unserem Lehren und Lernen verpflichtet. DER VIERTE EXKURS Kommunikative Ethik: 25 Stimmen von Lernenden "Die zentrale Prämisse der Diskursethik schreibt fest, dass nur diejenigen Normen und normativen institutionellen Regelungen gültig sind, denen alle Betreffenden in einer speziellen Argumentationssituation, die als "Diskurs" bezeichnet wird, zwangsfrei zustimmen können. Das ist die Metanorm der moralischen Autonomie innerhalb der Diskursethik" (Benhabib 1999). In unseren Ethikseminaren für Studierende der Medizin in der Universität Ulm sprechen wir mit Beteiligten im "herrschaftsfreien Diskurs" (Habermas, Apel), im "Sokratischen Gespräch", (Nelson 1996, Heckmann 1993, Birnbacher 1996) über medizinethische Konflikte und daraus sich ergebende Entscheidungen, um zu Problemlösungen zu kommen; über die theoretischen Begründungen der Diskursethik, wie überhaupt über ethische Theorien, sprechen wir nur sehr wenig, fast überhaupt nicht, und wenn, dann nur auf mehr oder minder ausdrücklichen Wunsch der Studierenden (manchmal und selten etwas mehr). Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer an den Seminaren füllt am Ende der 8 bis 10 Stunden des intensiven Diskurses in den Klein- und den Kleinstgruppen einen Evaluationsbogen aus, in dem u. a. auf die offene Frage "Was hat Ihnen gut am Seminar gefallen?" Antworten erbeten werden. Aus einer Stichprobe (Seminare vom Sommersemester 1994 und vom Wintersemester 1994/95) der insgesamt rund 1000 Evaluationsbögen suchten wir Antworten heraus, die sich auf Merkmale der kommunikativen Ethik beziehen. Wir wollen nur hören, was die Lernenden uns zu sagen haben, deshalb lassen wir die 25 Äußerungen unkommentiert; die Studierenden sollen das letzte Wort haben: 1. "... Die gute Atmosphäre in der Gruppe. Jeder konnte sich durch eigene Gesprächsbeiträge beteiligen." 2. "... Jeder konnte offen seine Meinung sagen; aktive Mitarbeit statt Vortrag." 3. "... dass man in kleinen Gruppen gearbeitet hat und sich jeder beteiligen konnte." 4. "... Ruhige Atmosphäre, kein Konkurrenzdruck." 5. "... Ich fand die offene Diskussion in der Gruppe sehr wichtig - man konnte die eigene Position zu einer Problematik neu überdenken und mit Hilfe der Anregungen anderer Teilnehmer ggf. korrigieren." 6. "... Offenheit, mit der die eigene Meinung geäußert werden konnte." 7. "... Offene Gespräche unter Gleichgestellten und dadurch Beleuchtung der Konflikte aus unterschiedlichen Perspektiven." 8. "... Ich fand es besonders wichtig, viele verschiedene Positionen zu einer Problematik kennenzulernen und dabei festzustellen, dass fast alle irgendwo vertretbar aber auch anfechtbar sind." 34 9. "... Offene Auseinandersetzung; ruhige, klare Gespräche unter klarer zurückhaltender Moderation." 10. „... Beleuchtung vieler Facetten eines Problems, Hören konträrer Meinungen und Argumente.“ 11. "... wie immer die gemeinsame Erarbeitung von Problemen, das Herauskristallisieren, das Nachvollziehen von Gedanken, Anregungen von anderen in der Gruppe." 12. "... Die Themen wurden von allen Seiten beleuchtet, es war immer genug Zeit, darüber nachzudenken und mitzudenken." 13. "... Respektvoller Umgang miteinander - einander zuhören." 14. "... Das Aufeinandertreffen teilweise sehr unterschiedlicher Meinungen und das Auseinandersetzen mit diesen oft von der eigenen Meinung abweichenden Themen erweiterte den Blickwinkel hinsichtlich gewisser Probleme." 15. "... Ich habe für mich persönlich meinen "Denkhorizont" erweitert, neue Probleme erkannt, werde bestimmt auch noch weiter darüber nachdenken." 16. "... Die intensive Beschäftigung mit einem ethischen Konflikt, in diesem Fall der Sterbehilfe ... sehr interessant, dass doch relativ unterschiedliche Meinungen vorhanden waren." 17. "... Ich habe mich ernst genommen gefühlt, konnte mich frei äußern. Ich hatte die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wenn mir etwas unklar war." 18. "... Neue Meinungen, Ideen, Vorstellungen der anderen, die ich in meine Vorstellungen einbauen konnte." 19. "... Jeder Teilnehmer konnte zu jedem Zeitpunkt seine Meinung bzw. Fragen los werden, konnte ausreden, wurde ernst genommen." 20. "... Zahlreiche Meinungen und Gesichtspunkte werden zusammengebracht; man wird sich gemeinsam der Komplexität bewusst und lernt sich auch in andere Personen einzufühlen." 21. "... Solidarität mit anderen bzw. ich stehe doch nicht alleine da." 22. "... Anreiz zum eigenen Weiterdenken und entdecken." 23. "... Gleichberechtigung aller Teilnehmer, Erlaubnis "dumme Fragen" zu stellen." 24. "... Kommunikation war vorhanden, durch Einblick vieler Meinungen konnte der Horizont erweitert werden." 25. "... Spannende, sehr einfühlsame Schilderungen, auch genügend Theorie. Ganz klasse fand ich, dass man soviel fragen konnte wie man wollte, d. h. es war z. B. nicht zu viel und nicht zu wenig Theorie." FAZIT Der Arbeitskreis "Ethik in der Medizin" stellt mit diesem Bericht zum ersten Mal ausführlicher die vom Arbeitskreis entwickelte Konzeption der sequenzierten Fallanalyse vor, die ein Kernstück bildet in den seit vielen Jahren an der Universität Ulm durchgeführten Seminaren zur "Ethik in der Medizin". Diese Seminare erfahren eine hohe Akzeptanz; die Teilnahme erfolgt freiwillig; die Seminare gehören nicht zum Pflichtcurriculum. 35 Der Arbeitskreis wurde seit Beginn seines Bestehens (1989) vielfach unterstützt durch die Universität Ulm, ihre Medizinische Fakultät, die Ulmer Universitätsgesellschaft sowie durch großzügig bemessene Projektmittel durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg. Dafür danken wir. In diesem Bericht klingt mehrfach an, dass die Seminare nur in solcher Intensität und in solchem Umfang durchgeführt werden konnten dank des hohen Einsatzes einer Vielzahl von Mitgliedern der Universität, von Studierenden, Ärztinnen und Ärzten, Pflegekräften und auch Patientinnen und Patienten. Ebenfalls konnten wir sehr häufig Gäste begrüßen, die entweder als Berichterstatter mit eigenen Fällen oder als aufmerksame Teilnehmer einen Beitrag zum Gelingen unserer Seminare geleistet haben. Damit ist auch eine unseres Erachtens zentrale Aussage von Ritschl zu wiederholen, die wir eingangs unseres Berichtes zitiert haben: Medizinische Ethik ist "nicht ein Fach wie die Physik oder die Jurisprudenz, in denen Experten verbindliche Auskunft und entsprechende Anweisungen geben können". Vielmehr kann das Lehren und Lernen nur gelingen, wenn alle Beteiligten am medizinischethischen Geschehen den permanenten Lernprozess nicht nur passiv registrieren, miterleben oder miterleiden; das aktive Mitgestalten an diesem Lernen und Lehren ist eine Voraussetzung dafür, dass Ethik in der Medizin aus der randständigen Rolle in das Zentrum der Medizin sich hineinentwickelt. Wir verbinden mit dieser Aussage eine Forderung: Die Krise der modernen Medizin ist auch und vielleicht in erster Linie verknüpft mit Defiziten im Lehren und Lernen des medizin-ethischen Diskurses; hieraus ergibt sich die dringende Forderung, diesen Diskurs intensiver als bisher zu praktizieren. Der Lernprozess in kleinen Gruppen anhand realer Fälle, die im medizinethischen Diskurs bearbeitet werden, leistet hierzu einen Beitrag. Abschließend sei noch eine Problematik angeschnitten, die sich mit dem schwierigen Aspekt befasst, ob Ethik in der Medizin in einer künftigen Ausbildungsordnung ein Pflichtfach werden soll. Sollte dies der Fall sein (einiges spricht nach dem Beratungsstand dafür), dann darf uns Lehrende dies nicht von unseren Pflichten entbinden, eine dieser Aufgabe angemessen aufwendige Lehr-Lern-Konzeption anzubieten; die sehr entmutigenden Erfahrungen mit den sog. Pflichtfächern, wie sie noch immer, leider allzu oft, im Paukstil exekutiert werden, sollten uns eine Lehre sein. Wir hoffen und wünschen uns, dass die hohe Akzeptanz der von uns als freiwilliges Lehrangebot durchgeführten Seminare von uns selbst (und vielleicht auch von anderen Lehrenden) als ein verpflichtender Qualitätsstandard verstanden wird, der auch für eine künftige Pflichtveranstaltung gelten muss. 36 DANKSAGUNG Am Gelingen des erfolgreichen Unternehmens "Ethik in der Medizin" an der Universität Ulm haben viele Menschen mitgewirkt. Sie waren als Moderatorinnen und Moderatoren, Fall-referentinnen und Fallreferenten, Organisatorinnen und Organisatoren in den letzten 5 Jahren tätig; Ihnen, den Schwestern und Pflegern, Studentinnen und Studenten, Ärztinnen und Ärzten, Professorinnen und Professoren, Dozentinnen und Dozenten, Patientinnen und Patienten, Biologinnen und Biologen, danken wir herzlich: Birgit Abler, Annette Bauer, Helga Bauhard, Clemens Becker, Petra Blum, Maxi Braun, Thomas Brummer, Annika Callsen, Elfriede Dehlinger, Michael Dippers, Axel Fetzer, Heinz Fischer, Stefanie Fleischer, Gerhard Gaedicke, Regina Gaissmaier, Dieter Gerstner, Michael Gommel, Markus Guhlich, Stefan Hamm, Helmut Harr, Hermann Heimpel, Katrin Herdegen, Ingo Kennerknecht, Henrik Kessler, Sarina Kirchmann, Elke Kohler, Jörg Kustermann, Claudia Lensing, Gert Liffers, Manfred Lutz, Regine Mayer-Steinacker, Elisabeth McAvinue, Martina Muckel, Brigitte Munzert, Christoph Ochsenfahrt, Wolfgang Paulus, Friedemann Pfäfflin, Martina Pfeiffer, Claudia Preuß, Angelika Rapp-Dvorak, Rosemarie Rau, Irene Reinisch, Gerd Richter, Susanne Roller, Anne Rose, Julian Rosenthal, Margarethe Ruepp, Armin Schaer, Margaretha Schlipf, Ursula Schluckebier, Michael Schmidt, Michael Schulte, Andrea Seufferlein, Daniela Sigrist, Kim Spallek, Dorothee Speit, Günter Speit, Gaby Staib, Jürgen Steinacker, Claudia Steinhauser, Michael Strößler, Stefan Thamasett, Andreas Uhl, Walther Vogel, Gerhard Wech, Monika Weiss, Heidemarie Wiedeck, Kerstin Wiesmiller, Hans-Joachim Winckelmann, Anja Wirth, Michael Wolf, Manfred Wolfersdorfer, Eylem Yalcin, Alexandra Zagoura, Andrea Ziegler 37 LITERATUR Allert G (1989) Medizinische Ethik lernen und lehren. Ein Bericht über Aus- und Weiterbildungsprogramme in medizinischer Ethik - Bioethics - in den USA. 30. Sonderbeilage, Medizinische Ethik. Ärzteblatt Baden Württemberg 1 Allert G, Sponholz G, Meier-Allmendinger D, Gaedicke G, Baitsch H (1994) Kurze Übersicht über die Lehraktivitäten des Ulmer Arbeitskreises für Ethik in der Medizin. Ethik Med 6: 99-104 Allert G, Sponholz G, Baitsch H, Kautenburger M (1998) Consensus Formation in Genetic Counseling: A Complex Process. In: Have ten HAMJ, Sass HM (eds) Consensus Formation in Healthcare Ethics. Kluwer, Dordrecht Boston London, S 193-207 Apel KO, Kettner M (Hrsg, 1993) Zur Anwendung der Diskursethik in Politik, Recht und Wissenschaft. Suhrkamp, Frankfurt Baumann ARN, Deber R (1989) Decision Making and Problem Solving in Nursing: An Overview and Analysis of Relevant Literature. Literature Review Monographs 3, University of Toronto Beauchamp TC, Childress JF (1989) Principles of Biomedical Ethics. Oxford University Press, New York, Oxford Benhabib S (1995) Selbst im Kontext. Gender Studies. Suhrkamp, Frankfurt Benhabib S (1998) Hannah Arendt - Die melancholische Denkerin der Moderne. Rotbuch, Hamburg Benhabib S (1999) Kulturelle Vielfalt und demokratische Gleichheit. Horkheimer Vorlesungen. Fischer, Frankfurt Birnbacher D (1996) Philosophie als sokratische Praxis. In: Girndt H (Hrsg.) Philosophen über das Lehren und Lernen der Philosophie. Sankt Augustin, S. 1 - 15 Bundesärztekammer (1996) 99. Deutscher Ärztetag in Köln. Entschließungen zum Tagesordnungspunkt III. Die Medizinischen Hochschulen im Wandel des Gesundheitswesens. Deutsches Ärzteblatt 93: 1191-1195 Bundesgesetzblatt (1989) Siebte Verordnung zur Änderung der Approbationsordnung für Ärzte vom 21. Dezember 1989: 2549-2560 Burger W, Scheffner D (1993) Der Berliner Reformstudiengang Medizin. psychomed 5: 270274 Cohen MD, March JG, Olsen JP (1972) A Garbage Can Model of Organizational Choice. Administrative Science Quaterly 4: 1-25 Dewey J, Tufts JH (1932) Ethics. Henry Holt and Company, New York DuBose ER, Hamel RP, O´Connell LJ (eds, 1994) A Matter of Principles? Trinity Press Int., Valley Forge, Pennsylvania USA Engelhardt v D (1994) Ethik in der medizinischen Ausbildung. Das Lübecker Modell: Grundkurs - Patientenseminar -Studientag. Ethik Med 6: 82-87 Fins JJ, Bacchetta MD, Miller FG (1997) Clinical Pragmatism: A Method of Moral Problem Solving. Kennedy Insitute of Ethics Journal, 7: 129-145 Fins JJ, Miller FG, Bacchetta MD (1998) Clinical Pragmatism: Bridging Theory and Practice. Kennedy Instiute of Ethics Journal, 8: 37-42 Flechsig KH (1996) Kleines Handbuch didaktischer Modelle. Neuland, Eichenzell Frewer A (Hrsg., 1993/1994): Ethik im Studium der Humanmedizin. Lehrsituation und Reformperspektive an deutschen Universitäten. Teil 1 u. 2 Palm & Enke, Erlangen und Jena Frey K (1996) Die Projektmethode. Der Weg zum bildenden Tun. Beltz, Weinheim Basel, 7. Auflage 38 Fuchs C (1987) Erziehung zur Ethikfähigkeit. Verantwortung für die medizinische Ausbildung. In: Schlaudraff U (Hrsg) Ethik in der Medizin. Tagung der Evangelischen Akademie Loccum vom 13. - 15. 12. 1985. Springer, Berlin Heidelberg New York, S 27-33 Habermas J (1992) Erläuterungen zur Diskursethik. Suhrkamp, Frankfurt a.M, 2. Auflage Heckmann G (1993) Das sokratische Gespräch. Weber, Zucht & Co, Kassel Heister E (1987) Ethik in der ärztlichen Ausbildung. Med. Dissertation, Universität Freiburg Heubel F (1994) Kolloquium ”Ethik in der Medizin”. Medizinethischer Unterricht am Marburger Fachbereich Medizin. Ethik Med, 6: 88-92 Hufnagel E (1993) Pädagogische Vorbildtheorien. Königshausen & Neumann, Würzburg Hunter KM (1991) Doctors´ Stories. The narrative Structure of Medical Knowledge. Princeton University Press, Princeton Jonsen AR (1994) Clinical Ethics and the Four Principles. In: Gillon R (ed.) Principles of Health Care Ethics. John Wiley & Sons, Chichester New York Brisbane Toronto Singapore, S 13-21 Kahlke W, Reiter-Theil S (1995) Lernziele für die Auseinandersetzung mit ethischen Problemen. In: Kahlke W, Reiter-Theil S (Hrsg) Ethik in der Medizin. Enke, Stuttgart, S 17-22 Kaiser FJ (1992) Der Beitrag aktiver partizipativer Methoden. Fallstudie, Rollenspiel und Planspiel zur Vermittlung von Schlüsselqualifikationen. In: Keim H (Hrsg) Planspiel, Rollenspiel, Fallstudie. Zur Praxis und Theorie lernaktiver Methoden. Bachem, Köln, S 62-90 Keller F, Allert G, Sponholz G, Baitsch H (1998) Ulmer Gesprächsforum "Klinische Ethik" Nieren und Hochdruckkrankheiten 27: 210 - 211 Klein-Lange M, Schlaudraff U (1997) Mehr davon wäre gut. Positives Echo auf Ethik-Seminare für AiPs. Niedersächsisches Ärzteblatt 70: 18-20 Krathwohl DR, Bloom BS, Masia BB (1978) Taxonomie von Lernzielen im affektiven Bereich. Beltz, Weinheim Basel Luhmann N (1996) Persönliche Mitteilung in einem Briefwechsel mit den Verfassern über "ethische Aspekte der genetischen Beratung" im Zusammenhang mit dem Konfliktfeld Recht auf Nichtwissen Miller FG, Fins JJ, Bacchetta MD (1996) Clinical Pragmatism: John Dewey and Clinical Ethics. Journal of Contemporary Health Law and Policy, 13: 27-51 Moreno J (1995) Deciding Together. Oxford University Press, New York Neitzke G,(1998) Ethische Fallseminare im Medizinstudium. Erfahrungen mit einer neuartigen Veranstaltung an der Medizinischen Hochschule Hannover. Niedersächsisches Ärzteblatt 1: 13-15 Nelson L (1996) Die sokratische Methode. Weber, Zucht & Co, Kassel. 2. Auflage Olsen JP (1979) In: March JG, Olsen JP (eds) Ambiguity and Choice in Organisations. 2.ed. Universitestsforlaget, Bergen, Norway, S 82-139 Ott K (1993) Zur Frage, worauf hin Ethik orientieren könne. In: Wils J-P (Hrsg) Orientierung durch Ethik? Eine Zwischenbilanz. Schöningh Paderborn, S 71-94 Pellegrino ED (1995) Toward a Virtue-based Normativ Ethics for the Health Professions. Kennedy Institute of Ethics Journal, 5: 253-277 Piper TR (1993) Rediscovery of Purpose: The Genesis of the Leadership, Ethics, and Corporate Responsibility Initiative. In: Piper TR, Gentile MC, Parks SD (eds) Can Ethics be Taught? Harvard Business School, Boston Ritschl D (1996) Zwischen Machbarkeit und Menschenwürde: Medizinethik in der Kontroverse. In: Brockhaus-Enzyklopädie. Jahrbuch 1995, Mannheim, S 227-230 39 Robert Bosch Stiftung (Hrsg, 1995) Das Arztbild der Zukunft. Arbeitskreis Medizinerausbildung der Robert Bosch Stiftung - Murrhardter Kreis. Bleicher, Gerlingen Roth WM (1995) Authentic School Science. Knowing and Learning in Open-Inquiry Science Laboratories. Kluwer, Dordrecht, Boston, London Sass HM (1996) Ethik-Unterricht im Medizinstudium. Methoden, Modelle und Ziele der Integration von Medizinethik in die medizinische Aus- und Fortbildung. Medizinethische Materialien Heft 108, Zentrum für Medizinische Ethik, Bochum Sass HM, Viefhues H (1988) Ethik in der ärztlichen Praxis und Forschung. Bochumer Materialien zur Medizinethik. duphar med script Schlaudraff U (Hrsg,1987) Ethik in der Medizin. Tagung der Evangelischen Akademie Loccum vom 13. - 15. 12. 1985. Springer, Berlin Heidelberg New York Schreier H (1991) John Dewey. Ein Wegbereiter der modernen Erlebnispädagogik? Klaus Neubauer, Lüneburg Schwarz JU (1994) Medizinethisches Seminar ”Wahrnehmung ethischer Probleme im klinischen Alltag”. Ein Versuch an der Universitäts-Kinderklinik Tübingen (1992/93).Ethik Med 40: 109-113 Seedhouse D (1998) Ethics, the Heart of Health Care. John Wiley & Sons, Chichester, New York, Weinheim, Brisbane. Singapore, Toronto, 2. Edition Seidler E (1987) Geleitwort. In: Schlaudraff U (Hrsg) Ethik in der Medizin. Tagung der Evangelischen Akademie Loccum vom 13. - 15. 12. 1985. Springer, Berlin Heidelberg New York Sponholz G, Meier-Allmendinger D, Kautenburger M, Gaedicke G, Baitsch H (1991) AiPFortbildung "Ethik in der Medizin". Die Ulmer Konzeption, erste Erfahrungen. Ethik Med 3: 68-77 Sponholz G, Allert G, Meier-Allmendinger D, Gaedicke G, Baitsch H (1994) Fortbildungsveranstaltung für Ärzte im Praktikum (AiP) zur Ethik in der Medizin. (Ethics in medicine: Teaching postgraduate medical doctors). Ethik Med. 6: 77-81 Sponholz G, Kohler E, Strößler M, Gommel M, Baitsch H (1995) Ethik in der Medizin in der neuen ÄAppO - was Studierende der Medizin sich wünschen. Zeitschr. f. Med. Ethik 41: 236241 Sponholz G, Kohler E, Blum, P, Kümmel WF, Bauer AW, Baitsch H (1997) Keinmal, einmal, viele mal? Ethik im Medizincurriculum - Wünsche der Studierenden. Zeitschr. f. Med. Ethik 43: 159-168 Wiesemann C (1994) Das Erlanger Modell. Urteilskraft und Handlungskompetenz als Lernziele des Ethikunterrichts. Ethik Med. 6: 93-98 Wissenschaftsrat: (1992) Leitlinien zur Reform des Medizinstudiums. Köln 40 ANHANG Die Arbeitsmappe Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer erhält zu Beginn des Ethikseminars eine Arbeitsmappe. Diese wurde von Mitgliedern des AK "Ethik in der Medizin" erstellt, sie wird ständig überarbeitet; die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, die Mappe durch eigene Materialien zu ergänzen. Übersicht über die Inhalte der Arbeitsmappe Texte zur Theorie: Definitionen, Prinzipien, Zitate aus der Literatur. Hinweise zur Falldiskussion: Zusammensetzung der Gruppe, Lernziele, Spielregeln. Ethik in der Praxis: Die Komplexität der Entscheidungssituationen, Beispiele wichtiger medizinethischer Konfliktfelder, Fragen zur Situation der Fort- und Weiterbildung, Kodizes, Richtlinien, Deklarationen, Berufsordnungen. Ausgewählte Literatur zur Bioethik, Hinweise zu Literaturdankenbanken. Hilfsmittel und Arbeitsbögen zur Analyse und zur Behandlung medizin-ethischer Konflikte (z. B. Bochumer Arbeitsbogen). Die Klassifikation von Lernzielen (nach Krathwohl et al. 1978 sowie Piper 1993) Haltungen, Einstellungen, Werte (Values, Attitudes, Beliefs) Empathie, Vertrauen, Teamgeist, Lust am Lernen, Verantwortung übernehmen usw. Fähigkeiten und Fertigkeiten (Skills) Diskurskompetenz, Problemlösungskompetenz, klinische Fähigkeiten und Fertigkeiten, Analysekompetenz, Urteilsfähigkeit usw. Wissen (Knowledge) Faktenwissen, Verfügungswissen usw. Theorien, Normen, Regeln Ordnungen usw. "it is a call (this book) to rebalance the educational trilogy of values, knowlege, and skills. Each is important; each is insufficient in isolation." (Piper 1993, S. 10) 41 PERSPEKTIVEN UND GEDANKEN ZUR MEDIZIN-ETHISCHEN AUSBILDUNG * Andreas Uhl, Claudia Lensing Arbeitskreis Ethik in der Medizin, Universität Ulm 1. GEDANKEN ZUR MEDIZINETHISCHEN AUSBILDUNG Bei der Ausarbeitung des Beitrages diskutierten wir die Frage: Warum der Bereich Ethik wichtig und notwendig für das Medizinstudium ist? Dem wollen wir folgende Überlegung voranstellen: Die Humanmedizin umfaßt mehr als nur Naturwissenschaft. Sie bedient sich zwar natur-wissenschaftlicher Methoden und Erkenntnissen, steht aber durch die Individualität der Patienten und Ärzte immer wieder vor komplexen Fragestellungen und Lösungen. Das Studium sollte Studierende darauf vorbereiten, daß sie in ihrem ärztlichen Handeln nur selten monokausale Entscheidungsoptionen vorfinden, sondern vielmehr mehrdimensionalen Entscheidungsprozessen gegenüberstehen. [1] Sei es auf der kulturellen Ebene: Eine schwangere Muslime möchte von ihrem Frauenarzt erfahren, welches Geschlecht ihr Kind (ca. 11. Schwangerschaftswoche) hat. Sollte es ein Mädchen sein, so wird sie die Schwangerschaft unterbrechen. Sie hat schon drei Töchter und ihr Mann akzeptiert nur noch einen schon lang ersehnten Sohn. Wie sollen wir als zukünftige Ärzte mit diesen uns widerstrebenden Konflikten umgehen? Oder auf der therapeutischen Ebene: Die heutigen Therapien der rheumatoiden Arthritis können nur symptomatisch erfolgen, erzielen auf lange Sicht keine Besserung und gehen mit vielen unerwünschten Wirkungen einher. Gleichzeitig ist bei jedem Patienten der Krankheitsverlauf sehr unterschiedlich. Wie soll nun mit einem neuen, noch nicht erprobten Therapiekonzept umgegangen werden? Oder muß ein im sterben liegender Patient vor dem Verdursten mit einer Infusion bewahrt werden? Ist es nicht möglich, daß wir den allgemein anerkannten Wert auf den Sterbenden übertragen, daß es grausam ist, einen Menschen verdursten zu lassen? In der Literatur gibt es Hinweise, daß auf hormoneller Ebene eine geringere Ausschüttung von * Der Beitrag entspricht inhaltlich dem Vortrag, den wir auf der Fachtagung „Nephrologie, Ethik und Ziele der Medizin” am 13. September 1997 in Ulm gehalten haben. Ein Anliegen der Organisatoren der Fachtagung war es, studentische Beiträge in ein hauptsächlich von Hochschullehrenden geprägtes Forum einzufügen, um die Distanz zwischen Lehrenden und Lernenden zu verkleinern. Wir griffen diesen Vorschlag auf und erarbeiteten einen Vortrag, in dem wir unsere Erfahrungen darstellten, die wir in den letzten vier bis fünf Jahren in Ethikseminaren gemacht hatten. Wir erleben in Ulm eine kontinuierliche Ausbildung in Ethik in der Medizin und sind selbst als Studierende in der Ausbildung von Studierenden engagiert. 42 Schmerzantagonisten (Opioide) beim exsikkiert Sterbenden stattfindet und dadurch ein weniger qualvoller Tod eintreten könnte. Diese Beispiele sollen einen Einblick in die Vielfältigkeit von Konfliktfeldern geben, die im ärztlichen Alltag auftreten können. Betrachten wir diese drei Beispiele genauer, so stellen wir fest, daß immer ein übergeordnetes Wertesystem des einzelnen zu einer jeweils individuellen Entscheidung oder Einstellung führt. Das Medizinstudium bereitet auf die Tätigkeit als Arzt vor, d.h. die Qualtät der ärztlichen Tätigkeit steht in einem direkten Zusammenhang mit der Ausbildung. Aus diesem Grund ist es wünschenswert, daß das Studium auf folgende ethische Bereiche vorbereitet: • Erkennen ethischer Konfliktfelder • Orientierung in der Pluralität medizin-ethischer Auffassungen • Problemlösungskompetenz • Kommunikation Findet eine Vorbereitung auf die genannte Problematik nicht statt, werden Studierende einem luftleeren Raum überlassen, der häufig nicht bewußt wahrgenommen wird. Erst im Praktischen Jahr oder in der Zeit als Arzt im Praktikum, wenn konkrete Probleme im Umgang mit Patienten, Angehörigen oder Kollegen entstehen, wird dieses Defizit erkannt. Wie sieht die gegenwärtige Vorbereitung aus? Dozierende, Ärzte und Forscher stellen in unserer Ausbildung, also im Sozialisierungsprozeß zum Arzt, Orientierungspunkte und Vorbilder dar. Wir als Studierende werden über Jahre hinweg durch deren Verhalten und Einstellungen geprägt. In keiner Lehrveranstaltung wird jedoch gefordert, das eigene Wertesystem, geschweige denn das der Dozierenden zu reflektieren oder zu hinterfragen. Statt dessen übernehmen wir unbewußt die vorgelebten Einstellungen (und die sind nicht immer die allerbesten!). Wir leben in einem offenen System. Auf die Medizin bezogen bedeutet dies, daß sich beispielsweise durch den medizintechnischen Erkenntniszugewinn auch die jeweiligen ethischen Fragestellungen wandeln. Folglich sollten Studierende in ihrer Ausbildung darauf vorbereitet werden. Die folgende Überlegung verdeutlicht dies: Vor 40 Jahren war es unwahrscheinlich, Beiträge mit der Überschrift zu lesen, wie „Der Mensch hat ein Recht zu sterben”[2]. Heute werden Artikel dieser Art häufiger veröffentlicht, da der medizinische Fortschritt eine Vielfalt an lebensverlängernden Maßnahmen ermöglicht und durch die neue Situation wiederum andere Probleme entstehen. Werden diese lebensverlängernden Maßnahmen bejaht, stellt sich ab einem bestimmten Punkt die Frage nach der Lebensqualität. 43 Dem Erlernen der oben aufgeführten Fähigkeiten steht ein Ziel voran: Das Wecken der Bereitschaft, medizinische Sachverhalte und Zusammenhänge selbständig auf ethische Aspekte zu untersuchen und die eigene moralische Grundhaltung zu reflektieren. Bei einer Umfrage unter Medizinstudierenden in der Vorklinik beobachtete Sohr, daß „ein Ruf nach mehr menschlichen Qualitäten” laut wird und oft die Meinung vertreten wird, daß „gute Ärzte nicht nur durch fachliche Fähigkeiten brillieren”[3]. Von Ärzten wird das Beherrschen von Operationstechniken erwartet ebenso moralisches Handeln. Es stellt sich die Frage, ob ethische Kompetenzen nicht selbstverständliche fachliche Fähigkeiten sind? Unsere Erfahrungen spiegeln sich in einer Befragung von Ulmer Studierenden der Medizin am Ende des ersten Semesters wieder [4]. 60% der Studierenden hatten zu diesem Zeitpunkt an einem Ethikseminar teilgenommen. Die Ergebnisse dieser Befragung zeigen, daß die große Mehrheit dieser Gruppe der Auffassung ist, Ethik in der Medizin sei ein wichtiger Lehrgegenstand und Studierende sollten schon früh auf das Erkennen und Bearbeiten ethischer Konfliktsituationen vorbereitet werden. Alle Studierenden, die an einem Wochenendethikseminar teilgenommen hatten, wünschten, daß Veranstaltungen zur Ethik in der Medizin studienbegleitend angeboten werden, wobei die Mehrheit fallorientierte Kleingruppenseminare bevorzugt. Die Gruppe derer, die keine Ethikveranstaltung besucht hatten, unterschied sich zum Teil deutlich in ihren Aussagen. Nur ca. 55% der Studierenden dieser Gruppe meinte z.B., daß die Vorbereitung auf das Erkennen und Bearbeiten ethischer Konflikte schon in den ersten Semestern stattfinden sollte. Ebenso stimmten auffallend weniger Studierende einem studienbegleitendem Angebot zu. Gerade in der Vorklinik sind Studierende hoch motiviert. Hier sollten Impulse von Seiten der Lehrenden gesetzt werden. Lind untersuchte bei deutschen Studierenden die Änderung der moralischen Urteilskompetenz während des Studiums [5]. Die Studierenden wurden in 2 Gruppen eingeteilt: Eine Gruppe von Medizinstudierenden und eine Gruppe anderer Studierender, worunter sämtliche andere Fächer fallen. An der Studie haben über den gesamten Zeitraum 104 Medizinstudenten und 604 Studenten anderer Studiengänge teilgenommen. Der C score hat einen Intervall von 0 bis 100 Prozent, wobei 0% die Abwesenheit moralischer Urteilskompetenz und 100% die perfekte Urteilskompetenz bedeutet. Als Ergebnis konnte, wie auch untenstehende Grafik zeigt, festgestellt werden, daß Medizinstudierende im Vergleich zur Gruppe der anderen Studierenden mit einer deutlich größeren moralischen Urteilskompetenz zu studieren beginnen. Diese Kompetenz läßt im Verlauf des Studiums deutlich nach. Im Vergleich mit der Gruppe der anderen Studierenden wird die Urteilskompetenz nach 13 Semestern sogar kleiner. 44 Ände rung de r moralische n Urte ilskompe te nz be i de utsche n Me diz instude nte n 49 C Score (%) 47 45 43 41 1 5 9 1 Semester =0,5 Jahre 13 Medizinstudenten Andere Studierende Grafik freundlichst überlassen von Georg Lind; Konstanz [5] Welche Schlüsse können aus der Studie von Lind gezogen werden? Unseres Erachtens ist es zunächst wichtig, das Interesse an moralischen Fragen zu fördern, um die Entwicklung gegenläufig zu beeinflussen oder das hohe Maß an Idealismus in professionelle Handlungsoptionen für den klinischen Alltag umzuwandeln. Was für Gründe gibt es für das Nachlassen der moralischen Urteilskompetenz im Verlauf des Medizinstudiums? Liegt es an der Konfrontation mit der Realität oder daran, daß im Rahmen des bisherigen Studienplans keine Reflexion der Erfahrungen im Klinikalltag stattfindet? Ein weiterer Aspekt, warum es zu einer Änderung der moralischen Urteilskompetenz bei Medizinstudenten während dem Studium kommt, könnte auch sein, daß ein medizinisch guter Arzt viel Wissen benötigt, um dem Patienten eine möglichst gute Behandlung zukommen zu lassen und somit beim Medizinstudenten der Wissensbereich in den Vordergrund tritt und andere Bereiche wie die Ethik nur noch von unter geordnetem Interesse sind. Eine Forderung an eine neue Approbationsordnung ist, diesem Dilemma gerecht zu werden, in dem eine Verknüpfung der verschiedenen Bereiche stattfindet und studienbegleitend Ethik in der Medizin unterrichtet wird. 2. ARBEITSKREIS ETHIK IN DER MEDIZIN DER UNIVERSITÄT ULM Der Arbeitskreis „Ethik in der Medizin“ ist ein Zusammenschluß von Pflegekräften, Ärztinnen und Ärzten, Studierenden der Medizin und Biologie, Naturwissenschaftlern, Juristen, Psychologinnen und Pädagogen, die überwiegend an der Universität Ulm tätig sind. Ein Hauptziel dieser Gruppe ist die Einübung und Förderung der Ethikfähigkeit für Alle die 45 im Gesundheitswesen und / oder in der Forschung tätig sind. Derzeit hat der Arbeitskreis 60 Mitglieder. Die Ethikkurse sind freiwillig, die Teilnahme und der Erfolg eines Seminars beruht auf dem Engagement des Einzelnen. Die Herausarbeitung der Konfliktfelder hängt im wesentlichen davon ab, wie sich die Teilnehmer einbringen, der Moderation fällt die Aufgabe zu, einzelne Impulse zu setzen, Ideen beizusteuern. Statistisches zum Arbeitskreis In der Zeit vom Sommersemester 1994 bis Ende Wintersemester 1997/98 wurden vom Arbeitskreis Ethik in der Medizin 56 Seminare mit insgesamt 750 Teilnehmern durchgeführt. Seminare, die im Rahmen des Praktikums der Berufsfelderkundung und innerhalb der Erstsemestereinführung der Fachschaft Medizin veranstaltet wurden, sind hier nicht eingerechnet. Die Zahl der Teilnehmenden pro Semester stieg von ca. 40 im Sommersemester 1994 auf ca. 150 im Wintersemester 1997/1998. Zum Vergleich: Einem Jahrgang gehören 260 bis 300 Studierende an. Welche Erfahrungen gibt es in bezug auf ethische Ausbildung in den ersten Semestern des Medizinstudiums? 1996 wurde eine Befragung unter Studierenden der Medizin der Universität Ulm des 1. Studienjahres durchgeführt (n=250; dies entspricht 96% des Jahrgangs) [6]. Die Aussage „Als Unterrichtsform eignet sich am besten die fallorientierte Kleingruppenarbeit” wurde zu 77% als zutreffend und nur zu 6% als nicht zutreffend bewertet. 16% gaben an, es nicht zu wissen. Eine Befragung von 661 Erstsemester in der Medizin des Jahrgangs 1995/96 der Universitäten Heidelberg, Mainz und Ulm ergab folgende Ergebnisse: Ca. 90% der Befragten wünschten sich ein frühes Vorbereiten auf das Erkennen und Bearbeiten ethischer Konflikte. So gut wie alle (ca. 96%) stimmten der Aussage zu, daß Ethik in der Medizin ein wichtiger Sind Sie der Auffassung, daß Ethik in der Medizin ein wichtiger Lehrgegenstand ist? N = 661, Mainz n = 206, Ulm n = 250, Heidelberg n = 205 100 Rel. Häufigkeit in % 80 Mainz Ulm 60 Heiddelberg 40 20 0 Ja Nein Keine Angabe Lehrgegenstand sei. 46 Aufbau und Ablauf der Ethikseminare: Die Seminare finden in aller Regel am Freitag Abend und am Samstag Vormittag statt. Dieser für eine universitäre Veranstaltung ungewöhnliche Zeitrahmen wird von studentischer Seite begrüßt, weil dadurch die Seminare sich vom sonstigen Uni- Alltag abgrenzen. In der Regel stellt am Freitagabend eine ärztliche Referentin oder ein ärztlicher Referent aus der Klinik, seltener ein(e) Patient(in), ein Mitglied des Pflegepersonals, ein(e) Angehörige(r) eines Patienten oder ein (e) Klinikseelsorgerin, einen selbst erlebten Fall in sequenzierten Abschnitten vor [7]. Der Referent beschränkt sich auf die Berichterstattung und fungiert als Experte für die Beantwortung von Fachfragen. Vor dem Seminar werden die ReferentInnen durch die ModeratorInnen mit den Lernzielen vertraut gemacht (siehe unten: Spielregeln). Die Aufgabe der Moderatoren - ärztliche Mitglieder und studentische TutorInnen des Arbeitskreises - umfaßt neben der Steuerung und Moderation des Seminars insbesondere das Wecken und Fördern medizinethischer Kompetenzen der Studierenden durch gezielte Intervention an der passenden Stelle. Zur Erläuterung der medizinethischen Komponenten kann von den Moderatoren Kleinstgruppenarbeit, eine Rollenspiele Arbeitsmappe oder Planspiele herangezogen können werden. Diskursfähigkeit Durch und praxisorientiertes Handeln intensiv geübt werden. Spielregeln für alle Seminarteilnehmenden • Einander zuhören • Am konkreten Fall bleiben • FRAGEN KÖNNEN JEDERZEIT GESTELLT WERDEN • Alle haben gleiche Rechte FÜR DIE MODERATOREN/REFERENTINNEN GELTEN ZUDEM NOCH ERWEITERTE SPIELREGELN • Personale Trennung von Fallbericht und Moderation • Kein Dozieren und Monologisieren • Vermeiden vorschneller moralischer Bewertungen • Geduld • Vermeiden von Tadel 47 Eine wichtige Rolle spielen die Kaffeepausen und das gemeinsame Frühstück am Samstagmorgen. Dadurch wird die Möglichkeit für ein ungezwungenes Gespräch unter den Teilnehmern und Kontakt zwischen Lernenden und Lehrenden hergestellt. Am Ende des Seminars werden unter den studentischen Teilnehmern Evaluationsbögen verteilt. Auf diese Art und Weise bekommen die Moderatoren eine direkte (anonyme) Rückmeldung über das Seminar. Ein wichtiger Punkt sind die freien Äußerungen, durch die es möglich wird, einzelne Gesichtspunkte kritisch zu überarbeiten. Ziele der Ethikseminare In den Ethikseminaren in Ulm wird versucht ein Gleichgewicht zwischen den drei Bereichen Wissen (knowledge), Fähigkeiten (skills), Werte (values, beliefs, attitudes) herzustellen. Piper bezeichnet dies als Voraussetzung für ein sinnvolles und effektives Lernen [8]. Fuchs beschreibt dies im Zusammenhang mit Ethik auch als üben der Ethikfähikeit [9]. Trilogie des Lernens Werte / Einstellungen Fähigkeiten Wissen Die Vorlesungen und Praktika des Pflichtlehrplans decken hierbei den Bereich Wissen ab. In den Ethikseminaren liegt der Schwerpunkt auf den Bereichen Fähigkeiten und Werte, denn „...das Übergewicht an Wissensvermittlung vernachlässigt nicht nur die Fertigkeiten, sondern in besonderer Weise die Werte, Einstellungen und Haltungen, die für den ärztlichen Beruf unabdingbar sind” [10]. Daraus leiten sich die konkreten Lernziele der Seminare ab: Ausbildung und Training von Kompetenzen zur Erkennung, Benennung und Lösung von ethischen Konflikten, sowie Einüben von Diskurs- und Reflexionsfähigkeit [11]. Hierbei wird bewußt auf einen belehrend-paternalistischen Vorlesungsstil verzichtet, und statt dessen eine aktive Teilnahme am Seminargeschehen gefördert: Zwischenfragen sind jederzeit erlaubt und nach jedem Berichtsabschnitt des Referenten können wir Studierende unsere Vorstellungen in der Gruppe diskutieren. Wir üben das Sokratische Gespräch. 3. FALLBEISPIEL 48 Der folgende Fall verdeutlicht die oben dargestellten Lernziele und Rahmenbedingungen. Um den sequenzierten Ablauf zwischen Fallberichtschilderung und Diskussion im Forum herauszustellen haben wir die Fallschilderung bzw. die Unterbrechung durch die Moderatoren hervorgehoben. Erste Fallschilderung durch den Referenten Der Leiter der Sektion Nephrologie der Universität Ulm, berichtete von einer 34jährige Patientin, die sich bei ihm zunächst ambulant wegen Schmerzen im Bereich der Nieren und Kopfschmerzen vorgestellt hat. Zur Vorgeschichte: 1979 wurde der Patientin wegen eines Hydrocephalus ein Ventil zur Ableitung des Liquors implantiert. Die Operation verlief komplikationslos jedoch entwickelte die Patientin postopertiv häufig Kopfschmerzen und bekam deshalb vom Hausarzt Schmerzmittel wie Paracetamol verschrieben. Die jetzt aufgetretenen Flankenschmerzen könnten auf eine Schädigung der Nieren hinweisen, die wiederum durch den regelmäßigen Gebrauch von Schmerzmittel bedingt sein könnten. Unterbrechung Die Moderatoren Helmut Baitsch und Gerlinde Sponholz unterbrachen den Fallbericht, um zunächst medizinische Fragen im Plenum zu klären. Da die Teilnehmer im wesentlichen aus den frühen Semestern kamen, wurden zunächst medizinisch grundlegende Fragestellungen geklärt, wie z. B.: Was ist ein Nephrologe? Was ist ein Hydrocephalus? Was ist Paracetamol? Welche Organe werden durch Schmerzmittel wie Paracetamol geschädigt? Schon bei der Klärung medizinischer Inhalte zeigte sich die grundlegende Schwierigkeit, daß die meisten Teilnehmer es nicht gewohnt sind, Fragen zu stellen. Eine Frage zu stellen bedeutet in gewisser Weise, daß man sich nicht sicher ist oder etwas nicht weiß – und die wenigsten von uns wurden dazu erzogen, Unsicherheit und Nichtwissen preis zu geben. In einer solchen Situation sind Fragen die von Moderatoren gestellt werden wichtig. Um die Fragen zu strukturieren benutzten wir den Bochumer Arbeitsbogen. Was für einen Eindruck hinterlies die Patientin beim Referenten? Der Referent beschrieb die Patientin als intelligent und aufgeschlossen, jedoch in bezug auf den Schmerzmittelgebrauch zeigte er sich ihren Angaben gegenüber eher skeptisch. Er hatte den Eindruck, daß die Patientin sehr viel mehr Schmerzmittel einnahm, als sie ihm gegenüber angab. Die Moderatoren fragten, ob aus der bisherigen Fallschilderung des Referenten schon ethische Konflikte zu erkennen sind? In der Gruppe gab es ein buntes Bild an Meinungen. Ein Teilnehmer stellte die Frage, was diese Fallschilderung mit Ethik zu tun hätte, er könne hierin keinen Konflikt sehen. Andere sahen ein Problem in der Arzt-Patientenbeziehung, da der Arzt nur begrenzt Zeit für 49 einen Patienten aufbringen kann und diese in diesem Fall nötig sei, um bei der Patientin die Einsicht bezüglich der Schmerzmedikamenteneinnahme zu ändern. Ein weiterer Teilnehmer war erstaunt, daß ein Medikament dem Patienten schaden kann. Dabei stellte sich die Frage, wie sich der Patient selbst schützen kann und wie der Patient seitens der Gesellschaft geschützt werden kann? Die Aufgabe der Moderatoren bestand darin ethische Konfliktfelder zu fokussieren, um somit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen roten Faden in die Hand zu geben. Eine Hilfestellung waren hier die in der Ulmer-Ethikmappe enthaltenen ethischen Prinzipien. Prinzipien der „mittleren” Ebene nach Beauchamp und Childress erweitert nach Maßgabe unserer Erfahrungen [12] • Gutes tun • nicht schaden • Wahrhaftigkeit • Gerechtigkeit • Verschwiegenheit • Glaubwürdigkeit • Verantwortung • Vertrauen • Autonomie und Selbstbestimmung Jedoch stellte sich hier schon bei der Bearbeitung des ersten Prinzips die Frage, wie sieht dieses „Gutes tun” aus? Jeder Teilnehmer brachte seine eigenen Werte und Vorstellungen mit, die geprägt sind durch Erziehung, Bildung und eigenes Nachdenken. Fortsetzung der Fallschilderung Die Patientin wurde stationär aufgenommen. Die Nierenretentionswerte (z. B. Kreatinin) der Patientin stiegen im Laufe der nächsten Tage stark an. Es wurde vermutet, daß die Patientin trotz der Gespräche weiterhin und in hohem Maße nierenschädigende Medikamente einnahm bzw. die Niere schon so stark geschädigt war, daß der jetzige Verlauf durch alleiniges Absetzen der Medikamente nicht mehr aufzuhalten war. Referent und Patientin einigten sich darauf, daß sich die Patientin konsiliarisch in der Schmerzambulanz vorstellt, um das weitere Procedere hinsichtlich der Schmerzmedikation und der eventuell schmerzmittelinduzierten Kopfschmerzen abzuklären. 50 Unterbrechung Es wurden zunächst wieder medizinische Fragen geklärt. In die anschließende Diskussion streuten die Moderatoren folgende Themen ein: 1. Wie ist das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patientin? 2. Ist die Autonomie der Patientin gewährleistet? 3. Welche Handlungsoptionen hat der Arzt? Einige Teilnehmer sahen das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient beeinträchtigt, indem die Problematik mit der Patientin in die Schmerzambulanz verlagert wurde. Andere Teilnehmer sahen das Vertrauensverhältnis dadurch eher gestärkt, weil der behandelnde Arzt Kompetenzen abgeben konnte und sich mit anderen Fachärzten gemeinsam für das Wohlergehen der Patientin einsetzte. Der Schritt wurde auch als ein Zugewinn an Autonomie seitens des Patienten gewertet, da sie sich mehrere Meinungen anhören konnte. Fortsetzung der Fallschilderung Die Nierenretentionswerte sowie die Elektrolyte der Patientin stiegen im weiteren stationären Verlauf stark an, so daß sich das Vollbild einer terminalen Niereninsuffizienz entwickelte, welches ohne ein ärztliches Eingreifen mittels einer Dialyse für die Patientin tödlich enden würde. Die Nieren der Patientin war zu diesem Zeitpunkt irreversibel geschädigt. Unterbrechung Im Verlauf der Diskussion kamen wir auf den Punkt ”mangelnde Ressourcen” zu sprechen, der im Krankheitsverlauf für Patientin und Ärzte an Bedeutung zunehmen könnte. Es wäre denkbar, daß die Nierenschädigung so gravierend ist, daß über eine Nierentransplantation nachgedacht werden muß. Da in Deutschland der Bedarf an Spendernieren, um ein Vielfaches größer ist als das Angebot fragten wir uns, nach welchen Kriterien entschieden werden soll, welcher Patient eine Niere bekommen soll. Soll sie grundsätzlich der jüngere Patient bekommen? Was aber, wenn der Jüngere seine Nieren mehr oder weniger selbstverschuldet, wie in diesem Fall durch Schmerzmittelabusus, geschädigt hat. Sollte sie dann doch der Ältere bekommen, der z.B. eine neue Niere aufgrund eines angeborenen Defektes benötigt und bisher ein gesundes Leben geführt hat? Für die Moderation bestand die Schwierigkeit, die Diskussion nicht ins allgemeine abgleiten zu lasssen, sondern immer wieder zu fragen, welche konkrete Bedeutung und Konsequenz ein allgemein oder gesellschaftspolitisch formulierter Gedanke für die Patientin hat? 51 4. ERFAHRUNGEN UND FAZIT Als im Sommersemester 1994 erstmals Ethikseminare für Studierende der frühen Semester angeboten wurden, befanden wir uns in der angesprochenen Zielgruppe. Wir meldeten uns als Interessenten und nahmen im folgenden Semester an zwei weiteren Seminaren teil. Dabei blieb es jedoch nicht. Die Seminare begeisterten uns, so daß wir weitere Seminare besuchten. Was waren die Gründe für diese Begeisterung? Die Seminare unterscheiden sich in vieler Hinsicht von den üblichen Veranstaltungen der Universität. Folgende Aussagen von Studierenden beschreiben diese Situation umfassend: • „Atmosphäre, Verhalten der Dozenten (nicht von oben herab, nehmen einen ernst, hören zu), andere Art der Lernform, aber doch viel effektiver als Vorlesung”. • „...Ermutigung alles sagen zu dürfen und zu fragen...”. • „Kein Frontalunterricht sondern Unterrichtsgespräch mit Möglichkeit zur aktiven Beteiligung und Fragestellung”. • „Der Weg zur Selbständigkeit in ethischen Fragen ist lang. Ich darf nicht erst nach dem Studium, wenn ich plötzlich mit ethischen Fragen konfrontiert werde, anfangen, mich damit auseinanderzusetzen”. Den Zitaten aus den Evaluationsbögen schließen wir uns an. Rückblickend können wir feststellen, daß es sinnvoll ist, sich mit den anfangs aufgeführten Lernzielen und Kompetenzen auseinanderzusetzen. Hierbei ergaben sich im Laufe der Semester verschiedene Schwerpunkte: Zu Beginn stand die Entwicklung und Festigung unseres eigenen Wertesystems im Vordergrund. In der Schule wurden wir eher darauf trainiert, Wissen aufzunehmen, ohne dieses zu hinterfragen. Bei den Diskussionen in den Ethikseminaren geschieht etwas ganz anderes: Wir werden mit Werte-systemen anderer konfrontiert, beginnen das eigene zu reflektieren und kommen so zu Entscheidungen, für die wir Verantwortung übernehmen können. Im Entwurf zur 8. Novelle der ÄAppO 1995 wurde erstmals der Bereich Ethik in der Medizin explizit als Lehr-/Lerngegestand vorgesehen. Der Arbeitskreis beschäftigt sich mit der Frage, wie Ethik gelehrt und gelernt werden könnte. Bei diesen Überlegungen sollten diejenigen zu Wort kommen, die Erfahrungen in medizinethischer Ausbildung gesammelt hatten. Zunächst wurde grundsätzlich eine praktische, anwendungsorientierte ethische Ausbildung während des Studiums gefordert. Sie sollte in Form von Kleingruppenseminaren stattfinden, wie wir sie vorher beschrieben haben. Vorlesungen wurden nicht befürwortet. Die 52 eine Hälfte der Befragten wünschte sich die Ethikseminare als Pflichtveranstaltung für alle, während die andere Hälfte Wahlpflichtfächer bevorzugte, in denen z.B. die ethischen Themen gewählt werden könnten. Als Problem wurde immer wieder genannt, daß durch eine Pflichtteilnahme die offene Atmosphäre zerstört werden könnte. Vielen Studierenden war es wichtig, daß eine kontinuierliche Ausbildung während des Studiums stattfindet. Eine einmalige Veranstaltung würde als nicht ausreichend angesehen. Prüfungen wurden von so gut wie allen Studierenden abgelehnt. Falls jedoch geprüft werden müßte, sollte diese Prüfung in Form einer mündlichen Gesprächsrunde mit Falldiskussion stattfinden. Strikt abgelehnt wurden Multiple-choice-Prüfungen, sowie das reine Abfragen ethischer Lehrsätze. Es zeigte sich dagegen, daß die Vermittlung ethischer Theorie gewünscht wurde. Es ist jedoch wichtig, daß sie sich immer auf den jeweiligen Fall bezieht. "Theorie von Anfang an beim jeweiligen Fallbeispiel einstreuen" lautet eine Aussage. Der Wunsch nach einer ethischen Ausbildung beruht bei vielen Studierenden darauf, daß sie schon vor dem Studium ethische Problem im ärztlichen Bereich (z.B. während des Krankenpflegepraktikums oder Zivildienstes) erlebt hatten. Sie äußern, genauso wie viele junge Ärzte, daß sie unvorbereitet mit Konflikten konfrontiert wurden, denen sie nicht gewachsen waren. Durch diese Erlebnisse steht bei vielen das Erlernen der Fähigkeit zum Diskurs mit Patienten, Angehörigen, Pflegepersonal und ärztlichen Kollegen im Vordergrund der ethischen Ausbildung [7]. Im Laufe der Zeit wurde uns die zentrale Stellung der Sprache bewußt. Wir erlebten und erleben sie als den Schlüssel zum Erwerb der oben angesprochenen Kompetenzen. Wie ist das zu verstehen? Sprache hat vier Funktionen: • Expressive • Deskriptive • Argumentative • Kommunikative [13] Bei der Bearbeitung eines Falles werden alle vier Funktionen benötigt. Die Analyse eines Konflikts basiert auf einer Beschreibung der jeweiligen Situation. Die Vorbereitung und Durchführung eines Rollenspieles verlangt Diskurs-, Verbalisierungs-, Bewertungs- und Begründungskompetenz. Am grundlegendsten erscheint uns jedoch die vierte Funktion: das miteinander Kommunizieren. Dies setzt die aktive Teilnahme aller voraus. Aktiv sein bedeutet z.B. auch, bei Unklarheiten nachzufragen; wo bekommen wir die Fähigkeit gelehrt, zuzugeben, etwas nicht zu wissen oder nicht verstanden zu haben? Weiterhin sind wir durch das aktive Kommunizieren in Prozesse involviert, in denen wir mit unserem eigenen 53 Wertesystem konfrontiert werden. In einem solchen Rahmen können wir zu Entscheidungen kommen, die nicht nur von unseren herkömmlichen Wertmaßstäben geprägt sind. Um besser verständlich zu machen, warum uns die ethische Ausbildung, wie wir sie erleben, wichtig ist, müssen wir einen kurzen Blick auf den Studienplan in der Ausbildung zum Humanmediziner werfen. Innerhalb von 10 Semestern werden sämtliche Einzelfächer unabhängig von einander gelehrt. Dies bedeutet, daß anschließend naturwissenschaftliches Wissen vorhanden ist, die Anwendung auf die praktische Arbeit mit einem Patienten jedoch nicht erlernt wurde. In den Ethikseminaren lernen wir uns aktiv in einen Lernprozeß zu integrieren, teilzunehmen und uns selbst und unser Umfeld kritisch zu betrachten. Dabei soll nicht der Eindruck entstehen, es sei überflüssig, naturwissenschafliche Fakten zu lehren und zu lernen, dagegen die ethische Ausbildung das “Ein-und-Alles” im Medizinstudium sei. Es ist nicht vorstellbar, den technischen Bereich einer Diagnose auszuklammern oder einem Patienten aufgrund mangelnden Wissens Behandlungsoptionen vorzuenthalten. Genausowenig aber darf der ethische Bereich fehlen, da hier Fähigkeiten vermittelt werden, mit Wissen und medizinischen Können verantwortungsvoll mit dem Patienten zusammenarbeiten zu können. Wir wünschen uns eine Ausbildung, in der die drei Bereiche Wissen, Fähigkeiten und Werte / Einstellungen gleichberechtigt und miteinander erworben werden können. Wir denken, daß die Universität neben der Aufgabe der Wissensvermittlung, die kompetente Ärzte hervorbringen soll, auch die Verantwortung hat, Studierenden ein “Handwerkszeug” mitzugeben, um im späteren medizinischen Alltag, sei es als praktizierender Arzt oder Forscher, ethische Konflikte erkennen und entsprechend verantwortungsbewußt handeln zu können. Wir, und das sind alle Studierende, die im Arbeitskreis engagiert sind, haben diese Unterichtsform als eine erlebt, die Studierende in Begeisterung und Staunen versetzen kann. 54 LITERATUR: 1. Keller F: Mehrwertige Logik bei der medizinischen Entscheidungsfindung. Internistische Welt, 11:281-284, 1998 2. Jonas H: Technik, Medizin und Ethik. Suhrkamp, 242 ff, 1985 3. Sohr S: Menschenkenntnis als Lernziel? Auf der Suche nach dem „guten“ Arzt. Psychomed. 7. 93 – 95, 1995 4. Sponholz G, Kohler E, Gommel M, Callsen A, Bauer A, Meier-Allmendinger D, Allert G, Keller F, Baitsch H: Ethik in der Medizin - Sind Studierende daran interessiert? Medizinische Ausbildung 13/2:103 - 110, 1996 5. Lind G: Are helpers always moral? Empirical findings from a longitudinal study of medical students in Germany. Invited paper to be presented at the reginal conference of the International Council of Psychologists (ICP), Padua, July 1997 6. Sponholz G, Kohler E, Blum P, Kümmel WF, Bauer AW, Baitsch H: Aus der Forschung, Keinmal, einmal, viele mal? Ethik im Medizincurriculum – Wünsche der Studierenden. Zeitschrift für medizinische Ethik, 43:161, 1997 7. Gerlinde Sponholz G, Allert G, Keller F, Meier – Allmendinger D, Baitsch H: Das Ulmer Modell der medizinethischen Lehre - sequenzierte Falldiskussion für die praxisnahe Vermittlung medizinethischer Kompetenz (Ethikfähigkeit), Zentrum für medizinische Ethik, Medizinethische Materialien Heft 121, Bochum 1999 8. Piper TR: Rediscovery of Purpose: The Genesis of the Leadership, Ethics, and Corporate Responsibility Initiative. In: Piper TR, Gentile MC, Parks SD (eds) Can Ethics be Taught? Harvard Business School, Boston (1993) 9. Fuchs C: Erziehung zur Ethikfähigkeit. Verantwortung für die medizinische Ausbildung: In: Schlaudraff U. (Hrsg.) Ethik in der Medizin. Tagung der evangelischen Akademie Loccum vom 13. – 15. 12 1985. Springer Berlin Heidelberg New York, S. 27-33, 1987 10. Sponholz G, : Ethik in der Medizin in der neuen ÄAppO – was Studierende sich wünschen. Zeitschrift für medizinische Ethik, 41/3:237, 1995 11. Sponholz G, Baitsch H, Keller F, Allert G, Meier-Allmendinger D: Ethik in der Medizin die Fallstudie, Modell für die fächerintegrierende Lehre. Medizinische Ausbildung, 1/5, S. 8 ff, 1996 12. Beauchamp TC, Childress JF: Principles of biomedical ethics. Oxford University Press, Oxford 1979 13. Kahlke W., Reiter-Theil S.: Ethik in der Medizin, Enke Verlag, 17 ff, 1995 EIN WORT DES DANKES Zunächst möchten wir den Herausgebern dieses Heftes danken, die es ermöglichten den Beitrag interessierten Lesern und Leserinnen zur Verfügung zu stellen. Besonderer Dank gilt den Initiatoren des Arbeitskreises Ethik in der Medizin an der Universität Ulm, die es durch Ihren Einsatz ermöglichten, daß wir als Studierende eben die beschriebene Lernform kennen lernten; darüber hinaus danken wir für die interessanten Diskussionen, Anregungen, die den Beitrag in die Form gebracht haben, in der er jetzt vorliegt. 55 ZUSAMMENFASSUNG: Die Autoren stellen den Ulmer Ansatz eines narrativen und diskursiven Unterrichtsmodells in medizinischer Ethik vor, sowohl aus studentischen Perspektive (Uhl, Lensing) als aus der Unterrichtenden (Sponholz, Allert, Keller, Meier-Allmendinger, Baitsch). Die mit Fallstudien arbeitende didaktische Methode ist praxisnah und diskursiv. ABSTRACT: The authors present a narrative and discursive model of teaching medical ethics, from the perspecrtive of medical students (Uhl, Lensing) and from the group of teachers who have developed this model (Sponholz, Allert, Keller, Meier-Allmendinger, Baitsch). This Ulm diadactical method is discursive and close to clinical practice. 56 Zentrum für Medizinische Ethik Medizinethische Materialien Sehr geehrte Damen und Herren, an dieser Stelle befindet sich in der gedruckten Version die Auflistung unserer Veröffentlichungen aus der Reihe "Medizinethische Materialien." Da es sich bei den PDF- Dokumenten zum Teil um ältere Veröffentlichungen handelt und die darin aufgeführte Liste der "Medizinethischen Materialien" daher nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist, bitten wir Sie, sich im Internet auf unserer Homepage über neue Veröffentlichungen zu informieren. www.medizinethik-bochum.de 57 58