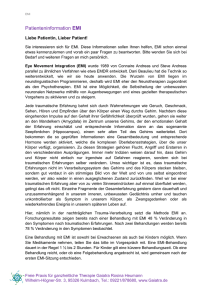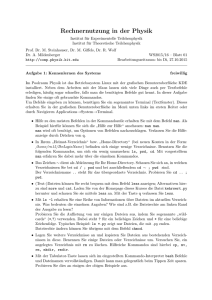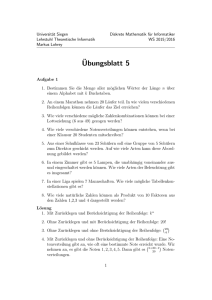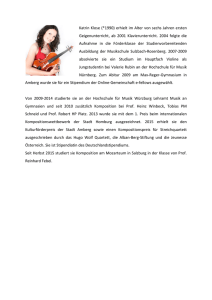Universität für Musik und darstellende Kunst Wien Algorithmische
Werbung

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Magister artium der Studienrichtung Musikerziehung Algorithmische Komposition Theoretischer Überblick und praktische Anwendungsbeispiele György Bárány Juli 2005 Institut für Analyse, Theorie und Geschichte der Musik Betreuer: a. o. Univ.-Prof. Dr. Gerold W. Gruber Vorwort Musik ist sicherlich die abstrakteste und am schwersten faßbare Kunstform, wenngleich sie heute wahrscheinlich zu den präsentesten gehört. Obwohl sie es vermag, Menschen mit wenigen, eigentlich inhaltslosen Elementen zu tiefsten Emotionen zu rühren, hat sie wesentlich mehr mit Mathematik zu tun als beispielsweise Literatur oder Malerei. Sie unterliegt physikalischen Gesetzmäßigkeiten, repräsentiert geometrische Strukturen und spiegelt logische Regeln wider. Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit der Fragestellung, ob hinreichend komplexe mathematische Zusammenhänge im musikalischen Kontext es ermöglichen können, menschliche Kreativität zu simulieren oder gar zu ersetzen. Musik kann als hohe Kunst, aber auch als Handwerk gesehen werden, und die Frage, wie gut man dieses Handwerk beherrschen muß, um Kunst schaffen zu können, ist legitim und nicht leicht zu beantworten. Es sind Hilfestellungen denkbar, die das Komponieren auf ganz andere Gebiete verlagern und für die musikalisches Vorwissen nicht unbedingt notwendig ist. Die damit zusammenhängenden theoretischen und praktischen Fragestellungen, die nicht nur die Musik selbst oder mathematische Hilfsmittel betreffen, sondern auch philosophische, soziologische oder rechtliche Aspekte haben können, sollen hier ebenfalls behandelt werden. Die Relevanz des hier diskutierten Themas beschränkt sich nicht allein auf die Kreativitäts- und Intelligenzforschung, sondern berührt auch Disziplinen wie Musikgeschichte, -theorie, -pädagogik und -soziologie. Die vorliegende Arbeit möchte deshalb verschiedentliche Impulse zur weiteren Beschäftigung mit der Materie geben. Nach einer Einführung in die Thematik und der Klärung der für die Diskussion notwendigen Begriffe werden die verschiedenen Motivationen für algorithmische Komposition anhand eines musikgeschichtlichen Überblicks dargelegt. Im Anschluß daran erfolgt eine genauere Vorstellung einiger ausgewählter Beispiele solcher Kompositionstechniken, die sowohl theoretisch durchleuchtet als auch praktisch angewandt werden, um am so komponierten Output die Instrumente der Musikanalyse einsetzen zu können. Die Schlußfolgerungen, die sich daraus ergeben, können letztendlich hoffentlich brauchbare Antworten auf die offenen Fragen liefern. Diese Arbeit wurde in vollem Bewußtsein und unter Beachtung der gesetzlich vorgeschriebenen Übergangsfrist in alter Rechtschreibung verfaßt. Für den 2 Satz zeichnet die Open-Source-Software LATEX1 verantwortlich, der Notensatz ist mit dem ebenfalls freien Programm LilyPond2 erstellt worden. Mein Dank gilt zuvörderst meinen Eltern, die mir meinen bisherigen Lebensweg und mein Studium u. a. biologisch, ideell und finanziell ermöglicht und geprägt haben; meinen Brüdern, die trotz zum Teil unterschiedlicher Interessen sowohl an meinem persönlichen als auch meinem akademischen Werden aktiv teil hatten und auch auf technische Fragen betreffend der theoretisch einfachen, praktisch aber nicht immer ganz reibungslosen Einbindung von LilyPond in LATEX mehr oder minder wertvolle Antworten liefern konnten; sowie meiner Lebenspartnerin und wichtigsten Motivatorin Marielies Klebel, die mir nicht nur mit einer gesunden Mischung aus Geduld und Ungeduld sowohl beim Reifungsals auch beim Fertigstellungsprozeß der vorliegenden Arbeit tatkräftig zur Seite stand, sondern auch eine sehr schöne Perspektive auf ein weiteres erfülltes gemeinsames Leben bietet. Von den vielen Einflüssen meiner universitären Ausbildung möchte ich in erster Linie meinen Diplomarbeitsbetreuer Dr. Gerold W. Gruber hervorheben. Er hat mir die Zeit für die langsame Entstehung dieser Arbeit gewährt und bei Bedarf Hilfestellungen angeboten. Außerdem hat er mir, wie auch viele andere meiner Lehrer, nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch neue Sichtweisen eröffnet und Mut zum Hinterfragen und selbständigen Erkennen gegeben. Zu danken habe ich ebenfalls meinen FreundInnen und StudienkollegInnen, im besonderen Maga. Elisabeth Wiesbauer für alles mögliche (u. a. ihre Erfahrungen mit MS Word3 , die nicht unerheblich daran beteiligt waren, mich für die Verwendung von LATEX zu entscheiden), Gerlinde Fritz für ihre sprachliche und jede andere Form von Hilfe und Veronika Humpel für ihr immer offenes Ohr und etliche Gläschen Wein, sowie allen dreien und vielen nicht näher genannten für die unzähligen Möglichkeiten, gemeinsam zu komponieren, zu musizieren und zu lachen. Ein großes Dankeschön an Áron Cserveny4 nicht nur für die rota (S. 43); ich freue mich auf weitere gemeinsame Projekte und Herausforderungen. 1 2 3 4 http://www.latex-project.org http://lilypond.org Wiesbauer, S. 6. http://www.artbyaron.com 3 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 1.1 Begriffsklärung . . . . . . . . . . . 1.1.1 Algorithmus . . . . . . . . . 1.1.2 Komposition . . . . . . . . . 1.1.3 Algorithmische Komposition 1.2 Grundfragen . . . . . . . . . . . . . 1.2.1 Die Urheberfrage . . . . . . 1.2.2 Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Beispiele relevanter Algorithmentypen 2.1 Transformationsalgorithmen . . . . . . 2.2 Stochastische Algorithmen . . . . . . . 2.3 Regelbasierte Systeme . . . . . . . . . 2.4 Zellautomaten . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Genetische Algorithmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 6 7 8 9 9 10 . . . . . 13 13 16 19 20 25 3 Historischer Überblick über algorithmische Kompositionsansätze 3.1 Quod ad cantum redigitur omne quod dicitur . . . . . . . . . . . 3.2 Isorhythmie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Improvisierte Gegenstimmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 Kompositionsmethoden für Laien . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 Zwölftonmusik und Serialität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6 Das Computerzeitalter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 30 31 33 35 37 40 4 Ausgewählte Beispiele algorithmischer Kompositionstechniken 43 4.1 Bontempis Nova Methodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 4.2 Musikalische Würfelspiele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 4 4.2.1 4.3 Das Musikalische Würfelspiel als stochastischer Algorithmus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Experiments in Musical Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1 Funktionsweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rekombination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mustererkennung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Form und Struktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPEAC-Analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2 Kompositionsprozeß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.3 EMIs Fähigkeiten und Mängel . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.4 Rezeption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Konklusion und Ausblick Analyse . . . . . . . . . . . . . . Musikpädagogische Bedeutung . . Kunstwert und historischer Wert Ausblick . . . . . . . . . . . . . . 6 Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 58 59 59 62 66 68 71 78 80 82 82 83 83 85 88 5 1 Einführung 1.1 Begriffsklärung 1.1.1 Algorithmus Unter einem Algorithmus versteht man eine eindeutige Abfolge von präzise formulierten Anweisungen, die in der Regel von einem mechanisch oder elektronisch arbeitenden Gerät durchgeführt werden sollen. Im Gegensatz zu alltäglichen, meistens weniger exakt ausformulierten Vorschriften (Kochrezepte, Partituren, Spielregeln, Bastel- oder Bedienungsanleitungen u. a.), die oft beliebig interpretierbare Teile enthalten, sind bei einem Algorithmus Wahlmöglichkeiten nur dann zugelassen, wenn genau festgelegt wird, wie die Auswahl einer Möglichkeit erfolgen soll. Algorithmen sollen im allgemeinen einzelne Probleme oder bestimmte Klassen von Problemen lösen, sind also zweckorientiert. Sie geben an, wie Eingabedaten schrittweise in Ausgabedaten umgewandelt werden sollen. Mathematisch gesehen beschreibt ein Algorithmus also die Abbildung f : E → A von der Menge der zulässigen Eingabedaten E in die Menge der Ausgabedaten A. Nicht alle Probleme sind algorithmisch lösbar, die Abbildung kann also nicht immer durch einen Algorithmus realisiert werden. Solche Probleme können mit Computern oder anderen Maschinen klarerweise nicht verarbeitet werden. Das Wort selbst leitet sich aus dem Namen des persischen Mathematikers Abu Abdallah Muhammad ibn Musa al-Chwarizmi5 ( der aus Chwarizm6 stam” mende“, unterschiedliche Transkriptionsweisen möglich) ab, dessen Hauptwerk, das 825 erschienene Al-kitab al-muchtasar fi hisab al-dschabr wa-l-muqabala 7 (Das umfassende Buch vom Rechnen durch Ergänzung und Ausgleich), in der lateinischen Fassung mit den Worten Dixit Algorithmi [. . . ]“ beginnt. ” Algorithmen haben eine Reihe von formalen Eigenschaften. Sie sind statisch und dynamisch finit, es darf also weder die Beschreibung des Algorithmus 5 6 7 * 780, † zw. 835 und 850. Ihm wird unter anderem die Übernahme der Ziffer 0 aus dem indischen ins arabische und damit in unser modernes Zahlensystem zugeschrieben. Heute Chiwa, Stadt im Nordwesten Usbekistans, damals zur persischen Provinz Chorassan gehörend. Aus dem Ausdruck al-dschabr leitet sich das Wort Algebra ab. 6 noch der zu einem beliebigen Zeitpunkt der Durchführung benötigte Speicherplatz unendlich groß sein. Sie liefern in der Regel nach einer endlichen Anzahl von Schritten ein Resultat und halten (Terminierung ) – ausgenommen Steuerungs- und sonstige Algorithmen, die auf einen expliziten Befehl warten müssen, um beendet zu werden. Ein Algorithmus, der mit gleichen Eingabewerten und Startbedingungen immer wieder zum gleichen Ergebnis kommt, heißt determiniert. Wenn zu jedem Zeitpunkt der Ausführung höchstens eine Möglichkeit der Fortsetzung besteht, ist der Algorithmus außerdem deterministisch. Es ist offensichtlich, daß jeder deterministische Algorithmus auch determiniert sein muß, was umgekehrt allerdings nicht zwingend gilt. Gibt es an einer Stelle der Durchführung mehrere Möglichkeiten der Fortsetzung, von denen eine beliebige ausgewählt werden kann, handelt es sich um einen (in erster Linie für die theoretische Informatik interessanten) nichtdeterministischen Algorithmus, während man von einem stochastischen (randomisierten, probabilistischen) Algorithmus spricht, wenn man den Fortsetzungsmöglichkeiten bestimmte Wahrscheinlichkeiten zuordnen kann (wobei diese keine Eingabewerte darstellen, also nicht zum Input gehören). 1.1.2 Komposition Komposition (lat. compositio, Zusammenstellung) bezeichnet in der Musik sowohl den Vorgang des Komponierens, sprich die schriftliche Festlegung von ” Entscheidungen“8 oder die musikalische Schöpfung, deren Ergebnis meist in ” fixierter Form vorliegt“9 , als auch das Ergebnis selbst, nämlich die geordnete, ” wohllautende tonschriftliche Ausarbeitung der Zusammensetzung von Tönen im Sinne eines für sich bestehenden Werkes“10 . Auch der Aspekt der Tren” nung von Produktion und Reproduktion mehrstimmiger Musik“11 ist eng mit dem Begriff verbunden. Die oben angesprochenen Entscheidungen betreffen immer den Kontext der zum Zeitpunkt der Komposition aktuellen musikalischen Vorgaben. Der Komponist versucht, das zur Verfügung stehende musikalische Material (an sich schon eine Konvention, wie uns Musikgeschichte und -ethnologie zeigen) anhand bestimmter Kriterien zu strukturieren. In der Regel geschieht das im Hinblick 8 9 10 11 Eggebrecht, S. 47. http://de.wikipedia.org/wiki/Komposition %28Musik%29 Eggebrecht, S. 210. Eggebrecht, S. 45. 7 auf ein Zielpublikum, dessen Erwartungen das Entscheidungsverfahren (meistens, aber nicht immer, positiv) beeinflussen. Es geht also um Freiheit in der ” Gebundenheit, nämlich: das Treffen (Verantworten und Fixieren) von Entscheidungen innerhalb eines Systems des musikalisch Geltenden, das in der Lehre als Regelsystem erscheint und in der Praxis veränderbar ist, um von daher auch wiederum die Lehre zu modifizieren.“12 Das Ergebnis des Kompositionsprozesses ist eine Aneinanderreihung der getroffenen Entscheidungen, die dem fertigen Werk eine Identität verleihen. Die Festlegung der identitätsstiftenden Elemente, die Produktion des musikalischen Werkes, ist damit abgeschlossen. Für die Reproduzierbarkeit muß eine Form der Notation gewählt werden, die dem Ausführenden mehr oder weniger Freiheiten erlauben kann, aber die wesentlichen Merkmale, die für die eindeutige Wiedererkennbarkeit der Komposition sorgen, unmißverständlich festhält. Es ergibt demnach durchaus einen Sinn, die beiden Bedeutungen des Wortes, also den Prozeß und das Ergebnis, gesondert zu betrachten. Im Normalfall beschäftigt sich sowohl die Rezeptionsgeschichte als auch die Musikanalyse mit dem Ergebnis, dem fertigen musikalischen Werk, da ein Einblick in den Kompositionsprozeß nur dann gegeben ist, wenn uns der Komponist durch Skizzen, Tagebucheintragungen, Briefe, Vorträge oder ähnliches Einblicke gewährt. Aber selbst in diesen Fällen muß man vom Werk ausgehen, und die vorhandene Zusatzinformation über den Schöpfungsakt kann nur dazu beitragen, die Erkenntnisse, die anhand des Ergebnisses zusammengetragen werden können, zu bestätigen oder gegebenenfalls zu widerlegen. 1.1.3 Algorithmische Komposition Die dieser Arbeit zugrundeliegende Begriffspaarung bedeutet vor besagtem Hintergrund einen auf exakt ausformulierten Anweisungen basierenden musikalischen Entscheidungsprozeß sowie dessen Ergebnis. Es sollen hier also Zugänge und Ansätze behandelt werden, die es erlauben, den Kompositionsvorgang so transparent zu gestalten, daß die ihm zugrundeliegende Mechanik offensichtlich wird, und daß auch Laien oder sogar Computerprogramme zielgerichtet Musik komponieren können. Die übliche Art zu komponieren beinhaltet in der Regel ein entsprechendes Studium der theoretischen Grundlagen, eine gewisse Beschäftigung mit Musikgeschichte und Musizierpraxis, kurz gesagt also die Annäherung an den Kon12 Eggebrecht, S. 87. 8 text, in dem die Kompositionsentscheidungen getroffen werden. Der Kontext gibt die Alternativen vor, von denen der Komponist eine bevorzugt, um im nächsten Schritt gleich wieder vor mehreren Wahlmöglichkeiten zu stehen. Für die Auswahl und die daraus folgenden Konsequenzen ist der schöpferische Geist, die Kreativität zuständig. Musikalische Kontexte lassen sich unschwer in formale Beschreibungen fassen. Jedes Lehrwerk ist solch ein festgeschriebener Kontext, der die Gebundenheit repräsentiert, aber gleichzeitig jedem, der sich damit auseinandersetzt, die Freiheit der Entscheidung innerhalb des Regelwerks bietet. Es ist also auch denkbar, innerhalb eines formalen Systems algorithmisch Entscheidungen zu treffen, und zwar nach formalen Kriterien. Dabei erfolgt etwas, was man als Mechanisie” rung der Kreativität“13 bezeichnen könnte und was nur auf den ersten Blick als Widerspruch erscheint. Kreativität ist die Essenz dessen, was nicht me” chanisch ist. Und doch ist jeder kreative Akt mechanisch – es gibt genauso eine Erklärung dafür wie für einen Schluckauf. Das mechanische Substrat der Kreativität ist vielleicht verborgen, aber es existiert.“14 Wie wir bereits gesehen haben, ist für die Rezeption letzten Endes nicht der Prozeß selbst, sondern das Werk, also das Ergebnis des Schöpfungsaktes, wichtig. Ist es eventuell auch möglich, den algorithmischen Kompositionsprozeß ganz anders zu gestalten? Kann ein (zumindest partieller) Verzicht auf die präzise formale Beschreibung des gewünschten Kontextes sowie auf das Treffen von Entscheidungen zu einem musikalisch befriedigenden Ergebnis führen? Diese Fragen werden anhand verschiedenster Zugänge zur algorithmischen Komposition untersucht und beantwortet. 1.2 Grundfragen 1.2.1 Die Urheberfrage Bei algorithmisch komponierter Musik stellt sich die Frage, wer als Urheber eines solchen Werkes bezeichnet werden kann. Die Problematik hat einige weitschweifende Aspekte, beispielsweise einen rechtlichen, ihre Relevanz für die vorliegende Arbeit beschränkt sich allerdings primär darauf, jeweils brauchbare und legitime Aussagen über die Urheberschaft treffen zu können. Schon bei Werken von echten“ Komponisten kann es vorkommen, daß mehr ” als die bloße Nennung des direkten Urhebers notwendig ist. Ein Student, der 13 14 Hofstadter 1992, S. 717. ebenda 9 sich gerade mit Fuxens Gradus ad Parnassum beschäftigt, wird dies bei seinen diesbezüglichen Arbeiten eventuell vermerken. Bei genauer Befolgung der Fuxschen Anweisungen könnte Fux selbst ohne weiteres als Koautor angesehen werden. Je genauer die Anweisungen sind, je weniger Entscheidungsfreiheit der Ausführende hat und je irrelevanter seine Person für das Ergebnis ist, desto eher sprechen wir vom Autor der Kompositionsanweisungen selbst als dem Komponisten des Musikstücks (dies gilt verstärkt für die musikalischen Würfelspiele, die in Kapitel 4.2 behandelt werden). Noch spannender wird die Frage, wenn die algorithmische Komposition nicht durch Menschen, sondern durch einen Computer erfolgt. Hierzu ist ein Programm notwendig, das von einem Menschen erstellt wird. Es macht Sinn, in manchen Situationen von einem Meta-Autor15 zu sprechen, zum Beispiel wenn der Programmierer selbst die Feinheiten des Ergebnisses nicht in allen Einzelheiten geplant hat oder zur besagten Leistung eventuell gar nicht fähig gewesen wäre. Die Autorschaft ganz dem Programm zuzuschreiben würde aber eine Stufe von Komplexität erfordern, die heute undenkbar scheint. In der vorliegenden Arbeit wird versucht, eine mehr oder weniger differenzierte und sinngemäße Zuordnung zu finden. In einigen Fällen wird das Ergebnis einfach als Produkt des jeweiligen Algorithmus bezeichnet, in anderen wird es notwendig sein, das Programm, den Programmierer und sogar den als Vorlage herangezogenen Komponisten, also drei Instanzen der Autorschaft, zu nennen. 1.2.2 Bewertung Geht man vom Ergebnis eines beliebigen Kompositionsprozesses aus, ist es zunächst unerheblich, ob es sich dabei um einen freien, kreativen oder einen gebundenen, vorgegebenen, algorithmischen Prozeß handelt. Geht es aber um die qualitative Bewertung besagten Ergebnisses, kann dieser Unterschied doch relevant sein. Die Bewertung jeder Art von Kunst (bzw. allein schon die Zuordnung zur Kategorie Kunst“) ist vielschichtig und äußerst subjektiv. Ein Kunstwerk hat ” z. B. geschichtlichen, ästhetischen und funktionalen Wert, um nur einige zu nennen. Diese drei kann man beispielsweise durch eine entsprechende Analyse mehr oder weniger objektiv bestimmen. Es gibt aber einen für die Praxis wesentlich wichtigeren und subjektiveren Wert, den man Rezeptionswert nennen könnte: jeder Kunstrezipient entscheidet für sich, welche Bedeutung er dem rezipier15 in Anlehnung an Hofstadter 1992, S. 646. 10 ten Werk beimißt. Dazu können ihm die objektivierteren Werteinschätzungen durchaus eine Hilfestellung bieten, aber er kann seine Meinung auch völlig ohne diese bilden. Urheber oder Werke, die nicht in gängige Schemata passen, rufen bei manchen Menschen zunächst automatisch Ablehnung hervor. Aussagen wie solche ” Pseudokunst könnte auch ein kleines Kind erschaffen“ werden durch die Tatsache relativiert, daß von Kindern oder auch z. B. von behinderten Künstlern geschaffene Werke trotz eventuell vorhandener Ähnlichkeit mit Werken anerkannter Künstler sehr selten als vollwertige Kunst rezipiert werden. Die Identität des Künstlers kann also für den subjektiven Rezeptionswert des Werkes eine große Rolle spielen. Dies gilt in verstärktem Maß für algorithmisch geschaffene Kunst, besonders beim Einsatz von Computerprogrammen. Da wir Menschen einerseits unseren Rechenmaschinen die Kreativität und den Willen zum Kunstschaffen (unter dem Gesichtspunkt des bisher erreichten relativ niedrigen und durchschaubaren Komplexitätsgrades wohl zurecht) absprechen, andererseits aber von ihrer Andersartigkeit fasziniert sind, können wir Werke, als deren Urheber ein Computerprogramm gilt, wohl sehr schwer unvoreingenommen beurteilen. Eine Analyse kann uns zwar den musikalisch-ästhetischen Wert zu bestimmen helfen, der Rezeptionswert kann aber durch die Befangenheit der Rezipienten (in diese oder jene Richtung) stark verfälscht werden. Für eine unverfälschte, nicht durch die persönliche Voreingenommenheit diktierte Bewertung kann es also interessant sein, algorithmisch geschaffene Werke auch ohne genauen Hinweis auf ihre Herkunft einem Publikum vorzustellen. Diese Idee entspricht im wesentlichen einer speziellen, auf den Bereich Kunst beschränkten Variante des sogenannten Turing-Tests16 , eines Denkmodells aus der theoretischen Diskussion der künstlichen Intelligenz. Der britische Mathematiker Alan Turing17 schlug den nach ihm benannten Test 1950 als Entscheidungsverfahren für die Problematik der künstlichen Intelligenz vor. Grob vereinfacht ist es für Turing dann sinnvoll, einen Computer als künstlich intelligent zu bezeichnen, wenn ein Betrachter das (in der Praxis auf eine schriftliche Unterhaltung beschränkte) Verhalten des Computers, dessen nichtmenschliches Wesen aber dem Betrachter unbekannt ist, als menschliches, also intelligentes Verhalten beurteilt. Es geht also darum, scheinbare Intelligenz 16 17 http://de.wikipedia.org/wiki/Turing-Test Alan Turing, * 23. Juni 1912 in London, † 7. Juni 1954 in Wilmslow, gilt als Begründer der theoretischen Informatik. 11 nicht an formalen Kriterien, sondern sozusagen an ihrem unvoreingenommenen Rezeptionswert festzumachen. Ein Programm, das den Turing-Test bestehen will, wird versuchen, menschliches Verhalten zu imitieren (zum Teil also sogar die eigene Überlegenheit, die beispielsweise auf rechnerischem Gebiet vorhanden ist, verschleiern). Die Aufgabenstellungen können vielfältig und unter anderem auch künstlerischer Natur sein. In der ursprünglichen, allgemeinen Form des Turing-Tests werden also sowohl unerwartet schlechte als auch unerwartet gute Ergebnisse Verdacht erregen und den Rezeptionswert beeinflussen. Wenn wir dieses Modell für die algorithmische Komposition adaptieren, müssen wir den Anspruch ein wenig anders formulieren. Hier reicht es nicht, ein Werk in Unkenntnis des Verfassers einfach als menschliche Schöpfung einzustufen (denn die meisten Menschen können wenig bis gar nicht komponieren), sondern es soll quasi als vollwertiges Kunstwerk akzeptiert und rezipiert werden. Am einfachsten wird dieses Ziel durch die Imitation existierender, von Menschenhand geschaffener Musik erreicht, da hierbei die Möglichkeit auf das Zurückgreifen auf eine Vorlage sowie eine Art Wiedererkennungsfaktor hilfreich sein können. Die vorliegende Arbeit wird die Ergebnisse verschiedener Ansätze algorithmischer Komposition zunächst durch die Mittel der Analyse auf ihren mehr oder weniger objektiven ästhetischen Wert untersuchen. Sollte diese Beurteilung so positiv ausfallen, daß eine Einordnung als Kunstwerk sowie eine entsprechende Diskussion als sinnvoll erscheinen, wird auch auf den Rezeptionswert unter Beachtung der oben erwähnten Gesichtspunkte Rücksicht genommen. 12 2 Beispiele relevanter Algorithmentypen Die theoretische Beschäftigung mit Algorithmen zeigt, daß es nicht nur unzählige, voneinander nicht immer klar unterscheidbare Typen gibt, sondern auch daß eine umfassende und systematische Typologie bislang fehlt. Zudem ist im Blickwinkel der Komposition nicht jede Algorithmenklasse relevant. Die folgenden Beispiele nennen einige Typen, die in Verbindung mit algorithmischen Kompositionsmethoden berücksichtigt werden können. Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Nach den jeweiligen Definitionen und der Erläuterung der Funktionsweisen werden einige konkrete musikalische Beispiele präsentiert, die die Relevanz des jeweiligen Algorithmentyps sichtbar machen sollen. 2.1 Transformationsalgorithmen Die einfachste und häufigste Methode, algorithmisch zu komponieren, ist die Übertragung (Transformation) einer aus formalen Zeichen bestehenden Kette in eine Kette akustischer Ereignisse, die wir bei entsprechender Beschaffenheit als Musik bezeichnen. Der musikalische Output hängt dabei klarerweise sowohl vom Input als auch von den Transformationsregeln ab. Die Erstellung oder das Finden einer Zeichenfolge ist in der Regel kein besonders schwieriges Unterfangen. Alphabetische Zeichenfolgen findet man überall, wo man hinsieht, für Zahlenfolgen gibt es auch genügend Quellen (Würfelergebnisse, Telefonnummern, arithmetische Zahlenfolgen usw.). Manche Zeichenfolgen sind zufällig, manche gehorchen irgendwelchen Bildungsgesetzen oder haben einen inneren Zusammenhang. Erzeugt man eine Zahlenfolge durch einen Computer, spricht man konsequenterweise von Pseudozufallszahlen, da sie in der Regel durch einen deterministischen Algorithmus erzeugt werden und daher gar nicht wirklich zufällig sein können (ganz abgesehen davon, daß sogar scheinbar zufällige Würfel- und Rouletteergebnisse auf einer mikroskopischen Ebene ganz klaren deterministischen mechanischen Gesetzen gehorchen und 13 daher ebenfalls nicht wirklich zufällig, aber durch die hinreichende Komplexität solcher Vorgänge prinzipiell sehr schwer vorausberechenbar sind). Liegt nun eine Zeichenfolge vor, gibt es unzählige Möglichkeiten, sie in Musik zu übertragen. Die einfachste wäre beispielsweise, Zahlen in direkte Beziehung zu Tonhöhen zu setzen, wobei wir einen Schlüssel brauchen. Die Folge 1-2-34-5-5-6-6-6-6-5-4-4-4-4-3-3-2-2-2-2-1 ergibt entsprechend kodiert (1 = c, 2 = d, 3 = e, 4 = f , 5 = g, 6 = a) offensichtlich die Töne des Kinderliedes Alle meine Entchen (ohne die zugehörigen Tonlängen), wohingegen ein anderer Schlüssel (z. B. 1 = c, 2 = f is, 3 = h, 4 = es, 5 = a, 6 = b) augenscheinlich zu einem gänzlich anderen Ergebnis führt. :: :> > > > > > : > > / 3> > 1 1 2 3 2 3 4 4 5 5 :: : :: > > > > ::: > 6 6 6 6 5 :: : : :: > > > > ::: > > ::: > > > > 4 4 4 4 ::: > > ::: 3 > > > > ::: > ::: : : : : 9 38 > > > > 5 5 6 6 6 6 5 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 :: :: > 1 ::: 2 > > ::: :: : : /9 8 > > > > :: > 3 3 2 2 2 2 1 An diesem Beispiel wird die Relevanz beider Faktoren (der Zeichenfolge sowie des Übertragungsschlüssels) evident. Will man das erwähnte Kinderlied mit Hilfe der obigen Hexachord-Kodierung mittels eines Würfels erzeugen, müßte man schon sehr großes Glück haben, denn die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten dieser bestimmten aus 22 Tönen bestehenden Tonfolge beträgt 1/622 . Es ist also wesentlich wahrscheinlicher, andere, in den meisten Fällen musikalisch unbrauchbare oder zumindest recht dürftige Tonfolgen zu erhalten. Diese Vorgehensweise ist demnach nicht wirklich dazu geeignet, ein erwartetes musikalisches Ergebnis zu realisieren. Es ist natürlich auch ohne weiteres möglich, mehrstimmige (sowohl polyals auch homophone) Musik mittels Transformationsalgorithmen zu generieren, wenn man die Übertragungsregeln entsprechend wählt. Wichtig ist aber, daß musikalische Struktur nur dann entsteht, wenn sie entweder in der Zeichenfolge oder in der Kodierung enthalten ist. Die Schlußwirkung am Ende des obigen Kinderliedes entsteht eben durch die allmähliche Annäherung an die Zahl 1, die in diesem Fall dem Grund- und Endton entspricht, bzw. durch die Terminierung des Umwandlungsprozesses an dieser Stelle. Eine unendliche Zeichenfolge (was bei arithmetisch erzeugten Zahlenfolgen relativ häufig ist) könnte also sozusagen zu keinem Schluß führen, während bei einer endlichen 14 Folge das Erreichen des Schlußtones und der Zeichenfolge für musikalisch sinnvolle Ergebnisse zusammenfallen müßte. Da dies unwahrscheinlich ist, kann man natürlich die Übertragungsregeln entsprechend gestalten, indem man die Anzahl der verwendeten Zeichen a priori beschränkt (wobei man im Falle einer aus weniger Zeichen bestehenden Folge die Differenz irgendwie auffüllen müßte, z. B. indem man von vorne beginnt) oder beispielsweise eine als Schlußkadenz gültige Zeichenfolge gleichzeitig als Terminierungscode festlegt, womit man die Länge des erzeugten Musikstücks zwar nicht weiter bestimmt (theoretisch könnte diese Zeichenfolge ja auch gleich am Anfang auftreten und zu einem sofortigen Abbruch führen), aber immerhin für eine Schlußwirkung sorgt. Transformationsalgorithmen können rein synthetisch oder aber analytisch geprägt sein. Die direkte Umwandlung einer Zahlenfolge in Töne, wie oben beschrieben und gezeigt, ist ein Exempel für eine rein synthetische Vorgangsweise, da weder für den Input noch für die Transformationsregeln analytischer Aufwand betrieben werden muß. Dementsprechend sind musikalische Strukturen nicht grundsätzlich zu erwarten, sondern treten in unwahrscheinlichen Extremfällen auf. Das Vorhandensein einer musikalischen Form, eine bewußt herbeigeführte Schlußwirkung, und sonstige musikalische Strukturen setzen hingegen eine analytische Beschäftigung mit Musik voraus. Die gewünschten Aspekte müssen entweder bei der Auswahl bzw. Generierung des Inputs berücksichtigt oder auf die eine oder andere Art und Weise wie oben beschrieben in die Übertragungsregeln kodiert werden. Mit einer analytischen Annäherung kann man relativ einfach musikalisch wertvolle Ergebnisse erzielen. Strenggenommen fallen Methoden wie Bontempis Ansatz (siehe Kapitel 4.1) oder Musikalische Würfelspiele (Kapitel 4.2) auch in diese Kategorie, da bei beiden bestimmte Zahlenfolgen nach von erfindungsreichen Komponisten definierten Regeln (die außerdem den jeweiligen Kompositionsstil widerspiegeln) in Musik umgewandelt werden. Bleibt man allerdings bei der ausschließlich synthetischen Methode, muß man auf bekannte musikalische Strukturen verzichten. Ob das Ergebnis überhaupt als Musik und weiterführend als Kunst wahrgenommen wird, ist natürlich fraglich. Dennoch sind bestimmte Nischen für diese Art der Komposition denkbar. Nehmen wir als Beispiel Zeichenfolgen, die aus geometrischen Gebilden abgeleitet werden. Man könnte z. B. den Positionen des Kartesischen Koordinatensystems musikalische Parameter (neben Tonhöhe auch Lautstärke oder Klangfarbe usw.) zuweisen und dadurch jedes Gebilde, das in diesem Koordinatensystem 15 dargestellt wird, in Klänge umwandeln. Für diese Art der synthetischen Komposition nimmt man häufig Fraktale oder Zellautomaten als Grundlage, aber jedes andere auf diese Weise darstellbare Bild eignet sich genauso. Nimmt man etwa das Fernsehbild oder die Darstellung auf dem Computerbildschirm, die ebenfalls auf einem Koordinatensystem basieren, kann man die optische Bewegung, die ja tatsächlich einer Änderung der geometrischen Beschaffenheit des Bildes entspricht, in musikalische Bewegung umwandeln. Je nach Wahl der Übertragungsregeln kann man die Musik klanglich den Bildern anpassen (für abstraktes Material eventuell dissonante Klänge, für gegenständliche Darstellungen Konsonanzen), wobei sich sowohl Rhythmus als auch Mikro- und Makrostruktur der akustischen Untermalung an der optischen Veränderung orientieren. Im multimedialen Bereich könnten solche synthetischen Kompositionsalgorithmen Verwendung finden und durchaus zu interessanten Ergebnissen führen. 2.2 Stochastische Algorithmen Stochastische Algorithmen enthalten Zufallselemente, die während der Ausführung zum Tragen kommen und dadurch das Ergebnis beeinflussen. Zufällig generierter Input allein reicht nicht aus, um von diesem Algorithmentyp sprechen zu können, weshalb beispielsweise Musikalische Würfelspiele nicht in diese Kategorie fallen. Stochastische Algorithmen sind nicht determiniert, da die Zufallselemente während der Verarbeitung dafür sorgen, daß der Input jedes mal etwas anders umgewandelt wird. Als Beispiel könnte man eine Umwandlungsvorschrift nennen, die nach dem im vorigen Unterkapitel vorgestellten Prinzip Zahlen in Töne umwandelt, wobei zu jeder Zahl jeweils ein zufälliger Wert zwischen 0 und 5 addiert wird. Dadurch wird ein angenommener Eingabewert 1, der eigentlich dem Ton c entspricht, mit jeweils der gleichen Wahrscheinlichkeit in die einzelnen Töne des Hexachords überführt. Daß diese Vorgehensweise nicht zu einer merkbaren Steigerung der Qualität und des musikalischen Zusammenhangs führt, ist offensichtlich. Als Gegensatz dazu wird im folgenden eine Methode vorgestellt, die MarkowProzeß genannt wird und sowohl als Analyse- als auch als Syntheseinstrument in vielen Bereichen der Wissenschaft gute Dienste leistet. Der russische Mathematiker A. A. Markow18 berechnete anhand der Novelle Eugen Onegin von 18 Andrei Andrejewitsch Markow, auch Markov oder Markoff transkribiert, * 14. Juni 1856 in Rjasan, † 20. Juli 1922 in Petrograd. 16 A. S. Puschkin19 die Auftrittshäufigkeit der Vokale und Konsonanten in Abhängigkeit vom vorangegangenen Buchstaben. Diese Art der quantitativen Textanalyse wurde als mächtiges Instrument erkannt und mathematisch ausgebaut, sodaß sie heute beispielsweise bei der automatisierten Sprach- und Schrifterkennung, aber auch in der Wettervorhersage oder bei Risikoberechnungen angewandt wird. Eine Markow-Kette erster Ordnung ist eine Folge von Ereignissen, bei der die Wahrscheinlichkeit für den Zustand zum Zeitpunkt t + 1 einzig und allein vom Zustand zum Zeitpunkt t abhängt. Eine entsprechende Analyse kann Abhängigkeiten zwischen den Gliedern der Kette zutage fördern und die sogenannten Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen den Ereignissen angeben. Sehen wir uns die Funktionsweise dieses Modells an einem musikalischen Beispiel an. > > > > > > > Wie man sieht, geht hier ein e mit jeweils 50%-iger Wahrscheinlichkeit in ein g bzw. in ein d über, wohingegen nach einem c entweder ein e oder das Ende der Melodie (diesen Zustand könnten wir mit 0 bezeichnen) kommt. Alle anderen Töne führen mit 100%-iger Wahrscheinlichkeit in den jeweils folgenden. Diese Sachverhalte kann man in einer kleinen Tabelle, der sogenannten Übergangsmatrix, festhalten. c d c d 1 0,5 e f g e 0,5 f g 0 0,5 0,5 1 1 Die Markow-Analyse zeigt, daß diese Melodie aus der Aufeinanderfolge zweier wichtiger Motive besteht: dem Terzsprung aufwärts sowie dem melodischen Abwärtsschreiten. Gleichzeitig liefert diese Analyse auch den Stoff für eine Synthese, bei der diese Motive zum tragen kommen können. Diese kann theoretisch unendlich viele, unterschiedlich wahrscheinliche Ergebnisse erzeugen. 19 Alexander Sergejewitsch Puschkin, * 6. Juni 1799 in Moskau, † 10. Februar 1837 in Sankt Petersburg 17 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Die erste dieser Tonfolgen (die als Extremfall nur aus einem einzigen Ton besteht) ist bei weitem die wahrscheinlichste, tritt sie doch in 50% aller Fälle auf. Bei allen anderen Beispielen verringert sich die Wahrscheinlichkeit, weil mehrere nicht zwingende Ereignisse kumulieren. Mit jedem c und e halbiert sich die gesamte Auftrittswahrscheinlichkeit der jeweiligen Folge, wobei mathematisch gesehen sogar eine unendlich lange Folge eine zwar unendlich kleine, aber positive Wahrscheinlichkeit aufweist. Die Mächtigkeit des Markow-Prozesses als Analyse- und Syntheseinstrument kann man noch erhöhen, wenn man Markow-Ketten n-ter Ordnung bildet. Das bedeutet, daß nicht nur das jeweils vorangegangene Ereignis die Auftrittswahrscheinlichkeit des nachfolgenden bestimmt, sondern es werden die vorhergehenden n Glieder der Folge berücksichtigt. Die Übergangsmatrix sieht abhängig vom Wert n jeweils etwas anders aus und die Analyse geht in gewisser Weise mehr in die Tiefe. Ein Anstieg von n führt zu immer mehr 100%-igen Übergangswahrscheinlichkeiten, was zu immer weniger Möglichkeiten der Synthese bis hin zu einer bloßen Reproduktion des Originals zur Folge hat. Im Falle unserer kleinen Melodie ist dies bereits bei n = 2 der Fall. c d e f c-e e-g 1 g-f 1 f-e 1 e-d 1 d-c g 0 1 1 Die Markow-Analyse eignet sich natürlich nicht nur für einzelne Melodien, sondern auch für mehrstimmige Werke, wobei neben der Tonhöhe auch Notenlängen, harmonische Umgebung und andere musikalische Aspekte berücksichtigt werden können bzw. müssen. Sie kann allerdings in erster Linie die Beschaffenheit des musikalischen Materials beschreiben, die Struktur hingegen nur sehr bedingt (wie wir gesehen haben, können bei einer Anwendung der MarkowMethode mit kleiner Ordnungszahl Ergebnisse mit erheblichen Längenunterschieden entstehen). Für eine erfolgreiche Synthese nach dieser Verfahrensweise 18 muß umfangreiches Datenmaterial (womöglich mit homogener Struktur) vorhanden sein, und die jeweils ideale Ordnungszahl kann nur nach mehreren Versuchen gefunden werden. Als Analyseinstrument kann uns diese Methode dafür nicht nur einzelne Ketten n-ter Ordnung als melodische, harmonische oder rhythmische Motive eines Komponisten liefern, sondern eben auch die jeweils passende Ordnungszahl n, die sich möglicherweise sogar als Invariante eines persönlichen oder allgemeinen Stils erweisen könnte. 2.3 Regelbasierte Systeme Wenn jemand heutzutage komponieren lernt, nimmt er dazu in den meisten Fällen bestimmte Regelwerke in die Hand, denen er mehr oder weniger strikt folgt. Das legt die Vermutung nahe, daß auch regelbasierte algorithmische Kompositionsmethoden denkbar und zielführend sein können. Tatsächlich sind solche Ansätze angedacht und auch verwirklicht worden (siehe z. B. Kapitel 4.3). Für zufriedenstellende Ergebnisse muß man die notwendigen Regeln in eine formal eindeutige und widerspruchsfreie Sprache fassen, was nicht immer einfach, aber auf jeden Fall machbar ist. Die Regeln werden befolgt, indem aus dem Pool aller Fortsetzungsmöglichkeiten die im Sinne des Regelwerks gültigen herausgefiltert werden, unter denen anschließend eine (meist zufällig) ausgewählt wird. Regelbasierte Algorithmen können im Gegensatz zu den bisher erwähnten Algorithmentypen in Sackgassen münden, also während der Verarbeitung Situationen erzeugen, in denen keine gültige Weiterführung mehr möglich ist. In solchen Fällen wird das sog. Backtracking-Verfahren angewandt, das jeweils bis zum letzten Punkt, bei dem eine sinnvolle Alternative möglich ist, zurückgeht. Das erinnert an die aus der Lernpsychologie bekannte Problemlösungsmethode Versuch und Irrtum (trial and error ). Die scheinbare Einfachheit und Eleganz des Ansatzes bringt aber auch einige Nachteile mit sich. So sind regelbasierte Algorithmen nur dann wirklich brauchbar, wenn tatsächlich alle wichtigen Aspekte der Komposition in Regeln gefaßt sind. Stimmführungsregeln allein führen zu Ergebnissen mit korrekter Stimmführung, aber ohne nennenswerte musikalische Form und Struktur; das bloße Befolgen von Formschemata ergibt keine harmonisch gültige Komposition usw. Hat man alle notwendigen Parameter erfaßt und in Regeln beschrieben, ist man gewissermaßen in diesen gefangen. Die Ergebnisse sind immer gültig, bedingt durch den Algorithmus aber auch in gewisser Weise zufällig bzw. beliebig. 19 Außerdem fehlt die im Sinne einer ästhetisch-künstlerischen Äußerung oft erwünschte Möglichkeit, manche Regeln bewußt zu verletzen. Es ist nicht immer ohne weiteres möglich, die Regeln einfach zu verändern oder auch nur zu erweitern. Daher kann es für merkbar unterschiedliche Ergebnisse häufig nötig sein, auf ein anderes Regelwerk zurückzugreifen. Ein weiteres Problem ist, daß Kompositionsregeln bis auf wenige Ausnahmen im Laufe der Musikgeschichte aus vorhandener Musik abgeleitet wurden und daher nicht präskriptiv, sondern deskriptiv sind. Das bedeutet, daß das sture Befolgen des Regelwerks bestenfalls ein Ergebnis erlaubt, das gewissermaßen einer Rekonstruktion oder Imitation des Originals entspricht; die verwendete Methode ist außerdem aufwendig und unflexibel. Regelbasierte Kompositionsalgorithmen können demnach nur erfolgreich sein, wenn ein umfassendes Regelwerk vorhanden ist, das alle notwendigen Aspekte der Komposition hinreichend abdeckt. Zudem wären für diverse Bereiche dieses Regelsystems mehrere alternativ einsetzbare Subsysteme wünschenswert, die untereinander austauschbar und mit anderen Subsystemen vernetzt sind, sodaß eine Kombination aus unterschiedlichen Regeln (z. B. die Stimmführungsregeln von Palestrina kombiniert mit Beethovenschen Formen und Strukturen) möglich wird. Nur so kann eine gewisse Flexibilität sowie Experimentier- und Innovationsfähigkeit gewährleistet werden. 2.4 Zellautomaten Ein Zellautomat (auch zellulärer Automat, englisch cellular automaton) ist ein räumlich und zeitlich diskretes dynamisches System, bei dem eine gegebene Zustandsmenge in einem definierten Zellraum nach einem Zeitsprung in eine neue Zustandsmenge überführt wird. Die Entwicklung jeder einzelnen Zelle zum Zeitpunkt t + 1 hängt primär vom eigenen Zellzustand sowie von den Zellzuständen einer vorgegebenen Nachbarschaft zum Zeitpunkt t ab. Zellautomaten können in der Regel aus sehr einfachen oder auch chaotischen Zuständen mithilfe einfacher Regeln relativ komplexe und langlebige Strukturen erzeugen. Für die anschauliche Darstellung des Prinzips von Zellautomaten eignet sich das sog. Game Of Life 20 des englischen Mathematikers J. H. Conway21 . Der Zellraum ist 2-dimensional, quadratisch und der Einfachheit halber in jede Richtung unendlich. Jede Zelle kann einen von zwei Zuständen einnehmen, die man 20 21 http://de.wikipedia.org/wiki/Game of Life John Horton Conway, * 26. Dezember 1937 in Liverpool. 20 gemeinhin als lebendig und tot bezeichnet und mit einer vollen bzw. leeren Zelle darstellt. Als Nachbarschaft werden alle acht (vier seitlich und vier diagonal) benachbarten Zellen definiert. Die klassischen Regeln des Game of Life lauten folgendermaßen: • Eine tote Zelle mit genau drei lebenden Nachbarn wird in der Folgegeneration neu geboren. • Eine lebende Zelle mit weniger als zwei lebenden Nachbarn stirbt in der Folgegeneration (Einsamkeit). • Eine lebende Zelle mit mehr als drei lebenden Nachbarn stirbt in der Folgegeneration (Überbevölkerung). Daraus folgt natürlich, daß eine Zelle mit einer optimal beschaffenen Nachbarschaft (zwei oder drei lebende Zellen) theoretisch unendlich lange überleben kann. Viel interessanter als der Zustand einzelner Zellen sind jedoch die Strukturen, die durch die Gesamtheit aller Zellzustände gebildet werden. Die einfachen Regeln können abhängig vom Ausgangsmuster zu einer erstaunlichen Komplexitätsstufe führen. Manche Gebilde sind stabil und verändern sich nicht, andere oszillieren (durchlaufen also immer wieder eine periodische Folge von Zuständen), wieder andere vergehen oder wachsen chaotisch. Es gibt auch eine Reihe von Strukturen, die sogenannten Gleiter oder Raumschiffe, die sich in einem periodischen Bewegungsablauf mit konstanter Geschwindigkeit im Zellraum fortbewegen. ~ ~~ / ~~ ~~ stabil / ~~ ~~ ~ ~~~ / ~ oszilliert / ~~~ ~ Game of Life ist eine von unzähligen möglichen 2-dimensionalen Zellautomaten. Neben den Regeln (der Anzahl der jeweils für Geburt oder Tod notwendigen lebenden Nachbarzellen) kann man weitere Zellzustände einführen, wodurch 21 man Zellen gleichsam altern lassen kann, oder die Definition der Nachbarschaft verändern, indem man beispielsweise nur die direkt seitlich benachbarten oder aber auch weiter entfernte Zellen als Nachbarn betrachtet. Außerdem ist die Beschaffung des Zellraums ebenfalls veränderbar, so sind z. B. hexagonale oder trigonale Räume denkbar. Die Eigenschaften der verschiedenen Welten sind mannigfaltig: manche erzeugen regelmäßige Strukturen wie z. B. Schachbrettmuster, andere bilden hauptsächlich große zusammenhängende Gebiete, ebenso gibt es explodierende oder alles schnellstmöglich tilgende Welten oder sogenannte Kopierwelten, die jedes vorhandene Muster identisch nachbilden. Die visuell weit weniger interessanten, für die Musik aber durchaus einigermaßen relevanten 1-dimensionalen Zellautomaten gehorchen im wesentlichen den selben Grundsätzen. Ihre formale Beschreibung entspricht der von Musik in mancher Hinsicht. Dimension: dem 1-dimensionalen Raum entspricht die Frequenz der Tonhöhen, die Veränderung entfaltet sich entlang der Zeitdimension. diskreter Zellraum: in den meisten Formen abendländischer Musik wird nicht der gesamte Frequenzbereich verwendet, sondern nur bestimmte regelmäßig (logarithmisch) gegliederte Ausschnitte desselben, die Tonhöhen. diskrete Zeit: Musik ist zeitlich gegliedert, wobei es immer eine kleinste Zeiteinheit (in der Regel die Länge des kürzesten Notenwerts) gibt; alle anderen Notenwerte sind deren Vielfache. die Relevanz der Nachbarschaft: das Verhältnis der zu einem Zeitpunkt erklingenden Frequenzen zueinander beeinflußt nicht nur den momentanen Höreindruck, sondern durch harmonische und melodische Notwendigkeiten auch den nachfolgenden Klang. Während 1-dimensionale Zellautomaten üblicherweise mit einer horizontalen Raum- und dementsprechend einer von oben nach unten vertikal verlaufenden Zeitachse dargestellt werden, ist es für unsere Zwecke sinnvoller, die Darstellung jener von Musik anzugleichen, indem sie um 90◦ nach links gekippt wird. Die Regeln werden angegeben, indem man alle Kombinationen von Zellzuständen inklusive der Zustände der relevanten Nachbarn sowie den jeweils nachfolgenden Zustand angibt. Für einen Automaten mit zwei Zuständen und der Berücksichtigung der direkten Nachbarn (elementary cellular automaton)22 könnte man 22 http://mathworld.wolfram.com/ElementaryCellularAutomaton.html 22 beispielsweise die Regel, daß ausschließlich isolierte lebende Zellen (Zellen ohne lebende Nachbarn) weiterleben, folgendermaßen angeben: ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Sogar bei dieser einfachen Konfiguration gibt es acht mögliche Zustände für die berücksichtigten drei Zellen, was bei jeweils zwei Folgezuständen insgesamt 28 = 256 mögliche Regeln bedeutet. Musikalisch relevant sind in erster Linie jene Regeln, bei denen nur jeweils einige wenige Zellen leben, weshalb bei den folgenden Beispielen aus Gründen der Einfachheit nur die Zustände angegeben werden, auf die eine lebende Zelle folgt. Eine einfache Regel zeigt, wie ein Zellautomat eine Fortschreitung erzeugen kann, die der Auflösung eines Quintsextakkordes entspricht. Im weiteren Verlauf sieht man Terzenschichtungen, die immer enger werden und schließlich in einem einzelnen Ton enden. 3 >>>> >>> >> > ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ Wie man erkennen kann, bleibt von zwei Tönen im Sekundabstand (ohne weitere direkte Nachbarn) jeweils der obere bestehen, während sich zwei Töne im Terzabstand sozusagen in der Mitte treffen. Sekundcluster sowie alle Intervalle größer als eine Terz haben bei dieser Regel keine Chance auf ein Fortbestehen, sodaß dieser spezielle Zellautomat eigentlich nur die obige Funktion erfüllen kann. 23 Dieses einfache System kann man nun auf verschiedene Arten erweitern. Man kann weitere Zellzustände einführen und die Regeln so wählen, daß eine Zelle mehrere dieser Zustände (z. B. jung-alt-tot) durchlaufen kann, wodurch sich verschiedene Lebensdauern bzw. auf die Musik umgelegt Notenlängen ergeben. Musikalisch mindestens ebenso relevant wäre die Wahl der Nachbarschaft, die auch weiter entfernt liegende Zellen berücksichtigt. Durch solche Erweiterungen wird es möglich, Fortschreitungen zu erzeugen, die im ursprünglichen System nicht machbar waren. Eine Vorhaltskette läßt sich beispielsweise auf die folgenden zwei Arten realisieren: = > > => > => > => > => > => > ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ²¯ ²¯ ±° ±° ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ²¯ ~ ±° ²¯ ²¯ ~ ²¯ ²¯ ±° ²¯ ±° ~ ~ ±° ±° ~ ~ ±° ²¯ ~ ~ ±° Aus ähnlichen Fortschreitungen und Sequenzen lassen sich auf diese Weise Regeln ableiten, die zum Teil relativ komplex sein müssen, um die gewünschten Stimmführungstendenzen zu erlauben, alle anderen aber auszuschließen. Interessant wird es freilich, wenn man die Regeln auf ganz andere Ausgangszustände anwendet. Wie wir gesehen haben, führen manche Regeln dabei schnell zum Ausdünnen und Absterben der Strukturen, es ist aber durchaus denkbar, daß in manchen Welten interessante Klangstrukturen entstehen, die sich zwar akustisch von jenen unterscheiden, die zur Regelfindung gedient haben, aber dennoch die selben Gesetzmäßigkeiten widerspiegeln und daher auf einer elementaren Ebene mit ihnen verwandt sind. 24 Die Anzahl möglicher Regeln hängt von der Anzahl der Zellzustände und der Beschaffenheit der Nachbarschaft ab und wächst bei steigender Komplexität dieser Faktoren exponentiell. Bei n Zellzuständen und m berücksichtigten Zellen kann die gesamte Nachbarschaft insgesamt nm Zustände einnehmen, wobei jede dieser Nachbarschaftszustände wiederum in n Folgezustände überführt m werden kann. Die Gesamtzahl aller möglichen Regeln beträgt demnach n(n ) . Im Vergleich zu den 256 möglichen Regeln des elementaren Zellautomaten (zwei Zustände, 3-zellige Nachbarschaft) kommt man bereits mit 3 Zuständen und der selben Nachbarschaft auf 327 = 7 625 597 484 987 Möglichkeiten, die zudem noch in Abhängigkeit vom Ausgangszustand ganz unterschiedliche Ergebnisse liefern können. Es ist extrem aufwendig, aus dieser astronomisch hohen Zahl an Regeln die musikalisch relevanten auszufiltern. Neben den erwähnten Parallelen zeigen Zellautomaten natürlich auch einige wichtige Unterschiede zu musikalischen Strukturen. Vor allen Dingen sind sie deterministisch (und daher auch determiniert), während in der Musik ein bestimmter Zustand meistens mehrere gültige Fortsetzungensmöglichkeiten hat. Sie bilden bevorzugt iterative Strukturen wie die oben angeführten Sequenzen, führen diese aber gegebenenfalls bis ins Unendliche fort, was musikalischen Formen in der Regel nicht entspricht. Gleich aufgebaute Klänge in unterschiedlichen Funktionen (z. B. ein Durdreiklang auf der Tonika und auf der Dominante) werden außerdem gleich behandelt, was der Entwicklung musikalischer Formstrukturen auch abträglich ist. Zudem ist der Raum nicht einheitlich beschaffen: der in den obigen Beispielen der Einfachheit halber diatonische Tonraum müßte eine ziemlich komplexe Erweiterung erfahren, um eine sinnvolle Chromatik zu ermöglichen. Alles in allem eignen sich daher Zellautomaten allein nicht zur Komposition. Dennoch können bei einer tiefergehenden Untersuchung bestimmter Konfigurationen auch musikalisch interessante Strukturen auftauchen, die zumindest im kleinen Rahmen brauchbare Impulse liefern können. 2.5 Genetische Algorithmen Genetische Algorithmen verwenden Strategien der Evolutionstheorie, um schrittweise möglichst gute Lösungen für ein Problem zu finden. Sie zeichnen sich dadurch aus, daß stets eine gewisse Menge, die sog. Population, von möglichen Lösungen vorhanden ist, die sich durch bestimmte Mechanismen verändert und auf eine Optimierung zuläuft. 25 Jede vorhandene Lösung (Individuum) besitzt eine Folge oder Menge elementarer Bausteine (Gene), das Genom. Aus jeder Population wird mit Hilfe bestimmter Vererbungsmechanismen eine Folgepopulation erzeugt, wobei die Individuen eine Bewertung erfahren und je nach Fitnesswert überleben, veränderte Nachkommen erzeugen oder verschwinden (Selektion). Im Durchschnitt steigt bei gut gewählten Parametern die Fitness von einer Population zur nächsten, auch wenn einzelne Individuen dieser Tendenz nicht entsprechen. Die grundlegendsten Vererbungsmechanismen sind die folgenden: Selektion: zufällige Auswahl von Individuen aus der Population, wobei Individuen mit höherem Fitnesswert wahrscheinlicher ausgewählt werden. Rekombination: die Genome verschiedener Individuen werden gemischt, woraus ein neues Genom entsteht. Mutation: einzelne Gene eines Individuums werden bei der Vererbung nach dem Zufallsprinzip minimal verändert. In den Folgegenerationen werden also bestimmte Genome oder Genomabschnitte verstärkt auftreten, während zu jedem Zeitpunkt eine hinreichend große genetische Diversität vorhanden sein muß, damit der Algorithmus nicht in einer Sackgasse landet. Gesteuert wird der Prozeß von vielen Parametern, zu denen beispielsweise Wahrscheinlichkeit und Stärke von Mutationen oder die Größe der Population gehören. Man kann sowohl die einzelnen Begriffe als auch die Vorgänge auf musikalische Inhalte umlegen. Demnach wäre ein Individuum eine Ton- oder Klangfolge gewünschter Länge, in der Ausgangspopulation zufällig generiert und danach durch den Evolutionsprozeß geformt. Die Gene könnten einzelne Töne, Klänge oder auch Motive sein. Durch Selektion, Rekombination und Mutation entstehen immer neue Musikstücke, deren Fitness bestimmt und im Verlauf der Generationenfolgen immer optimaler wird. Rekombination wird meistens mit einem sogenannten Crossover realisiert, bei dem ein bestimmter Teil des Genoms eines Individuums mit dem äquivalenten Genomteil eines anderen vertauscht wird, wodurch sich die komplementären Genomteile verbinden und zwei neue Genome erzeugen. 26 :: : > > > > > :> > :: : > > > > > > :> XX : »» XXX »»» XX » » X» X» XX XXX »»» » » XXX z »»» :: : > > > > > > :> :: : > > > > > :> > Bei einer Mutation verändert sich das eine oder andere Gen zufällig um einen meist minimalen Wert. Bei einer Tonfolge könnte das eine andere Tonhöhe, eine neue rhythmische Unterteilung oder der Wechsel eines anderen musikalischen Parameters, aber auch eine beliebige Kombination der erwähnten Faktoren sein, wie im folgenden Beispiel sichtbar: :: : > > > :> ² :: : > > > : /> :: :: > > > > :: > > > :: > > Ganz wesentlich für brauchbare Ergebnisse ist die Bestimmung des Fitnesswertes. Bei mathematischen Problemen kann man diesen meist sehr exakt angeben, bei musikalischen Fragestellungen kann dies allerdings viel schwieriger sein. Wollte man beispielsweise eine Tonleiter mittels genetischer Komposition erzeugen, könnte man jedem von dieser abweichenden Ton einen negativen Wert zuordnen, sodaß die fertige Tonleiter durch den höchstmöglichen Fitnesswert, nämlich den ohne Abweichungen erreichten Wert 0 gekennzeichnet 27 wäre. Auch andere Bewertungskriterien sind denkbar, so z. B. positive Werte für sangliche und negative für unsangliche Intervalle bei der Komposition einer Melodiestimme, Konsonanzen- und Dissonanzenbehandlung beim Erfinden einer Gegenstimme usw. Andere Eigenschaften (Stil, Qualität, emotionaler Gehalt) von Musik sind allerdings nicht ohne weiteres formal exakt beschreibbar, weshalb auch die Bestimmung des jeweiligen Fitnesswertes schwieriger sein kann. Für solche Fälle bietet sich auch bei genetischen Algorithmen die Möglichkeit an, die Bewertung von einem oder mehreren Menschen durchführen zu lassen. Natürlich schadet das der Geschwindigkeit des Algorithmus, über längere Zeiträume können aber mit diesem Verfahren nicht nur Ergebnisse erzielt werden, für die sonst eine umfassende formale Beschreibung aller bevorzugten Eigenschaften notwendig wäre, sondern auch der Gewichtung verschiedener persönlicher Geschmäcker Rechnung getragen werden. Genetische Algorithmen sind nicht determiniert und erlauben in der Regel mehrere vergleichbar gute Lösungen. Sie simulieren biologische Systeme und sind daher einigermaßen flexibel und dynamisch. Mit der geschickten Wahl der Parameter können sie auch in der Musik, besonders in Verbindung mit anderen Algorithmentypen, interessante und innovative Ergebnisse erzielen. 28 3 Historischer Überblick über algorithmische Kompositionsansätze Im Laufe der Musikgeschichte haben sich immer wieder Kompositionsansätze herauskristallisiert, die die kompositorische Freiheit zugunsten (durch stärkere Gebundenheit) vereinfachter Abläufe zu einem gewissen Grad aufzugeben bereit waren. Die hierzu benötigten Regeln sind nicht immer explizit ausformuliert, manchmal entsprechen sie einfach auch einer musikalischen Praxis, die erst im nachhinein schriftlich fixiert worden ist. Betrachtet man die solchen noch genauer zu diskutierenden Bestrebungen zugrundeliegende Motivation als mögliches Kriterium, ergibt sich folgende grobe Klassifikation: Gebundenheit als verbindungstiftendes Element: die Beschränkung gewisser Aspekte der kompositorischen Freiheit (z. B. musikalisches Material, bestimmte Strukturen u. a.) schafft Homogenität innerhalb eines Werkes, eines Zyklus oder einer Werkgruppe. Die Notwendigkeit hierzu entsteht beispielsweise aus der Aufgabe anderer Bindungen und ermöglicht das Experimentieren mit und die Entwicklung von neuen Strukturen, Formen oder Klängen (z. B. Isorhythmie, Serialität). Freiwillige Bindung als kompositorische Hilfestellung: will ein Komponist die Kontrolle über bestimmte Aspekte seiner Werke aufgeben oder aber über fehlende Inspiration oder mangelnde Motivation hinwegkommen, kann er zu algorithmischen Hilfestellungen greifen, die er entweder nach seinen eigenen Vorstellungen gestaltet oder eventuell von anderen übernimmt. Als Werkzeug dazu dient oft der Computer (z. B. Xenakis, Cope). Improvisationsvorschriften: sie betreffen freilich zunächst in erster Linie praktische Fragen der Ausführung, nicht die Komposition selbst. Allerdings finden improvisierte Strukturen oft Eingang in die Praxis geschriebener, auskomponierter Musik und repräsentieren damit eine weitere Gruppe algorithmischer Kompositionsansätze (z. B. Faburden/Fauxbourdon, Diminution). 29 Kompositionsmethoden für Laien: eine entsprechend definierte sehr starke Gebundenheit kann dazu führen, daß musikalische Entscheidungsfreiheiten weitestgehend aufgegeben bzw. durch willkürliche oder zufällige Entscheidungen ersetzt werden können. Dadurch wird es möglich, ohne jede musikalische Vorbildung zu komponieren (wobei hier die ursprüngliche Wortbedeutung Zusammenstellen“ in den Vordergrund tritt). Da” bei kann es sich sowohl um eine Spielerei als auch um eine wissenschaftliche Beschäftigung mit der Kompositionstheorie handeln (z. B. Guido von Arezzo, Kircher, Bontempi, Musikalische Würfelspiele). Es ist nicht immer eindeutig, ob die Regeln, die einer Kompositionsmethode oder bestimmten Aspekte derselben zugrundeliegen, die Bezeichnung algorith” mischer Kompositionsansatz“ rechtfertigen, weswegen der folgende Einblick in die Chronologie der verschiedenen Ansätze eine subjektive Auswahl darstellen muß und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben darf. Ansätze, die ausschließlich die formale Anlage von Musikstücken betreffen, wie Cope23 sie sogar anhand von Flußdiagrammen analysiert, werden dabei bewußt nicht berücksichtigt, da sie im Blickwinkel der vorliegenden Arbeit eine zu wenig konkrete Organisation musikalischen Materials darstellen. 3.1 Quod ad cantum redigitur omne quod dicitur Guido von Arezzo24 widmet in seinem 1026 verfaßten Micrologus de disciplina artis musicae einen Abschnitt der Transformation von Texten in einstimmige Melodien. Er meint, daß wie alles, was gesprochen wird, geschrieben werden ” kann, so auch alles in Gesang gebracht zu werden vermag, was gesprochen wird“25 . Seine hierfür angegebene Methode ist extrem einfach und erlaubt auch gewisse Freiheiten. Die Grundlage bietet eine Zuordnung der fünf Vokale zu den Tönen des Guidonischen Tonsystems. Die Vokale werden in ihrer alphabetischen Reihenfolge solange wiederholt, bis jedem Ton ein Vokal entspricht. Γ A B C D E F G a b/h c d e f g aa bb/hh cc dd a e i o u a e i o u a e i o u a e i o 23 24 25 Cope 2000, S. 3 ff. Guido von Arezzo, * um 992, † 1050. zitiert nach http://www.lml.badw.de/info/guidomi.htm 30 Wählt man nun einen Tonbereich aus, kann man einen Text ohne Schwierigkeiten vertonen, indem man für jede Silbe den entsprechenden Ton heranzieht. ^ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ San cte I o han nes me ri to rum tu o rum co pi as ne que o dig ne ca ne re Um die Wahlmöglichkeiten, die sich bis jetzt auf Tonbereich und gegebenenfalls (bei einem Tonumfang, der über eine Quint hinausgeht) auf einzelne Töne beschränken, zu erweitern, fügt Guido der obigen eine zweite, um zwei Vokale nach links verschobene Vokalreihe hinzu: Γ A B C D E F G a b/h c d e f g aa bb/hh cc dd a e i o u a e i o u a e i o u a e i o i o u a e i o u a e i o u a e i o a e Das erlaubt nun u. a. die verstärkte Verwendung kleiner (nur Prim und Sekund) oder bestimmter bevorzugter Intervalle. Die Möglichkeiten sind somit nicht nur breit gefächert, sondern auch in einem einfachen logischen System zusammengefaßt, mit dem auch Laien umgehen können, ohne angesichts allzu großer Wahlfreiheiten vor Schwierigkeiten zu stehen. Die Methode kann allerdings auch einfach als ein Gerüst für ein hochwertiges Endergebnis angesehen und verwendet werden. Obwohl Guido keine genaueren Angaben macht, wie dies zu geschehen hat, erlaubt er ausdrücklich, gegebenenfalls von den genannten Regeln wegzugehen, um z. B. die Charakteristika der Tonart hervorzuheben und zu verstärken. Denkbar ist auch die Verwendung intervallischer oder gar motivischer Zellen, um eine gewisse Einheitlichkeit und einen hohen Wiedererkennungswert zu gewährleisten, sowie beispielsweise das melodische Äquivalent zu einem eventuell gegebenen Reimschema, da ja hierbei Silben mit gleichen Vokalen eine große Rolle spielen. 3.2 Isorhythmie Eine besonders konsequente Form der rhythmisch-melodischen Organisation stellt die Isorhythmie dar, die sich im wesentlichen auf die Motette der Ars Nova beschränkt, wenngleich einerseits ihr Einfluß auch auf andere Gattungen und die nachfolgenden Epochen spürbar ist und andererseits im 20. Jhdt. ähnliche 31 Phänomene auftauchen. Sie tritt zum ersten Mal in P. de Vitrys26 Motettenschaffen jeweils im Tenor auf, erreicht aber bei Machaut27 und in weiterer Folge bei Dufay28 auch die anderen Stimmen. Isorhythmie ist eine Satztechnik in der Mehrstimmigkeit des 14. und 15. Jh., ” bei welcher ein großflächiges rhythmisches Schema bei wechselndem melodischen Gehalt in einer oder mehreren Stimmen wiederholt durchgeführt wird“29 . Die periodische Wiederholung kleinräumiger rhythmischer Strukturen war bereits in der Notre-Dame-Schule üblich und wurde in der Ars Antiqua zu einer isoperiodischen Durchgestaltung der Phrasenlängen weiterentwickelt. Bei isorhythmischen Kompositionen ist aber eine konsequente Trennung bei der Durchführung von rhythmischer Struktur und melodischem Material zu beobachten. Das Prinzip ist in aller Klarheit anhand des Tenors von de Vitrys Motette In nova fert/Garrit gallus/N[euma] zu erkennen. Das melodische Schema (color genannt) ist ein aus 36 Tönen bestehendes tradiertes Neuma. Das rhythmische Modell (und dessen Wiederholungen) heißt talea und umfaßt 10 Mensuren, die insgesamt zwölf Töne (und zwei Pausen) enthalten. Bei der sogenannten Ordinierung, also der rhythmischen Einrichtung des Tenors werden nun color und talea übereinandergelegt und so oft wie nötig wiederholt. Daß in diesem Fall drei taleae der einmaligen Darstellung des color entsprechen, ist für das Sichtbarmachen der Prinzips praktisch, aber keinesfalls die Regel – talea und color müssen nicht an der selben Stelle beginnen oder in einem ähnlich einfachen Längenverhältnis zueinander stehen. talea 3 4 26 27 28 29 =: > = 2 4 > > = " = Philippe de Virty, * 1291 in Paris, † 1361 ebenda. Guillaume de Machaut, * zw. 1300-05, † 1377 in Reims. Guillaume Dufay, * um 1400, † 1474. Kügle, Sp. 1219. 32 > > 3 4 > = =: ": color 3 3 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < ordinierter Tenor 11 21 3 3 3 3 4 =: > = =: > = =: > = 2 4 > > = 2 4 > > = 2 4 > > = = > > " = > > " = > > " > = =: ": 3 4 > = =: 3 4 > = =: ": 3 4 ": Wir sehen also, wie talea und color den Tenor gleichsam vordefinieren – in Kenntnis dieser beiden Faktoren ist an jedem Punkt eine eindeutige Vorhersage der Fortsetzung möglich. Das hohe Maß an Organisation innerhalb einer oder mehrerer Stimmen stellt ein starkes verbindungsstiftendes Element dar. Gleichzeitig kann man bei isorhythmisch gestalteten Motetten eine Kongruenz zwischen den taleae und den Textabschnitten der Oberstimmen erkennen. Die Ordinierung des Tenors korrespondiert also mit der strophischen Form des Textes und hat demnach nicht ausschließlich rhythmisch-melodische, sondern auch formale Funktion. 3.3 Improvisierte Gegenstimmen Während im 14. Jhdt. auf dem europäischen Festland die Contrapunktus-Lehre entstand, gab es in England eine quasi entgegengesetzte Entwicklung, nämlich die einer nach festen Regeln improvisierten Mehrstimmigkeit. Bei den verschie- 33 denen Arten dieser Stegreifpraxis mußten die Sänger der verschiedenen Stimmen ihre Töne nach bestimmten Vorschriften in sight in der Nähe des Choralcantus (oder plainsong) imaginieren, die aber wegen des ebenfalls vorgegebenen Transpositionsintervalls in voice woanders erklangen. Soll der Sänger des treble (der Oberstimme) beispielsweise den plainsong durchgehend in Oberquarten begleiten, muß er in sight den plainsong mitlesen, wobei durch die fixe Quarttransposition nach oben seine Stimme in voice in der Quartparallele erklingt. Die historisch bedeutsamste Ausprägung dieser Improvisationspraxis ist der Faburden, der sowohl als Terminus als auch in seinem Wesen in enger Verbindung mit dem Fauxbourdon, einer um 1430 am Festland entstandenen ausnotierten Kompositionspraxis, steht. Der Faburden besteht aus einem plainsong, einem in Oberquarten verlaufenden treble und einem faburden, der sich an Anfang und am Schluß sowie zwischendurch gelegentlich in der Unterquinte, sonst aber durchgehend in der Unterterz des plainsongs zu finden ist. Der trebleSänger liest also, wie bereits erwähnt, in sight den plainsong mit und transponiert automatisch alles eine Quart hinauf, während der faburden in sight mal den Einklang, mal die Oberterz des plainsongs sucht und seine Töne automatisch um eine Quint nach unten transponiert. faburden in sight in voice treble plainsong 6 > 6 > 6 3> 6 > == == == == 6 > 6 > 6 > 6 > 6 > 6 > == == == == 3 == == 6 > == Aus dem Notenbeispiel30 ist ersichtlich, daß sich diese Art Musik ausschließlich auf Terz-Sext- und (zur Gliederung) Quint-Oktav-Klänge beschränkt, was für die damalige Zeit eine revolutionäre Errungenschaft darstellt. Die Klang” deklamation des Faburden ist, vom artifiziellen Standpunkt aus gesehen, höchst einfach, um nicht zu sagen primitiv – aber sie enthält als Zündstoff die Vorherrschaft des klanglich Imperfekten .“31 Diese Errungenschaft der imperfekten Klänge konnte über den Fauxbourdon und anschließend über die kontrapunktische Vokalpolyphonie ihren Siegeszug antreten, doch dazu mußte sie erst hoffähig gemacht werden. Die Hauptarbeit hierzu leistete Dufay, der um 1430 in der Postcommunio seiner Missa Sancti 30 31 nach Eggebrecht, S. 204. ebenda 34 Jacobi die oben beschriebene Improvisationspraxis kompositorisch umdeutet und ausnotiert. Das Schreiben von beständigen Quartparallelen war allerdings kontrapunktisch verpönt, weswegen beim Fauxbourdon-Satz auch nicht alle Stimmen ausgeschrieben werden. War es beim Faburden die Mittelstimme (der plainsong), die als einzige schriftlich fixiert war, wird hier gerade sie weggelassen, während die Oberstimme (als Cantus) und die unterste (als Tenor) notiert werden. Der Tenor verläuft auch hier im wesentlichen in Untersexten zum Cantus und bildet am Anfang und am Ende jedes Abschnitts sowie an bestimmten Gliederungspunkten die Unteroktave. Der Contratenor wird in Unterquarten zum Cantus dazugesungen, was wie erwähnt kontrapunktisch gesehen eine falsche (=faux ) Unterstimme (=bourdon) darstellt. 3.4 Kompositionsmethoden für Laien Die bisherigen Beispiele haben verschiedene algorithmische Formen der Organisation musikalischen Materials aufgezeigt, aber jeweils nur einzelne Aspekte einer Komposition betroffen. Der im 17. Jahrhundert einsetzende Rationalismus rückt jedoch allmählich die alle Aspekte umfassende Annäherung an algorithmisch komponierbare Musik in den Vordergrund. Interessanterweise stammt einer der ersten solchen Zugänge von keinem erklärten Rationalisten, sondern dem jesuitischen Universalgelehrten Athanasius Kircher32 . In seinem umfangreichen Werk Musurgia Universalis (1650) beschäftigt er sich mit Musik, wobei er keine rationalistische Idee verfolgt, sondern anhand der musikalischen Harmonie die allen Dingen zugrundeliegende Gottesordnung aufzudecken versucht. Das Buch enthält neben Studien zum Gesang der Vögel, instrumentenbaulichen Ausführungen, anatomischen Untersuchungen des menschlichen Hörapparates und Kommunikations- bzw. Abhörmechanismen auch eine mechanische Vorrichtung, mit der sich viertimmige Musik komponieren läßt. Die arca musarithmica ist ein Kästchen, in dem sich eine gewisse Anzahl beidseitig bedruckter Holzplättchen, die man ähnlich wie Karteikarten handhaben soll, befindet. Man analysiert zunächst den zu vertonenden Text und sucht dann eines der rhythmischen Silbenstruktur entsprechenden Plättchen aus, das sowohl einen contrapunctus floridus als auch einen rhythmisch simpleren Kontrapunkt enthält. Diese Bausteine können auf bestimmte Arten kombiniert werden 32 Athanasius Kircher, * 2. Mai 1602 in Geisa bei Fulda, † 27. November 1680 in Rom. 35 und ergeben letztendlich eine Vertonung des zugrundegelegten Textes. Leider ist die Beschreibung Kirchers nicht in allen Einzelheiten nachvollziehbar, und die wenigen existierenden gebauten Exemplare der arca scheinen der Beschreibung in manchen Punkten nicht zu entsprechen, sodaß die vollständige Funktionsweise dieser Erfindung heute nicht mehr ohne weiteres nachvollziehbar ist. Nur ein Jahrzehnt später schuf der italienische Kastrat, Komponist und Musikhistoriker G. A. Bontempi33 seine Heinrich Schütz gewidmete Nova quatuor vocibus componendi methodus (Dresden 1660), die ebenfalls für die vierstimmige Vertonung von in erster Linie religiösen Texten konzipiert war. Kapitel 4.1 widmet sich der genauen Erklärung des zugrundeliegenden Prinzips und der Analyse damit komponierter Musik. Im Laufe des 18. Jahrhunderts bekam die Mathematik als Hilfswissenschaft auch in der Musik eine immer gewichtigere Rolle, was z. B. das Wirken des Universalgelehrten und Bach-Schülers L. C. Mizler34 beweist. Er lehrte unter anderem Musik und Mathematik an der Leipziger Universität und war Mitbegründer und Sekretär der Correspondierenden Societät der musikalischen Wissenschaften, der ersten Gelehrtengesellschaft, die sich ausschließlich der Musik widmete. Seinen Anspruch, mathematische Strukturen in der Musik aufzudecken, belegt beispielsweise seine Schrift Anfangsgründe des General-Basses, nach mathematischer Lehr-Art abgehandelt, und vermittelst einer hierzu erfunden Maschine auf das deutlichste vorgetragen (1739). Es verwundert kaum, daß in der zweiten Hälfte des 18. Jhdts. diese rationale Sichtweise auf den spielerischen Unterhaltungsaspekt traf und eine langanhaltende Mode der Musikalischen Würfelspiele, mit denen sich Kapitel 4.2 beschäftigt, ins Leben rief. Diese Würfelspiele produzieren Tänze nach dem Geschmack der Zeit und entheben durch den Zufallsfaktor den Spieler jeglicher kompositorischer Entscheidung und Verantwortung. Das verbindende Element der erwähnten Kompositionsmethoden ist die Bemühung, die Regeln so zu definieren, daß sie ausschließlich gültige musikalische Entscheidungen zulassen, gleichzeitig aber die Wahlfreiheit nicht so sehr einschränken, daß der Output allzu gleichförmig wird. Es bedarf also eines gut durchdachten Konzepts, diesem Anspruch gerecht zu werden. 33 34 Giovanni Andrea Bontempi, * ca. 1624 in Perugia, † 1. Juli 1705 in Brufa. Lorenz Christoph Mizler, * Juli 1711 in Heidenheim, † März 1778 in Warschau. 36 3.5 Zwölftonmusik und Serialität Das Aufgeben der tonalen Bindung in der Zweiten Wiener Schule war ein Akt der Befreiung der Musik von oft als naturgegeben“ bezeichneten Prädesti” nationen, die aus der mathematisch-physikalischen Obertonstruktur entstehen und unter einem bestimmten kompositorischen Blickwinkel Zwänge darstellen. Diese individuell-schöpferische Handlung bedeutete gleichzeitig aber auch das Abhandenkommen einer wichtigen Organisationsstruktur musikalischen Materials. In der Grundtonbezogenheit der Musik, ihrer Tonalität, lag eine emi” nent sinnstiftende und formbildende Kraft. Diese Kraft muß in der atonalen Musik, wo die Beziehung auf einen Grundton ausgeschaltet wird, ersetzt werden. Dies war für die Komponisten der Wiener Schule das kompositorische Hauptproblem.“35 Neben anderen Lösungsmöglichkeiten (beispielsweise der mit einer starken Ausdrucksverdichtung einhergehenden extremen Kürze) entstand in Schönbergs in den 1910er Jahren verfaßten Werken allmählich ein neues einheitsstiftendes Moment, das Anfang der 20er zur Entwicklung der Komposition mit Zwölftonreihen führte. Die Reihe bietet eine neue Bindung, die die atonale Expressivität nicht einschränkt, gleichzeitig aber Organisationsstrukturen und sinnstiftende Zusammenhänge bietet. Die Zwölftonreihe (deren Erfindung bereits einen eigenständigen kompositorischen Akt darstellt und oft mit einem peniblen Konstruktionsprozeß einhergeht) führt natürlich nicht ohne weiteres zu algorithmischem Komponieren, aber sie erlaubt eine rein formale Durchorganisation des musikalischen Materials. Sie enthält alle zwölf Töne einer Oktav und garantiert eine Gleichberechtigung, indem sie (nach der strengen Regel) das erneute Auftreten eines Tones vom Erklingen der anderen elf abhängig macht. Zusätzlich stehen für die Arbeit mit Zwölftonreihen (neben der Grundgestalt) die elf Transpositionen sowie die drei zusätzlichen Modi (Umkehrung, Krebs und Krebsumkehrung) und deren Transpositionen zur Verfügung. Die Übertragung des Reihenprinzips auf weitere musikalische Parameter (neben der Tonhöhe auch Tondauer, Lautstärke und Klangfarbe) führte zur Entwicklung der Serialität. Der Grundgedanke serieller Musik ist es, das musikali” sche Material nicht als vorgegebenes zu benutzen (um mit diesem vorgegebenen 35 Eggebrecht, S. 779. 37 und daher bereits bedeutungsträchtigen Material zu komponieren), sondern das Material für jede Komposition neu und einmalig entstehen zu lassen“36 . Die Zuordnung der einzelnen Parameter gibt den Tönen erst ihre Identität (und Daseinsberechtigung), wobei dieses Darlegen der Ordnung (Disposition) die Komposition gleichsam deterministisch entstehen läßt. Der kompositorische Prozeß wird hier also als eine ordnende Handlung gesehen, die Musik ist die (für jedes Werk neue, einzigartige) Konsequenz dieser Handlung. Wie die Rezeptionsgeschichte allerdings zeigt, ist diese theoretische Einmaligkeit serieller Musik für den Hörer kaum bis gar nicht nachvollziehbar, wohingegen der Eindruck einer punktuellen, bei ungenauem Hinsehen und -hören eher gleichförmigen Musik sehr stark ist. Das ist auch einer der Gründe, warum die Serialität in der hier dargestellten Konsequenz nur ganz wenige Werke der Musikgeschichte betrifft – die meisten Komponisten haben (innerhalb des seriellen Rahmens) Mittel und Wege für die Verwirklichung ihrer Subjektivität gesucht und gefunden. Gleichzeitig entstand eine neue Strömung, die der Aleatorik, die den (kontrollierten) Zufall und eine gewisse Offenheit der Interpretation ins Spiel bringt und damit der (scheinbaren) Beliebigkeit serieller Musik keinen ästhetischen Schaden zufügt, sondern sie durch die determinierte Indetermination um eine neue Dimension bereichert. Die am stärksten rational durchorganisierte Art von Musik (innerhalb der abendländischen Musikgeschichte), die sich durchaus auch algorithmisch verwirklichen läßt, wirft also sowohl kompositorische Fragen als auch Interpretations- und Rezeptionsprobleme auf. Demnach besteht hier eine Diskrepanz zwischen der theoretischen Möglichkeit, ohne musikalische Vorkenntnisse zu komponieren, und der Bereitschaft, sich als Laie mit dieser Art Musik zu beschäftigen. Eine Verbindung zwölftönig-atonaler algorithmischer Kompositionsmethode und publikumswirksamer Eingängigkeit schafft das von J. M. Hauer37 entwickelte Zwölftonspiel, das aufgrund dieser Qualitäten immer wieder gerne in der Musikpädagogik verwendet wird. Die genauen Vorgaben und die wenigen kompositorischen Freiheiten ermöglichen das Komponieren esoterisch anmutender, ästhetisch nicht unbedingt minderwertiger Musik. Herzstück eines Hauerschen Zwölftonspiels ist einerseits die Zwölftonreihe, andererseits aber eine Zuordnung der Reihentöne zu vier sog. Dreitongruppen. Diese umfassen jeweils drei chromatisch aufeinanderfolgende Töne (bei ei36 37 Eggebrecht, S. 813. Josef Matthias Hauer, * 19. März 1883 in Wiener Neustadt, † 22. September 1959 in Wien. 38 nem beliebigen Ton nach oben beginnend) und entsprechen vereinfacht gesagt dem Tonumfang der vier Stimmen der akkordischen Begleitung, der Klangreihe. Letztere entsteht, indem jeder Ton der Zwölftonreihe solange liegenbleibt, bis er von einem anderen Ton der selben Dreitongruppe abgelöst wird (wobei sowohl Zwölfton- als auch Klangreihe zyklisch in den Anfang münden, weshalb man die noch nicht vollstimmigen Akkorde mit den jeweiligen Schlußtönen ergänzen muß). 3< Reihe < 2< 2< 2< < 3< < < 3< /< 3< 2< < 3 < 2 < 928 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 2 < < < < < < Dreitongruppen 3 < 2 < 3 < 928 < < < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 2 < < < < < 3< 2< < 3< 3< 2< < < < < < < < 3< 3< 3< < / < < 928 < < < < < < < < < / < / < / < 2 < Die Melodiebildung zu einer solchermaßen erzeugten Klangreihe ist ähnlich einfach: die Melodie besteht jeweils aus dem aktuellen Ton der Zwölftonreihe, dem sog. obligaten Sekundschritt (sprich der Verbindung des in der Dreitongruppe vorangehenden Tones mit dem aktuellen Ton, im obigen Notenbeispiel mit Klammern gekennzeichnet) sowie den zwischen Reihenton und dem nächsten obligaten Sekundschritt liegenden Akkordtönen in einer bestimmten vorgegebenen rhythmischen Form. 39 2 > > 3> > 3> 2> > 3> > 3 > > 3 3 >>> > 3 3> 3 >>> > > > /> 2 3 >>> > >>> /> 3> 2 >>> > 3 3 >>> > > > > > 3> 3> 3> 2> 3> 3 3 3 >>> 3 3 >>> > > > > > 3> > 3> /> 3 3 >>>> 3 2 >>>> 3 >> 3 / >> >> / 3 >> 2< << 928 3 << Durch rhythmische Variation (sowohl der Melodie als auch der Begleitung) und einfache formale Vorschläge (Wiederholungen mit auf- und absteigender Veränderung des Tonraums sowie Verwendung des Akkordkrebses) lassen sich durch diese relativ banalen Vorgaben unzählige musikalisch einigermaßen wertvolle Musikstücke komponieren, wobei hier, wie der Name schon sagt, weniger die hohe Kunst als vielmehr der spielerische Aspekt im Vordergrund steht. Die Reduktion der Klanglichkeit auf eine meditativ-monotone, eingängige Form der zwölftönigen Atonalität ermöglicht somit eine hörer- bzw. spielergerechte Annäherung an eine algorithmische Kompositionsmethode. 3.6 Das Computerzeitalter Die Möglichkeit, mittels einer Rechenmaschine oder eines Computers algorithmisch zu komponieren, wurde von Ada Lovelace38 , der diese und ähnliche theoretische Einsichten in die Funktionsweise von Babbages39 nie gebauter Analyti38 39 Augusta Ada King Byron, Countess of Lovelace, * 10. Dezember 1815 in London; † 27. November 1852 in London. Mathematikerin, Hobbymusikerin, Tochter von Lord Byron und Mitarbeiterin von Charles Babbage. Charles Babbage, * 26. Dezember 1792 in Teignmouth, Devonshire, † 18. Oktober 1871 in London. Mathematiker, Philosoph, Erfinder und politischer Ökonom. 40 cal Engine 40 posthum den Ruf der ersten Programmiererin“ eingebracht haben, ” bereits 1843 vorhergesagt. In ihren Notizen zu Menabreas Buch41 schreibt sie: Supposing, for instance, that the fundamental relations of pitched ” sounds in the science of harmony and of musical composition were susceptible of such expression and adaptations, the engine might compose elaborate and scientific pieces of music of any degree of complexity or extent.“42 Tatsächlich wurde bereits Illiac, einer der ersten Großcomputer, in den 50ern von L. Hiller und L. Isaacson dazu benutzt, Musik zu komponieren (Illiac Suite, 1956). Für den Kompositionsprozeß wurden diverse algorithmische Experimente benutzt. Iannis Xenakis erkannte als einer der ersten bekannten Komponisten die Möglichkeiten computerunterstützten Musikschaffens. Er bezog viele außermusikalische, vorzugsweise mathematische oder geometrische Ideen in seine Kompositionen mit ein, wofür ein digitaler Rechner unerläßliches Werkzeug wurde. Er vermischte oft den Output des Computers mit von Hand komponierten Passagen und veränderte auch computergeneriertes Material, um seiner jeweiligen kompositorischen Intention gerecht zu werden. Seither beschäftigen sich immer mehr Musiker und Programmierer mit den Möglichkeiten computerunterstützter Komposition. Sowohl die Ansätze als auch die Intentionen sind so gut wie unüberschaubar, besonders weil die wenigsten Projekte gut dokumentiert sind. Es gibt sowohl kommerzielle Produkte, die Musik komponieren oder beispielsweise eine Begleitung im Stile verstorbener Jazzgrößen generieren, als auch kleine, experimentelle Arbeiten von Studenten oder Hobbymusikern. Eingesetzt werden so ziemlich alle vorstellbaren Algorithmentypen und Kompositionsmethoden. Wie bereits in Kapitel 1.2.2 erwähnt, ist es schwer, computergenerierte Musik objektiv zu bewerten. Aus diesem Grund versuchen viele Entwickler komponierender Software, die großen Meister als Vorbilder zu nehmen, damit der Output nicht nur dem Computer entstammt, sondern auch einen anerkannten Meta-Autor hat. Es mag wenig überraschen, daß J. S. Bach derjenige zu sein scheint, dessen Werk am häufigsten für eine Analyse und anschließende Synthese herhalten muß. 40 41 42 Entwurf eines mechanischen Computers von Charles Babbage, erstmals 1837 beschrieben. Sketch of The Analytical Engine Invented by Charles Babbage. By L. F. Menabrea of Turin, Officer of the Military Engineers. With notes upon the Memoir by the Translator Ada Augusta, Countess of Lovelace. Genf 1842. zitiert nach http://www.fourmilab.ch/babbage/sketch.html 41 Manche programmieren Kompositionssoftware aber auch weniger aus einem künstlerischen Ausdrucksbedürfnis heraus, sondern schlicht und einfach, um über ein kreatives Loch hinwegzuhelfen. Interessanterweise entstand eines der heute bekanntesten und am besten dokumentierten Kompositionsprogramme, Experiments in Musical Intelligence von David Cope, aus eben dieser Motivation. Dieser Ausnahmeerscheinung ist Kapitel 4.3 gewidmet. 42 4 Ausgewählte Beispiele algorithmischer Kompositionstechniken 4.1 Bontempis Nova Methodus Das 1660 in Dresden erschienene Traktat Nova quatuor vocibus componendi methodus, qua musicae artis plane nescius ad compositionem accedere podest des Giovanni Andrea Bontempi ist eine der ersten für Laien gedachten Kompositionsanleitungen, die heute in allen Details nachvollziehbar ist und tatsächlich ohne besondere Vorkenntnisse brauchbare Ergebnisse produziert. Es ist Heinrich Schütz (Henrico Sagittario) gewidmet, aber im Gegensatz zu anderen Werken Bontempis nicht besonders bekannt und in der Fachliteratur kaum präsent. Das Herzstück dieser Methode ist die rota, eine aus neun Kreissegmenten bestehende und in vier konzentrische Ringe unterteilte Kreisscheibe. Die Ringe stehen für die vier Stimmen (vom Cantus außen bis zum Bassus innen), denen jeweils acht Zahlen zugeordnet sind. Wie man leicht erkennen kann, steigen die Zahlen im innersten (zum Bassus gehörenden) Ring im Uhrzeigersinn von 1 bis 8 an, wohingegen die anderen Zahlen auf den ersten Blick etwas durcheinander erscheinen. 43 Die Zahlen repräsentieren die Tonstufen einer mixolydischen Tonleiter über zweieinhalb Oktaven, wobei der Grundton nicht vorgegeben ist und frei gewählt werden kann. Aufgrund der Tonumfänge und der Vorzeichen bieten sich in erster Linie die Töne F , G und A als Grundton an. Übersetzt man die Zahlen nun in Töne, beispielsweise in der Tonart F-Mixolydisch (im Uhrzeigersinn, sprich mit schrittweise aufsteigendem Bassus), ergeben sich folgende Harmonien (die nicht als Harmoniefolge, sondern einfach als Auflistung des zur Verfügung stehenden Materials verstanden werden sollen): 3 3 == == == == = = == = = = = = = = = = = 3 = 3 = = = = = = = 1 2 3 4 5 6 7 8 Der erste Schritt zur Komposition ist die Wahl einer Textstelle und einer passenden rhythmischen Strukturierung derselben. Im folgenden wird zu Bontempis Beispieltext In convertendo Dominus captivitatem Sion facti“ nach sei” nen Anweisungen, aber aufgrund eigenständiger Entscheidungen ein neuer Satz komponiert. Der Text kann z. B. folgendermaßen rhythmisiert werden: : > > > > > > > = In con ver ten do Do mi nus > >>> > > > = cap ti vi ta tem Si on fac < ti Nun weist man den einzelnen Silben jeweils die für den Bassus vorgesehenen Zahlen in fast beliebiger Anordnung zu: die einzigen Ausnahmen sind die Anfangstöne 3, 5 und 7 sowie die Schritte 1-7 und 2-8 (jeweils eine kleine Septim) bzw. 3-7 (verminderte Quint), klarerweise in beide Richtungen. Bontempi empfiehlt außerdem die Verwendung kleiner Schritte, aber daran muß man sich nicht strikt halten. Die letzten beiden Silben bekommen einstweilen keine Ziffern zugeordnet. > > > > > >: > = 1 6 3 4 2 In con ver ten do 1 Do 3 4 mi nus > >>> > > > = 2 7 4 5 2 cap ti vi ta tem 44 4 6 < Si on fac ti Mit Hilfe der rota kann man die Harmonien nun leicht ergänzen: Cantus 17 15 19 15 16 17 19 15 16 16 15 12 16 15 15 Altus 15 15 15 13 13 15 15 13 13 14 13 14 13 13 15 Tenor 12 10 8 13 11 12 8 13 11 9 13 12 11 13 10 Bassus 1 6 3 4 2 1 3 4 2 7 4 5 2 4 6 Um die Komposition abzuschließen, muß man zu den von Bontempi vorgegebenen Kadenztafeln greifen, die die Verbindung zwischen dem Akkord der drittletzten Silbe (in unserem Fall dem Akkord über 6) und der gewünschten Zieltonart, für die die selbe Einschränkung gilt, wie für den allerersten Ton (also alles außer 3, 5 und 7), anzeigen. Diese Kadenzen bestehen im wesentlichen aus dem letzten angegeben Akkord, der Dominante der jeweiligen Zieltonart und der Auflösung in selbige, stellenweise durch Vorhalte und sonstige Bewegung aufgelockert. Peilen wir beispielsweise den Zielakkord über 1 an, stellt Bontempi folgende Kadenzen zur Verfügung: 3 3 == => 2 > == == == == 3 3 >> >> => > == = => > == = = 3 3 = = = 3 = 3 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = > > == >> >> => > == 938 == 2 == == = > => > == > = = = = = = 45 = = = = 938 == = = = = = = = = = = = = = Das solchermaßen erarbeitete Stück sieht also in seiner Gesamtheit wie folgt aus: 33 >> > >> > > >> :: >> > > > > >: > > 3 > > > 3 > > > > >: > >> >> >> > > > >>> >>> > == = = In con ver ten do Do mi nus >> >> > => 2 > << > > > = > > > = cap ti vi ta tem Si on fac < < ti Das Ergebnis ist ein unbestreitbar authentisches und gleichzeitig individuelles Stück geistlicher Musik des 17. Jahrhunderts. Die Einfachheit und die Eleganz der Kompositionsmethode sowie die vielen Wahlfreiheiten des damit arbeitenden Laien werfen aber die Frage auf, wie es Bontempi gelingen konnte, mögliche Kompositionsfehler auszuschließen und ein mehr oder weniger gleichbleibendes Qualitätsniveau zu garantieren. Die angegebenen Beschränkungen für den Bassus stellen sicher, daß innerhalb dieser Stimme keine unsanglichen (und daher unerlaubten) Intervallsprünge (Septim bzw. Tritonus) auftreten. Jede andere Stimme ist so konzipiert, daß die selben Intervalle ebenfalls ausgeschlossen werden (auch die Stimmkreuzung beim Akkord über 5 ist darin begründet). Die Stimmführungsregeln gelten aber nicht nur jeweils auf eine Stimme bezogen, sondern betreffen auch Akkordprogressionen, wobei offene oder verdeckte Oktav- und Quintparallelen vermieden werden sollen. Bontempis Regeln lassen genau 50 mögliche Akkordprogressionen zu (von jeder der acht Stufen könnte man auf die sieben anderen wechseln, es sind aber drei Schritte und ihre Umkehrungen verboten, also (8 · 7) − 6 = 50), und es erscheint ziemlich aufwendig, die unerlaubten Parallelen bei all diesen Möglichkeiten bewußt zu vermeiden. Bontempi erreicht dies, indem er jeden einzelnen Akkord unterschiedlich setzt – und das gelingt ihm, obwohl sieben der acht Akkorde grundständig sind (der Akkord über 3 ist klarerweise ein Sextakkord, damit keine verminderte Quint über dem Grundton entsteht). Transponiert man alle grundständigen Akkorde exemplarisch nach C (wobei die Versetzungszeichen aus Gründen der Einfachheit weggelassen werden), sieht man den jeweils unterschiedlichen Akkordaufbau: 46 = = == == = = = = = = = = = = = = = = = == == = 1 2 4 5 6 7 8 Keine der drei Oberstimmen befindet sich zweimal in der gleichen Oktavoder Quintposition zum Bassus, denn dies würde im Falle der entsprechenden Akkordprogression zu einer offenen Parallele führen. Wir sehen aber, daß jede der drei Stimmen entweder Oktav oder Quint (oder beide) in zwei verschiedenen Lagen berührt. Angesichts der Tatsache, daß das zweite Mal in allen Fällen eine Lage tiefer erfolgt und daß der Bassus sich dabei auf einer höheren Stufe als zuvor befindet, ergeben sich daraus Antiparallelen, die, wie Lester nachweist, zu Bontempis Zeit nicht nur unproblematisch, sondern explizit erlaubt waren.43 Freilich bedeutet die Vermeidung aller möglichen Fehlerquellen nicht unbedingt hochwertige Qualität. So zeigt beispielsweise der Cantus trotz fehlender unsanglicher Intervalle in den seltensten Fällen wirklich eine schöne Stimmführung (und wenn, dann auch eher zufällig), und auch motivische Bezüge zwischen einzelnen Abschnitten sind nur im Bassus einfach zu bewerkstelligen. Was den harmonischen Verlauf betrifft, so sind in allen möglichen Modi (die nicht einmal einheitlich sein müssen, weil man nicht mit der selben Stufe schließen muß, mit der man begonnen hat) die selben acht Akkorde in verschiedenen Permutationen, aber unabhängig von der Zählzeit, vom Text oder sonst irgendeinem musikalischen Faktor zu finden. Mit dem Zulassen einer uneinheitlichen Tonalität, bei der der eigentliche Modus erst mit der Zieltonart feststeht, verletzt Bontempi auch nicht den Geschmack seiner Zeit44 , was allerdings durch die systematische Fixierung von Tonartenbezügen im Laufe der folgenden Generationen rückblickend erstaunlich wirken mag. Der Nachhall von Bontempis Methodus war gering, aber es existiert ein auf den ersten Blick vergleichbares Werk. Der Stuttgarter Vizekapellmeister Johann Christoph Stierlein veröffentlichte in seinem Theoriebuch Trifolium musicale (1705) unter anderem eine Anleitung Wie man arithmetice, und mit lau43 44 Lester, S 95. siehe Lester, S. 98. 47 ter Zahlen an statt der Noten componiren lernen könne. Trotz offensichtlicher Ähnlichkeiten mit Bontempis methodus (Stierleins Methode basiert ebenfalls auf einer Kreisscheibe, die das Tonmaterial der einzelnen Stimmen angibt) gelingt es ihm jedoch nicht, das im Titel gegebene Versprechen einzulösen, denn seine Anweisungen sind so knapp und unverständlich, daß man das Wesentliche, nämlich die Auswahlmechanismen der skizzierten Möglichkeiten, nicht mehr nachvollziehen kann.45 So bleibt also Bontempis Traktat ein einzigartiges Stück Musikgeschichte, das nicht nur erlaubt, innerhalb eines sehr stark eingeschränkten, aber ausreichend freien Systems ohne Vorkenntnisse zu komponieren, sondern auch noch interessante und authentische Einblicke in die Theorie der damaligen Zeit gewährt. 4.2 Musikalische Würfelspiele In der zweiten Hälfte des 18. Jhdts. kamen Musikalische Würfelspiele als eine Art Unterhaltung für Menschen ohne musikalische Bildung auf. Sie ermöglichten das Zusammenstellen – also Komponieren im ursprünglichen Wortsinn – von kleinen, musikalisch nicht besonders anspruchsvollen, aber rein statistisch betrachtet praktisch einzigartigen Stücken auf Zufallsbasis. Das erste solche Spiel ist das von J. Ph. Kirnberger verfaßte, 1757 in Berlin veröffentlichte Werk Der allezeit fertige Polonoisen- und Menuettencomponist“, das eine bis in die ” erste Hälfte des 19. Jhdts. anhaltende Mode begründet hat. Einer der neusten modischen Zeitvertreibe in Gesellschaften ist jetzt ” in Frankreich das musikalische Würfel-Spiel; wo jedermann, der nur ein bißgen Clavier spielen kann, ohne ein Wort von Composition zu verstehen, vermittelst zweyer Würfel und eines Notenblatts, Menuets ins Unendliche komponiren kann. Keiner unserer Leser wird hoffentlich diese Kunst für Hexerey, oder für mehr halten als was sie ist: nemlich einen glücklichen Einfall eines guten mathematischen Kopfs, die müßige frivole Pariser Welt mit einer musikalischen Posse auf etliche Tage zu amüsiren.“46 Kirnberger erwähnt, daß die Idee ursprünglich nicht von ihm stammt und er sie nur übernommen und verfeinert hat, um das Spiel schlußendlich realisieren zu können. Die Quelle seiner Anregung ist heute Gegenstand von Spe45 46 Lester, S. 100. zitiert nach Reuter, http://chr-reuter.de/wuerfel/geschichte.htm 48 kulation. Die Inspiration könnte auf die Weiterentwicklung der Ideen eines der bereits erwähnten Vorgänger zurückgehen, aber ebenso beispielsweise aus der persönlichen Kommunikation mit Freunden oder Kollegen stammen. Es ist sogar denkbar, daß Kirnberger Jonathan Swifts Beschreibung einer aus Wörtern ganze Sätze erzeugenden Vorrichtung in Gulliver im Lande der Mathematiker kannte und musikalisch umsetzen wollte. Weiters wird er sich als Theoretiker wohl auch mit L. C. Mizlers und Joseph Riepels mathematischen und kombinatorischen Denkweisen beschäftigt haben. Heute sind etliche Würfelspiele noch bekannt, wenn auch teilweise nicht mehr auffindbar oder nicht eindeutig einem Komponisten zugeordnet. Einige Beispiele in chronologischer Reihenfolge:47 • J. Ph. Kirnberger: Der allezeit fertige Polonoisen- und Menuettencomponist. Winter, Berlin 1757. • Carl Philipp Emanuel Bach: Einfall, einen doppelten Contrapunct in der Octave von sechs Tacten zu machen, ohne die Regeln davon zu wissen. Lange, Berlin 1754-1778. • Maximilian Stadler: Tabelle, aus welcher man unzählige Menueten und Trio für das Klavier herauswürfeln kann. Wien 1781 (ursprünglich evtl. Paris, 1780). • Michael Johann Friedrich Wiedeburg: Musikalisches Charten-Spiel ex G dur, wobey man allezeit ein musikalisches Stück gewinnet, zum Vergnügen und zur Übung der Clavierspieler und zum Gebrauch der Organisten in kleinen Städten und auf dem Lande. Aurich 1788. • Gioco filarmonico o sia maniera facile per comporre un infinito numero de minuetti e trio anche senza sapere il contrapunto. Luigi Marescalchi, Neapel 1790. Joseph Haydn zugeschrieben, offensichtlich identisch mit Stadler (1781).48 • Wolfgang Amadeus Mozart: Anleitung so viel Walzer oder Schleifer mit zwei Würfeln zu componiren so viel man will ohne musikalisch zu seyn noch etwas von der Composition zu verstehen (KV Anh. 294d). J. J. Hummel, Berlin-Amsterdam 1793. Die Autorschaft Mozarts ist strittig. 47 48 angelehnt an Reuter, http://chr-reuter.de/wuerfel/geschichte.htm siehe Pajot, http://www.mozartforum.com/Library%20Articles/Library 46 K Anh C30.01 Dice Game.htm 49 • Anleitung so viel Englische Contre-Dänze mit zwei Würfeln zu componiren so viel man will ohne musikalisch zu seyn noch etwas von der Composition zu verstehen. J. J. Hummel, Berlin-Amsterdam 1793. W. A. Mozart zugeschrieben. • Friedrich Gottlob Hayn: Anleitung, Angloisen mit Würfeln zu komponiren. Beytrag zur Unterhaltung für Musikliebhaber. Dresden 1798. • C. H. Fiedler: Musicalisches Würfelspiel oder der unerschöpfliche Ecossaisen-Componist. Hamburg 1801. Das Aufkommen der Musikalischen Würfelspiele geht mit einem Paradigmenwechsel in der Musik einher. Im Gegensatz zu Kircher, für den die Mathematik eine Art Beschreibung der allen Dingen zugrundeliegenden Gottesordnung ist, sind die Komponisten des späten 18. Jahrhunderts Rationalisten, die die Mathematik als Hilfswissenschaft begreifen und ihre Wirkung offenlegen wollen. Gleichzeitig vollzieht sich ein Wandel im musikalischen Denken: bis zur Mitte des Jahrhunderts war das Generalbaßspiel Grundlage sowohl der Spieltechnik als auch der Komposition und Kirnberger selbst einer der letzten großen Theoretiker dieser Denkweise. Die theoretischen Werke Riepels stellen allerdings die Taktordnung in den Mittelpunkt; nach seiner Auffassung besteht Musik aus Bausteinen, die man in gewissem Rahmen austauschen oder umstellen kann. Diese Denkart spiegelt sich in den Musikalischen Würfelspielen wider, wobei Kirnberger hier eine einzigartige Stellung zukommt: er ist nicht nur der konservative Verfechter der alten Ideen, sondern auch einer der ersten, die das moderne Gedankengut aufgreifen und anwenden. Alle Musikalischen Würfelspiele funktionieren nach dem gleichen Schema. Der Ausführende braucht eine bestimmte Anzahl von Würfeln sowie die vom Autor vorgegebene Tabelle und die entsprechenden Notenblätter. Bei jedem Wurf weist die Tabelle der gewürfelten Augenzahl einen Takt des Notenblattes zu, es gibt also jeweils so viele Anfangstakte, zweite Takte usw., wie mögliche Augenzahlen. Hat man die geforderte Anzahl von Würfen ausgeführt und die mit den Augenzahlen korrespondierenden Takte gefunden und zusammengefügt, erhält man ein fertiges Musikstück. Bei fast allen Musikalischen Würfelspielen handelt es sich um einfache, gleichförmig aufgebaute, periodische Stücke, meist Tänze wie Menuett, Polonaise oder Walzer. Der harmonische Verlauf ist fix, die einzelnen Alternativen stellen also nur melodische und rhythmische Variationen dar. Die Vorgangsweise bei 50 der Erstellung eines neuen Würfelspiels besteht also aus dem Komponieren einer Vorlage und einer entsprechenden Anzahl von Variationen über das gleiche harmonische Schema. Die Variationen werden danach zerstückelt und die Takte bekommen jeweils eine Zahl zugewiesen, die in der Tabelle einem Würfelergebnis entspricht. Die Stücke sind in der Regel für ein bis zwei Melodiestimmen und einen Baß komponiert, sodaß sich mehrere Ausführungsmöglichkeiten bieten (Melodieinstrument(e) + Baßinstrument, Melodieinstrument(e) + Baß + Tasteninstrument bzw. nur ein Tasteninstrument). Die Anzahl aller möglichen Ergebnisse läßt sich relativ einfach berechnen. Mit einem Würfel hat man sechs, mit zweien elf mögliche Augenzahlen, denen jeweils ein Takt der Musik zugeordnet ist. Für zwei aufeinanderfolgende Takte beträgt die Anzahl der Kombinationen 6 · 6 bzw. 11 · 11, da jeder erste Takt mit jedem zweiten verbunden werden kann. Bei einem n-taktigen Stück käme man also auf 6n bzw. 11n Kombinationsmöglichkeiten. Tatsächlich sind aber in der Regel einige Takte identisch (meist gibt es einige gleiche Alternativen für die Schlußtakte, im Extremfall sogar nur eine einzige Möglichkeit, die aber allen Würfelergebnissen zugewiesen wird), sodaß sich insgesamt etwas weniger Kombinationen ergeben. Aber selbst wenn man nur den 6-taktigen ersten Teil der Kirnbergerschen Polonoise (sic! ) betrachtet, kommt man mit einem Würfel auf immerhin 66 = 46 656, mit zwei Würfeln (bei sieben verschiedenen Schlußtakten) sogar auf 115 · 7 = 1 127 356 Möglichkeiten (nimmt man den 8-taktigen zweiten Teil dazu, ergeben sich für die ganze Polonoise bereits 78 364 164 096 bzw. 241 658 985 007 517, also über 240 Billionen mögliche Kombinationen!). Rein statistisch ist also jedes mit einem Musikalischen Würfelspiel komponierte Stück so gut wie einzigartig. Trotz Verwendung eines Zufallselements handelt es sich hierbei um einen determinierten Algorithmus, denn gleiche Eingabewerte (sprich: eine identische Folge von Augenzahlen) liefern jeweils das selbe Ergebnis. Bei Verwendung eines Würfels ist die Auftrittswahrscheinlichkeit jedes einzelnen erzeugten Stückes gleich hoch (sieht man von den eventuell identischen Takten ab, die mehreren Würfelergebnissen zugeordnet sind), zwei Würfel führen aber schon zu einem interessanten Phänomen. Die möglichen Würfelergebnisse 2–12 treten nicht mit der selben Wahrscheinlichkeit auf, denn für die Ergebnisse 2 und 12 gibt es jeweils nur eine mögliche Kombination (1+1 bzw. 6+6), für die 7 beispielsweise jedoch sechs (1+6, 2+5, 3+4, 4+3, 5+2, 6+1). Die Auftrittswahrscheinlichkeit der Summe der Augenzahlen beider Würfel ist also bei 2 und 12 am niedrigsten (jeweils 1/36) und steigt von beiden Extremen bis hin zur 7 schrittweise um den 51 selben Wert bis auf 6/36=1/6. Das Würfelergebnis 7 kommt also sechsmal so häufig vor wie z. B. das Ergebnis 2 und genauso oft wie die Ergebnisse 4 und 10 zusammengenommen (jeweils 3/36, insgesamt also 6/36). Dadurch werden die den wahrscheinlicheren Zahlen zugeordneten Takte sozusagen bevorzugt, ebenso wie Stücke, in denen besagte Takte kumulieren. Es ist eine interessante Frage, ob dies den Komponisten Musikalischer Würfelspiele bewußt war, aber es ist anzunehmen, daß die Würfelergebnisse zumindest bei Kirnberger und C. Ph. E. Bach den Takten zufällig zugeordnet worden sind; die Beschaffenheit der Kirnbergerschen Polonoisentakte deutet darauf hin. Könnte man eine melodische und rhythmische Homogenität bei den Takten, die jeweils gleichen Augenzahlen zugeordnet sind, feststellen, wie es beispielsweise bei dem Mozart zugeschriebenen Würfelspiel bis zu einem gewissen Grad der Fall ist, könnte man zwar von einer nicht zufälligen Taktzuweisung ausgehen, aber für die bewußte Verwendung der statistischen Bevorzugung besagter Würfelergebnisse müßte zum Beispiel ein merkbares Qualitätsgefälle vorhanden sein. Sehen wir uns den ersten Teil einer nach Kirnbergers Vorgaben erwürfelten Polonoise an. Die sechs Würfelergebnisse sind der Reihe nach 8, 8, 4, 9, 6 und 3, was nach der Tabelle den Takten 114, 112, 60, 110, 48 und 26 entspricht (aus platztechnischen Gründen beschränken wir uns auf die für ein Tasteninstrument zusammengefaßte Begleitung, die neben dem Baß auch die Stimmen der beiden Melodieinstrumente enthält). / / 114 2 3 4 3 4 > d >> :> > >> >> > * > > //110> > > >> > > > >> :: >> >> >> 4 2 > d > > > > > > > > > > >> >> > > > > > > > > 112 60 > /> 48 > > > > > > > >26> > > :> > > > = > > > 2> >/> 2>/> > >= > > > > > > /> > 52 > >: :: > > :: Wir sehen hier eine relativ mittelmäßige, wenn nicht gar schlechte Komposition. Sie entspricht zwar dem vorgegebenen, an sich schon wenig aufregenden Harmonieschema (bis auf die Takte 2 und 5 befinden wir uns durchgehend auf der Tonika), weist aber neben einem akuten Mangel an motivischer Bezugnahme und melodischer sowie rhythmischer Homogenität auch einige unsangliche bzw. ungeschickte Intervallsprünge oder unmotivierte Tonwiederholungen auf. Die Linienführung im Baß ist konsequent, wenn auch äußerst banal, aber an den Oberstimmen merkt man, daß es sich hier um Bausteine handelt. Würden wir den Vorgang wiederholen, sollten wir auch bei anderen Würfelergebnissen Musik ähnlicher Qualität erhalten. Der Verdacht liegt nahe, daß die hohe Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten im statistisch relevanten Großteil aller Fälle mit qualitativ minderwertigen Ergebnissen einhergeht. Das Baukastenprinzip wird offensichtlich, wenn man zunächst alle Anfangstakte (geordnet nach aufsteigendem Würfelergebnis) und in weiterer Folge die Fortsetzungsmöglichkeiten genauer unter die Lupe nimmt. d // 70 3 4 > >>> >>> > > 2 // 3 4 > > > 10 > >>> >>> // 62 > > d > d 44 > > > > >> > >>> >>> >> > // > > > >: > > > > >>>> 4 2 42 72 >> > > > >: >> >: >> d d > >: >> >: >> d114> d >> > > >> :> > >> >> 3 > >> > > > > >> > > > * > > > > 3 53 131 138 144 //123 > > >>> >> > > > > >> > > >> > >>>>> > > >>> > > > > 8 2 // > > > > > > > > > > > > Innerhalb der Takte ist keine harmonische, sondern nur melodische Bewegung vorhanden, die sich allerdings im wesentlichen auf rhythmisch variierte Dreiklangszerlegungen beschränkt. Der Baß begnügt sich gar mit Grundton und Terz, sofern er nicht die Bewegung der Oberstimme eine Oktav tiefer mitmacht. Interessant ist, daß die ersten sechs (also die für das Spiel mit einem Würfel vorgesehenen) Takte ausnahmslos in der Oktave enden und damit in der Fortsetzung parallele Oktaven riskieren. Der siebente Anfangstakt (114) kommt gar auf eine Quint (+ Oktav) zwischen Oberstimme und Baß, und nur zwei der insgesamt elf Takte (123 und 138) gehen auf die stimmführungstechnisch interessante Alternative der Terz, die man in Anbetracht der nachfolgenden Dominante melodisch wesentlich unbedenklicher weiterführen könnte. // 34 43 > > > > > >> 2 // 3 4 24 > > > > >>>> > >> >> > > 3 >> > > > > > 6 > > > > > >> > > > > > > > > > >> 112 > 3 d 56 // 8 > > > > > > > > >/> > >>> > > > > 4 2 // > > > >: > >> 54 30 > > >> > > >> > >>>> > > >> > > >> > > > //116 > > > > > 147 d >>: > >> >> :> > >> >> > > 151 8 2 // > > > > >>* > > > > > 153 >> > > >> >> > > > > > > > > > > Die Betrachtung der fortführenden Takte offenbart auf den ersten Blick, daß Kirnberger tatsächlich elf melodisch und rhythmisch sehr homogene Variationen erstellt, auseinandergerissen und nach dem Zufallsprinzip den Würfelergebnissen zugeordnet hat. Es ist evident, daß er die Fortsetzung der mit einem Würfel erreichbaren Takte bewußt von den restlichen fünf trennt (sodaß also die Fortsetzungen auch jeweils im Spiel mit einem Würfel auftreten können), aber ansonsten ist keine Regelmäßigkeit zu erkennen: der dem Würfelergebnis 1 (bzw. mit zwei Würfeln 2) entsprechende Takt 70 erfährt seine Weiterführung in T8 (Würfelergebnis 4 bzw. 5), wohingegen beispielsweise der mit 11 erwürfelte T138 in den dem selben Würfelergebnis entsprechenden T151 führt. Im Gegensatz dazu sieht man bei einem durch das Mozartsche Würfelspiel generierten Walzer, daß hier die Variationen wesentlich weniger durcheinandergemischt worden sind. Ein Walzer, der nur aus gleichen Würfelergebnissen (hier jeweils die 6) besteht, zeigt große rhythmisch-melodische Homogenität. 148 2 3 8 3 8 > > > > 74 > > > > 163> > 45 >> > > /> > > > > > >>> > >> * >> * >> 55 * >> * > >c / > 5 2 80 > * 97 36 >107> > /> > > > / > > >> >> > > > >> > > > > * :: > > > > : : > 1. > 2. Die oben erwähnten stimmführungstechnischen Risiken zeigen nun bei bestimmten Taktkombinationen tatsächlich negative Auswirkungen. Die Oktavparallelen kommen zwar nur in den Verbindungen jener Takte vor, in denen Oberstimme und Baß sowieso in Oktaven laufen, da Kirnberger sonst bei der Verwendung des Grundtons in der Melodiestimme des zweiten Taktes im Baß auf die Terz ausweicht (T147), aber die Quinte am Beginn von T153 kann in Kombination mit der Quint am Ende des vorangehenden T114 zu einer offenen Quintparallele zwischen den Außenstimmen führen. Es ist eine interessante Frage, ob Kirnberger diese inkonsequente bzw. falsche Stimmführung bemerkt und bewußt nicht korrigiert oder einfach übersehen hat. Stimmführungstechnische Mängel sind auch anderswo zu bemerken: die Takte 147 und 153, besonders aber T116 legen durch die Septim der Dominante eine melodische Fortführung in die Tonikaterz nahe, was leider der dem Würfelergebnis 1 bzw. 2 entsprechende T68 nicht zu leisten vermag (alle anderen Alternativen für den dritten Takt hingegen schon). Die Gründe für die mäßige Qualität des Outputs liegen also auf der Hand: für die Möglichkeit, unzählige Ergebnisse ohne Fachwissen produzieren zu können, nimmt Kirnberger Inhomogenität und Inkonsequenz in Kauf. Es ist wohl unmöglich, ein Würfelspiel, das vorwiegend Meisterwerke produziert, zu entwerfen, da der Aufwand mit der Anzahl der Möglichkeiten ins Unermeßliche steigt: es gilt nicht nur, mindestens sechs qualitativ hochwertige Variationen zu produzieren, sondern der Komponist müßte auch noch die einzelnen Taktkombinationen genauer untersuchen und gegebenenfalls Korrekturen durchführen, die sich wiederum anderswo, nämlich z. B. in einer der ursprünglichen Variationen, auswirken. So aber liegt die Qualität wie auch die Autorschaft in einem eigenartigen Zwischenraum zwischen dem Komponisten, in unserem Fall Kirnberger, und einem angenommenen musikalisch ungebildeten Spieler. 56 4.2.1 Das Musikalische Würfelspiel als stochastischer Algorithmus Die Analyse einzelner Takte des Kirnbergerschen Würfelspiels zeigt deutlich, daß jeder Takt bessere und schlechtere (stilistisch, stimmführungstechnisch oder charakterlich passendere bzw. weniger passende) Fortführungsmöglichkeiten hat. Dieser Tatsache würde man Rechnung tragen, wenn man das zu komponierende Musikstück als Markow-Kette erster Ordnung (eine höhere Ordnungszahl ist angesichts der Kürze der Kette nicht unbedingt sinnvoll) betrachtet, deren Glieder die einzelnen vorgegebenen Takte sind. Eine echte Markow-Analyse ist hier natürlich nicht möglich, da uns außer den elf ursprünglichen Variationen, die es in der Notentafel zu finden gälte, keine fertigen Stücke mit diesen Bausteinen zur Verfügung stehen, jene aber keine Alternativen zulassen und daher eine Matrix mit ausschließlich 100%-igen Übergangswahrscheinlichkeiten erzeugen würden. Wir können diese also nur mehr oder weniger willkürlich zuordnen, wobei uns immerhin die Theorie der Epoche und auch die Musik Kirnbergers und seiner Zeitgenossen gewisse Hilfestellungen bieten können. So können wir offensichtliche Stimmführungsschwächen und andere Unvollkommenheiten der Vorlage mit einer Übergangswahrscheinlichkeit von 0 versehen und damit ausschließen, auf der anderen Seite aber die durch Kirnberger auskomponierten Variationen sowie melodisch und rhythmisch konsequente Fortführungen einzelner Takte statistisch bevorzugen. Kirnberger ermutigt den musikalisch gebildeten Spieler seines Würfelspiels, die Würfel wegzulassen und eigenhändig nach einem gefälligen Musikstück zu suchen. Der dabei ablaufende kreative Prozeß basiert grundsätzlich auf den selben Faktoren, wie die beschriebene Markow-Synthese: Stimmführungsregeln, melodisch-rhythmische Homogenität und eine Portion Zufall. Es ist hier also offensichtlich möglich, den kreativen Prozeß mittels stochastischer Methoden zu imitieren. Eine andere, weniger willkürliche Möglichkeit, die statt der theoretischen Faktoren den Publikumsgeschmack berücksichtigt, wäre eine Datenbank, die neben einigen zufällig generierten Polonoisen auch ihre jeweilige Bewertung durch ein Publikum als Zahlenwert enthält. Aus diesem Wert könnte man die (subjektiv wahrgenommene) Qualität (sprich: Publikumswirksamkeit bzw. Rezeptionswert) der einzelnen Stücke ablesen, was wiederum Grundlage einer echten Markow-Analyse sein könnte. Die Taktverbindungen beliebter Stücke bekommen in den Übergangsmatrizen höhere Wahrscheinlichkeiten zugewiesen als die der schlecht bewerteten Erzeugnisse, was bei der Komposition neuer Werke entsprechend zum Tragen kommt. Jedes neue Stück bereichert die Datenbank 57 durch seine Substanz und seine Bewertung, was wiederum in weiterer Folge die Analyse des gesamten Datenbankbestandes beeinflußt. Wie auch immer die Realisation aussehen mag, das Ergebnis wird mit hoher Wahrscheinlichkeit qualitativ hochwertiger sein als ein rein zufällig erzeugtes Musikstück. Das geht wiederum natürlich auf Kosten der Anzahl möglicher Stücke, da manche Taktverbindungen ganz ausscheiden. Durch die Gewichtung der Wahrscheinlichkeiten ist es also möglich, die Quantität des Outputs zu verringern und gleichzeitig die Qualität zu erhöhen. 4.3 Experiments in Musical Intelligence Experiments in Musical Intelligence (EMI) ist ein 1981 angefangenes Projekt des Komponisten und Musikwissenschaftlers David Cope49 , das Stilanalyse und algorithmische Komposition miteinander verbindet. EMI ist aus dem Bedürfnis entstanden, eine künstlerische Blockade50 zu überbrücken, wobei der Computer eine Art Hilfestellung bieten sollte, die jedoch weder beliebig noch zufällig ist. Copes Programm analysiert Musik, die sich in der internen Datenbank befindet, und komponiert im Endeffekt ähnliche Musik. Die Wahl der unzähligen Parameter kann den Grad dieser Ähnlichkeit bestimmen. Theoretisch ist es sogar möglich, stilistisch inhomogene Musik in die Datenbank zu laden, um so einen interessanten, wenngleich künstlerisch vielleicht nicht wirklich hochwertigen Stilmix zu erzeugen. Da keine eindeutige Definition des Begriffs Stil“ im Bezug auf die Musik ” existiert, entwirft Cope seine eigene, sehr pragmatische Definition: [. . . ] the identifiable characteristics of a composer’s music which are ” recognizably similar from one work to another“51 Ausgehend von dieser Definition schafft er eine komplexe, durch seine persönliche Sichtweise der Musik geprägte Analysemethode, die mehrere vorhandene Analysemodelle (Analyse nach Schenker, pitch-class-sets, linguistische Modelle usw.) übernimmt, zum Teil verändert und zusammenführt. Hierzu ist allerdings ein gewisses Volumen an zu analysierenden Originalwerken nötig, denn die Analyse sucht, wie die Definition ankündigt, nach Gemeinsamkeiten der vorgegebenen Werke. 49 50 51 David Cope, * 17. Mai 1941 in San Fancisco; Professor an der University of California, Santa Cruz. http://arts.ucsc.edu/faculty/cope/index.htm Cope 1991, S. 18. Cope 1991, S. 30. 58 Copes Ansatz ist nicht nur umfassend und gut dokumentiert, sondern auch ziemlich erfolgreich. Das beweisen die zahlreichen Tonträgerveröffentlichungen, Vorlesungsreihen an mehreren amerikanischen Universitäten und die Reaktionen von Publikum und Fachkollegen. In diesem Kapitel wird ein einigermaßen detaillierter Einblick in die Funktionsweise von EMI gewährt, begleitet von einer konkreten und hoffentlich aufschlußreichen Analyse einer von EMI im Stile Bachs komponierten Invention. Den Abschluß bildet eine kleine Zusammenfassung der Erfolge von und Reaktionen auf Copes Programm. 4.3.1 Funktionsweise EMI ist ein in der Programmiersprache LISP (kurz für LISt Processing) entwickeltes Programm, das in seiner Funktion stark durch den formalen Aufbau dieser Sprache geprägt ist. LISP besteht im wesentlichen aus Einzelwerten (Atomen) und Listen von Atomen, wobei letztere auch hochgradig verschachtelt sein können. Auch die Programmanweisungen sind formal gesehen Listen. Dadurch ist es möglich, mit verhältnismäßig wenigen Programmbefehlen sehr komplexe Operationen zu definieren und durchzuführen. Der Struktur der Programmiersprache entsprechend stellt EMI Musik als Listen (bzw. Listen von Listen) von Einzelwerten dar, wobei Tonhöhe und Tondauer in Zahlen umgesetzt werden. EMI analysiert und manipuliert diese Listen und gibt ebenfalls Listen aus, die anschließend wieder in Tonhöhen und Notenwerte umgesetzt werden können. Gleichzeitig ist es aber auch möglich, an vielen Punkten des Prozesses das vorläufige Ergebnis zu begutachten und gegebenenfalls einzugreifen. Seit der ersten Version hat Cope sein Programm in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt, verändert und verbessert, sodaß eine komplette und in jedem Punkt zutreffende Beschreibung von EMI nicht möglich ist. Die nachfolgende Funktionsbeschreibung enthält die Grundsätze der von Cope dokumentierten Entwicklung. Rekombination Um sicherzustellen, daß EMI Musik komponiert, die auch vom Komponisten der jeweiligen Originalwerke in der Datenbank hätte komponiert werden können, wird die Musik in Einzelteile zerlegt und anders zusammengesetzt. Cope nennt diesen Vorgang recombinancy (Rekombination). Dieses Prinzip läßt sich sehr gut an Bach-Chorälen beobachten, da die gleichmäßige Viertelbewegung und 59 die Homogenität der durchgehend vierstimmigen Textur dem Verfahren sehr entgegenkommen. Gibt man mehrere (oder gar alle) Choräle in EMIs Datenbank, werden diese zerlegt und in sogenannten Bibliotheken gespeichert. In jeder Bibliothek sind jeweils identisch gesetzte Akkorde gemeinsam mit ihren von Bach komponierten Fortführungen enthalten, wie es das folgende Notenbeispiel zeigt. Die Zahlen oberhalb der Notensysteme geben die Nummer des Chorals (nach der Zählung von C. Ph. E. Bach) und des Taktes an, in dem sich die zitierte Akkordverbindung befindet. 3 >> > 7:1 > > > > 3 >> >> 3 2 >> 157:2 188:3 > > > > > >> > > > > > = > > > : 3 >> ::: =>: = > > >> > 2 > > 26:1 188:11-12 >> >> 7:2 : :: = :: = : : >> ::: >> == : >> ::: >> >> >> > > > 3> > > > > > : >> ::: => > 322:5-6 >> > >> 188:9 322:7 188:14-15 224:1 > > > > > : >: > > : > > > > > > > :: > :: > 2> > > :> >: >> > >> > :: > :: > 322:4-5 >> 938 >> 188:5 >> >> Hat man solche Bibliotheken angelegt, ist es ein leichtes, einen neuen Choral zu komponieren, indem man einfach irgendwo beginnt und unter den sich jeweils anbietenden Fortsetzungsmöglichkeiten eine auswählt. Die Gefahr, in eine Sackgasse zu kommen, besteht bei dieser Methode nicht, da jeder Akkord, der kein Schlußakkord ist, mindestens eine Fortsetzung hat. Der schlimmste Fall, der eintreten kann, besteht darin, daß mangels Alternativen über längere Distanz eine Originalkomposition wiederholt wird (in diesem Fall kann man die Datenbank erweitern oder einen Schritt zurückgehen und einen anderen Weg einschlagen). Wie das in der Praxis aussieht, zeigt das folgende Notenbeispiel (die Klammern geben die jeweils für die Rekombination herangezogene Akkordverbindung an).52 52 nach Cope 2001, S. 96 ff. 60 3 > > >> >> >> > 26:0-1 >> > >> > > > > > > > > 3 7:2 = > > > >> > > > 322:9 > > >> >> > > > > > > > > >> >> > > > > > > > > > EMI 224:1-2 > > 3 > > >> / >> > > > > > L > > >> > >> > > >> >> > >> == M >> > >> > > > > > >> =L > > /> > M 3 >> >> >> >> >> > > > > > > > 4 > > >> > >> Mit dieser Methode ist es offensichtlich möglich, Choräle zu schreiben, die ausschließlich aus von Bach bevorzugten Akkordprogressionen bestehen. Damit dies reibungslos möglich ist, müssen sich die Stücke der Datenbank in der selben Tonart befinden, was also entweder eine entsprechende Auswahl oder eine passende Transposition bedeutet. Der Datenbankbestand kann allerdings von EMI automatisch variiert werden, um die Bibliotheken zu vergrößern. Hierzu eignen sich Methoden wie die diatonische Transposition, bei der die Akkordverbindungen unter Beibehaltung des diatonischen Tonmaterials (und Verzicht auf die konkreten Intervallgrößen) Stufe für Stufe transponiert werden (aus einem F-Dur-Akkord wird also g-Moll, a-Moll, B-Dur usw.), Oktav- oder gegebenenfalls auch Quinttranspositionen einzelner Stimmen oder Stimmtausch. Ein grundlegendes Problem der skizzierten Methode ist, daß die solchermaßen komponierte Musik zwar in jedem Moment von der Qualität des Originals profitiert, über weite Strecken aber ziel- und richtungslos umherirrt, wobei sich Kadenzen eher zufällig ereignen (was unter anderem zu erheblich unterschiedlichen Phrasenlängen führen kann). Im Falle der Choräle wäre eine mögliche Lösung die Verwendung eines Cantus firmus, der Richtung und Phrasenlängen steuern könnte, aber das ist keine generell einsetzbare Hilfe. Stattdessen orientiert sich EMI an einem der Werke in der Datenbank und übernimmt die zeitlichen und tonartlichen Entfernungen und Proporionen der Kadenzen mit 61 einer vorgegebenen Abweichungstoleranz. Damit kann nicht nur die prinzipielle Form imitiert werden, sondern auch die für die Formbildung wichtigen Tonartenverhältnisse (z. B. bei der Sonatenhauptsatzform). Ein weiteres Problem, das bei den Chorälen kaum, bei anderer Musik aber sehr wohl auftauchen kann, ist die unterschiedliche Beschaffenheit der einzelnen Bausteine (die nicht immer einzelne Viertel sein müssen, sondern je nach Art der Musik auch kürzer oder länger, beispielsweise einen ganzen Takt lang sein können). Charakter, harmonische Geschwindigkeit oder die Anzahl der Stimmen können zwischen harmonisch und melodisch eigentlich passenden Bausteinen erheblich divergieren. EMI speichert bei der Zerlegung der Musik diese und weitere Aspekte der einzelnen Segmente als eine Art Metainformation und kann bei der Auswahl auf diesbezügliche Kompatibilität achten. Mustererkennung Eine simple Rekombination einzelner Bausteine hat sich bei der Komposition von Chorälen im Stil von Bach als praktisch erwiesen, in anderer Musik hingegen ist sie nicht so einfach zu bewerkstelligen und führt außerdem zu unbefriedigenden Ergebnissen. Grund dafür ist, daß dabei wichtige stilprägende Elemente, die den Umfang der Bausteine überschreiten, auseinandergerissen und dadurch getilgt werden. EMI hat deswegen einige Subprogramme, die sowohl einzelne melodische und rhythmische Muster (patterns) als auch Muster in der Verbindung melodischer und rhythmischer Elemente suchen, registrieren und in Beziehung zueinander setzen. Dieser Prozeß erfolgt rein formal und ist mit diversen Parametern verknüpft, die u. a. die Länge gesuchter Muster steuern. Damit verhält es sich ähnlich, wie mit den Markow-Ketten: sind die Muster zu kurz, können sie nicht den werkimmanenten Zusammenhang zur Gänze erfassen, sind sie aber zu lang, besteht die Gefahr, daß zu lange, erkennbare Stücke des Originals unverändert in der Neuschöpfung auftauchen. In früheren Versionen von EMI mußte man diese Parameter händisch einstellen und gegebenenfalls feinabstimmen, während inzwischen Algorithmen hierfür eingebaut wurden. Cope unterscheidet drei Unterarten von Mustern, die EMI finden und imitieren soll. Er nennt sie signatures, earmarks und unifications. Wie wir sehen werden, ist diese Unterscheidung nicht nur logisch, sondern auch notwendig. Die wichtigste Gruppe sind die sogenannten Signaturen. Sie bezeichnen zusammenhängende Muster, die in mindestens zwei, besser in mehreren bzw. allen 62 Werken eines Komponisten vorkommen und daher den Stil dieses bestimmten Komponisten erheblich mittragen. Sie erscheinen mehrfach innerhalb eines Werkes, meist aber nicht wörtlich, sondern in variierter Form. Signaturen verweisen sehr stark auf die Epoche und den allgemeinen Stil sowie auf einen einzelnen oder eine Gruppe von stilistisch eng verwandten Komponisten. EMI verwendet eine Technik der künstlichen Intelligenz, die sich patternmatching nennt. Diese soll sicherstellen, daß Signaturen gefunden werden, die einander im Wesen ähneln (exakte Wiederholungen stellen eine Ausnahme dar) und deren Unterschiede innerhalb tolerabler Grenzen liegen, sodaß sie für den Hörer tatsächlich als artverwandte Muster erscheinen. Beispiele für eine typische Signatur der Wiener Klassik finden sich in Mozarts Klaviersonaten, und zwar selbst in zeitlich weit auseinanderliegenden Werken und in Sätzen unterschiedlichsten Charakters. Die hier gezeigte Signatur (Cope bringt wesentlich mehr Beispiele als Illustration53 ) besteht aus einer aufsteigenden, chromatisch erweiterten Tonleiter, einem relativ großen Abwärtssprung und einem abschließenden Auflösungsschritt ebenfalls nach unten. Die Begleitung erfolgt in Akkordzerlegungen und stellt eine Kadenz mit Quartsextvorhalt und Dominantseptakkord dar. Die einzelnen Faktoren (die Anzahl der Töne im chromatischen Lauf, die Größe des Abwärtssprungs, Stimmführung, rhythmische Aufteilung usw.) sind von Fall zu Fall unterschiedlich, dennoch nimmt man diese Figuren als prinzipiell identische Signaturen wahr. > /> > d 2>: KV 279, 2:16 3 2 53 3 3 4 > > > > > > > > > > 3 3 4 > > 3333 3 3 3333 Cope 2001, S. 110. 63 d > > 2 > > 2 > > >> : > KV 280, 2:56-7 6 8 6 8 > * * > 2> 3> >> > /> > > > > > KV 332, 3:220-1 33 3 3 > 2 223 2 22 33 > 33 2 3 > > >> :: > > > > >> >: > >> > > > >> Es ist evident, daß solche Signaturen den Zerlegungs- und Rekombinationsprozeß überstehen müssen, um einen Wiedererkennungswert transportieren zu können, also werden sie von EMI sozusagen geschützt. Sie werden auf mehrere Arten verwendet: zum einen werden sie bei der Erfindung thematischen Materials herangezogen (wobei u. a. die bereits erwähnten Variationsmechanismen eingesetzt werden), zum anderen treten sie beispielsweise bei Kadenzen in einer sehr ähnlichen Weise auf wie im Original. Sie sind auch bei einer nachträglichen Analyse des von EMI komponierten Materials vielfach vordergründig erkennbar, ohne plagiierend zu wirken. Eine ganz andere Art von Mustern stellen die sogenannten earmarks dar. Diese haben so etwas wie eine Signalwirkung und sind typischerweise nur jeweils ein- oder zweimal innerhalb eines Werkes zu finden, und zwar meist kurz vor oder nach einem wichtigen Ereignis in der musikalischen Struktur. Obwohl sie sich in der Regel eindeutig von ihrer Umgebung abheben, sind sie eher Ideen oder Gesten als konkretes musikalisches Material, weswegen sie auch etwas schwieriger zu finden sind. Tatsächlich geht EMI so vor, daß zunächst alle Signaturen und werkimmanenten Muster gesucht und gekennzeichnet werden, wonach die wenigen Überbleibsel bei entsprechender Position als earmarks identifiziert werden können. Die folgenden beiden Beispiele aus Mozarts Klavierkonzerten zeigen, daß trotz einiger Ähnlichkeiten (ein gewisses insistierendes Moment, Synkopierung) die konkreten musikalischen Elemente relativ unterschiedlich aussehen können.54 54 zitiert nach Cope 2001, S. 117 ff. 64 >> > >> / >> >> >> >> > > > >>> > > > > > >> >> >> > KV 415, 1:295-300 2 >> > >> > >> >> >> >> > >> > 33 3 3 4 == ::: 2 == : 33 3 3 4 >> > >> > > > > > >> >> > >> > > > > > > > > > > > >> > > > > > >> >> >> 4 2 >> > >> > >> > << < >>>>> /> > >> > > > > > > > > > >> > > > > / > > > > > > > > 3 === ::: 3 3 7 2 KV 491, 1:480-6 > 2> > > > >> > > >> > > >> > > > > > > > > > 2> > > > > > > > > > > 3 > > *: > 33 > > > > > > > > > > > > > > > > > /> > > /> *: > ==== = = EMI setzt diese earmarks ein, um logische, kohärente, formal und stilistisch gültige Strukturen zu schaffen, wobei die richtige Positionierung hier von entscheidender Wichtigkeit ist. Wie man sieht, stehen hier im Gegensatz zu den Signaturen weniger lokale, melodisch oder rhythmisch interessante Aspekte des Materials im Vordergrund, sondern die formstiftende Kraft, die sich im größeren Zusammenhang des Werkes offenbart. Ein dritter Typ von Mustern sind die sog. unifications. Sie sind die werkidentitäts- und einheitstiftenden Elemente, die sich nicht in mehreren, sondern nur in jeweils einem Werk finden lassen und diesem den konkreten Wiedererkennungswert und den motivisch-thematischen Zusammenhalt geben. Drei Beispiele aus dem zweiten Satz von Mozarts Klaviersonate KV 284: 65 /// 2 /// > > > = > :> > >> > >X > / > > 2 > > = > >> >> /> 2> > /> 2> > p p p f f sf >> > / > > 2 > > = >> >> > / > > 2 > > >> > / > > 2 > > >> = >/> > 2> > ( T2-4 3 4 3 4 T32-4 > / > > 2 > > > > > > > > >> >X > > > X /> 2> > p f f >> >> >> ( T40-2 2 > > p sf /// >W > > > > > > >>>> >> > > /// / > 2 > > >/> > 2> > > > >> W >/> > 2> > > p> > > > > >> Die Relevanz von unifications besteht nicht in ihrer Beschaffenheit, wie die der Signaturen, sondern in ihrer relativen zeitlichen und tonalen Stellung zueinander. Sie sollen nicht zitiert oder wiederverwendet werden, weil sie zu stark mit einem bestimmten Originalwerk verknüpft sind. Ihre Positionen hingegen geben EMI Aufschluß darüber, wo und wie das neu komponierte motivischthematische Material stilgerecht eingesetzt werden kann. Um eine diesbezügliche Kontinuität zu erreichen, entnimmt EMI dem anfangs komponierten thematischen Material solche unifications, um sie im weiteren Verlauf des Kompositionsprozesses nach dem Schema des dem Werkverlauf zugrundeliegenden Originals einzusetzen. Auch für die Komposition kontrastierender Teile sind diese Muster wichtig, denn ihre Position im ursprünglichen Werk gibt EMI vor, wo sie im neu komponierten Stück vorkommen sollten, und die Beschaffenheit der bereits im neuen Werk vorhandenen unifications erlaubt dem Programm, einen bewußten und stilistisch passenden Kontrast zu setzen. Form und Struktur Die Entstehung musikalischer Form geht über die Analyse und Rekombination vorhandenen musikalischen Materials hinaus. Frühe Versionen von EMI waren nicht in der Lage, mit diesem Aspekt adäquat umzugehen, sodaß der Benutzer des Programms diverse formale Merkmale händisch definieren mußte. Inzwi- 66 schen hat Cope die formalen und strukturellen Analysefähigkeiten von EMI ertweitert, wodurch der stilgerechte Aufbau der Outputs kein Problem mehr darstellt. Eine wichtige Aufgabe der Formanalyse ist das Erkennen von Abschnittsgrenzen. EMI geht dabei auf mehreren Ebenen vor. Das Auffinden thematischer Abgrenzungen geschieht mit Hilfe der selben Mustererkennungsalgorithmen, wie die Analyse der oben beschriebenen Muster. Hier geht es aber nicht um Gemeinsamkeiten, sondern um Unterschiede. Wenn das Programm keine Ähnlichkeiten zwischen vorhergehenden und nachfolgenden Mustern findet, ist ein neuer Abschnitt gefunden. Sollte dieses Mustererkennungsverfahren keine befriedigenden Ergebnisse liefern, wird nach Unterschieden anderer musikalischer Merkmale gesucht. EMI analysiert hierzu Textur, rhythmische Elemente, Dynamik, Klangfarben, Registerwahl, Phrasenlängen oder die Dichte des Materials, um Kontraste und dadurch Abschnittsgrenzen zu finden. Sollte dies bei allzu homogener Musik noch immer nicht ausreichen, kann das Programm eine harmonische Analyse durchführen, um die Position von Kadenzen, die Abschnitte abschließen und neue einleiten, zu finden. Selbst das kann aber schwierig sein, weil eine solche harmonische Analyse beispielsweise bei Bachschen Fugen Kadenzen finden könnte, wo eigentlich keine sind. Cope geht davon aus, daß gute Musik gewisse Grundprinzipien von Balance und Proportionen beinhaltet. Deswegen kann EMI in schwierigen Fällen dei Phrasenlängen anderer Werke in der Datenbank auf das gerade zu analysierende Stück übertragen und damit konkrete Stellen als potentielle Abschnittsgrenzen markieren. Danach können diese Annahmen mit Hilfe der bisher beschriebenen Methoden leicht verifiziert oder falsifiziert werden. Musikalische Form besteht klarerweise nicht nur aus Abschnitten und Kadenzen, sondern hat wesentlich mehr Ebenen mit jeweils verschiedenem Inhalt. EMI kennt drei hierarchische Ebenen: Motiv, Phrase und Abschnitt. Motive sind kurze, acht bis zwölf Töne umfassende melodische Zellen, die wiederholt, variiert oder sequenziert werden können. Phrasen bestehen aus mehreren Motiven und werden durch Kadenzen abgeschlossen. Auch Phrasen können wiederholt oder variiert werden oder kontrastierende Gegenstücke haben. Abschnitte bestehen aus Phrasen und können ebenfalls Wiederholungen und Variationen erfahren, um eine übergeordnete Form zu erzeugen. Wie bereits mehrmals angedeutet nimmt EMI bei der Komposition eines neuen Stückes eines der Werke aus der Datenbank als Grundlage für die Form. 67 Zunächst wird die formale Anlage ermittelt und diese dann mit Material gefüllt. Den Inhalt liefern die durch die Mustererkennung gefundenen Bausteine, die unterschiedlich eingesetzt werden. Von EMI neu komponierte bzw. aus Originalmaterial rekombinierte Motive werden auf ähnliche Weise behandelt, wie dies im ursprünglichen Werk mit den unifications geschieht. Phrasen werden mit Signaturen vervollständigt, die z. B. bei den Kadenzen immer wieder zum Tragen kommen, und die aus diesen Phrasen gebildeten Abschnitte werden gegebenenfalls mittels earmarks verknüpft. So kann gewährleistet werden, daß auch die formalen Aspekte dem Stil des Originals entsprechen. SPEAC-Analyse Die vielfältigen Fähigkeiten von EMI sorgen dafür, daß beim Kompositionsprozeß oft mehrere Entscheidungsmöglichkeiten zur Auswahl stehen. Diese Alternativen können nach den bisher beschriebenen Gesichtspunkten durchaus gleichwertig sein, trotzdem wäre es nicht unbedingt optimal, die Entscheidung einem Zufallsgenerator zu überlassen. Für solche Fälle hat Cope eine hierarchische Analysemethode entwickelt, die sich mit Tongruppen beschäftigt, aber nicht nur ihre bloße Struktur enthüllt, wie beispielsweise die pitch-classAnalyse, sondern auch signifikante Beziehungen und Verhältnisse zwischen ihnen und gleichzeitig auch ihre musikalische Funktion zutage fördert. Die sogenannte SPEAC-Analyse vereint Ideen und Methoden diverser Analysemethoden und entwickelt sie weiter, um den Anforderungen Copes gerecht zu werden. Das Akronym steht für die Begriffe statement, preparation, extension, antecedent und consequent. Diese Attribute werden den Tönen und Akkorden in Abhängigkeit von ihrer Position und dem jeweiligen Kontext zugeordnet, um gleichsam ihre musikalische Bedeutung herauszufinden. Das geschieht bei Bedarf auf mehreren Ebenen. Die einfache Präsentation musikalischen Materials ist ein statement (S). Ein Akkord oder eine melodische Einheit, die diese Rolle innehat, muß in keiner Beziehung zum umgebenden Material stehen und ist daher stabil. Solche Momente kommen in erster Linie am Anfang von Phrasen oder Abschnitten vor, selten mittendrin oder gar am Ende. Zwei weitere Attribute haben eine starke strukturelle Bindung zueinander. Die Funktionen antecedent (A, zu Deutsch Vorgeschichte oder auch Bezugselement, im Kontext der musikalischen Formenlehre Vordersatz ) und consequent (C, Folge bzw. Konsequenz, Nachsatz ) bedingen einander, indem einem A ein C folgen bzw. einem C ein A vorangehen muß. Was das Material angeht, ist ein 68 C oftmals leicht zu verwechseln mit einem S, ist aber durch die vorangegangene Bedingung wesentlich zwingender und stabiler. Die obigen drei Hauptfunktionen können durch die beiden restlichen erweitert werden. Das kann durch eine vorhergehende preparation (P) oder eine nachfolgende extension (E) erfolgen. Diese beiden Elemente können die Aussage, die durch die bedeutungstragenden Funktionen entsteht, leicht modizifieren bzw. einfärben. Bevor wir diese Funktionen an einem musikalischen Beispiel vergegenwärtigen, können wir ein äquivalentes sprachliches Beispiel untersuchen. Der Satz Ich gehe heute ins Kino“ enthält alle fünf Elemente. Ich“ ist eine an sich ” ” konsequenzlose und ohne Kontext nichtssagende Feststellung. Das Verb gehe“ ” enthält nicht nur eine Information, sondern wirft auch Fragen auf und bedingt eine Antwort auf diese Fragen. Diese Antwort wird mit dem Objekt geliefert, wobei Kino“ das informationstragende Element und ins“ die (hier gramma” ” tikalisch notwendige) Erweiterung ist. Heute“ erweitert die Aussage, die das ” Verb transportiert. Alles in allem könnte man den Satz also mit den oben beschriebenen Funktionen als SAEPC darstellen. Man kann diesen Satz nun auf verschiedenen Ebenen analysieren. Läßt man die erweiternden Funktionen weg bzw. faßt man sie mit den zugehörigen Hauptfunktionen zusammen, ergibt sich das sprachlich nicht mehr ganz korrekte, aber immerhin eindeutige Information transportierende satzähnliche Gebilde Ich gehe Kino“. Die Struktur besteht nunmehr aus SAC, die bedeutungsmodi” fizierenden (und in gewisser Weise auch identitätsstiftenden) Elemente fehlen. Würde man den Satz weiter reduzieren wollen, würde sich das C-Element anbieten, da es durch den schlußfolgernden Charakter die vorausgehende Bedingung impliziert. Somit wäre das Wort Kino“ allein je nach Gesprächssituation fast ” ausreichend, um den selben Sachverhalt zu verdeutlichen. Interessanterweise verändert sich aber auf dieser Ebene die Funktion des Elements, da es sozusagen den ganzen Satz repräsentiert und deshalb ein statement darstellt. Die Funktionen der Elemente sind also nicht fix, sondern je nach Kontext und Ebene veränderlich. Auf der höchsten hierarchischen Ebene steht immer ein S (die verschiedenen Ebenen und die Reduktion auf ein allen Strukturen zugrundeliegendes gemeinsames Element ist eine offensichtliche und vielsagende Parallele zur Schenkerschen Reduktionsanalyse, die mit ihren Methoden auch zu einem im wesentlichen immer gleichen Ursatz führt). Die Aufeinanderfolge der SPEAC-Elemente ist zwar einigermaßen frei, manche Verbindungen sind aber ausgeschlossen. So können beispielsweise C oder 69 E nicht am Anfang eines Werkes stehen, da beide per Definition vorangehende Elemente brauchen. Ebenso eignen sich P oder A nicht als Abschluß, da ihnen jeweils andere Elemente folgen müssen. Außerdem sind einige Verbindungen wesentlich wahrscheinlicher als andere, die zwar theoretisch möglich, aber eben ungewöhnlich sind. Anhand eines musikalischen Beispiels (Mozarts Klaviersonate KV 284, die Takte 13-17 des letzten Satzes) kann man die verschiedenen hierarchischen Ebenen und die Kombinationsmöglichkeiten der SPEAC-Elemente sehr gut nachvollziehen. Der Tonika-Akkord (S) wird sowohl durch den Auftakt vorbereitet (P) als auch verlängert. Danach erfolgen zwei durch die zweite Stufe vorbereitete A-C-Verbindungen (Dominantseptakkord-Tonika). Harmonisch sieht man keinen großen Unterschied (abgesehen vom dazwischengeschobenen Quartsextakkord), aber der Oktavsprung und die dynamische Differenz zwischen dem dritten und dem vierten Takt zeigen, daß es sich bei dieser Kadenz nicht um den endgültigen Schluß dieser Phrase, sondern um eine Vorbereitung desselben handelt, was man auf einer höheren Ebene entsprechend kennzeichnen kann. P // // 2 o S MMM MMM ooo o o MMM o o o MMM oo o o MMM oo o o MMM oo o MMM o o MMM oo o o ² M& wooo S A C? C B CC y ~ BB ?? ÄÄ CC yy ~~ BB ?? Ä y ~ Ä C y ~ B ?? Ä CC y ~ BB Ä~~ ² !  |yy ² ² ÄÄÄ ! S > > = f " E P A > > >>>> > >>>> p C P A C > > >>> >>> > > > > > > f > > > > > > > > > > > > > > > >> > f > > > > > > == = Die SPEAC-Analyse bietet EMI eine zusätzliche Hilfestellung bei der Auswahl ansonsten gleichwertiger Alternativen. Folgt das Programm der Richtung, die eine Originalkomposition vorgibt, ist die Qualität des Outputs wesentlich höher, als bei zufälliger Rekombination vorhandenen Materials. Das Zuordnen 70 der SPEAC-Funktionen erfolgt durch eine Mischung aus harmonischer Analyse und einer eigens für EMI entwickelten Methode, die die Spannungsniveaus einzelner Akkorde analysiert. Je nach intervallischer Zusammensetzung und tonaler Funktion bekommen die so untersuchten Akkorde Zahlenwerte zugeordnet, die diese Niveaus angeben, wobei eine höhere Zahl höhere Spannung bedeutet. So können Spannungs- und Entspannungsmomente formal ausgedrückt werden. Besonders hohe Niveaus zeigen die antecedents an, denen die starke Entspannung der consequents folgt. Neutralere Werte deuten auf die Erweiterungsfunktionen hin. 4.3.2 Kompositionsprozeß Dem theoretischen Einblick in EMIs Funktionsweise soll nun ein praktisches Beispiel folgen, anhand dessen weitere technische Einzelheiten sowie konkrete Entscheidungen des Programms sichtbar gemacht werden. Das Werk, dessen Entstehung skizziert wird, ist ein Stilimitiat Mozartscher Klaviermusik 55 , modelliert jeweils am zweiten Satz der Klaviersonaten KV 284, 310, 330, 333 und 545. Bevor ein neues Stück komponiert werden kann, muß eine Datenbank aufgesetzt werden. Diese enthält einige Werke als lange Zahlenkolumnen, die in den bereits erwähnten Listen zusammengefaßt sind. Cope benutzt eine adaptierte Version des weltweit verbreiteten Datenstandards MIDI, womit es möglich ist, Werke nicht zur Gänze händisch in die Datenbank einzugeben, sondern beispielsweise Dateien aus dem Internet herunterzuladen und zu importieren. In der Datenbank werden keine tatsächlichen akustischen Ereignisse kodiert, wie z. B. auf einer CD, sondern ausschließlich die Anweisungen, die für den Computer wichtig sind, um Musik zu produzieren (vergleichbar mit einem Notenblatt, das auch nicht die Klangereignisse, sondern nur die Anweisungen zur Erzeugung derselben enthält). Um Musik in Zahlen zu kodieren, muß man alle wichtigen Aspekte der Klangerzeugung bestimmten Regeln folgend in Zahlenwerte umsetzen. Das Programm beschränkt sich dabei auf Tonhöhe, Zeitwerte (Anfangszeit und Tonlänge) sowie Lautstärke, wohingegen in MIDI theoretisch weitere Attribute zur Verfügung stehen. Außerdem muß jedes solchermaßen kodierte Ereignis die Zugehörigkeit zu einer Stimme (in der Computermusik spricht man hierbei von Kanälen) fixieren, um bei der Analyse logische und konsistente Mustererkennung zu er55 Cope 2001, S. 379 ff. 71 möglichen. Ein Tonereignis in der EMI-Datenbank sieht folgendermaßen aus: (0 60 1000 1 64) Die erste Ziffer (0) bezeichnet die Anfangszeit, der Ton beginnt also offensichtlich sofort am Anfang des Stückes. Die zweite Zahl (60) ist die MIDI-Tonhöhe c1 (MIDI ordnet jeder Tonhöhe eine Zahl zwischen 0 und 127 zu, wobei die Erhöhung um eins einen Halbtonschritt nach oben bedeutet). Der dritte Wert ist wieder ein Zeitwert, wobei 1000 der Länge einer Viertelnote entspricht, und zwar unabhängig vom jeweiligen, extra angegebenen Tempo. Die restlichen beiden Zahlen geben an, daß der Ton zu Kanal 1 gehört und mit einer mittleren Lautstärke (auch diese in Werten von 0-127 kodiert) erklingen soll. Die Werke, die für die Datenbank ausgewählt werden, müssen einige Kriterien erfüllen. Zunächst müssen sie für eine gelungene Stilreplikation natürlich stilistische Homogenität zeigen, also am besten von einem Komponisten oder zumindest aus einer Epoche stammen. Außerdem gilt es zu beachten, daß EMI den musikalischen Stil anhand der oben beschriebenen, in den Tonereignissen kodierten Parameter analysiert, wohingegen Aspekte wie Instrumentierung, eventuelle Texte, Artikulation, instrumententechnische Vorgaben u. a. irrelevant sind. Die ausgewählten Stücke müssen weitere Gemeinsamkeiten haben, um die Qualität des Outputs zu steigern. Die dem hier untersuchten Kompositionsprozeß zugrundeliegende Datenbank enhält fünf langsame Sätze aus Klaviersonaten von Mozart, die zudem alle im 3/4-Takt stehen. Würde man signifikant unterschiedliche Werke oder Taktarten hinzunehmen, könnte das Ergebnis viel zu uneinheitlich ausfallen. Die ausgewählten Sätze sind alle in Dur, wobei die tatsächliche Tonart unerheblich ist, weil EMI die Datenbank bei Bedarf in eine einheitliche Tonart transponiert. Auf Basis der vorliegenden Stücke wird das Programm also einen langsamen Klaviersonatensatz im Stile Mozarts im 3/4-Takt und in einer Durtonart komponieren. Weitere Auswahlkriterien für hinreichend ähnliche Werke sind z. B. Charakter, Begleitmuster oder Verzierungen. Letztere stellen einen Sonderfall für EMI dar. Bestimmte Verzierungen sind zwar zweifellos Träger musikalischen Stils, können aber duch die vielen zusätzlichen kurzen Notenwerte die Mustererkennung erheblich durcheinanderbringen. Es ist daher oft angeraten, die Verzierungen in der Datenbank wegzulassen und im Anschluß an den fertigen Kompositionsprozeß an den geeigneten Stellen hinzuzufügen. Wichtige Ornamentations- und Artikulationselemente können zwar 72 verwendet werden, müssen aber dann entsprechend in passende zahlenmäßig ausgedrückte Ereignisse übersetzt werden. Generell gilt, daß man bei der Übertragung der urprünglichen Daten Anweisungen des Notenmaterials in die Ereignisse der Datenbank einige Dinge beachten muß. So müssen unter anderem rhythmische Inhomogenitäten, beispielsweise schnelle, in Achteln notierte und langsame, in Sechszehnteln notierte äquivalente Figuren, z. B. Alberti-Bässe, ausgeglichen werden, indem man sich für eine der beiden Notationsmöglichkeiten entscheidet und die andere entsprechend ändert. Auftakte, also Takte mit einem signifikanten Pausenanteil, werden von EMI gesondert gehandhabt, und müssen dementsprechend ausgewiesen werden. Wichtig ist auch die Zuordnung der einzelnen Stimmen zu verschiedenen Kanälen. Wie solcherart aufbereitetes Material aussieht, zeigt das folgende Notenbeispiel: zunächst der Anfang des zweiten Satzes von KV 310, danach die von Cope für EMI aufbereitete Version des selben Materials.56 Wir sehen, daß der Auftakt als ganzer Takt notiert ist, daß jede Stimme einen eigenen Kanal erhält und daß die von Mozart vorgeschriebene Verzierung nach der üblichen Aufführungspraxis der Zeit als kurzer Vorschlag realisiert wird. 3 2 56 3 3 4 > : > > > > > >> >> >> > >> >> > fp 3 4 ( > > p > > > > Cope 2001, S. 150. 73 3 " 3 4 ! ( * > > > > > 3 3 4 ! > > > 3 3 4 ! > > > 3 3 4 > >>> > > > > > > > > > > Das Zusammenstellen und Aufbereiten der Datenbank ist ein mühsamer und zeitintensiver Vorgang, wonach allerdings EMI auf Knopfdruck ein Werk nach dem anderen produzieren kann. Je mehr Stücke die Datenbank enthält, desto abwechslungsreicher wird der Output. Es besteht außerdem die Möglichkeit, einige Werke aus der Datenbank auszublenden, um dadurch bewußt bestimmte Aspekte der restlichen Werke zu forcieren. Die vom Programm komponierten Werke sind zwar qualitativ untereinander vergleichbar, in Einzelheiten können sie jedoch stark voneinander abweichen. Manche Stücke enthalten zu lange, eindeutig wiedererkennbare Passagen aus einem der Originale, andere sind formal inhomogen oder einfach nur banal. Letztendlich liegt die Entscheidung, ob ein Werk von EMI für eine Analyse oder gar eine Aufführung wertvoll genug ist, beim Benutzer des Programms. Ist die Datenbank fertiggestellt, beginnt EMI mit der Analyse des vorhandenen Materials. Die Musik wird hierfür in kleine, zweckmäßige Fragmente zerlegt (deren Länge auch durch den Benutzer steuerbar ist) und auf Stimmführung untersucht, wobei im Gegensatz zu den oben erwähnten Bach-Chorälen bei nicht durchgehend homophoner Musik die jeweilige melodieführende Stimme (in der Regel die oberste) dafür ausreicht. Bei den restlichen Stimmen ist die Beibehaltung des Charakters wichtiger, als die ursprünglichen Zieltöne. Zusätzlich werden Signaturen, earmarks, unifications, SPEAC-Funktionen und weitere Informationen gesammelt und in separaten Bibliotheken gespeichert, auf die 74 jeweils an verschiedenen Punkten des Kompositionsprozesses zurückgegriffen wird. Das konkret untersuchte Werk von EMI verwendet Material aus fünf Sonatensätzen und orientiert sich formal am zweiten Satz von KV 284 (das ist eine vom Programm getroffene zufällige Entscheidung). Die Formanalyse findet in ebendiesem Satz die Grenzen der einzelnen Abschnitte, und die Mustererkennung stellt fest, daß an diesen Punkten einheitliches Material verwendet wird. Ein Vergleich mit den anderen Werken der Datenbank identifiziert diese Muster als Signaturen, die nahezu unverändert in das neu zu komponierende Stück übernommen (und natürlich in die entsprechende Tonart transponiert) werden, wobei ihre tonalen Verhältnisse fix, ihre genauen Positionen jedoch einigermaßen flexibel sind. /// T16 > > >= > 2 /// > > > T30 > > > > > > > T46 >> > > > > > T69 / >> 2> = > > > T92 >> > >=> >> Wenn die Form in groben Umrissen feststeht, sucht EMI nach dem geeigneten Inhalt.57 Der erste Takt wird aus einer Bibliothek gewählt, die die jeweils ersten Takte der Originale sowie andere passende Takte, aber klarerweise weder Kadenzen noch Signaturen enthält. Das Programm entscheidet sich für Takt 9 von KV 330, verändert aber das Material geringfügig, um erstens nicht wörtlich zu zitieren und zweitens die Tonart F-Dur einzuführen. Für die Wahl des zweiten Taktes wird der Zielton der Melodie festgestellt und der Charakter der Begleitung beibehalten. EMI durchforstet die Bibliotheken auf der Suche nach einer von der originalen Weiterführung abweichenden Alternative, auf die nur dann zurückgegriffen werden darf, wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt. In diesem konkreten Fall entscheidet sich das Programm für eine wiederum leicht veränderte Variante des ersten Taktes. Damit wird zusätzlich eine motivische Vereinheitlichung der ersten beiden Takte erreicht. Der gewünschte Anschlußton und der Charakter der nächsten beiden Takte führen zur Auswahl von Takt 7 von KV 284, der unverändert übernommen wird. Mangels einer befriedigenden Alternative setzt EMI diesen Takt genauso fort, 57 Die nun folgenden Ausführungen orientieren sich an Cope 2001, S. 156 ff. 75 wie dies im Original zu sehen war. Während dies in den wesentlich exponierteren ersten beiden Takten vermieden wurde, ist der Wiedererkennungswert einer solchen Verbindung innerhalb einer Phrase wesentlich geringer und die Wahl daher akzeptabel. Der nächste Takt bringt einen leichten Charakterwechsel mit Sechszehntelbewegung und chromatischen Nebennoten (Takt 71 von KV 284) und wird nach dem Muster der Takte 5 und 6 des formgebenden Satzes sequenziert. Auch hier werden zwei im Original aufeinanderfolgende Takte (59 und 60 von KV 284) angehängt, die ohne Kadenz in die Wiederholung der ersten sechs Takte zurückführen. Takt 15 und 16 sind zwei verschiedene Signaturen, die den ersten thematischen Abschnitt abschließen. Obwohl insgesamt 10 Takte, also über 60% des Materials nahezu unverändert aus KV 284 stammen, kann man sehen, daß die Rekombinationsmethode durchaus annehmbare und stilistisch passende Ergebnisse, aber keine Plagiate produziert.58 3 2 3 3 4 3 4 > > >: > >: > * > > >: > >: > * >: >> >> > * ( * > > * ( > >> >> >> >> >> >> > > 3 2 >>> 3 > >> >> >> > > 2 > > > > > 3 > > / > > > > > > > > > > > / > > > > > >> > / > > > > > > 2 > > > > >> > / > > > > > > 2 > > > > > /> > 3 4 2 58 Cope 2001, S. 161. 76 > > > > > 2> 3> > > * > >>:>> : > * > >> :>> : 3 > > >> > > * ( ( >> >> ( >> > * ( 3 > > > 7 2 3 >: 11 2 > >> >> >> 2>>> 3 > >> >> >> > >> >> >> 3 * > >> > > > > > > > > > 3> >/> > > 2> >> > / > > > > > > 2 > > > > > > > > > > > > > > / > > >> > > > : > > > > > > > > > : > > >> > > > > > > > > /> > 2 > > / > > > * >= > >> > > > 3 * > > 3 14 2 Im weiteren Verlauf der Komposition kommen immer wieder die selben Mechanismen zum Tragen, wobei das Nachvollziehen der Entscheidungen von EMI nicht immer ganz einfach ist. In der ausführlichen Analyse von Cope59 werden auch weitere Feinheiten wie die Verwendung von earmarks, Rekombination von einzelnen Viertelschlägen im Gegensatz zu den bisherigen ganzen Takten, Variation sowie die Verschmelzung bestimmter Elemente aus verschiedenen Quellen (beispielsweise die Melodie der ersten vier Takte kombiniert mit einer Begleitung aus KV 545) aufgezeigt. Cope selbst hat dabei natürlich den entscheidenden Vorteil, nicht nur die genaue Funktionsweise des Programms zu kennen, sondern auch während des Kompositionsprozesses diverse Zwischenergebnisse einsehen zu können. 59 Cope 2001, S. 153 ff. 77 4.3.3 EMIs Fähigkeiten und Mängel Der Einblick in die Funktionsweise des Programms erlaubt auch einige Aussagen darüber, was EMI gut kann und was weniger. Cope bietet in seinen Büchern weitere Details zu dieser Frage, obwohl er natürlich nicht unvoreingenommen an das Thema herangeht. Man würde erwarten, daß ein Programm, das unter anderem Stimmführungsund harmonische Analyse für die Imitation des Stils verwendet, u. a. bei atonaler Musik versagen oder zumindest eine tiefgreifende Umprogrammierung benötigen würde. Cope meint, dies sei nicht der Fall,60 da EMI die Stimmführungsregeln und die Art der Harmonik aus den Originalwerken ableitet. Gerade bei motivisch einheitlicher oder sehr stark mit Spannungsverhältnissen gesättigter Musik (Schönberg, Webern) kann man sich gut vorstellen, daß die Mustererkennung und die SPEAC-Analyse brauchbare Ergebnisse liefern. Es hängt natürlich vom Musikstil und der Gattung ab, wie konsequent EMI den Stil destillieren und in die algorithmischen Neuschöpfungen einfließen lassen kann. Aus einheitlichen, regelmäßigen Einheiten aufgebaute Musik wie die Bach-Choräle oder Ragtimes von Scott Joplin kommen der Rekombinationsmethode offensichtlich entgegen, mit unregelmäßigeren oder stark subjektiven Strukturen beispielsweise der Vorklassik kommt das Programm viel weniger gut zurecht.61 Streng kontrapunktische Formen wie Fugen oder Kanons bereiten EMI besondere Schwierigkeiten, da hier die formalen und die motivisch-thematischen Aspekte in einer Weise miteinander verschmelzen, die den Analyse- und Kompositionsansatz des Programms nicht entspricht. Schon die Wahl eines geeigneten Fugenthemas ist eine Aufgabe, die nur bedingt formal beschrieben und programmiert werden kann.62 Für diesen Zweck hat Cope Subprogramme vorgesehen, die entsprechende Regeln enthalten und diese dann mit den rekombinierten Mustern zusammensetzen. Leider geht dabei EMIs Stärke, Stimmführungsregeln aus Originalwerken zu extrahieren, verloren, und die solchermaßen erzeugten Stücke werden kaum besser, als mustergültige Schulfugen mit etwas motivischer Anlehnung an das Vorbild. Obwohl bereits erwähnt wurde, daß die Datenbanken verhältnismäßig gleichförmige Stücke enthalten müssen, um stilistische Einheit zu gewährleisten, hat Cope mit EMI auch mehrsätzige Werke, Zyklen oder sogar ganze Opern kom60 61 62 Cope 2001, S. 553. Cope 1991, S. 193 ff. Cope 1991, S. 188 78 poniert. Dies erfordert natürlich die nachträgliche Zusammensetzung mehrerer Einzelstücke, die aus verschiedenen Datenbanken kreiert worden sind. So wie die endgültige Auswahl der veröffentlichten Werke beim Menschen liegt, ist die Komposition eines Ganzen aus Fertigteilen eine Verantwortung, die das Programm nicht übernehmen kann. Da EMI Stücke nicht in bestimmten Tonarten komponiert, sondern die erzeugte Musik immer sozusagen eine mögliche Realisation in der jeweiligen Tonart darstellt, ist es ein leichtes, Zyklen wie die diatonisch geordneten Inventionen nach Bachschem Vorbild oder durch verwandte Tonarten verbundene Sonaten oder Opern zusammenzustellen. Gleichzeitig fallen aber Aspekte wie Tonartencharakteristik, die gerade bei Bachs Zyklen essentiell sind, unter den Tisch. Textunterlegte Musik stellt für EMI einen Spezialfall dar. Da Texte für den Rekombinations- und Kompositionsprozeß keine Rolle spielen, können die Phrasenlängen z. B. bei einem Choral nicht einem zugrundeliegenden Texte angepaßt werden (wobei EMI bei der Choralkomposition auch keine Cantus firmi verwendet). Demensprechend können auch keine Aussprache- oder Betonungseigenheiten berücksichtigt werden; Textausdeutung ist jenseits aller Möglichkeiten. Eventuelle Texte (z. B. für Lieder oder Opern) müssen nach Fertigstellung der Komposition nachträglich angepaßt werden, was die Ergebnisse qualitativ schwächt. Es wäre zwar vorstellbar, auch für diese Problematik entsprechende Subprogramme zu entwerfen, die auf rhythmische und eventuell (mit genügend Metainformation versehen) auch inhaltliche Aspekte des Textes Rücksicht nehmen, aber das würde wohl empfindlich in den Rekombinationsprozeß eingreifen und die Qualität im Endeffekt nicht unbedingt steigern. EMIs Schwierigkeiten mit Verzierungen wurden ebenfalls schon skizziert. Generell gilt, daß EMI keine Rücksicht auf Aufführungspraxis oder Spielbarkeit nimmt, weil das kein Teil des Konzepts ist und die Rekombinationsmöglichkeiten manchmal erheblich einschränken würde. Verziehungen und weitere aufführungspraktische Hinweise muß man händisch hinzufügen, und der technische Schwierigkeitsgrad bewegt sich meist einem ähnlichen Bereich wie beim Original, da viele Attribute des musikalischen Materials beim Kompositionsverfahren übernommen werden. Obwohl EMI ursprünglich als Kompositionshilfe ersonnen wurde, besteht gerade diese Möglichkeit nur sehr bedingt, da das Programm sowohl ganze Stücke in der Datenbank braucht als auch ganz Stücke ausgibt. Aus dieser Tatsache resultiert eine Notwendigkeit für ein neues Programm, das ähnlich funktioniert, 79 aber an jedem Punkt des Arbeitsprozesses konsultiert werden kann und Hilfestellungen in der jeweils gewünschten Form und im präferierten Umfang bietet.63 Copes neues, diesem Bedürfnis entgegenkommendes Projekt heißt Alice (ALgorithmically Integrated Composing Environment) und ist neben neuen, den hier skizzierten Grundlagen EMIs ähnlichen, aber detaillierter und vor allem flexibler arbeitenden Algorithmen mit einer gewissen Lernfähigkeit ausgestattet. Dies wird über ein sogenanntes Assoziationsnetz64 (association net), das die Verknüpfungen der Elemente innerhalb des vorhandenen Materials (z. B. ein bestimmtes charakteristisches Intervall am Beginn jeder Phrase) gleichsam bewertet und aufgrund der Bewertung ähnliche Verknüpfungen (Assoziationen) generieren kann, erreicht; wobei die Lernfähigkeit erstens aus der Summe all dieser Bewertungen und zweitens aus der Möglichkeit, durch entsprechendes negatives Feedback die gespeicherten Assoziationen aufzulösen und neu zu bewerten, entsteht. Dies führt mittelfristig dazu, daß nicht gewünschter Output minimiert und die Qualität ohne weitere Korrekturen am Algorithmus optimiert werden kann. 4.3.4 Rezeption Neben Copes theoretischer Reflexion über EMI in diversen Büchern und Zeitschriftenartikeln65 hat er auch verschiedene Tonträger mit Musik von EMI veröffentlicht 66 und weitere Einzelstücke auf seiner Homepage zum Download67 freigegeben. Auch Radiosendungen, Vorlesungen und Vorträge an amerikanischen Universitäten haben dazu beigetragen, Copes Arbeit bekannt zu machen. Der Kognitionswissenschaftler, Physiker und Philosoph D. R. Hofstadter 68 brachte 1979 in seinem mehrfach preisgekrönten und visionären Buch Gödel, Escher, Bach 69 seine Überzeugung zum Ausdruck, Computerprogramme könnten erst dann schöne“ Musik schreiben, wenn sie die emotionale und kognitive ” Tiefe und Komplexität des menschlichen Geistes erreichen würden.70 Seine Begegnung mit EMI 1995 ließ ihn diese Aussage nicht nur überdenken, sondern auch eine befruchtende Diskussion und Zusammenarbeit mit Cope entstehen. 63 64 65 66 67 68 69 70 Cope 2000, S. 35 f. Cope 2000, S. 51 ff. siehe http://arts.ucsc.edu/faculty/cope/bibliography.htm siehe http://arts.ucsc.edu/faculty/cope/bibliography page 2.htm http://arts.ucsc.edu/faculty/cope/mp3page.htm Douglas R. Hofstadter, * 15. Februar 1945; Professor an der Indiana University, Bloomington. http://www.cogs.indiana.edu/people/homepages/hofstadter.html Hofstadter 1992. Hofstadter 1992, S. 721. 80 Die beiden Professoren stehen gleichsam für die beiden Extreme der Bandbreite aller möglichen Reaktionen auf den Output von EMI. Während es für Cope kein Problem darstellt, von seinem Programm komponierte Stücke (bzw. zumindest den Teil, der seinen strengen Auflagen genügt und daher den von ihm persönlich durchgeführten Auswahlprozeß übersteht) als vollwertige und funktionierende, wenn auch nicht einmalige und geniale, Musik zu sehen, äußert Hofstadter pessimistische Bedenken, weil für ihn der Erfolg EMIs quasi gleichbedeutend mit der Schlußfolgerung ist, daß Musik (und in Folge auch der menschliche Geist) wesentlich seichter ist, als er dies gern annehmen würde.71 Ein wichtiger Unterschied in der Sichtweise der beiden ist die Antwort auf die Frage, bei welcher Instanz im musikalischen Kommunikationsvorgang Schönheit und Wert der Musik entstehen: Hofstadter beharrt darauf, daß dies beim Sender (dem Komponisten bzw. Ausführenden) geschieht, während Cope den Empfänger hervorhebt. Diese Frage wird (allgemein, also nicht nur auf EMI bezogen) in Kapitel 5 noch durchleuchtet. EMI wird von Menschen verschiedener Einstellung gegenüber künstlicher Intelligenz und Kreativität auch ganz unterschiedlich rezipiert. Für manche ist das Programm ein interessantes Werkzeug, für andere der Tod der Musik oder zumindest eien Art Betrug. Dies alles deutet aber darauf hin, daß EMI nicht nur mit der bloßen Möglichkeit, auf diesem Weg Musik zu komponieren, auffällt, sondern auch tatsächlich eine gewisse Qualität produziert. In Kapitel 1.2.2 wurde die Möglichkeit diskutiert, den Output eines Computerprogramms ohne Hinweis auf den Komponisten zu bewerten, da ansonsten Vorurteile zu Tragen kommen und das Ergebnis des Vorgangs negativ beeinflussen können. Dies läßt sich unter anderem mit einer an Blindverkostungen erinnernden Vorgehensweise bewerkstelligen, indem man einem Publikum mehrere Werke verschiedener Komponisten, unter denen sich eben auch EMI-Output befindet, vorsetzt und es bittet, die Werke den Komponisten zuzuordnen. Bei diversen Anlässen haben Cope und Hofstadter diesen Test durchgeführt, beispielsweise mit Werken von EMI, einem Originalkomponisten (Bach, Chopin) und einem Kompositionslehrer einer amerikanischen Universität. Genaue Statistiken über die Ergebnisse aller solchen Tests gibt es nicht, aber es sind einige Fälle überliefert, in denen ein Großteil des Publikums den Output des Programms als Original identifiziert hat.72 71 72 Hofstadter 2001, S. 80. siehe Hofstadter 2000, S. 66f oder Hubner, http://www.sonic.net/˜ric/music/notes/wtc.htm 81 5 Konklusion und Ausblick Die vorangegangenen Kapitel haben gezeigt, daß algorithmische Komposition durchaus funktionieren, sprich innerhalb eines gegebenen musikalischen Kontextes gültige oder zumindest annehmbare Ergebnisse liefern kann. Daraus ergeben sich natürlich einige Fragen und Konsequenzen, die hier kurz angerissen werden sollen. Algorithmisch komponierte Musik hat je nach Betrachtungsweise unzählige Aspekte, von denen hier allerdings nur die im Blickwinkel der vorliegenden Arbeit relevantesten herausgegriffen werden sollen. Dabei wird aufgezeigt, was eine Analyse solcher Kompositionsmethoden- und ergebnisse zutage fördern kann, welche musikpädagogische Bedeutung die Thematik hat und auf welche Weise man den Kunstcharakter algorithmisch komponierter Musik diskutieren kann. Im Anschluß erfolgt ein kurzer Ausblick, der sich mit den theoretisch vorstellbaren Möglichkeiten und Chancen algorithmischer Komposition beschäftigt. Analyse Die bloße Analyse des Outputs einer algorithmischen Kompositionstechnik kann kein umfassendes Bild liefern. Auch bei Werken menschlicher Komponisten werden bei der Musikanalyse in der Regel äußere, nicht werkimmanente Faktoren berücksichtigt. Zudem würde eine solche Analyse die Tatsache ignorieren, daß das untersuchte Werk das Ergebnis einer algorithmischen Kompositionsmethode ist, und wäre daher im Kontext dieser Arbeit uninteressant und wertlos. Vom analytischen Standpunkt aus gesehen ist also der Vorgang mindestens ebenso wichtig wie das Ergebnis selbst. Eine hinreichend umfassende Analyse einer algorithmischen Kompositionmethode und einiger durch diese komponierten Stücke erlaubt Einblicke in das Musikdenken und die Ästhetik der Zeit (z. B. die Relevanz der Stimmführung bei Bontempi oder die Bedeutung der Taktgliederung bei Kirnberger), die ohne Einsicht in den Kompositionsprozeß nicht im selben Ausmaß vorhanden wären. Bei einem hochkomplexen Algorithmus wie EMI sind darüber hinaus allgemeine Aussagen über Kompositionsprozesse denkbar, die in gewissem Rahmen 82 auch auf den kreativen Akt menschlicher Komponisten übertragbar sind. Auch ein Mensch braucht in der Regel das Studium vorhandener Musik, um daraus Regeln zu abstrahieren, die Gültigkeit selbiger zu verifizieren und sich gleichsam Vokabeln anzueignen, die er in seinem eigenen Schaffensprozeß bewußt einsetzen kann. EMI beschränkt sich im wesentlichen darauf, aber das trifft auf die Mehrzahl aller komponierenden Menschen ebenfalls zu. Musikpädagogische Bedeutung Die musikpädagogischen Implikationen der in dieser Arbeit beschriebenen Zugänge und Methoden liegen auf der Hand. Die Integration entsprechender Elemente in den Musikunterricht kann die Unterrichtsgestaltung beleben, Interaktion und persönliche Erfahrung fördern, sowohl die ästhetische als auch die handwerkliche Komponente des Musikschaffens hervorheben, Musikgeschichte und Musiktheorie begreifbar machen, Kreativität wecken, vorführbare Erträge schaffen und wesentlich zur Festigung der Unterrichtsinhalte beitragen. Es wäre zu wünschen, daß solche Impulse in die Praxis der Musikerziehung einfließen. Die Verfügbarkeit einer Vielzahl solcher Ideen ist, wie auch aus der vorliegenden Arbeit und der angeführten Literatur ersichtlich, gegeben. Einige der beschriebenen Methoden bedürfen nur einer minimalen Aufbereitung für den Musikunterricht, technisch umsetzbar sind sie alle. Die Vielfalt der einzusetzenden Medien (vom Würfelspiel bis hin zum Computer) und der Möglichkeiten des Umgangs mit dem Ergebnis (z. B. Analyse, computerunterstützte Wiedergabe oder öffentliche Aufführung) eröffnet neue Dimensionen und Anknüpfungspunkte für einen lebendigen, praxisorientierten und vorzeigbaren Unterricht. Darüber hinaus können die hier angeführten Zugänge auch eine Beschäftigung mit der Materie auf höherem Niveau, beispielsweise auf der universitären Ebene, bereichern. Studierende musikalischer Studienrichtungen könnten zumindest in den Fächern Tonsatz und Musikanalyse hiervon profitieren, die Thematik bietet aber auch für Bereiche wie Musiksoziologie oder Urheberrecht Relevanz und Diskussionsstoff. Kunstwert und historischer Wert Eine der wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit dem Thema der vorliegenden Arbeit scheint jene zu sein, ob algorithmisch komponierte Musik Kunst sei oder nicht. Zwischen uneingeschränkter Bejahung und Verneinung dieser Frage 83 gibt es eine ziemlich große Bandbreite an möglichen Antworten. Die pragmatische Antwort lautet freilich: Kunst ist, was als Kunst rezipiert wird. Das beinhaltet natürlich auch die subjektive Komponente, die darin besteht, daß das Prädikat Kunst“ nicht absolut und untrennbar am Kunstwerk haftet, son” dern von jedem Rezipienten selbst damit in Verbindung gebracht wird – oder eben auch nicht. Und während sich die meisten (durch die mitteleuropäische Kultur geprägten) Menschen einig sind, daß die Musik Beethovens Kunst ist (auch wenn sie tatsächlich von vergleichsweise wenigen aktiv rezipiert wird!), besteht diese Einigkeit schon bei Werken der Moderne nicht in diesem Maß. Algorithmisch komponierte Musik, die durchaus als Kunst rezipiert wird (siehe EMI oder auch die Musikalischen Würfelspiele), fällt also nicht aus dem Rahmen, sondern paßt gewissermaßen in die Entwicklung der immer subjektiver und individueller werdenden Kunstrezeption. Ein Vorwurf, dem algorithmisch komponierte Kust oft begegnet, ist die angeblich fehlende Intentionalität. Küntler wie Beethoven oder Picasso wollten Kunst schaffen und haben dafür auch eine gewisse körperliche, intellektuelle und materielle Leistung erbringen müssen, was bei einem komponierenden Computer nicht der Fall ist: das intentionale Moment ist nicht vorhanden und die erbrachte Leistung unterscheidet sich nicht wesentlich von dem, was der Computer sonst auch tut, nämlich schlicht und einfach binäre Zahlen zusammenrechnen. Für diesen Vorwurf gibt es allerdings mehrere mögliche Antworten. Einerseits ist die Intentionalität gar nicht unbedingt notwendig, um ästhetischen Genuß zu ermöglichen. So sind z. B. Naturphänomene oder schöne Landschaften in der Regel nicht intentional entstanden, werden aber dennoch oft unter Umständen, die der Kunstrezeption nicht unähnlich sind (finanzieller Aufwand, Anreise, Erinnerungsobjekte usw.), bewundert. Andererseits ignoriert der Vorwurf die Intentionalität, die zwar nicht direkt im Endprodukt, aber zumindest im Algorithmus steckt. Bontempi und Kirnberger haben sich theoretisch und praktisch mit der Materie befassen müssen, um ihre Methoden zu entwickeln und zu verfeinern, und die inzwischen über 20 Jahre währende Arbeit David Copes an EMI ist ein nahezu unglaublicher und entsprechend respektwürdiger Akt kompositorischen Willens. Musikhistorisch gesehen ergibt sich allerdings ein etwas anderes Bild. Selbst wenn wir die sehr selten eindeutige und vor allem extrem subjektive Trennung zwischen Kunst und Unterhaltung außer Acht lassen, müssen wir zugeben, daß beispielsweise Musikalische Würfelspiele zwar einiges über ihre Zeit aussagen, 84 aber weder einen Meilenstein der Musikgeschichte darstellen noch jemals als besonders niveauvolle Werke gelten können. Das spricht natürlich nicht gegen den Kunstcharakter, denn große Teile des gesamten Musikschaffens aller Epochen sind ebenso weder Meisterwerke noch Meilensteine, aber die haupsächliche historische Bedeutung algorithmischer Kompositionsansätze liegt eben weniger in ihrem musikalischen als vielmehr in ihrem analytischen, methodischen und praktischen Inhalt. Bei EMI (und anderen Ansätzen, die die Musik vergangener Zeiten zu imitieren versuchen) sieht es auf den ersten Blick wieder anders aus. Die meisten Werke EMIs haben nicht einfach einen niedrigen, sondern strenggenommen so gut wie überhaupt keinen musikhistorischen Wert, da sie jenseits aller direkten kulturellen Bindung (zeitlicher oder auch geographischer Natur) an die jeweiligen Epochen als isolierte Kuriosa dastehen. Selbst eine Datenbank voller zeitgenössischer Werke könnte EMI nicht die Fähigkeit verleihen, eine Neuerung oder Weiterentwicklung zu erschaffen – dafür fehlt nämlich tatsächlich das intentionale Moment. Die scheinbare musikgeschichtliche Wertlosigkeit wird allerdings durch die historische Bedeutung dieses Zugangs für kognitive und ästhetische Fragestellungen relativiert. Es erscheint also (in einem gewissen Gegensatz zu Meisterwerken der Musikliteratur wie den Symphonien Beethovens) als sinnvoll, den für die Rezeption relevanten Kunstwert algorithmisch komponierter Musik vom historischen Wert zu trennen. Man kann solche Musik ohne weiteres als Kunst rezipieren und ihr auch eine historische Bedeutung beimessen, nur betreffen diese beiden Formen der Wertschätzung jeweils andere Aspekte. Hofstadters 1979 geäußerte Vermutung (siehe S. 80) könnte man aber in einer etwas anderen Form erneut in den Raum stellen, denn es wird wohl noch einige Zeit vergehen, bis Computer Musik komponieren können, bei der ästhetischer und historischer Wert zusammenfallen, die also nicht nur als bloße (zeitlose) Kunst, sondern tatsächlich auch als bewußt innovative und daher auch musikhistorisch bedeutsame Kunst rezipiert werden kann. Ausblick Die bisher genannten Aspekte interessieren Musikwissenschaftler, -pädagogen und eventuell -liebhaber, haben aber für die breite Öffentlichkeit wenig Relevanz. Daß allerdings Musik im täglichen Leben der meisten Menschen eine immer größere Rolle spielt, ist unbestreitbar. Durch das Internet, neue Musikformate wie MP3 und entsprechende Abspielgeräte steigt die Verfügbarkeit 85 enorm, während die neuen Medien und besonders auch die Telekommunikation neue Formen funktionaler Musik fördern. Der Markt wächst also, und das Angebot wächst mit. Der Trend geht in vielen Bereichen in Richtung Individualisierung. Das betrifft nicht nur Unternehmen, die ihrem marketing- und werbetechnisch notwendigen Image auch eine akustische Komponente hinzufügen wollen, sondern natürlich auch Privatpersonen, die beispielsweise ihrer schwindenden Einzigartigkeit in der Masse der identitätslosen Mobiltelefonierer mit persönlichen Klingeltönen entgegenwirken müssen. Daß die Anbieter solcher Services natürlich nicht jedem Privatkunden ein eigenes Musikstück anbieten können und dadurch die vermeintliche Individualisierung nur innerhalb bestimmter, zum Teil recht enger Grenzen möglich ist, ist evident. Für die Anbieter musikalischer Inhalte der neuen Medien sind die oben erwähnten Überlegungen zum Thema Kunstcharakter oder geschichtlicher Wert algorithmischer Musik freilich irrelevant. Die Devise lautet schlicht und einfach: was sich verkauft, ist gut. Heute ist aber ein großer Teil des erhältlichen Contents urheberrechtlich geschützt, weswegen die Anbieter diverse Abgaben an die Rechteinhaber leisten müssen. In Extremfällen befindet sich solch ein Produkt an der Untergrenze der Wirtschaftlichkeit. Algorithmisch komponierter Content könnte beide Probleme beheben: die unvollständige Individualisierung und die niedrige Gewinnspanne. Entsprechend programmierte Datenbanken können für jeden Kunden ein tatsächlich einzigartiges und in hohem Maße individuelles Produkt generieren; bei Bedarf könnte der Benutzer sogar interaktiv in den Kompositionsprozeß eingreifen und dadurch von vornherein eine starke emotionale Bindung an das Ergebnis herstellen. Gleichzeitig hätte das Produkt bei relativ fixen Entwicklungskosten kaum Folgekosten, Urheberrechtsabgaben und dergleichen würden entfallen. Durch diese Faktoren werden Kundenbindung und Gewinnmaximierung in einem weit höheren Maß erreicht, als dies bisher der Fall ist. Auch für die Medienkomposition könnten algorithmische Methoden neue Impulse liefern. Es ist heutzutage nicht unüblich und vor allem durch entsprechende Hilfsmittel immer einfacher, sowohl die visuellen als auch die technischen Grundlagen einer Website- oder Videofilmproduktion auf einem gewissen Niveau ohne professionelle Hilfe selbst entwickeln zu können; die notwendigen musiktheoretischen und -praktischen Kenntnisse scheinen sich indes wesentlich langsamer zu verbreiten. Das kann dazu führen, daß der akustische Inhalt zugekauft werden muß, was nicht nur Geld kostet, sondern oft auch dem Gesamt- 86 konzept abträglich ist. Auch hier könnten einfach zu bedienende interaktive Programme eine Lösung darstellen. Algorithmisch komponierte Musik ist momentan eine Randerscheinung, obwohl sie im Verlauf der Musikgeschichte immer wieder aufgetaucht ist und interessante Ergebnisse geliefert hat. Inzwischen ist allerdings sowohl der Markt als auch die technische Durchführbarkeit gegeben, sodaß wir in Zukunft eventuell verstärkt mit diesem Phänomen konfrontiert werden. 87 6 Literaturverzeichnis Cope, D.: Computers and musical style. The computer music and digital audio series, vol. 6. A-R Editions, Inc., Madison, Wisconsin 1991. Cope, D.: The algorithmic composer. The computer music and audio series, vol. 16. A-R Editions, Inc., Madison, Wisconsin 2000. Cope, D.: Virtual Music: computer synthesis of musical style. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2001. Duden: Informatik – ein Sachlexikon für Studium und Praxis. Dudenverlag, Mannheim (u. a.) 1993. Eggebrecht, H. H.: Musik im Abendland. Prozesse und Stationen vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Piper, München 1996. Guido von Arezzo: Micrologus de disciplina artis musicae. Verfügbar unter http://www.music.indiana.edu/tml/9th-11th/GUIMICB MBBR2784.html; deutsche Übersetzung (Michael Hermesdorff, Trier, 1876) http://www.lml.badw.de/info/guidomi.htm Hofstadter, D. R.: Gödel, Escher, Bach – ein Endloses Geflochtenes Band. dtv/Klett-Cotta, München 1992. Hofstadter, D. R.: Starrin Emmy Straight in the Eye—And Doing My Best Not to Flinch. in: Cope, D.: Virtual Music: computer synthesis of musical style. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2001. S. 33 ff. Hubner, J.: The Well-Tempered Computer. http://www.sonic.net/˜ric/music/notes/wtc.htm Kügle, K.: Isorhythmie; in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart 2, Sachteil Bd. 4, Sp. 1219-1229. Bärenreiter, Kassel 1998. 88 Kupper, H.: Computer und Musik: mathematische Grundlagen und technische Möglichkeiten. BI Wissenschaftsverlag, Mannheim (u. a.) 1994. Lester, J.: Composition Made Easy: Bontempi’s Nova Methodus of 1660 ; in: Theoria 7, S. 87-102. University of North Texas, College of Music, Denton, Texas 1993. o. V.: Game of Life. http://de.wikipedia.org/wiki/Game of Life o. V.: Komposition (Musik). http://de.wikipedia.org/wiki/Komposition %28Musik%29 o. V.: Turing-Test.http://de.wikipedia.org/wiki/Turing-Test Pajot, D.: Musikalische Wurfelspiele – Dice Games Attributed to Mozart. http://www.mozartforum.com/Library%20Articles/Library 46 K Anh C30.01 Dice Game.htm Reuter, Ch.: Die Musikalischen Würfelspiele. http://chr-reuter.de/wuerfel/geschichte.htm Walker, J.: Sketch of The Analytical Engine. http://www.fourmilab.ch/babbage/sketch.html Wiesbauer, E.: Chomskys musikalische Erben. Ein Überblick über linguistisch beeinflusste generative Ansätze in der Musiktheorie. Diplomarbeit an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Institut für Analyse, Theorie und Geschichte der Musik, Wien 2002. Notenmaterial Bach, J. S.; Rempp, F. (Hrsg.): Neue Ausgabe sämtlicher Werke. Serie III: Motetten, Choräle, Lieder. Band 2, Teil 2, Choräle der Sammlung C. P. E. Bach. Bärenreiter, Kassel 1996. Mozart, W. A.; Plath, W. und Rehm, W. (Hrsg.): Neue Ausgabe sämtlicher Werke. Serie IX: Klaviermusik. Werkgruppe 25: Klaviersonaten. Bärenreiter, Kassel 1986. 89 Lebenslauf 28. Juni 1977 geboren in Budapest, Ungarn, als zweiter Sproß einer an sich unmusikalischen, aber mit diversen anderen Talenten gesegneten Familie. 1983-1989 besuchte ich mit mehreren freiwilligen und unfreiwilligen Wechseln etliche Schulen in Budapest und sang lautstark im Musikunterricht mit, während mir selbiges im Schulchor leider aufgrund einiger akustischer Fehltritte versagt geblieben ist. 1987 erhielt ich meinen ersten Instrumentalunterricht (Trompete), und zwar trotz – nach dem Gesichtsausdruck des Lehrers beim ersten Vorsingen zwecks Feststellung meiner Musikalität zu urteilen – offensichtlich ungenügender Eignung. Und da Singen auch ein wichtiger Bestandteil des durch die Kodály-Methode geprägten Theorieunterrichts war, blieben mir ähnliche Grimassen auch später nicht erspart. 1989-1996 durfte ich die Vorzüge des österreichischen Schulsystems an zwei AHS im 19. Wiener Gemeindebezirk genießen, während meine Affinität zur Musik immer mehr erwachte. Endlich durfte ich im Schulchor (meist als einzige Männerstimme) auch richtige Töne treffen, bekam Gitarren-, Gamben- und später Klavierunterricht und sammelte gegen Ende meiner Gymnasialzeit auch Erfahrung im Chorleiten und Komponieren. 1996 begann ich mein Studium an der Universität (damals noch Hochschule) für Musik und darstellende Kunst Wien. In den vergangenen neun Jahren durfte ich von meinen Professoren und meinen StudienkollegInnen sowohl auf fachlicher als auch auf menschlicher Ebene viel lernen, was ich in Zukunft an nachfolgende Generationen weiterzugeben hoffe. 2001 und 2002 wurden von Studierenden der Musikuniversität zwei Werke aufgeführt, an denen ich als Komponist (zusammen mit meinen geschätzten Kolleginnen Elisabeth Wiesbauer, Gerlinde Fritz, Veronika Humpel und Theresa Gruber) und Dirigent beteiligt war: Jörgi, der Drachentöter nach dem gleichnamigen Büchlein von Leo Lukas73 und Das Wort, eine epische Kantate nach einem Libretto von mir, für die die Welt leider noch nicht bereit war. 73 http://www.leolukas.kultur.at/basic3/leo13.htm 90 Erklärung Ich versichere hiermit, daß ich die vorliegende Arbeit selbständig verfaßt, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und mich auch sonst keiner unerlaubten Hilfe bedient habe. Ich habe diese Diplomarbeit bisher weder im Inland noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt oder veröffentlicht. Wien, 25. Juli 2005 91