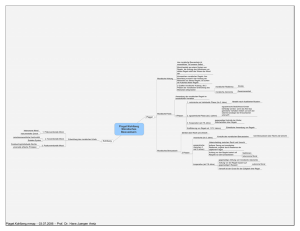Der moralische Wert der Ausnahme
Werbung

Ugo Perone Der moralische Wert der Ausnahme1 1. Ethik oder Moral? Unsere Kultur hat ihre Wurzeln in zwei antiken Sprachen (und Kulturen), im Griechischen und im Lateinischen. Aus dem Griechischen stammen das Wort und der Begriff der Ethik. Ausgehend von dem Wort ethos, welches die Bräuche und die Gewohnheiten, die Sitten und die Regeln einer Gesellschaft bezeichnet, hat Aristoteles eine Ethik entworfen, welche sich mit dem guten, dem gelingendem Leben befasst. Das Wort ethos hat seine Wurzeln wiederum im Bereich des Hauses, so dass die aristotelischen Tugenden deutlich die Züge einer dem eigenen Ort und Ursprung entlehnten Schicklichkeit aufweisen. Die Ethik ist ein Handeln nach der eigentlichen Natur des Menschen. Aus dem Lateinischen dagegen stammen das Wort und der Begriff der Moral. Er geht auf das Wort mos (Plural mores) zurück, welches ebenfalls den Brauch und die Gewohnheit, die Sitte und Regel einer Gesellschaft bezeichnet. Zugleich tritt hier die Idee eines Individuums hervor, das nach seinem Willen und entsprechend seinen Wünschen Entscheidungen trifft. Ethik und Moral bedeuten so gesehen dasselbe, aber die etymologischen Herkünfte lassen unterschiedliche Akzente durchblicken: Die Ethik ist mehr an eine Natur und eine Gesellschaft gebunden, die Moral setzt dagegen den Willen und das Individuum stärker in den Vordergrund. Nichtsdestotrotz sind die beiden Begriffe in unserer Gesellschaft – mit wenigen Ausnahmen, z. B. bei Hegel – als Synonyme in den Wortschatz eingegangen. Es ist vielleicht kein Zufall, wenn Immanuel Kant – der zweite Meilenstein in der Ethik nach Aristoteles – und nach ihm Fichte den Versuch unternehmen, eine terminologische Variante mit dem deutschen Substantiv Sittenlehre und der generalisierten Verwendung des Adjektivs praktisch durchzusetzen. Die Sittenlehre unterstreicht die Beziehung des Moralischen zur Sitte und zum Brauch, bemüht sich aber zugleich um eine Art Bereinigung dieser Beziehung durch eine Korrektur, eben mittels der Variante einer Metaphysik der Sitten, d. h. einer reinen, von empirischen Elementen befreiten Grundlegung des Moralischen. Auch das Adjektiv praktisch lässt das Griechische anklingen (prattein) und dient doch zugleich der methodischen 1 Ich bedanke mich bei meiner Assistentin Frau Dr. Silvia Richter für die sorgfältige Revision meines Manuskripts und für manche den Text bereichernde Anregungen. 1 Unterscheidung zwischen einer praktischen Vernunft, die das Handeln bestimmt, und einer reinen Vernunft, die sich dem Erkennen widmet. Kants Lehre war außerordentlich wirkmächtig, sein Versuch, das Ethische im Moralischen aufgehen zu lassen, war allerdings weniger erfolgreich. Es ist Hegel, der dann nach Kant streng zwischen Moral und Sittlichkeit unterscheidet. Die Moral bezieht für ihn die Kantische Auffassung der Pflicht und des Sollens ein. Die Sittlichkeit ist dagegen „die Vollendung des objektiven Geistes“. In ihr wird „die Einseitigkeit des subjektiven Geistes“ aufgehoben und der Wille der einzelnen Subjektivität zur „Wirklichkeit zugleich als Sitte“, das heißt, „die selbstbewusste Freiheit [wird] zur Natur“. Bei beiden Denkern können wir also erneut die alte Differenzierung zwischen Ethik und Moral wiedererkennen. Bei Kant, der wenig mit Aristoteles teilt, ist das Moralische eine Lehre, welche die Sitten aus der Perspektive des reinen Willens und seines Wirkungsvermögens auf die Handlung betrachtet. So ist es, wie man sagen könnte, die Moral, die hier das Primat gegenüber der Ethik hat. Umgekehrt verhält es sich bei Hegel, der die Moral zu einem abstrakten Sollen herabsetzt und ihr die Kraft abspricht, die Wirklichkeit zu gestalten. Nur der Sittlichkeit, welche die Freiheit in die Wirklichkeit umsetzt und einem Volk ein ethos schenkt, kann ein solches Primat zuerkannt werden. Der alte Kampf zwischen Athen und Rom gewinnt hier neue Konturen. Spuren dieses unentschiedenen Streits finden sich nach wie vor in unserer Alltagssprache, so zum Beispiel eine extreme Verflechtung im Englischen: Hier bezeichnet moral die moralische Lehre, morals sind dagegen die Sitten, während morale den Gemeinschaftsgeist benennt. Im Italienischen finden wir den selben Unterschied zwischen la morale (Femininum), welche dem englischen moral entspricht, und il morale (Maskulinum), welches dem englischen morale gleichkommt. Wenn eine solche mehrdeutige Verflechtung in der Sprache beibehalten wird und auch die Philosophie zu keiner eindeutigen Lösung gelangt, haben wir einigen Anlass zu glauben, dass der Wirrwarr von Begriffen offenbar einem Wirrwarr von ungelösten Fragen entspricht. Die Sprache verdeckt die Probleme nur, indem sie sie unbeantwortet in sich aufbewahrt. Vor einem moralischen Horizont – und mit diesem Ausdruck wollen wir das Primat des Ethischen oder des Moralischen vorerst unberührt lassen – kreuzen sich einerseits soziale Bräuche, welche das ethos einer Gesellschaft bilden, und andererseits freie Entscheidungen, welche jeder einzelnen Handlung zu Grunde liegen. Ein soziologisch orientiertes Wissen über die Bräuche ist sowohl legitim wie möglich, ein metaphysischer Aufbau lässt sich aber kaum damit begründen. Ähnlich ist es, wenn man die Gründe einer Entscheidung rekonstruieren will. Psychologisch ist das, wenn auch 2 schwierig, vermutlich möglich. Der Ehrgeiz, ein reines Wissens über die Freiheit zu erlangen, wird aber wahrscheinlich scheitern. Gerade diese Schwierigkeiten erklären, warum man in der öffentlichen Diskussion ständig zwischen zwei entgegengesetzten Positionen oszilliert: Einerseits haben wir moralisch orientierte und rhetorisch gut konstruierte Aufrufe, andererseits gelangen wir immer wieder zu der trostlosen Feststellung ihrer Unwirksamkeit. Es gelingt diesen ethischen Prinzipien meistens zu spät und nur post festum, sich zu Wort zu melden, also dann, wenn die Not des Lebens oder das Wunder der Großzügigkeit den Knoten beinahe oder schon gelöst haben. Und dieses Hin und Her ist in einer flüchtigen Zeit wie der unsrigen, in der das Denken nicht in einem von der Mehrheit der Menschen geteilten Kontext von Bräuchen und Regeln stattfindet, sondern der Ermüdung der individuell und sozial oft divergenten, ja sogar widersprüchlichen Wahlentscheidungen ausgesetzt ist, sogar noch radikaler. Was man als den ‚Konflikt der Interpretationen’ bezeichnet hat – etwas, das noch tragbar war, solange es in erster Linie „nur“ um alternative theoretische Weltanschauungen ging – wird unerträglich, wenn sich diese Sichtweisen unvermeidlich in auseinanderdriftenden Lebensstilen niederschlagen. In diesem Zusammenhang, der eigentlich auf die Dringlichkeit des Moralischen weist, wird die Möglichkeit einer universellen moralischen Verpflichtung radikal in Frage gestellt. Das cartesianische Modell der Kompatibilität einer unbezweifelbaren theoretischen Erkenntnis und einer nur vorläufigen Moral erweist sich als durchaus gebrechlich. Wir verfügen über keine unbezweifelbare Wahrheit, und genau aus diesem Grund spüren wir, dass die Welt des Moralischen etwas Wesentliches enthält, ja sogar, dass sie bis zu einem gewissen Grad der einzig gangbare Weg ist, Wahrheit zu bekennen. Aus dem gleichen Grund zeigt die rein funktionalistische Unterscheidung zwischen privaten Lastern und öffentlichen Tugenden ihre volle Unzulänglichkeit. Allein schon deshalb, weil das öffentliche Wohl hinreichend kaum zu bestimmen ist, setzen wir voraus, dass das private Verhalten einer Person ihrem öffentlich erklärten Projekt entspricht. 2. Hegels Kritik als Zeitdiagnose Bevor wir die Analyse fortsetzen, erlauben Sie mir, kurz bei einem Zitat von Hegel zu verweilen. Auch wer Hegels Philosophie ablehnt, muss seine außerordentliche Fähigkeit zu einem konzentrierten Einblick in die geistige Situation seiner Zeit, die möglicherweise auch die unsere ist, anerkennen. Im Paragraphen 511 der Enzyklopädie, in dem Abschnitt, 3 den er der Moralität widmet und in dem er die Kritik der Kantischen Moral ausführt, beschreibt er das Drama der zeitgenössischen Moral folgendermaßen: „Der allseitige Widerspruch, welchen dieses vielfache Sollen, das absolute Sein, welches doch zugleich nicht ist, ausdrückt, enthält die abstrakteste Analyse des Geistes in ihm selbst, sein tiefstes Insichgehen. Die Beziehung der sich widersprechenden Bestimmungen aufeinander ist nur die abstrakte Gewissheit seiner selbst, und für diese Unendlichkeit der Subjektivität ist der allgemeine Wille, das Gute, Recht und Pflicht, ebensowohl als auch nicht; sie ist es, welche sich als das Wählende und Entscheidende weiß.“ Es ist hier nicht der Ort für eine detaillierte Auslegung dieses ebenso schwierigen wie faszinierenden Textes. Begnügen wir uns mit einigen Hinweisen, welche uns helfen sollen, seine Bedeutung für unser Anliegen zu erkennen. Die Kantische Moral, hier stellvertretend für jede gehobene aufklärerische Moral, stützt sich auf abstrakte Normen und Pflichten, auf ein Sollen, welches doch zugleich nicht ist (und ein Sollen darf eben nie mit einem Sein verwechselt werden). Die Folge ist eine doppelte: Einerseits wird die Welt durch einen allseitigen Widerspruch durchquert, da die Auffassungen derart auseinandergehen, dass sie ständig zu neuen Widersprüchen führen. Andererseits steigt die subjektive Gewissheit zur höchsten Instanz auf, zu der einzigen, welche in der Lage sein soll, den abstrakten moralischen Normen einen Inhalt zu verleihen. Bei Hegel dient die Kritik, wie wir wissen, dazu, das Ethische, d. h. eine Sittlichkeit, welche sich in staatlichen Institutionen verkörpert, durchzusetzen. Nach den Ereignissen des 20. Jahrhunderts sind wir diesbezüglich allerdings zu Recht skeptisch geworden. Und dennoch: Verspüren wir nicht ein ähnliches Gefühl angesichts der Impotenz des moralisch Abstrakten? Und schlägt sich dieses Fühlen nicht in zwei entgegengesetzte Richtungen nieder? Mit der Konsequenz zweier widersprüchlicher Verhaltensweisen: einerseits ein politisches Engagement, welches die Schwäche der Moral ausbessern will, und andererseits eine Vorsicht, welche es sich zur Aufgabe macht, die Rechtsordnung vor jeder moralischen Einmischung zu schützen? Ist die Moral nicht ständig einem Zuviel oder einem Zuwenig ausgesetzt, die ihr am Ende jede Autorität absprechen? Hegel spricht im Paragraphen 512 von einem moralischen Ruin der Moral, die, so seine Worte, „unmittelbar in sich zusammensinkt“. Sie erscheint und ist nutzlos. Sie dient bestenfalls dazu, die Konflikte des modernen Menschen darzustellen, eines Menschen, der sich als Täter freier Entschlüsse, die einer objektiven Norm Wirklichkeit verleihen, 4 verstehen will – der sich aber zugleich als Urheber der Norm entdeckt und gerade deswegen durchschaut hat, welche Eigeninteressen ihr zugrunde liegen. Und dies alles geschieht nicht per accidens, sondern gehört strukturell zu einer Moral, die sich als autonom versteht. Die Widersprüche belagern dann ein Moralisches, das Objektivität und Universalität anstrebt, aber durch die Subjektivität gesetzt wird. Aus diesem Grund wird die Moral als Produkt einer Moderne, die in Kant gipfelte, von Hegel verspottet. Im besten Fall beschreibt die Moral nicht viel mehr als die Stimmung eines moralischen Bewusstseins oder – wie vielleicht Nietzsche sagen würde – seinen Gesundheitszustand, den Grad seiner geistigen Anspannung. Eine Moral wäre dann nichts anderes als ein Spiegel der spirituellen Bestrebungen einer Zeit. 3. Die Bedeutung der Ausnahme Aber ist das wahr? Doch nur, wenn die Moral nichts anderes wäre als die Feststellung einer universell geltenden Norm, wenn sie, wie Kierkegaard sagen würde, der Entschluss für eine einem universellen Prinzip untergeordnete Existenz wäre. Aber dies wäre eine Karikatur des Moralischen, die trotz der Zugehörigkeit zu einer relativ homogenen Gemeinschaft nicht einmal für Aristoteles zuträfe. Und so kann sie auch in der Moderne nicht sein (gelten), wo eben die Aufgabe, das Wahre und das Gute zu stiften, der Macht des Subjekts anvertraut wurde. Wie Hegel klar gezeigt hat, erleben wir in der Moderne den Widerspruch zwischen der unpersönlichen Universalität der Norm und der individuellen Freiheit, welche eigentlich das Fundament der Norm bildet, am eigenen Leibe. Daher eben bemüht Hegel sich zu zeigen, dass die Moral der Norm und des Sollens in die konkrete Wirklichkeit einer in Institutionen sich entfaltenden Freiheit, d. h. in die Ethik, übergeht oder sogar schon übergegangen ist. Offenbar stehen wir dann vor dem folgenden Dilemma: Entweder gibt es eine Moral, welche nach einem universellen Willen strebt, aber dann auf den bereits erwähnten Widerspruch zwischen Universalität und Individualität des Willens stößt, oder es handelt sich um eine Ethik im Hegelschen Sinne, in der der individuelle Wille schon ins Universelle übergegangen ist, aber zu dem Preis, die Norm durch das graue Antlitz einer Institution ersetzt zu haben. In beiden Fällen, wage ich zu behaupten, leidet das Moralische unter einer schmerzlichen Ungleichzeitigkeit. Entweder kommt es als Moral zu früh, als ein Imperativ, welcher stets nur gebietet, was sein soll, ohne jemals in Erfüllung zu gehen, oder es kommt als Ethik zu spät, als ein Reelles, das schon hinter jeder Entscheidung steht. Dieser innere Widerspruch wirft nicht unbedeutende Schatten auf den Versuch, das 5 Moralische mit einem Wissen über die Normen, die die Handlung bestimmen, zu identifizieren. Ich schlage vor, eine andere Hypothese zu untersuchen: Das Moralische beschäftigt sich nicht mit der Bestimmung einer universell geltenden Norm, sondern mit der reflektierten Übernahme, Anwendung, Erweiterung und Kritik bereits existierender Normen. Um das Begriffspaar Ethik und Moral wieder aufzugreifen, könnte man vielleicht folgende Formel wagen: Das echt Moralische ist nicht eine Moral, welche sich einfach vom Ethischen absetzt, oder umgekehrt eine Ethik, welche die Moral auflöst, sondern das echt Moralische ist der riskante Versuch, die schon bestehenden Normen mit den Ausnahmen des Lebens in Einklang zu bringen. 4. Bedürfnis und Wunsch, Brauch und Gebot In der Tat befinden sich die Regeln hinter oder vor jeder Moral: Sie haben ihren Ort im Bedürfnis und im Wunsch, in den Bräuchen und im Gebot. Zunächst im Bedürfnis und im Wunsch: Der duale Trieb nach Selbsterhaltung und Selbstentfaltung ist im genetischen Programm der Menschheit verankert. Dabei ist das Bedürfnis nach innen gerichtet und bezieht sich auf das, was jeder zu seiner eigenen Erhaltung braucht. Der Wunsch wendet sich dagegen nach außen und bezieht sich auf das, was jeder im Hinblick auf seine Entfaltung anstrebt. Dieser duale Trieb kann zweifellos durch Bildung, Kultur und Gesellschaft umgeformt werden, aber er lässt sich niemals zur Gänze eliminieren. Was sich jeweils ändert, ist lediglich der Punkt der Balance zwischen dem Bedürfnis und dem Wunsch. Das Bedürfnis nach Selbsterhaltung und Selbstbehauptung und der Wunsch nach Öffnung und Anerkennung beschreiben dabei grundlegende Strukturen des Subjekts, die zwar entgegengesetzte Richtungen angeben, die aber per se keine Spaltung verursachen. Bedürfnis und Wunsch kreuzen sich, ihrer Divergenz zum Trotz, und tauschen möglicherweise sogar die Namen: Man spricht dann vom Wunsch nach Autonomie und Selbständigkeit und von einem Bedürfnis nach den Anderen. Das Bedürfnis ist eben nicht nur nach innen gerichtet und der Wunsch nicht nur nach außen. Der Behauptung eines solchen dualen Triebes geht es nicht darum, Bedürfnis und Wunsch scharf voneinander zu trennen (wo fängt das eine an, und wo endet das andere?), es geht ihr vielmehr darum, die doppelte und gleichzeitig einheitliche Bewegung, die vor jeder Konstitution der Existenz besteht, ersichtlich zu machen. Die jeweilige Konfiguration ist das, was vor jeder moralischen Entscheidungen steht. Sie ist selbstverständlich nicht mit einer Norm gleichzusetzen, nach der man suchen 6 kann, sie bildet aber die Voraussetzung jeder Normierung. Sie enthält sogar eine Grundregel, eine, die uns – endliche Wesen – am Leben hält und an die Erde bindet. Bedürfnisse und Wünsche sind Bildungen in diesem Sinne. Sie sind dies, gerade weil sie aneinander gebunden sind. Das Bedürfnis gibt uns zu verstehen, dass wir bedürftig und begrenzt sind, dass wir an die Not wie an eine Notwendigkeit geknüpft sind. Der Wunsch besagt, dass unser Begehren sich aus der Schranke des Bedürfens befreien will, dass es bis zum Himmel und zu den Sternen (der Etymologie von desiderium folgend: ad astra) transzendieren will. Zusammen bilden Bedürfnis und Wunsch die gesetzgebende Konstellation unseres endlichen Lebens; sie binden uns an die Erde, aber sie bestimmen auch unsere Blicke darüber hinaus. Etwas Ähnliches trifft auf die Gebote und Bräuche zu. Bräuche stellen bestimmte Verhaltensformen dar, die sich im Laufe der Zeit zu einer Norm herauskristallisiert haben. Bei den Geboten in ihrer religiösen Formulierung handelt es sich um durch Offenbarung empfangene Befehle. Die einen wie die anderen schreiben bestimmte Verhaltensweisen vor und schließen andere aus. Bräuche machen dies auf eine fast unmittelbare und kaum reflektierte Weise und umreißen damit den Rahmen der Möglichkeiten, die dem Einzelnen in einem spezifischen historischen und sozialen Kontext offenstehen. Das Gebot dagegen, das für sich in Anspruch nimmt, aus einer externen Quelle zu stammen, impliziert ein absolutes Urteil, das möglicherweise mit den Bräuchen in Konflikt geraten kann. In gewisser Weise entspricht die Funktion der Bräuche der des Bedürfnisses. Beide bilden den Rahmen, innerhalb dessen es einem Subjekt gegeben ist, sich zu entwickeln. Das Gebot dagegen gleicht in seiner Absolutheit der Begierde. Es schreibt eine Norm vor, die den gegebenen Kontext sprengt. So verlangen die Mosaischen Gebote als erstes die Anerkennung eines in der Geschichte wirkenden, aber die Geschichte übersteigenden (transzendenten) Gottes. Dies gilt selbstverständlich auch für Gebote, die keinen religiösen Charakter haben, in denen jedoch – wie im Fall der Menschenrechte – Rechte als verbindlich formuliert werden, welche die historische Kontingenz überschreiten. Auch in diesem Fall wird – um die Analogien weiter zu verfolgen – ein potenzieller Konflikt zwischen Bräuchen und Geboten offensichtlich. Die ersteren sind im gleichen Maße starr wie veränderlich. Das Gebot dagegen ist unwiderruflich, jedoch gerade durch seine Absolutheit zugleich offen für unterschiedliche Umsetzungen. Henri Bergson hatte etwas ähnliches im Blick, als er den Unterschied zwischen einer geschlossenen und einer offenen Moral einführte, ein Unterschied, der parallel zu jenem zwischen einer statischen und einer dynamischen Religion verläuft. 7 In einer solchen begrifflichen Konstruktion wird man die Wirksamkeit eines grundlegenden Prinzips Romano Guardinis wiedererkennen. Er schreibt: „Dieses eigentümliche Verhältnis, in dem jeweils zwei Momente einander ausschließen, und doch wieder verbunden sind, ja […] einander geradezu voraussetzen; dieses Verhältnis […] nenne ich Gegensatz.“2 Wir haben es hier mit Gegensätzen zu tun, welche das LebendigKonkrete des Lebens zu erfassen versuchen. Und wie Guardini hinzufügt: „Das Leben aber ist nicht Synthese dieser Verschiedenheit; nicht ihre Vermischung, nicht ihre Identität. Sondern das Eine, das in dieser gebundenen Zweiheit besteht.“3 Deswegen darf die polare Kraft eines Gegensatzes nie mit einem Widerspruch verwechselt werden.4 Jeder, der zur Welt kommt, jeder neugeborene Mensch – und das ist es, was ich hier mit Bezug auf das Moralische besonders hervorheben will – ist bereits in ein stabiles, aber zugleich anpassungsfähiges Netzwerk von Normen eingeschrieben, das seine persönliche und soziale Stellung umrahmt. Jedem steht es zu, zu einem individuellen Gleichgewicht zwischen Bedürfnissen und Wünschen und zwischen Bräuchen und Geboten zu gelangen. Das Moralische beschäftigt sich damit im engeren Sinne und untersucht, welche Normen einer persönlichen Entscheidung zugrunde liegen sollten. Und eine Entscheidung, die auf eine bestimmte Situation bezogen ist und einen Sonderfall zu berücksichtigen hat, kann dann zur Voraussetzung für die Erneuerung einer Norm werden. Gerade an dieser Schnittstelle setzt das Moralische an. Die Aspekte, die wir hier aufgreifen, sind im Grunde bereits von der klassischen wie der neuzeitlichen Philosophie beschrieben worden. Wenn Aristoteles die Tugend als mesotes („Mitte“) beschreibt und die unterschiedlichen Definitionen des Glücks in Betracht zieht, dann zeigt er, dass es nicht darum geht, die Norm zu erfinden, sondern darum, sie als eine bereits im Leben vorfindliche zu erkennen. Denn er bestimmt nicht apodiktisch, was tugendhaft ist, sondern erkennt es als etwas kat’emas, d. h. auf uns bezogenes, an. Und selbst bei Kant ist das Sollen ein Faktum der reinen praktischen Vernunft, etwas das „apodiktisch gewiß“, „gegben“ und „gesetzt“ ist5. So gilt die universelle und uneingeschränkte Gültigkeit in Bezug auf den moralischen Imperativ zwar als sein Merkmal, nicht aber als seine Begründung. Die Verpflichtung leitet ihre Begründung nicht aus ihm ab, sondern, wie gesagt, aus einem Faktum. 2 R. GUARDINI, Der Gegensatz. Versuche zu einer Philosophie des Lebendig-Konkreten, Grünewald/Schöningh 1998 (1. Auflage 1925), S. 28. 3 4 5 A. a. O., S. 45. A. a. O., S. 83. S. I. KANT, Kritik der praktischen Vernunft, II 61 f. 8 Und auch die moralische Bedeutung der Ausnahme wurde in der Tradition erkannt. Denken wir, um nur einige Beispiele zu erwähnen, an Kierkegaard, der gerade im religiösen Stadium das Recht der Ausnahme gegen die Ansprüche des Universellen verteidigt hat (bis zum Fall Abraham, der – nur Gott gehorchend und jedes moralische Gesetz brechend – bereit war, seinen Sohn Isaak zu opfern). Oder an die Moral der Jesuiten, die es sich zum Ziel gemacht hatten, alle legitimen Ausweichmöglichkeiten aus der moralischen Norm ausfindig zu machen. Auch dieser Versuch, den Pascal in Les Provinciales zu Recht als „entgegenkommende Verpflichtung“ verspottet, ist von dem Bewusstsein geprägt, dass die Moral mehr als universell geltende Normen braucht. Leider, muss man indes hinzufügen, führt diese kasuistische Lösung auf ungewollte Weise zu der Stärkung einer Moral nach dem Muster einer Rechtsordnung. Sogar die Relativierung der Moral, wie sie sich im Gedanken der ‚provisorischen Moral’ bei Descartes darstellt, oder die diffuse Spiritualität des new age, die das Prinzip Verantwortung durch die Suche nach einem persönlichen Lebensstil ersetzt, bestätigen das verbreitete Unbehagen gegenüber der moralischen Frage und zeugen von der Suche nach einer Lösung, die in der Lage ist, Norm und Erfahrung besser in Einklang zu bringen. Die Fragwürdigkeit oder sogar Unzulänglichkeit solcher Lösungen sollte uns jedoch nicht die Augen verschließen vor den Problemen der allgemein geltenden Moral, auf welche diese versuchten Lösungen implizit hinweisen. 5. Das Moralische der Moral: der Schutz der Wirklichkeit Die Moderne hat die Brisanz des Problems der moralischen Ausnahme in der Tat enorm gesteigert. In Zeiten einer (relativen) Homogenität konnte man noch versuchen, es zu lösen, in dem man die Ausnahme als individuelle Abweichung von der Norm rechtfertigte. Man konnte auf einen Ausnahmezustand hinweisen, ohne den gesamten Aufbau der Moral dadurch in Frage zu stellen. In Zeiten jedoch, in denen auf jeder Ebene – sowohl in Bezug auf Bedürfnisse und Wünsche als auch auf Bräuche und Gebote – die Erfahrung gemacht wird, dass Regeln entweder jede bestimmende Kraft verloren haben oder aber in ausweglosem Kontrast zueinander stehen, stellt sich da nicht erneut die Frage nach der Notwendigkeit der Normativität des Moralischen? Verlangt nicht gerade die heutige Situation gegen alle Behauptungen, dass sich die Moral ihrer „Niederlagen“ zum Trotz wieder in eine normative Richtung begibt? Ein Weg in diese Richtung scheint mir allerdings versperrt. In der Tat ist der groß angelegte Versuch Kants, im Autonomiebegriff einen festen Boden für die Moral zu 9 gewinnen, gescheitert. Die Moralsysteme des 19. Jahrhunderts konnten den Mächten des Bösen im 20. Jahrhundert keine ausreichende Widerstandskraft entgegensetzen, wie Dietrich Bonhoeffer in eindrucksvoller Weise gezeigt hat. Die Ereignisse jenes Jahrhunderts haben die Gefahren einer formalen Pflichtethik herausgestellt und damit die Unbeständigkeit einer Normativität, die plötzlich zu Diensten des Bösen umschlagen kann. Diese „Umwertung der Werte“ zeigte sich am Deutlichsten in den nationalsozialistischen Begriffen von „Moral“, die nach und nach die Gesellschaft zersetzten: Ehre, Treue, Schande und Kameradschaft, etc., all diese Begriffe nahmen unter dem NS-Regime einen wichtigen Stellenwert ein.6 Insofern war das NS-Regime keineswegs ein a-moralisches Regime, d. h. eines ohne Moral – es hatte sehr wohl einen klaren Moralkodex. Jedoch standen die Werte dieser sogenannten „Moral“ unter dem Zeichen des Bösen. Die Nazis usurpierten die bestehenden Werte und Tugenden, indem sie sie für ihre machtpolitischen Zwecke missbrauchten. Man muss also von vorne beginnen. Gerade in der Zeit eines moralischen Pluralismus, wie wir ihn heute haben, ist die Moral mehr denn je dazu aufgerufen, den Ernstfall eines schwerwiegenden Konflikts zwischen Prinzipien, die für sich genommen gut sind, aber nicht gemeinsam angewendet werden können, zu bedenken. Ihre Aufgabe wird dann in erster Linie und grundlegend darin bestehen, der Erfahrung gerecht zu werden und ihrer außergewöhnlichen und unübersetzbaren Struktur Rechnung zu tragen. Dies kann jedoch nicht durch einen einfachen Verweis auf die Einzigartigkeit und Einmaligkeit einer Situation geschehen. Wäre dies der Weg, wäre keine ernsthafte Diskussion möglich. Sie wäre auch gar nicht nötig, und der Fall, um im Bild zu bleiben, schließlich weder „ernst“ noch außergewöhnlich. Wie jedes Ereignis, das sich einfach den Regeln widersetzt, könnte es nur beschrieben werden, bestenfalls mit ästhetisierenden Akzenten. Zu einem moralischen und ernsten Dilemma wird dieses Ereignis nur, wenn und weil schon Regeln hinter seiner Erfahrung stehen: die 6 Dies zeichnen die Studien von R. GROSS, Anständig geblieben. Nationalsozialistische Moral, S. Fischer, Frankfurt a.M., 2010 nach. Gross zeigt, dass erst ein System von gegenseitig eingeforderten moralischen Gefühlen und Tugenden die Begeisterung der deutschen Bevölkerung für die nationalsozialistische „Volksgemeinschaft“ ermöglicht und mobilisiert hat. Der Titel der Studie leitet sich aus der berühmten Rede, die Heinrich Himmler am 4. Oktober 1943 in Posen vor 92 SS-Offizieren hielt, ab: „Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn hundert Leichen beisammen liegen, wenn fünfhundert daliegen oder wenn tausend daliegen. Dies durchgehalten zu haben, und dabei – abgesehen von Ausnahmen menschlicher Schwächen – anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht. Dies ist ein niemals geschriebenes und niemals zu schreibendes Ruhmesblatt unserer Geschichte.“ Man bekommt den Eindruck, Himmler habe hier den moralischen Begriff des „Menschseins“ an sich verloren bzw. komplett invertiert – und zwar zum Bösen.umgedreht. 10 unmittelbaren Regeln des Bedürfnisses und des Wunsches und die schon mehr oder weniger reflektierten Regeln der Bräuche und des Gebotes. Vor der Moral, wie ich sie verstehe, gibt es ein Ethos – jenes Ethos, von dem die Ethik uns berichtet.7 Die Moral jedoch entsteht gerade dann, wenn die Ethik nicht (mehr) ausreicht. Der Ernstfall ist das, was die Ethik nicht erwartet, wofür sie aber Regeln aufgestellt hatte. Der Ernstfall verlangt eine spezielle Art der Anerkennung. Und dies ist eben die Aufgabe der Moral. Sie tut dies, indem sie doppelt Abstand nimmt: Abstand zum einen von der Norm, Abstand zum anderen von der unmittelbaren konkreten Situation. Abstand nehmen bedeutet nicht, sich zu distanzieren. Die Moral weiß, dass die Situation volle Anerkennung, eine Anerkennung ohne Abzug verlangt. Sie weiß aber auch, dass eine solche Anerkennung den Fall zur Norm erhöht, und dass die Norm wiederum an ihrer Fähigkeit gemessen wird, in anderen – ähnlichen – Fällen einspringen zu können. Die Moral betritt dann in einen kreativen Bereich, in dem der Einzelfall zum Prüfstein einer Norm wird. Sie kann sich dieser Freiheit stellen, weil die Regel ihr vorausgeht. Sie besitzt Stärke, weil sie auf dem Boden derselben Norm ruht, die sie in Frage stellt. Sie besitzt Stärke, weil die Normativität eine grundlegende Bestimmung unseres Wesens ist, eine Bestimmung, die uns vorangeht und transzendiert.8 Die Aufgabe der Normativität besteht jedoch nicht primär darin, zu einer neuen, wenn auch immer komplexeren und raffinierteren Norm zu gelangen. Die Moral überlässt diese Aufgabe daher bereitwillig dem Recht, der Politik oder den Bräuchen oder, um ein umfassenderes Wort zu verwenden, dem Leben mit seiner Fähigkeit, sich in immer neuen Formen zu organisieren. Für sich beansprucht die Moral den integralen Schutz des Ausnahmefalls, d. h. den Schutz der Besonderheit dieses Falls, aber zugleich auch den Schutz dessen, was am Ursprung dieser Besonderheit liegt, nämlich die konstituierende und umrahmende Kraft der Norm. Die Moral kommt wirklich zu spät, wenn es darum geht, dem Realen Regeln vorzuschreiben. Sie ist jedoch ausschlaggebend, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Sie lehrt uns, ihre Ernsthaftigkeit und Endgültigkeit abzuwägen sowie die Folgen, die aus ihr hervorgehen, zu berücksichtigen. 7 Von hier an verwende ich den Begriff Moral nicht mehr als Gegenpol zur Ethik, sondern entfalte die Beziehung zwischen Moral und Ethik auf eine andere Weise als im ersten Teil der Abhandlung. Moral entspricht hier dem, was ich provisorisch bis jetzt das Moralische genannt habe. 8 In diesem Sinne spricht zum Beispiel Emmanuel Levinas von einer „Ethik der Heteronomie“, die ihre Normativität aus einer Quelle vor mir, d. h. außerhalb meines Selbst, bezieht und mir vom Antlitz des Anderen – der immer schon vor mir da ist und mir zu-vor kommt – aus befiehlt, ohne dass ich diesem Befehl ausweichen oder ihn abweisen kann. 11 Die Entscheidung ist ein Akt der Freiheit, und damit ein nie einfacher, nie gleichgültiger Akt des Geistes. Die Freiheit besteht nicht darin, dass man frei wählt.9 Da sie ein Akt des Geistes ist, hat sie als ein solcher zu gelten, d. h. weder nur Ausdruck der wählerischen Kraft des Geistes zu sein noch nur Zeugnis von dessen Teilnahme an einer universell geltenden Ordnung. Es ist an der Freiheit, eine Entscheidung zu treffen, die das Innige und Wesentliche des Geistes schöpferisch in Handlungen umsetzt, die wiederum auf eine Weise individuell geprägt sind, dass sie, ohne jemals wiederholt werden zu können, doch für alle vorbildlich bleiben. Sie können deshalb nie einfach wiederholt werden, weil nie derselbe Fall einem anderen Menschen widerfahren wird. Geschähe dies, so wäre dieselbe Entscheidung fällig. Die Entscheidung ist eine schwerwiegende Situation, in die der Geist sich vertiefen oder sich zerstreuen kann, in der das Geistige wächst und reift oder steril und stumpf wird. Die Entscheidung ist eine Geste, welche in die Realität hinein wirkt, welche teilt und neu ordnet, trennt, ent-scheidet, welche aber stets das Ziel hat, etwas Kostbares hervorzubringen. Der Geist einer Person besteht aus einer Fülle von Entscheidungen, die bewusst und intentional zu einer wechselseitigen Verträglichkeit gebracht worden sind. Diese Entscheidungen sind nicht umkehrbar. Jede von ihnen stärkt oder schwächt den ganzen Prozess, der im Gange ist; keine ist aber allein in der Lage, die anderen zu rechtfertigen. Die Moral besteht in dem Bewusstsein, dass auch die Freiheit eine dunkle Seite besitzt, und darin, die Abgründe der Freiheit zu ermessen. Die Freiheit kann darin bestehen, die Bedürfnisse so trivial zu befriedigen, dass daraus nichts anderes hervorgeht als unsere bloße Zugehörigkeit zur Lebenswelt. Sie kann auch den Wunsch geradezu dämonisch verwirklichen wollen, so als ob wir keiner Welteinschränkung zugewiesen wären. Aber Freiheit kann auch bedeuten, auf schöpferische Weise den richtigen Weg für uns und für andere zugänglich zu machen, so dass die Tiefe des Lebens plötzlich sichtbar wird. Mit dieser Wegführung entwerfen wir eine Interpretation unseres In-der-WeltSeins. Wir setzen hier unseren persönlichen Wahrheitsakzent in der Welt um. Zwei entscheidende Momente dieses freien moralischen Aktes sollten berücksichtigt werden. Wie schon Luigi Pareyson betonte, ist das echt Moralische von existenzieller Natur: Jede Entscheidung hat mit der Singularität der Person und des jeweiligen Falls zu tun, nicht weniger als mit dem Universellen der Norm und der Bräuche.10 Die Freiheit besteht gerade darin, den Gegensatz – um eine Kategorie des Guardinischen Denkens zu verwenden – zwischen Singularität und Universalität zur 9 Gerade aus diesem Grunde und völlig zu Recht schreibt Guardini (a.a.O., S. 152 ff.), dass das Problem der Freiheit nicht darin besteht, ob man frei ist, sondern wie man frei ist. 10 Vgl. L. PAREYSON, Kierkegaard e Pascal, Mursia, Milano 1998, S. 152. 12 lebendigen Grundlage des Lebens zu erheben, d. h. zu einer Einheit zu bringen, die keine Synthese ist, aber auch keinen Widerspruch darstellt. Es handelt sich vielmehr um ein Spannungsfeld, in dem zwei entgegengesetzte Richtungen das Leben bestimmen. Wie Guardini eben schreibt: „Es handelt sich um eine eigentümliche Art der Beziehung, gebildet durch Ausschließung und relative Einschließung zugleich“, und er fügt hinzu: „Widersprechend darf das Verhältnis nicht sein.“11 Wie die moderne ethisch-politische Debatte gezeigt hat, verlangt gerade diese Konkretheit der moralischen Entscheidung eine Begründung der Norm, die über die reine Vernunft hinausgeht und die Anerkennung einer emotionalen Bindung zum Anderen einschließt: eines Mitgefühls, das die Basis zu einer Entscheidung liefern kann, ohne diese notwendigerweise zu begründen. Der Akt der Freiheit – so könnte man sagen – stellt die Fähigkeit dar, dreierlei auf gleiche Weise zu berücksichtigen: die volle Anteilnahme des entscheidenden Subjekts, die Sorge für die Anderen, die involviert sind, und die normative paradigmatische Bedeutung erga omnes der Entscheidung selbst. Die Weise, auf die es der Moral gelingt, das zu tun, was gemacht werden soll, hat Ähnlichkeiten mit dem Vorgehen der Kunst. Wie diese trifft die Moral Entscheidungen auf Grund von Regelungen, die ihr jedoch niemals eine einfache Ableitung erlauben. Man braucht ein ganzes Leben, um im richtigen Moment die richtige Entscheidung zu treffen – gerade dort, wo es nicht nur darum geht, Normen anzuwenden, sondern darum, ein neues Feld zu betreten. Selig ist das Leben, wenn es dem Ernstfall nicht begegnen muss. Aber es ist selig, auch weil es sich darauf vorbereitet hat. Manchmal steht es einem Schauspieler in einem Theaterstück zu, nur einen einzigen Satz auszusprechen. Selbst dieser Satz kann entscheidend sein. In jedem Fall ist er es für den, der ihn ausspricht. Hermeneutik bedeutet nicht nur Wahrheitsbegriffe zu deuten, sondern auch Zeichen der Wahrheit in Handlungen umzusetzen. Eine Berufung zur Wahrheit hat auch das Leben als Ganzes. In diesem Sinne beginnt Levinas’ erstes philosophisches Hauptwerk Totalität und Unendlichkeit mit der für die menschliche Existenz alles entscheidenden Frage: „Jeder wird uns ohne weiteres darin zustimmen, dass es höchst wichtig ist zu wissen, ob wir nicht von der Moral zum Narren gehalten werden.“12 Denn wir stehen immer vor einer moralischen Existenz, wenn wir uns vor Handlungen befinden, die der Wirklichkeit als Ganzer und jedem in ihr beteiligten Wesen gerecht werden wollen. Auch die Freiheit ist, wie die Wahrheit, nie einseitig. Sowohl die Wahrheit als auch die Freiheit 11 R. GUARDINI, Der Gegensatz. Versuche einer Philosophie des Lebendig-Konkreten, Grünewald/Schöning, Mainz, Paderborn 1998, S. 81, 83. 12 E. LEVINAS, Totalität und Unendlichkeit. Versuch über die Exteriorität, hg. von N. Krewani, Alber Verlag, München/Freiburg, 2002 (1. Aufl. 1961), S. 19. 13 pflegen und schützen alles, was um sie herum ist, und sorgen dafür, dass es wächst. Ethos ist die Heimat, aus der ich komme und wo ich lebe; das Gebot, wie Vico sagen würde, ist wie ein Donnergrollen, das unsere Augen zum Himmel erhebt; und die Moral ist die bewegliche Schwelle, die das Haus für alle bewohnbar macht und seine Grenzen bis in den Himmel hinein erweitert. Die Moral produziert nicht das Gute, eigentlich sucht sie nicht einmal danach. Das Gute ist schon da im Leben, jedoch immer vermischt mit den Bedürfnissen und Wünschen. Die Moral ist die Fähigkeit, das Gute zu entdecken und zu schützten. Sie gibt dem Lebenden eine neue Orientierung, die aber keine Norm im engen Sinne ist, sondern vielmehr die Erschließung neuer geistiger Möglichkeiten. Menschen können auch ohne diese moralische Orientierung mit ihrem Leben fertig werden, ihnen (uns) können Ethos, Recht, Politik, Bräuche und gute Manieren reichen. Jedoch wären all diese Dinge kein Ausdruck des Geistes, wenn sie nicht von einer Dringlichkeit durchherrscht würden, die das Siegel des menschlichen Lebens selbst ist und die uns zeigt und immer wieder vor Augen führt, dass gerade dieses endliche, flüchtige menschliche Leben eine Art Abbreviatur der Wahrheit ist. 14