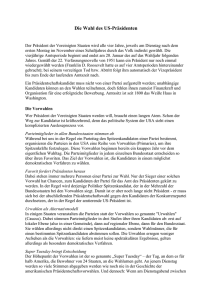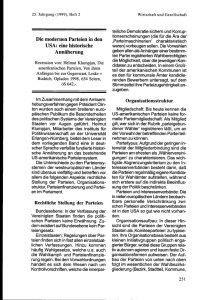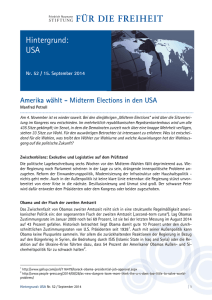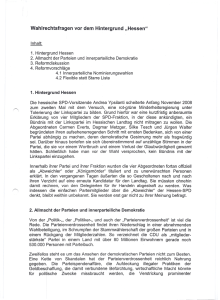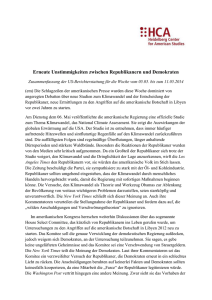Datei herunterladen
Werbung
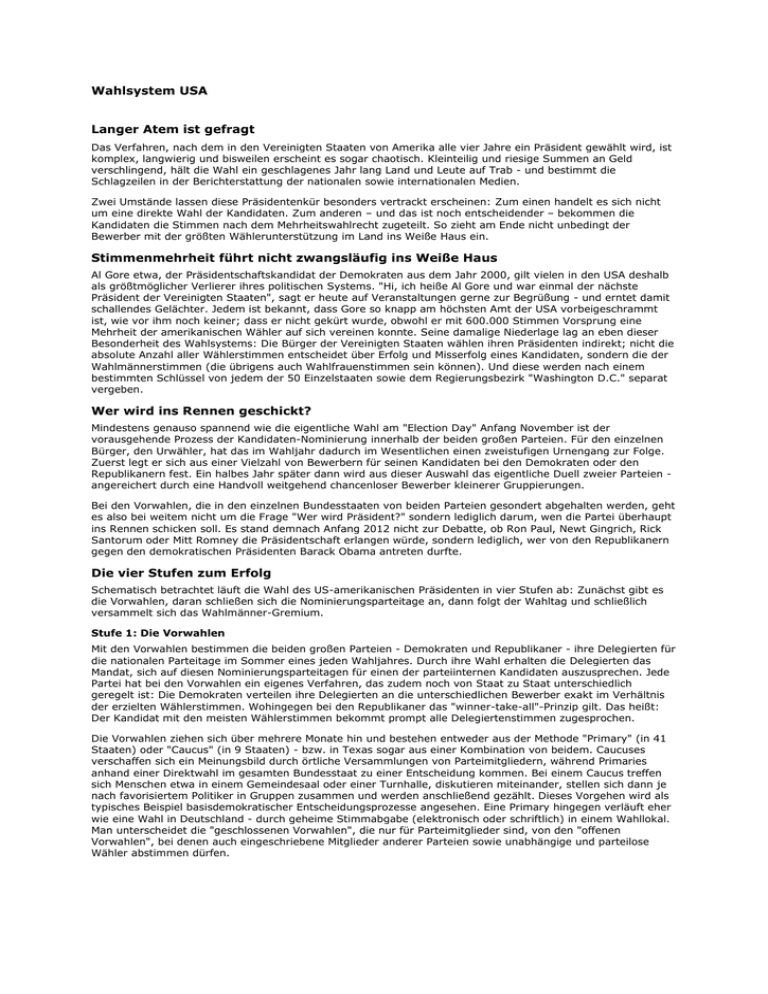
Wahlsystem USA Langer Atem ist gefragt Das Verfahren, nach dem in den Vereinigten Staaten von Amerika alle vier Jahre ein Präsident gewählt wird, ist komplex, langwierig und bisweilen erscheint es sogar chaotisch. Kleinteilig und riesige Summen an Geld verschlingend, hält die Wahl ein geschlagenes Jahr lang Land und Leute auf Trab - und bestimmt die Schlagzeilen in der Berichterstattung der nationalen sowie internationalen Medien. Zwei Umstände lassen diese Präsidentenkür besonders vertrackt erscheinen: Zum einen handelt es sich nicht um eine direkte Wahl der Kandidaten. Zum anderen – und das ist noch entscheidender – bekommen die Kandidaten die Stimmen nach dem Mehrheitswahlrecht zugeteilt. So zieht am Ende nicht unbedingt der Bewerber mit der größten Wählerunterstützung im Land ins Weiße Haus ein. Stimmenmehrheit führt nicht zwangsläufig ins Weiße Haus Al Gore etwa, der Präsidentschaftskandidat der Demokraten aus dem Jahr 2000, gilt vielen in den USA deshalb als größtmöglicher Verlierer ihres politischen Systems. "Hi, ich heiße Al Gore und war einmal der nächste Präsident der Vereinigten Staaten", sagt er heute auf Veranstaltungen gerne zur Begrüßung - und erntet damit schallendes Gelächter. Jedem ist bekannt, dass Gore so knapp am höchsten Amt der USA vorbeigeschrammt ist, wie vor ihm noch keiner; dass er nicht gekürt wurde, obwohl er mit 600.000 Stimmen Vorsprung eine Mehrheit der amerikanischen Wähler auf sich vereinen konnte. Seine damalige Niederlage lag an eben dieser Besonderheit des Wahlsystems: Die Bürger der Vereinigten Staaten wählen ihren Präsidenten indirekt; nicht die absolute Anzahl aller Wählerstimmen entscheidet über Erfolg und Misserfolg eines Kandidaten, sondern die der Wahlmännerstimmen (die übrigens auch Wahlfrauenstimmen sein können). Und diese werden nach einem bestimmten Schlüssel von jedem der 50 Einzelstaaten sowie dem Regierungsbezirk "Washington D.C." separat vergeben. Wer wird ins Rennen geschickt? Mindestens genauso spannend wie die eigentliche Wahl am "Election Day" Anfang November ist der vorausgehende Prozess der Kandidaten-Nominierung innerhalb der beiden großen Parteien. Für den einzelnen Bürger, den Urwähler, hat das im Wahljahr dadurch im Wesentlichen einen zweistufigen Urnengang zur Folge. Zuerst legt er sich aus einer Vielzahl von Bewerbern für seinen Kandidaten bei den Demokraten oder den Republikanern fest. Ein halbes Jahr später dann wird aus dieser Auswahl das eigentliche Duell zweier Parteien angereichert durch eine Handvoll weitgehend chancenloser Bewerber kleinerer Gruppierungen. Bei den Vorwahlen, die in den einzelnen Bundesstaaten von beiden Parteien gesondert abgehalten werden, geht es also bei weitem nicht um die Frage "Wer wird Präsident?" sondern lediglich darum, wen die Partei überhaupt ins Rennen schicken soll. Es stand demnach Anfang 2012 nicht zur Debatte, ob Ron Paul, Newt Gingrich, Rick Santorum oder Mitt Romney die Präsidentschaft erlangen würde, sondern lediglich, wer von den Republikanern gegen den demokratischen Präsidenten Barack Obama antreten durfte. Die vier Stufen zum Erfolg Schematisch betrachtet läuft die Wahl des US-amerikanischen Präsidenten in vier Stufen ab: Zunächst gibt es die Vorwahlen, daran schließen sich die Nominierungsparteitage an, dann folgt der Wahltag und schließlich versammelt sich das Wahlmänner-Gremium. Stufe 1: Die Vorwahlen Mit den Vorwahlen bestimmen die beiden großen Parteien - Demokraten und Republikaner - ihre Delegierten für die nationalen Parteitage im Sommer eines jeden Wahljahres. Durch ihre Wahl erhalten die Delegierten das Mandat, sich auf diesen Nominierungsparteitagen für einen der parteiinternen Kandidaten auszusprechen. Jede Partei hat bei den Vorwahlen ein eigenes Verfahren, das zudem noch von Staat zu Staat unterschiedlich geregelt ist: Die Demokraten verteilen ihre Delegierten an die unterschiedlichen Bewerber exakt im Verhältnis der erzielten Wählerstimmen. Wohingegen bei den Republikaner das "winner-take-all"-Prinzip gilt. Das heißt: Der Kandidat mit den meisten Wählerstimmen bekommt prompt alle Delegiertenstimmen zugesprochen. Die Vorwahlen ziehen sich über mehrere Monate hin und bestehen entweder aus der Methode "Primary" (in 41 Staaten) oder "Caucus" (in 9 Staaten) - bzw. in Texas sogar aus einer Kombination von beidem. Caucuses verschaffen sich ein Meinungsbild durch örtliche Versammlungen von Parteimitgliedern, während Primaries anhand einer Direktwahl im gesamten Bundesstaat zu einer Entscheidung kommen. Bei einem Caucus treffen sich Menschen etwa in einem Gemeindesaal oder einer Turnhalle, diskutieren miteinander, stellen sich dann je nach favorisiertem Politiker in Gruppen zusammen und werden anschließend gezählt. Dieses Vorgehen wird als typisches Beispiel basisdemokratischer Entscheidungsprozesse angesehen. Eine Primary hingegen verläuft eher wie eine Wahl in Deutschland - durch geheime Stimmabgabe (elektronisch oder schriftlich) in einem Wahllokal. Man unterscheidet die "geschlossenen Vorwahlen", die nur für Parteimitglieder sind, von den "offenen Vorwahlen", bei denen auch eingeschriebene Mitglieder anderer Parteien sowie unabhängige und parteilose Wähler abstimmen dürfen. Stufe 2: Die Nominierungsparteitage Im Spätsommer bestimmt jede Partei auf den großen nationalen Nominierungsparteitagen für sich ihren Kandidaten für die anstehende Wahl. Bei den Demokraten wählen 4.049 Delegierte, bei den Republikanern knapp 2.380. Die meisten von ihnen, etwa vier Fünftel, sind durch die Vorwahlen auf einen Namen festgelegt. Zünglein an der Waage bei dieser Entscheidungsfindung sind die so genannten Super- beziehungsweise Unverpflichteten Delegierten; das sind typischerweise Kongressmitglieder, Gouverneure sowie Vertreter des Parteiapparates. Sie haben die Freiheit, sich ohne Auflagen erst auf dem Parteitag für einen der Bewerber zu entscheiden. In der Praxis aber haben auch sie sich häufig schon während der Vorwahlen für einen Kandidaten ausgesprochen, so dass es selten zu Überraschungen auf diesen Parteitagen kommt. Der designierte Präsidentschaftskandidat sucht sich nach seiner Nominierung dann diejenige Person aus, die von der Partei als Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten ("Running Mate") in die Wahl geschickt werden soll. Stufe 3: Der Wahltag Sind die Präsidentschaftskandidaten nominiert, beginnt die heiße Phase des Wahlkampfs, in der die Präsidentenbewerber vor allem die Wähler in den bevölkerungsreichen Staaten zu gewinnen suchen. Denn dort gibt es für sie die meisten Wahlmännerstimmen zu holen. Auf der dritten Stufe der Präsidentschaftswahl, am Wahltag, gilt nämlich wieder das Prinzip der einfachen Mehrheit ("winner-take-all"): Ein Kandidat benötigt pro Bundesstaat lediglich eine Wählerstimme mehr als irgendeiner seiner Mitbewerber - und es werden ihm direkt alle Wahlmännerstimmen dieses Staates zugesprochen. Sowohl die Wählerstimmen für die unterlegenen Kandidaten als auch die Stimmen, die über das unabdingbare Minimum zur Erreichung eines Mandats hinausgehen, spielen bei der Ermittlung des Wahlergebnisses danach keine Rolle mehr. Und genau das ist auch der Grund, warum Al Gore im Jahr 2000 gegen George W. Bush den Kürzeren zog - trotz zahlenmäßig größerer Unterstützung in der Bevölkerung. Das Kuriose an diesem Wahlsystem ist also: Gelingt es einem der Kandidaten die elf bevölkerungsreichsten Staaten für sich zu entscheiden, verfügt er bereits über eine Mehrheit der 538 Wahlmännerstimmen. Damit würde er neuer amerikanischer Präsident werden, auch wenn die anderen 39 Bundesstaaten gegen ihn votierten. "Election Day" ist für die US-Amerikaner - einer alten Tradition folgend - immer am Dienstag nach dem ersten Montag im November. Am Ende dieses Tages steht der Sieger häufig bereits fest. Stufe 4: Das Wahlmänner-Gremium Doch erst mehr als einen Monat später - genauer gesagt am Montag nach dem zweiten Mittwoch im Dezember treten die Wahlmänner zusammen, um nun formal für Präsident und Vizepräsident zu stimmen. Allerdings versammelt sich das Wahlmänner-Gremium nicht an einem zentralen Ort, sondern kommt einzeln in den 50 Bundesstaaten sowie in der Hauptstadt Washington D.C. zusammen. Unterschrieben, versiegelt und beglaubigt werden die Wahlmänner-Stimmen dann an den Senatspräsidenten und den Archivar der Vereinigten Staaten am Regierungssitz verschickt. Erst jetzt hat der fast einjährige Auswahlprozess ein Ende gefunden, und der neue Präsident ist offiziell bestimmt. Politische Positionen Hillary Rodham Clinton Donald J. Trump Partei Demokraten Republikaner Enge Partnerschaft mit EU und Nato Ja nicht zwingend Beziehungen zu Russland belastet unbelastet US-Bodentruppen im Anti-Terror-Kampf Nein Nein Atom-Deal mit dem Iran Ja Nein Freihandel Ja Nein Legalisierung und Integration illegaler Migranten Ja Nein Aufnahme von Flüchtlingen Ja Nein Klimaschutz Ja Nein Obamacare ausbauen ersetzen Strengere Waffengesetze Ja Nein Abschaffung der Todesstrafe Nein Nein Steuererhöhung für Reiche Ja Nein, ausser für HedgefondsManager Steuerliche Entlastung von Geringverdienern Ja Ja Homo-Ehe Ja Nein Abtreibung Persönlich dagegen, soll aber Nur bei Vergewaltigungen, Entscheidung jeder Frau sein Inzest, oder Gefahr für die Mutter