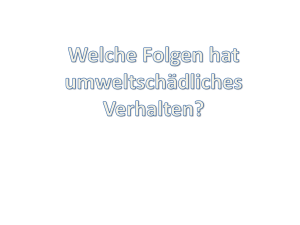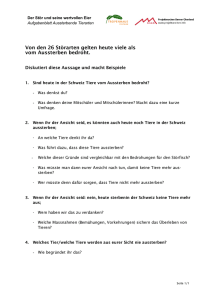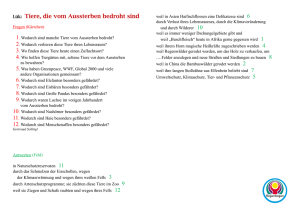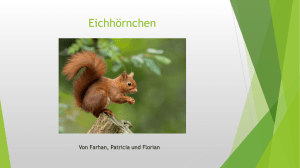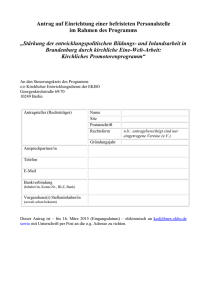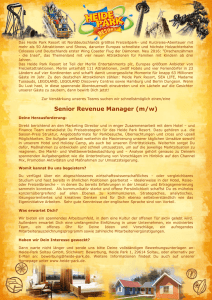Beitrag-biol.Vielfalt-UN.Dekade - UN
Werbung

Das Wildnisgroßprojekt der Heinz Sielmann Stiftung (HSS) in der Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide. Ein Beitrag zur Erhöhung der biologischen Vielfalt: 1. Einleitung In unserer heutigen Kulturlandschaft gehen mehr und mehr natürliche Offenlandschaften mit ihren charakteristischen, oftmals seltenen Tier- und Pflanzenarten verloren. Sie sind, abgesehen von Sonderstandorten wie z. B. dem Wattenmeer, einzelnen Hochmooren oder den hochalpinen Regionen, zu einer absoluten Seltenheit in Deutschland geworden. Wo früher durch unkontrollierte Brände große halboffene und offene Strukturen entstanden, Fließgewässer ungehindert über ihre Ufer treten durften und Sturm- oder Schneebruchereignisse große Lücken in Wäldern hinterließen, konnten große Pflanzenfresser diese Flächen über teils lange Zeiträume als Nahrungsgrundlage nutzen und so offenhalten, bevor sich offene Strukturen über anfängliche Pionierstadien wieder zu Schlusswaldgesellschaften entwickelten. Heutzutage werden Waldbrände unverzüglich gelöscht, Flüsse oft begradigt und eingedeicht und Blößen im Wald oftmals wieder aufgeforstet. Die ursprünglich beheimatete Anzahl großer Pflanzenfresser (Großherbivoren) ist nur noch mit wenigen Arten, häufig inselartig isoliert, natürlicherweise vertreten. Unabhängig davon, ob das spontane Auftreten dieser offenen Landschaftsstrukturen ihre Ursachen in biotischen oder abiotischen Prozessen finden, schließt sich gegenwärtig viel zu oft ein sofortiges „Management“ für diese Flächen an, um sie möglichst schnell wieder einer wirtschaftlichen Nutzung zuzuführen. Umso wichtiger erscheinen daher Projekte, die dynamische Prozesse soweit als möglich zulassen und sich um einen dauerhaften Erhalt großer, unzerschnittener offener und halboffener Landschaftsstrukturen und naturnaher Wälder bemühen, um auch den dort speziell angepassten Organismen einen entsprechenden Lebensraum zu erhalten. In Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide werden große Teile des ehemaligen TÜP „Döberitz“ von den Naturschutzgebieten (NSG) „Döberitzer Heide“ und „Ferbitzer Bruch“ eingenommen. Das beide NSG umfassende Areal stellt eine EU-weit einmalige Kombination biologischer, landschaftsökologischer und geomorphologischer Besonderheiten dar, wobei das NSG Döberitzer Heide überwiegend die höher gelegenen trockeneren und das NSG Ferbitzer Bruch mehr die tiefer gelegenen nasseren Bereiche repräsentiert. Außerdem sind nahezu alle Bereiche der Heide als FFH Gebiet im Rahmen Natura 2000 gemeldet und als Vogelschutzgebiet mit europäischer Bedeutung (SPA) ausgewiesen sowie als Important Bird Area (IBA) benannt. Fokus des Wildnisgroßprojektes der Heinz Sielmann Stiftung ist es, neben dem wesentlichen Beitrag zum Arterhalt von Wisent und Przewalskipferd, insbesondere den hohen Flächenanteil an Offenland - Lebensraumtypen (LRT) dauerhaft zu erhalten. Dazu erhält die HSS auch Unterstützung aus dem Landesamt für Umwelt (LfU) Brandenburg. Da ehemalige TÜP immer eine latente Gefahr von Restmunition bergen, schied - im Gegensatz zur weniger belasteten Ringzone - im Kernbereich der Döberitzer Heide eine Nutztierbeweidung mit Rindern, Schafen oder Ziegen aufgrund der veterinärmedizinischen Vorgaben, Kennzeichnungspflichten und Kontrollen weitgehend aus. Gleiches galt überwiegend auch für Verfahren zur motormanuellen und mechanischen Offenhaltung als auch für das Brennen solcher Flächen. So wurde ein Handlungskonzept ausgearbeitet, welches den Einsatz der „wilden“ Vertreter unserer Großherbivoren als Landschaftsgestalter vorsieht. Dieser Ansatz folgt dem Grundsatz, dass sich die Tiere so weit als möglich unbeeinflusst vom Menschen ohne Zufütterung in einer 1.860 ha großen Wildniszone entwickeln können. Dabei wird eine Verschiebung der Biotopgrenzen durchaus toleriert, wenn in der Bilanz die offenen und halboffenen Strukturen auf ganzer Fläche erhalten werden können. Schließlich ist die Wildniszone nicht durch Koppeln untergliedert, und die Tiere folgen auf ganzer Fläche ihrem natürlichen Verhalten. Das heißt, sie halten sich auch vorwiegend dort auf, wo sie neben Störungsfreiheit auch die besten Nahrungsgrundlagen finden. Aktuell wird in Zusammenarbeit mit Hochschulen und dem Leibnitz Institut für Zoologie- und Wildtierforschung eine Kapazitätsgrenzermittlung der Großherbivoren realisiert, und das Projekt wird ferner mittels eines Monitorings wissenschaftlich begleitet. Im Gegensatz zur Wildniszone findet in der sogenannten Naturerlebnis-Ringzone ein Flächenmanagement mit Rindern, Pferden, Schafen und Ziegen statt, die in halbwilder Haltung auf rund 800 ha eingestellt sind (siehe Karte). 2. Ausgewählte Beiträge zur biologischen Vielfalt am Beispiel der Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide a. Säugetiere (51 Arten) Wisent (Bos bonasus): Laut IUCN weltweit als gefährdet eingestuft. Letzter frei lebender Wisent wurde verm. 1927 im Kaukasus geschossen. Heute gibt es weltweit wieder ca. 4.000 Stück, davon etwa die Hälfte in freier Wildbahn lebend. In der Döberitzer Heide stehen aktuell etwa 90 Tiere. Der Wisent benötigt ein ausgeprägtes Lebensraummosaik aus Wäldern und Offenflächen. Przewalskipferd (Equus ferus przewalskii): Einziges noch existierendes echtes Wildpferd. Laut IUCN weltweit als stark gefährdet eingestuft. Letztes frei lebendes Exemplar wurde 1969 beobachtet. Heute gibt es weltweit wieder etwa 2.500 Stück, davon nach Auswilderung wieder etwa 500 Tiere in freier Wildbahn. In der Döberitzer Heide stehen zurzeit 36 Tiere. Benötigt große offene und schütter bewachsene Lebensräume; durchstreift zur Nahrungssuche aber auch lichte Wälder. Rothirsch (Cervus elaphus): In der Döberitzer Heide mit etwa 120 Tieren vertreten. Bevorzugt abwechslungsreichen Lebensraum mit Wald, Halboffen- und Offenland, wo es ursprünglich beheimatet war. Wolf (Canis lupus): In Deutschland als vom Aussterben bedroht eingestuft. Durchstreift die Döberitzer Heide immer wieder in mehreren Populationen – hat hier aber wegen der für ein Rudel zu großen Flächenansprüche bisher keine Sesshaftigkeit entwickelt. Gemäß der FFH-Richtlinie in den Anhängen II (speziell zu schützender Lebensraum) und IV (streng geschützte Art) gelistet. Fischotter (Lutra lutra): In Deutschland gefährdet und ist gemäß der FFHRichtlinie im Anhang II enthalten. Bevorzugt naturnahe und klare WasserLebensräume mit Fischreichtum – nimmt auch andere kleine Beute. Wird außerdem in Landlebensräumen beobachtet. Probleme entstehen dabei beim Wechsel über Verkehrstrassen. Biber (Castor fiber): Befindet sich deutschlandweit auf der Vorwarnliste und ist gemäß der FFH-Richtlinie im Anhang II enthalten. Hat sich im Gebiet entlang eines großen Grabensystems mit Anschluss an die Havel und naturnahen Umgebungsbiotopen ausgebreitet. Fledermäuse: Im Gebiet 12 Arten, darunter das in Deutschland auf der Vorwarnliste stehende Große Mausohr (Myotis myotis). Gemäß der FFHRichtlinie im Anhang II (speziell zu schützender Lebensraum) aufgeführt. Vom Großen Mausohr erhöhen sich die Stückzahlen von Jahr zu Jahr. Einen wichtigen Beitrag dazu bilden die zahlreichen als Winterquartiere ausgebauten Bunkeranlagen und die abwechslungsreiche (Hutungs-) Landschaft mit einem vielfältigen Angebot an Großinsekten. b. Vögel (198 Arten, davon 119 Brutvogelarten) Wiedehopf (Upupa epops): Deutschlandweit stark gefährdet und gelistet in der Vogelschutzrichtlinie. Im Gebiet, welches im Land Brandenburg für die Art als Schwerpunkt der Verbreitung gilt, bis zu 11 Reviere und etwa 5-6 Brutpaare nachgewiesen. Benötigt strukturreiche, wärmegetönte Offenund Halboffenlandschaften. Dabei sind kurz oder spärlich bewachsene Bereiche zur Nahrungsaufsuche erforderlich – aufgenommen werden vor allem größere Insekten am Boden. Diese besonderen Lebensraumansprüche werden durch extensive Beweidung, vor allem mit Schafen und Ziegen und dem Einsatz der Großherbivoren befördert. Zur Brut sind zusätzlich Baumhöhlen oder Nischen am Boden, z. B. durch Ablagerung von Baumstämmen oder alten militärischen Gebäuderesten, erforderlich. Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria): Gelistet in der Vogelschutzrichtlinie. Von Anfang der 90er Jahre mit 250 Revieren, daher gilt bzw. galt das Gebiet als Vorkommensschwerpunkt für die Art im Land Brandenburg, noch etwa 80 sind aktuell davon erhalten geblieben. Charakteristische Art extensiv beweideter, halboffener und eher frischer bis feuchter Standorte. Schließung der Gehölzbestände und Bewaldung würden zum Verschwinden der Art führen. Ziegenmelker (Caprimulgus europaus): Deutschlandweit gefährdet und gelistet in der Vogelschutzrichtlinie. Bis zu 25 singende Männchen. Benötigt lichte Wälder bzw. Vorwälder mit trockenem Heidecharakter. Große Rohrdommel (Botaurus stellaris): Bis zu 8 singende Männchen registriert. Deutschlandweit stark gefährdet und gelistet in der Vogelschutzrichtlinie. Braucht großflächige, ungestörte Wasserröhrichte und ein abwechslungsreiches Nahrungsangebot. Kranich (Grus grus): Gelistet in der Vogelschutzrichtlinie Bis etwa 10 Brutpaare. Vor allem in den zahlreichen Feuchtwiesen und Mooren. Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe): Deutschlandweit vom Aussterben bedroht! Förderung im Gebiet durch spezielle Schutzmaßnahmen - oft im Zusammenhang mit Kompensationsmaßnahmen. Zahlreiche Brutpaare im Gebiet und wohl eine der individuenstärksten Vorkommen im Land Brandenburg. Benötigt kurzrasige und vegetationsfreie Sandoffenflächen sowie Brutmöglichkeiten, wie Steinhaufen. Wird durch Schaf- und Ziegenbeweidung und den Einsatz von Großherbivoren (z. B. durch Wälzen im Sand) gefördert. Heidelerche (Lullula arborea): Gelistet in der Vogelschutzrichtlinie. Gehört mit bis zu 130 Revieren zu den charakteristischen Arten des Gebietes und kommt in lichten Vorwäldern mit Heidecharakter vor. Ist deutschlandweit in der Vorwarnstufe gelistet. c. Reptilien / Amphibien (16 Arten) Zauneidechse (Lacerta agilis): Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie. Die Zauneidechse kommt im Gebiet in nahezu allen Offen- und Halboffenlandschaften trockener bis frischer Standorte vor. Ist deutschlandweit in der Vorwarnliste enthalten. Profitiert von Entkusselungs-Maßnahmen und damit von der Wiederherstellung von Offenlandschaften. Rotbauchunke (Bombina bombina): Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie. Die Rotbauchunke ist deutschlandweit als stark gefährdet eingestuft. Besitzt individuenstarke Vorkommen in den zahlreichen Klein- und Kleinstgewässern sowie Überschwemmungsbereichen. Profitiert von der Mahd überschwemmungsgefährdeter Nasswiesen und der Schaffung neuer Kleingewässer sowie auch von Entkusselungs-Maßnahmen. d. Insekten Käfer (mehr als 1.700 Arten, davon 22 deutschlandweit vom Aussterben bedrohte und 103 stark gefährdete Arten): 15 der 22 deutschlandweit vom Aussterben bedrohte Käferarten des Gebietes sind Bewohner alter Wälder, wie sie sich vor allem in der Wildniszone darstellen. Zu nennen wäre beispielhaft der Eremit (Osmoderma eremita) – Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie – mit zahlreichen Nachweisen in alten Bäumen (Linde und Eiche). Heuschrecken (36 Arten): Im Gebiet kommt zum Beispiel die Blauflügelige Sandschrecke (Sphingonotus caerualans) in offensandigen Bereichen vor – sie dürfte durch spezielle Pflegemaßnahmen (Befahren und Freilegen von Dünen und offenen Sandflächen) und den Einsatz der Großtiere (z. B. durch Wälzen im Sand) profitieren. Der Sumpf-Grashüpfer (Chorthippus montanus) findet sich im feuchten, extensiv genutzten Grünland. Beide genannte Heuschreckenarten sind im Land Brandenburg gefährdet. Stechimmen – Bienen (200 Arten) und Wespen (280 Arten): Die hohe Artenzahl wird in Berlin-Brandenburg in keinem anderen Gebiet erreicht. Deutschlandweit sind 3 Arten vom Aussterben bedroht und 10 Arten stark gefährdet. Genannt sei Euchroeus purpuratus, eine deutschlandweit vom Aussterben bedrohte Goldwespenart. Schmetterlinge (1.000 Arten Groß- und Kleinschmetterlinge): Als Beispiel sei von den Großschmetterlingen der deutschlandweit vom Aussterben bedrohte Eisenfarbige Samtfalter (Hipparchia statilinus) genannt. Diese Art benötigt offene, maximal schütter bewachsene Sandstellen und Dünen. Von den Kleinschmetterlingen sei der Silberfleck-Spreizflügel (Tebenna bjerkandrella) genannt, von dem bisher im Land Brandenburg bisher nur zwei Nachweise erbracht werden konnten. Die Raupe frisst nur an Weidenblättrigem Alant (Inula salicina) – einer im Land Brandenburg stark gefährdeten Pflanzenart des extensiv genutzten Offenlandes. e. Spinnen und andere Gliederfüßer, Mollusken Urkrebse: 2 Arten – Sommer-Feenkrebs (Branchipus schaefferi), in Deutschland vom Aussterben bedroht, und Triops (Triops cancriformis), in Deutschland stark gefährdet. Benötigt temporäre Wasseransammlungen, die sich in Fahrspuren und in Tiersuhlen erhalten. Noch zahlreiche f. Vorkommen auf der gesamten Fläche vorhanden. Förderprojekt durch das BfN und dabei Schaffung zahlreicher neuer feuchter Senken mit Etablierung neuer Urkebsvorkommen. Rote Röhrenspinne (Eresus niger): Wärmeliebende und deutschlandweit stark gefährdete Art der Trockenrasen. Sowohl die extensive Pflege mit Nutztieren als auch der Einsatz der Großherbivoren trägt zur Offenhaltung der Landschaft und damit auch zum Erhalt der Trockenrasen bei und ermöglicht letztendlich das Überleben der Roten Röhrenspinne. Dreizähnige Turmschnecke (Chondrula tridens): In Deutschland vom Aussterben bedroht. Einziges zurzeit bekanntes Vorkommen im Land Brandenburg. Benötigt extensiv genutzte trockene und kalkreiche offene und halboffene Hutungen. Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior): Im Anhang II der FFHRichtlinie gelistet. Deutschlandweit gefährdet – die Art kommt vor allem in nassen Wiesen vor. Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana): Im Anhang II der FFHRichtlinie gelistet. Deutschlandweit stark gefährdet – die Art kommt vor allem in nassem Offenland vor. Pflanzen (900 Arten) und Kryptogamen (Moose: 200 Arten, Flechten: 100 Arten, Pilze: 600 Arten) Sumpfknabenkraut (Orchis palustris): Benötigt nasse und nährstoffarme Grünland-Moore, die extensiv genutzt und einschürig gemäht werden. Im Gebiet individuenreiches Vorkommen. Deutschlandweit stark gefährdet. Weißes Fingerkraut (Potentilla alba): In Brandenburg stark gefährdet. Art der lichten Wälder und Säume sowie Hutungen. Graue Skabiose (Scabiosa canescens): In Brandenburg stark gefährdet. Kalk- und wärmeliebende Art der lichten Wälder und Hutungen. Deutschland besitzt eine hohe Verantwortung bei der Erhaltung der Art, da die Graue Skabiose hier eines ihrer Verbreitungsschwerpunkte hat. Bryoria implicior: Erstnachweis für Deutschland. Diese Flechtenart benötigt lichte, halboffene Wälder und Säume sowie Hutungen. Braungrüner Zärtling (Entoloma incanum): Im Land Brandenburg vom Aussterben bedrohte Pilzart – benötigt nährstoffarmes, extensiv beweidetes Grünland. Schonener Goldhaarmoos (Orthotrichum scanicum): Einziger Fundort im Land Brandenburg. Nur wenige Fundorte in Deutschland. Weltweit vom Aussterben bedroht. Benötigt lichte, halboffene Wälder und Säume sowie Hutungen.