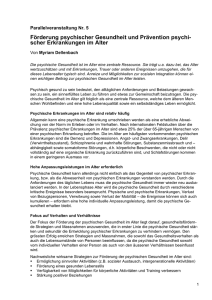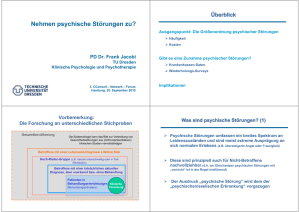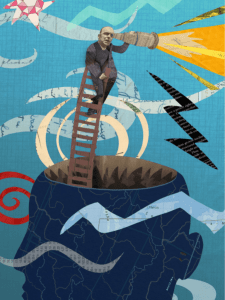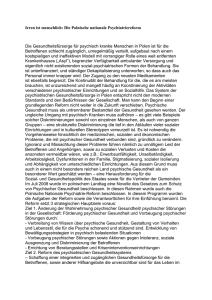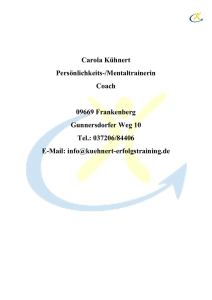READ - Psychologische Hochschule Berlin
Werbung

22 Ausgabe 5/12, 15. Jahrgang PSYCHISCHE STÖRUNGEN Der Hype um die kranke Seele Illustration: Oliver Weiss K Die Deutschen – ein Volk von psychisch Kranken? Depression und Burnout – eine Epidemie des 21. Jahrhunderts? Für solche Befunde besteht kein Grund, ist Frank Jacobi überzeugt. Psychische Erkrankungen gehörten schon immer zum Leben dazu – so wie körperliche auch. Sie werden heute nur öfter als solche wahrgenommen und diagnostiziert. aum ein Monat vergeht, in dem die Öffentlichkeit nicht über die Zunahme psychischer Störungen diskutiert. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Krankenkassen seit Mitte der 1990er Jahren einen Zuwachs psychischer Diagnosen verzeichnen. Darüber hinaus verbreiten sich immer stärker Ergebnisse aus epidemiologischen und gesundheitsökonomischen Bevölkerungsstudien, aus denen Umfang und Kosten psychischer Störungen hervorgehen. Diese Faktoren mögen auch dazu beigetragen haben, dass die Europäische Kommission die Losung „Keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit“ ausgegeben hat. Ein bio-psycho-soziales Verständnis von Gesundheit findet sich zwar bereits seit rund 60 Jahren in der Verfassung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Dort ist Gesundheit als ein „Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens“ und nicht nur als das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen definiert. Richtig angekommen ist das Thema im öffentlichen Bewusstsein aber wohl erst in jüngerer Zeit. Breites Spektrum an Leiden. Psychische Störungen umfassen ein breites Spektrum an Leidenszuständen und sind meist eine extreme Ausprägung eines an sich normalen Erlebens wie Angst Ausgabe 5/12, 15. Jahrgang oder Traurigkeit. Psychische Störungen sind prinzipiell auch für NichtBetroffene nachvollziehbar – ein Gleichsetzen mit „verrückt“ ist in der Regel irreführend. Unter dem Begriff psychische Störungen werden im Folgenden die Diagnosen aus dem Kapitel F der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) verstanden, in dem psychische und Verhaltensstörungen aufgeführt sind. Dort sind alle Diagnosen hinsichtlich ihrer Merkmale und Zusatzkriterien konkret beschrieben, so dass sie alle beteiligten Berufsgruppen verstehen. Ein Beispiel: Jeder Mensch kennt Zeiten von Niedergeschlagenheit und Erschöpfung und hat sich irgendwann schon einmal „depressiv“ gefühlt. Für die Diagnose einer Depression müssen allerdings mehrere Kriterien gleichzeitig erfüllt sein, die beileibe nicht auf jeden zutreffen. Außerdem muss eine deutliche Veränderung gegenüber dem Normalzustand einer Person erkennbar sein: Das ist dann der Fall, wenn der betroffene Patient mindestens 14 Tage lang fast ununterbrochen unter einer gedrückten Stimmung und großer Antriebslosigkeit leidet. Zusätzlich gesellen sich drei weitere depressionstypische Symptome hinzu. Diese betreffen sowohl körperliche Aspekte wie etwa die Beeinträchtigung des Schlafes oder des Appetits als auch psychische Aspekte wie Gefühle von Wertlosigkeit oder wiederkeh- 23 Früher war es Rücken­ schmerz – heute stellt der Arzt korrekter­ weise eine psychische Störung dahinter fest. rende Gedanken an Suizid. Die genannten Symptome verursachen in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Einschränkungen bei den Betroffenen. Sie dürfen nicht mit einfacher Trauer – ausgelöst beispielsweise durch den Verlust einer geliebten, nahestehenden Person – oder durch einen medizinischen Krankheitsfaktor erklärbar sein. Zum Krankheitsbild Depression zählt auch nicht, was Experten einer bipolaren Störung („manischdepressiv“) zuordnen. Wahre Häufigkeit versus Inanspruchnahme. Solchen Kriterien entsprechend, können psychische Störungen in Studien mit diagnostischen Instrumenten wie strukturierten Interviewleitfäden abgefragt werden, um so die Häufigkeit (Prävalenz) über einen bestimmten Zeitraum hinweg zu ermitteln. Übrigens ist die Zuverlässigkeit (Reliabilität) solcher Diagnosestellung durchaus befriedigend und oftmals höher als bei manchen organischen Befunden – obwohl hier in der Regel keine „objektiven“ Laborparameter vorhanden sind. Wenn Gesundheitseinrichtungen oder Kostenträgern derartige Daten aber nicht in Feldstudien, sondern über vorhandene Routinestatistiken erheben, dann ist zu beachten, dass in diesen Fällen die Repräsentativität eingeschränkt ist: Nur ein gewisser Teil derjenigen, die die Kriterien für eine psychische Störung erfüllen, sucht aktiv eine Behandlung auf und setzt damit das Behandlungsangebot auch adäquat um. Es gibt demzufolge einen „Inanspruchnahme-Bias“, der nicht allein vom Schweregrad oder der klinischen Bedeutsamkeit des Falles, sondern auch von anderen Faktoren abhängt. Hierzu zählt beispielsweise ein aktives und informiertes Gesundheitsverhalten auf Patientenseite, das wiederum oft mit Alter, Bildung oder Geschlecht zusammenhängt. Ob Ärzte und Therapeuten Betroffene als psychisch krank erkennen und behandeln, ist auch von der individuellen lokalen Praxis des jeweiligen klinischen Alltags hinsichtlich Diagnostik, Indikationsstellung und Angebotssituation abhängig. Daher sind wahre Häufigkeit – basierend auf Schätzungen aus Bevölkerungsstudien – und Inanspruchnahme beziehungsweise Versorgungsaspekte – basierend auf administrativen Statistiken – getrennt darzustellen. Krankheitstage wegen Depression & Co. gestiegen. Die Entwick- lung der Krankheitsstatistiken veranlasste die Kassen, gesonderte Schwerpunkt-Analysen anzustellen, die zur verstärkten Würdigung psychischer Störungen beitragen. Es zeigte sich: Krankschreibungen wegen psychischer Diagnosen nehmen spätestens seit Mitte der 1990er Jahre zu – und zwar entgegen dem allgemeinen Trend, wonach Arbeitsunfähigkeitstage (AUTage) in vielen anderen Krankheitsgruppen abnehmen. Auch bei den Frühverrentungen stieg der Anteil der psychischen 24 Störungen an – mittlerweile zählen sie zu den häufigsten Diagnosen. Die hohe Zahl der Fehltage am Arbeitsplatz aufgrund psychischer Störungen beruht insbesondere auf einer hohen Zahl an AU-Tagen pro AU-Fall – höhere Werte gibt es nur bei Krebserkrankungen. Und ein weiterer wichtiger Aspekt: Die Zahl der AU-Tage ist bei den anderen Krankheitsarten durchschnittlich um das Dreifache erhöht, wenn (zusätzlich) auch noch psychische Störungen vorliegen. Die Folge dieser Entwicklung ist: Psychische Störungen rangieren bei den meisten Kostenträgern inzwischen mit Blick auf die Anzahl der Fehltage am Arbeitsplatz gleich hinter Muskel- und Skeletterkrankungen sowie Verletzungen und Krankheiten des Atmungssystems auf dem vierten Platz – wobei in Abhängigkeit von der Versichertenstruktur große Veränderungen zwischen den einzelnen Krankenkassen festzustellen sind: AU-Tage wuchsen besonders stark in den Dienstleistungssektoren, die erhöhte Anforderungen an den Umgang mit den eigenen Emotio­nen stellen. Außerdem finden sich deutlich erhöhte Raten bei Menschen, die ohne Arbeit sind. Befunde sind kein Artefakt. Es gibt jedoch einige Aspekte, die als Ursache für eine vermehrte Krankschreibung andere Grün- Fehltage wegen kranker Seele 100 % 5 % 90 % 95 % 80 % 7 % 88 % 70 % √ Psychische Diagnosen √ Andere Krankheitsarten 9 % 81 % 10 % 75 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 0 % 1995 2000 2005 2010 Entwicklung der Arbeitsunfähigkeitstage (AU-Tage) in Deutschland: Im Zeitraum von 1995 (100 Prozent) bis 2010 (85 Prozent) hat es einen leichten Rückgang der AU-Tage gegeben. Der Anteil psychischer Diagnosen ist im gleichen Zeitraum auf mindestens zehn Prozent gestiegen – ein im Vergleich zu anderen Krankheiten, die Arbeitsunfähigkeit nach sich ziehen, immer noch moderater Wert. Quelle: F. Jacobi Ausgabe 5/12, 15. Jahrgang Körperlich und psychisch fit im Job Arbeitschutz und Gesundheitsförderung stärker miteinander zu verzahnen– das ist ein Anliegen der Demografiestrategie „Jedes Alter zählt“, die das Bundeskabinett Ende April verabschiedet hat. Der Arbeitsschutz in den Betrieben soll künftig so ausgerichtet sein, dass nicht nur technische, sondern auch psychische Gefährdungen Berücksichtigung finden. Die Krankenkassen sollen dafür gewonnen werden, gemeinsam mit den Unternehmen Gesundheitsprogramme zu entwickeln. Die AOK unterstützt mit ihrem Service „Gesunde Unternehmen“ Betriebe bereits dabei, arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu identifizieren und abzubauen. Dazu hält die Gesundheitskasse ein speziell auf die Betriebe zugeschnittenes Maßnahmenpaket bereit. Weitere Informationen zum Thema im Internet unter: www.demografiestrategie.de; www.aok-bgf.de de als eine „echte“ Zunahme psychischer Störungen vermuten lassen. Dazu zählen die Ausdifferenzierung des Diagnosespektrums und der behandelnden Fachärzte, der Direktzugang zum Psychotherapeuten in Folge des Psychotherapeutengesetzes aus dem Jahr 1999, die verbesserte Wahrnehmung psychisch kranker Menschen durch Hausärzte und die vermehrte Akzeptanz psychischer Probleme und Symptome auf Patientenseite, insbesondere bei jüngeren Männern. Dies bedeutet freilich nicht, dass die vermehrte Diagnostik der letzten Zeit ein Artefakt ist, dass also viele Fälle in den Statistiken eigentlich „gar nicht wirklich krank“ sind. Es ist auch zu beachten, dass in der Praxis das Phänomen des Überdiagnostizierens – im Sinne von Krankschreibung aufgrund einer psychischen Störung, obwohl die diagnostischen und Schweregrad-Kriterien gar nicht erfüllt sind – weit seltener ist als das des Unterdiagnostizierens – im Sinne von Nicht-Erkennen und Nicht-Behandeln. Verlagerung hin zu psychischen Diagnosen. Der Befund, dass sich die AU-Tage bei den meisten Kassen aufgrund psychischer Diagnosen seit Mitte der 1990er Jahre – entgegen einem allgemeinen Trend bei anderen Erkrankungsarten – nahezu verdoppelt haben, wird öffentlich gerne dramatisch hervorgehoben. Indirekt wird eine Kostenexplosion, bedingt durch psychische Störungen, beschworen. Bei genauerer Betrachtung der Zahlen zeigt sich indes, dass die AU-Tage seit dem Jahr 1995 insgesamt eher ein wenig zurückgegangen sind. Gleichwohl liegt der Anteil psychischer Störungen aktuell bei zehn bis 15 Prozent, während er vor knapp 20 Jahren bei fünf bis zehn Prozent lag (siehe Abbildung „Fehlzeiten wegen kranker Seele“ auf Seite xx). Ein Anteil von zehn bis 15 Prozent ist – im Lichte der großen, in epidemiologischen Studien ermittelten Krankheitslasten betrachtet – durchaus moderat. Es ließe sich auch so formulieren: Angesichts des gesellschaftlichen Wandels, bedingt durch einen rasanten Zuwachs an kommunikativen und emotional relevanten Aufgaben im Dienstleistungsbereich sowie ein immer stärkeres Verschwimmen von Arbeit und Freizeit, sind wir heute nicht kränker, sondern anders krank. Und wahrscheinlich hat auch eine Verlagerung in Richtung psychischer Störungen als Diagnose derart stattgefunden, dass ein Teil der Betroffenen früher auch krankgeschrieben worden wäre – nur eben nicht wegen eines psychischen Leidens, sondern anders klassifiziert, das heißt Ausgabe 5/12, 15. Jahrgang beispielsweise mit dem Befund einer muskuloskelettalen Erkrankung. Psychische Störungen gehören quasi zum normalen Leben dazu – ebenso wie körperliche Erkrankungen. Dies bedeutet aber nicht, dass wir eine psychisch kranke Gesellschaft sind. Jeder Dritte ist betroffen. Gleichwohl ist das Problem der psy- chischen Erkrankungen nicht zu unterschätzen. So geht aus repräsentativen epidemiologischen Studien hervor, dass etwa jeder dritte bis vierte Erwachsene im Zeitraum eines Jahres (mindestens) eine aktuelle Diagnose aus dem Bereich der psychischen und Verhaltensstörungen erhält. Das heißt, dass im jeweils vergangenen Jahr die Kriterien für mindestens eine psychische Störung zumindest zeitweise erfüllt waren. Das Risiko, irgendwann im Laufe des Lebens von einer psychischen Störung betroffen zu sein, wird auf rund 50 Prozent geschätzt. Das bedeutet: Jeder Zweite leidet im Laufe seines Lebens mindestens einmal an einem psychischen Leiden. Die häufigsten Störungsformen sind affektive Störungen – insbesondere Depression, somatoforme Störungen (Schmerzstörung), Substanzstörungen (Alkoholabhängigkeit) sowie verschiedene Formen von Angststörungen. Psychotische Störungen wie Schizophrenie und Essstörungen wie Anorexia oder Bulimia nervosa sind zwar wenig häufige Störungsbilder. Sie gehen aber oft mit schwerwiegenden Konsequenzen und Chronizität einher (siehe Abbildung „Depression, Phobie, Schmerz“: Häufigkeit einzelner psychischer Diagnosen“ auf Seite xx). Prävalenzzahlen zu hoch angesetzt? Die quantitative Bedeutung psychischer Störungen ist mit über 15 Millionen Betroffener im Alter von 18 bis 65 Jahren in Deutschland beziehungsweise mit über 160 Millionen Betroffenen in der Europäischen Union – bezogen auf die gesamte Lebensspanne, also nicht nur die 18- bis 65-Jährigen, – bemerkenswert und nahezu doppelt so hoch wie in den frühen 1980er Jahren. Angesichts der berichteten hohen Prävalenzzahlen und dem geschätzten Lebenszeitrisiko von 50 Prozent stellt sich die Frage, ob solche Schätzungen womöglich zu hoch angesetzt sind. Frühere Studien und amtliche Statistiken, die zu deutlich niedrigeren Häufigkeiten kamen, beschränkten sich zum einen auf eine geringere diagnostische Breite – beispielsweise nur schwere Psychosen sowie Depressionen, Alkoholabhängigkeit und Suizidhandlungen. Heute – nicht zuletzt im Zuge der Weiterentwicklung moderner Diagnosesysteme – ist das untersuchte Spektrum erheblich differenziert und ausgeweitet worden. Außerdem betrachteten Statistiker früher oft nur jene Fälle, die eine 25 Depression, Phobie, Schmerz: Häufigkeit einzelner psychischer Diagnosen Depression Spezifische Phobien Somatoforme Störungen Alkoholabhängigkeit Soziale Phobie Panikstörungen Generalisierte Angststörung Agoraphobie (ohne Panik) Bipolare Störungen Psychotische Störungen Zwangsstörungen Drogenabhängigkeit Essstörungen 12-Monatsprävalenz (%) 0 6,9 % 6,4 % 6,3 % 2,4 % Im Zeitraum eines Jahres erkranken, so aktuelle Studien, im Schnitt 6,9 Prozent aller Bürger in der Euro­ päischen Union an einer Depression und durchschnittlich 6,4 Prozent an spezifischen Formen der Phobie. ­Bipolare Störungen (Schizophrenie) und Ess­störungen sind zwar weniger häufig verbreitet – dafür aber in ­ihrer Behandlung ­langwieriger und komplexer. Quelle: H.-U. Wittchen & F. Jacobi (2005) 2,3 % 1,8 % 1,7 % 1,3 % 0,9 % 0,8 % 0,7 % 0,5 % 0,4 % 1 2 3 4 5 6 7 entsprechende Behandlung erhielten. Kritiker hoher Prävalenzschätzungen führen einerseits an, dass Berichte über die Häufigkeit psychischer Störungen lediglich der Pharmaindustrie nützten. Außerdem kann offenbar nicht sein, was nicht sein darf: Die Prävalenzraten sind weitaus höher als das jeweilige Gesundheitssystem Patienten vertragen könnte. Oft schwingt der Unterton mit: „Es kann doch nicht angehen, dass jeder Zweite im Laufe seines Lebens an einer psychischen Störung leiden soll.“ Dem lässt sich allerdings entgegengehalten, dass die 12-Monatsprävalenz irgendeiner körperlichen Erkrankung im Erwachsenenalter bei über 60 Prozent liegt. Das heißt: 60 Prozent aller Erwachsenen erkranken im Laufe eines Jahres körperlich – von der Allergie über Bluthochdruck bis zur Krebserkrankung. Warum sollten Gehirn und Nervensystem seltener betroffen sein als andere, weniger komplexe Organbereiche? Im Übrigen ist bei körperlichen Erkrankungen üblicherweise eine große Variabilität hinsichtlich Schweregrad und Behandlungsbedarf zu verzeichnen, ohne dass deswegen ihre festgestellte Häufigkeit angezweifelt wird. auch meist im Zusammenhang mit psychischen Störungen auftritt, insgesamt betrachtet immer noch ein relativ seltenes Ereignis. Allerdings beginnen psychische Störungen in der Regel früher als die meisten anderen Krankheitsarten und sind nicht selten mit chronischen oder schwankenden Verläufen sowie erheblichen Belastungen und Einschränkungen verbunden. Ferner bleiben psychische Störungen immer noch vergleichsweise häufig unerkannt und unbehandelt. Daher ist der Anteil an YLD verglichen mit anderen Erkrankungen ausgesprochen hoch: 42 Prozent aller aufgrund von Krankheiten mit Behinderungen beziehungsweise Einschränkungen verbrachten Lebensjahre sind mit psychischen Störungen assoziiert. Ferner ergaben die Schätzungen der direkten und indirekten Kosten für psychische Störungen und neurologische Erkrankungen zusammen den Betrag von 800 Milliarden Euro für die gesamte Europäische Union – standardisiert auf das Jahr 2010. Dies ist mehr als bei Herz-/Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Diabetes zusammen. Kosten in Höhe von 800 Milliarden Euro. Die durch psychische durch psychische Störungen gehen übrigens weit über die Krankschreibungen hinaus. So heißt es etwa in Studien aus dem Dienstleistungsbereich, dass bei nicht krankgeschriebenen depressiven Berufstätigen die reduzierte Arbeitsleistung pro Monat mehreren Abwesenheitstagen entspricht. Und auch bei nicht oder nur teilweise Erwerbstätigen ist eine Einschränkung bei der Erfüllung von Rollenaufgaben ein entgangener Nutzen für die Gesellschaft. Ferner kann – auch wenn dies wissenschaftlich noch kaum untersucht ist – davon ausgegangen werden, dass psychische Störungen mehr noch als andere Erkrankungen das Risiko in sich tragen, dass Betroffene beruflich unter ihren Möglichkeiten bleiben, weil sie etwa aufgrund sozialer Ängste höhere Bildungsangebote oder bestimmte Karrierechancen nicht wahrnehmen. Verglichen mit den hohen monetären und nicht- Krankheiten ausgelöste Krankheitslast wird mittels Maßzahlen berechnet, welche die WHO seit Ende der 1980er Jahre im Rahmen der ersten „Burden of disease“-Studien entwickelt hat. Ziel solcher Indikatoren ist der Vergleich verschiedener Krankheitsarten über Regionen hinweg – und zwar nicht nur anhand von Säuglingssterblichkeit oder Lebenserwartung. Auch Aspekte wie verminderte Lebensqualität und Beeinträchtigung von Rollenfunktionen sind als Krankheitslast einbezogen. Hierbei schätzen Experten zum Beispiel bei den „Years lived with disability“ (YLD) die gesammelten Lebensjahre in der Bevölkerung, die mit suboptimaler Gesundheit – also Beeinträchtigungen – verbracht werden. Psychische Störungen führen zwar nur in seltenen Fällen zum Tod. Zum Beispiel ist der Suizid, wenn er 26 Seelischem Leid mehr Gewicht geben. Die indirekten Kosten Ausgabe 5/12, 15. Jahrgang monetären Kosten erscheint die Bedeutung, die psychischen Störungen in unserem Gesundheitssystem zugebilligt wird, trotz vermehrter Hinwendung immer noch nicht ausreichend zu sein. Beispielsweise betragen die Ausgaben für Psychotherapie, die laut Leitlinien eine erste Methode in der Behandlung psychischer Leiden darstellt, nur knapp fünf Prozent aller ambulanten Gesundheitsausgaben. Und im Medizinstudium widmen sich Curricula bis heute zu weit weniger als zehn Prozent dem Phänomen der psychischen Störungen und weiteren psychischen Faktoren, die auch bei körperlichen Erkrankungen relevant sind. Zunahme oder nicht? Falsche Frage! Hypothesen, dass psychische Störungen real so dramatisch zugenommen haben, wie es die Entwicklung der Kostenträger-Daten zunächst nahelegt, betreffen primär gesellschaftliche Veränderungen, insbesondere in der Arbeitswelt. Und tatsächlich haben Risikofaktoren für psychische Erkrankungen wie berufliche Leistungsorientierung, Gratifikationskrisen, mangelnde Bildungschancen oder Instabilität in vielen Lebensbereichen zugenommen. Inwiefern solche Entwicklungen aber mit veränderten Raten psychischer Störungen einhergehen, bleibt reine Spekulation – solange Experten die entsprechenden Prävalenzen nicht in derselben Population mit derselben Methodik in größeren Zeitabständen wiederholt messen. In solchen wiederholten Bevölkerungsstudien, wie sie in England, den Niederlanden oder den USA vorliegen, sind allerdings im Abstand von zehn Jahren keine Zuwächse der Prävalenz psychischer Störungen seit 1990 festzustellen. Auch wenn psychische Störungen auf der Bevölkerungsebene nicht zunehmen, gibt es allerdings bei feinerem Auflösungsgrad Subgruppen mit möglichen Steigerungsraten bei bestimmten Diagnosen. Dazu gehören etwa Depressionen und Hyperaktivitätsstörungen bei Kindern und Jugendlichen oder vermehrte psychische Störungen bei sozial benachteiligten Menschen. Kein Jahrhundert der Depression. Vor dem Hintergrund der gestiegenen Aufmerksamkeit – sowohl auf ärztlicher wie auch auf Patientenseite – und der fehlenden Hinweise auf eine steigende Prävalenz lässt sich folgende Schlussfolgerung ziehen: Psychische Störungen haben an Bedeutung gewonnen, ohne dass dies einer realen allgemeinen Zunahme entspricht. Trotz möglicher Zuwachsraten in bestimmten Subgruppen und trotz durchaus noch vorhandener Wissenslücken macht deshalb es keinen Sinn, bei psychischen und Verhaltensstörungen von einer „Epidemie des 21. Jahrhunderts“ oder einem „Age of Depression“ zu sprechen. Ganz andere Aspekte als diese Epidemie-Hypothese sind heute tatsächlich von Belang. Zu nennen ist hier insbesondere das Problem, dass die Versorgung bei psychischen Störungen – trotz relativ guter Rahmenbedingungen in Deutschland – nicht optimal ist. Im Rahmen der Zunahme-Debatte sollten übrigens auch andere Indikatoren psychischer Gesundheit in der Bevölkerung nicht aus dem Auge verloren werden: Suizidraten sinken in den zurückliegenden Dekaden kontinuierlich, Alkohol- und Nikotinkonsum haben im Schnitt ebenfalls abgenommen und die gemessene gesamtgesellschaftliche Lebensqualität verläuft erstaunlich unabhängig von gesellschaftlicher Wohlfahrt weitgehend gleich. Ausgabe 5/12, 15. Jahrgang Keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit. Auswirkungen gesellschaftlicher Trends sollten also nicht dramatisiert werden. Gewiss verändern sich Befindlichkeiten. Stressfaktoren und Unsicherheiten befinden sich stets im Wandel. Gleichzeitig finden aber auch Anpassungsprozesse statt, neue Schutzfaktoren in der Allgemeinbevölkerung greifen ebenfalls. Ferner sollte nicht unberücksichtigt bleiben, dass sich die Arbeitsbedingungen in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur verschlechtert, sondern an vielen Stellen – nicht zuletzt durch Umsetzung arbeitspsychologischer Erkenntnisse – auch verbessert haben. In einer Meta-Analyse wurde die nicht gefundene Schwankung der Bevölkerungsprävalenz psychischer Störungen über die Zeit hinweg so kommentiert: Jede Zeit hat ihre vulnerablen Individuen, die auf Stressoren mit psychischen Störungen – erkannt oder unerkannt – reagieren. Angesichts der großen Relevanz psychischer Störungen ist die ständige Frage, ob es nun eine „echte“ Zunahme gibt, im Grunde falsch. Richtig und wichtig ist dagegen die Botschaft: „Keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit“. Sie muss nicht durch drastische Überzeichnungen aufgrund einer gefühlten Zunahme psychischer Störungen gestärkt werden. Angesichts der heutigen Größenordnung ist auch ohne Zunahme Handlungsbedarf angezeigt. Anders krank als früher. Es gibt letztlich gute Argumente dafür, dass eine vermehrte Investition in psychotherapeutische und andere verhaltensbezogene Maßnahmen wie zum Beispiel bessere Anreize für Gespräche und verhaltensorientierte Interventionen im hausärztlichen Bereich dem „wahren Bedarf“ entgegenkommt. Wenn sich die erwähnten Zuwächse bei Krankenstand und Behandlung psychischer Störungen fortsetzen, dann wäre dies eher als Aufholen an den wahren Erkenntnisstand denn als Psychiatrisierung normaler Probleme zu werten. Wie bereits eingangs hinsichtlich der gestiegenen Krankheitszahlen aufgrund psychischer Diagnosen formuliert: Wir sind heute einfach anders krank als früher. Und wir können es uns angesichts unseres relativen Wohlstandes und der großen Fortschritte in der Medizin mittlerweile eher leisten, den bereits seit dem Jahre 1946 proklamierten psycho-sozialen Gesundheitsbegriff der WHO ernstzunehmen und dem psycho-sozialen Teil ein höheres Gewicht zu geben. √ Professor Dr. Frank Jacobi ist Diplom-Psychologe und lehrt an der ­Psychologischen Hochschule Berlin und an der Technischen Universität ­Dresden im Fach Klinische Psychologie. ­Kontakt: [email protected] Lese- und Webtipps · w ww.aok-bgf.de > Umfangreiche Informationen zur Betrieblichen Gesundheitsförerung und zum AOK-Service „Gesunde Unternehmen“. · Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland des Robert KochInstituts: www.rki.de > Gesundheitsmonitoring > Forschungsprojekte > Nicht übertragbare Krankheiten > DEGS-Zusatzuntersuchung „Psychische Gesundheit“ · Size, burden and cost of disorders of the brain in Europe: www.psychologie.tu-dresden.de/i2/klinische/sizeandburden.html 27