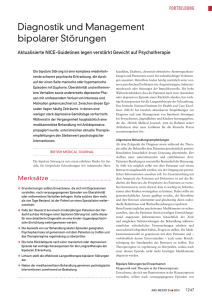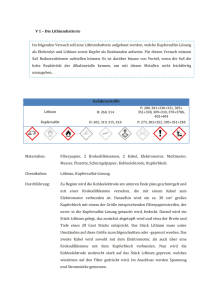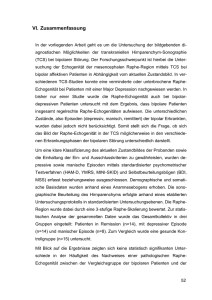bipolare störungen: neues aus der forschung 2015/2016
Werbung

BIPOLARE STÖRUNGEN: NEUES AUS DER FORSCHUNG 2015/2016 Michael Bauer, Rita Bauer, Markus Donix, Ute Lewitzka, Esther Mühlbauer, Andrea Pfennig, Maximilian Pilhatsch, Dirk Ritter, Philipp Ritter, Emanuel Severus. Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Technische Universität Dresden 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Prodromalforschung: Früherkennung bei bipolaren Störungen Vor der ersten Manie: Vergleich des Symptomprofils der ersten depressiven Episoden zwischen bipolaren und unipolaren Patienten Gestörter Schlaf als potentieller Risikofaktor für die spätere Entwicklung einer bipolaren Störung? Temperament und prodromale Symptome im Vorfeld einer ersten manischen bzw. hypomanen Episode: eine Pilotstudie Klassifikation, Diagnostik und Verlauf Progressive Abfolge klinischer Stadien in der Entwicklung bipolarer Störungen DSM-5: Bipolare Störungen DSM-5: Warum ist die Manie keine eigenständige Kategorie? Der Einfluss von Life-Events auf die erstmalige vs. wiederholte Krankenhausaufnahme aufgrund einer bipolaren Störung Herzinfarktrisiko bei bipolarer Störung: Ergebnisse einer epidemiologischen Studie 3 3.1 Suizidforschung Die suizidprophylaktischen Eigenschaften von Lithium bei Patienten mit affektiven Störungen: Übersicht 4 4.1 Epidemiologie und Komorbidität Reduziertes Schlaganfallrisiko nach Behandlung mit Lithium bei Patienten mit bipolarer Störung Typ 2 Diabetes und Prä-Diabetes bei bipolarer Störung 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6 6.1 Pharmakotherapie: Wirkungen und Nebenwirkungen Renale Nebenwirkungen von Lithium: Ergebnisse einer longitudinalen Untersuchung Entwicklung chronischer Nierenerkrankung unter Lithium und Antikonvulsiva: Ergebnisse einer dänischen Registerstudie Langzeitbehandlung mit Lithium: Risiko für Nierentumore? Schilddrüsenfunktion bei Langzeit Lithium-behandelten bipolaren Patienten: eine Querschnittsstudie Symptomatik und Therapie der Lithium Intoxikation Placebo-kontrollierte Studie einer Zusatztherapie mit Armodafinil bei Depression im Rahmen einer Bipolar-I-Störung Einnahme von Nahrungsergänzungsstoffen bei Patienten mit bipolarer Störung Psychologische Faktoren und IT-basierte Interventionen Die Bedeutung von Lebensereignissen und psychologischen Faktoren hinsichtlich des Beginns von ersten und wiederkehrenden affektiven Episoden bei Kindern von bipolar Erkrankten: Ergebnisse der Seite 2 6.2 6.3 2.7 Niederländischen Studie Stimmungsschwankungen bei Bipolar-I versus Bipolar-II Störungen: kontinuierliche tägliche Selbstbeobachtung mittels Smartphone Tägliche Smartphone-basierte Selbstbeobachtung bei bipolaren Störungen –MONARCA I: placebo-kontrollierte Studie Literatur 1 Prodromalforschung: Früherkennung bei bipolaren Störungen Bipolare affektive Störungen sind schwere, episodisch verlaufende und gewöhnlich lebenslang bestehende Erkrankungen, die für die Betroffenen häufig mit erheblichen Einschränkungen und Behinderungen in der Lebensgestaltung einhergehen. Da der Beginn für die Mehrzahl der Betroffenen bereits im jungen Erwachsenenalter (15-25. Lebensjahr) liegt, handelt es sich um eine Erkrankungsgruppe mit großer epidemiologischer und gesundheitspolitischer Bedeutung. In der Regel entwickeln sich bipolare Störungen bei Personen mit einem erhöhten Krankheitsrisiko über ein unspezifisches Prodromalstadium in der Adoleszenz oder im jungen Erwachsenenalter zu einer ersten affektiven Episode. Im weiteren Verlauf kommt es dann gewöhnlich lebenslang zu unvorhersehbaren Rezidiven und bei einem Teil der Patienten zur Entwicklung von Therapieresistenz depressiver Episoden. Eine positive Familiengeschichte mit bipolaren Störungen ist einer der stärksten und beständigsten Risikofaktoren. Angehörige eines Betroffenen mit Bipolar-I- oder Bipolar-IIStörung haben ein 10fach erhöhtes Risiko, ebenfalls zu erkranken (1). Abb. 1: modifiziert aus: Leopold et al. (2013) Nervenarzt 84(11):1310-5. (1) Erschwerend kommt hinzu, dass es sich bei der bipolaren Störung um eine heterogene Erkrankung mit einer erheblichen Latenz von den ersten Symptomen bis zur Diagnose handelt. Die Früherkennung und Frühintervention haben theoretisch das Potential, die Krankheitsprogression zu mindern und die negativen Folgen der Erkrankung zu reduzieren (2). Es gibt zunehmend Hinweise aus der Forschung der vergangenen 5 Jahre, dass der Manifestation der bipolaren Störung eine Phase dynamischer Symptomentwicklung vorausgeht (Prodromalstadium). Diese Phase ist hinsichtlich der Dauer sowie der Frühidentifikation und -Intervention dem Prodromalstadium der Schizophrenie ähnlich, wenngleich Stimmungsschwankungen häufiger im bipolaren Prodrom und attenuierte, positive psychotische Symptome häufiger im schizophrenen Prodrom auftreten. Unklar ist derzeit ebenfalls, welche Symptome oder Symptomkomplexe sich am besten eignen, um reliabel Patienten vor Beginn einer Manie zu identifizieren, ob Früherkennung einer Bipolar-II-Störung möglich ist und ob und inwieweit sich Prodromi in Seite 4 Patientenuntergruppen unterscheiden, abhängig vom Vorliegen von z.B. genetischer Belastung, psychotischen Vollsymptomen, Erkrankungsalter, spezifischen Komorbiditäten. 1.1 Vor der ersten Manie: Vergleich des Symptomprofils der ersten depressiven Episoden zwischen bipolaren und unipolaren Patienten Obgleich die Manie oder Hypomanie für die Diagnose einer bipolaren Störung obligat ist, manifestiert sich die Erkrankung in den meisten Fällen zunächst in Form einer depressiven Episode. Da sich die psychopharmakologische Behandlung der unipolaren und bipolaren Störung deutlich unterscheiden und einige Medikamente, die bei der Behandlung depressiver Episoden zum Einsatz kommen, den Verlauf der bipolaren Störung ungünstig beeinflussen können (z.B. trizyklische Antidepressiva), wären Marker, die frühzeitig auf einen bipolaren Verlauf hinweisen, von hohem klinischen Nutzen. Die EDSP-Studie ist eine große, longitudinalen Kohorten-Studie einer repräsentativen Bevölkerungs-Stichprobe (N=3.021) Jugendlicher und junger Erwachsener (Alter 14-24 Jahre bei Einschluss) und einem Follow-up von bis zu zehn Jahren. Die Teilnehmer wurden in regelmäßigen Intervallen mittels des M-CIDI untersucht. In der hier beschriebenen Analyse dieser EDSP-Daten wurden die Symptomprofile der ersten depressiven Episoden von Patienten, die im weiteren Verlauf der Studie mindestens eine weitere depressive Episode (unipolar; N=659) oder eine (Hypo-) Manie (bipolar; N=35) entwickelt hatten, verglichen (3). Die ersten depressiven Episoden jener Probanden, die im weiteren Verlauf eine Manie oder Hypomanie entwickelt hatten, waren signifikant häufiger mit Suizidalität, übermäßigen Schuldgefühlen, vollständiger Anhedonie und ein Morgentief assoziiert. Hyperphagie und Hypersomnie hatten keine prädiktive Aussagekraft. Kommentar: Bei jungen Patienten, deren erste depressive Episoden mit Suizidalität, übermäßigen Schuldgefühlen, vollständiger Anhedonie und einem Morgentief assoziiert sind, sollte die Möglichkeit, dass es sich um die Erstmanifestation einer bipolaren Störung handeln könnte, in Erwägung gezogen werden. 1.2 Gestörter Schlaf als potentieller Risikofaktor für die spätere Entwicklung einer bipolaren Störung? Eine Vielzahl von Studien konnte belegen, dass Schlafstörungen bei Personen mit einer bipolaren Störung häufig auftreten und mit einem schlechten funktionellen Outcome assoziiert sind. Unklar bleibt jedoch, ob diese Symptome als Folge der Erkrankung bzw. der Medikation auftreten oder, ob sie schon vor der Erstmanifestation zu beobachten sind und somit einen Risikofaktor für die spätere Entwicklung der Störung darstellen. Ausgewertet wurden Daten der EDSP-Studie (s.o.) (4). Eingeschlossen wurden all jene Probanden, die zur Baseline-Erhebung keine Diagnose einer psychiatrischen Störung hatten. Zur Charakterisierung des Schlafes, wurde der Fragebogen SCL-90 genutzt, mittels dessen Ein- und Durchschlafstörungen bzw. unerholsamer Schlaf quantifiziert werden können. Die Assoziation mit dem späteren Auftreten einer bipolaren Störung mittels logistischer Regression wurde errechnet. 1.943 Probanden hatten zum Zeitpunkt der Baseline-Erhebung keine psychiatrische Erkrankung. 41 von diesen Probanden entwickelten im Verlauf eine bipolare Störung. Nach Adjustierung für mögliche konfundierende Variablen (Geschlecht, Alter, Substanzkonsum, positive Familienanamnese) erhöhten Schlafstörungen signifikant das Risiko, im weiteren Verlauf eine bipolare Störung zu entwickeln (OR 1,75; p=0,001). Abb. 2: Ritter et al. (2015) J Psychiat Res 68:76-82. (4) Kommentar: Schlafstörungen erhöhen bei gesunden Personen das Risiko einer späteren bipolaren Störung. Schlafstörungen treten schon vor Erstmanifestation der Erkrankung auf und sind daher vermutlich keine Folge der Erkrankung oder der Behandlung. 1.3 Temperament und prodromale Symptome im Vorfeld einer ersten manischen bzw. hypomanen Episode: eine Pilotstudie Es wurde bereits eine Reihe von vermeintlichen prodromalen Symptomen im Vorfeld des Beginns einer bipolaren Erkrankung beschrieben, dazu gehören z.B. Stimmungslabilität, Stimmungsschwankungen, zyklothyme Merkmale, depressive Stimmung, rasende Gedanken, Reizbarkeit und körperliche Unruhe. Allerdings wurde die Beziehung zwischen Temperament und prodromalen Symptomen einer bipolaren Störung, speziell manischen bzw. hypomanen prodromalen Symptomen, noch nicht näher untersucht. Die Hypothese dieser retrospektiven Studie lautete, dass Patienten mit höheren Scores in zyklothymen und reizbaren Stimmungsskalen eine größere Zahl an manischen/hypomanen prodromalen Symptomen aufweisen (5). Dazu wurden in dieser Pilotstudie 39 euthyme Patienten mit Bipolar-I oder –IIStörung mit der ersten manischen/hypomanen Episode innerhalb der letzten 8 Jahre retrospektiv mittels TEMPS-A (Temperament Evaluation of Memphis, Pisa, Paris and San Diego-autoquestionnaire) sowie BPSS-R (Bipolar Prodrome Symptom Scale-Retrospective) untersucht. Die BPSS-R-Skala erfasst 39 subklinische Symptome im Vorfeld einer manischen, depressiven oder hypomanen Episode. In dieser Studie wurden nur die Daten vor einer manischen bzw. hypomanen Episode analysiert. Von den 39 eingeschlossenen Seite 6 Patienten (Alter 36.1 ± 9.9 Jahre, weiblich=59 %, bipolar-I=62 %) wiesen 100 % subklinische Manie-Symptome (MW=7.4±2.9) und 92.3 % subklinische Depressionssymptome (MW=2.4±1.5) auf. 87.5 % bzw. 43.6 % wiesen allgemeine psychopathologische Symptome (MW=3.2±2.0) oder subklinische psychotische Symptome (MW=0.7±1.0) auf. Multivariate Regressionsanalysen zeigten einen signifikanten Zusammenhang zwischen zyklothymem Temperament und dem BPSS-R Gesamtscore (R2=0.161, p=0.045) sowie dem Psychose-Teilscore (R2=0.125, p=0.029) (5). Kommentar: Die Daten weisen auf einen möglichen Zusammenhang zwischen zyklothymem bzw. reizbarem Temperament und prodromalen Symptomen im Vorfeld einer ersten manischen bzw. hypomanen Episode hin. Zur Identifizierung von Risikopatienten, die eine Bipolar-I oder –II-Störung entwickeln, kann die Erfassung des zyklothymen Temperaments somit hilfreich sein. 2 Klassifikation, Diagnostik und Verlauf 2.1 Progressive Abfolge klinischer Stadien in der Entwicklung bipolarer Störungen Anhand prospektiver Daten von 229 Hochrisikopersonen für die Entwicklung bipolarer Störungen (Kinder bipolar erkrankter Eltern) haben kanadische Kollegen der Forschergruppe um Anne Duffy die Hypothese aufgestellt, dass es eine progressive Abfolge klinischer Stadien in der Entwicklung bipolarer Störungen gibt, welche nach eher unspezifischen Veränderungen auch eine unipolare Depression beinhalten (s. Abb. 3). Abb. 3: Keown-Stoneman et al. (2015) Int J Bipolar Disord 3:5. (6) Im vorliegenden Artikel dieser Gruppe werden an diesen Daten zwei statistische Analysestrategien angewandt, welche sich potenziell eignen, die Hypothese dieser Progression zu testen (6). Beide statistischen Vorgehensweisen eigneten sich und wiesen ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer bipolaren Störung bei vorher einsetzender unipolarer Depression nach. Im ersten Verfahren, einer Cox-Regression, wurde gezeigt, dass das Risiko, eine bipolare Störung zu entwickeln, um das 5-fache ansteigt, wenn bereits eine unipolare Depression erlebt wurde (Hazard Ratio 5.070, p=0,0231). Das zweite Verfahren, ein Multi-State-Modell, liefert keine Regressionskoeffizienten, kann jedoch die Wahrscheinlichkeit, in einem bestimmten Alter bestimmte klinische Stadien durchlebt zu haben, untersuchen. In der Grafik (Abb. 4) kann man sehen, dass es eine gewisse Progression von eher unspezifischen Veränderungen über unterschwellige depressive Episoden hin zu einer majoren Depression und später zur bipolaren Störung, zumindest bei den Kindern von bipolar Erkrankten, zu beobachten ist. Im Fazit resümieren die Autoren, dass beide statistische Verfahren Vor- und Nachteile haben, aber beide geeignet sind, die Progression zu untersuchen. Abb. 4: Keown-Stoneman et al. (2015) Int J Bipolar Disord 3:5. (6) Kommentar: Hochrisikopersonen für die Entwicklung bipolarer Störungen (Kinder bipolar erkrankter Eltern) durchlaufen verschiedene Stadien bis zum Vollbild einer bipolaren Störung. 2.2 DSM-5: Bipolare Störungen Nachdem 2013 die 5. Auflage des Klassifikationssystems „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“ (DSM-5) der American Psychiatric Association erschienen ist, wurde 2015 nun die deutsche Auflage als Buch publiziert (7). Darin finden sich in getrennten Kapiteln die beiden großen und bedeutsamen „mood disorders“ (bipolare Störungen und depressive Störungen), die neben der traditionellen Unterteilung (primary mood disorders) in sog. sekundäre mood disorders untergliedert werden: Dies ist in der folgenden Abb. 5 dargestellt (8). Seite 8 Abb. 5: Malhi et al. Aust N Z J Psychiatry 2015;49:1087-1206. (8) DSM-5 hat weitere wichtige Neuerungen auf dem Gebiet der bipolaren Störungen mit sich gebracht. In DSM-5 finden sich „Bipolar and related Disorders“ nun erstmalig in einem eigenen Kapitel wieder, lokalisiert zwischen den Kapiteln „schizophrenia spectrum and other psychotic disorders“ sowie „depressive disorders“. Krankheitsbilder, die die Kriterien für bipolare Störungen erfüllen, jedoch im Rahmen von Substanzkonsum oder körperlichen Erkrankungen auftreten finden sich nunmehr auch in dem neu geschaffenen Kapitel „Bipolar and related disorders“ (9). Die Zunahme zielgerichteter Aktivität/Energie ist, neben einer gehobenen, expansiven bzw. gereizten Stimmung, nunmehr ein essentielles Hauptsymptom für (hypo)manische Episoden. Unter Antidepressiva sich entwickelnde (hypo)manische Episoden können jetzt, sofern die Symptomatik in unveränderter Form auch nach Absetzen des Antidepressivums über den physiologischen Effekt des Antidepressivums hinaus in gleicher Ausprägung bestehen bleibt, für die Diagnosestellung einer Bipolar-I- bzw. II-Störung herangezogen werden. In der folgenden Tabelle sind die wesentlichen Neuerungen dargestellt. Abb. 6: Möller et al. (2015) Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 265(2):87-106. (9) Kommentar: DSM-5 hat einige wichtige Veränderungen hinsichtlich der Diagnostik bipolarer Störungen mit sich gebracht. Während einige dieser Neuerungen, insbesondere was den Zusatz von zielgerichteter Aktivität/ Energie als obligatorisches Symptom für (hypo)manische Episoden angeht, als sinnvoll angesehen werden müssen bleibt dies für andere, z.B. unterschwellige bipolare Störungen, erst noch abzuwarten. 2.3 DSM-5: Warum ist die Manie keine eigenständige Kategorie? Der Autor Jules Angst aus Zürich, ein weltweit hochangesehener Wissenschaftler, der seit mehr als 50 Jahren die Verläufe von affektiven Erkrankungen systematisch untersucht, setzt sich in diesem Beitrag kritisch mit der Tatsache auseinander, dass im neuen DSM-5 die unipolare Manie erneut keine eigene diagnostische Kategorie darstellt (10). Anders als im ICD-10, aber wie bereits in DSM-IV und DSM-III, also den Vorläuferversionen des Klassifikationssystems, werden unipolare Manien zu den bipolaren Störungen integriert – hingegen unipolare Depressionen als eigene Gruppe verzeichnet wird. Die unipolare Manie ist zwar viel seltener ist als die unipolare Depression, aber zweifelslos existiert sie, wie J. Angst aus den prospektiven Daten der ZüricherLangzeitstudie ablesen kann. Es ist essentiell dies zu wissen, denn es gibt einige Unterscheidungsmerkmale zur unipolaren Depression: die Manie beginnt viel früher im Leben, zeigt öfters psychotische Merkmale, geringe Suizidraten und Rapid Cycling, weniger Angstsymptome, höhere Raten an zyklothymem Temperament, und insgesamt eine etwas bessere Prognose. Interessanterweise gibt es auch Hinweise, dass Patienten mit unipolarer Manie schlechter auf Lithium, und etwa gleich auf Valproat ansprechen, als bipolare Seite 10 Patienten. Auch genetische Studien belegen, dass die Manie und die Depression unterschiedlichen familiären Transmissionspfaden folgen. Kommentar: Es erschließt sich nicht auf den ersten Blick, warum die unipolare Manie im DSM-5 keine eigene diagnostische Kategorie darstellt sondern unter den bipolaren (manisch-depressiven) Störungen eingeordnet wird. Für den Kliniker ist es wichtig, dass er dennoch realisiert, dass es diese – wenn auch relativ seltene – affektive Störung gibt, die sich in vielen Aspekten des Verlaufs, der Therapie und Prognose von den anderen affektiven Störungen unterscheidet. 2.4 Der Einfluss von Life-Events auf die erstmalige vs. wiederholte Krankenhausaufnahme aufgrund einer bipolaren Störung Ziel dieser holländischen Arbeit war es, die Kindling-Hypothese zu überprüfen, die davon ausgeht, dass sog. Life-Events beim Auftreten einer ersten Episode einer bipolaren Erkrankung einen größeren Einfluss hat als dies bei nachfolgenden Episoden der Fall ist (11). Zu diesem Zweck wurden zwischen 2001 und 2006 51 Zwillingspaare mit remittierter bipolarer Erkrankung (37 bp-I, 14 bp-II) und 35 Zwillingspaare als Kontrollen mit dem Life Events and Difficulties Schedule (LEDS), einem halbstandardisierten Interview zur Erfassung von Lebensereignissen und hieraus resultierenden Problemen untersucht, um somit den Einfluss von Life-Events auf erstmalige vs. wiederholte Hospitalisierung, den Einfluss vorhergehender auf nachfolgende Hospitalisierung und den Zusammenhang von Life-Events und Anzahl der Hospitalisierungen zu überprüfen. Die Ergebnisse der Untersuchung legen nahe, dass unter Beachtung der Schwere und Anzahl der Lebensereignisse diese einen Einfluss sowohl auf die Erst- als auch die wiederkehrenden Krankenhausaufnahmen wegen einer bipolaren Erkrankung zu haben scheinen, dieser Effekt aber nicht vom direkten Einfluss der Life-Events auf die Erkrankung abhängig ist. Die Anzahl der bisherigen Krankenhausaufenthalte scheint – so ein weiteres Ergebnis – ein guter Indikator für das Risiko einer erneuten Aufnahme zu sein. Da der Einfluss von Life-Events auf die Erstaufnahme in eine Klinik wegen einer bipolaren Erkrankung stärker war als dies vor weiteren Aufenthalten der Fall war, könnte dies als Hinweis auf einen möglichen Kindling-Effekt verstanden werden. Abb. 7.: Kemner et al.(2015) Int J Bipolar Disord 3:6. (11) Kommentar: Die beiden Einflussfaktoren auf das Risiko einer erneuten Krankenhausaufnahme – Lebensereignisse und bisherige Hospitalisierung – scheinen unabhängig voneinander zu sein. Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse ergibt sich Anhalt für die Hypothese, dass die mögliche Verminderung von schwerwiegenden Lebensereignissen im Leben von Menschen bzw. deren psychischer Auswirkungen (z. B. mittels psychotherapeutischer Bearbeitung) zur Verhinderung von Hospitalisierungen aufgrund einer bipolaren Erkrankung führen könnte. 2.5 Herzinfarktrisiko bei bipolarer Störung: Ergebnisse einer epidemiologischen Studie Vor dem Hintergrund der bekanntermaßen deutlich erhöhten Mortalität bei schwerwiegenden psychiatrischen Erkrankungen untersuchten die Autoren das relative Risiko akuter Myokardinfarkte bei Patienten mit Schizophrenie und Bipolaren Störungen. Die Populationsbasierte Kohortenstudie wurde durch eine Abfrage administrativer Daten aus der Taiwan National Health Insurance Research Database (NHIRD) über einen Zeitraum von 11 Jahren realisiert. Es wurden die Daten von insgesamt 70.225 bipolaren oder schizophrenen Patienten und 207.592 Patienten ohne psychiatrische Erkrankung über 18 Jahre ausgewertet. Dabei konnte gezeigt werden, dass insbesondere Frauen und Patienten in jüngeren Altersgruppen mit bipolarer Störungen oder Schizophrenie ein deutlich erhöhtes Risiko für akute Myokardinfarkte aufwiesen, wobei dieses erhöhte Risiko nur teilweise durch demografische Charakteristika oder Komorbiditäten erklärbar war (12). Abb. 8: Alters-stratifizierte Hazard ratios und 95 % Konfidenceintervalle of AMI bei Patienten mit Schizophreniie oder bipolarer Störung. Wu et al. (2015) PLoS One 10(8):e0134763. (12) Kommentar: Zur Aufklärung der kausalen Mechanismen des erhöhten Myokardinfarktrisikos bei Frauen und jungen Patienten mit schwerwiegenden psychiatrischen Erkrankungen (Schizophrenie, bipolare Störung) bedarf es weiterer Untersuchungen. 3 Suizidforschung Seite 12 Die Behandlung suizidalen Verhaltens und die Verhinderung von Suiziden ist in den letzten Jahren in den Mittelpunkt psychiatrischer Forschung gerückt und nimmt damit auch einen größeren Stellenwert in der Erarbeitung von Behandlungs- und Präventionsstrategien ein. Innerhalb verschiedener psychiatrischer Erkrankungen weisen Patienten mit einer bipolaren Störung den stärksten Zusammenhang zwischen Erkrankung und Suizid auf – Suizide von Patienten mit bipolarer Störung machen etwa ein Viertel aller Suizide aus. 3.1 Die suizidprophylaktischen Eigenschaften von Lithium bei Patienten mit affektiven Störungen: Übersicht Die aktuellste Übersicht zum Thema suizidprotektive Wirkung von Lithium stammt von Lewitzka et al. (13). Die Forscher führten ein umfassendes Review der zu diesem Thema erschienenen Arbeiten durch, das im Folgenden kurz zusammengefasst wird: Lithium verhindert Suizide im Rahmen der Behandlung affektiver Erkrankungen unabhängig von seinen stimmungsstabilisieren Eigenschaften. Unter der Behandlung ist das Suizidrisiko etwa 5fach reduziert im Vergleich zu anderen medikamentösen Behandlungsstrategien. Lithium stellt zudem eine wirkungsvolle Augmentationsstrategie in der Behandlung depressiver Episoden bei Non-respondern einer vorangehenden antidepressiven Medikation dar. Erste Hinweise auf suizidpräventive Eigenschaften von Lithium wurden eher zufällig im Rahmen von Studien entdeckt, die eigentlich der Untersuchung stimmungsstabilisierender Wirkeigenschaften dienten wurden auf potentielle anti-suizidale Effekte von Lithium durch Barraclough erstmals hingewiesen 1992 konnte in einer großen, internationalen Studie gezeigt werden, dass 827 Lithiumbehandelte Patienten im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen keine signifikant verschiedenen Mortalitätsraten aufwiesen, wobei epidemiologische Daten 2- 3fach erhöhte Mortalitätsraten bei unbehandelten bipolaren Patienten im Vergleich zu gesunden Probanden beschreiben. Die erste Placebokontrollierte, randomisierte Studie, die die Untersuchung anti-suizidaler Effekte von Lithium zum Gegenstand hatte, wurde 2008 publiziert. Dabei war die Inzidenz vollendeter Suizide in der Lithium-Gruppe signifikant geringer (p = 0,049). Anti-suizidale Effekte unter Lithium-Behandlung sind sowohl bei bipolaren wie auch unipolaren und schizoaffektiven Störungen und unter normalen, therapeutischen Lithium-Blutspiegeln (0,5-1,0 mmol/l) nachweisbar. Der genaue Wirkmechanismus anti-suizidaler Effekte ist derzeit unvollständig verstanden. Eine besondere therapeutische Herausforderung stellt die Frage dar, ob Lithium im Falle eines unzureichenden stimmungsstabilisierenden Effektes abgesetzt werden sollte, insbesondere auch im Hinblick auf das zwar kleine aber doch existierende Risiko einer Nierenschädigung bei jahrzehntelanger Prophylaxe. Denn es erscheint durchaus möglich, dass im individuellen Patienten Lithium trotz suboptimaler Stimmungsstabilisierung einen suizidpräventiven Effekt hatte. Die Inzidenz von Suiziden ist im ersten Jahr nach Absetzen von Lithium 20fach erhöht. In dieser klinischen Konstellation ist somit im Rahmen der möglichen Unabhängigkeit anti-suizidaler und stimmungsstabilisierender Effekte besondere Umsicht und Kompetenz seitens der Behandler erforderlich. Für Lithium als eine der ältesten in der Psychiatrie verwendeten pharmakologischen Substanzen wurde seit Anfang der 90iger Jahre ein eigenständiger, im Vergleich zu anderen Psychopharmaka wahrscheinlich spezifischer sogenannter anti-suizidaler Effekt nachgewiesen. Trotz dieses Wissens und des heute ebenfalls in nationalen und internationalen Leitlinien dokumentierten Stellenwertes von Lithium in der Akut-und Erhaltungstherapie affektiver Störungen ist Lithium hinsichtlich seiner Verschreibungshäufigkeit im Vergleich zu anderen psychotropen Substanzen unterrepräsentiert. Suizidale Gedanken bzw. suizidales Verhalten können im Rahmen einer bipolaren Störung auftreten. Rechtzeitiges Erkennen einer Gefährdung sowie das Einleiten therapeutischer Maßnahmen sind in einer solchen Situation besonders wichtig. Neben psychotherapeutischen Strategien zur Krisenbewältigung sind auch pharmakologische Behandlungsansätze sinnvoll und richtig. Neben den oben beschrieben Suizid-verhindernden Effekten von Lithiumsalzen gibt es klinische Einzelfallhinweise, dass Lithium auch akute „anti-suizidale“ Wirkungen besitzt. Dieser Frage wurde allerdings nicht in einer Studie nachgegangen. Deshalb wird aktuell in einer vom BMBF geförderten multizentrischen Studie in Deutschland untersucht, wie schnell dieser Effekt einsetzt – hierzu wird interessierten Probanden, die an einer depressiven Störung (allein) oder einer depressiven Störung im Rahmen einer bipolaren Erkrankung sowie einem gewissen Maß an Lebensüberdruss bzw. Suizidalität leiden, angeboten, neben allen üblichen und angezeigten therapeutischen Maßnahmen zusätzlich Lithium oder Placebo einzunehmen. Kommentar: Das Suizidrisiko ist bei erwachsenen Patienten mit bipolarer Störung insgesamt ca. 20mal höher verglichen mit dem Risiko für die allgemeine Bevölkerung. Innerhalb verschiedener psychiatrischer Erkrankungen weisen Patienten mit einer bipolaren Störung den stärksten Zusammenhang zwischen Erkrankung und Suizid auf – Suizide von bipolaren Patienten machen etwa ein Viertel aller Suizide aus. Für Lithium als eine der ältesten in der Psychiatrie verwendeten pharmakologischen Substanzen wurde seit Anfang der 90iger Jahre ein eigenständiger, im Vergleich zu anderen Psychopharmaka wahrscheinlich spezifischer sogenannter anti-suizidaler Effekt nachgewiesen. Trotz dieses Wissens und des heute ebenfalls in nationalen und internationalen Leitlinien dokumentierten Stellenwertes von Lithium in der Akut-und Erhaltungstherapie affektiver Störungen ist Lithium hinsichtlich seiner Verschreibungshäufigkeit im Vergleich zu anderen psychotropen Substanzen unterrepräsentiert. 4 Epidemiologie und Komorbidität 4.1 Reduziertes Schlaganfallrisiko nach Behandlung mit Lithium bei Patienten mit bipolarer Störung Seit einigen Jahren existiert die Hypothese, dass mit fortschreitender bipolarer Störung auftretende Verminderungen des Hippocampusvolumens durch mögliche neuroprotektive Effekte einer Lithiumbehandlung, aber nicht durch andere pharmakologische Behandlungen, günstig beeinflusst werden können. Da sich dieser Effekt auch bei weniger guten Lithium-Respondern zeigte, wird angenommen, dass dieser neuroprotektive Effekt (und seine neurobiologische Basis) von Lithium unabhängig von seinen rezidivprophylaktischen Wirkungen eintritt. Zahlreiche Studien weisen auf mögliche neuroprotektive Eigenschaften von Lithium hin, im Tierversuch konnte beispielsweise das Auftreten atherosklerotischer Plaques durch Lithium vermindert werden. Es ist bislang nur unzureichend untersucht worden, ob eine Behandlung mit Lithium beim Menschen Seite 14 das Risiko für zerebrovaskuläre Erkrankungen verändert. Lan und Kollegen (14) untersuchten in einer retrospektiven Kohortenstudie den möglichen Zusammenhang einer Lithiumbehandlung mit dem Auftreten von Schlaganfällen bei bipolaren Patienten. Sie konnten hierzu die Daten von 1 Million Patienten der taiwanesischen National Health Insurance Research Database (NHIRD) nutzen. Abb. 9: Lan et al. (2015) Bipolar Disord 17(7):705-14. (14) Die Autoren konnten zeigen, dass eine Lithiumbehandlung mit einem signifikant reduzierten Schlaganfallrisiko verbunden ist. Diese Assoziation war am deutlichsten bei Patienten, die mit höherer kumulativer Lithiumdosis behandelt worden waren und bei längerer Behandlungszeit. Das Design der Untersuchung lässt jedoch keinen Rückschluss auf einen kausalen Zusammenhang von Lithiumtherapie und dem Auftreten von Schlaganfällen zu, und wichtige Schlaganfallrisikofaktoren, wie Adipositas oder Rauchen, waren nicht bekannt. Kommentar: Eine Behandlung mit Lithium könnte bei bipolaren Patienten das Schlaganfallrisiko senken. Die Risikoreduktion ist wahrscheinlich von der Behandlungsdauer und den eingesetzten Dosierungen abhängig. Ein möglicher kausaler Mechanismus kann aus der Studie allerdings nicht abgeleitet werden. 4.2 Typ 2 Diabetes und Prä-Diabetes bei bipolarer Störung Störungen des Glucose-Stoffwechsels führen zu Schädigungen des CNS und sind kardiovaskuläre Risikofaktoren. Es wird angenommen, dass diese Störungen für die erhöhte Morbidität und Mortalität bipolarer Patienten verantwortlich sind. Patienten mit bipolarer Störung leiden häufiger (ca. 33 %) an einem metabolischen Syndrom. Ferner belegten epidemiologische Studien, dass bei der bipolaren Störung die Lebenserwartung etwa 10 Jahre verkürzt ist: Bei Männern um 10,1 Jahre und bei Frauen um 11,2 Jahre. Die Todesursachen wurden nicht untersucht, aber es wird vermutet, dass die Differenz der Lebenserwartungen nicht allein durch Suizide zu erklären ist. Bezugnehmend auf die Datenlage wurde diskutiert, dass Herzinfarkte oder Schlaganfälle todesursächlich gewesen sein könnten. Auf andere Befunde über unausgewogene Ernährung, physische Inaktivität sowie metabolische und kardiovaskuläre Nebenwirkungen bei langjähriger Neuroleptikabehandlung von psychiatrischen Patienten wurde in diesem Zusammenhang verwiesen. Die Notwendigkeit von zu entwickelnden Strategien gegen die Früh-Mortalität wird deutlich: kardiovaskuläre Erkrankungen, Krebs oder Diabetes mellitus müssen rechtzeitig erkannt und behandelt werden. Epidemiologische Daten zur Prävalenz von Diabetes und seiner Vorstufen (Prä-Diabetes) bei bipolaren Störungen liegen nicht vor. Die vorliegende neue Studie von Leopold et al. (15) unterzog prospektiv 85 euthyme Patienten mit bipolarer Störung (die fast alle psychopharmakologisch behandelt wurden) einer ausführlichen Diagnostik bezgl. des Diabetes Risikos (oraler Glucosetoleranz-Test [OGTT] und weitere Laboruntersuchungen für metabolische Parameter), die zufällig aus einer Stichprobe zweier Uni-Kliniken in Deutschland gezogen wurden. Die Ergebnisse sind in Abb. 10 zusammengefasst. Danach fand sich bei 7 % ein (manifester) Diabetes Mellitus, bei 27 % Diabetes-Vorstufen (anhand der Werte des OGTT). Abb. 10: Häufigkeit von prä-diabetischen Auffälligkeiten und metabolischem Syndrom bei bipolaren Störungen. Leopold et al. (2016) J Affect Disord 189:240-5. (15) Die Lebensqualität und das Funktionsniveau waren deutlich schlechter bei Patienten mit abnormalem Glucosestoffwechsel im Vergleich mit Patienten, die Normalwerte aufwiesen (s. Abb. 11). Seite 16 Abb. 11: Lebensqualität und Funktionsniveau bei prä-diabetischen Patienten mit bipolarer Störung. Leopold et al. (2016) J Affect Disord 189:240-5. (15) Kommentar: Ein Drittel der bipolaren Patienten wiesen in einer Querschnittsstudie Störungen im Glucosestoffwechsel auf. Bei bipolaren Patienten sind auf (prä)-diabetische Stoffwechsellagen und Zeichen des metabolischen Syndroms zu achten und bei positivem Befund entsprechend therapeutisch und psychoedukativ entgegenzuwirken. 5 Pharmakotherapie: Wirkungen und Nebenwirkungen 5.1 Renale Nebenwirkungen von Lithium: Ergebnisse einer longitudinalen Untersuchung Lithium ist der Goldstandard in der Behandlung von bei Patienten mit bipolaren Störungen. Als effektiver Stimmungsstabilisator kann es Phasenhäufigkeit und -Intensität deutlich abschwächen, idealerweise sogar vollständig verhindern (sogenannte Lithium-Response). Lithium wird schon seit mehr als 60 Jahren in der Behandlung von affektiven Störungen eingesetzt – aus diesem Grunde liegen sehr gute Daten zur Sicherheit und Verträglichkeit auch bei langjähriger Anwendung vor. Da Lithium über die Niere ausgeschieden wird, gehört die regelmäßige Überprüfung der Nierenfunktion zum Standardmonitoring in der Lithiumtherapie. Ganz im Fokus des wissenschaftlichen Interesses stand in den vergangenen Jahren vor allen Dingen der Einfluss von einer langjährigen Lithiumtherapie auf die Nierenfunktion aber auch auf mögliche andere, strukturelle Schädigungen (s auch 5.2). Zum besseren Verständnis der (komplexen) Nierenfunktion und ihre Beeinflussung von Lithium sei kurz an die Physiologie der Niere erinnert: Im Glomerulum der Niere werden durch Filtration aus dem Blut täglich ca. 180 l Primärharn erzeugt, die in den Tubuli durch Rückresorption derart konzentriert werden, dass nur ungefähr ein Prozent der Primärharnmenge tatsächlich als Sekundärharn ausgeschieden wird. Beide Fähigkeiten der Niere, Primärharnund Sekundärharnproduktion, können durch Lithium beeinträchtigt werden. Die glomeruläre Filtrationsrate (GFR) gibt das pro Minute filtrierte Blutvolumen an (Normwert im jüngeren Alter um 120 ml/min) und wird häufig über die Kreatinin-Clearance abgeschätzt. In einer systematischen Übersichtsarbeit und Metaanalyse zu Lithium-assoziierten Nebenwirkungen zeigten sich zum einen eher geringe Einschränkungen der glomerulären Filtrationsrate (eGFR), andererseits eine erhöhte Rate an terminaler Niereninsuffizienz bei mit Lithium behandelten Patienten im Vergleich zu Kontrollen. Letztere tritt jedoch vor allem bei mangelhaft kontrollierter oder mit zu hohen Serumlithiumspiegeln durchgeführter Behandlung auf (16). In einer aktuellen Untersuchung aus Italien wurden alle zwischen 1980 und 2012 mit Lithiumsalzen behandelte Patienten der Lithium-Spezialambulanz gescreent und 953 Patienten in eine Studie eingeschlossen, um die Nierenfunktion im Langzeitverlauf darzustellen. In der Querschnittsbetrachtung war die eGFR niedriger bei Frauen, bei älteren Patienten und bei Patienten mit längerer Lithium-Behandlung. Die Longitudinal-Ergebnisse zeigten, dass die Hälfte der länger als 20 Jahre mit Lithium behandelten Patienten eine eGFR unter 60 ml/min/1,73m2 hatte (16). Kommentar: Neben der Dauer der Lithium-Behandlung sollte das zunehmende Patientenalter als Risikofaktor für eine reduzierte glomeruläre Filtrationsrate in Betracht gezogen werden. 5.2 Entwicklung chronischer Nierenerkrankung unter Lithium und Antikonvulsiva: Ergebnisse einer dänischen Registerstudie In einer groß angelegten dänischen Registerstudie von Kessing et al. (17) wurde der Frage nachgegangen, ob eine Langzeitbehandlung mit Lithium bzw. anderen stimmungsstabilisierenden Medikamenten (auch Antipsychotika und Antidepressiva) zu einer chronischen Nierenerkrankung (=Niereninsuffizienz) führen kann. Verschiedene Informationen aller dänischen Bürger (5.4 Mio.) sind in offiziellen Registern erfasst, dazu zählen beispielsweise gesundheitsrelevante Parameter wie Diagnosen, Verschreibungen etc. Diese Daten kann man nun für die Untersuchung verschiedener Fragestellung nutzen. In der hier vorgestellten Arbeit wurden zwei große Gruppen analysiert: Die Gruppe 1 bestand aus 1.800.591 zufällig ausgewählten Individuen, davon waren 1.500.000 Personen, die am 1.1.1995 in Dänemark registriert waren. Des Weiteren befanden sich in dieser Gruppe 10.591 Personen, die im Zeitraum von 1.1.1994 bis 21.12.2012 mit einer einzelnen manischen Episode bzw. mit einer bipolaren Störung registriert worden waren sowie eine weitere Gruppe von im Zeitraum vom 1.1.1995 bis 31.12.2012 registrierten Lithium(n=26 731) bzw. mit anderen stimmungsstabilisierenden Medikamenten behandelten (n=420 959) Patienten. Die zweite große Gruppe (n=10 591) stellte die Untergruppe dar, die mit einer bipolaren Störung diagnostiziert worden waren. Damit wurde sichergestellt, dass in der Gruppe 1 alle Patienten unabhängig von der Art der Erkrankung eingeschlossen wurden. Analysiert wurde das Auftreten von einer möglichen chronischen Niereninsuffizienz bzw. von einer gesicherten Niereninsuffizienz, außerdem wurde untersucht, wie häufig eine terminale Niereninsuffizienz (d.h. ein Stadium der Schädigung, Seite 18 welches eine Hämodialyse bzw. eine Transplantation erforderlich machen würde) auftritt. Die Autoren fanden, dass die Therapie mit Lithium (unabhängig von der Diagnose) mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer möglichen bzw. manifesten Niereninsuffizienz assoziiert ist. Es wurde kein solcher Zusammenhang für die Behandlung mit anderen stimmungsstabilisierenden Medikamenten bzw. Antipsychotika oder Antidepressiva gefunden. Weder Lithium noch die anderen Medikamente waren mit einem erhöhten Risiko für das Auftreten einer terminalen Niereninsuffizienz assoziiert. In der Analyse der bipolaren Patienten zeigte sich, dass hier die Lithiumtherapie als auch die Therapie mit anderen stimmungsstabilisierenden Medikamenten mit einem erhöhten Risiko für Niereninsuffizienz vergesellschaftet war, dies wiederum war nicht bei der Betrachtung der anderen Medikamente (Antipsychotika, Antidepressiva) zu beobachten. Auch in der Gruppe der Patienten mit bipolarer Störung und Lithiumtherapie zeigte sich kein erhöhtes Risiko für das Auftreten einer terminalen Niereninsuffizienz. Interessanterweise wies die Behandlung mit anderen stimmungsstabilisierenden Medikamente ein solch erhöhtes Risiko auf. Kommentar: Auch unter den heutigen modernen Bedingungen in der Behandlung mit Lithium oder anderen Stimmungsstabilisatoren kann es zu einem erhöhten Auftreten einer Niereninsuffizienz kommen, ein erhöhtes Risiko für die terminale Niereninsuffizienz zeigte sich bei den mit Lithium behandelten Patienten jedoch nicht. Wichtig in diesem Zusammenhang sind die etablierten Kontrolluntersuchungen (alle 3-6 Monate Laborkontrolle, angestrebte LithiumSerumspiegel von 0.6-0.8mmol/l) die es möglich machen, rechtzeitig Funktionseinschränkungen der Niere zu erkennen und dann durch entsprechende Maßnahmen eine irreversible Schädigung zu verhindern. 5.3 Langzeitbehandlung mit Lithium: Risiko für Nierentumore? Eine neuere Studie aus Paris (Frankreich) hat Hinweise erbracht, dass Patienten mit schwerer Niereninsuffizienz, die Lithium über mehr als 10 Jahre erhalten hatten, ein erhöhtes Risiko für Nierentumore einschließlich Karzinomen haben könnten. Dieser Befund und weitere Hinweise haben dazu geführt, dass die Fachinformationen der Lithiumpräparate europaweit angepasst werden sollen. Ausgangspunkt der aktuellen Diskussion über ein fraglich erhöhtes Risiko ist eine Publikation aus der Nephrologischen Abteilung am Neckar Hospital der Universität Paris Descartes mit dem Titel „Increased risk of solid renal tumors in lithium-treated patients“, veröffentlicht 2014 in „Kidney International“. Dabei untersuchten die Autoren Zaidan et al. in einer retrospektiven Studie, ob langzeitig mit Lithium behandelte Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz ein höheres Risiko für Nierentumore im Vergleich zu Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz ohne Lithiumbehandlung haben. Über einen 16-Jahres-Zeitraum (1996-2011) wurden bei 14 der 170 mit Lithium behandelten Patienten Nierentumore festgestellt (8,2 %), darunter 7 bösartige und 7 gutartige (d.h. je 4,1 % gut- bzw. bösartige Nierentumore). Die mittlere Dauer der Lithium-Exposition bei Tumordiagnosestellung betrug 21,4 Jahre. Die französischen Autoren schlussfolgern, dass es ein erhöhtes Risiko von Nierentumoren bei langzeitig mit Lithium behandelten Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz gibt. Diese Warnung hat seit Jahresbeginn 2015 in Deutschland Besorgnis und Verunsicherung sowohl bei ärztlichen Kollegen, als auch Patienten ausgelöst. Eine Übersicht von Conell et al. (18) in der Zeitschrift Der Nervenarzt hat die aktuelle Datenlage erläutert und angemessen wie folgt eingeordnet: Möglicherweise lag bei dieser Studie aus Paris ein Selektions-Bias vor: Es wurden bezüglich des Auftretens von Nierentumore nur Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz betrachtet, welche Lithium erhielten im Vergleich zu Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz ohne Lithiumeinnahme. Patienten ohne Nierenfunktionsstörungen wurden nicht untersucht. Ebenso fanden die Dauer der Lithiumexposition sowie weitere kumulative Risikofaktoren keine Berücksichtigung. Ein Detection-Bias könnte resultieren, weil Lithiumpatienten ohnehin bezüglich der Nierenfunktion unter besonderer medizinischer Beobachtung stehen (z.B. durch regelmäßige Bestimmung des Creatinin) (18). Dieser Bias könnte durch Vergleich mit anderen Medikamenten umgangen werden (s. nachstehende Studie von Kessing et al., (20)). Durch zwei aktuelle Registerstudien aus Dänemark, die nachstehend beschrieben werden, kann jedoch erst einmal „Entwarnung“ gegeben werden (19, 20): das Risiko, wenn es überhaupt eines gibt, ist sehr gering; die beschriebenen wenigen Fälle aus Paris traten auch nur bei sehr langer Lithiumtherapie (Jahrzehnte) und bestehender Niereninsuffizienz auf (18). Die beiden aktuellen, separat durchgeführten dänischen Fall-Kontroll-Studien aus 2015 zeigten, dass die Verordnung von Lithium nicht mit einem erhöhten Risiko von Krebserkrankungen des oberen Harntraktes (einschließlich der Niere) assoziiert war (19, 20). Die Autoren Pottegård et al. (19) führten eine groß angelegte pharmakoepidemiologische Studie über den möglichen Zusammenhang zwischen dem langfristigen Einsatz von Lithium und dem Risiko von Krebserkrankungen der oberen Harnwege, einschließlich Nierenzellkarzinom, Nierenbeckenkarzinom oder Harnleiterkrebs, durch. Die Autoren identifizierten anhand des dänischen Krebsregisters alle histologisch nachgewiesenen Krebsfälle der oberen Harnwege in Dänemark zwischen 2000 und 2012. Insgesamt wurden 6.477 Fälle gefunden und mit 259.080 nach Alter und Geschlecht gematchten Kontrollen ohne Krebsdiagnose verglichen. Die Daten zur Lithium-Einnahme von 1995 bis 2012 wurden anhand des dänischen Rezeptregisters ermittelt. Die Autoren errechneten die Assoziation zwischen dem langfristigen Einsatz von Lithium (≥ 5 Jahre) und dem Risiko von Krebserkrankungen der oberen Harnwege mittels konditionaler logistischer Regression. Für potentiell konfundierende Variablen (Medikation, Komorbiditäten, sozioökonomischer Status) wurde adjustiert. Dabei zeigte sich, dass 0,22 % der Krebsfälle und 0,17 % der Kontrollgruppe Lithium langfristig eingenommen hatten. Das ergab insgesamt eine adjustierte Odds Ratio (OR) von 1,3 (95 % Konfidenzintervall [95 % CI], 0,8 bis 2,2) und somit keine signifikante Assoziation von Krebserkrankungen der oberen Harnwege mit dem langfristigen Einsatz von Lithium (19). Das Ziel der zweiten dänischen Studie von Kessing et al (20) war es, das Auftreten von (gut- und bösartigen) Tumore der Nieren und oberen Harnwege, zwischen Individuen, die wegen einer bipolaren Störung Lithium, aber auch Antikonvulsiva oder andere Psychopharmaka erhielten, im Vergleich zu denen, die keiner solchen Exposition ausgesetzt waren, abzuschätzen. Seite 20 Abb. 12: Kumulative Inzidenz von Tumore (gut-und bösartig) der Niere und oberen Harnwege bei bipolaren Patienten, die mit Lithium lange behandelt wurden (Patientenalter: 30, 45, 60 und 75 Jahre) Kessing et al. (2015) Bipolar Disord 3. doi: 10.1111/bdi.12344. [Epub ahead of print]. (20) Es handelt sich bei der vorliegenden Untersuchung um eine ganz Dänemark umfassende, populationsbasierte Longitudinalstudie. Es wurden 2 Kohorten gebildet: Kohorte I mit allen Personen, die Lithium (n = 24.272) oder Antikonvulsiva (n = 386.255) erhielten, allen Menschen mit der Diagnose einer bipolaren Störung (n = 9.651) und einer zufälligen Stichprobe von 1.500.000 Menschen aus der dänischen Bevölkerung. In Kohorte II befanden sich (als Subkohorte von I) nur die bipolaren Patienten. Die Studie bezog Daten von 1995 bis einschließlich 2012 ein. Ausgeschlossen waren Patienten, bei denen vor Studieneinschluss bereits Tumore der Niere und oberen Harnwege bekannt waren. Outcomekriterien war das nachfolgende Auftreten dieser Tumore; untergliedert in drei Gruppen: 1. kombiniert bösartige und gutartige Tumore, 2. bösartige und 3. gutartige Tumore. Die Analysen wurden adjustiert für die Anzahl der Verordnungen für Lithium bzw. Antikonvulsiva, Antipsychotika, Antidepressiva und allen anderen verordneten (psychiatrischen und somatischen) Medikamenten; Alter; Geschlecht; Arbeitsverhältnis; Kalenderjahr und die Diagnose einer bipolaren Störung. Dabei zeigte sich, dass die Langzeitbehandlung mit Lithium nicht mit erhöhten Raten von Tumore der Nieren und oberen Harnwege verbunden ist (bereinigte HazardRatio [HR] „bösartig oder gutartig“: 0,67-1,18, p = 0,70; bereinigte HR „bösartig“: 0,61-1,34, p = 0,90; bereinigte HR „gutartig“: 0,74-1,18, p = 0,70) (s. Abb. 12). In gleicher Weise trifft das für die Langzeitbehandlung mit Antikonvulsiva zu (bereinigte HR „bösartig oder gutartig“: 0,97-1,18, p = 0,10; bereinigte HR „bösartig“: 0,82-1,15, p = 0,80; bereinigte HR „gutartig“: 0,941,36, p = 0,20). Die Befunde wurden bei den 9651 Patienten mit der Diagnose einer bipolaren Störung bestätigt. Limitierend für die Untersuchung war u.a., dass weder die Lithiumdosierungen, noch Nierenfunktionsparameter berücksichtigt werden konnten, weil diese Daten nicht im Register erfasst sind. Die Autoren schlussfolgern, dass die Behandlung mit Lithium nicht mit erhöhten Raten von Tumoren der Nieren und oberen Harnwege verbunden ist (20). Kommentar: Um valide Aussagen zu der Fragestellung zu erhalten, ob eine Lithium-Langzeittherapie Nierentumore verursachen kann, sind große Patientenzahlen bzw. Vergleichspopulationen erforderlich. Dänemark ist hierfür aufgrund der großen staatlichen Register hervorragend geeignet. Zwei aktuelle dänische Fall-Kontroll-Studien belegen, dass die Verordnung von Lithium nicht mit einem erhöhten Risiko von Krebserkrankungen des oberen Harntraktes (einschließlich der Niere) assoziiert war. 5.4 Schilddrüsenfunktion bei Langzeit Lithium-behandelten bipolaren Patienten: eine Querschnittsstudie Diese Querschnittstudie untersucht den klinisch bedeutsamen jedoch mechanistisch weitgehend unverstandenen Zusammenhang zwischen Lithiumeinnahme und Veränderung der Schilddrüsenfunktion (21). Hierzu wurden Serumspiegel von Schilddrüsenhormonen und Schilddrüsenautoantikörper bei Patienten mit bipolarer Störung und einer mindestens 10 Jahre andauernden Lithiumbehandlung bestimmt. Die Stichprobe umfasste 45 weibliche und 21 männliche Patienten, welche Lithium über 10-44 Jahre (MW 21 Jahre) zur Rezidivprophylaxe manischer und depressiver Episoden eingenommen hatten. Als neuroendokrine Marker wurden TSH, fT3, fT4, anti-TPO-, antiTG und TSHRezeptor-Antikörper bestimmt. Die Ergebnisse der Messungen der Schilddrüsenhormone, TSH (Abb. 11) und Antikörper (Abb. 12) sind in den beiden nachstehenden Abbildungen dargestellt. Differences in hormone values were calculated using the Mann–Whitney test. Differences in percentages were calculated using the chi- square test. fT3 = free thyroxine; fT4 = free triiodothyronine; SD = standard deviation; TSH = thyroidstimulating hormone. aDifference: men/women. Abb. 13: Kraszewska et al. (2015) Bipolar Disord 17(4):375-80. (21) Seite 22 Differences in antibody values were calculated using the Mann–Whitney test. Differences in percentages were calculated using the chi- square test. Anti-TG = thyroglobulin antibodies; anti-TPO = thyroid peroxidase antibodies; anti-TSH-R = thyroid stimulating receptor antibodies; SD = standard deviation. aDifference: men/women. Abb. 14: Kraszewska et al. (2015) Bipolar Disord 17(4):375-80. (21) 22 % der weiblichen Patienten jedoch kein männlicher Patient wies unter der Lithiumbehandlung eine manifeste Hypothyreose auf. Bei mehr als der Hälfte untersuchter Patienten zeigten sich erhöhte Autoantikörper (Tab. 3). Hierbei ergaben sich keine geschlechtsspezifischen Unterschiede. Serumspiegel der TSH-Werte korrelierten hochsignifikant mit anti-TPO- und antiTG Antikörperspiegeln. Die Dauer der Lithiumeinnahme hatte keinen Einfluss auf die untersuchten neuroendokrinen Marker. Die Ergebnisse bestätigen die höhere Anfälligkeit weiblicher Patienten für eine Veränderung der Schilddrüsenfunktion unter Lithiumeinnahme. Im Gegensatz zur renalen Funktionseinschränkung scheint kein zeitlicher Zusammenhang zwischen Lithiumeinnahme und Schilddrüsenfunktionsstörungen zu bestehen. Die erstaunlich hohe Rate erhöhter Autoantikörper ist Spekulationen der Autoren zufolge eher durch die bipolare Störung als durch die Lithiumtherapie begründet. Sie unterstreicht die bisher unterforschte mögliche Beteiligung autoimmunologischer Prozesse bei der Pathogenese bipolarer Störungen (21). 5.5 Symptomatik und Therapie der Lithium Intoxikation Die Lithiumintoxikation ist aufgrund der geringen therapeutischen Breite Lithiums weiterhin ein häufiges und daher klinisch hoch relevantes Problem bei Lithium-behandelten Patienten. Die Evidenz zum therapeutischen Management der Lithiumintoxikation resultiert aktuell lediglich aus Tierstudien, pharmakokinetischen Studien und kleineren Beobachtungsstudien, weshalb verfügbare Behandlungsleitlinien einer erheblichen Variabilität unterliegen. Abb. 15 macht deutlich, dass zwischen akuter und chronischer Intoxikation unterschieden werden muss. Abb. 15: Haussmann et al. (2015) Int J Bipolar Disord 3:23. (22) Die Autoren geben eine Übersicht zur aktuellen Evidenz zur Behandlung der Lithiumintoxikation, um einen Beitrag zur Standardisierung dieser potentiell lebensbedrohlichen Komplikation zu leisten (22). Im Rahmen der Literatursuche wurden eine beträchtliche Anzahl an Einzelfallberichten und kleineren Fallserien detektiert. Es wurden jedoch keine randomisierten, placebokontrollierten Studien oder Metaanalysen gefunden, weshalb der Fokus in puncto klinischer Evidenz auf Fallserien und relevanten Übersichtsartikeln lag. Abb. 16 fasst die Indikationsstellung und den Zeitpunkt der Beendigung der Hämodialyse zusammen; Abb. 17 die therapeutischen Optionen bei Lithiumintoxikation. Abb. 16: Indikationen zur Hämodialyse. Haussmann et al. (2015) Int J Bipolar Disord 3:23. (22) Seite 24 Abb. 17: Haussmann et al. (2015) Int J Bipolar Disord 3:23. (22) Kommentar: Die Autoren verdeutlichen, dass die Datenlage insbesondere in Bezug auf die Indikationsstellung und den Zeitpunkt der Beendigung der Hämodialyse insuffizient und inkonsistent sind. Neben den Behandlungsaspekten heben die Autoren die Bedeutung präventiver Maßnahmen hervor und betonen dabei neben einer kritischen Indikationsstellung und Patientenselektion die hohe Relevanz von Behandler- und Patientenwissen, um Lithiumintoxikationen wirkungsvoll verhindern zu können. Die Literaturübersicht zeigt auch die Notwendigkeit der Erarbeitung differenzierter Therapiestandards (22). 5.6 Placebo-kontrollierte Studie einer Zusatztherapie mit Armodafinil bei Depression im Rahmen einer Bipolar-I-Störung Für die Behandlung der bipolaren Depression sind derzeit nur 3 Substanzen zugelassen von der FDA: Quetiapin (Monotherapie), Olanzapin + Fluoxetin (in Kombination) sowie Lurasidon (als Monotherapie oder zusätzlich zu Lithium oder Valproat; nicht auf dem deutschen Markt). Armodafinil (R-Modafinil) ist in den USA zur Behandlung starker Schläfrigkeit bei Schichtarbeitern, Narkolepsie und als Zusatztherapie bei obstruktiver Schlafapnoe zugelassen. Mehrere, wenn auch nicht alle Studien weisen auf den Nutzen einer aus Armodafinil bestehenden Begleittherapie bei depressiven Episoden im Rahmen einer Bipolar-I-Störung hin. Frye und Kollegen (23) untersuchten in einer multizentrischen, Placebo-kontrollierten, doppelblind-randomisierten Studie die Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit einer solchen Zusatztherapie an insgesamt 399 Patienten, welche stabil auf einen Mood Stabilizer oder ein Neuroleptikum eingestellt waren und über 8 Wochen zusätzlich 150mg/d Armodafinil versus Placebo erhielten. Die Behandlung zeigte insgesamt keinen signifikanten Effekt auf die Ausprägung spezifisch depressiver Symptome (gemessen mit IDS-C30Score), jedoch zeigten sich innerhalb der Verumgruppe positive Wirkungen der Armodafinil-Behandlung auf folgende sekundäre Outcomeparameter: Verbesserung in der CGI, Verbesserung in der GAF und Remission (definiert als Verbesserung des IDS-C30 ≤ 11) (s. Abb. 18). Die Verträglichkeit war gut. IDS-C30 response and remission. Symptomatology–Clinician-Rated. IDS-C30 = 30-Item Inventory of Depressive Abb. 18: Frye et al. (2015) Int J Bipolar Disord 3(1):34. (23) Kommentar: Zugelassene Behandlungsoptionen für bipolare Depressionen sind begrenzt, weswegen weitere Therapiemöglichkeiten benötigt werden. Die zusätzliche Add-on Gabe von Armodafinil verbesserte (bei allgemein guter Verträglichkeit) die Symptome der bipolaren Depression, wenngleich nur in einigen sekundären Outcomeparametern. Weitere Untersuchungen zur Indentifikation von Subgruppen, die eine bessere Response auf Armodafinil aufweisen, sollten in Zukunft durchgeführt werden. 5.7 Einnahme von Nahrungsergänzungsstoffen bei Patienten mit bipolarer Störung Die Einnahme von nicht-verschreibungspflichtigen, vielfach in Drogerie- und Supermärkten erhältlichen sogenannten Nahrungsergänzungssubstanzen hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Es wird geschätzt dass etwa 50 % der US amerikanischen Bürger mehr oder weniger regelmäßige solche Substanzen einnehmen, insbesondere Vitamine, Mineralien (z.B. Magnesium), pflanzliche Stoffe, Aminosäuren und Proteine. In der vorliegenden Studie wurden 348 Personen aus den USA mit bipolarer Störung nach der Einnahme solcher Substanzen befragt (24). Etwa 30 % der Befragten (n=101) nahmen zusätzlich zu ihren Medikamenten zur Behandlung der bipolaren Erkrankung mindestens eine Nahrungsergänzungssubstanz (insgesamt 40 verschiedene Subtanzen) über einen Zeitraum von mehreren Monaten ein. Am häufigsten wurden Fischöle, Vitamin B, Melatonin sowie Multivitamine eingenommen. Insbesondere ältere Patienten, solche mit weißer Hautfarbe und einer längeren Erkrankungsdauer nahmen Nahrungsergänzungsstoffe häufiger ein. Kommentar: Viele Patienten mit bipolarer Störung nehmen zusätzlich in nicht unerheblichem Maße frei käufliche Nahrungsergänzungsstoffe ein. Die Ursache hierfür ist vermutlich vielfältig. Da viele dieser Stoffe negative Interaktionen mit herkömmlichen Medikamenten verursachen können, ist es wichtig, dass Ärzte ihre Patienten nach der Einnahme von Nahrungsergänzungsstoffen befragen (inklusive der Motivation), um mögliche negative pharmakokinetische Konsequenzen abschätzen zu können. Seite 26 6 Psychologische Faktoren und IT-basierte Interventionen 6.1 Die Bedeutung von Lebensereignissen und psychologischen Faktoren hinsichtlich des Beginns von ersten und wiederkehrenden affektiven Episoden bei Kindern von bipolar Erkrankten: Ergebnisse einer niederländischen Studie Lebensereignisse sind ein bekannter Risikofaktor hinsichtlich des Beginns und Wiederauftretens von unipolaren und bipolaren affektiven Episoden, insbesondere bei Vorliegen von genetischer Vulnerabilität. Das dynamische Wechselspiel zwischen Lebensereignissen und psychologischen Zusammenhängen wurde jedoch bisher wenig erforscht. In der vorliegenden Studie aus den Niederlanden wurde der Einfluss von Lebensereignissen auf den Beginn bzw. das Wiederauftreten von affektiven Episoden von Kindern bipolar Erkrankter sowie die Auswirkungen von Temperament, Krankheitsbewältigung sowie Erziehungsstil auf diese Verbindung untersucht (25). Methodisch wurden Kinder bipolar Erkrankter (n = 108) im Langzeitverlauf von der Adoleszenz bis ins Erwachsenenalter untersucht und affektive Störungen wurden mit dem „Kiddie Schedule für affektive Erkrankungen und Schizophrenie-Gegenwarts- und Lebenszeit-Version“ (K-SADS-PL) oder dem Strukturierten Klinischen Interview für Achse-I-Erkrankungen (SKID) des DSMIV bewertet; Lebensereignisse mit dem „Life Events and Difficulties Schedule“ (LEDS) sowie die psychologischen Messwerte mit der Utrechter Bewältigungsliste, dem Temperament und Charakter Inventar (TCI) und der Kurzform des EMBU (Memories of Upbringing Instrument). Anderson-Gill Modelle (Erweiterungen des Cox Modells, portionales hazard Model) wurden zur Auswertung genutzt. Die Ergebnisse zeigen: Lebensereignisse hängen mit einem erhöhten Risiko für erste und – wenn auch weniger ausgeprägt – nachfolgende affektive Episoden zusammen. Passive Krankheitsbewältigungsstrategien vergrößern das Risiko für den Beginn wie das Wiederauftreten von affektiven Episoden, verändern aber ebenso die Auswirkungen von Lebensereignissen auf affektive Erkrankungen. Eine Veranlagung zur Vermeidung von Leid war mit Wiederauftreten von affektiven Episoden assoziiert (25). Kommentar: Zusammenfassend kann resümiert werden, dass Lebensereignisse speziell ein Risikofaktor für den Beginn einer affektiven Erkrankung sind, allerdings weniger für Rückfälle von Episoden. Psychologische Faktoren (passives Bewältigungsstrategien und Veranlagung zur Vermeidung von Leid) tragen zu einem Risiko des Wiederauftretens einer Episode bei und haben ferner einen moderierenden Effekt auf den Zusammenhang zwischen Lebensereignissen und affektiven Episoden. Diese Ergebnisse begründen möglichst frühe Interventionsstrategien für Kinder bipolar Erkrankter. 6.2 Stimmungsschwankungen bei Bipolar-I versus Bipolar-IIStörungen: kontinuierliche tägliche Selbstbeobachtung mittels Smartphone Manische und depressive Episoden entwickeln sich üblicherweise innerhalb von Tagen bis Wochen. Die Prävention neuer Episoden ist das zentrale Ziel in der Langzeit-Behandlung von Patienten mit bipolarer Störung. Um beginnende Episoden frühzeitig behandeln zu können ist eine zeitige Identifikation von Frühwarn-Symptomen unerlässlich. Da die Termine bei dem behandelnden Arzt meist mehrere Wochen auseinander liegen obliegt es schwerpunktmäßig den Patienten, die Frühwarnzeichen zu erkennen. Die Beobachtung der eigenen Symptomatik erfolgt häufig mittels „Mood-Chart“. Diese können entweder schriftlich ausgefüllt werden oder auf elektronischer Erfassung basieren. Diese traditionellen Formen des „Mood-Charting“ haben jedoch erhebliche Einschränkungen in der alltäglichen klinischen Praxis. Erstens wird beim täglichen „Mood-Charting“ nur retrospektiv der Verlauf der vergangenen 24 Stunden erfasst und kann daher erheblich durch Recall-Bias gestört werden. Zweitens hindern die Symptome einer beginnenden Episode (z.B. Gedankenrasen, Ablenkbarkeit) den Patienten daran Symptome sorgfältig zu notieren. Drittens ist diese Form der Symptomerfassung auch für zuverlässige Patienten letztendlich ermüdend, so dass diese ihre Beteiligung einstellen. Die Entwicklung innovativer Formen der Erfassung, welche eine langfristige Quantifizierung von Symptomen auch ohne oder mit nur marginaler Beteiligung der Patienten ermöglichen, ist daher von hoher Bedeutung. Das Smartphonebasierte ambulante Assessment mit Echtzeit-Datenerfassung und schwellenwertabhängiger Intervention ist eine solche Entwicklung (Übersicht: (26)). In der Pilotstudie von Faurholt-Jepsen et al. (27) wurden Unterschiede zwischen Bipolar-I und Bipolar-II-Patienten hinsichtlich der täglich erlebten Symptomatik mittels dieser neuen Technologie untersucht, welche bei bipolar erkrankten Personen auch zwischen einzelnen Krankheitsepisoden häufig weiter im Sinne instabiler Stimmung bestehen bleibt. Insgesamt 33 Patienten (13 Bipolar-I, 20 Bipolar-II) nutzten für jeweils mindestens sechs Monate ein Smartphone-basiertes Selbstbeobachtungssystem, worüber Stimmung, Schlaf, Medikation, Aktivitätslevel, Gereiztheit und weitere Symptome auf täglicher Basis erfasst wurden. Patienten vom Erkrankungstyp Bipolar-II hatten im Vergleich zu Bipolar-I Patienten durchschnittlich deutlich niedrigere Stimmungswerte angegeben (-0.54 vs. -0.19 auf einer Skala von -3 bis +3; p=0.02), weniger euthyme Tage berichtet (51.0 % vs. 74.5 %; p=0.03) sowie durchschnittlich mehr Tage mit depressiver Symptomatik verbracht (45.1 % vs. 18.8 %; p=0.01). Unterschiede hinsichtlich mit (hypo)manischer Symptomatik verbrachter Tage wurden nicht berichtet (2.7 % vs. 5.5 %; p=0.17). Kommentar: Die Pilotstudie zeigte, dass ein Smartphone-basiertes Selbstbeobachtungssystem von Patienten angenommen wird und technisch machbar ist. Im Vergleich zur Typ-I Störung scheint die Stimmung von Patienten mit Bipolar-II Störung instabiler zu sein und sie verbringen trotz kontinuierlicher Behandlung relativ wenig Zeit in euthymer Stimmungslage, weswegen gerade bei Menschen diesen Erkrankungstyps ein besonderes Augenmerk auf subsyndromale Symptome gelegt werden sollte und verbesserte Behandlungsstrategien benötigt werden. 6.3 Tägliche Smartphone-basierte Selbstbeobachtung bei bipolaren Störungen – MONARCA I: placebo-kontrollierte Studie In dieser randomisierten klinischen Studie von derselben Arbeitsgruppe wie unter 6.2 beschrieben, wurde der Fragestellung nachgegangen, inwiefern die tägliche Nutzung elektronischer Selbstbeobachtung mittels Smartphonetechnologie eine Reduktion depressiver und manischer Symptomatik bei Patienten mit bipolaren Erkrankungen erzielen kann (28). Hierfür wurde insgesamt 78 Patienten für sechs Monate ein Smartphone überlassen, wobei bei einer Hälfte der Teilnehmer (der Interventionsgruppe) zum einen über ein elektronisches Selbstbeobachtungssystem Stimmung, Schlaf, Medikation, Aktivitätslevel, Gereiztheit und weitere Symptome auf täglicher Basis erfasst Seite 28 wurden und zum anderen eine Feedbackschleife sowohl die behandelnde Klinik als auch den Patienten selbst über die von ihm eingegebene Symptomatik informierte. Bei Auffälligkeiten hinsichtlich bipolarer Symptomatik wurden die Patienten in der Interventionsgruppe per SMS, Anruf oder E-Mail kontaktiert, mögliche Interventionen besprochen bzw. Termine in der Klinik vereinbart. Signifikante Unterschiede hinsichtlich depressiver oder manischer Symptomatik zwischen den beiden Gruppen konnten nicht gefunden werden, in beiden Gruppen konnte eine Verringerung hinsichtlich der Symptomschwere während der 6-monatigen Studienteilnahme gezeigt werden. Patienten der Interventionsgruppe erlebten tendenziell vermehrt depressive Symptomatik (p=0.066), bei Personen mit manischer Symptomatik reduzierte sich diese im Verlauf (p=0.051). Kommentar: Der Einsatz elektronischer Selbstbeobachtungsmethoden muss weiter kritisch untersucht und der Nutzen für die Behandlung bipolarer Erkrankungen überprüft werden bevor Smartphonetechnologien als klinisches Mittel in der Praxis eingesetzt werden. 7 Literatur 1. Leopold et al. (2013) Prävention bipolarer Störungen. Nervenarzt 84(11):1310-5. 2. Pfennig et al. (2014) Early specific cognitive-behavioural psychotherapy in subjects at high risk for bipolar disorders: study protocol for a randomised controlled trial. Trials 8;15:161. 3. Pfennig et al. (2015) Symptom characteristics of depressive episodes prior to the onset of mania or hypomania. Acta Psychiatr Scand DOI: 10.1111/acps.12469 [Epub ahead of print]. 4. Ritter et al. (2015) Disturbed sleep as risk factor for the subsequent onset of bipolar disorder – Data from a 10-year prospective-longitudinal study among adolescents and young adults. J Psychiat Res 68:76-82. 5. Zeschel et al. (2015) Temperament and prodromal symptoms prior to first manic/hypomanic episodes: Results from a pilot study. J Affect Disord 173:39-44. 6. Keown-Stoneman et al. (2015) Multi-state models for investigating possible stages leading to bipolar disorder. Int J Bipolar Disord 3:5. 7. American Psychiatric Association (2015) Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen (DSM-5). Falkai P, Wittchen HU (Hrsg.) Hogrefe, Göttingen. 8. Malhi et al. (2015) Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists clinical practice guidelines for mood disorders. Aust N Z J Psychiatry 49(12):1087-206. 9. Möller et al. (2015) DSM-5 reviewed from different angles: goal attainment, rationality, use of evidence, consequences-part 2: bipolar disorders, schizophrenia spectrum disorders, anxiety disorders, obsessive-compulsive disorders, trauma- and stressor-related disorders, personality disorders, substance-related and addictive disorders, neurocognitive disorders. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 265(2):87-106. 10. Angst J (2015) Will mania survive DSM-5 and ICD-11? Int J Bipolar Disord 3:24. 11. Kemner et al. (2015) The influence of life events on first and recurrent admissions in bipolar disorder. Int J Bipolar Disord 3:6. 12. Wu et al. (2015) Relative Risk of Acute Myocardial Infarction in People with Schizophrenia and Bipolar Disorder: A Population-Based Cohort Study. PLoS One 10(8):e0134763. 13. Lewitzka et al. (2015) The suicide prevention effect of lithium: more than 20 years of evidence-a narrative review. Int J Bipolar Disord 3(1):32. 14. Lan et al. (2015) A reduced risk of stroke with lithium exposure in bipolar disorder: a population-based retrospective cohort study. Bipolar Disord 17(7):705-14. 15. Leopold et al. (2016) Type 2 diabetes and pre-diabetic abnormalities in patients with bipolar disorders. J Affect Disord 189:240-5. 16. Bocchetta et al. (2015) Renal function during long-term lithium treatment: a crosssectional and longitudinal study. BMC Medicine 13:12. 17. Kessing et al. (2015) Use of Lithium and Anticonvulsants and the Rate of Chronic Kidney Disease: A Nationwide Population-Based Study. JAMA Psychiatry 72(12):1182-91. 18. Conell·et al. (2015) Gibt es bei der Lithiumlangzeitbehandlung ein erhöhtes Risiko für Nierentumoren? Nervenarzt 86:1157–61. 19. Pottegård et al. (2015) Long-Term Lithium Use and Risk of Renal and Upper Urinary Tract Cancers. J Am Soc Nephrol. 2015 May 4. pii: ASN.2015010061. [Epub ahead of print]. 20. Kessing et al. (2015) Lithium and renal and upper urinary tract tumors - results from a nationwide population-based study. Bipolar Disord 3. doi: 10.1111/bdi.12344. [Epub ahead of print]. 21. Kraszewska et al. (2015) A cross-sectional study of thyroid function in 66 patients with bipolar disorder receiving lithium for 10-44 years. Bipolar Disord 17(4):37580. 22. Haussmann et al. (2015) Treatment of lithium intoxication: facing the need for evidence. Int J Bipolar Disord 3:23. 23. Frye et al. (2015) Randomized, placebo-controlled, adjunctive study of armodafinil for bipolar I depression: implications of novel drug design and heterogeneity of concurrent bipolar maintenance treatments. Int J Bipolar Disord 3(1):34. 24. Bauer et al. (2015) Common use of dietary supplements for bipolar disorder: a naturalistic, self-reported study. Int J Bipolar Disord 3:12. Seite 30 25. Kemner et al. The role of life events and psychological factors in the onset of first and recurrent mood episodes in bipolar offspring: results from the Dutch Bipolar Offspring Study. Psychol Med. 2015 Sep;45(12):2571-81. 26. Faurholt-Jepsen et al. (2015) Smartphone data as an electronic biomarker of illness activity in bipolar disorder. Bipolar Disord 17(7):715-28. 27. Faurholt-Jepsen et al. (2015) Mood instability in bipolar disorder type I versus type II-continuous daily electronic self-monitoring of illness activity using smartphones. J Affect Disord 186:342-9. 28. Faurholt-Jepsen et al. (2015) Daily electronic self-monitoring in bipolar disorder using smartphones - the MONARCA I trial: a randomized, placebo-controlled, single-blind, parallel group trial. Psychol Med 45(13):2691-704.