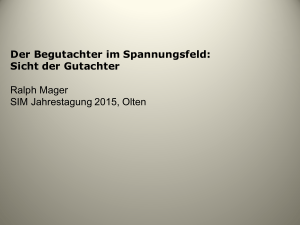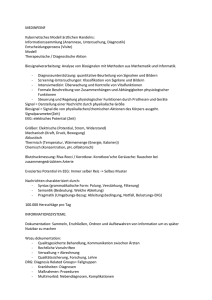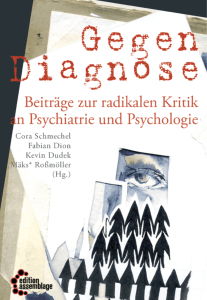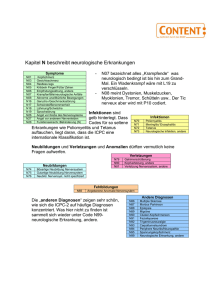Brief für Korrespondenz - IV-Stellen
Werbung

IV-STELLEN-KONFERENZ CONFERENCE DES OFFICES AI CONFERENZA DEGLI UFFICI AI CONFERENZA DILS UFFIZIS AI Das Kreuz mit psychiatrischen Diagnosen Prof. Dr. Wulf Rössler, Universität Zürich In der Bevölkerung gibt es ein tief verwurzeltes Misstrauen nicht nur gegenüber psychisch Kranken sondern auch gegenüber den Diensten und Einrichtungen, die psychisch kranke Menschen betreuen und behandeln. Zusätzlich befürchten viele Menschen, dass normales Verhalten vorschnell pathologisiert wird. Wie tief dieses Misstrauen sitzt, wurde kürzlich deutlich, als eine Revision des amerikanischen Klassifikationssystems DSM 5 vorgestellt wurde, wo teilweise neue psychiatrische Diagnosen eingeführt oder die diagnostische Schwelle für einige Diagnosen abgesenkt wurde. Die öffentliche Empörung fand ihren Ausdruck in zahlreichen Artikeln und Stellungnahmen in den Massenmedien ob der zu erwartenden Inflation psychiatrischer Diagnosen und der damit einhergehenden Psychiatrisierung der Bevölkerung. Bei oberflächlicher Betrachtung hat tatsächlich in den letzten Jahrzehnten die Zahl psychiatrischer Diagnosen enorm zugenommen. Zugegeben, es besteht eine gewisse Willkür der psychiatrischen Experten. Psychiatrische Diagnosen haben i.d.R. kein somatisches Substrat. Demzufolge gibt es auch keine Labortests, die eine Diagnose verifizieren. Alle neurowissenschaftlichen oder sonstigen differentialdiagnostischen Erkenntnisse beruhen auf Gruppenunterschieden mit einer breiten Überlappung zwischen gesund und krank. Eine präzise Zuordnung zu den Kategorien „gesund“ oder „krank“ ist nicht möglich. Psychiatrische Diagnosen werden deshalb bis heute ausschliesslich klinisch gestellt. Was aber in den vergangenen Jahrzehnten versucht wurde, war, gestörtes Verhalten präziser zu beschreiben, was eine Unterteilung bestehender Diagnosen zur Folge hatte. Damit war die Vorstellung verknüpft, dass sich präziser beschriebene Krankheitsbilder auch zielgenauer behandeln lassen. Diese Hoffnungen haben sich nur teilweise erfüllt. Jedenfalls lässt sich menschliches Verhalten nicht einfach erfinden und mit neuen psychiatrischen Diagnosen etikettieren. Hingegen ist die Grenze zwischen gesund und krank Gegenstand fortdauernder Diskussionen, nicht viel anders als in der Körpermedizin. Ab welchen Werten genau sprechen wir von einem Hypertonus oder einem Diabetes? Auch in der Körpermedizin ist die Grenzziehung bei vielen Krankheitsbildern nicht sehr trennscharf und Gegenstand fachspezifischer Diskussionen. Also kein Anlass auf die Psychiatrie herabzuschauen! Was die vorgenannte Revision des DSM 5 betrifft, war das Hauptanliegen, psychische Störungen möglichst frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Es gehört mittlerweile zum medizinischen Grundwissen, dass vorbeugen besser ist als heilen und Anfangsstadien einer Erkrankung eine bessere Prognose haben als chronische Erkrankungen. Das gilt mittlerweile auch für die Psychiatrie. Aber mit das Wichtigste einer psychiatrischen Diagnose ist, inwieweit Symptome die Funktionsfähigkeit der Patienten beeinträchtigen. Jedenfalls sind es häufig weniger die einzelnen Symptome einer psychiatrischen Störung als die daraus resultierende gestörte Funktionsfähigkeit und das damit verbundene subjektive Leiden, weswegen Patienten im Gesundheitswesen Rat und Hilfe suchen. Der Zeitpunkt, ab wann die Betroffenen nicht mehr richtig ihre Aufgaben erfüllen können, kann allerdings subjektiv sehr unterschiedlich empfunden werden. Deswegen ist vorschnelles Diagnostizieren und Behandeln eigentlich weniger ein Problem der Fachleute sondern eher der Patienten selbst, die Behandlung suchen und wünschen, wo die Diagnosekriterien (noch) nicht erfüllt sind. Landenbergstrasse 39 6005 Luzern Telefon 041 369 08 08 Fax 041 369 08 10 www.ivsk.ch www.coai.ch IV-STELLEN-KONFERENZ CONFERENCE DES OFFICES AI CONFERENZA DEGLI UFFICI AI CONFERENZA DILS UFFIZIS AI Wahrscheinlich ist die angestiegene Bereitschaft der Bevölkerung bereits wegen leichterer psychischer Probleme bei Ärzten Rat und Hilfe zu suchen, der Hauptgrund für den Anstieg psychiatrischer Diagnosen und nachfolgender Behandlungen im Gesundheitswesen. Sollten wir Patienten zurückweisen, weil sie ggfs. die Diagnosekriterien (noch) nicht erfüllen? Der Arzt, der nie Patienten behandelt, die nicht alle Diagnosekriterien erfüllen, werfe den ersten Stein. Eine Diagnose, die es in den Klassifikationssystem der Psychiatrie als eigenständige Diagnose gar nicht gibt, hat eine bemerkenswerte Karriere gemacht: das Burnout Syndrom – ein Begriff aus der Arbeits--‐ und Organisationspsychologie. Das Burnout Syndrom repräsentiert das Lebensgefühl einer gestressten modernen Gesellschaft. Der Begriff ist sozusagen vom Volk in die Medizin getragen worden und besitzt als solcher eine hohe Akzeptanz. Der Begriff „Burnout“ wird aber heute nicht nur von Betroffenen benutzt, um alle möglichen subjektiven Leidenszustände zu kennzeichnen, sondern auch gerne von Ärzten, die eine Stigmatisierung durch psychiatrische Diagnosen vermeiden wollen. Aber für Burnout gilt das Gleiche, wie für psychiatrische Diagnosen: es ist nicht nur eine Frage, ob die Schwelle zu einer Diagnose erreicht wird, sondern auch die Dauer der Störung und der damit einhergehenden Funktionseinschränkungen. Ob die „Funktionen“ eingeschränkt sind, hängt natürlich auch von den Anforderungen der Arbeitsumgebung ab. Bei steigenden Anforderungen steigt auch das Risiko für Funktionsstörungen. Nebenbei bemerkt tragen circa 60% der Schweizer Bevölkerung eine Brille --‐ mit steigender Tendenz. Das ist weniger auf das geschickte Marketing der Brillenglassindustrie zurückzuführen, sondern den gestiegenen Anforderungen an unsere Lesefähigkeiten, dem wachsenden Anteil an Computerarbeit oder der Mobilität mit Individualverkehrsmitteln geschuldet. Ähnliches gilt für die Diskussion um das ADHD. Würden wir in Mitteleuropa noch im Wald leben und als Jäger und Sammler unseren Lebensunterhalt sicherstellen, gäbe es dieses Störungsbild mutmasslich nicht bzw. würde nicht als Störung interpretiert. Aber in unserer heutigen Bildungsgesellschaft mit langen Ausbildungszeiten ist es ein Muss für Kinder und Jugendliche bestimmte Zeitstrecken ruhig sitzen und sich konzentrieren zu können. Wer vorschlägt, unruhige Kinder mehrere Stunden am Tag im Freien zu beschäftigen, benachteiligt diese Kinder in ihren Lebenschancen. Und weiterführend: eine niedrigere Bildung erhöht das Risiko für psychische Störungen lebenslang. Menschen mit psychischen Erkrankungen haben ein beträchtliches Beschäftigungsrisiko. Je nach Schwere der Erkrankung sind bis zu 80% arbeitslos. Sind sie einmal arbeitslos, verlaufen ihre psychischen Erkrankungen chronischer mit einer Tendenz zur Verschlechterung. Sind sie in Beschäftigung, ist ihr Einkommen deutlich unterdurchschnittlich. Krankheitsabwesenheiten sind deutlich häufiger und v.a. Menschen mit psychischen Erkrankungen sind inzwischen die Hauptgruppe derer, die frühberentet werden. Es ist nicht Gegenstand dieses Vortrags sich damit auseinander zu setzen, ob Frühberentungen ein unabänderliches Schicksal sind – wohl eher nicht, wie viele Integrationsmassnahmen zeigen. Ausserdem ist es keine exklusive Aufgabe der Invalidenversicherung. Viele der Krankheitsabwesenheiten und nachfolgenden Frühberentungen stehen im Zusammenhang mit organisatorischen Mängeln in der Arbeitsumgebung. Während die Arbeitsmedizin ein scharfes Auge auf die physische Umwelt der Beschäftigten hat, steckt die Analyse der psycho--‐sozialen Arbeitsumwelt der Beschäftigten noch in den Kinderschuhen. Viele Beschäftigte ziehen den Status der Arbeitsunfähigkeit den der (drohenden) Arbeitslosigkeit vor. Ausserdem haben viele Arbeitnehmer in höherem Alter das Gefühl, genug geleistet zu haben. Mit ihren Ärzten verbindet sie ein therapeutisches Bündnis, die sie nachvollziehbar in ihren Anliegen unterstützen. Für die Sozialleistungsversicherungen bleibt es ihrerseits ein verständliches Anliegen, eine Behinderung von allgemeinem Elend und persönlichem Leid unterscheiden zu können. Also, was macht eine Behinderung wegen einer psychischen Erkrankung aus und rechtfertigt ggfs. eine nachfolgende Berentung? Wenn es nicht unbedingt die Diagnose ist, sind es mindestens drei 2/3 IV-STELLEN-KONFERENZ CONFERENCE DES OFFICES AI CONFERENZA DEGLI UFFICI AI CONFERENZA DILS UFFIZIS AI Faktoren, die wesentlich Einfluss nehmen: die Chronizität einer Erkrankung, komorbide Erkrankungen (i.d.R. eine psychische Störung, die mit einer körperlichen Erkrankung zusammen vorliegt) und die Persönlichkeit der Betroffenen. Die meisten Nicht-Fachleute sind sich zumeist nicht bewusst, dass viele psychische Störungen auf dem Boden einer vorbestehenden Vulnerabilität entstehen. Diese Vulnerabilität hat viele Ursachen, meist eine Mischung aus individuell--‐genetischen und umgebungsbedingten Einflussfaktoren während der Kindheit und Jugend. Wie wir die Welt wahrnehmen und interpretieren macht dann im Erwachsenenalter unsere Persönlichkeit aus. Die Persönlichkeit beeinflusst dann auch wesentlich unseren Umgang mit (psychischen) Erkrankungen. Wesentlichen Einfluss auf das Risiko der Chronifizierung und damit auf das Risiko einer Behinderung zu entwickeln, haben auch komorbide Erkrankungen, z.B. Herz--‐Kreislauferkrankungen oder Diabetes. Wenn sich im Rahmen einer somatischen Erkrankung eine Depression entwickelt, stehen die Chancen für eine Rückkehr ins Arbeitsleben nicht gut. Die Invalidenversicherung steht am Ende einer langen Reihe von Versäumnissen. Der berühmte Ökonom Richard Layard hat erst kürzlich festgestellt, dass wir nicht zu viel sondern entschieden zu wenig für die Therapie psychischer Erkrankungen ausgeben. Korrespondenzadresse: Prof. Dr. med. Dipl.‐Psych. Wulf Rössler Militärstrasse 8 CH--‐8021 Zürich [email protected] 3/3