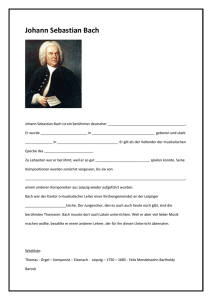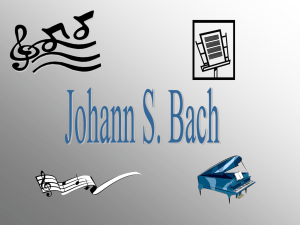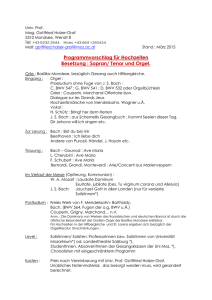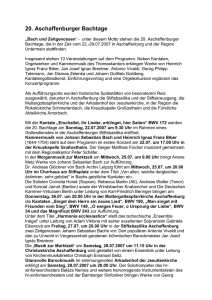DIE MUSIKGESCHICHTE DES 19. JAHRHUNDERTS KANN MAN
Werbung

Christian Martin Schmidt DIE MUSIKGESCHICHTE DES 19. JAHRHUNDERTS KANN MAN OHNE BACH NICHT SCHREIBEN CHRISTIAN MARTIN SCHMIDT „Nachdem ich, einem mutmaßlichen Wunsch des geneigten Lesers entsprechend, Bach in dieser Darstellung verhältnismäßig viel Raum gewidmet habe, muß ich bekennen, daß ich als Historiker ein schlechtes Gewissen habe: denn nach diesem Unterkapitel habe ich den Faden genau dort wieder aufzugreifen, wo ich ihn liegen ließ“1. Dieser Satz, mit dem Jacques Handschin in seiner Musikgeschichte im Überblick das vornehmlich Mozart und Haydn gewidmete Kapitel über den klassischen Stil in der Instrumentalmusik eröffnet, exponiert einen eklatanten Widerspruch. Auf der einen Seite bringt Handschin seine Überzeugung zum Ausdruck, daß Bach kein wesentlicher Anteil an der historischen Entwicklung des 18. Jahrhunderts zukomme, daß mithin der Gang der Musikgeschichte in diesem Jahrhundert über Bach hinweggegangen sei und daß es folglich der Gewissensruhe eines nur an der Sache orientierten Musikhistorikers zuträglicher gewesen wäre, in seiner Darstellung dem Thomaskantor die ihm angemessene, das heißt geringe Rolle zuzuweisen. Dem steht der mutmaßliche Wunsch des geneigten Lesers gegenüber, der einen Historiker selbst vom Format Handschins zu Konzessionen zwingt. Es ist der Leser des Jahres 1948, als die Musikgeschichte im Überblick zum ersten Mal erschien, ein Leser, dessen Bach-Bild von einer ganz anderen – eher unhistorischen und jedenfalls dem frühen 18. Jahrhundert ganz fremden – Überzeugung geprägt ist, nämlich der von der „Greatness in Music“ oder „Größe in der Musik“, wie Alfred Einstein eines seiner bedeutendsten Bücher genannt hat. Kennzeichnend für diese Kategorie, die ganz und gar dem 19. Jahrhundert zugehört und folglich im 20. wesentlich nur noch retrospektiv, das heißt für Komponisten vorangegangener Epochen, immer weniger dagegen für solche der eigenen Zeit Anerkennung findet, ist die Zugehörigkeit zu einem ganzheitlichen Konzept von Kunst, Kultur, mithin zu einem – heute brüchig 1 J. Handschin, Musikgeschichte im Überblick, 2. Aufl., Luzern/Stuttgart 1964, S. 329. Die Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts kann man ohne Bach nicht schreiben gewordenen und wohl kaum mehr reparablen – Orientierungs- und Identifikationsrahmen der Gebildeten. Der substantielle Rang dieser Kategorie ist deshalb vielleicht eher durch literarische Zeugnisse denn durch direkt als Musikschrifttum gedachte Abhandlungen zu illustrieren und in seiner Strahlkraft, die angekränkelt ist, wenigstens begreifbar zu machen. So legt Thomas Mann, dessen Beschäftigung mit Musik oder auch der Größe in Musik zu einer Grundkonstante seines literarischen Werks gehört, 1901, das heißt knapp fünfzig Jahre vor jener Konzession Handschins, einem Nachfolger Dietrich Buxtehudes in den Buddenbrooks die folgenden Worte in den Mund, bei denen weniger der Inhalt denn die Emphase davon zeugt, daß von etwas ganz Großem, Erhabenem die Rede ist: „O Bach! Sebastian Bach, verehrteste Frau!“ rief Herr Edmund Pfühl, Organist von Sankt Marien, der in großer Bewegung den Salon durchschritt, während Gerda lächelnd, den Kopf in die Hand gestützt, am Flügel saß, und Hanno, lauschend in einem Sessel, eines seiner Knie mit beiden Händen umspannte … „Gewiß … wie Sie sagen … er ist es, durch den das Harmonische über das Kontrapunktische den Sieg davongetragen hat … er hat die moderne Harmonik erzeugt, gewiß! Aber wodurch? Muß ich Ihnen sagen, wodurch? Durch die vorwärtsschreitende Entwicklung des kontrapunktischen Stiles – Sie wissen es so gut wie ich! Was also ist das treibende Prinzip dieser Entwicklung gewesen? Die Harmonik? O nein! Keineswegs! Sondern die Kontrapunktik, verehrteste Frau! Die Kontrapunktik! … Wozu, frage ich Sie, hätten wohl die absoluten Experimente der Harmonik geführt? Ich warne … solange meine Zunge mir gehorcht, warne ich vor den bloßen Experimenten der Harmonik!“2 Wie nun aber ist der genannte Widerspruch zu erklären; wie konnte ein solcher, in der Musikgeschichte wahrhaft einzigartiger Wandel hinsichtlich der Geltung eines Komponisten bzw. dessen Werkes geschehen? Verblüfft ist auch Richard Wagner, dies freilich ganz im Blick aufs Metier und – wie noch mehrfach aufgrund der Tagebücher von Cosima zu dokumentieren sein wird – in der sicheren Überzeugung der Größe von Bach: „Und diese Wunder von dem armen Kerl mit der Perücke auf dem Clavicembalo, es ist unglaublich“3. Auf der einen Seite steht der Thomaskantor, dessen Kompositionen in den letzten zwei Dekaden seines Lebens als veraltet, überholt angesehen wurden und dessen unmittelbare Geschichtswirksamkeit – wie von Handschin – angezweifelt werden kann. Auf der anderen Seite tritt uns ein Genius der Musik entgegen, der Weltgeltung erlangt hat, der – um nochmals Wagner zu zitieren – als der „eigentliche Musiker“ selbst über Mozart und Beethoven stünde4 und hinsichtlich dessen Albert Schweitzer in der Gewißheit des allgemeinen 2 Th. Mann, Buddenbrooks. Verfall einer Familie, achter Teil, sechstes Kapitel, Anfang. 3 C. Wagner, Die Tagebücher, 4 Bde, hrsg. v. M. Gregor-Dellin u. D. Mack, 2. Aufl., München/Zürich 1982, 4/S. 1047. 4 Ebenda, S. 4/S. 730. Christian Martin Schmidt Einverständnisses formulieren konnte: „Jahrhunderte und Generationen haben an dem Werke gearbeitet, vor dessen Größe wir ehrfürchtig stille stehen“5. In der Tat hat das 19. Jahrhundert Bach zunehmend einen Rang an Größe, Erhabenheit und fast mythischer Verklärtheit zugesprochen, der ansonsten einzig Beethoven zukommt; und das hat sich bis auf den heutigen Tag nicht geändert, wiewohl die mythische Komponente bei Beethoven wohl größere Blüten getrieben hat. Das blieb zwar nicht ohne – freilich folgenlose – Einwände. So spricht Elisabet von Herzogenberg, eine kluge und überaus kunstverständige Frau, in ihrem Brief vom 1. Dezember 1879 an Brahms, von „der gang und gäben, konventionellen Bewunderung für den »alten Bach«“6, und – wie wiederum dieselbe Schreiberin berichtet – warf Friedrich Chrysander, der große Händel-Forscher, Brahms die „einseitig dünkende Vergötterung Bachs“ vor7. Keineswegs Händel, wohl aber Bach betrifft unsere Ausgangsfrage. Warum also kann man sie, um auf die Ebene der Geschichtsschreibung zurückzukehren, mit Carl Dahlhaus folgendermaßen auf den Punkt bringen: „Die Musikgeschichte des 18. Jahrhunderts kann man, wie Jacques Handschin behauptete, ohne Bach oder an ihm vorbei schreiben – trotz seines Einflusses auf Philipp Emanuel –, die des 19. Jahrhunderts nicht“8. Ob Handschins Behauptung bezüglich Bachs Rolle innerhalb der Musikgeschichte des 18. Jahrhunderts zutrifft, ist hier nicht unser Gegenstand. Sicher dagegen ist, daß die verbreitete Auffassung, Bachs Kompositionen seien nach seinem Tod gänzlich vergessen worden und erst durch die Berliner Aufführung der Matthäus-Passion 1829 wie Phönix aus der Asche wiederaufgestanden, in den Bereich der Legenden gehört. Sehr wohl gab es mehrere Stränge einer Bach-Tradition, von denen ich hier nur auf die wichtigsten hinweisen möchte, weil sie für die Art der Rezeption im 19. Jahrhundert gleichsam Vorgaben gemacht haben. Erinnert sei nur an die mittlerweile gut dokumentierte Bach-Pflege in Wien, die in Gottfried van Swieten ihren vielleicht nicht wichtigsten, aber doch namhaftesten Vertreter hat. Genannt sei auch die nur selten unterbrochene Aufführungstradition der Bachschen Vokalwerke (freilich nur der kleineren) an der Thomasschule in Leipzig. Zweifellos am breitesten und folgenreichsten indes war die Tradierung Bachs in Berlin. (Die Vorbildfunktion der Berliner Sing-Akademie, die Hans Heinrich Eggebrecht in dieser Hinsicht für das beginnende 19. Jahrhundert konstatiert, hatte – dies als kennzeichnendes Detail in Parenthese – sogar die Konsequenz, daß man sich in Leipzig als eigentlicher Wahrer des Bach-Erbes in Frage gestellt fühlte. Die 5 A. Schweitzer, Johann Sebastian Bach, Leipzig 1977, S. 18. 6 Johannes Brahms im Briefwechsel mit Heinrich und Elisabet von Herzogenberg, in: Johannes Brahms Briefwechsel Bd I, hrsg. von M. Kalbeck, 4. Aufl., Berlin 1921, S. 109. 7 Ebenda, S. 151. 8 C. Dahlhaus, Grundlagen der Musikgeschichte, Köln 1977, S. 248. Die Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts kann man ohne Bach nicht schreiben Tatsache, daß die Berliner Wiederaufführung der Matthäus-Passion von 1829 zwar in mehreren anderen deutschen Städten eine unmittelbare Nachfolge fand, die Thomasschule in Leipzig sich aber erst zwölf Jahre später, also 1841, zu einer Aufführung des Werkes bereitfand, hatte – wie Hans-Joachim Schulze unlängst vermutete – neben anderem auch den Grund, daß man sich dort selbst hinsichtlich des Aufführungsgegenstandes aus Berlin keine Vorschriften machen lassen wollte.) Die meisten Facetten der Berliner Bach-Tradition sind bekannt, etwa die persönlichen Bindungen nicht nur von Carl Philipp Emanuel, sondern auch von Christoph Nichelmann, Johann Friedrich Agricola und Johann Philipp Kirnberger an den Vorbild gebenden Thomaskantor oder auch die Tatsache, daß in der Sing-Akademie bereits drei Jahre nach ihrer Gründung, das heißt, 1794, unter Carl Friedrich Fasch, dem Vorgänger Zelters, Kompositionen von Bach zur Aufführung gebracht wurden. Ich möchte aber vor allem zwei weitere Aspekte in den Vordergrund rücken. Der eine betrifft die gegenständliche Grundlage der Berliner Bach-Pflege, nämlich die Vielzahl der Manuskripte, die nach der Erbteilung von 1750 über Carl Philipp Emanuel nach Berlin gelangten und damit überhaupt erst die Möglichkeit schufen, sich mit dem Werk Johann Sebastians theoretisch wie praktisch auseinanderzusetzen. Das muß insofern besonders hervorgehoben werden, als die Verbreitung der Kompositionen Bachs – letztlich bis hin zum Beginn der Gesamtausgabe im Jahre 1850 – sei es durch Drucke, sei es durch kursierende Abschriften, durchaus noch nicht geklärt ist und damit einigermaßen sichere Schlußfolgerungen hinsichtlich des zunächst bloß faktischen Kenntnisstandes der jeweiligen Rezipienten – welche Kompositionen waren wem überhaupt zugänglich – bisher nicht gezogen werden können. Der zweite Aspekt sollte sich als besonders folgenreich erweisen. Die musikalische Vorklassik in Berlin war eminent theoretisch, genauer: aufs Schreiben über Musik gerichtet, wie überhaupt das philosophische und musiktheoretische Denken im weiteren Zeitraum um 1800 eher im norddeutschen Raum angesiedelt war. Herauszuheben in diesem Kontext ist Friedrich Wilhelm Marpurg, der 1750/ 1751 bzw. 1752 an den beiden ersten Ausgaben der Kunst der Fuge beteiligt war; er hat namentlich mit seiner Abhandlung von der Fuge, die in zwei Teilen 1753 bzw. 1754 erschien, den – wenn auch problematischen – Rahmen für alle weitere Beschäftigung mit diesem Gegenstand abgesteckt, indem er einerseits von Bach als alles überragendem Musterautor dieser Kompositionsart ausging und andererseits von dessen Kompositionen im wesentlichen Fugen für Tasteninstrumente, nämlich die des Wohltemperierten Klaviers und die der Kunst der Fuge als Modelle hinstellte. Von den etwa 350 Seiten der Abhandlung sind nur 14 den, wie Marpurg es nennt, Singfugen gewidmet. Diese Ausrichtung oder Eingrenzung hat nicht nur die didaktische Theorie der Fuge bis auf den heutigen Tag, sondern auch die Bach-Rezeption des 19. Jahrhunderts aufs entscheidendste beeinflußt. Christian Martin Schmidt All die genannten Traditionsstränge verblieben trotz der inhaltlichen Intensität namentlich in Berlin im lokalen Rahmen und waren – um es schroff zu formulieren – nicht auf Weltgeltung angelegt. Sie schufen aber die faktische Voraussetzung für den historischen „Kairos“ der Wiederaufführung der Matthäus-Passion, der zu dem „Wunder der Musikgeschichte“ führte, wie Friedrich Blume die Bach-Rezeption im 19. Jahrhundert treffend bewertete. Voraussetzung war also einerseits die Präsenz Bachs in Berlin, die von Zelters Sing-Akademie nachhaltig befördert wurde und mit der sich zunächst die Familie Felix Mendelssohn Bartholdys, dann aber vor allem dieser selbst kompositorisch und praktisch uneingeschränkt identifizierte. (Man kann als Historiker Zweifel haben, ob der Rang als historisches Ereignis, den jene Wiederaufführung am 11. März 1829 in Berlin ohne jeden Zweifel erlangt hat, bzw. die Zuweisung an Berlin und die dort Beteiligten sachlich berechtigt ist; unklar ist die Rollenverteilung zwischen Zelter, Felix Mendelssohn Bartholdy und dessen Schwester Fanny, die damals noch nicht, wohl aber sieben Monate später, Hensel hieß; in Frage gestellt wird zweitens die alleinige Initiative der Berliner durch die Tatsache – auf die unlängst Michael Heinemann in seiner Dissertation über die Bach-Rezeption Liszts aufmerksam gemacht hat –, daß man in Frankfurt bereits intensiv an den Proben zu einer Aufführung der Matthäus-Passion war, die dann am 29. Mai, also nur gut zweieinhalb Monate nach der Berliner stattfand; drittens ist es zumindest überlegenswert, warum die Aufführung des Credo aus der h-Moll-Messe, die Gasparo Spontini 1828 in der Berliner Oper leitete, keine vergleichbare Wirkung zeitigte.) Die zweite und wohl noch wichtigere Voraussetzung für die epochale Wirkung jener Aufführung jedoch besteht in der allgemeinen Rezeptionshaltung der Zeit, innerhalb derer der Begriff „klassisch“ nun auch auf die Musik bezogen ein eingeführter Begriff war und die „Größe in der Musik“ von neuen Kompositionen bzw. repräsentativen Aufführungen geradezu erwartete. Ich will als Beleg dafür weniger Theoretiker oder Rezensenten bemühen, sondern lediglich auf die Häufigkeit hinweisen, mit der Beethoven Werke seiner Spätzeit als „groß“ bezeichnete, was sich – wohl überflüssig zu betonen – nicht allein auf die Dimension bezieht; op. 106 heißt Große Sonate für Hammerklavier, op. 133 Große Fuge, selbst die Diabelli-Variationen nennt Beethoven in einem Brief an Simrock „Große Veränderungen über einen bekannten Deutschen“. Und als am 7. Mai 1824 die 9. Symphonie im Wiener Kärntnertortheater zur Uraufführung gelangte, verzeichnete das Programm neben dieser „Großen Symphonie“ eine „Große Ouvertüre“, nämlich Die Weihe des Hauses op. 124 sowie drei „Große Hymnen“, nämlich das Kyrie, Credo und Agnus Dei aus der Missa solemnis op. 123. Solchem Anspruch an Größe hatte sich die Matthäus-Passion ziemlich genau zwei Jahre nach dem Tod Beethovens anzumessen, und sie wurde ihm – wie die Wirkung zeigt – in jeder Hinsicht gerecht. Geschafft war damit der Übergang vom historischen Relikt, das von ei Die Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts kann man ohne Bach nicht schreiben nigen wenigen geschätzt und gepflegt wurde, zum Gegenstand der ästhetischen Kontemplation und Verehrung vieler – genau hiermit sind die beiden Ebenen bezeichnet, die jenen von Handschin exponierten Widerspruch ausmachen. Die Komposition ist nicht mehr allein als geschichtliches Dokument in ihren historischen Kontext – und bei Bach in ihre äußere Zweckbestimmung – eingebunden, sondern wird dank ihrer Größe oder sachlichen Qualität als ein dem historischen Wandel enthobenes Objekt der Kunstbetrachtung angesehen. Und Bachs Musik bewährte sich innerhalb einer solchen, ihr originär gänzlich fremden Betrachtungsweise in einem solchen Maße, daß er nicht nur in den Kanon der Auctores classici Aufnahme fand, sondern in ihm sogar einen herausragenden Rang erlangte. Zusammen mit dem Begriff der Größe und Erhabenheit von Musik nämlich, ihrer Geltung als autonome Kunst, bildete sich seit Anfang des 19. Jahrhunderts nicht nur ein festes Repertoire von immer wieder aufgeführten Kompositionen heraus, sondern gleichermaßen ein Kanon von Komponisten, in denen bestimmte Genres ihre ausgezeichneten Vertreter fanden: Palestrina stand für die katholische Kirchenmusik, Bach für die protestantische, Gluck für die musikalische Tragödie und Mozart für die Opera buffa, Haydn für das Streichquartett, Beethoven für die Symphonie, Schubert für das Lied. Für Bach indes ist die genannte Zuordnung unvollständig, denn er steht nicht nur für den Bereich der evangelischen Kirchenmusik, sondern weit wichtiger noch für ein Grundprinzip kompositorischer Arbeit: für den Kontrapunkt und ganz speziell für die Fuge. Von ihr schreibt Carl Dahlhaus: „Die Fuge ist – neben der Symphonie – die einzige musikalische Form oder Struktur, von der man ohne Übertreibung sagen kann, daß sie im allgemeinen Bewußtsein der Gebildeten zu einer Idee oder sogar zu einem Mythos geworden ist: zu einem »Opus metaphysicum«“9. Und dieses Opus metaphysicum repräsentierte und repräsentiert ohne jede Einschränkung Bach. Das stellt ihn unmittelbar auf dieselbe Ebene, die allerhöchste in jenem Kanon, wie Beethoven, der das andere Opus metaphysicum, die Symphonie vertritt – ich werde darauf zurückkommen. Keine Symphonie des 19. Jahrhunderts wurde – um es überspitzt zu sagen – ohne direkten Bezug zu Beethoven geschrieben; und kein Komponist konnte eine Fuge verfertigen, ohne sich des übermächtigen Einflusses von Bach bewußt zu sein. Das hat zum einen darin seinen Grund, daß die weitgehend didaktisch ausgerichtete – allerdings auch überwiegend pedantisch bornierte – Fugentheorie, in welche die Kontrapunktlehrbücher regelhaft mündeten, im Anschluß an Marpurgs bis weit ins 19. Jahrhundert als mustergültig empfundene Abhandlung von der Fuge stets von Bach als Modell ausgingen. 9 C. Dahlhaus, Die Musiktheorie im 18. und 19. Jahrhundert, Darmstadt 1989 (= Geschichte der Musiktheorie, Bd 11), S. 149. Christian Martin Schmidt Und in der allgemeinen Rezeption zum zweiten gilt sogar das bloße Komponieren von Fugen als Bach-Bezug, wie namentlich bei Felix Mendelssohn Bartholdy, Robert Schumann, Franz Liszt oder Max Reger zu sehen ist – dies meist zu Recht und, etwa durch Einarbeitung des BACH-Topos eingestandenermaßen. Nun war die Fuge im 19. Jahrhundert ja alles andere als eine quantitativ herausragende Formungsart – Schönberg hat sie sogar als Durchführungstechnik bezeichnet und damit hinsichtlich ihres formalen Orts eingegrenzt –, ihre Geltung als das Nonplusultra des kompositorischen Metiers aber wurde dadurch in keiner Weise tangiert; man denke nur an die Kontrapunktstudien von Schumann, Brahms, bei dem allerdings der Kanon eine dominierende Rolle spielt, von Verdi und selbst von George Gershwin, der, als er 1928 von Jacques Ibert gefragt wurde, was er unter „seriös“ verstehe, auf Bach, die Fuge und den Kontrapunkt hinwies. Um den extraordinären Rang zu illustrieren, der der Fuge beigemessen wurde, möchte ich die Anleitung zur Fugenkomposition10 zitieren, die der Reger-Schüler und damalige Professor für Komposition an der Staatlichen akademischen Hochschule für Musik in Berlin, Hermann Grabner, 1934 veröffentlichte. Einleitung – Motto – ein Reger-Zitat: „Hundert Fugen muß man schreiben, dann kann man erst etwas!“ Einleitung – erster Absatz – das Fugenthema als Drohung oder wie man das gegnerische Defizit an Metier als Waffe benutzen kann: „Als Max Reger einmal von einem Kritiker eine schlechte Besprechung erhalten hatte, schleuderte er sie wütend hin und rief: »Der Kerl soll mir nur kommen! Dem gebe ich ein so schwieriges Fugenthema, daß er es nicht beantworten kann. Dann werde ich es ihm zeigen!«“. Einleitung – dritter Absatz – Rangbestimmung und Allgemeingültigkeit: »Auch heute noch gilt das Studium der Fuge als Abschluß des kompositionstechnischen Unterrichtes überhaupt. Hat der angehende Komponist und Dirigent seine kontrapunktische Routine und Beherrschung der strengen Form durch das »Gesellenstück« einer Fuge zu erweisen, so fordert man vom Schulmusiker mit Recht die Anfertigung einer schulgerechten Fugenexposition, da gerade die Bewältigung dieser Aufgabe den Nachweis seiner vielseitigen musikalischen Ausbildung erbringen kann: Beherrschung der kontrapunktischen Satztechnik, Sinn für melodisches Entwickeln, sicheres harmonisches Empfinden und zielbewußtes Formgefühl, Verständnis des Wesens der Fuge und ihrer vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten.“ Einleitung – vierter Absatz – Rückführung auf den Urvater bzw. die Bibel der Fugenkomposition: „In diesem Sinne mögen die folgenden Kapitel Anleitung 10 H. Grabner, Anleitung zur Fugenkomposition, Leipzig 1934, vergleiche S. 3. Die Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts kann man ohne Bach nicht schreiben sein, eine bescheidene Vorstufe zum vollkommensten aller Fugenlehrbücher, das sich uns in Bachs genialem Wohltemperierten Klavier präsentiert.“ Man kann ohne Übertreibung behaupten, daß das Wohltemperierte Klavier das Kernstück der Bach-Rezeption des 19. Jahrhunderts darstellt. Das hat wenigstens drei Gründe. Erstens galt es als Modell für den mit der Harmonie versöhnten Kontrapunkt und – wie wir bereits gesehen haben – als Muster für die kontrapunktische Didaktik. Zweitens kam es als Instrumentalstück mit der Maxime überein, daß sich die autonome Tonkunst in allererster Linie in der reinen, nicht mit Worten vermischten Instrumentalmusik erfülle. Und drittens kam es als Klavierstück der allgemeinen musikalischen Praxis der Zeit entgegen – ein Aspekt, dem in der Vergangenheit wohl allzu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Denn das 19. Jahrhundert ist nicht nur ein in Chorvereinen singendes, sondern vor allem auch klavierspielendes Jahrhundert. Wenn Bach in Opposition zu Händel, der in Chorkonzerten und Musikfesten mit seinen Oratorien für lange Zeit die Oberhand behielt, zu Recht als „Komponist für Komponisten“ bezeichnet wurde, bei dem man fürs eigene Komponieren lernen konnte – und kaum ein Komponist hat diese Chance ungenutzt gelassen –, so muß dem ergänzend hinzugefügt werden, daß Bach gleichermaßen als „Komponist für Pianisten“ zum obligatorischen Repertoire der Klavierspieler gehörte. Darauf hat mit Blick auf Liszt und bereits für das Jahr 1820 Michael Heinemann hingewiesen: „Eine seriöse Fundierung künftigen Virtuosentums bedurfte auch der Beherrschung Bachscher Kompositionen.“ Um nur noch einen weiteren, am Klavier konzertierenden Komponisten anzuführen: Als der fünfzehnjährige Brahms im September 1848 in Hamburg sein erstes eigenes Konzert gab, stand eine – leider nicht näher zu identifizierende – „Fuge von Sebastian Bach“ auf dem Programm; und als er sich am 29. November 1862 zum ersten Mal als Solospieler dem Wiener Publikum vorstellte – wie wir wissen, blieb das nicht ohne Konsequenzen – so trug er auch eine leider heute verschollene Bearbeitung der Orgeltoccata F-Dur BWV 540 vor. Doch kommen wir nochmals auf den „Komponisten für Komponisten“ zurück, von dem man fürs eigene Komponieren lernen konnte. Solche Funktion Bachs blieb bis weit ins 20. Jahrhundert erhalten, während die Rolle Beethovens hinsichtlich dieses – freilich nur dieses Aspekts – zunehmend schwächer wurde. Arnold Schönberg, den man bezüglich seines Kunst- und Werkbegriffs sowie seiner unmittelbaren Traditionsbezogenheit dem 19. Jahrhundert zuordnen kann, legt davon beredtes Zeugnis ab, wenn er in seinem Artikel Nationale Musik vom Februar 1931 seine fünf Haupt-Lehrmeister aufführt und in erster Linie Bach sowie Mozart und erst in zweiter Beethoven, Brahms sowie Wagner nennt. Interessant aber ist auch – worauf hier nur kurz eingegangen werden kann –, was Schönberg von Bach gelernt hat: Christian Martin Schmidt 1. Das kontrapunktische Denken, d.i. die Kunst, Tongestalten zu erfinden, die sich selbst begleiten können. 2. Die Kunst, alles aus Einem zu erzeugen und die Gestalten ineinander überzuführen. 3. Die Unabhängigkeit vom Taktteil.11 Daß Schönberg als allererstes auf den Kontrapunkt abhebt, kann im Rahmen der Rezeptionstradition nicht wundernehmen. Freilich zeichnet sich hier ein Kontrapunktbegriff ab, der vom konventionellen einigermaßen unterschieden ist. Letzterer erfüllt sich in einem ausgewogenen Tonsatz, der von gleichwertigen, selbständigen Stimmen, mithin als Netzwerk linearer Stränge, strukturiert ist. Für Richard Wagner beispielsweise legitimiert solche Konsistenz der Linearität sowohl Härten des vertikalen Zusammenhangs, also der Harmonik, als auch die Vernachlässigung der Form bzw. Darstellungsart. Im Blick auf Liszts Faust-Symphonie sagt er am 3. August 1869: „Bei Bach kommen auch große Härten vor, allein bei ihm entstehen sie aus der Konsequenz, mit der er die einzelnen Stimmen führt, aus der Logik des Gedankens, nicht aus einer gewissen Nachlässigkeit“12. Und angesprochen auf die Begabung französischer Musiker (Grétry, Méhul) äußert er am 28. Juni 1872: „O, bedeutend sind die Franzosen, das ist keine Frage, was ihnen fehlt, das ist das Ideale, das, was sich, wenn es darauf ankommt, gar nicht um die Form kümmert, wie z. B. Bach, der die Gesetze des Wohllautes, die dem Italiener alles waren, einfach vernachlässigte, der Selbständigkeit der Stimmen zuliebe“13. Schönberg dagegen zielt auf die Vereinheitlichung des Tonsatzes durch Stimmen, die zwar als kontrapunktische miteinander kombiniert, vor allem aber durch ihren motivischen Inhalt miteinander verbunden sind, sei es in der Form der Identität von Hauptstimme und Begleitung: „Die Tongestalt, die sich selbst begleiten kann“, sei es als Varianten eines motivischen Kerns, „alle aus Einem erzeugt“; Schönberg meint also in erster Linie Verfahren der motivisch-thematischen Arbeit zum Zweck der Integration des musikalischen Satzes, die er – zu Recht oder zu Unrecht – Bach zuweist. Zwar hatte bereits Marpurg in seiner Abhandlung von der Fuge diesem Aspekt beträchtliche Aufmerksamkeit geschenkt, in den Vordergrund der musikalischen Wahrnehmung getreten indes und damit geschichtsträchtig geworden ist die motivisch-thematische Arbeit als Basis der musikalischen Entfaltung erst in der Wiener Klassik, namentlich bei Beethoven. Schönberg dagegen spürt – freilich ganz und gar ohne Tendenz zu historischer Wahrheitsfindung, sondern allein innerhalb der Systema- 11 A. Schönberg, Nationale Musik, in: Stil und Gedanke. Aufsätze zur Musik, hrsg. v. I. Vojtech, Frankfurt 1976, S. 250-254, hier S. 253. 12 C. Wagner, Die Tagebücher, a. a. O., 1/S. 136. 13 Ebenda, 1/S. 540. Die Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts kann man ohne Bach nicht schreiben tik des eigenen Lernprozesses – die Wurzeln jener auf ein organisch sich entfaltendes Kunstwerk gerichteten, alles miteinander verbindenden motivischthematischen Arbeit – und ich wiederhole, zu Recht oder zu Unrecht – bei Bach auf und unterminiert solchermaßen den historischen Rang der Errungenschaften der Klassik, namentlich Beethovens. Die Aspekte, die er dann bei Beethoven, einem seiner Lehrmeister zweiter Linie, nennt, fallen dann auch vergleichsweise minder gewichtig aus; sie sind entweder Unterpunkte bzw. Doppelungen von dem bei Bach Ausgeführten oder betreffen allgemeinere und schwer nachvollziehbare Gesichtspunkte wie vor allem „Die Kunst, unbedenklich lang, aber herzlos kurz zu schreiben, wie es die Sachlage erfordert“14. „Die Erhebung Bachs zum Klassiker“, so schreibt Rudolf Stephan, „geht also von allem Anfang an, um es roh zu sagen, auf Kosten Beethovens“15. Das klingt paradox, war es doch die Figur Beethovens, die es überhaupt erst ermöglicht hatte, den Begriff des Höchsten, der unnahbaren Größe von Musik im allgemeinen Bewußtsein zu verankern. Doch wurde damit zugleich der Weg geöffnet, den Maßstab solcher Größe auch an das Werk anderer Komponisten anzulegen und damit potentiell die Alleinvertretung Beethovens am Zenit der autonomen Tonkunst in Frage zu stellen. Freilich konnte allein Bach den hohen Ansprüchen solch emphatischen Qualitäts- und Kunstbegriffs Genüge leisten, dies insonderheit wiederum durch seine Fugen. Wenn Erwin Ratz in seiner Einführung in die musikalische Formenlehre16 gleichsam die Summa der retrospektiven Musiktheorie der Zweiten Wiener Schule darlegt, so sind es ausschließlich Werke Bachs und Beethovens, denen sich seine analytische Interpretation zuwendet; der Untertitel des Buches, das nebenbei gesagt dank seines Niveaus zur Pflichtlektüre jedes an Musik näher Interessierten gehört, Über Formprinzipien in den Inventionen und Fugen J. S. Bachs und ihre Bedeutung für die Kompositionstechnik Beethovens offenbart den gleichen eher systematischen, historisch jedenfalls schwer belegbaren Ansatz wie die angeführten Bekenntnisse Schönbergs. Und wenn August Halm im Jahre 1920 seine Lehre von den Zwei Kulturen der Musik entfaltet, so sind es die Sonaten Beethovens und die Fugen Bachs, in denen sich diese beiden Kulturen realisiert haben. Um nochmals Rudolf Stephan zu zitieren: „Bachs Fugen, die einzig deren Begriff vollständig entsprechen, sind, wie Beethovens Sonaten, Realisation höchster Möglichkeiten […] Fuge und Sonate sind Be- 14 A. Schönberg, Nationale Musik, a. a. O. 15 R. Stephan, Johann Sebastian Bach und die Anfänge der Neuen Musik, in: Vom musikalischen Denken. Gesammelte Vorträge, S. 18-24, hier S. 23. 16 E. Ratz, Einführung in die musikalische Formenlehre, Wien 1968. Christian Martin Schmidt reiche, in welchen nach Halms Lehre sich die Musik als Tonkunst bisher einzig rein verwirklicht hat, als autonome Tonkunst, die ihren Sinn aus sich selbst empfängt und nicht aus irgendwelchen außermusikalischen oder außerhalb des jeweiligen Werkes liegenden Sachverhalten“17. In den beiden angeführten Büchern stehen Bach und Beethoven gleichrangig nebeneinander. Richard Wagner dagegen hat, seiner spezifischen historischen Situation entsprechend und in direktem Blick aufs eigene Komponieren, Bach direkt gegen Beethoven ausgespielt. Ich beziehe mich dabei wiederum auf die Tagebücher Cosimas, wobei mir bewußt ist, daß die Eintragungen hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit angezweifelt werden können und angesichts der Tatsache, daß sie 25 Jahre umspannen, keinen stringenten inhaltlichen Zusammenhang bilden. Dennoch formieren sich Wagners dort dokumentierte Äußerungen zu einem Mosaik, das sich – was Bach betrifft – zu einem Gesamtbild mit nur wenigen wesentlichen Widersprüchen ordnen läßt18. Allein der Darstellung zuliebe – und keineswegs in Übereinstimmung mit der Chronologie – gliedere ich die folgenden Aussprüche Wagners in vier Schritte. Der erste stellt – noch mit Zögern – Bach neben Beethoven, führt aber rasch zu Wagners ureigenstem Interessengegenstand, dem Musikdrama; Cosima notiert unter dem 9. März 1873: „Wie ich bemerke, daß keiner wie Beethoven uns das Bild des Wesens der Dinge gegeben, sagt R., vielleicht Bach, und durch die Form der Fuge so merkwürdig, und die Musik scheint selbst wie ein Wesen, das verschiedene Entwicklungen gehabt, bis aus dieser Zauberlaterne das Drama projiziert wird“19. Hier ist die direkte Beziehung des Musikdramas zur Fuge Bachs noch nicht unzweifelhaft schlüssig, in späteren Äußerungen indes wird Wagner noch mehrmals behaupten, die Meistersinger stellten die Fortsetzung des Wohltemperierten Klaviers dar. Der zweite Schritt betrifft die Kompetenz, das handwerkliche Können bei der Verfertigung von Fugen, hinsichtlich derer Wagner die Superiorität Bachs betont. So sagt er am 15. Januar 1872: „So eine Bach’sche Fuge, das ist ein Kristall in der Schußbewegung, bis es auf dem Orgelpunkt erstarrt“, und direkt gegen Beethoven und Mozart gerichtet: „Was die Fuge betrifft, so sollen diese Herrn sich verstecken gegen Bach, sie haben mit dieser Form gespielt, haben zeigen wollen, daß sie es auch konnten, er aber hat die Seele der Fuge gezeigt, er hat nicht anders gekonnt als in Fu- 17 R. Stephan, Johann Sebastian Bach und die Anfänge der Neuen Musik, a. a. O., S. 22. 18 Die einzige in den Tagebüchern überlieferte Äußerung zu Bach, die für mich ein Rätsel bleibt, ist die folgende, die das Verhältnis von Wagner sowohl zu Bach als auch zu Brahms betrifft: „Brahms komponiert, wie Bach hätte komponieren mögen“, in: C. Wagner, Die Tagebücher, 2/S. 876. 19 Ebenda, 2/S. 648. Die Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts kann man ohne Bach nicht schreiben gen schreiben“20. Noch schärfer am 12. Dezember 1881: „Er spricht von der Fuge v. Bach wie von einer untergegangenen Gattung, gegen welche die Fuge in Sonate 106 z.B. [also der Hammerklaviersonate] eine Kinderei sei“21. In einem weiteren Schritt indes stellt Wagner die Fuge bzw. das Bachsche Komponieren insgesamt nicht wie Halm und Ratz neben, sondern gegen die Sonate: Am 13. Juli 1872 notiert Cosima: Mit den Kindern gearbeitet; nachmittags und abends Feustels, dazu J.[osef] Rubinstein […]. Das Klavierspiel des letzteren freut uns sehr, eine Fuge von Bach namentlich (aus dem Wohltemperierten Klavier Des dur) stimmt uns ganz extatisch, „es ist, als ob erst jetzt Musik wirklich ertönt hätte“, sagt R. Wie ich R. sage, daß, merkwürdigerweise, dieses Scherzando mich mit ungeheurer Wehmut erfüllte, sagt R. „Ich begreife es, es ist wie ein rastloses Weiterschreiten, als ob er sagte, hier habt ihr alles, womit ihr später arbeiten werdet, wo ihr ruhen und weilen werdet, ich weiß das alles, mich treibt es weiter. Eine Sphinx, aber das ist deutsch. Wie flach und konventionell erscheint die Sonatenform dagegen, dieses italienische Produkt; nur dadurch, daß er das Beiwerk dieser Form so ungeheuer belebte, näherte sich Beethoven wieder Bach“22. Dem auffallend ähnlich ist die Eintragung vom 9. März 1878: Darauf spielt R. aus dem Wohltemperierten Klavier das cis moll Präludium zu unsäglichem Eindruck. Wie die ruhige Klage einer Sphinx oder verschwindender Götter oder einer Natur der Menschenerschaffung erklingt es in uns! R. sagt, er habe sich das komponiert von der Kindheit an, er wisse nicht, ob er es richtig spiele. Über die Verflachung, welche auf diese Form des Prälude und der Fuge die Sonate hervorgebracht, das war Philipp Emanuel, der diese italienische Form einführte, und die ganze darauf aufgebaute Musik ist wie Konzert, Hofkonzertmusik, gegen diese Offenbarung23. In einem letzten Schritt schließlich geht Wagner – was sich freilich schon in einem der obigen Zitate andeutete – so weit, Bach zur Geburtsstätte der neueren Musik, das heißt wohl der seinen, zu erklären. Unter dem 2. Februar 1879 findet sich folgender Eintrag in Cosimas Tagebüchern: Abends wiederum Präludien und Fugen, heute fünf an der Zahl, bei der 4ten (No. 12 des zweiten Teiles) sagt R., das sei ein förmlicher Übergang zur neueren Musik. Das habe Bach seiner Frau vorgespielt. Vorher hatte er betont, wie diese Werke von dem Musiker für sich selbst gemacht worden seien und wie seicht einem dagegen die Musik für andre, wie sie die Nachfolger gemacht hätten, dagegen vorkäme, die Sonate; „freilich ist auch etwas Schönes daraus hervorgegangen, aber dies hier ist wie die Geburtsstätte“24. 20 Ebenda, 1/S. 480 f. 21 Ebenda, 4/S. 847. 22 Ebenda, 1/S. 547 f. 23 Ebenda, 3/S. 54. 24 Ebenda, 3/S. 302. Christian Martin Schmidt All dies sind private Äußerungen Wagners, die substantielle Elemente seines musikalischen Denkens insofern vielleicht deutlicher werden lassen als die publizierten, weil sie nicht durch den bewußten Filter der öffentlichen Selbstdarstellung gegangen sind. Sie lassen sich in vielerlei Hinsicht interpretieren; für unseren Zusammenhang indes ist nur die Bach zugewiesene Rolle von Belang. Offenkundig ist, daß Wagner sich in seinem künstlerischen Selbstverständnis in einem Konkurrenzverhältnis zu Beethoven fühlt – ähnlich wie später Thomas Mann zu Goethe. Bach dagegen stellt durch die historische Distanz, um es schroff zu sagen, keine direkte Bedrohung dar, die Qualität seiner Musik jedoch und der in ihr hervortretende kompositorische Rang repräsentieren für Wagner eine so unbezweifelbare Größe, daß in seinem permanenten und immer auf Beethoven fixierten Prozeß der Selbstfindung Bach gleichsam als Bundesgenosse gegen diesen aufgerufen werden kann. Ich habe es mir, meine Damen und Herren, im Vorangehenden versagt, Ihnen in der Geschütztheit der analytischen Einzeluntersuchung konkrete Beispiele der kompositionstechnischen Anknüpfung des 19. Jahrhunderts an Bach zu demonstrieren (und Ihnen damit die kaum zu umgehende Monotonie der sachbezogenen Detailbetrachtung erspart). Hier hätten allgemein die von Bach so einzigartig realisierte Versöhnung von Harmonie und Kontrapunkt zur Sprache kommen können und der Einfluß der Stücke des Wohltemperierten Klaviers auf die Geschichte des im 19. Jahrhundert so zentralen Lyrischen Klavierstücks, konkreter die Adaption Bachscher Verfahren in der Fugenkomposition generell, die Übernahme von Modellen der Vokalkomposition etwa in Mendelssohns Paulus oder in den deutschsprachigen Motetten von Brahms, die bindende Rückbeziehung der Choralvorspiele und -phantasien von Brahms und Reger auf Bach usw. Das alles aber ist durch Einzeluntersuchungen bekannt genug und hätte die Bach-Rezeption des 19. Jahrhunderts allenfalls in Einzelpunkten beleuchtet, mithin wesentliche Aspekte im dunkeln gelassen. Im Tonsatz der Musikdramen Wagners beispielsweise lassen sich direkte Anknüpfungspunkte an Bach kaum plausibel machen, das ihnen zugrundeliegende Musikdenken indes ist – wie deutlich genug geworden sein dürfte – zutiefst von der Beschäftigung mit Bachs Kompositionen geprägt. Daß man die Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts nicht ohne Bach schreiben kann, ist mithin weniger auf direkte kompositionstechnische Übernahmen, als vielmehr auf dessen Omnipräsenz im Denken und für die Ästhetik der Zeit zurückzuführen. Kaum eine Lücke lassend, gilt sie für alle wesentlichen kompositorischen Strömungen der Zeit: Bachs Kompositionen sind für die emphatisch auf Fortschritt gerichtete „Musik der Zukunft“, die in Liszt und Wagner ihre herausragenden Vertreter hatte, ebenso verbindlich wie etwa für Brahms’ Konzeption einer „dauerhaften Musik“, die sich dem zugleich erneuernden und zerstörerischen Impetus von Geschichte gegenüber eher skeptisch verhält – schließlich und vor allem auch für die Musikauffassung Schönbergs, der mit Die Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts kann man ohne Bach nicht schreiben dem Versuch, jene beiden Strömungen zu versöhnen, mithin „dauerhafte Musik für die Zukunft“ zu schreiben, den letzten großen Entwurf zur Bewahrung einer als ethische Verpflichtung empfundenen Tonkunst wagte – auch für Schönberg bedeutete Bach eine bindende Instanz, deren sowohl Ethos als handwerkliche Qualität vorbildhaft kombinierender Kraft sich keiner, der dem Anspruch autonomer Tonkunst gerecht werden wollte, entziehen konnte.