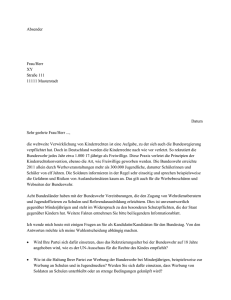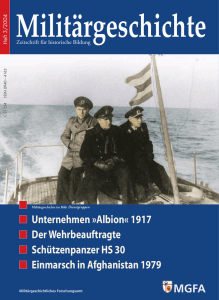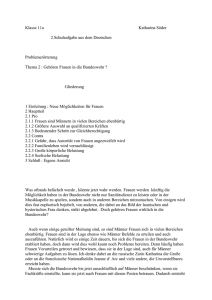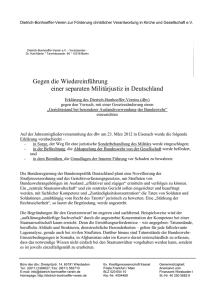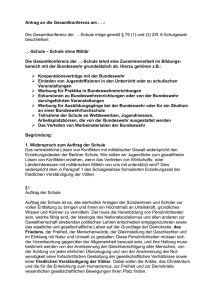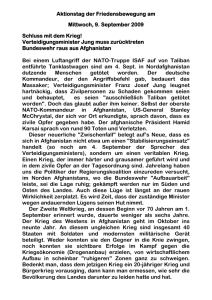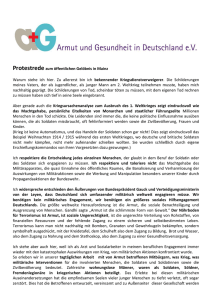Zeitschrift "Militärgeschichte" - RK
Werbung

Zeitschrift für historische Bildung C 21234 ISSN 0940 – 4163 Heft 3/2004 Militärgeschichte Militärgeschichte im Bild: Dienstgruppen Unternehmen »Albion« 1917 Der Wehrbeauftragte Schützenpanzer HS 30 Einmarsch in Afghanistan 1979 Militärgeschichtliches Forschungsamt MGFA Militärgeschichte Zeitschrift für historische Bildung Herausgegeben vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt durch Kapitän z.S. Dr. Jörg Duppler und Oberst i.G. Dr. Hans Ehlert (V.i.S.d.P.) Produktionsredakteur der aktuellen Ausgabe: Major Heiner Bröckermann M.A. Redaktion: Major Heiner Bröckermann M.A. (hb) Hauptmann Agilolf Keßelring M.A. (aak) Bildredaktion: Dipl.-Phil. Marina Sandig Redaktionsassistenz: Richard Göbelt, Stud. Phil. Lektorat: Dr. Aleksandar-S. Vuletić Layout/Grafik: Maurice Woynoski Anschrift der Redaktion: Redaktion »Militärgeschichte« Militärgeschichtliches Forschungsamt Postfach 60 11 22, 14411 Potsdam Telefon: (03 31) 97 14 -569 Telefax: (03 31) 97 14 -507 Homepage: www. mgfa.de Technische Herstellung: MGFA, Schriftleitung Manuskripte für die Militärgeschichte werden an diese Anschrift erbeten. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht gehaftet. Durch Annahme eines Manuskriptes erwirkt der Herausgeber auch das Recht zur Veröffentlichung, Übersetzung usw. Honorarabrechnung erfolgt jeweils nach Veröffentlichung. Die Redaktion behält sich Kürzungen eingereichter Beiträge vor. Nachdrucke, auch auszugsweise, fotomechanische Wiedergabe und Übersetzung sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Redaktion und mit Quellenangaben erlaubt. Dies gilt auch für die Aufnahme in elektronische Datenbanken und Vervielfältigungen auf CD-ROM. Die Redaktion hat keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte derjenigen Seiten, auf die in dieser Zeitschrift durch Angabe eines Link verwiesen wird. Deshalb übernimmt die Redaktion keine Verantwortung für die Inhalte aller durch Angabe einer Linkadresse in dieser Zeitschrift genannten Seiten und deren Unterseiten. Dieses gilt für alle ausgewählten und angebotenen Links und für alle Seiteninhalte, zu denen Links oder Banner führen. © 2004 für alle Beiträge beim Militärgeschichtlichen Forschungsamt (MGFA) Sollten nicht in allen Fällen die Rechteinhaber ermittelt worden sein, bitten wir ggf. um Mitteilung. Editorial »Nicht Mensch, nicht Vieh! Auf´s Pferd gesetzte Infanterie!« So beschrieben unsere Altvorderen die Dragoner. Konnte der Dragoner doch auf- und abgesessen kämpfen und war dabei genauso viel oder wenig geschützt wie seine anderen Kameraden der Kavallerie. Unsere Panzergrenadiertruppe kennt Ähnliches. Das »Heckklappenvieh« scheint da ganz nah an der alten Formulierung zu liegen. Die Bezeichnung Panzergrenadiere wurde 1942 festgeschrieben, ebenso wie der damalige Farbenwechsel von »rosa« zu »wiesengrün«. Die Reihenfolge und Gewichtung von Schutz, Feuerkraft und Beweglichkeit bestimmten durch die kurze Geschichte der Truppengattung hindurch den Einsatz und die Fahrzeuge der motorisierten Infanterie. Von Geburt an stand die Truppengattung dabei im Schatten ihres Nachbarn auf dem Gefechtsfeld: der Panzertruppe. Das man sich als ein Verbund begriff, dafür sorgte nicht zuletzt die durch die Bundeswehr institutionalisierte Gemeinschaft der Panzertruppenschule in Munster, wo Panzer-, Panzeraufklärungsund Panzergrenadiertruppe zusammengeführt wurden. Die überlieferte Anekdote über das dortige Kunstwerk der drei steinernen Schildkröten, die ein Schelm rosa, grün und goldgelb strich, zeigt wie sehr man aber auf den kleinen Unterschied auf dem Gefechtsfeld stolz war. Foto: Stadt Munster Der Panzer, im Ersten Weltkrieg noch Unterstützungswaffe der Infanterie, wandelte sich im Zweiten 5 SPz HS 30 Weltkrieg zur bestimmenim Deutschen den Waffe des Blitzkrieges, Panzermuseum deren Erfolge die auf KraftMunster wagen gesetzte Infanterie ihrerseits ausnutzen sollte. 5 Standort Grundschule am Süllberg, Leihgabe der Bundeswehr Im Gefecht gegen Panzer bewährte sich vor allem der Panzer selbst. Das begleitende Sturmgeschütz in Verbindung mit leicht gepanzerten Mannschaftstransportwagen der Grenadiere hatte nie die gleiche Kampfkraft aufzubieten. Mit der Entwicklung der Hohlladung wurde der ohnehin nach oben offene Schützenpanzerwagen (SPw) immer anfälliger für Beschuss. Doch eine Panzerung wie beim Kampfpanzer gab man dem SPw nicht. Schutz gegen Waffenwirkung bedeutete höheres Gewicht und damit eingeschränkte Beweglichkeit. Die Verwundbarkeit meinte man mit der höheren Beweglichkeit wieder aufzuwiegen. Dieses Dilemma blieb der Panzergrenadiertruppe und ihren jeweiligen »Gefechtsfeld-Taxis« erhalten. Den Ideen eines Schützen-Kampf-Panzers, wie dem israelischen Merkhava, folgte man in Deutschland nicht. Das Gespann Leopard – Marder bewährte sich in Mitteleuropa. Für die Transformation der Bundeswehr stehen schon neue Ideen parat. Bleiben wird dabei die Frage, wie das Problem der Optimierung von Schutz, Feuerkraft, Beweglichkeit und Führung technisch gelöst wird. Diese Ausgabe der Militärgeschichte bietet Ihnen diesmal einen untauglichen Versuch aus der Geschichte an: den Schützenpanzer HS 30. Die Redaktion der Militärgeschichte wünscht Ihnen eine interessante Lektüre Druck: SKN Druck und Verlag GmbH & Co., Norden ISSN 0940-4163 Heiner Bröckermann M.A. Major Foto: Privatbesitz IMPRESSUM D i e A u t o r e n Inhalt • Unternehmen »Albion« Die erste »joint operation« deutscher Streitkräfte • Kontrolle zum Schutz der Soldaten Dr. Gerhard P. Groß, geboren 1958 in Mainz, Oberstleutnant und Leiter Teilbereich »Erster Weltkrieg« im Forschungsbereich »Zeitalter der Weltkriege« am MGFA, Potsdam Rudolf Josef Schlaffer M.A., geboren 1970 in Amberg/Bayern, Hauptmann und Wissenschaftlicher Mitarbeiter am MGFA, Potsdam Dr. Dieter H. Kollmer, geboren 1964 in Hamburg, Major und Dozent für Militärgeschichte an der Offizierschule des Heeres, Dresden Dr. Matthias Uhl, geboren 1970 in Nordhausen, Wissenschaflicher Mitarbeiter am Institut für Zeitgeschichte/ Außenstelle Berlin 4 8 Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages • Der Schützenpanzer HS 30 Dichtung und Wahrheit 12 • Vor 25 Jahren: Der sowjetische Einmarsch in Afghanistan 1979 16 • Service 22 Das historische Stichwort: 9. November 1914: Der Untergang des Kleinen Kreuzers S.M.S. EMDEN 22 Medien online/digital 24 Lesetipp 26 Ausstellungen 28 Geschichte kompakt 30 • Militärgeschichte im Bild Eine Stunde Null? Deutsche Soldaten als Hilfstruppen der westlichen Besatzungsmächte 1945–1958 Dienstgruppen: Ehemaliges Flugsicherungsboot REIHERLEIN mit Unterscheidungszeichen »International Cäsar« als Doppelstander. (v.l.n.r.): OLt (w) Großkurth, KKpt Pieper und Divisionspfarrer Foto: Wehrgeschichtliches Ausbildungszentrum der Marineschule Mürwik Weitere Mitarbeiter dieser Ausgabe: Frank Gerlich, Freiburg im Breisgau; Oberst Dr. Winfried Heinemann, MGFA; Dr. Rüdiger Wenzke, MGFA; Dr. Gerhard Wiechmann, Oldenburg 31 Unternehmen Albion 1917 Unternehmen »Albion« Die erste »joint operation« deutscher Streitkräfte I akg-images m August 1914 trat das Deutsche Reich in den Ersten Weltkrieg ein, ohne seine See- und Landkriegführung aufeinander abgestimmt zu haben. Der Kaiser war nicht in der Lage gewesen, die ihm von der Verfassung zugewiesene Funktion des Obersten Kriegsherren auszufüllen und sich gegen den Ressortegoismus von Armee und Marine durchzusetzen. So legten Armee und Marine unabhängig voneinander und ohne sich wechselseitig zu unterstützen den Schwerpunkt ihrer Kriegführung zwar in den Westen; doch während die Flotte in der Nordsee eher defensiv auf die entscheidende Schlacht mit der Royal Navy wartete, suchte die Armee gemäß dem Schlieffenplan bewusst offensiv die Schlachtentscheidung in Frankreich. Der Ostseeraum war für die deutsche Kriegführung nur ein Nebenkriegsschauplatz. Daher wurden dort an der Ostfront zunächst nur schwache Verbände und in der Ostsee selbst wenige und ältere Kreuzer und Panzerkreuzer eingesetzt. Beide waren für größere Offensivoperationen nicht ausreichend. Daher operierten sowohl Heer als auch Marine unabhängig von- 4 einander eher defensiv. Eine neue Lage entstand, als im Frühjahr 1915, nach den Niederlagen an der Westfront, die deutsche Oberste Heeresleitung (OHL) den Schwerpunkt der Kriegführung an die Ostfront verlagerte und eine Großoffensive gegen Russland eröffnete. Die Ausweitung des taktischen Durchbruches durch das russische Stellungssystem von Gorlice-Tarnow zur strategischen Offensive im Mai beschleunigte den seit einem Monat andauernden Angriff im Baltikum. Die Marine unterstützte diesen auf Ersuchen des Oberbefehlshabers Ost, Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, durch Küstenbeschießungen, während auf Wunsch des Chefs der 2. OHL, General Erich von Falkenhayn, ein Flottenverband für mehrere Tage in den Rigaer Meerbusen vorstieß, um der Flankenbedrohung des Heeres durch Angriffe der russischen Baltischen Flotte zu begegnen. Ende September war Kurland besetzt und die operativen Ziele der OHL erreicht. Die Armee ging entlang der Düna zur Verteidigung über. Die geografische Lage des Baltikums als Küstenregion hatte Armee und Marine erstmalig gezwungen, gemein- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2004 same Operationsplanungen zu erarbeiten und ihr Vorgehen aufeinander abzustimmen. Mit der Besetzung Kurlands war aber die Eroberung der Baltischen Inseln, Ösel (Saaremaa), Moon (Muhu) und Dagö (Hiiumaa), zu einer wichtigen operativen Option für die Ostseestreitkräfte geworden. Dies umso mehr, als der Flottenvorstoß in den Rigaer Meerbusen gezeigt hatte, dass nur die Besetzung der Inseln die Beherrschung dieses Seegebietes ermöglichen sowie den Schutz der Heeresflanke in Kurland gegen russische Heeres- und Marineverbände garantieren würde. Erste Planungen Vor diesem Hintergrund begann der Admiralstab Ende 1915 mit Vorarbeiten für die Eroberung und dauerhafte Besetzung der Baltischen Inseln. Da die Marine ein solches Unternehmen ohne die Beteiligung der Armee nicht durchführen konnte, versuchte der Admiralstabschef, Admiral Henning von Holtzendorff, die OHL für eine Unternehmung gegen die Inseln zu gewin- das Landungskorps an Bord eines Truppentransportdampfers nen. General v. Falkenhayn lehnte eine Eroberung der Baltischen Inseln jedoch ab. Er suchte nun – 1916 – erneut die Kriegsentscheidung im Westen. Aber auch im Admiralstab lag der Schwerpunkt der Seekriegführung weiterhin in der Nordsee, so dass das Interesse an Operationen im Ostseeraum schnell erlosch. Die Schlacht von Verdun (Februar bis Juli 1916) und die Seeschlacht vor dem Skagerrak (31. Mai 1916) sowie die Verteidigungskämpfe an der Somme und in Galizien banden alle verfügbaren Reserven. Da ohne Verstärkungen an eine Offensive im Baltikum nicht zu denken war, herrschte an der See- und Landfront im Ostseeraum trügerische Ruhe. Der Stellungskrieg vor Riga fand sein Pendant im Minen- und Kleinkrieg in der östlichen Ostsee. Eine durch die russische Passivität möglich gewordene offensive deutsche Gesamtkriegführung im Ostseeraum unterblieb. 1917 änderte sich die Lage. Zum einen traten die USA in den Krieg ein, zum anderen erschütterten revolutionäre Unruhen Russland. Davon waren zunehmend auch die russischen Streitkräfte betroffen. Die Versuche der Ententemächte, aufeinander abgestimmt im Osten und Westen die deutsche Front zu durchbrechen, scheiterten. Als sich im Frühjahr 1917 die kurzzeitig gehegten Hoffnungen auf einen Sonderfrieden mit Russland zerschlugen, plante die 3.OHL unter Generalfeldmarschall von Hindenburg und General Ludendorff, durch gezielte militärische Operationen Druck auf die russische Regierung auszuüben. In Gesprächen mit dem Admiralstab sondierte der Erste Generalquartiermeister der OHL, General der Infanterie Erich Ludendorff, ab Mai 1917 die Möglichkeiten einer Beteiligung der Marine an Operationen gegen die Ålandinseln, Kronstadt oder Ösel. Der Admiralstab lehnte eine Beteiligung zwar nicht kategorisch ab, gab aber zu bedenken, dass die Konzentration von Seestreitkräften in der Ostssee den uneingeschränkten U-Boot-Krieg gegen Großbritannien negativ beeinflussen könnte. Wenn überhaupt, käme nur eine Eroberung Ösels in Frage. Diese lehnte Ludendorff ab. Er wollte den russischen Zusammenbruch durch die Besetzung der Ålandinseln beschleunigen. Für ihn waren im Gegensatz zum Admiralstab die Baltischen Inseln nur ein nachrangiges Ziel. Die OHL stellte daraufhin vorerst alle weiteren Planungen einer gemeinsamen Operation ein und eröffnete am 1. September 1917 – ohne Beteiligung der Marine – die Offensive gegen Riga. Bereits zwei Tage nach Angriffsbeginn waren die Übergänge über die Düna gewonnen sowie Riga genommen (siehe Militärgeschichte 1/2004). Nach Beendigung der Kampfhandlungen wurde die Masse der Divisionen nach Italien und an die Westfront verlegt. Als Ludendorff weiterhin an der Besetzung der Ålandinseln festhielt und der Marine Feigheit sowie mangelnden Offensivgeist vorwarf, erklärte der Admiralstab am 8. September, die Besetzung Ösels zur Vorbedingung für ein Unternehmen gegen die Ålandinseln. Zur Durchsetzung seiner weitergehenden Ziele im Ostseeraum akzeptierte Ludendorff nun den Vorschlag des Admiralstabes. Die Marine ist nicht feige akg-images Ösel am 12. Oktober 1917 begibt sich 5 Generalfeldmarschall von Hindenburg und General Ludendorff, nach einem Gemälde von Hugo Vogel (1855–1934) akg-images 3 Vor der Ausschiffung in der Tagga-Bucht auf 5 Vorbereitung zur Eroberung von Ösel, Moon und Dagö vom 11. bis 20. Oktober Warum sprach sich der Admiralstab für diese aufgrund der starken Verminung riskante Unternehmung gegen die Baltischen Inseln aus? Es ging nicht wie immer wieder dargestellt um »sea control« in der mittleren und östlichen Ostsee. Auch die Verbesserung der seestrategischen Position in der Ostsee sowie die Sicherung der lebensnotwendigen Versorgungen aus Schweden standen nicht im Vordergrund der Überlegungen der Marineführung. Der Admiralstab forcierte dieses riskante Unternehmen, um dem aus Heereskreisen immer wieder geäußerten Vorwurf der Feigheit zu begegnen, und zur Existenzsicherung der Marine im Gesamtgefüge des Kaiserreiches. Gleichzeitig bot der Einsatz schwerer Überwasserstreitkräfte der Hochseeflotte die Möglichkeit, den Besatzungen der Flotte nach den Gehorsamsverweigerungen auf einigen Schiffen Anfang August 1917 eine sinnvolle Tätigkeit zu bieten. Als wichtigstes Ziel verfolgte der Admiralstab mit der Unternehmung jedoch das Ziel, sich gegenüber dem 1917 Kommando der Hochseeflotte und des Oberbefehlshabers der Ostseestreitkräfte (OdO) und deren beider partikularistischen Interessen als alleinige Seekriegsleitung unterhalb des Kaisers zu etablieren. Dieser Absicht kam der Vorschlag der OHL sehr entgegen, dass – unter der Gesamtleitung des Armeeoberkommandos 8 (General der Infanterie Oskar v. Hutier) – zur See der Chef des zu bildenden Sonderverbandes der Marine und an Land der Kommandierende General des Landungskorps führen sollte. Denn damit konnte der Admiralstabschef Holtzendorff die Führungsansprüche des Flottenchefs, Admiral Reinhard Scheer, sowie des OdO, Großadmiral Prinz Heinrich von Preußen, aus Anciennitätsgründen abweisen und einen Sonderverband unter Weisung des Admiralstabes bilden. Hinsichtlich der Landungsoperationen und der noch nie geübten Zusammenarbeit von Marine und Armee Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2004 5 Unternehmen Albion 1917 Die Landung in der Tagga-Bucht und die Nebenlandung bei Pamerot sollten überraschend im Morgengrauen unter Artillerieunterstützung der Flotte erfolgen. Nach Bildung eines Brückenkopfes durch starke Infanteriekräfte plante man die Ausschiffung der Artillerie, Kavallerie und des schweren Gerätes. Beginn der Operation MGFA/Woynoski 5 Das Unternehmen »Albion« 1917 11.–15. Oktober 16.–20. Oktober stellte das Unternehmen »Albion« (kelt.-lat.-griech. Bezeichnung für England, als »perfides Albion« seit den französischen Revolutionskriegen 1792 auch als Schmähwort im Gebrauch; Anm. d.Red.) hohe taktische Anforderungen an die beteiligten Stäbe. Auf russischer Seite erwartete die deutsche Führung starke Küstenbatterien auf Ösel sowie etwa eine Infanteriedivision in ausgebauten Feldbefestigungen als Inselbesatzung. Zur See rechnete man mit Teilen der russi- 6 Inmediatsvortrag-Berechtigung nicht aufgeführt schen Baltischen Flotte, einigen britischen U-Booten und einer erheblichen Minenbedrohung. Insgesamt schätzte man die Verteidigungsstärke der russischen See- und Landstreitkräfte wegen der revolutionären Umtriebe unter den russischen Soldaten als gering ein. Wichtigste Voraussetzung für das Gelingen des Unternehmens war die Überraschung. Um diese nicht zu gefährden, sollten die Anmarschwege trotz der starken Verminung erst kurz vor Operationsbeginn geräumt werden. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2004 Die schlechten Witterungsbedingungen erschwerten jedoch die Minenräumarbeiten und führten zu Zeitverzögerungen, die für Ausladeübungen genutzt wurden. Angesichts der kritischen Lage an der Westfront in Flandern und der bevorstehenden Offensive in Italien drang die OHL, ohne Rücksicht auf die noch nicht abgeschlossenen Minenräumarbeiten, auf die baldige Durchführung des Unternehmens. Am 11. Oktober stach der Sonderverband von Libau (Liepāja) aus in See. Der Zeitdruck zwang den Führer des Sonderverbandes die letzten Seemeilen ohne vorangehende Minenräumarbeiten zurückzulegen. Ab 12. Oktober um 05.30 Uhr erfolgte die Landung in der Tagga-Bucht unter dem Feuerschutz der Schiffsartillerie. Nach Bildung des Brückenkopfes begann die Ausschiffung der Masse der 42. Infanteriedivision. Die Nebenlandung zweier Radfahrbataillone in Pamerot verlief ebenfalls erfolgreich. Diese stießen sofort ins Inselinnere und auf Orrisar vor. Dort bildete die »Abteilung Winterfeld« am Moon-Ösel-Damm einen weiteren Brückenkopf. Versuche der russischen Baltischen Flotte, in den Soelo-Sund vorzustoßen und die Truppenanlandungen zu verhindern, brachen im Feuer der deutschen Linienschiffe zusammen. Noch ohne Artillerieunterstützung begann nach Stabilisierung des Brückenkopfs in der Tagga-Bucht am selben Tag der Vormarsch auf die Sworbe-Halbinsel und Arensburg (Kuressaare). Die auf dem Flugzeugmutterschiff »Sankt Elena« stationierten Torpedo- und Jagdflieger der Marine griffen ebenso wie Flugzeuge der Armee und Marineluftschiffe in die See- und Landgefechte ein. Die Kämpfe wurden überall schnell und erfolgreich beendet. Nur die Abteilung Winterfeld geriet bei Orrisar (Oris- saare) in Bedrängnis, als russische Verbände versuchten über den Moon-ÖselDamm nach Osten durchzubrechen. Unter Feuerschutz des Linienschiffs »Kaiser« drang die Flottille »Rosenberg« zur Unterstützung der Abteilung Winterfeld in die Kassar Wiek vor. Die einbrechende Dunkelheit verhinderte aber die Feuerunterstützung für die bedrängten deutschen Truppen. Die schwierige Lage konnte erst am 14. Oktober bereinigt werden, als gegen Abend erste Verstärkungen der 42. Infanteriedivision eintrafen. Die deutschen Seestreitkräfte konnten, nachdem sie erst am 16. Oktober die Minensperren in der Irbe-Straße durchbrochen hatten und in den Rigaer Meerbusen eingedrungen waren, die Heeresoperation auf Ösel nicht wesentlich unterstützen. Erst am 17. Oktober stieß ein gemischter Verband unter Admiral Paul Behnke (ausgezeichnet mit dem Orden Pour le Mérite am 31.10.1917) in den Moon-Sund vor. Dort kam es zu einem Gefecht mit schweren russischen Seestreitkräften in dessen Verlauf das russische Linienschiff »Slava« von »König« und »Kronprinz« so schwer getroffen wurde, dass es auf Grund geriet und von der Besatzung aufgegeben werden musste. Nach weiteren Treffern durch deutsche Linienschiffe zogen sich die verbliebenen russischen Seestreitkräfte zurück und liefen nach Norden ab. Am 19. Oktober verließen die letzten Schiffe der Baltischen Flotte das Seegebiet um die Baltischen Inseln. Am 18. Oktober erfolgte über den Moon-Ösel-Damm der Angriff auf Moon. Gegen Abend waren die Russen geschlagen und die Insel besetzt. Nach erfolgreicher Landung auf Dagö am 12. Oktober wurde die Insel bis zum 20. Oktober erobert. Damit befanden sich die Baltischen Inseln in deutschem Besitz. Ergebnis des Landungsoperation Die personellen Verluste waren für ein Landungsunternehmen dieser Größenordnung gering. 201 deutsche Soldaten wurden während der Kämpfe verwundet; 210 Soldaten fielen – darunter der Dichter Walter Flex. Die Mehrzahl der Gefallenen – nämlich 156 – waren Marineangehörige der Minenräumverbände. Dagegen fielen während der Landkämpfe »nur« 54 Heeressoldaten; weitere 135 wurden verwundet. Die hohen Gefallenenzahlen der Marine im Gegensatz zu denen der Armee sind darauf zurückzuführen, dass die russischen See- und Landstreitkräfte, infolge der revolutionären Unruhen ihre starken Stellungen nur schwach verteidigten. Die Minengefahr blieb aber ungeachtet der inneren Zustände der russischen Streitkräfte weiterhin extrem hoch. Die materiellen Verluste der Marine waren daher nicht zu unterschätzen. Drei Großkampfschiffe hatten Minentreffer erhalten, mehrere Torpedoboote und Minenräumboote waren durch Minentreffer gesunken. Folgendes Fazit der militärischen Zusammenarbeit von Armee und Marine während der Vorbereitungen und der Durchführung des Unternehmens »Albion« lässt sich ziehen. Die taktisch-operative Zusammenarbeit funktionierte während dieser ersten größeren amphibischen Operation deutscher Streitkräfte – trotz der teilweise beträchtlichen Unkenntnis über Taktik, Waffensysteme und Organisation der jeweiligen Schwesterwaffe – im Großen und Ganzen gut. Die Unternehmung offenbarte aber auch deutliche Mentalitätsunterschiede zwischen Armeeund Seeoffizieren. Diese sind nicht zuletzt auf die Unkenntnis über Taktik, Waffensysteme und Organisation der jeweiligen Schwesterwaffe zurückzuführen. So fiel es z.B. Armeeoffizieren schwer, die Auswirkungen des hohen Technisierungsgrades der Marine auf deren Einsatzgrundsätze zu verstehen. Im Kampf um eine einheitliche Seekriegsleitung innerhalb der Marine hatte der Admiralstab einen Erfolg errungen. Versuche des Flottenkommandos und des OdO während des Unternehmens »Albion«, die Leitungsbefugnisse des Admiralstabschefs in Frage zu stellen, beantwortete der Kaiser als Oberster Kriegsherr und Oberbefehlshaber der Marine mit einer kaiserliche Weisung. Diese stellte klar, dass Befehle des Chefs des Admiralstabes mit unmittelbaren Befehlen des Kaisers gleichzusetzen seien. OHL und Admiralstab hatten mit der Eroberung der Baltischen Inseln ihre Ziele erreicht. Ludendorff hatte gegenüber den Russen mit geringem Kräf- teansatz der Armee ein Zeichen gesetzt und die Voraussetzungen für die Besetzung seiner eigentlichen Ziele im Ostseeraum, den Ålandinseln und Finnland, geschaffen. Die Marine hatte durch fehlerlose Durchführung ihres Einsatzes ihre Existenzberechtigung unter Beweis gestellt. In Heereskreisen war man mit dem Einsatz der Marine zufrieden. Das Misstrauen gegenüber der Marineführung und ihrer in der Armee als zu defensiv empfundenen Kriegführung war aber noch nicht überwunden. Ressortstreitigkeiten innerhalb der Marine und zwischen OHL und Admiralstab belasteten die Zusammenarbeit von Armee und Marine auf der operativ-strategischen Ebene bis zum Kriegsende 1918 erheblich. Die Einsatzverbände Angesichts der russischen Seestreitkräfte und der Minenverseuchung der Gewässer um die Baltischen Inseln sowie der britischen Niederlage vor Gallipoli konzentrierte Holtzendorff mit dem III. und IV. Geschwader zehn der modernsten Linienschiffe der Hochseeflotte in der östlichen Ostsee. Sie bildeten den Kern des Sonderverbandes. Zu diesen Geschwadern traten die II. und VI. Aufklärungsgruppe, die U-Bootsflottille Kurland, die II. und VI. Torpedobootsflottille, die 7. Torpedoboots-Halbflottille, die II. Minensuchflottille, die 8. MinensuchHalbflottille, eine Sperrbrechergruppe, die Suchflottille der Ostsee, mehrere Kleinfahrzeuge und Luftschiffe sowie die Transportflotte hinzu. Eine eventuelle Beeinträchtigung des U-Boot-Krieges nahm der Admiralstab in Kauf. Vizeadmiral Eberhardt Schmidt wurde die Führung des Sonderverbandes übertragen. Dessen Aufgabe war der sichere Transport des Landungskorps, die Niederkämpfung feindlicher Küstenbatterien und der Kampf gegen die russischen Seestreitkräfte. Das A.O.K. 8 stellte unter Führung des Generalkommandos XIII. Reservekorps, Kommandeur General der Infanterie Hugo von Kathen, die 42. Infanteriedivision als Landungskorps. Diese wurde durch ein Infanterieregiment, zwei Infanterie-Radfahrbrigaden, ein Sturmbataillon sowie Artillerie-, Pionier-, Sanitäts- und Nachschubverbände verstärkt. Das Landungskorps umfasste insgesamt 24500 Soldaten sowie 8500 Pferde, 2500 Fahrzeuge – mit Masse Pferdefuhrwerke – und 50 Geschütze. n Gerhard P. Groß Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2004 7 Der Wehrbeauftragte Kontrolle zum Schutz der Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages A m 12. November 1955, dem Geburtstag des preußischen Militärreformers Gerhard von Scharnhorst, erhielten die ersten 101 Freiwilligen der Bundeswehr aus der Hand des ersten Bundesministers für (erst später der) Verteidigung Theodor Blank ihre Ernennungsurkunden. Bereits am 26. März 1954 war die Erste Wehrergänzung (Gesetz zur Ergänzung des Grundgesetzes) in Kraft gesetzt und danach die allgemeine Wehrpflicht in der Bundesrepublik eingeführt worden (Wehrpflichtgesetz vom 7.7.1956). Manche Wehrpflichtige, die nun im April 1957 auf einem Kasernenhof standen und zum Dienst in der Bundeswehr verpflichtet wurden, mögen in der Erwartung ihres Grundwehrdienstes an das Bild des »Schleifers« Platzek aus dem populären Film »08/15« gedacht haben. Platzek schikanierte die Rekruten in der Ausbildung. Es stellte sich daher für viele die Frage: »Wie wird es mir wohl in der Bundeswehr ergehen?« Anders als die Rekruten des Wehrmachtswachtmeisters Platzek im nationalsozialistischen Deutschland dienten die Rekruten der jungen Bundeswehr in einem Staat mit einer demokratischen Gesellschaftsordnung. Durch die Binnenstruktur der »Inneren Führung« – der Führungsphilosophie der Bundeswehr, die in einer Person den Staatsbürger und den Soldaten vereint – sollten nun die Soldaten nach dem Leitbild des »Staatsbürgers in Uniform« ausgebildet werden. Parlamentarische Sicherungselemente trugen zudem die Gewähr dafür, dass die Bundeswehrsoldaten nicht von Typen wie »Platzek« ausgebildet und geführt wurden. Eines der parlamentarischen Sicherungselemente sollte der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages sein. n Entstehung des Amtes Über einen westdeutschen Verteidigungsbeitrag bestand zwischen den Bundestagsparteien in den fünfziger Jahren keine Einigkeit. Während die 8 CDU-geführte Bundesregierung die Aufstellung westdeutscher Streitkräfte als notwendigen militärischen Beitrag gegen die militärische Bedrohung aus dem Osten, aber auch für die Einbindung der Bundesrepublik als souveränen Staat in die NATO betrachtete, sah die größte Oppositionspartei SPD hierin einen verhängnisvollen Schritt zur endgültigen Teilung Deutschlands zwischen West und Ost. Ein innenpolitisch tragfähiger Kompromiss ließ sich nur durch eine Wehrverfassung erreichen, welche die Soldaten mit parlamentarischen Kontrollmechanismen vor Missbrauch durch militärische Vorgesetzte schützte. Die neu zu schaffende westdeutsche Armee musste im Nachhinein in die seit 1949 bestehende Staatsverfassung, das Grundgesetz, eingepasst werden. Andererseits sollte in wenigen Jahren eine Armee von etwa einer halben Million Mann aufgestellt werden, wie die Bundesregierung ihren Bündnispartnern zugesagt hatte – eine Aufgabe, die nur äußerst schwer zu lösen war und schon allein deswegen zu Konflikten innerhalb der Streitkräfte führen musste. Neben der Schaffung des Verteidigungsausschusses einigten sich die Bundestagsabgeordneten auf ein bis dahin in der deutschen Verfassungsgeschichte einzigartiges parlamentarisches Kontrollinstrument für die Streitkräfte: das Amt des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages. Die Initiative erging dazu bereits 1951 von Ernst Paul (SPD) aus, der während der nationalsozialistischen Herrschaft nach Schweden emigriert war. Seit 1915 gab es dort das Amt eines Militärbeauftragten (»Militie-Ombudsman«), das Paul für vorbildhaft für die künftigen west/deutschen Streitkräfte hielt. Zu Jahresbeginn 1954 entsandte der Deutsche Bundestag eine Studienkommission des Ausschusses für Fragen der Europäischen Sicherheit – faktisch war dies der Vorgänger des späteren Verteidigungsausschusses – nach Schweden, um sich über das Amt des Militär- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2004 beauftragten des schwedischen Reichstages zu informieren. Sie sollte dort Einrichtungen studieren, die Orientierungspunkte für den demokratiegerechten Aufbau einer künftigen deutschen Truppe boten. Der Delegation gehörte unter anderem auch der spätere Generalinspekteur der Bundeswehr Oberstleutnant a.D. Ulrich de Maizière an. Die Kommission kam zu dem Schluss, dass »die Grundgedanken einer demokratischen Ordnung in der schwedischen Armee mit solcher Konsequenz durchgeführt« worden seien, »dass die schwedischen Einrichtungen unter allen Umständen als wesentliches Modell bei dem Neubau einer Wehrmacht benutzt werden können. Das trifft insbesondere aus dem Grunde zu, weil in Deutschland [...] der ernsthafte Versuch gemacht wird, die Grundgedanken auch in der Ordnung der Wehrmacht zu verwirklichen.« Das Beispiel Schweden diente fortan in der parlamentarischen Debatte als Vorbild für die Verhandlungen um einen westdeutschen Verteidigungsbeitrag. Doch im Bundestag war die Einrichtung eines solchen Militärbeauftragten umstritten. Das Für und Wider ging durch alle Fraktionen. SPD-, FDP-, aber auch einige CDU/CSU-Abgeordnete stimmten für den Wehrbeauftragten, während ein Großteil der CDU/ CSU-Fraktion dieser Institution eher kritisch-abweisend gegenüber stand. Deren Mitglieder befürchteten, dass eine derartige Einrichtung das Vertrauensverhältnis zwischen den Vorgesetzten und Untergebenen in der Bundeswehr untergraben würde. Die anderen Kontrollmöglichkeiten (z.B. der Verteidigungsausschuss, der Petitionsausschuss, die Regelung des Oberbefehls, die Trennung von Armee und Militärverwaltung usw.) wurden als ausreichend zum Schutz der Soldaten angesehen. Ein Kompromiss führte zu einer parlamentarischen Einigung, um die notwendige verfassungsändernde Mehrheit zu erreichen. Dieser war aber nur mit den Stimmen der SPD und Die Namensfrage: Wehrmacht oder Bundeswehr? Der Name »Bundeswehr« für die Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland war bei ihrer Gründung alles andere als klar. Die Westdeutschen Truppen wurden durch eine interne Verfügung des späteren Generalinspekteurs Adolf Heusinger (1897– 1982) im Amt Blank (dem Vorläufer des Bundesministeriums für Verteidigung) ab März 1955 in ihrer Gesamtheit als »Die Streitkräfte« bezeichnet. Alle Anklänge an die Namen »Reichswehr« oder »Wehrmacht« sollten hierdurch vermieden werden. Im allgemeinen deutschen, aber auch internationalen Sprachgebrauch wurde jedoch nach wie vor von der »Wehrmacht« gesprochen. Am 12. Juli 1955 standen sich im Sicherheitsausschuss die Anträge von Dr. Richard Jaeger (CDU/CSU) und Dr. Erich Mende (FDP) gegenüber: Während die CDU/CSU mit dem Namen Bundeswehr den defensiven Charakter der Streitkräfte zum Ausdruck bringen wollte, bemängelte die FDP »Bundeswehr« klänge zu sehr nach »Feuerwehr«. Da keine Einigung in Sicht war, wurde die Entscheidung vertagt. Schließlich entschied sich am 22. Februar 1956 der Verteidigungsausschuss des Bundestages für die Bezeichnung »Bundeswehr«. aak FDP möglich. Beide Fraktionen wollten aber das Amt des Wehrbeauftragten geschaffen sehen. Die SPD bevorzugte eigentlich ein spezielles parlamentarisches Misstrauensvotum gegen den Verteidigungsminister. Als dies aber nicht zu erreichen war, sollte zumindest das Amt des Wehrbeauftragten eingerichtet werden. Unter der Führung der beiden einflussreichen Verteidigungspolitiker Fritz Erler (SPD) und Richard Jaeger (CDU/CSU) einigte man sich Die Wehrbeauftragten 1959–1961 Generalleutnant a.D. Helmuth Otto von Grolman (6.11.1898–18.1.1977), CDU. Grolman war im Zweiten Weltkrieg u.a. Divisionskommandeur und Chef des Generalstabes der Heeresgruppe Süd 1961–1964 Vizeadmiral a.D. Hellmuth Guido Heye, (9.8.1895–10.11.1970), MdB (CDU) 1953–1961. Heye wurde im Zweiten Weltkrieg als Kommandant des Schweren Kreuzers »Admiral Hipper« mit dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausge-zeichnet, später wurde er Admiral der Kleinkampfverbände. 1970–1975 Fritz-Rudolf Schultz, (*19.2.1917), MdB (FDP) 1957–1975 wurde als Führer eines Panzerregiments im Zweiten Weltkrieg mit dem Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet. 1985–1990 Willi Weiskirsch, (1.1.1923–11.9.1996), MdB (CDU) 1976–1985), wurde als Obergefreiter im Zweiten Weltkrieg mehrfach verwundet; als Publizist trat er u.a. mit dem Buch »Nie wieder Komiß! – Es muß alles anders werden« hervor. 1995–2000 Claire Marienfeld, (*21.4.1940), MdB (CDU) 1990–1995, Die erste weibliche Wehrbeauftragte, in ihrer Amtszeit erfolgte die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Rechtmäßigkeit der Auslandseinsätze der Bundeswehr (12.7.1994). 1964–1970 Matthias Hoogen, (25.6.1904–13.6.1985), MdB (CDU) 1949–1964. Hoogen wurde 1940 zur Wehrmacht einberufen, zum Reserveoffizier ausgebildet und war nach Fronteinsatz in der Feldgerichtsbarkeit der Luftwaffe tätig. 1975–1985 Karl Wilhelm Berkhan, (8.4.1915–9.3.1994), MdB (SPD) 1957–1975. Der Maschinenbauingenieur und spätere Lehrer nahm am Zweiten Weltkrieg teil und war von 1969–1975 Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Verteidigung. 1990–1995 Alfred Biehle, (*15.11.1926), MdB (CSU) 1969–1990, nahm 1944/45 am Zweiten Weltkrieg teil und wurde verwundet. Von 1982 bis 1990 war er Vorsitzender des Verteidigungsausschuss. Seit 2000 Dr. Willfried Penner, (*25.05.1936), MdB (SPD) 1972–2000, der heutige Wehrbeauftragte. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2004 9 Fotos: Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages Soldaten Der Wehrbeauftragte auf einen interfraktionellen Beschluss. Nach einer erneuten Wehrverfassungsnovelle (Zweite Wehrergänzung) am 22. März 1956 begannen dann die Beratungen über die Gesetzesentwürfe über den Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages gemäß Artikel 45 b des Grundgesetzes. Die SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag stimmte jedoch im April 1957 gegen das von ihr selbst immer geforderte Wehrbeauftragtengesetz, weil der Wehrbeauftragte nach der Gesetzesvorlage der Regierung zwar mit einer einfachen Mehrheit gewählt, aber nur mit einer Zweidrittelmehrheit abgesetzt werden konnte. Somit sei der Wehrbeauftragte, so die Schlussfolgerung Erlers, dann eben nicht der Vertreter des gesamten Volkes, sondern lediglich einer Partei, also der Mehrheit von CDU/CSU. Im angerufenen Vermittlungsausschuss einigten sich schließlich die Vertreter von Bundesrat und Bundestag auf Wahl und Abberufung des Wehrbeauftragten mit einfacher parlamentarischer Mehrheit. n Vom Gesetz zur Person Im April 1957 formulierte der Wehrexperte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Georg Kliesing wegweisend die Anforderungen an die Person des Wehrbeauftragten: »Die Persönlichkeit allein ist entscheidend. Es handelt sich um die charakterlichen und geistigen Voraussetzungen. Wir verlangen vom Wehrbeauftragten in erster Linie Aufgeschlossenheit für die staatspolitischen Anliegen unserer jungen Demokratie. Wir verlangen von ihm eine vertiefte Kenntnis der soziologischen, der sozialpsychologischen und vor allem der jugendpsychologischen Fragen unserer Zeit. [...]. Es kommt darauf an, dass er aus seiner eigenen Lebenserfahrung heraus mit den Schwierigkeiten vertraut ist, mit denen die junge Generation, die heute Soldat werden muss, zu ringen hat.« Dieses treffende Anforderungsprofil für den künftigen Amtsinhaber setzte hohe Maßstäbe für die Kandidatenauswahl. Solch eine Person zu finden, sollte daher auch zum Problem werden. Der Anwärter musste charakterlich integer sein, der Regierungspartei angehören oder ihr zumindest nahe stehen, am besten noch von der Opposition mitgetragen werden, zugleich ein Wehrexperte und 10 Der Verteidigungsausschuss Der Verteidigungsausschuss ist das Gremium, das auf der Seite des Parlaments dem Verteidigungsministerium und dessen nachgeordneten Bereichen, also den Streitkräften und der Bundeswehrverwaltung gegenübersteht. Dem Verteidigungsausschuss kommt als »Kern der parlamentarischen Kontrolle über die Armee«, in der parlamentarisch-politischen Praxis und in der breiten Öffentlichkeit grundlegende Bedeutung zu. Zu den klassischen Aufgaben des Verteidigungsausschusses gehört die Beratung der ihm von Plenum überwiesenen Gesetzesentwürfe und Entschließungsanträge. vor allem in der Lage sein, das Vertrauen der Soldaten zu gewinnen. Erst 1959 konnte der erste Wehrbeauftragte sein Amt antreten. Die Bundeswehr dagegen war bereits knapp vier Jahre im Aufbau und hatte schon die ersten Bewährungsproben im Bereich der Menschenführung hinter sich. Diese reichten von einfachen Beschwerden bis zum sogenannten Iller-Unglück vom 3. Juni 1957, als bei einer Ausbildungsübung bei Kempten im Allgäu 15 grundwehrdienstleistende Soldaten im Fluss ertranken. Helmuth Otto von Grolman, ein ehemaliger Generalleutnant der Wehrmacht, trat sein Amt als Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages am 3. April 1959 an. Für Grolman bestand die Hauptaufgabe darin, eine Institution, die wie die Bundeswehr selbst ein »Nachzügler« in der westdeutschen Staatsverfassung war, in ein bereits etabliertes und funktionierendes politisches System zu verorten. Schon sein erster Jahresbericht an den Bundestag 1959 brachte ihn und sein Amt in Konfrontation mit dem damaligen Verteidigungsminister Franz-Josef Strauß. Seine Bewertung, wonach sich im abgelaufenen Berichtsjahr schon deutlich alle zwangsläufig nachteiligen Folgen des zu schnellen Aufbaus der Bundeswehr gezeigt hätten, wollte Strauß so nicht hinnehmen und bestritt daraufhin die Kompetenz des Wehrbeauftragten zu solchen Feststellungen. Der Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2004 Ruf, die Zuständigkeiten des Wehrbeauftragten enger zu fassen, erschallte lautstark vor allem aus den Reihen der Regierung. Dies sollte sich auch beim zweiten Wehrbeauftragten, dem ehemaligen Vizeadmiral Hellmuth Guido Heye wiederholen. Der Jahresbericht 1963, der nach Ansicht Heyes nicht die ihm gebührende Aufmerksamkeit von Parlament, Verteidigungsausschuss und Regierung fand, stellte eklatante Mängel im Bereich »Menschenführung« und »Innere Führung« in der Bundeswehr fest. Heye entschloss sich daher zu dem ungewöhnlichen Weg, sinngemäß den Bericht in der Illustrierten »Quick« mit der Schlagzeile »In Sorge um die Bundeswehr« 1964 zu veröffentlichen. »Es ist bedauerlich, es aussprechen zu müssen: Wenn wir nicht das Ruder herumwerfen, entwickelt sich die Bundeswehr zu einer Truppe, wie wir sie nicht gewollt haben. Der Trend zum Staat im Staat ist unverkennbar.« Diese Kernaussage Heyes, veröffentlicht in der Illustrierten mit deutlichen Anspielungen auf das distanzierte Verhältnis der Reichswehr zur Weimarer Republik, löste starke politische und gesellschaftliche Kontroversen aus. Seine Ausführungen zeigten, dass die Innere Führung in der Truppe nur unzureichend umgesetzt wurde und es noch immer erhebliche Defizite in der Menschenführung gab. Infolge der hart geführten Auseinandersetzungen trat Heye im November 1964 zurück, offiziell aus gesundheitlichen Gründen. Der Jurist und CDU-Bundestagsabgeortnete Matthias Hoogen wurde zum Nachfolger Heyes gewählt. Es gelang ihm, allmählich seine Kompetenzen gegen den Widerstand des Verteidigungsministeriums zu erweitern. Neben seinem gesetzlichen Auftrag als Kontrolleur sah er sich auch als Sachwalter der Bundeswehr gegenüber dem Parlament sowie als Mittler zwischen Armee, Politik und Gesellschaft. FritzRudolf Schultz setzte ab 1970 als vierter Wehrbeauftragter die Vorarbeit Hoogens fort und wurde zum Motor der Auseinandersetzung um die nach wie vor strittige Kompetenzfrage zwischen dem Amt des Wehrbeauftragten und dem Verteidigungsministerium. Durch seine Beharrlichkeit befasste sich der Verteidigungsausschuss seit Anfang Amtszeit (27. April 1990– 27. April 1995) Alfred Biehles (CSU) dominierte neben der Abwicklung der Nationalen Volksarmee der DDR (NVA) unter gleichzeitiger teilweisen Übernahme ihrer Soldaten in die Bundeswehr auch die Feststellung der Verfassungsmäßigkeit des Einsatzes deutscher Streitkräfte im Rahmen kollektiver Sicherungssysteme. Auf die weitere Verwurzelung der »Inneren Führung« im Einsatz, wie etwa auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien, legte die erste Frau im Amt, Claire Marienfeld (CDU) ihr Augenmerk. Unter Willfried Penner (SPD), der seit dem 11. April 2000 die Amtsgeschäfte führt, kam zum Einsatz auf dem Balkan der Auftrag in Afghanistan hinzu. n Wehrpflicht und Wehrbeauftragter Die Entstehung des Amtes des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages war nicht nur das Ergebnis einer Konzession an die damalige Opposition, um die verfassungsrechtlich erforderliche 2/3-Mehrheit für die Zustimmung zur Wehrergänzung zu erhalten, sondern sie diente vor allem dem Schutz der grundwehrpflichtigen jungen Männer vor der Willkür von Vorgesetzten. Die Funktion des Amtes war eng mit der Wehrform verbunden, denn die Schutzbedürftigkeit der Wehrpflichtigen wurde als wichtiges Element dieser Institution gedeutet. Diese Notwendigkeit sahen viele Abgeordnete parteiübergreifend. Der Wehrbeauftragte erweiterte im Laufe seiner Entwicklungsgeschichte seinen Kontrollauftrag. Während der Früh- und Aufbauphase (1955–1968) der Bundeswehr beschränkte sich seine Kontrolle auf seinen Verfassungsauftrag: der Einhaltung der Grundrechte der Soldaten und der Grundsätze der Inneren Führung. Seit 1968, als sich die Bundeswehr konsolidierte, begann sich der Wehrbeauftragte vornehmlich auf Fürsorgeangelegenheiten und organisatorische Unzulänglichkeiten zu konzent- Heinrich Bauer Smaragd KG der siebziger Jahre, im Übrigen gegen den Willen des Verteidigungsministeriums, mit einer Novellierung des Wehrbeauftragtengesetzes. Schultz´ Nachfolger im Amt Karl Wilhelm Berkhan sollte aber erst der Erfolg der Novellierung zuteil werden. Berkhan war ein »Vorzeigesozialdemokrat« und Weggefährte des profilierten SPD-Wehrexperten Helmut Schmidt, dem ersten SPDVerteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland und späteren Bundeskanzler. Er wurde am 19. März 1975 mit breiter parlamentarischer Zustimmung zum Wehrbeauftragten gewählt. Berkhans Erfahrungen als Teilnehmer des Zweiten Weltkrieges, seine Ausbildung zum und seine berufliche Tätigkeit als Pädagoge, seine Kenntnisse als Reserveoffizier der Bundeswehr und sein Sachverstand als Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Verteidigung (1969–1975) unter Helmut Schmidt und Georg Leber (SPD) ließen ihn zur »Idealbesetzung« für das Amt des Wehrbeauftragten werden. Im Jahre 1980 stellte er sich als bislang einziger Wehrbeauftragter einer Wiederwahl und führte seine Arbeit bis 1985 fort. Zu Berkhans Verdiensten in diesem Amt gehörte vor allem die Umsetzung der schon genannten Novellierung des Wehrbeauftragtengesetzes im Jahre 1982, die er aber interessanterweise als Staatssekretär im Verteidigungsministerium noch zu verhindern versucht hatte. In der Novellierung wurden die Stellung, die Aufgaben und Befugnisse des Wehrbeauftragten konkretisiert, um die langanhaltenden Kompetenzstreitigkeiten endlich zu klären. Es blieb bei der alleinigen Funktion eines »Hilfsorganes« des Deutschen Bundestages und der damit eindeutigen Zuordnung zum gesetzgebenden Bereich. Es wurde aber auch zweifelsfrei geklärt, in welchen Fällen die Bundeswehr zur Auskunft an den Wehrbeauftragten verpflichtet ist. Auf das Wahrnehmungsproblem der Jahresberichte in der Öffentlichkeit wies Willi Weiskirch (CDU), Wehrbeauftragter seit dem 20. März 1985, hin. Sie sind eben keine Zustands-, sondern Mängelberichte. In der medialen Berichterstattung überwogen aber die Verstöße gegen die Menschenführung die Probleme im Fürsorgebereich. Eine Rezeption, die auch unter den Nachfolgern erhalten bleiben sollte. Die 5 Titelblatt der Illustrierten Quick. Wehrbeauftragtenbericht als Aufmacher rieren. Damit blieb der Dualismus zwischen Verteidigungsministerium und Wehrbeauftragtem erhalten. Zwar scheint die Bedeutung des Amtes in jüngster Zeit nicht mehr so gewichtig zu sein, wie es für die Aufbauphase der Bundeswehr gegolten haben mag, gleichwohl darf das gesunkene öffentliche Interesse, das sich zumeist nur noch auf die Veröffentlichung von gravierenden Verstößen gegen die Menschenwürde aus dem aktuellen Jahresbericht beschränkt, nicht über die weitere uneingeschränkte Notwendigkeit diese Amtes für die Soldaten der Bundeswehr hinwegtäuschen. Selbst bei einer eventuellen Abschaffung der Wehrpflicht würde die Legitimation des Amtes bestehen bleiben, denn eine Auswertung der Eingabenverteilung nach Dienstgradgruppen in den bisherigen Jahresberichten zeigt deutlich, dass das Amt für den Zeit- und Berufssoldaten genauso wichtig war und ist wie für die Grundwehrdienstleistenden – gerade im Hinblick auf die weiter ansteigende Zahl von Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Auch in der laufenden Phase der Transformation der Bundeswehr wird das parlamentarische Kontrollinstrument »Wehrbeauftragter« wohl ausgleichend wirken können. n Rudolf Schlaffer Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2004 11 Schützenpanzer HS 30 Der Schützenpanzer HS 30 Dichtung und Wahrheit A m 5. Mai 1955 – also vor fast genau 50 Jahren – wurde mit dem Inkrafttreten der sogenannten Pariser Verträge die Bundesrepublik Deutschland Teil der NATO. Insbesondere die Vereinigten Staaten hatten seit 1950 auf eine bundesdeutsche Beteiligung an den Verteidigungsbemühungen der westlichen Demokratien in Mitteleuropa gedrängt. Nicht nur die geopolitische Lage der Bundesrepublik entlang des Eisernen Vorhanges, sondern auch die Aussicht auf rund 500 000 deutsche Soldaten zur konventionellen Verteidigung waren hierfür ausschlaggebend. Die politisch Verantwortlichen in Washington hatten während des Zweiten Weltkriegs großen Respekt vor der Kampfstärke und Disziplin der deutschen Soldaten gewonnen. Darüber hinaus sollte die konventionelle Verteidigung Westeuropas spätestens – so die Vorstellung der Regierung Truman – ab 1953 maßgeblich durch die Europäer selbst sichergestellt werden. Die USA wollten sich in der Hauptsache auf die atomare Abschreckung konzentrieren. Folglich verlangte Washington von Bonn als Preis für den NATO-Beitritt eine sehr schnelle Aufrüstung. Bis Ende 1959 sollten die zwölf aufzustellenden westdeutschen Divisionen dem Bündnis unterstellt werden. Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) stimmte dieser Forderung zu, obwohl er genau wusste, dass dies einen schnelleren Aufbau nötig machen würde, als ihn die Wehrmacht von 1935 bis 1939 unter wesentlich günstigeren Voraussetzungen geleistet hatte. Ausgehend von einer konventionellen Verteidigung Mitteleuropas kamen die militärischen Berater des ersten Verteidigungsministers der Bundesrepublik Deutschland, Theodor Blank (CDU), zu dem Schluss, dass es im 12 Falle einer kriegerischen Auseinandersetzung zu einer großen Panzerschlacht in der norddeutschen Tiefebene kommen würde. Für diese Auseinandersetzung brauchte man eine große Anzahl gepanzerter Fahrzeuge. Kampf- und Kanonenjagdpanzer, Flugabwehr- und Aufklärungspanzer sowie Gefechtsstandfahrzeuge und natürlich Schützenpanzer. Auf der Grundlage der Erfahrungen während des Zweiten Weltkrieges an der Ostfront, hatte die militärische Spitze im Bundesministerium für Verteidigung (BMVg) sehr genaue Vorstellungen von dem, was der zukünftige Schützenpanzer der Bundeswehr alles können sollte. Nur leider gab es zu diesem Zeitpunkt weltweit noch nicht einen Schützenpanzer mit der gewünschten Ausstattung. Das einzige Fahrzeug, das den Vorstellungen der bundesdeutschen Planern nahe kam, war der französische AMX 13-VTP. Dieser erschien aber den Beschaffungsreferaten im BMVg mit einem Stückpreis von umgerechnet 250 000 DM zu teuer. Über diese hauptsächlich militärischen Aspekte hinaus gab es noch andere wichtige Faktoren, die die Beschaffung von Rüstungsgütern insbesondere in der Aufbauphase der Bundeswehr beeinflussten. Mitte der fünfziger Jahre befand sich die westdeutsche Wirtschaft in einer Phase der Hochkonjunktur und die Unternehmen hatten wenig Interesse an Rüstungsaufträgen. Dies lag zum einen an den hohen Entwicklungskosten für militärisches Gerät, die üblicherweise nur bedingt durch den Auftraggeber gezahlt wurden, zum anderen an den – u.a. aufgrund des bundesdeutschen Rüstungsgüterexportverbotes – fehlenden internationalen Folgeaufträgen. Insgesamt also ein unsicheres Geschäft, auf das sich nur wenige Unternehmen Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2004 in einer Phase voller Auftragsbücher einlassen wollten. Dieses mangelnde Interesse an Rüstungsaufträgen in der deutschen Industrie eröffnete der Bundesregierung die Möglichkeit für Kompensationsgeschäfte mit den bisherigen Schutzmächten Frankreich und Großbritannien, deren Volkswirtschaften sich in einer tiefen Rezession befanden. In Frankreich wurde u.a. der Schützenpanzer, kurz »Hotchkiss« bestellt. In Großbritannien hingegen sollte der Kampfpanzer »Centurion« geordert werden. Diesem Geschäft kamen aber die Amerikaner zuvor. Sie stellten der jungen Bundeswehr im Rahmen einer sehr kostengünstigen Militärhilfe u.a. die Kampfpanzer M-41 und M-47 kostenfrei zur Verfügung. Dementsprechend mussten im Verteidigungsministerium neue Überlegungen angestellt werden, wie die britische Industrie an der Aufrüstung der Bundeswehr beteiligt werden konnte. Eine Lösung für dieses Problem bahnte sich an, als die Schweizer Hispano Suiza Gruppe dem BMVg 1955 einen Schützenpanzer anbot, der in Großbritannien bei einer bis dahin nicht sehr bekannten Firma namens British MARC gefertigt werden sollte. Aber nicht nur die Möglichkeit diesen Panzer in Großbritannien fertigen lassen zu können und der Zeitdruck durch die Zusagen der Bundesregierung an die NATO, sondern auch der vorgeblich niedrige Anschaffungspreis von ca. 170 000 DM wie auch die Ausstattung des Fahrzeuges, die den Wünschen der bundesdeutschen Beschaffer entsprach, führten zu einer schnellen – und wie sich später herausstellen sollte – überstürzten Entscheidung für den so genannten Schützenpanzer, lang Hispano Suiza HS 30, für die Panzergrenadiertruppe der Bundeswehr. male haben: 4 volle Geländegängigkeit und Vollkette; BWB WTS Der Preis für das Fahrzeug war von großer Bedeutung, da aufgrund der panzergrenadierstarken Struktur der Bundeswehr nicht weniger als 10 680 Schützenpanzer angeschafft werden sollten. Dementsprechend lag der veranschlagte Beschaffungspreis bei ungefähr zwei Milliarden DM. Der jährliche Verteidigungsetat betrug aufgrund der ökonomischen Rahmenbedingungen und Vorgabe des rigiden Finanzministers Fritz Schäffer (CSU) nur konstante neun Milliarden DM. Bei einer Investitionsquote von geschätzten 30% des Verteidigungsetats hätte diese einzelne Beschaffung fast den gesamten Rüstungsetat eines kompletten Jahres verbraucht. Das BMVg musste in den fünfziger Jahren aber nicht nur Gefechtsfahrzeuge für die Kampftruppe beschaffen, sondern sämtliche Ausrüstungsgegenstände, die Soldaten für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Zudem mussten Kasernen, Flughäfen gebaut und sonstige Infrastruktur renoviert oder gänzlich neu geschaffen sowie Kleinfahrzeuge, Transportfahrzeuge, Fernmeldegerät, Kleinwaffen etc. angeschafft werden. Um mit dem vorhandenen Budget so viel wie möglich beschaffen zu können, war es daher dringend notwendig, das entsprechende Gerät so kostengünstig wie möglich zu erwerben. Den Beschaffern des BMVg bot sich folgendes Bild: weltweit gab es in der Nachkriegszeit noch keinen Markt für Schützenpanzer. Die Fahrzeuge der Amerikaner und Briten waren bereits über zehn Jahre alt und entsprachen in der Technik dem Stand der dreißiger Jahre. Der französische AMX 13-VTP war den Verantwortlichen im BMVg zu teuer. Der von der Ford Motor Corporation für die US-Streitkräfte neu entwickelte Schützenpanzer M 59 entsprach aufgrund seines hohen Gewichts und 2,40m hohen Aufbauten nicht den Vorstellungen der bundesdeutschen Planer. Im Herbst 1955 stellte Großbritannien der Bundeswehr zunächst einmal 500 veraltete »Bren-Carrier« zu je 4000 DM zur Verfügung. Mit diesem Fahrzeug konnten vorübergehend die Einsatzverfahren der Panzergrenadiertruppe geübt werden. Der zukünftige Standard-Schützenpanzer sollte aber nach den Vorstellung der Bundeswehrführung folgende entscheidende Merk- 4 kraftschlüssiges, stufenloses Getriebe bei mindestens 20 PS pro to Gewicht; 4 Rundumpanzerung mit zweiflügeligem Heck, bei einer max. Höhe von 160 cm ohne Geschützturm; 5 Schützenpanzer HS 30 4 Platz für 10 Mann Besatzung sowie eine 20mm Bordkanone und eine Vernebelungseinrichtung. Aus heutiger Sicht verwundert es natürlich, dass dies genau die Anforderungen waren, die Hispano Suiza während eines ersten Gesprächs mit dem BMVg für seinen neu entwickelten Schützenpanzer HS 30 angab. Vermutlich hatte das Schweizer Unternehmen über Informanten die Daten zum Anforderungsprofil im Vorfeld erfahren und nutzte dies nun in den Verhandlungen aus. Bevor der eigentliche Beschaffungsvorgang näher beschrieben wird, sollen zunächst noch ein paar Fakten über den heutzutage eher unbekannten Herstellers des ersten Schützenpanzers für die Panzergrenadiertruppe der Bundeswehr angeführt werden. 5 Bundeskanzler Adenauer und Verteidigungsminister Strauß vor einem Holzmodell des Schützenpanzers HS 30 auf dem Truppenü- Schützenpanzer HS 30 – Der Hersteller Die im Sommer des Jahres 1904 von dem Schweizer Motoreningenieur Mark Birkigt gegründete Aktiengesellschaft stellte anfangs Motorräder, dann 1910 erste Personenkraftwagen her. In den ersten Jahren seines Bestehens besaß das Unternehmen eine Produktionsstätte im spanischen Barcelona und eine im schweizerischen Genf. Hieraus entstand der Firmenname: Hispano Suiza. Während des Ersten Weltkriegs hielt sich Hispano Suiza mit dem Bau von Motoren für französische Kampfflugzeuge und der Produktion einfacher Lastwagen für die französische Armee über Wasser. Der erste Versuch, sich im Bereich der Rüstungsgüterproduktion mit Nachdruck zu etablieren, scheiterte 1921 kläglich mit dem bungsplatz Bergen-Hohne, 25. September 1958 Bau eines unförmigen Panzerwagens für die französische Armee. Weltbekannt wurde der Schweizer Motorenbauer dann ab Mitte der zwanziger Jahre mit dem Bau von Luxusautomobilen. Hispano Suiza war mit seinen Modellen, so z.B. 1930 mit dem ersten 6-Zylinder-Pkw und 6500 ccm starken H 6 B in dieser Zeit der Hauptkonkurrent von Rolls-Royce und des deutschen Unternehmens Maybach. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges war der Markt für Luxuskarossen vollkommen weggebrochen. Hispano Suiza musste sich, wenn das Unternehmen überleben wollte, ein neues Betätigungsfeld suchen. In dieser Situation kam der Geschäftsführung zugute, dass das Unternehmen während der dreißiger Jahre Nachbaurechte für eine Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2004 13 Schützenpanzer HS 30 bevorzugt Firmen Aufträge erhielten, die durch ehemalige Offiziere aus den Beschaffungsämtern der Wehrmacht vertreten wurden. Diesen Sachverhalt wiederum machten sich einige Firmen zu nutze, um am Aufbau der Bundeswehr gewinnbringend partizipieren zu können. Der Beschaffungsvorgang BWB WTS Hispano Suiza hatte verschiedene Hebel, mit denen das Unternehmen ins Geschäft mit der Bundesrepublik kommen konnte. Einerseits die Produktionsstätten in Großbritannien, in denen der HS 30 gefertigt werden sollte. Bonn hätte damit das Problem der Kompensation des gescheiterten BWB WTS 20-mm-Kanone der deutschen Firma Rheinmetall erworben hatte. Dies wurden nun als Chance gesehen, daraus Kapital aus der Aufstellung der bundesdeutschen Streitkräfte zu schlagen. Die Schweizer waren jedoch nicht die einzigen Interessenten. Viele Firmen weltweit wollten an dem Milliardenumsatz zu partizipieren. Da die Geschäfte mit dem Bau von Luxuskarossen immer noch nicht angelaufen, die meisten vorhandenen Patente veraltet und Kapital bzw. externe Geldgeber für große, dringend notwendige Investitionen nicht vorhanden waren, glaubte die kaufmännische Leitung des Genfer Unternehmens mit während des Zweiten Weltkrieges erworbenen zusätzlichen Lizenzen gute Geschäfte 5 Schützenpanzer AMX-13 5 Schützenpanzer Bren Carrier machen zu können. Wie der erste Kontakt zwischen der Hispano Suiza-Gruppe und dem bundesdeutschen Verteidigungsministerium zustande gekommen ist, lässt sich heute nicht mehr genau nachvollziehen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich um Beziehungen des NS-deutschen Geheimdienstes aus dem Zweiten Weltkrieg über Liechtenstein in die Schweiz gehandelt hat. Weiter forciert wurde dieser Kontakt dann insbesondere durch ehemalige Offiziere, die im Heereswaffenamt der Wehrmacht tätig gewesen waren. Diese gingen nun in den Rüstungsabteilungen des BMVg entweder als Lobbyisten, respektive Berater, ein und aus – oder waren dort sogar in verantwortlicher Position tätig. Sie nutzten ihre ehemalige Stellung, ihre Beziehungen und ihr Fachwissen, um die Produkte der von ihnen vertretenen Unternehmen mit Nachdruck den Verantwortlichen im Verteidigungsministerium anzubieten. Diese Beziehungen führten dazu, dass insbesondere bei der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für das Heer Centurion-Geschäftes lösen können. Zudem hatten die Genfer gute Kontakte zu Hanomag und Henschel aufgebaut und diesen ehemaligen deutschen »Panzerschmieden« für den zukünftigen bundesdeutschen Schützenpanzer bereits Nachbaurechte angeboten. Genau das lag im Interesse des BMVg, denn mittelfristig sollten deutsche Ingenieure Kompetenzen im Waffenbau erhalten. Forciert wurde das Geschäft zudem durch das sehr aggressive Verhalten der deutschen Lobbyisten für die Schweizer Aktiengesellschaft. Sie trieben das Geschäft ohne Skrupel voran und informierten die Genfer Zentrale stets über rüstungspolitische Entwicklungen in Bonn. Wie bereits geschildert brauchte die junge Bundeswehr so schnell wie möglich eine große Anzahl, kostengünstiger, aber trotzdem »eierlegender Wollmilchsäue« in Form von Schützenpanzern, die den Vorstellungen der für den Aufbau der Panzergrenadiertruppe Verantwortlichen im Bonner Verteidigungsministerium entsprachen. Genau solch ein Fahrzeug behauptete His- 14 Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2004 pano Suiza liefern zu können, obwohl das Unternehmen noch keine Erfahrung im Panzerbau besaß. Es sei ihnen sogar möglich, einen Schützenpanzer billiger und effizienter zu bauen, als alle anderen am Markt befindlichen, seit Jahrzehnten im Panzerbau erfahrenen Anbieter. Noch bemerkenswerter ist aber, dass die Verantwortlichen im BMVg dies tatsächlich geglaubt haben. Bereits im Mai 1956 wurde Hispano Suiza ein Entwicklungsauftrag erteilt, obwohl das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt nur unvollständige Konstruktionszeichnungen und vage Versprechungen vorweisen konnte. Umso mehr verwundert es, dass in den folgenden Monaten schnell nacheinander entscheidende Verträge abgeschlossen wurden, die das BMVg für die nächsten Jahre beim Schützenpanzerkauf an die Schweizer »Möchtegern-Panzerbauer« banden. Damit begann der nicht enden wollende Ärger mit Hispano Suiza. Bereits wenige Wochen nach der Unterzeichnung der ersten Verträge zeigte Hispano Suiza sehr deutlich seine wahren Absichten bei dem Geschäft mit dem deutschen Verteidigungsministerium. Es ging den Schweizern einzig darum, mit dem geringst möglichen Aufwand einen maximalen Gewinn zu erzielen. Offensichtlich nicht an Folgeaufträgen der Bonner Rüstungsabteilungen interessiert, setzten sie alles daran, die geschlossenen Verträge weitestgehend zu eigenen Gunsten auszulegen. Dabei half ihnen stets das Geflecht von Abhängigkeiten auf der Seite des Auftraggebers. Die Bundeswehr musste so schnell wie möglich aufgerüstet werden, das Geld sollte in Großbritannien ausgegeben werden, es gab keine den bundesdeutschen Anforderungen entsprechenden Schützenpanzer am Markt und am schlimmsten für das BMVg: Die geschlossenen Verträge ließen nur einen sehr teuren Ausstieg zu. Im Laufe des Jahres 1957 veränderte sich dann die Situation grundlegend. Franz-Josef Strauß (CSU) hatte im Herbst 1956 das Verteidigungsministerium übernommen und den Charakter der Aufrüstung der Bundeswehr umgewandelt: Statt der von der NATO geforderten schnellen, rein quantitativen Aufrüstung der westdeutschen Streitkräfte, wollte Strauß eine »Qualitätsarmee« schaffen. Sein Ziel war BWB WTS es, die jungen bundesdeutschen Streitkräfte mit dem besten und modernsten militärischen Gerät auszurüsten. Im Rahmen der Veränderungen stieß er auf die Verträge mit der Hispano Suiza-Gruppe. Der neue Verteidigungsminister reagierte verärgert auf das Geschäftsgebaren der Schweizer. Wiederholt brachte er dies zum Ausdruck. Endgültig platzte Strauß der Kragen im Sommer 1958, als er bei einer Besprechung mit der Firmenleitung von Hispano Suiza erläutert bekam, dass der Konzern die Garantie für alle mit dem Fahrzeug verbundenen Risiken übernehmen würde, nicht aber für deren »Kriegstauglichkeit«. Wenig später wurde ein Hinweis des Auftraggebers auf die Störanfälligkeit des Schützenpanzers bei den Probeläufen an der Panzertruppenschule in Munster von den Schweizern lapidar mit der Bemerkung abgetan, dass die Truppe dann vorsichtiger mit dem Fahrzeug umgehen solle! Franz-Josef Strauß war nun am Ende mit seiner Geduld und wollte nur noch, »dass möglichst etwas Brauchbares geschaffen wird«. Die Geschäftsführung von Hispano Suiza war für ihn als Geschäftspartner inakzeptabel geworden. Die Anzahl der bestellten Panzer wurde in der Folgezeit nach langwierigen Verhandlungen von anfänglich 10 680 auf nur noch rund 2800 reduziert. Nur 1089 HS 30 wurden schließlich in Großbritannien bei dem Lizenznehmer Leyland produziert, die restlichen jeweils 806 bei Hanomag und Henschel in der Bundesrepublik . Die Bundesregierung versuchte, mit dem Erwerb des HS 30 unterschiedliche Probleme auf einmal zu lösen. Dadurch schuf sie jedoch neue Schwierigkeiten. Diese zu beseitigen dauerte einige Jahre. Die fehlende Zahl Schützenpanzer wurde zunächst durch eine Weiterentwicklung des amerikanischen M 59 – den M 113 – ergänzt. Noch im Winter 1958 gab das BMVg bei Hanomag und Henschel eine Studie für den ersten originär westdeutschen Schützenpanzer in Auftrag. Daraufhin entwickelten verschiedene bundesdeutsche Firmen ein völlig neues Modell den 1971 in die Bundeswehr eingeführten Schützenpanzer Marder. Die an diesem Projekt beteiligten Unternehmen erhielten immer erst Entwicklungskosten erstattet, wenn sie die 4 Schützenpanzer M-59 Funktionstüchtigkeit des jeweils vorgelegten Bauteils nachweisen konnten. Dies war eine der Lehren, die aus dem gescheiterten HS 30-Projekt gezogen wurden. Aber nicht nur der Beschaffungsvorgang wurde grundlegend verändert, auch die Kontrolle der Beschaffungsabteilungen wurde erheblich verbessert. Schützenpanzer HS 30 – Ein Beschaffungsskandal? Der Erwerb des Schützenpanzers HS 30 beschäftigte die politische Landschaft in der Bundesrepublik noch bis Anfang der siebziger Jahre. Nachdem dieser Vorgang Ende der fünfziger Jahre nur eine »Kleine Anfrage« der SPD-Fraktion im Bundestag nach sich gezogen hatte, führte die ohne Zweifel politisch motivierte Pressekampagne gegen Franz-Josef Strauß Mitte der sechziger Jahre noch einmal dazu, dass das HS 30-Projekt in aller Breite in der Öffentlichkeit aufgerollt wurde. Bernt Engelmann, Rudolf Augstein und verschiedene andere Journalisten überregionaler Zeitungen untersuchten die Ereignisse aus der Aufbauphase der Bundeswehr so intensiv, dass sich der Bundestag veranlasst sah, zu dieser Thematik im April 1967 einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Die Spekulationen über den Ablauf der Beschaffung wurden von Tag zu Tag umfangreicher und abenteuerlicher. Neben glaubwürdigen und unbescholtenen Zeugen meldeten sich Scharlatane und Geltungssüchtige zu Wort, die es für den Ausschuss immer schwieriger machten, die tatsächlichen Vorgänge herauszufiltern. Hauptzielscheibe dieses angeblichen Skandals wurde nun die »Große Koalition« des amtierenden Bundeskanzlers Kurt Georg Kiesinger (CDU) und hier besonders Franz-Josef Strauß, der mittlerweile das Finanzressort leitete. Einige Journalisten warfen Strauß unverhohlen vor, sich an der HS 30-Beschaffung bereichert zu haben. Dass dies nicht der Wahrheit entsprach, belegen neueste Forschungsergebnisse. Im Zusammenhang mit der Beschaffung des Schützenpanzers HS 30 kann man ihm höchstens den Vorwurf machen, dass er nicht gleich nach Amtsbeginn als Verteidigungsminister den Auftrag storniert hat. Zu diesem Zeitpunkt waren die Probleme aber noch nicht abzusehen, die dieser Beschaffungsvorgang mit sich brachte. Strauß ist es letztlich gewesen, der die betrügerischen Machenschaften der Hispano Suiza soweit wie möglich eingeschränkt hat und die Beschaffung des HS 30 auf ein Minimum reduzieren konnte. n Dieter H. Kollmer Literaturtipp: Dieter H. Kollmer, Rüstungsgüterbeschaffung in der Aufbauphase der Bundeswehr – verdeutlicht am Bespiel der Beschaffung des Schützenpanzers HS 30, Stuttgart 2002 (= Beiträge zur Wirtschaftsund Sozialgeschichte, 93) Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2004 15 ullstein - AP Einmarsch in Afghanistan 1979 5Lager sowjetischer Militärfahrzeuge am Rande des Flughafens von Kabul, Ende Dezember 1979 I n der Nacht vom 25. zum 26. Dezember 1979 war die Luft über dem Kabuler Flughafen erfüllt vom Triebwerkslärm schwerer Transportmaschinen. Geruch von verbranntem Gummi lag schwer über der Landebahn, ununterbrochen landeten und starteten neue Maschinen der sowjetischen Luftwaffe. Aus den Rümpfen von über 150 Militärtransportern quollen mehrere tausend Fallschirmjäger der 103. Garde-Luftlandedivision, die als Eliteeinheit der Sowjetarmee gefürchtet war. Die sich rasch formierenden Kolonnen nahmen am Abend des 27. Dezembers 1979 Kurs auf Kabul mit der Aufgabe, wichtige strategische Punkte der Hauptstadt Afghanistans zu besetzen. Eine Spezialeinheit des KGB eilte in Richtung des Kabuler Regierungspalastes, um den amtierenden Präsidenten der Demokratischen Republik Afghanistan, Hafizullah Amin, zu beseitigen und an seine Stelle den Moskau treu ergebenen Babrak Karmal zu setzen. Der den sowjetischen Fallschirmjägern entgegengebrachte Widerstand wurde rasch und mit großer Brutalität gebrochen. Bei der handstreichartigen Besetzung Kabuls starben mehr als 80 sowjetische Soldaten, über 200 von ihnen wurden verletzt, die afghanische Zivilbevölkerung hatte mehr als Tausend Opfer zu beklagen. Wenig später überschritten drei Divisionen der sowjetischen Armee mit mehr als 45 000 Mann die Grenzen des afghanischen Staates. Sie sollten die 7000 in Kabul gelandeten Fallschirmjäger unterstützen und weitere wichtige 16 strategische Punkte des Landes unter ihre Kontrolle bringen. Über diese Blitzaktion, die nicht nur die sowjetische und afghanische Bevölkerung, sondern auch die gesamte Weltöffentlichkeit überraschte, war in den Zeitungen der UdSSR kein einziges Wort zu lesen. Erst am 29. Dezember 1979 veröffentlichte die sowjetische Nachrichtenagentur Tass eine dürre Pressemeldung über die Invasion in Afghanistan. Mit der handstreichartigen Besetzung Kabuls begann die Sowjetunion den längsten Krieg ihrer Geschichte. Mehr als zehn Jahre führte Moskau einen unerklärten Feldzug gegen das Volk Afghanistans, der über 15 000 sowjetischen Soldaten und unzähligen afghanischen Männern, Frauen und Kindern das Leben kosten sollte. Weitere hunderttausende ehemalige Sowjetsoldaten und Millionen Afghanen sind in Folge des Krieges an Körper und Seele mit den äußeren und inneren Spuren der Kämpfe gebrandmarkt. Während die UdSSR kurz nach dem Rückzug ihrer Truppen (14. April 1989) auf Grund der inneren Schwäche des kommunistischen Systems auseinander fiel, kam Afghanistan nicht zur Ruhe. Ein jahrzehntelanger, blutiger Bürgerkrieg forderte weitere schwere Opfer unter der Zivilbevölkerung. Erst nach dem Sturz der Taliban-Herrschaft durch eine von den USA geführte internationale Koalition von Streitkräften 2001 versucht das Land allmählich und durch die Unterstützung einer internationalen Friedenstruppe seinen inneren Frieden zu finden, ein Prozess, dessen Erfolg jedoch immer noch ungewiss erscheint. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2004 Vor 25 Jahren: Der sowjetische Einmarsch in Afghanistan 1979 Vorspiel zur sowjetischen Invasion Nach Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Tod Stalins begann eine Periode der Annäherung Afghanistans an die Sowjetunion. Ausdruck des veränderten Verhältnisses zwischen beiden Ländern war ein Besuch des sowjetischen Generalsekretärs Nikita Chruschtschow in Kabul 1955. Daraufhin erhielt das Land Militärhilfe in Höhe von 25 Mio. Dollar sowie eine Zusage über die Entsendung sowjetischer Militärberater. Weiterhin sollte ein sowjetischer Kredit über 100 Mio. Dollar die wirtschaftliche Entwicklung des Landes beschleunigen. Afghanistan geriet damit entgegen seiner offiziellen Neutralitätspolitik immer mehr in den Sog des sowjetischen Machtbereichs. Vor allem die afghanische Armee wurde von der UdSSR zur ideologischen Infiltration genutzt, da eine Vielzahl der afghanischen Kadetten jetzt an kommunistischen Militärakademien studierte. Mit den Streitkräften Afghanistans verfügten die Sowjets im Laufe der Jahre über ein Machtinstrument, das sie in die Lage versetzte, bei gegebenem Anlass auf die politischen Geschicke des Landes einzuwirken. Am 3. Juli 1973 stürzte Prinz Mohammed Daoud Khan die Monarchie unter König Zahir Schah und ernannte sich zum ersten Präsidenten der neu proklamierten Demokratischen Republik Afghanistan. Obwohl die Regierung Daoud grundlegende politische, soziale und wirtschaftliche Reformen versprach, konnte sie auf Grund der ökonomischen Schwäche 3 Die sowjetische Invasion vom 24. bis 27. Dezember 1979 6 Ein sowjetisches Panzerfahrzeug auf Patrouillenfahrt in Kabul MGFA/Woynoski des Landes kaum tiefgreifende Veränderungen in der Gesellschaft bewirken. Daoud, der sich zunächst stark an die Sowjetunion angelehnt hatte – 1973 erhielt das Land 11,5 Mrd. Dollar Wirtschafts- und Militärhilfe durch die UdSSR –, begann allmählich die Gefahr einer zu engen Bindung zu fürchten. Seit 1975 versuchte er sich aus der »brüderlichen« Umarmung Moskaus zu lösen. Das gelang ihm auch zum Teil. Er verminderte die Zahl der sowjetischen Militärberater von einigen Hundert auf 35. Gleichzeitig suchte er Unterstützung bei Staaten der Region und Verbindung mit der westlichen Welt, vor allem mit den USA. Damit wurde die Regierung Daoud für die Sowjets zu einem unsicheren Machtfaktor; sie musste »verschwinden«. An die Stelle Daouds wollte der sowjetische Geheimdienst den Führer der Parcham-Fraktion innerhalb der afghanischen kommunistischen Partei, Babrak Karmal, zu setzen. Er war ein langjähriger Agent des KGB und deshalb dessen Favorit. Doch gelang es dem sowjetischen Geheimdienst nicht, sich gegen Leonid Breschnew durchsetzen. Der sowjetische Partei- und Staatschef favorisierte den Generalsekretär der afghanischen kommunisti- schen Partei und Chef der Khalq-Fraktion Mohammed Taraki. Dieser hatte bei einem kurzen Treffen mit dem sowjetischen Parteichef einen so starken Eindruck hinterlassen, dass Breschnew ihn zum neuen Präsidenten Afghanistans bestimmte. Karmal wurde auf den Posten des Botschafters in Prag abgeschoben. Die reformorientierte, konservativ neutralistisch ausgerichtete Regierung Daoud wurde im April 1978 durch einen Putsch von Kommunisten und linksgerichteten Teilen der Armee, mit Hilfe des KGB und des sowjetischen Militärgeheimdienstes GRU, gewaltsam beseitigt. Dafür, dass der Staatsstreich vom 27. April 1978, bei dem Daoud und 1000 weitere Afghanen ihr Leben verloren, von den Sowjets geplant war, sprechen mehrere Fakten. Seine Leitung erfolgte durch sowjetische Militärberater, die in der Botschaft der UdSSR in Kabul saßen. Sie gaben auch den Mord am Parcham-Ideologen Mir Akbar Khaiber in Auftrag, der zum auslösenden Moment des Umsturzes wurde. Mit Hilfe von Moskau treu ergebenen Offizieren konnte die afghanische Armee zum Putsch gegen Daoud bewegt werden. Das entscheidende Bombardement zur akg-images / AP Erstürmung des Präsidentenpalastes wurde von sowjetischen Piloten durchgeführt. Damit hatte die UdSSR den »Abweichler« Afghanistan zunächst wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Der Versuch des kommunistischen Regimes, eine rasche soziale Umwälzung des afghanischen Gesellschaftsgefüges nach sowjetischem Vorbild zu erreichen, musste auf Grund der inneren Gegebenheiten des Landes fehlschlagen. Die traditionell geprägten Stammes- und Clanstrukturen und die feudal geprägte Wirtschaftsordnung des Landes standen allen raschen »Modernisierungsversuchen« im Wege. Den entschiedenen Widerstand der Traditionalisten rief die Regierung vor allem durch den Versuch einer Landreform hervor. Sie hätte die traditionellen Besitzstrukturen gänzlich aufgelöst. Der Erfolg der Landreform existierte lediglich auf dem Papier. In Propagandaberichten der offiziellen Presse tanzten Bauern vor Begeisterung, küssten ihre Urkunden über den Landerhalt und schwangen rote Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2004 17 ullstein - AP ullstein - AP ullstein - ullstein bild Einmarsch in Afghanistan 1979 Prinz Mohammed Daoud Khan Hafizullah Amin Mohammed Taraki stürzte am 3. Juli 1973 die Monarchie und ernannte sich zum ersten Präsidenten der neu proklamierten Demokratischen Republik Afghanistan Vizepremier, Nachfolger von Taraki nach dessen Ermordung im September 1979 Generalsekretär der afghanischen kommunistischen Partei und Präsident 1978/79 Fahnen. Doch die Wirklichkeit sah anders aus: »Es fehlte an allem anderen, was für den Erfolg einer Agrarreform nötig war, nämlich ordentliche Vermessung, Hilfe und Beratung beim Betriebsaufbau, Werkzeuge, Saatgut, Düngemittel, Bildung von Genossenschaften und Kredithilfe. [...] Das Ganze erwies sich als Fehlschlag und wirkte eher gegen als für das Regime. In der Landbevölkerung wuchsen die Zweifel, ob die Maßnahmen wirklich in ihrem Interesse seien.« Die kommunistische Führung des Landes, deren Mitglieder untereinander zerstritten waren, erwies sich als unfähig, die anstehenden politischen Aufgaben zu lösen. Indessen förderte die verfehlte Politik der Regierung die Kräfte der muslimischen Opposition, so dass eine Ablösung des kommunistischen Regimes immer wahrscheinlicher schien. Am 13. März 1979 brach in der Provinz Herat ein Aufstand gegen das Regime in Kabul aus. Dabei unterstützten Teile der afghanischen Armee aktiv die Widerstandskämpfer. In der Provinzhauptstadt Herat eroberten die Rebellen im Handstreich das Polizeihauptquartier und das Gefängnis. Danach begannen Kämpfe um die Garnison der 17. Infanteriedivision, welche bereits nach kurzer Zeit zu den Mujaheddin (arabisch: Heilige Krieger) überlief. Zur gleichen Zeit entlud sich der aufgestaute Hass der Bevölkerung auf die örtlichen Vertreter des Regimes. 18 Die Antwort der Kabuler Regierung ließ nicht lange auf sich warten. Vier Tage nach Beginn des Aufstandes begannen Flugzeuge und Hubschrauber mit der Bombardierung der Stadt. Gleichzeitig wurden loyale Truppenverbände zur Niederschlagung der Rebellion in Marsch gesetzt. Der erdrückenden Übermacht konnte die Garnison eine Woche lang widerstehen, danach fiel sie. Als die Regierungstruppen in das wiedereroberte Herat einrückten, zogen Willkür und Terror ein. Wahllos wurden Menschen verhaftet oder getötet. Den Kämpfen um die Stadt fielen 25 000–30 000 Personen zum Opfer und eine noch größere Zahl von Menschen wurde verwundet. Nach der Besetzung der Provinzhauptstadt verhängte die Regierung das Kriegsrecht über Herat. Soldaten und Geheimdienstleute durchkämmten systematisch die Häuser nach versteckten Rebellen. Die Verhafteten wurden häufig sofort erschossen oder in die zahlreichen Gefängnisse verschleppt und dort gefoltert. Dem Aufstand von Herat folgten jedoch zahlreiche weitere bewaffnete Aktionen gegen die Regierung in Kabul, so dass diese sich selbst mit unverhülltem Terror kaum noch an der Macht halten konnte. Deshalb erörterte das Politbüro der KPdSU ab dem Frühjahr 1979 die Möglichkeiten einer militärischen Invasion in Afghanistan, um dessen kommunistische Regierung weiter an der Macht zu halten. Am 17. März 1979 trafen sich Außenminister Andrej Gromyko, der Sekretär des Zentralkomitees (ZK) Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2004 der KPdSU Andrej Kirilenko, Verteidigungsminister Dimitrij Ustinow, Geheimdienstchef Jurij Andropow und der Vorsitzende des Ministerrats Alexej Kossygin, um über die prekäre Lage in Afghanistan zu beraten. Auf der Sitzung vertraten Außenminister Gromyko und ZK-Sekretär Kirilenko die Position, dass ein Abfall Afghanistans von der Sowjetunion auf keinen Fall hingenommen werden könne und eine militärische Intervention deshalb nicht auszuschließen sei. Auch Kossygin und Andropow wollten Afghanistan nicht als sowjetisches Einflussgebiet verlieren, wiesen jedoch auch auf die Risiken eines bewaffneten Eingreifens für die UdSSR hin. Demgegenüber verwies Verteidigungsminister Ustinow darauf, dass die afghanische Führung ein aktives Eingreifen der Sowjetarmee in die Kämpfe zur Zerschlagung der Opposition erwarte. Im Verteidigungsministerium seien deshalb bereits zwei Varianten für den Einfall in Afghanistan ausgearbeitet worden. Der erste Plan sah die Besetzung Kabuls durch Fallschirmjäger der 105. Luftlandedivision und eines motorisierten (mot.) Schützenregimentes, das auf dem Luftweg dorthin verbracht werden sollte, innerhalb von 24 Stunden vor. Gleichzeitig sollten die 68. mot. Schützendivision und die 5. mot. Schützendivision über die Landesgrenze in Afghanistan einfallen. Einen Zeitraum von drei Tagen betrachtete Ustinow für die Vorbereitung der Invasion als ausreichend. Der zweite Plan sah nur die Entsendung von zwei sowjetischen Divisionen nach Afghanistan vor. Die Pläne zur Invasion wurden während einer Inspektionsreise von General Iwan Pawlowskij weiter präzisiert. Der General weilte von August bis Oktober 1979 in Afghanistan, um die für einen militärischen Einmarsch benötigten Informationen zu sammeln. Begleitet wurde er von einem Stab mit 63 hohen Offizieren, darunter elf Generälen. Weitere Aufklärung über die Verhältnisse in der afghanischen Armee und im Staatsapparat erhielt er von den mehr als 3000 sowjetischen Militärberatern, die sich seit 1978 in Afghanistan befanden. Pawlowskij, Oberbefehlshaber der Landstreitkräfte und stellvertretender Verteidigungsminister, hatte bereits 1968 eine gleich geartete Inspektionsreise in die ČSSR unternommen und im August 1968 die Truppen des Warschauer Vertrages zur Niederschlagung des Prager Frühlings befehligt. Jetzt waren Pawlowskijs »Erfahrungen« wieder gefragt, denn in Kabul hatte ein »afghanischer Alexander Dubček« das Regierungsruder in die Hand genommen. Im September 1979 stürzte Vizepremier Hafizullah Amin seinen bisherigen Lehrer Taraki und ließ ihn ermorden. Moskau sah über die Hinrichtung Tarakis hinweg und gratulierte dem Putschisten zu seiner »Wahl«. Die Führungsriege des KGB war sich jedoch über das baldige Ende Amins im Klaren. Ihre Quellen aus Kabul berichteten über eine wachsende islamische Opposition gegen Amin, eine drohende Rebellion innerhalb der Armee und einen unvermeidbaren wirtschaftlichen Zusammenbruch des Landes. Amin, der selbst erkannte, in welcher gefährlichen Lage er sich befand, versuchte, als Vertreter einer nationalistisch eingestellten Fraktion der Kommunisten, die verfahrene Situation im Land zu überwinden. Dabei setzte er sich auch über die bestehenden ideologischen Grenzen hinweg. Vor allem war Amin bestrebt, die muslimische Opposition an der Macht zu beteiligen und so den inneren Konflikt im Land zu beseitigen. Um dieses Ziel zu erreichen, stellte er dem Führer der Oppositionskräfte Gulbuddin Hekmatyar den Posten des Premierministers in Aussicht und versprach die Landreform zurückzunehmen. Amerikanische Geheimdienst-Quellen bezeichneten ihn deshalb als »erbarmungslosen Marxisten aber auch als Opportunisten, der gewillt ist die Seiten zu wechseln, falls der Preis hoch genug ist«. So verwundert es nicht, dass Amin bereits im Februar 1979 gegenüber dem US-Botschafter in Kabul, Adolph Dubbs, antisowjetische Gefühle signalisierte und die Loslösung Afghanistans von der UdSSR in Aussicht stellte. Vor allem der nach der Machtergreifung Amins nach Moskau geflohene radikale Kommunist Babrak Karmal drängte deshalb auf seine Beseitigung. Als Amin die sowjetischen Militärberater ausweisen wollte, war für Moskau das Fass zum Überlaufen gebracht. Zunächst jedoch erörterte das Politbüro die Möglichkeiten einer Beseitigung Amins ohne militärische Inter- vention. Es beauftragte den KGB mit der Ermordung Amins, um ein massives militärisches Eingreifen der UdSSR zu verhindern. Für derartige Spezialaufgaben war innerhalb des sowjetischen Geheimdienstes die 8. Abteilung der Verwaltung C der Auslandsaufklärung zuständig. Sie schlug Amins Vergiftung vor. Doch dem Unternehmen war kein Erfolg beschieden, denn Amin erwies sich als nicht weniger vorsichtig als die italienischen Borgia. Aus Furcht davor vergiftet zu werden, wechselte er beständig Speisen und Getränke, so dass der geplante Mordanschlag aufgegeben werden musste. Zur gleichen Zeit begann Amin mit seinen Versuchen zur Aussöhnung mit der Opposition. Die sowjetischen Agentenberichte, die daraufhin aus Kabul in Moskau eintrafen, zeichneten ein immer düstereres Bild der Lage. Alle Denkschriften wiesen darauf hin, dass an Stelle des kommunistischen Regimes eine antisowjetische islamische Republik treten würde, wenn nicht bald eine schnelle Beseitigung Amins erfolge. Der erneute Appell zum militärischen Eingreifen kam von der Internationalen Abteilung der KPdSU. Sie verwies darauf, dass die Sowjetunion eine Abschaffung des Sozialismus im benachbarten Afghanistan nicht hinnehmen könne. KGB und Außenministerium standen hingegen auf Grund der zu erwartenden Verschlechterung des internationalen Klimas einer groß angelegten militärischen Aktion mit Unbehagen gegenüber. Operation »Sturm - 333« Spätestens am 26. November 1979 fällte das Politbüro der KPdSU unter der Regie Breschnews die endgültige Entscheidung, Amin militärisch zu beseitigen und gewaltsam die bestehende politische Lage in Afghanistan zu Gunsten der UdSSR zu ändern. Der Entschluss zur Invasion wurde im engsten Führungskreis getroffen. Daher erfuhren auch die damaligen Kandidaten des Politbüros, Michail Gorbatschow und Eduard Schewardnadse, erst aus Zeitung und Rundfunk vom Einfall in Afghanistan. Das entscheidende Argument zur Durchführung der Aktion war: Die Verhinderung eines Sieges der islamischen Fun- damentalisten über den Sozialismus in Afghanistan. Ganz im Sinne der Breschnew-Doktrin legte die sowjetische Parteiführung fest: »Die Folgen eines solchen Schlages auf unser Prestige wären unvorhersehbar. Die Sowjetunion kann ein solches Risiko nicht eingehen.« Bereits am 29. November erfolgte die Verlegung von Einheiten des 345. Garde-Luftlanderegimentes nach Bagram, einen in der Nähe von Kabul gelegenen Flughafen. Die dorthin verlegten Soldaten sollten ein sowjetisches Bataillon verstärken, das seit Juli 1979 auf dem Militärstützpunkt stationiert war. Am 6. Dezember 1979 befanden sich bereits drei Elitebataillone in Bagram. Zwischen dem 8. und 10. Dezember trafen weitere Kampftruppen in einer Stärke von 600 Mann ein, die zehn Tage später nach Norden zum Salang-PassTunnel in Marsch gesetzt wurden. Dort sollten sie den Schutz der strategisch wichtigen Verbindung zwischen Kabul und Termez übernehmen. Die Straße diente später als eine der zwei Haupteinfallrouten der sowjetischen Invasionstruppen. Ab Mitte Dezember begannen die Sowjets ebenfalls mit der Stationierung von Militäreinheiten auf dem Kabuler Flughafen. Im zentralasiatischen Teil der UdSSR wurden zwei Divisionen auf Kriegsstärke gebracht. Um die notwendigen Kräfte für den beabsichtigten Lufttransport der Truppen aufzubringen, zog die sowjetische Luftwaffenführung im Gebiet um Moskau und in Zentralasien starke Transportfliegerkräfte zusammen. Ebenso begannen die Militärs mit der Verlegung von Kampfgeschwadern aus dem Inneren der UdSSR an die Grenzen der afghanischen Republik. Die als Eliteeinheiten geltende 103. Luftlandedivision aus Witebsk in Weißrussland und die bei Kirowabad in Aserbaidschan stationierte 104. Luftlandedivision wurden in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Am 12. Dezember 1979 machten westliche Beobachter die Stationierung eines sowjetischen Kampfbataillons in Kabul aus. Den Geheimdiensten der USA blieben die Truppenbewegungen der sowjetischen Streitkräfte an der afghanischen Grenzen ebenfalls nicht verborgen. Bereits am 19. Dezember 1979 warnte die Regierung Carter einige Länder des westlichen Bündnis- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2004 19 akg-images / AP Einmarsch in Afghanistan 1979 5 Zwei bewaffnete moslemische Rebellen halten von Dach einen Hauses in Herat Ausschau nach sowjetischen Truppen ses vor einer möglichen sowjetischen Invasion in Afghanistan. Während in Kabul die Anwesenheit eines hohen, jedoch nicht identifizierbaren, sowjetischen Militärs als letztes sicheres Zeichen der bevorstehenden Invasion gedeutet wurde, versuchte der sowjetische Geheimdienst abermals das drohende Eingreifen der Sowjetarmee in die inneren Geschicke Afghanistans zu »verhindern«. Am 17. Dezember 1979 wurde auf Präsidenten Amin ein Anschlag verübt, bei dem dieser am Bein verwundet wurde. Bei dem Attentat, hinter dem das KGB als Drahtzieher stand, wurde der Chef des afghanischen Sicherheitsdienstes schwer verletzt. Damit war der afghanische Präsident zwar der aufmerksamen Augen und Ohren seines obersten Leibwächters weitestgehend beraubt, doch der sowjetische Geheimdienst hatte sein beabsichtigtes Ziel, die Beseitigung Amins, nicht erreichen können. Deshalb nahmen nun die sowjetischen Militärs endgültig das Heft des Handelns in die Hand. Amin selber zog sich nach dem Attentat am 19. Dezember in den Palastkomplex von Darulaman, sechs Meilen südwestlich von Kabul, zurück. Dorthin begleitete ihn seine Leibwache, während acht Panzer und einige gepanzerte Mannschaftstransporter den dürftigen Schutz des Areals übernahmen. Zu spät erkannte Amin, in welche aussichtslose Lage er sich manövriert hatte. Das abgelegene Gelände von Darula- 20 man bot einem eventuellen sowjetischen Kommandounternehmen beste Operationsmöglichkeiten. Deshalb beorderte er am 26. Dezember 1979 die 4. afghanische Panzerbrigade zu seinem Schutz nach Darulaman. Da jedoch Vorauskommandos der Sowjets zu diesem Zeitpunkt schon in Kabul gelandet waren und alle Ausfallstraßen der Stadt blockierten, hatten die regierungstreuen Truppen keine Chance mehr, zu Gunsten des amtierenden afghanischen Präsidenten einzugreifen. Die sowjetische Armee schloss bis zum 23. Dezember alle logistischen Vorbereitungen zur Durchführung des Unternehmens »Sturm - 333«, so der Codename, für die Besetzung Afghanistans, ab. Am 25. Dezember um 23.00 Uhr landeten die ersten Einheiten der 103. Luftlandedivision auf dem Kabuler Flughafen. Nur wenig später besetzten Kommandos die Flughäfen von Shindand und Kandahar. Auch auf dem Luftwaffenstützpunkt Bagram trafen laufend weitere Verstärkungen ein. Die Luftbrücke aus der UdSSR lief zwei Tage lang rund um die Uhr. Bis zum Morgen des 27. Dezembers waren allein in Kabul über 7000 Soldaten samt Ausrüstung gelandet. Die nach Afghanistan verbrachten sowjetischen Einheiten waren von der Militärführung zunächst in dem Glauben gelassen worden, bei der gesamten Aktion handle es sich um eine Übung. Gleichzeitig versuchten die Militärberater der UdSSR die afghanischen Armee-Einheiten davon zu überzeugen, dass lediglich ein größeres sowjetisches Manöver stattfinde. Hieraus lässt sich deutlich die Handschrift von General Pawlowskij ablesen, der bereits den Prager Frühling erfolgreich bezwungen hatte. Um die Landung der Truppen auf dem Kabuler Flughafen nicht zu gefährden, ordneten die sowjetischen Militärinspektoren der afghanischen Panzertruppen, die rund um die Hauptstadt stationiert waren, den Ausbau der Fahrzeugbatterien an, angeblich um sie winterfest zu machen. Damit war in den Tagen der sowjetischen Invasion die afghanische Panzerwaffe lahmgelegt. Die Armee der Republik hatte nun keine Möglichkeit die Luftlandungen der sowjetischen Truppen zu verhindern, obgleich einige Panzer auf der Landebahn genügt hätten, um das Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2004 sowjetische Unternehmen in ernsthafte Schwierigkeiten zu bringen. Auf einem Empfang der sowjetischen Botschaft machten die Gastgeber die zahlreich geladenen afghanischen Offiziere mit Wodka betrunken und ließen sie anschließend arretieren. Die von ihnen befehligten Einheiten, wurden von sowjetischen Truppen entwaffnet und in ihren Unterkünften interniert. Doch nicht alle Verbände der Armee Afghanistans ließen sich derart einfach überrumpeln. Am 27. Dezember 1979 wurde Kabul um 19.00 Uhr durch eine gewaltige Detonation erschüttert. Sowjetische Spezialeinheiten hatten durch die Sprengung des zentralen Nachrichtenkomplexes der Regierung das gesamte Kabuler Telefonsystem lahmgelegt, um so den organisierten Widerstand durch Präsident Amin erfolgreich zu verhindern. Wenig später, um 19.15 Uhr, kündeten rote Leuchtkugeln von der Einnahme des Innenministeriums, damals Hauptquartier der afghanischen Polizei. Zur selben Stunde, als Nachrichtenzentrale und Innenministerium gestürmt wurden, nahm eine bewaffnete Kolonne vom Kabuler Flughafen aus Kurs auf den Regierungspalast. Sie wurde angeführt von einer KGB-Spezialeinheit, die unter der Befehlsgewalt von Geheimdienst-Oberstleutnant Grigorij Borjanow stand. Die Vorauskommandos der 650 Mann starken Sondereinheit, zu denen auch die 154. Spezialabteilung des Militärnachrichtendienstes GRU – das so genannte muslimische Bataillon – gehörte, trugen afghanische Uniformen und ihre Fahrzeuge waren mit Hoheitszeichen der Demokratischen Republik Afghanistan versehen. Als afghanische Soldaten die Kolonne vor dem Regierungspalast stoppten und kontrollieren wollten, eröffneten die KGB-Einheiten sofort das Feuer. Den anschließenden Sturm auf den Präsidentenpalast leitete Oberstleutnant Borjanow persönlich. In der im 2. Stock des Palastes gelegenen Bar erschossen die Spezialeinheiten Präsident Amin und seine Geliebte. Danach gab Borjanow den Befehl, alle Augenzeugen des Kommandounternehmens zu liquidieren. Selbst immer noch mit seiner afghanischen Uniform bekleidet, endete Borjanow vor den Gewehrläufen sowjetischer Soldaten, die geflissentlich seine Anordnung alle 4 Sowjetische Soldaten entlang des Hauptverbindungsweges zwischen Kabul und Jalalabad Afghanen zu beseitigen, befolgten. Neben Borjanow verloren weitere fünf KGB-Angehörige und sechs Soldaten des Militärgeheimdienstes ihr Leben. Über 300 Angehörige der Leibwache Amins kamen bei den Kämpfen um, 1700 Mann inhaftierten die Sowjets. Zur selben Zeit war der Machtwechsel in Kabul bereits offiziell vollzogen. Noch während der Kämpfe um Amins Regierungssitz begann ein im usbekischen Termez gelegener sowjetischer Sender auf der Frequenz von Radio Kabul zu senden. Auf Grund seiner starken Sendeleistung konnte er das noch normal arbeitende Radio leicht übertreffen und strahlte um 20.45 Uhr eine auf Tonband aufgenommene Erklärung Karmals aus, der zum selben Zeitpunkt von den Sowjets nach Kabul geflogen wurde. Karmal, der im September 1978 vom Posten des Botschafters in Prag durch seine politischen Gegner in Afghanistan abberufen worden war, hatte eine Rückreise in die Heimat abgelehnt. Nach einem kurzen Aufenthalt im tschechischen Marienbad gewährte Moskau seinem neuen Favoriten im afghanischen Spiel politisches Asyl. Im Dezember 1979 war der Zeitpunkt gekommen, wo Karmal mit seinen politischen Widersachern blutig abrechnen konnte. Durch das aus der Sowjetunion ausgestrahlte afghanische Radioprogramm sollte die Bevölkerung des Landes in dem Glauben gelassen werden, der Machtwechsel hätte sich in aller Stille und ohne Gewaltanwendung vollzogen. Die Realität sah jedoch anders aus. Seit 22.30 Uhr tobten in der Innenstadt Kabuls schwere Kämpfe zwischen den sowjetischen Invasoren und Teilen der afghanischen Armee. Besonders heftige Gefechte entwickelten sich um das Gelände des Kabuler Rundfunks. Erst unter beträchtlichen Verlusten gelang den sowjetischen Angreifern der Sturm auf das Gebäude. Dann meldete das jetzt unter sowjetischer Regie geführte Radio Kabul, dass Karmal neuer Staatspräsident sei. Um akg-images / AP 03.15 Uhr verkündete der neue afghanische Rundfunk die Nachricht von der »Hinrichtung« Amins. In Moskau wurde unversehens aus »Genossen Amin« ein »blutdürstiger Agent des amerikanischen Imperialismus«. Karmal forderte die CIA und die amerikanische Regierung auf, Dokumente über die Angelegenheit »Amin« zu übergeben. Selbst innerhalb des KGB begann man der Theorie Glauben zu schenken, Amin sei während seines Studiums an der Kolumbus-Universität in New York von der CIA als Spion angeworben worden und habe seitdem gegen sie Sache des »Sozialismus« gearbeitet. In diesem Licht schien die Ermordung Amins gerechtfertigt, beseitigte Moskau doch »lediglich« einen gefährlichen Konterrevolutionär. Nachdem die Hauptstadt des Landes unter die Kontrolle der sowjetischen Fallschirmjäger gebracht worden war und die Verbindungswege im Land dürftig gesichert schienen, überquerten am Morgen des 28. Dezembers die 5. sowie die 108. mot. Schützendivision auf Pontonbrücken den Grenzfluss Amu-Darja. Die 201. mot. Schützendivision sowie mehrere selbständige Brigaden und Regimenter folgten wenig später nach. Die eingesetzten Truppen waren in aller Eile durch die Mobilmachung von Reservisten auf Kriegsstärke gebracht worden und zum großen Teil mit veraltetem Kriegsgerät ausgerüstet. Für die Invasion Afghanistans hatte die UdSSR keine erstklassige Einheiten aus dem Zentrum Europas abziehen wollen. Deshalb wiesen die an der Invasion beteiligten sowjetischen Verbände einen hohen Anteil von muslimischen Usbeken, Tadschiken und Turkmenen auf – ein Fehler, der später durch den verstärkten Einsatz russischer Einheiten behoben wurde. Die Muslime der asiatischen Sowjetrepubliken hatten sich für die Agitation der afghanischen Widerstandskämpfer überaus empfänglich gezeigt. Am 1. Januar 1980 standen bereits 30 000–40 000 sowjetische Soldaten in Afghanistan, bis zum 20. Januar stieg ihre Zahl auf rund 80 000 Mann. Damit hatte die Sowjetunion das Hauptziel ihrer militärischen Intervention erreicht: Die drohende Beseitigung des kommunistischen Regimes in Afghanistan war erfolgreich verhindert und mit Karmal eine gefügige Marionette Moskaus installiert worden. Nach den Worten von Staats- und Parteichef Breschnew verhinderte der Einmarsch die »reale Gefahr, dass Afghanistan seine Unabhängigkeit verlieren würde und in einen imperialistischen militärischen Brückenkopf an unserer Südgrenze umgewandelt wird«. Gleichzeitig konnte die Ausbreitung der islamischen Revolution auf die muslimischen Teile der UdSSR gestoppt werden. Denn wie 1978 Unruhen in Duschanbe zeigten, fielen die fundamentalistischen Parolen aus dem Iran bei den sowjetischen Muslimen durchaus auf fruchtbaren Boden. Doch auch ideologisch konnte die UdSSR einen zweifelhaften Erfolg verbuchen. Erneut war, entsprechend der Breschnewdoktrin, der Abfall eines kommunistischen Landes verhindert worden. Zudem besaßen die sowjetischen Militärs, die seit dem Zweiten Weltkrieg im Gegensatz zu den amerikanischen und britischen kaum Kampferfahrung hatten gewinnen können, jetzt ein ausreichend großes Experimentierfeld für die Erprobung neuer Kriegstaktiken und Waffen. Dafür sollte die UdSSR allerdings im weiteren Verlauf des Krieges einen hohen Preis zahlen. n Matthias Uhl Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2004 21 Das historische Stichwort ullstein - ullstein bild akg-images Service 5 Kapitän z.S. Karl von Müller 9. November 1914 Der Untergang des Kleinen Kreuzers S.M.S. EMDEN I m Morgengrauen des 9. November 1914 schiebt sich der rammspornbewehrte Bug eines deutschen Kreuzers in die Refuge-Bay der DirectionsInsel. Das Eiland gehört zu den australischen Cocos-Keeling-Inseln, gut 1000 km westlich von Java/Indonesien mitten im Indischen Ozean gelegen. Der Kreuzer ist ein »Geisterschiff«, das seit drei Monaten verzweifelt von britischen, französischen, russischen und japanischen Seestreitkräften kreuz und quer durch Ostasien gejagt wird. Sein Name ist Emden, der Kommandant Kapitän z.S. Karl von Müller. Vor dem Krieg nannte man sie wegen ihres schnittigen Aussehens den »Schwan des Ostens«, doch 13 Wochen auf hoher See ohne Dockmöglichkeit haben Schiff und Menschen auf das Stärkste belastet und verschlissen. An diesem Morgen plant Müller einen neuen Streich gegen das britische Empire: die Zerstörung der hiesigen Überseekabel- und Funktelegrafenstation. So winzig die Insel an sich ist: ihre Anlage ist eine der wichtigsten Kommunikationsschnittstellen des Weltreichs. Um 06.00 Uhr rauscht der Anker in die Tiefe, ein Landungszug von 3 Offizieren, 6 Unteroffizieren und 38 Mann wird ausgesetzt. Doch dann folgt ein fataler Fehler: Um Zeit zu sparen, will die Emden während der Operation Kohlen laden. Sie ruft per Funk den Trossdampfer Buresk an. Prompt meldet sich die britische Station und funkt den Eindringling an. 22 3 »S.M.S. Emden kapert im Golf von Bengalen einen englischen Dampfer«. zeitgenössisches Gemälde von Carl Schön Als keine Antwort erfolgt, schlagen die britischen Telegrafen Alarm. Störversuche der Emden scheitern … Bis zu dieser Stunde hatte die Emden eine nahezu beispiellose Karriere in der modernen Seekriegsgeschichte gemacht. Als Teil des in Ostasien stationierten deutschen Kreuzergeschwaders unter Vizeadmiral Graf Spee wurde sie am 6. August 1914 zum selbstständigen Kreuzerkrieg detachiert (d.h. entsendet), während das Geschwader selbst in der Unendlichkeit der Südsee seinen Weg nach Südamerika nahm, um vor Argentinien und Brasilien den britischen Handel zu schädigen. Spees strategische Lage in Asien war ab dem 23. August 1914 nahezu aussichtslos: Japan, hier die stärkste Seemacht, war auf Seiten der Entente in den Ersten Weltkrieg eingetreten und hatte alle deutschen Hoffnungen auf einen effektiven Handelskrieg zerschlagen. Karl von Müller machte aus der Situation das Beste und erwies sich als geschickter – und glücklicher – Taktiker; mehrmals kreuzten überlegene britische Kriegsschiffe seinen Weg und verpassten ihn nur knapp. Aber in einem Zeitalter ohne Luftaufklärung und Radar war knapp daneben, wie noch im Zeitalter der Segelschifffahrt, auch vorbei: ein Fühlunghalten durch Dritte war kaum möglich. Die Emden brachte insgesamt 23 Dampfer auf, von denen 16 versenkt wurden. Am 22. September 1914 tauchte sie urplötzlich vor der ostindischen Hafenstadt Madras auf und schoss die dortigen Öltanks in Brand. Exakt fünf Wochen später, am 28. Oktober 1914, drang die Emden im Morgengrauen in den Hafen von Penang nord- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2004 östlich von Singapur ein und torpedierte den russischen Kreuzer Schemtschug. Als der französische Torpedobootszerstörer Mousquet der Emden die Ausfahrt verwehren wollte, wurde er zum Wrack geschossen, einige Überlebende seiner Besatzung konnten durch die Emden geborgen werden. Der Überfall auf Penang löste in den Schifffahrtskreisen Asiens erneut Panik aus und verhinderte kurzfristig die Ausfahrt der so genannten imperial convoys von Australien nach Großbritannien, die das Mutterland des Empire mit lebenswichtigem Weizen versorgen sollten. Doch, Ironie der Geschichte: gerade einer dieser Geleitzüge wurde nun an diesem 9. November 1914 der Emden zum Verhängnis. Denn als Müller die Cocos-Inseln ansteuerte, ahnte er nicht, dass nur 50 Seemeilen entfernt ein Konvoi unter Bewachung auf dem Weg in den fernen SuezKanal war. Zufall? Schicksal? Mangelndes Glück? Ja und Nein. Kapitän von Müller wurde ein Opfer der neuen Funktechnologie – und dem Verlangen, eben gerade diese auszuschalten. Die Hilferufe der britischen Station wurden von den »Wachhunden« des Geleitzugs empfangen. Sofort wurde der australische Kreuzer Sydney, der Emden an Geschwindigkeit und Feuerkraft weit überlegen, detachiert. Innerhalb von einer Stunde, zwischen 10.00 und 11.00 Uhr des 9. November 1914, wurde die Emden zum hilflosen Wrack geschossen und auf ein Riff gesetzt. Von der gut 360 Mann starken Besatzung kamen 134 ums Leben, 116 gerieten am nächsten Tag in britische Gefangenschaft. akg-images 5 Kleiner Kreuzer S.M.S. Emden aus dem Fotoalbum v. A. Renard (Kiel) 4 Nach dem Gefecht am 9. November 1914 Vom australischen Kreuzer Sydney zum hilflosen Wrack geschossen und auf ein Riff gesetzt Die Geschichte der Emden könnte hier zu Ende sein. Doch beispiellose Popularität während des Ersten Weltkriegs wie auch danach erlangte sie durch den Landungszug ihrer Mannschaft, die der Gefangenschaft entging. Nach der Zerstörung der Kabelund Funkstation besetzte Kapitänleutnant Hellmuth von Mücke mit seinen Leuten den vor Anker liegenden Schoner Ayesha (sprich: Aischa) und segelte nach Niederländisch-Ostindien (Indonesien). Dort wurde die Ayesha zur Verwischung der Spuren selbst versenkt; die Besatzung wechselte auf den deutschen Dampfer Choising über, auf dem sie den Indischen Ozean durchquerte. Vor Hodeida im heutigen Jemen ausgebootet, schlugen sich die EmdenMänner entlang des Roten Meers durch das südliche Arabien, kämpften gegen Beduinen und erreichten nach unendlichen Mühen schließlich die HedschasBahn. Von hier aus gelangten sie nach Konstantinopel (heute: Istanbul). Bereits Mitte 1915 wurden in Deutschland Filmaufnahmen vom Empfang des Landungskorps in der Hauptstadt des Osmanischen Reiches gezeigt: Ein Vorzeichen der »Vermarktung« des sich rapide entwickelnden Emden- und Ayesha-Mythos. Die Geschichte beider Schiffe wurde durch eine geschickte deutsche Propaganda zur populärsten Darstellung des Ersten Weltkriegs; allein Kapitänleutnant von Mückes Memoiren wurden weit über eine halbe Million mal verlegt und erschienen mehrmals auch in englischer Sprache, zuletzt im Jahr 2000. Bis Ende der 1930er Jahre folgten zahlreiche Illustrationen, Jugend- und Kinder- buchadaptionen. Schon 1914 wurde in Japan ein Kurzspielfilm über das Schicksal der Emden gedreht, 1932 und 1934 produzierte der deutsche Regisseur Louis Ralph zwei Spielfilme; im zweiten traten sogar einige Besatzungsmitglieder auf. Angesichts dieser Popularität verwundert es nicht, dass der Name des Kreuzers innerhalb der deutschen Marinen weiter verliehen wurde. 1916 wurde der Kleine Kreuzer Emden (II) in Dienst gestellt. Er war an mehreren Operationen gegen russische und britische Seestreitkräfte beteiligt. 1925 wurde der neue Schulkreuzer der Reichsmarine auf den Namen Emden getauft, der mehrere große Auslandsreisen unternahm und dessen Mannschaft 1927 am Strandungsort der alten Emden eine Gedenkfeier abhielt. 1932 »spielte« der Kreuzer in dem deutschen U-Bootfilm »Morgenrot« (D 1933, R.: Gustav von Ucicky) einen britischen Panzerkreuzer. Im Januar 1945 transportierte der Kreuzer die aus dem monumentalen Tannenbergdenkmal »evakuierten« Sarkophage des Reichspräsidenten und Generalfeldmarschalls von Hindenburg und seiner Gattin von Königsberg (heute: Kaliningrad) nach Pillau (Baltisk). Bei einem Luftangriff im Kieler Hafen im April 1945 wurde der Kreuzer stark beschädigt und außer Dienst gestellt. 1959 lief in Hamburg das Geleitboot (ab 1965 Fregatte) Emden der Marine der Bundesrepublik Deutschland vom Stapel, das 1983 durch die in Emden gebaute Flugkörper-Fregatte der Klasse 122 ersetzt wurde, die heute noch in Dienst steht. Karl von Müllers streng nach Prisenordnung geführter Krieg und die korrekte und fürsorgliche Behandlung seiner Gefangenen sicherten der Emden auch beim Gegner ihre Popularität. Der britische König Georg V. erlaubte dem Kommandanten auch in der Gefangenschaft das Tragen des Degens. 1921 verlieh die preußische Regierung den (preußischen) Überlebenden der Emden (I) das Recht, an ihren Familiennamen »Emden« anzufügen; 1934 wurde diese Regelung durch Reichspräsident von Hindenburg auf alle Familienmitglieder ausgedehnt. Die «Emden-Familie« existiert noch heute durch die Nachfahren der ursprünglichen Besatzungsmitglieder. Die Emden (I) nahm das Schicksal des gesamten Kreuzergeschwaders voraus: Exakt vier Wochen später, am 8. Dezember 1914, unternahm Graf Spee entgegen den ausdrücklichen Warnungen der Mehrheit der Kommandanten seines Geschwaders einen Angriff auf Port Stanley, den Haupthafen der Falkland-Inseln, um die dortige Funkstation zu zerstören. Bis auf die Dresden sanken alle Schiffe des Geschwaders in der nun folgenden Falklandschlacht. In beiden Fällen war der Wunsch, gegnerische Kommunikationslinien zu zerstören, den Angreifern zum Verhängnis geworden. Das auf dem Riff im Pazifik liegende Wrack der Emden wurde zwar in den 1930er Jahren teilweise abgebrochen, die unter Wasser erhalten gebliebenen Reste stehen jedoch seit den 1980er Jahren unter Denkmalschutz. Gerhard Wiechmann Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2004 23 Medien online/digital ullstein - Archiv Gerstenberg Service Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648 tueller Forschungsbeiträge und -informationen (Artikel, Rezensionen, Sammlungsbeschreibungen, Volltexte); die Bündelung von bestehenden themenrelevanten Internetressourcen; die Publikation von Quellen in elektronischer Form als Beitrag zu einer sich wandelnden Kommunikationskultur in den historischen Wissenschaften.« Namhafte Partner des Webprojektes sind die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, die Bibliothek für Zeitgeschichte Stuttgart, die Humboldt-Universität zu Berlin und das Internetportal H-Soz-u-Kult – Kommunikation und Fachinformation für die Geschichtswissenschaften –, die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, die Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz und das Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam e.V. online »D aran erkenn´ ich meine Pappenheimer!«, ließ der Dichter Friedrich Schiller in seinem Drama »Wallensteins Tod« den berühmten Generalissimus sagen. Was der Inhaber des Regiments für ein Pappenheimer war, liest sich unter der Adresse http://www.koni.onlinehome.de ullstein - Archiv Gerstenberg 5 Gottfried Heinrich Graf zu Pappenheim 4 Albrecht Wallenstein so: »Gottfried Heinrich ... Pappenheim besaß niemals Wirklichkeitssinn. Für einen Oberbefehl fehlte ihm die nötige Geduld und die Gabe, die Gesamtsituation objektiv zu erfassen. Andererseits hatte er auch nicht das Zeug für eine untergeordnete Stellung. Er war rücksichtslos gegen die Mannschaft, anmaßend und arrogant; – aber er war auch der Abgott seiner Soldaten: der erste beim Angriff und der letzte beim Rückzug. Um seinen unglaublichen Mut rankten sich Legenden. Seine hundert Narben, deren er sich rühmte und das Muttermal, das zwei gekreuzten Schwertern glich, bestätigten die Soldaten in ihrer Meinung.« Einer vom Regiment Pappenheimer zu sein, stand damals für unbedingten Mut, Treue und Tapferkeit. Heute ist die Bezeichnung »Pappenheimer« eher mit der augenzwinkernden Einsicht in menschliche Unzulänglichkeiten verbunden. Die private Homepage »Wer war wer im Dreißigjährigen Krieg« von Klaus Koniarek enthält nicht nur 199 teilweise sehr ausführliche Biografien von Persönlichkeiten des 17. Jahrhunderts, sondern bietet neben einem Überblick über den Verlauf des Krieges 24 auch Detailinformationen zu Geld- und Warenwirtschaft, Sittengeschichte und zu den damals kämpfenden Armeen. Eine Rubrik nimmt fünfzehn selbst erstellte bzw. verlinkte fremde Stadtchroniken auf, wie die von Magdeburg und Ingolstadt. Die Kartenrubrik und das Literaturverzeichnis sind nicht so üppig ausgefallen, was der Freude an der Homepage jedoch keinen Abbruch tut. hb dig Themenportal Erster Weltkrieg 1914 –1918 D as historische Fachportal für Geschichtswissenschaft im deutschsprachigen Raum clioonline.de hat anlässlich des 90. Jahrestages des Beginns des Ersten Weltkrieges (1914–1918) ein spezielles Themenportal eingerichtet. Unter www. erster-weltkrieg.clio-online.de bieten die Betreuer Anke Winsmann, Vera Ziegeldorf und Thomas Meyer folgende vier Bereiche an: »Bündelung vorhandener Informationsangebote durch den Aufbau einer spezifischen Metasuchmaschine; die Veröffentlichung ak- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2004 Unter dem Oberbegriff »Themen« werden Artikel, Bücher im Volltext, Literaturberichte und Rezensionen zugänglich gemacht. Hier findet auch der nur allgemein Interessierte gute Aufsätze und Anregungen zur weiteren Lektüre. Die angebotenen Links zu »Spezialsammlungen« und »Literatur« sind dagegen vor allem für den interessierten Historiker von Bedeutung. Unter »Chronologie« wird, angelehnt an die Enzyklopädie Erster Weltkrieg (siehe Militärgeschichte 1/2004), ein detaillierter zeitlicher Verlauf des Ersten Weltkrieges wiedergegeben. Das ebenfalls empfehlenswerte »Web-Verzeichnis« bietet sortiert nach Forschungseinrichtungen, Institutionen, Nachschlagewerken, Portalen und Katalogen, Materialien- und Quellen eine sehr umfangreiche Sammlung von Links für den historischen Forscher, aber auch für den interessierten Internet-Surfer. Wer bislang Ton- und Bilddokumente vermisst hat, wird dabei auf sonst nur schwer zu findende Seiten stoßen. hb Die französische Fremdenlegion M it den nahenden Gedenktagen zum Ende des Zweiten Weltkrieges vor 60 Jahren und angesichts der damals beginnenden Nachkriegszeit rückt auch die Geschichte der französischen Fremdenlegion näher in unser historisches Bewusstsein. Haben doch ehemalige Soldaten von Wehrmacht und Waffen-SS und noch ungediente junge Deutsche über die Werbebüros der französischen Besatzungsmacht in Deutschland den Weg in die Ausbildungslager der Legion angetreten. Sie fanden aus unterschiedlichsten Gründen den Weg in die Fremdenlegion; gelandet sind sie dann als Söldner in den Brennpunkten der Konflikte der Nachkriegswelt: Indochina und Afrika. Der Berufssoldat der Bundeswehr Jürgen Joachim hat aus seiner Dienstzeit in Frankreich das Interesse für diese wohl berühmteste Söldnerarmee mitgebracht. Unter der Adresse www. sidi-bel-abbes.de präsentiert er seine technisch interessant gestaltete und inhaltsreiche private Homepage über historische und aktuelle Strukturen der Fremdenlegion. Unter der Überschrift »Die Fremdenlegion in der Vergangenheit« ist die Darstellung der Schlacht von Dien-Bien-Phu mit einer bebilderten Chronologie besonders hervorzuheben. Gut gelungen ist auch die Zusammenstellung von Wappen unterschiedlicher Regimenter und Kompanien mit begleitenden strukturhistorischen Angaben. Daneben findet man eine detaillierte Auflistung von Schlachten des 19. und 20. Jahrhunderts, an denen die Fremdenlegion beteiligt war. Die »Literaturecke« bietet eine umfangreiche kommentierte Übersicht zu Legionsliteratur unterschiedlichster Art. hb Marinegeschichte des Zweiten Weltkrieges eine sehr umfangreiche Darstellung der Marinegeschichte des Zweiten Weltkrieges, die den Schwerpunkt auf technische Details legt. Kritische Fragen zur Marine im Dritten Reich werden dabei nicht beleuchtet. Wer das erwartet, ist hier nicht gut beraten. Es geht vor allem um »Ingenieurleistungen«. In den Unterkapiteln U-Boote, U-Bunker, Geheimprojekte, Waffen- und Waffensysteme, Deutsche Kriegsschiffe, Operationen, Einheiten und Dienststellen, Mannschaften und Seealltag werden in unterschiedlicher Aufmachung viele technische Details, interessante Fotos und Risszeichnungen geboten. Einige Informationen betreffen auch schon das deutsche Kaiserreich und den Ersten Weltkrieg (z.B. die Seeschlacht vor dem Skagerrak 1916). Auch skurrile Anekdoten fehlen nicht, wie die von der 1941 aus dem Wasser gefischten schwarzen Bordkatze Oskar, die als »The Bismarck´s Cat« in die britische Marinegeschichte eingegangen ist. Die Buchempfehlungen unter Literatur sind dagegen noch ausbaufähig. hb W as aus der Begeisterung für ein Computerspiel alles werden kann, zeigt die Internetseite einer Gruppe von Silent Hunter2-Spielern. Unter der etwas zu viel versprechenden Adresse www. deutsche-marinegeschichte.de findet man gital Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2004 25 Service Lesetipp Bombenkrieg D as Thema Bombenkrieg hat Konjunktur. Im zeitlichen Abstand von sechzig Jahren wird es zunehmend möglich auch die Bombardierung der deutschen Städte zu untersuchen. Die Historiker nennen das Historisierung: Die unmittelbare Betroffenheit vom Zweiten Weltkrieg ist im öffentlichen Bewusstsein soweit gesunken, dass nun auch die »Opfer« in einem »Volk der Täter« thematisiert werden können – ohne, dass die Autoren sofort in die Rolle von Revisionisten gedrängt werden. Angestoßen durch Jörg Friedrichs »Der Brand« (siehe Militärgeschichte 1/2003) und aufgrund der sich allerorts jährenden Gedenktage der Bombenangriffe des Zweiten Weltkrieges sind inzwischen viele Publikationen zu diesem Thema auf dem Markt: Stephan Burgdorf und Christian Habbe (Hrsg.), Als Feuer vom Himmel fiel. Der Bombenkrieg in Deutschland, München 2003. ISBN 3-421-05755-9; 253 S., 24,90 € Für den Spiegel-Buchverlag haben Stephan Burgdorff und Christian Habbe »Als Feuer vom Himmel fiel. Der Bombenkrieg in Deutschland« herausgegeben. Unter den insgesamt sieben Kapiteln »Der Luftkrieg über Europa«, »Hitlers Bombenterror«, Deutschland im Feuersturm«, »Kriegsrecht und Moral«, »Die Schlacht am Himmel«, »Leben in Trümmern« und »Die Folgen der Zerstörung« finden sich jeweils bis zu sechs Aufsätze. Diese kurzen Aufsätze (fünf bis zehn Seiten) von Historikern und Zeitzeugen bieten in ihrer Kürze Einblicke in viele Bereiche rund um den Bombenkrieg. Das Buch gibt weni- 26 ger Antworten als Denkanstöße, beschreibt das Phänomen Bombenkrieg aber in zahlreichen Facetten. Ein beeindruckendes, aber dennoch ausgewogenes Buch. Der großformatige Bildband »Brandstätten. Der Anblick des Bombenkriegs« bewegt sich durch die teilweise sehr eindrucksvollen Schwarzweißbilder auf einer ganz anderen Ebene: der durch Eindrücke gespeisten Gefühlswelt. Nachdem im Kapitel »Früher« die später im Bombenkrieg zerstörte »heile Welt« gezeigt wird, schocken in den Jörg Friedrich, Brandstätten. Der Anblick des Bombenkriegs, München 2003. ISBN 3-549-07200-7; 240 S., 25,00 € Kapiteln »Angriff«, »Bergung«, »Trümmerleben« die Bilder von Trümmern, Toten und verzweifelten Helfern. Hier wird Krieg sehr konkret. Ob das Gezeigte zu weit geht, also moralische Grenzen überschritten werden, ist eine Frage des Geschmacks und des Standpunktes. Durch dieses Buch soll »die große Katastrophe unserer Zeitgeschichte in die deutsche Wirklichkeit zurückgeholt« werden. Diesem Anspruch wird das Buch gerecht. Begreift man es als Erinnerungsbuch, so hat dieses Buch eine wichtige Funktion. Doch wäre es schade, wenn durch eine Emotionalisierung des Themas der einsetzende Prozess der Historisierung verkehrt würde. aak Spionage W er sich für die Welt der Geheimdienste interessiert, kommt an diesem Lexikon nicht vorbei. Das einmalige Nachschlagewerk enthält nicht nur rund 2000 Sachstichworte mit Geheimdienstbezug, sondern auch über 2000 Kurzporträts bekannter und weniger bekannter Agenten. Dem Leser erschließt sich damit in kompakter und sachlicher Form viel Wissenswertes über die verborgene Arbeit der Geheimdienste vom Ersten Welt- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2004 Helmut Roewer, Stefan Schäfer und Matthias Uhl, Lexikon der Geheimdienste im 20. Jahrhundert, München 2003. ISBN 3-7766-2317-9; 527 S., 39,90 € krieg bis in die Gegenwart. Schwerpunkte bilden insbesondere die deutschen Dienste, darunter die Abteilung III b des Generalstabes der preußischen Armee, der Sicherheitsdienst des Reichsführers SS, das Amt Ausland/ Abwehr der Wehrmacht, die bundesdeutschen Dienste und natürlich das Ministerium für Staatssicherheit der ehemaligen DDR. Da die Autoren angesichts der Internationalität des Geheimdienstgeschäfts jedoch keineswegs nur deutschlandzentriert recherchiert haben, finden sich im Buch auch bisher oft nur schwer zugängliche Informationen über die Dienste zahlreicher anderer Staaten, u.a. der USA, Großbritanniens, Frankreichs, Italiens, Polens, Russlands bzw. der Sowjetunion, Spaniens oder der Tschechischen Republik. Der lexikalische Inhalt des Werkes erfährt mit 1465 Abbildungen und Organigrammen eine zusätzliche Bereicherung. Hunderte Literaturund Quellenhinweise geben darüber hinaus dem wissenschaftlichen Nutzer Anregungen für weitere Forschungen. Rüdiger Wenzke 20. Juli 1944 P eter Steinbach ist einer der bekannteren deutschen Autoren zur Geschichte des Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Aus Anlass des 60. Jahrestages von Attentat und Staatsstreichversuch hat er einige bereits früher erschienene Aufsätze in einem ansprechend gestalteten Band zusammengefasst und neu veröffentlicht. Steinbach stellt konsequent die Vorstellung heraus, die Militärs im Widerstand hätten sich von Anfang an dem Primat der Politik gebeugt. Nicht ein Peter Steinbach, Der 20. Juli 1944. Gesichter des Widerstands, München 2004. ISBN 3-88680-155-1; 352 S., 24,– € Militärputsch, sondern die Wiedererrichtung des Rechtsstaats sei beabsichtigt gewesen – ein Gegensatz, der vielleicht nicht zwingend ist. Nach einer Einführung (die 1984 erstmals erschien) stellt Steinbach mehrere Protagonisten des Widerstands in neun biografischen Skizzen vor. Vielleicht ist es seiner Grundthese geschuldet, dass darunter kein einziger Berufssoldat ist. Der Band schließt mit einer Schilderung der nationalsozialistischen Verfolgung des Widerstands und einem einordnenden Schlusskapitel. Es geht in diesem Buch nicht um neue Erkenntnisse oder Forschungsergebnisse, sondern um eine »auf die Verfassungsinhalte bezogene, wertgeprägte und zielorientierte Widerstandsdiskussion«. Wer weniger historische Fakten und kritische Analyse, und stattdessen eine Einordnung des Widerstands als Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland sucht, dem sei dieser Band empfohlen. Winfried Heinemann Öffnungszeiten, Ansprechpartner und ein Internetlink aufgeführt. Dass dies nicht ein bloßer »Reiseführer des Grauens« ist, verhindert eine umfangreiche Ergänzung mit Texten zu pädagogischen Erfahrungen und Empfehlungen. Sehr hilfreich ist auch der Teil zu Organisation und Finanzierung der Gedenkstättenfahrten. Hier haben die Bearbeiter wertvolle Hinweise zu Institutionen der politischen Bildung und der Jugendarbeit zusammengetragen. Schließlich werden einige Projekte aus der Praxis detaillierter beschrieben sowie Literaturhinweise und Internettipps aufgeführt. Alles in allem ein Handbuch, das auch über die Grenzen Nordrhein-Westfalens hinaus nutzbringend in der Planung von Gedenkstättenbesuchen eingesetzt werden kann. Klaus Ahlheim u.a (Bearb.), Gedenkstättenfahrten: Handreichung für Schule, Jugend- und Erwachsenenbildung in Nordrhein-Westfalen, Schwalbach/Taunus 2004. ISBN 3-89974-111-0; 154 S., 12.80 € Historische Bildung unterwegs Genozid in Afrika L Z ernen am Ort des historischen Geschehens ist eine wichtige Ergänzung der politischen und historischen Bildung in den Streitkräften. Mit dem neuen Führer werden nicht nur Hinweise zu Gedenkstätten im Bundesland Nordrhein-Westfalen gegeben. Über das bevölkerungsreichste Bundesland hinaus werden Gedenk- und Lernorte der Geschichte des »Dritten Reiches« in Deutschland, Polen und Tschechien beschrieben. Auf ein bis zwei Seiten werden jeweils eine Gedenkstätte, deren pädagogisches Angebot, hb eitgeschichte entzieht sich oft der genauen Betrachtung durch die auf den ersten Blick positive Tatsache, dass man ja selbst irgendwie dabei war und noch Zeitzeugen befragen kann. Wir stehen aber im »Dunkel des gelebten Augenblicks« (Ernst Bloch), wenn es darum geht, Ursachen, Handlungsstränge und Folgen einer aktuellen Entwicklung zu beschreiben. Das preisgekrönte Buch des französischen Journalisten Jean Hatzfeld enthält Eindrücke und Zeitzeugenberichte von einem Völkermord in Ruanda, der 1994 fast Jean Hatzfeld, Nur das nackte Leben. Berichte aus den Sümpfen Ruandas, Gießen 2004. ISBN 3-89806-933-8; 251 S., 19,90 € unbemerkt von der übrigen Welt stattfand. Ein Glossar, eine Chronologie und eine Abhandlung über Genozid und kollektives Trauma helfen bei der Einordnung des grausamen Inhalts. In etwa zehn Wochen wurden mehrere hunderttausend Tutsi von ihren Nachbarn und Mitbürgern vom Stamm der Hutu ermordet. Genauere Opferzahlen sind immer noch nicht verfügbar. Treffender als Zahlen beschreiben die Aussagen der Überlebenden das Grauen. Dabei gibt Hatzfeld seinen Kapiteln harmlose Namen und schildert jeweils zu Beginn friedliche Szenen oder gibt landeskundliche Hinweise, bevor er den Zeugen selbst die Beschreibung ihrer Erlebnisse überlässt. Da werden der heutige Kaufladen in der Hauptstraße von Nyamata und seine Besitzerin Marie-Louise in den wärmsten Farben beschrieben und im nächsten Moment hat Marie-Louise selbst das Wort und erzählt, wie ihr Mann erschossen, ihre Schwiegermutter »zerfleischt« und ihr Hab und Gut geplündert wurde. Sie selbst wurde von ihrem Hutu-Nachbarn gerettet, der aber auch ihr Geld und zwei Häuser als Gegenleistung erhielt. Der Leser fragt sich, was er im April 1994 eigentlich selbst gemacht hat, wenn Marie-Louise feststellt: »Ich glaube auch, dass die Ausländer vor lauter Mitleid gar nicht wieder zu sich kämen, wenn sie all das aus der Ferne sehen würden, was wir während des Völkermordes erlitten haben. Deswegen betrachten sie es auch lieber aus der Ferne.« hb Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2004 27 Service •Berlin Der Bodensee-Wasserflug 1913 und Coverstory – Kunst und Verpackung Ausstellungen S-Bahn: Stationen »Hackescher Markt« und »Friedrichstraße«; U-Bahn: Stationen »Französische Straße«, »Hausvogteiplatz« und »Friedrichstraße«; Bus: Linien 100, 157, 200 und 348, Haltestellen: »Staatsoper« oder »Lustgarten« Mythen der Nationen. 1945 – Arena der Erinnerungen Luftwaffenmuseum der Bundeswehr Groß-Glienicker Weg 14089 Berlin-Gatow Telefon: (0 30) 8 11 07 69 Telefax: (0 30) 36 43 11 98 e-mail: [email protected] www.luftwaffenmuseum.de Dienstag bis Sonntag 9.00 bis 17.00 Uhr (letzter Einlass 16.00 Uhr) 25. Juni 2004 bis 9. Januar 2005 Namibia – Deutschland: eine geteilte Geschichte. »Widerstand – Gewalt – Erinnerung« Deutsches Historisches Museum Ausstellungshalle von I.M. Pei Hinter dem Gießhaus 3 10117 Berlin Telefon: (0 30) 20 30 40 Telefax: (0 30) 20 30 45 43 www.dhm.de täglich 10.00 bis 18.00 Uhr 25. November 2004 bis 13. März 2005 Verkehrsanbindungen: ð 28 Deutsches Historisches Museum Ausstellungshalle von I.M. Pei Hinter dem Gießhaus 3 10117 Berlin Telefon: (0 30) 20 30 40 Telefax: (0 30) 20 30 45 43 www.dhm.de täglich 10.00 bis 18.00 Uhr 2. Oktober 2004 bis 27. Februar 2005 Verkehrsanbindungen: S-Bahn: Stationen »Hackescher Markt« und »Friedrichstraße«; U-Bahn: Stationen »Französische Straße«, »Hausvogteiplatz« und »Friedrichstraße«; Bus: Linien 100, 157, 200 und 348, Haltestellen: »Staatsoper« oder »Lustgarten« •Delitzsch Wege zur Freundschaft. Ausgewählte Zeugnisse der deutsch-amerikanischen Beziehungen 1507 bis 1995 Heeresunteroffizierschule I Feldwebel-Boldt-Kaserne Fw-Boldt-Str. 1 04509 Delitzsch Telefon: (0 34 20) 27 70 Täglich geöffnet, Besuch von Nichtangehörigen der Bundeswehr nach Absprache möglich 14. September bis 1. Dezember 2004 Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2004 •Dresden Zwischen Arsenal und Moderne. »Hinterlassenschaften aus fünf Jahrhunderten« und »Deutsche Militärgeschichte 1945 bis 1970« Militärhistorisches Museum, Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden Telefon: (03 51) 82 30, Telefax: (03 51) 8 23 28 05 e-mail: [email protected] www.MilHistMuseum.de Dienstag bis Sonntag 09.00 bis 17.00 Uhr Dauerausstellung Verkehrsanbindungen: Parkplatz am Museum; öffentliche Verkehrsmittel: Linien 7, 8, 91 bis Haltestelle »Militärhistorisches Museum« •Hamm Pharao siegt immer – Krieg und Frieden im Alten Ägypten Gustav-Lübcke-Museum Neue Bahnhofstraße 9 59065 Hamm Telefon: (0 23 81) 17 57 14 Telefax: (0 23 81) 17 29 89 email: [email protected] www.hamm.de/gustav-luebcke-museum/ Dienstag bis Sonntag 10.00 bis 18.00 Uhr Eintritt: 7,00 €, ermäßigt: 5,00 € 21. März bis 31. Oktober 2004 Verkehrsanbindungen: Das Museum liegt in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs •Hildesheim mit Buslinien 21, 61, 62 bis »Lutherkirche« Aufstand des Gewissens. Militärischer Widerstand gegen das NS-Regime 1933 – 1945 •Osterholz Scharmbeck Deutsche Jüdische Soldaten Nachschubschule des Heeres Rathaus Hildesheim Markt 1 31154 Hildesheim Telefon: (05 11) 32 73 63 Telefax: (05 11) 3 63 28 45 e-mail: [email protected] Montag bis Freitag 8.00 bis 18.00 Uhr 3. bis 15. Dezember 2004 •Ingolstadt 125 Jahre Bayerisches Armeemuseum – Zeugnisse deutscher Geschichte Neues Schloss und Reduit Tilly Paradestraße 4 85049 Ingolstadt Telefon: (08 41) 9 37 70 Telefax: (08 41) 9 37 72 00 e-mail: [email protected] www.bayerischesarmeemuseum.de Dienstag bis Sonntag 8.45 bis 16.30 Uhr 15. Juni 2004 bis 28. März 2005 ð Walther Rathenau Verkehrsanbindungen: Nächstgelegene Bushaltestellen: »Roßmühlstraße/ Paradeplatz« oder »Rathausplatz« • Koblenz Verkehrsanbindungen: mit der Deutschen Bahn bis Bahnhof »Ehrenbreitstein Bf, Koblenz«, auf die Festung gelangt man von dort mit einem Sessellift (Fahrzeiten: täglich 9.00 bis 17.50 Uhr) Der Traum vom Fliegen •Osnabrück Landesmuseum Koblenz Festung Ehrenbreitstein 56077 Koblenz Telefon: (02 61) 9 70 30 Telefax: (02 61) 70 19 89 e-mail: [email protected] www.landesmuseumkoblenz.de täglich 9.00 bis 17.00 Uhr Eintritt: 2,00 €, ermäßigt: 1,50 € 1. Juli bis 14. November 2004 ð Aufstand des Gewissens. Militärischer Widerstand gegen das NS-Regime 1933 – 1945 Graf Stauffenberg Gymnasium Osnabrück Gottlieb Planck Straße 1 49080 Osnabrück Telefon: (05 41) 3 80 31 Telefax: (05 41) 3 80 31 39 Montag bis Freitag 8.00 bis 16.00 Uhr 1. bis 26. November 2004 Verkehrsanbindungen: Vom Hauptbahnhof mit der Buslinie 51 bis Haltestelle »Magdalenenstraße«, mit Buslinie 71 bis »Welhornstraße«, ð Lucius D. Clay Kaserne 27711 Osterholz Scharmbeck (b. Bremen) Telefon: (0 47 95) 94 20 26 13. Oktober bis 17. November 2004 •Rastatt Gegen Diktatur – demokratischer Widerstand in Deutschland 1933 – 1945 / 1945 – 1989 Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegungen in der deutschen Geschichte Schloß Rastatt Herrenstraße 18 76437 Rastatt Telefon: (0 72 22) 77 13 90 Telefax: (0 72 22) 77 13 97 e-mail: [email protected] www.erinnerungsstaetterastatt.de Dienstag bis Sonntag 9.30 bis 17.00 Uhr Eintritt frei 30. September 2004 bis 9. Januar 2005 Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2004 29 17. November 1994 Geschichte kompakt Spion »Topas« verurteilt Am 17. November 1994 verurteilte das Düsseldorfer Oberlandesgericht den ehemaligen DDR-Spion Rainer Rupp (Deckname »Mosel«, ab 1979»Topas«) zu 12 Jahren Haft wegen schweren Landesverrates. Rainer Rupp, aufgewachsen in der Nähe von Trier, war schon 1968 als Student der Volkswirtschaft von der DDR-Staatssicherheit (Stasi) in Mainz angeworben und als »Kundschafter« der Hauptverwaltung A (HV A) mit langfristiger Perspektive aufgebaut worden. 1974 bekam er eine Stelle in der Politischen Abteilung des NATO-Wirtschaftsdirektorates und 1977 nahm er seine Agententätigkeit auf. Bis 1989 übermittelte Rupp aus dem NATO-Hauptquartier Brüssel rund 10 000 zum Teil hochbrisante Dokumente nach OstBerlin. 1993 wurde »Topas« mit seiner Ehefrau Christine-Ann (»Türkis«), die im NATOSicherheitsbüro als sein »Schutzwall« tätig war, verhaftet. Wohl auch weil das Paar drei Kinder hatte, wurde Christine-Ann Rupp nur zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. 1998 appellierten 40 Prominente an Bundespräsident Roman Herzog, Rainer Rupp zu begnadigen. Ende des Jahres wurde Rupp in den offenen Vollzug verlegt und 2000 vorzeitig aus der Haft entlassen. Rainer Rupp ist neben dem Kanzleramtsspion Günter Guillaume der bekannteste DDRAgent. Quellen sprechen von insgesamt ungefähr 300 Verurteilungen wegen DDR-Spionage und 800 Verfahrenseinstellungen gegen Zahlung von Bußgeldern bis 200 000 DM. hb 16. Dezember 1944 Heft 4/2004 Service Militärgeschichte Zeitschrift für historische Bildung Ü Vorschau Der äußerste Norden Europas lag im 20. Jahrhundert im Interessengebiet Deutschlands. Der nördliche Ostseeraum war gerade in militärischer Hinsicht für das Deutsche Reich von Bedeutung. Als Folge des Zusammenbruchs des Zarenreiches gegen Ende des Ersten Weltkrieges veränderte sich die Landkarte gewaltig. So entstand im Norden im Jahr 1917 ein neuer selbständiger Staat: Finnland. Eine wesentliche Rolle spielte hierbei das Deutsche Kaiserreich: Beginn der Ardennenoffensive »Soldaten der Westfront! Eure große Stunde hat geschlagen! Starke Angriffsarmeen sind heute gegen den AngloAmerikaner angetreten. Mehr brauche ich Euch nicht zu sagen. Ihr fühlt es alle: Es geht ums Ganze! Tragt in Euch die heilige Verpflichtung, alles zu geben und Übermenschliches zu leisten für 5 unser Vaterland und unseren Führer! US-Soldaten der 7th Armoured Division im heftig Der Oberbefehlshaber West, gez. Gerd umkämpften St. Vith, Jahreswende 1944/45 von Rundstedt, Generalfeldmarschall«. Dieser Tagesbefehl spricht nicht von ungefähr von übermenschlichen Leistungen, denn was Rundstedt hier forderte, war selbst seiner Ansicht nach unrealistisch. Die Offensivplanungen stellten eine magere Variante des »Sichelschnitt-Planes« von 1940 dar: Die gemeinsame Front der Briten und US-Amerikaner sollte durchbrochen, dadurch die nach Hitlers Meinung schon brüchige Koalition der Gegner aufgelöst und in Folge dessen den deutschen Truppen der freie Rücken für den »Endsieg« im Osten verschafft werden. Rundstedt und der mit der Offensive beauftragte Generalfeldmarschall Walter Model wussten, dass Hitlers Idee der »großen Lösung« eines Angriffs von Monschau–Trier durch die Ardennen über Namur–Liege bis nach Antwerpen in sieben Tagen illusorisch war, planten aber trotzdem die Operation mit über 200 000 Mann. Hitler hatte Model am Vorabend der Offensive zwei Seiten Anweisungen geschickt, die mit der Bemerkung schlossen: »Wenn diese Grundsätze für die Führung der Operation befolgt werden, ist ein großer Erfolg sicher.« Nach Anfangserfolgen wurde aber schnell deutlich, dass nicht einmal die Zwischenziele an der Maas erreicht werden konnten. Logistische Fehlplanungen gingen sogar von der Eroberung der alliierten Treibstoffbestände für das Erreichen des Angriffszieles aus. Solche Eroberungen gelangen jedoch nicht. Vielmehr kam es unterwegs allein wegen des Betriebsstoffmangels fast zum totalen Verlust der Panzerwaffe. Da die Luftüberlegenheit längst bei den Alliierten lag, wurde bereits in der Planung das schlechte Wetter zur Bedingung des deutschen Vormarsches. Weihnachten 1944 klarte es jedoch auf und die alliierten Bomben- und Tieffliegerangriffe setzten wieder ein. Ende Dezember war das Scheitern der Offensive unübersehbar. Am 2. Februar 1945 standen die deutschen Truppen wieder in ihren alten Stellungen; die operative Reserven waren vernichtet, 77 000 alliierte und 90 000 deutsche Soldaten waren gefallen. Nach dieser letzten großen Offensive wurde das Deutsche Reich weiter in seinen selbstverschuldeten Untergang gerissen. hb ullstein - LEONE 30 Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2004 5 Finnische Freiwillige der 2. Kompanie des Königlich Preußischen Jägerbataillons Nr. 27 Foto: Bertil Olofsson/Krigsarkivet, Stockholm Auf abenteuerlichen Wegen trafen ab 1915 junge Männer, meist Studenten in Deutschland ein, um durch preußischen Drill auf eine spätere Rolle als Freiheitskämpfer gegen Russland vorbereitet zu werden. Die jungen Finnen formten ein eigenes Bataillon, das Königlich Preußische Jägerbataillon Nr. 27, das unter anderem an der nördlichsten Stelle der deutschen Ostfront im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurde. Was führte diese jungen Männer freiwillig auf einen preußischen Truppenübungsplatz? Schließlich waren preußische Kasernenhöfe nicht gerade als Hort der Freiheit bekannt! Was versprach sich die deutsche militärische Führung davon, Untertanen des russischen Zaren gegen eben diesen einzusetzen? Was waren die strategischen Ziele im Ostseeraum? Was forderte der Kaiser, was plante die Marine und was tat die Heeresleitung? In der nächsten Ausgabe der Militärgeschichte werden die deutschen militärischen Beziehungen zum hohen Norden Europas thematisiert, die sich im selben Jahrhundert in unterschiedlichen Zeiten höchst unterschiedlich gestalteten. aak Militärgeschichte im Bild Eine Stunde Null? Deutsche Soldaten als Hilfstruppen der westlichen Besatzungsmächte 1945–1958 A ls am 8. Mai 1945 die Wehrmacht kapitulierte und der Krieg in Europa endete, bedeutete dies keineswegs das Ende ihrer Existenz: offiziell wurde sie erst am 20. August 1946 aufgelöst und bis dahin blieben auch ihre Organisationsstrukturen teilweise erhalten. Noch während dieser Übergangsphase begannen die westlichen Besatzungsmächte Großbritannien, USA und Frankreich aus deutschen Kriegsgefangenen und Freiwilligen Hilfskräfte zu rekrutieren. bände unter Beibehaltung alter Einsatzstrukturen mit deutschen Booten, Uniformen und Rangabzeichen eingesetzt. Es durften sogar Orden und Ehrenzeichen getragen werden, sofern diese keine nationalsozialistischen Embleme enthielten. Später wurde eine blaugefärbte britische Uniform mit abgewandelten Dienstgradabzeichen eingeführt. Als der Deutsche Minenräumdienst am 31. Dezember 1947 aufgelöst wurde, endete für gut 16000 Angehörige ein eigentümliches Wehrverhält- 5 Minensuchboot Skorpion (SK), erbaut 1942 als R 120 für die Deutsche Kriegsmarine, ab 1945 bei der GMSA Foto: Wehrgeschichtliches Ausbildungszentrum der Marineschule Mürwik Sie beseitigten Kriegsfolgen (Kampfmittelräumung, Reparatur militärischer Einrichtungen und der Infrastruktur allgemein) oder übernahmen Bewachungsaufgaben und entlasteten so die Besatzungstruppen, welche nach und nach demobilisiert wurden. Diese so genannten Dienstgruppen aus deutschen Kriegsgefangenen wurden ab Herbst 1945 unter den Bezeichnungen FA (Formation auxilaire) in der französischen, Labor Service (LA) bzw. Labor Service Units (LSU) in der amerikanischen und GSO (German Service Organization) in der britischen Zone geführt. Die bekannteste und effektivste Einrichtung dieser Art war der Deutsche Minenräumdienst (German Mine Sweeping Administration = GMSA). Nur eine Woche nach der Kapitulation wurden die Befehlsverhältnisse zwischen dem weiterhin existierenden Oberkommando der Kriegsmarine (OKM) und dem britischen Flottenkommando geregelt. Bis November 1945 wurden diese Minenräumver- nis: sie waren keine Kriegsgefangenen gewesen, sondern besaßen den Status des »Surrendered Enemy Personal«, also von Feindpersonal, welches sich ergeben hatte. Reste des GMSA fanden sich ab dem 1. Januar 1948 im Minenräumverband des Zollgrenzschutzes Cuxhaven wieder, welcher nach erneuter Reduzierung ab Juli 1951 in die Labor Service Unit B(ravo) integriert wurde, die dem Commander US Naval Advance Base Weser River in Bremerhaven unterstand. Ein Teil des Personals trat außerdem in den gerade gegründeten Bundesgrenzschutz (See) über. Nach der Aufstellung der Bundeswehr wurde 1956 der Großteil der Labor Service Unit B (60 Offiziere und 520 Unteroffiziere und Mannschaften) von der jungen Marine der Bundesrepublik Deutschland übernommen. Auch an Land hatte sich zwischenzeitlich die Struktur der Dienstgruppen verändert. So stellten die US-Streitkräfte für militärpolizeiliche Dienste wie die Bewachung von Sammelplätzen für Kriegsmaterial, Gebäude, Messen, Versorgungs- und Nachschublager Gruppen auf, die im Februar 1947 direkt dem Office of Provost Marshal (Militärpolizei = MP) unterstellt und einheitlich uniformiert und bewaffnet wurden. Hieraus ging im November 1947 die Industrial Police Division (Industriepolizei) hervor, die 1949 noch 9000 Mann umfasste, allerdings nicht nur Deutsche, sondern auch so genannte displaced persons, hauptsächlich ehemalige polnische Zwangsarbeiter, die nicht in das nun kommunistische Polen zurückkehren wollten. Die Industriepolizei wurde 1950 aufgelöst und in die Labor-Service-Wacheinheiten integriert. Der am 25. Juni 1950 ausgebrochene Koreakrieg führte zu einem starken Ausbau der Hilfstruppen (die 1952 immerhin ca. 80000 Mann umfassten), um alliierte Ressourcen für den Einsatz in Ostasien freizusetzen. So zählte 1953 das britische Kontingent 28000 Mann, die kaserniert untergebracht waren und sich aus Arbeits-, Transport-, Wachspezialverbänden, RoyalAir-Force- und Traffic- Controllgruppen zusammensetzten. Die LSU in der amerikanischen Besatzungszone verfügten sogar über Pionier- und Panzerinstandsetzungseinheiten. Zwischen 1945 bis zur endgültigen Auflösung 1958 waren mehrere zehntausend ehemalige deutsche Offiziere und Soldaten aktiv für die Besatzungsmächte tätig. Im März 1955, kurz vor der Aufstellung der Bundeswehr, dienten noch etwa 54000 Mann in den Dienstgruppen und ein Teil von ihnen – vorzugsweise Spezialisten für amerikanisches Kriegsgerät – wurde anschließend von der neu aufgestellten Bundeswehr übernommen. Gerhard Wiechmann Literaturtipp: H.-L. Borgert, W. Stürm, N.Wiggershaus, Dienstgruppen und westdeutscher Verteidigungsbeitrag. Vorüberlegungen zur Bewaffnung Der Bundesrepublik Deutschland, Boppard/Rh. 1982 (=Militärgeschichte seit 1945, 6) Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2004 31 Marineschule Mürwik N E U E P U B L I K ATIONEN DES MGFA Rolf Hobson, Maritimer Imperialismus. Seemachtideologie, seestrategisches Denken und der Tirpitzplan 1875 bis 1914. Aus dem Englischen übersetzt von Eva Besteck. Hrsg. vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt, Potsdam, und dem Institut für Verteidigungsstudien, Oslo, München: Oldenbourg 2004; X, 388 S. (= Beiträge zur Militärgeschichte, 61) ISBN: 3-486-56671-7 Preis: 34,80 € Auf breiter Quellen- und Literaturgrundlage wendet sich die Arbeit von Rolf Hobson der Frage nach den maritimen Verteidigungsbedürfnissen des Deutschen Reiches zu und gelangt dabei zu einer neuen Deutung der deutschen Flottenrüstung vor dem Ersten Weltkrieg. Der Autor bezieht die mit dem Zeitalter des ›industrialisierten Volkskrieges‹ sich rapide verändernden politischen, technologischen, wirtschaftlichen und völkerrechtlichen Bedingungen in seine Untersuchung mit ein. Er richtet ein besonderes Augenmerk auf den Aspekt des Seerechtes, das als Ausdruck des realen maritimen Kräfteverhältnisses in der Dreiecksbeziehung zwischen den beiden Kriegsparteien und den Neutralen dem Gebrauch von Seemacht als Instrument eines Wirtschaftskrieges Schranken auferlegte. Hobson gelingt der Nachweis, daß sich aufgrund einer selektiven Rezeption des Navalisten Mahan das ursprünglich militärisch begründete Kalkül der deutschen Flottenrüstung zu dem in sich widersprüchlichen Abschreckungskonzept der Risikoflotte wandelte, welches mit zuvor schon gewonnenen Einsichten unvereinbar war. Der vergleichende Blick auf parallele Ausprägungen des Navalismus in Rußland und in Österreich-Ungarn unterstreicht den Befund, daß das Besondere der Wilhelminischen Seerüstung nicht in einer ›innenpolitischen Krisenstrategie‹, lag, sondern in der dem Staatssekretär Admiral Tirpitz eigenen ›politischen‹ Deutung der Seemacht. Albert Hopman, Das ereignisreiche Leben eines ›Wilhelminers‹. Tagebücher, Briefe, Aufzeichnungen 1901 bis 1920. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes, Potsdam. Hrsg. von Michael Epkenhans, München: Oldenbourg 2004, XII, 1231 S. (= Beiträge zur Militärgeschichte, 62) ISBN: 3-486-56840-X Preis: 49,80 € Die wissenschaftliche Edition der Tagebücher, Briefe und Aufzeichnungen von Vizeadmiral Albert Hopman (1865–1942), einem der ranghöchsten Admirale der Kaiserlichen Marine, erlaubt einen tiefen Einblick in den Alltag eines Marineoffiziers in den ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Darüber hinaus ermöglicht sie es, wichtige außen- und marinepolitische Entscheidungen in den Jahren vor 1914 und während des Ersten Weltkrieges nachzuzeichnen. Hopmans Aufzeichnungen, vor allem seine Schilderungen führender Persönlichkeiten wie Wilhelm II., Tirpitz und Bethmann Hollweg, bestätigen einmal mehr in höchst anschaulicher Form die These vom »polykratischen Chaos« an der Spitze des Deutschen Reiches.