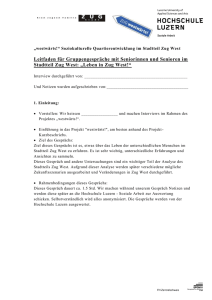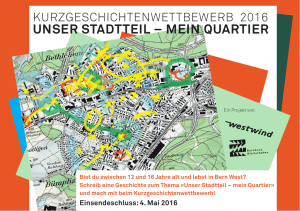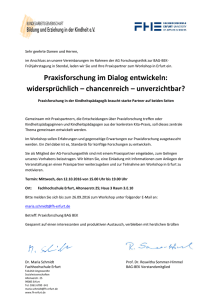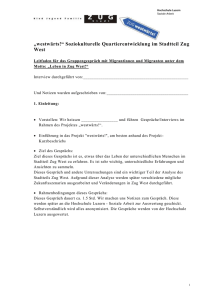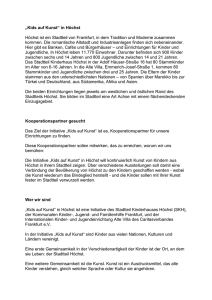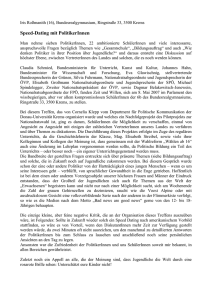Netzwerke Sozialer Arbeit zwischen Selbstorganisation und
Werbung
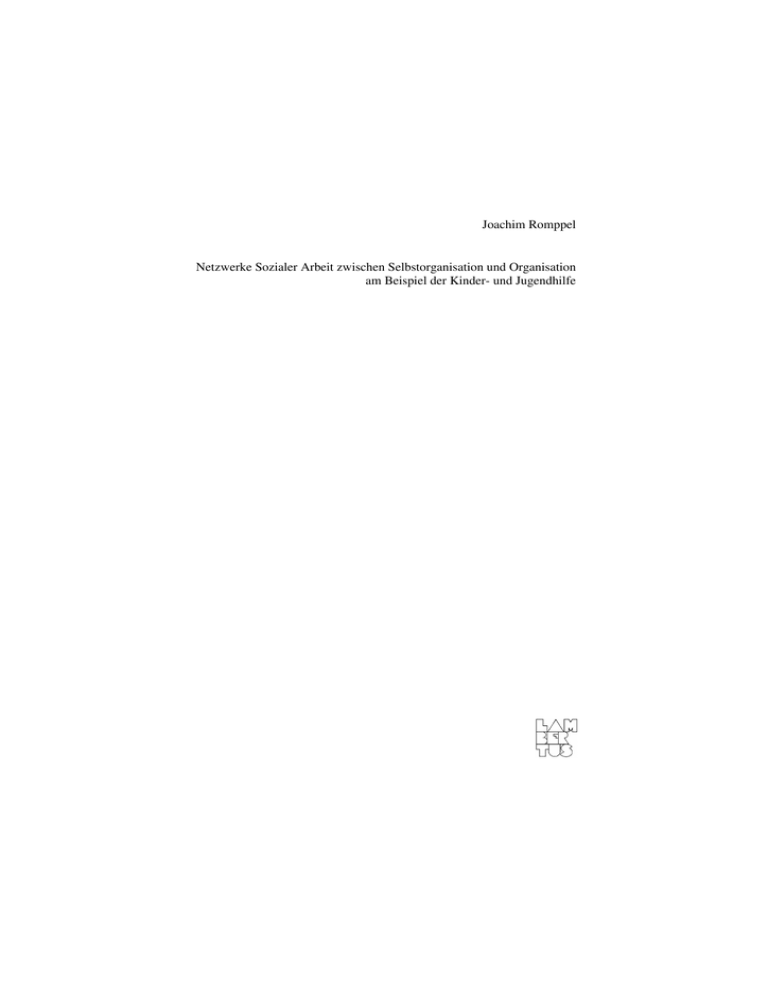
Joachim Romppel Netzwerke Sozialer Arbeit zwischen Selbstorganisation und Organisation am Beispiel der Kinder- und Jugendhilfe Joachim Romppel Netzwerke Sozialer Arbeit zwischen Selbstorganisation und Organisation am Beispiel der Kinder- und Jugendhilfe Lambertus Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. Alle Rechte vorbehalten © 2003, Lambertus-Verlag, Freiburg im Breisgau Umschlaggestaltung: Christa Berger, Solingen Satz und Layout: Ursi Aeschbacher, Herzogenbuchsee (Schweiz) Herstellung: Franz X. Stückle, Druck und Verlag, Ettenheim ISBN 3-7841-1438-5 Inhalt 1. Einleitung ............................................................................................ 9 2. Das Forschungsprojekt ....................................................................... 11 2.1 Zur erkenntnisleitenden Fragestellung .............................................. 11 2.2 Zur Praxisforschung .......................................................................... 13 2.3 Auswahl des Stadtteils, der Vernetzungsrunde und der Entscheidungsträger ................................................................... 16 2.4 Zum Forschungsdesign .................................................................... 21 2.5 Forschungsverlauf und Verzeichnis der Primärquellen .................... 26 3. Theoretische Bezüge ........................................................................... 30 3.1 Lebensbedingungen in sozialen Brennpunkten ................................ 30 3.1.1 Gesellschaftlicher Wandel und allgemeine Lebensbedingungen .. 30 3.1.2 Stadtteile als soziale Brennpunkte und Armutszonen .................... 31 3.1.3 Von sozialen Lagen zu Lebenslagen ............................................. 35 3.1.4 Zum Begriff und zur Theorie der Lebenswelt ............................... 37 3.1.5 Handlungsräume von Kindern und Jugendlichen .......................... 39 3.2 Vernetzung als Anforderung an Soziale Arbeit ................................ 41 3.2.1 Zum Verständnis von Institutionen und Organisationen ............... 41 3.2.2 Zum Begriff und zur Entwicklung von Netzwerken .................... 42 3.2.3 Unterschiedliche Perspektiven zur Vernetzung ............................. 44 3.2.4 Netzwerke in der Sozialen Arbeit .................................................. 46 3.2.5 Netzwerke aus der Geschlechterperspektive ................................. 47 3.3 Zur beruflichen Identität von Fachleuten der Sozialen Arbeit ................................................................................. 49 3.3.1 Der Identitätsbegriff von Mead ...................................................... 49 3.3.2 Weiterentwicklung des Symbolischen Interaktionismus ............... 51 3.3.3 Identität durch Kommunikation und Interaktion ........................... 52 3.3.4 Zur beruflichen Identität in der Sozialen Arbeit ............................ 53 3.3.5 Ergänzende Aspekte zur beruflichen Identität ............................... 60 4. Perspektiven zum Stadtteil .................................................................. 64 4.1 Die Sozialstruktur des Stadtteils Hannover-Vahrenheide ................ 64 4.1.1 Zur Geschichte und Struktur des Stadtteils .................................... 64 INHALT 4.1.2 Wohnumfeldverbesserung und Sanierung ..................................... 67 4.1.3 Zur Bevölkerung Vahrenheides ..................................................... 69 4.1.4 Organisationen der BewohnerInnen .............................................. 79 4.1.5 Stadtentwicklung und Soziale Einrichtungen in Vahrenheide ...... 80 4.1.6 Zusammenfassung ......................................................................... 82 4.2 Perspektiven und Zugänge Sozialer Fachkräfte ................................ 83 4.2.1 Kritik an statistischen Erhebungen ................................................ 84 4.2.2 Berufserfahrung und Diskurs als Ausgangpunkte ......................... 86 4.2.3 Zusammenfassung ......................................................................... 90 4.3 Perspektiven der PolitikerInnen und Verwaltungsleitung zum Stadtteil ........................................................................................... 91 4.3.2 Zusammenfassung ......................................................................... 93 4.4 Zusammenfassender Vergleich der Perspektiven zum Stadtteil ....... 94 4.4.1 Lebensweltbezug beeinflusst die Perspektiven .............................. 96 4.4.2 Entscheidungs- und Steuerungsbefugnisse beeinflussen die Perspektiven ................................................................. 99 4.4.3 Sozialpolitische Trends beeinflussen die Perspektiven ............... 100 5. Ergebnisse der Praxisforschung ........................................................ 102 5.1 Sitzungskultur und Arbeitsweise in der Selbstorganisation ........... 102 5.1.1 Freiwillige Zusammenarbeit ........................................................ 102 5.1.2 Ablauf der Sitzungen ................................................................... 103 5.1.3 Verbindungen zu anderen Gremien ............................................. 103 5.1.4 Funktionen der AG-Sitzungen ..................................................... 104 5.1.5 Die AG veränderte ihre Struktur .................................................. 109 5.1.6 Verschiedene Formen der Vernetzung ......................................... 110 5.1.7 Zusammenfassende Beurteilung der Arbeitsweise ...................... 112 5.2 Zukunftswerkstätten und Beteiligungsprojekte .............................. 115 5.2.1 Die Zukunftswerkstätten in Vahrenheide .................................... 117 5.2.2 Erfahrungen aus den ersten beiden Zukunftswerkstätten ............ 120 5.2.3 Auswertung der vier Zukunftswerkstätten ................................... 123 5.2.4 Reflexion über die Kooperation der Fachleute ............................ 128 5.2.5 Zustimmung von PolitikerInnen und Leitungskräften im Jugendamt ........................................................................................ 130 5.2.6 Kritische Anfragen von PolitikerInnen ........................................ 132 5.2.7 Zusammenfassung der Ergebnisse zur Beteiligung ..................... 134 5.3 Selbstsicht auf die Kooperation der AG Kinder- und Jugendarbeit ......................................................... 138 INHALT 5.3.1 Ziele der Kooperation .................................................................. 138 5.3.2 Wirkung der Kooperation ............................................................ 139 5.3.3 Spannungsverhältnisse in der Kooperation .................................. 142 5.3.4 Struktur der Vernetzung ............................................................... 146 5.3.5 Zusammenfassung des Selbstbildes der AG ................................ 149 5.4 Fremdsicht auf die Kooperation der AG Kinder- und Jugendarbeit ............................................................... 151 5.4.1 Kooperation zwischen PolitikerInnen, Verwaltungsleitung und der AG ........................................................... 152 5.4.2 Anlässe der Kooperation .............................................................. 155 5.4.3 Erwartungen an die sozialen Fachleute ....................................... 159 5.4.4 Zusammenfassung des Fremdbildes ............................................ 165 6. Vergleich der Ergebnisse mit der Fachliteratur ................................ 170 6.1 Netzwerken als Handlungsform Sozialer Arbeit ............................ 170 6.2 Berufliche Identität in Netzwerken und Bündnissen ...................... 178 6.3 Kompetenzen in Netzwerken bei Analyse und Planung ................. 184 6.4 Zusammenfassung .......................................................................... 188 7. Annäherung an Soziale Arbeit durch praxisbezogene Forschung .......................................................... 190 7.1. Zur Diskussion um Sozialpädagogische Forschung und Sozialarbeitsforschung ................................................................... 190 7.1.2 Zur Praxisforschung der Sozialen Arbeit ..................................... 192 7.1.3 Bezug auf die Aktionsforschung .................................................. 194 7.1.4 Zusammenfassung ....................................................................... 199 7.2 Zu den Erhebungsmethoden ........................................................... 200 7.2.1 Leitfaden-Interview ..................................................................... 200 7.2.2 Teilnehmende Beobachtung ........................................................ 202 7.2.3 Gruppendiskussionsverfahren ...................................................... 204 7.2.4 Soziogramm ................................................................................. 205 7.2.5 Schriftliche und telefonische Befragung ...................................... 207 7.3 Reflexion des Forschungsprozess ................................................... 213 7.3.1 Das Forschungsdesign ................................................................. 213 7.3.2 Veränderungen im Forschungsprozess ........................................ 215 7.3.3 Lernprozesse durch Zwischenberichte und Diskussion ............... 216 7.4 Zur Rolle des Praxisforschers ......................................................... 218 7.4 Perspektiven für die Praxisforschung ............................................. 222 INHALT 7.4.1 Methodologische Probleme einer Praxisforschung ..................... 222 7.4.2 Rückmeldung der AG-TeilnehmerInnen ..................................... 223 7.4.3 Praxisforschung oder Organisationsberatung? ............................ 224 7.4.4 Verbindung von Forschung und Beratung ................................... 225 7.4.5 Praxisforschung oder Sozialarbeitsforschung? ............................ 228 Literatur und Quellen ............................................................................ 231 Der Autor .............................................................................................. 250 1. Einleitung Sozialräumliche Ansätze sind derzeit in der Sozialen Arbeit gefragt. Ob in der Altenhilfe (vgl. Engel 2001), in der Jugendhilfe (vgl. Boomgaarden 2001) oder zu Fragen von Stadtentwicklung und Partizipation (vgl. Lüttringhaus 2000), in allen Bereichen entstehen neue Anforderungen an Analyse und Planung. Die Aufgaben in der Sozialen Arbeit sollen nicht nur an den Kontexten von Zielgruppen und Institutionen allein ausgerichtet werden, sondern auch physisch-materielle, kulturelle, soziale und symbolische Dimensionen des umgebenden Raumes berücksichtigen (vgl. Bourdieu 1991). Damit wird eine Vergleichbarkeit der Problemlagen und Bedarfe verschiedener Quartiere im Verhältnis zueinander und zu vorhandenen Infrastrukturen und Ressourcen möglich, die in einer Sozialraumanalyse (vgl. Freyburg; Schneider 1999) festgehalten werden sollen. Diese Anforderungen weisen auf vergleichbare fachliche Positionen in der Geschichte hin. Der Blick auf einen Stadtteil, ein Quartier oder ein Wohngebiet hat in der Sozialen Arbeit unter dem Begriff Gemeinwesenarbeit eine lange Tradition (vgl. Alinsky 1999; Hinte 1998; Oelschlägel 1986; Mohrlok u.a. 1993; Müller 1988) In Deutschland war Gemeinwesenarbeit in den 1970er Jahren in der Sanierungsbegleitung von Altbauvierteln und zur Bürgeraktivierung in den an Stadträndern neugebauten Großwohnsiedlungen gefragt. Insbesondere einseitige Wohnungsbelegung führte zu Segregation von Armutsbevölkerung und fehlende Infrastruktur ließ dort bereits in den 1980er Jahren Forderungen nach Sozial- und Stadtteilentwicklungsplanung aufkommen. Gemeinwesenarbeitsbüros übernahmen in den Stadtteilen u.a. Analyse- und Planungsaufgaben, deren Ergebnisse, angelehnt an Bürgerinitiativarbeit, unter großer Beteiligung der Bewohnerschaft und anderer Fachleute durchgesetzt wurden. Waren in den 70er Jahren Konzepte der Gemeinwesenarbeit gegen traditionelle Positionen von Politik und Verwaltung verbreitet, haben sich Formen der Zusammenarbeit gewandelt und sich Funktionen, wie z.B. „anwaltliche Beratung“, „intermediäre Instanz“, „Quartiersmanager“ herausgebildet. Damit werden Erwartungen verbunden, einerseits zwischen den Fachdisziplinen und andererseits zwischen Planungs-, Entscheidungs- und Ausführungsebenen zu vermitteln. In der Praxis haben sich daraus brauchbare Handlungskonzepte und Methoden entwickelt, denen vielfach leider die sozialarbeitsbezogene theoretische Fundierung fehlte, 9 1. EINLEITUNG weshalb auf stadtsoziologische Theorien zurückgegriffen wird. In Erinnerung blieben die Aktivitäten der Gemeinwesenarbeit in Politik und Verwaltung vorwiegend durch die Einmischung in lokalpolitischen Kontroversen und durch ihre Konfliktbereitschaft. Die Verbreitung des „Arbeitsprinzips Gemeinwesenarbeit“ (vgl. Oelschlägel 1985) führte zu einer erweiterten Perspektive in vielen Arbeitfeldern der Sozialen Arbeit sei es in Kindertagesstätten, in Beratungsstellen oder Jugendzentren. Aber auch bei Bildungs- und Kulturträgern oder darüber hinaus in anderen Fachgebieten, bei Planungs- und Sanierungsabteilungen der Kommunen. In Stadtteilen und Gemeinden haben sich in der Verbreitung dieses Prinzips inoffizielle Arbeitsgemeinschaften von in der Praxis tätigen SozialarbeiterInnen, ErzieherInnen und PädagogInnen aus Einrichtungen des Landes, der Stadt und der Verbände herausgebildet. Die als Stadtteilrunden, Jugend- und Sozialforen o.ä. bezeichneten Arbeitsformen waren in der Vergangenheit auf Initiative von Fachleuten der Sozialen Arbeit als zusätzliche Organisationsform neben den hierarchischen Strukturen in Stadtverwaltung und Verbänden entstanden. Die Runden sorgten intern für fachlichen Austausch, fungierten extern als Ansprechpartner für BürgerInnen und PolitikerInnen und gaben wertvolle Anregungen für Veränderungen und Entwicklungen in den Kommunen. Andererseits beanspruchten sie auch ein sozialpolitisches Mandat für Bevölkerungsgruppen, die sich zunächst nicht selbst organisieren konnten, was regelmäßig zu Konflikten mit der Verwaltung führte und Fragen nach der Rolle der Fachkräfte und direkter Beteiligung und Mitbestimmung der BürgerInnen aufkommen ließ. Mit dem Begriff „Vernetzung“ werden an diese Runden und Foren Ansprüche von Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit gerichtet, effektiver und effizienter zu kooperieren. Ökonomische Zwänge der Kommunen verschärfen die Probleme der Steuerung Sozialer Organisationen bei gleichzeitig notwendigen Haushaltskonsolidierungen und wachsenden sozialen Aufgaben (vgl. Altvater 2000). Das Verhältnis von inoffiziellen (Stadtteilrunden) und offiziellen Kooperationen (Ämter und Verbände) wirft Fragen danach auf, wie sich unterschiedliche Organisationsstrukturen mit Rollenkonzepten, Leitungsformen, Regeln und Machtausübung zur Bewältigung der gestellten Aufgaben eignen, um Stadtteile, die als Soziale Brennpunkte bzw. Armutszonen gelten, weiter zu entwickeln. Welche Konsequenzen ergeben sich aus den neuen Anforderungen für das Berufsbild von SozialarbeiterInnen und für die Organisation Sozialer Arbeit? 10 2. Das Forschungsprojekt 2.1 ZUR ERKENNTNISLEITENDEN FRAGESTELLUNG Im Forschungsprojekt wird die Qualität der Kooperation einer selbstorganisierten Arbeitsgemeinschaft der Sozialen Arbeit am Beispiel der AG Kinder- und Jugendarbeit Vahrenheide/Hannover in einer Praxisforschung analysiert, um deren Funktion, Arbeitsmethoden, Stärken und Schwächen im Kontext lokaler Entscheidungsprozesse zu erfassen. Die Fragestellung entstand vor dem kommunalpolitischen Hintergrund der Konkurrenz zwischen behördlich initiierter Kooperation der Stadt Hannover und den gewachsenen und selbstorganisierten Formen der Zusammenarbeit zwischen Fachkräften im Stadtteil. Deshalb ist zu fragen, nach einem Zusammenwirken bei dem, im § 80 KGHG festgelegten Dreierschritt von Analyse, Planung und Umsetzung. Vorab ist die Forschungsperspektive offen zu legen, um daraus theoretische Annahmen zu treffen, die den Begriff der „Zusammenarbeit“ unter drei Gesichtspunkten differenzieren: (1) Zusammenarbeit wird verstanden als Teil der beruflichen Tätigkeit Sozialer Arbeit, in der gesellschaftlich oder professionell anerkannte Problemlagen bearbeitet werden sollen (vgl. Staub-Bernasconi 1995; Wendt 1995; Klüsche 2001). (2) Die beruflichen Tätigkeiten stehen in Abhängigkeit von Kontextbedingungen (Geschichte, Sozialstruktur, Traditionen, Lokalpolitik, Organisationen) und sind eingebettet in einen zeitlichen und inhaltlichen Prozess der Entwicklung und Veränderung, bei dem aktives Eingreifen oder Unterlassen der verschiedenen lokalpolitischen Kräfte erfolgen (vgl. Heiner 1988a; von Kardorff 1988). (3) Die Tätigkeiten werden betrachtet als Interaktionen im Sinne Meads, durch die versucht wird, eine gemeinsam geteilte Bedeutung herzustellen, die auf die Betroffenen zurückwirkt. Unterschiedliche Perspektiven (Selbstund Fremdsicht) sowie Strukturen und Interessen lassen sich aus einer Perspektivverschränkung herausarbeiten (vgl. Mead 1973, 1980, 1983). Die gewählte Forschungsperspektive lässt sich mit dem Ansatz der Praxisforschung verbinden. Das führt zur Erweiterung der oben aufgeführten Fra11 2. DAS FORSCHUNGSPROJEKT gen nach Qualität der Vernetzung, denn Praxisforschung geht davon aus, dass bei einer wissenschaftlichen Überprüfung von Praxis die wichtigste Frage lautet, wie und unter welchen Bedingungen ein Ergebnis zustande gekommen ist. Daraus kann die Praxis am ehesten neue Einsichten für ihre Arbeit gewinnen. Aber auch für die wissenschaftliche Diskussion ist es wichtig, Wirkungen aus ihrem situativen und kontextuellen Zusammenhang zu begreifen und zu klären: • Welche Probleme und Aufgaben werden von Fachkräften im Stadtteil und Entscheidungsträgern für wichtig angesehen? • Von wem kommen welche Vorschläge, welche Fachkräfte in welcher Weise zur Verbesserung der Situation in dem Handlungsfeld beitragen könnte? • Von wem wurden welche Wege zur Problemlösung eingeschlagen, von wem wurden sie wie beurteilt? • Bei wem wurden welche Ergebnisse erreicht und von wem wurden sie wie beurteilt? (vgl. Heiner u.a. 1996, 133f.) Und darüber hinaus ist zu fragen: • Welche Fachkompetenzen sind in der Vernetzungsrunde vorhanden und warum werden diese bisher nicht in Planungs- und Entscheidungsprozessen der Stadt einbezogen? • Wie wird die Arbeit der AG von anderen Fachleuten aus Stadtverwaltung und Politik eingeschätzt, welche Erwartungen werden formuliert und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen der Handlungsebenen des Stadtteils und der Stadt vor dem Hintergrund unterschiedlicher Selbst- und Fremdbilder? Daraus lässt sich zusammenfassend die erkenntnisleitende Frage formulieren: (1) Wie, unter welchen Bedingungen und mit welchem Ergebnis arbeiten Fachleute der Sozialen Arbeit in einem Stadtteil zusammen? Zusätzlich soll mit Hilfe umfangreicher Rückkopplungen an die PraktikerInnen und der Diskussion von Zwischenergebnissen eine Fragestellung zu Lern- und Veränderungsprozessen durch Praxisforschung bearbeitet und gefragt werden: • Sind Rückkopplungen der Zwischenergebnisse geeignet Lernprozesse der Teilnehmenden anzuregen? 12 2.2 ZUR PRAXISFORSCHUNG Das Forschungsprojekt erhält somit eine Zweiteilung, die durch eine Veränderung der erkenntnisleitenden Frage zum Ausdruck kommt: (2) Wie, unter welchen Bedingungen und mit welchem Ergebnis arbeiten Fachleute der Sozialen Arbeit in einem Stadtteil zusammen, nachdem sie ihr Selbst- und Fremdbild reflektieren und diskutieren konnten? Es stellten sich darüber hinaus folgende methodologischen Fragen: • Welche Forschungsperspektive und welcher Forschungsansatz sind für die Untersuchung der Praxis Sozialer Arbeit, insbesondere der beruflichen Kooperation im Stadtteil geeignet? • Wo gibt es Anhaltspunkte für die Entwicklung eines geeigneten Forschungsdesigns? • Welche Methoden sind kombinierbar und welche Wissensbestände können jeweils damit erhoben werden? Vor Beginn des Forschungsvorhaben wurden neben dem Bezug zur Praxisforschung (vgl. Heiner 1988a; Moser 1995 und 1997; Müller 1988; Kardorff 1988) methodologische Anknüpfungspunkte in der qualitativen Sozialforschung gesucht z.B. bei der Abwägung der Begrifflichkeiten (vgl. Lamneck 1988; Terhard 1997; Weishaupt 1995), dem Feld- und Praxisbezug (vgl. Garz 1995; Honer 1989), der Nützlichkeit von Sozialforschung (vgl. Van de Vall 1989), der Anwendbarkeit von Ergebnissen (vgl. Beck, Bonß 1989). 2.2 ZUR PRAXISFORSCHUNG Qualitative Sozialforschung bietet eine Vielzahl methodologischer Ansätze und Erhebungsmethoden, die auch für die Untersuchung von Sozialer Arbeit geeignet sind (vgl. Flick u.a. 1991b; Friebertshäuser, Prengel 1997; vgl. König, Zedler 1995). Die Diskussionen über anwendungsorientierte Forschung zeigen, dass zusätzliche Anforderungen an die Methodologie notwendig sind, denn die Praxis erwartet einen Nutzwert von Forschungsergebnissen. Praxisbezogene Forschungsprojekte versuchen in der Wahl der Methoden flexibel zu bleiben, um eine Nähe und einen Subjektbezug zum Forschungsfeld herzustellen und zu erhalten. Die Rolle des Forschers verändert sich zusätzlich, wenn auch Empfehlungen und Beratungen erwartet werden und Bestandteil des Forschungsvertrages sind. Generell stellt sich die Frage, ob 13 2. DAS FORSCHUNGSPROJEKT solche Forschungsprojekte eher theoriegeleitet (vgl. Hopf 1993) oder theoriegenerierend (vgl. Strauss, Corbin 1996) arbeiten sollen. Für eine praxisbezogene Forschung in der Sozialen Arbeit lassen sich folgende Elemente aufgreifen und weiterführen. Die Praxis unterliegt zwei konstituierenden Größen: zum einen den vielfältigen Kontexten und zum anderen der Prozesshaftigkeit von Ereignissen und Handlungsmustern (vgl. Filsinger, Hinte 1988, 44). Beide Elemente sollten in der Praxisforschung zur Geltung kommen. Wesentlich ist der Zugang zur Praxis, der zunächst durch die Art der Kontaktaufnahme und Vertragsgestaltung beeinflusst wird, insbesondere durch den Grad an Mitgestaltung durch PraktikerInnen und durch die Wahl der Untersuchungsmethoden. Die Methoden sind an die Fragestellung und die Situation im Feld anzupassen. Auch wenn die zentralen Erhebungsmethoden qualitativ sind, finden sie Ergänzung durch quantitative Methoden. Empfehlenswert ist ein Mehrmethodenansatz. „Das eigenständige Profil der Praxisforschung wäre demnach einerseits in der Abgrenzung zur weniger anwendungs- und umsetzungsorientierter Grundlagenforschung zu sehen, es ist aber auch abzuheben von einer Handlungs- und Aktionsforschung, die sich einseitig auf qualitative Verfahren und Pläne festgelegt hat“ (Heiner 1988a, 9-10). Die Rückkopplung von Zwischenergebnissen ist bedeutsam, weil sie eine größere Transparenz des Forschungsverfahrens ermöglicht und die Untersuchten in den Forschungsprozess einbezieht. Die Diskussionen sollen inhaltlich, sprachlich und zeitlich der Praxis angepasst werden und eine Auseinandersetzung ermöglichen. Erhebungsphasen und Diskurse wechseln sich ab. So können die Handelnden im Feld zu Mitforschern werden, etwa durch Vorschläge zum Vorgehen und zu Fragestellungen (vgl. Moser 1995). Dadurch können die Beteiligten wissenschaftliche Erkenntnisse zu einem frühen Zeitpunkt für die Praxis verwerten (vgl. Beck, Bonß 1989). Die Diskussionen wiederum geben dem Forscher einen vertieften Einblick in Prozesse der Meinungsbildung und Umsetzung von neuen Erkenntnissen. „Diese Prozesse des Aushandelns ließen sich selbst als ein empirischer Test auf die Durchsetzungschancen der für die praktische Arbeit gesetzten Ziele und der dafür gewählten Arbeitsformen begreifen. Denn in den Argumentationsmustern der Beteiligten treffen die unterschiedlichen Interessen und Handlungs‚logiken‘ aufeinander, werden im Prozeß der Auseinandersetzung die feingesponnenen Netze der quer zu allen Beteiligten laufenden Koalitionen und machtbildenden Versäulungen sichtbar und geraten in Legitimationszwänge. Der einer derart kommunikativ angelegten Praxisforschung inhärente Zwang zur Diskursivie- 14 2.2 ZUR PRAXISFORSCHUNG rung der eigenen Handlungsprogramme kann zu einer präziseren und differenzierteren Konsens- und Kompromißbildung beitragen, ... und (idealerweise) kollektive Lernprozesse ermöglichen mindestens jedoch gewohnte Routinen, offengelegte Defizite, Fehlsteuerungen usw. zur Disposition stellen“ (Kardorff 1988, 97-98). Methodologisch ist in der oben vorgestellten Praxisforschung noch undeutlich, wie Erhebungsphasen und Rückkopplung sich unterscheiden. In der Aktionsforschung wurden diese Phasen selten getrennt und die Erhebungsmethoden nicht sorgfältig genug reflektiert und unterschieden. Im Gegensatz dazu soll in der Praxisforschung der Forschende nicht mehr aktiv in Handlungsvollzüge der Praxis eingreifen und sich dem Forschungsfeld zunächst nicht generell durch theoriebezogene Fragestellung annähern. Praxis- und wissenschaftlich forschende Perspektive werden einander gegenübergestellt. Die Verantwortungsbereiche „Handeln im Feld“ und „Forschen im Feld“ bleiben dabei getrennt. „Praxisforschung wird nicht mehr – wie etwa in der Diskussion über Handlungsforschung in den 70er Jahren – als Vehikel für Innovation gesehen, die auf diese Weise mit Sicherheit schnell und erfolgreich umzusetzen sind. ... der besondere Beitrag der Praxisforschung wird heute eher in einer begleitenden Unterstützung und einer geduldigen Vermittlungs- und Überzeugungsarbeit gesehen, bei denen der Forscher zwischen den fachlichen oder politischen Fronten steht und sich um Verständigung zwischen den Beteiligten bemüht ... Damit rückt die Praxisforschung in die Nähe der Politik- und Praxisberatung und flankiert mit ihrer Aufklärungsarbeit die Innovationsversuche der Verwaltung und der Politik sowie die Selbstaufklärung der Fachbasis in der Praxis“ (Heiner 1988a, 13). Die Ansätze der Praxisforschung lassen sich mit der Grounded Theory verbinden, wenn wie bei diesem Projekt eine Theorieentwicklung aus den Daten erfolgen soll. Die Rückkopplung von Zwischenergebnissen ist eine zusätzliche Besonderheit und bedeutet eine gezielte Intervention im Forschungsfeld, die zwar keinen direkten Eingriff in Soziale Arbeit darstellt, aber auf Überprüfung ggfs. Veränderung der Praxis hinzielt. Die Vorzüge der Aktionsforschung im Hinblick auf eine große Nähe zum Untersuchungsfeld und auf die Aushandlungsprozesse können genutzt werden. Doch sowohl Rückkopplung als auch Nähe zum Forschungsfeld bedürfen der Reflexion des Vorgehens, der Methodenentwicklung und -kontrolle (vgl. Kelle 1997). Es muss nachvollziehbar sein, welche Interessen den Forschenden leiten, welche Perspektive er einnimmt und ob eine Interven- 15 2. DAS FORSCHUNGSPROJEKT tion in die Praxis der Sozialen Arbeit durch Veränderungsvorschläge oder sogar Mitarbeit stattfindet. Deshalb sind die Interessen von ForscherInnen und ihre Reflexionen ein Bestandteil von Praxisforschung. Zu fragen ist: In welcher Weise sind ForscherInnen mit dem Praxisfeld verbunden? Welche Erfahrungen haben sie in dem Berufsfeld, und über welches Vorwissen verfügen sie? Handlungswissen kann sich als Vorteil erweisen, weil verwendete Begriffe geläufig sind und gezielter nachgefragt werden kann. Andererseits besteht die Gefahr, scheinbar Bekanntes ungefragt zu akzeptieren. Eine Berufstätigkeit im Untersuchungsfeld kann den Forscher an seine alte Funktion binden und die Forscherrolle für Außenstehende unglaubwürdig erscheinen lassen. Die schwierigste Situation ergibt sich, wenn die ForscherInnen gleichzeitig Urheber und Entwickler von Projektideen sind und den Verlauf nach Erfolgen und Misserfolgen untersuchen und beurteilen. Wenn eine weitreichende Verstrickung mit dem Untersuchungsfeld besteht, sind der Reflexion der eigenen Funktion Grenzen gesetzt. Untersuchungsergebnisse können dann einseitig ausfallen, Perspektiven von Betroffenen oder Außenstehenden vernachlässigt werden, weil sie zu völlig anderen, ja sogar konträren Ergebnissen gelangen. Zusammenfassend lassen sich die Besonderheiten dieses Forschungsprojekt wie folgt beschreiben: Das Forschungsprojekt soll einen Nutzwert für die PraktikerInnen im Feld ergeben, deshalb wurden bereits nach der Erhebung Zwischenergebnisse zurückgekoppelt und diskutiert, über diese kommunikative Validierung boten sich zusätzliche Erkenntnisse. Das bedeutete eine Intervention im Untersuchungsfeld, die in der Auswertung zu berücksichtigen war. Im Forschungsprozess wurden zwei Erhebungsmethoden (Interview und Beobachtung) bevorzugt eingesetzt, insgesamt kam es jedoch zu einem Methodenmix, um den Feld- und Subjektbezug zu wahren. Zwei Forschungsebenen wurden unterschieden und durch Erhebungen berücksichtigt: Kontext- und Prozessforschung, die sich wiederum in verschiedene Phasen unterteilen lassen. Die Interessen und die Rolle des Forschers wurden transparent gemacht und sind Teil der methodischen Reflexion. 2.3 AUSWAHL DES STADTTEILS, DER VERNETZUNGSRUNDE UND DER ENTSCHEIDUNGSTRÄGER Die Auswahl des Stadtteils Hannover-Vahrenheide mit einer Großwohnanlage der 70er Jahre erfolgte, weil hier ein sozialer Brennpunkt insofern an16 2.3 AUSWAHL erkannt wurde, dass Fachleute und PolitikerInnen gleichermaßen professionellen und lokalpolitischen Handlungsbedarf signalisierten. Darüber hinaus gab es politische Diskussionen und eine Verständigung, VahrenheideOst (vgl. www.nananet.de/institut/vahrenheide) ab 1998 als Sanierungsgebiet auszuweisen, wozu auf den unterschiedlichsten Ebenen Konzepte und Planungen entwickelt wurden. Der Stadtteil ist gem. § 55 Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) zusätzlich zur Zuständigkeit des Stadtrates mit 4 anderen Stadtteilen einem der 13 hannoverschen Stadtbezirke zugeordnet (vgl. Thiele 1997). Die Einwohnerzahlen verteilten sich am 1.1.2001 wie folgt: Tabelle 1: Einwohner im Stadtbezirk Bothfeld-Vahrenheide Stadtbezirk mit 5 Stadtteilen Einwohner 47.221 Vahrenheide 9.319 Isernhagen-Süd 2.767 Lahe 1.492 Bothfeld 19.472 Sahlkamp 14.171 (Vgl. Landeshauptstadt Hannover 2001b) Die Auswahl der Vernetzungsrunde (AG Kinder- und Jugendarbeit) erfolgte unter dem Gesichtspunkt, Handlungen und Handlungsfolgen (der Zusammenarbeit) im lokalpolitischen Kontext und deren Bedeutung für die Professionalität Sozialer Arbeit erheben und beobachten zu können. Dazu war es erforderlich einerseits das berufliche Handeln unter geringen institutionellen Zwängen zu berücksichtigen, weil dabei das Handlungsspektrum erweitert ist. Andererseits sollten sich bewährte Handlungsformen über die Gründungsphase hinaus als Routinen herausgebildet haben. Die berufliche Tätigkeit sollte über den Informationsaustausch hinausgehen und gemeinsame Aktionen beinhalten, die auch Einmischung in sozialpolitisch relevante Themen nicht ausschließt, wodurch zwangsläufig Kontakte ggf. Konfliktebenen mit Leitungs- und Entscheidungskräften entstehen. In den 25 Jahren der selbstorganisierten beruflichen Kooperation im Stadtteil Vahrenheide kristallisierten sich Themen heraus, zu denen kontinuier17 2. DAS FORSCHUNGSPROJEKT lich und langfristig gearbeitet wird. Einige Themen halten sich mit Beständigkeit, z.B. AG Alte Menschen, AG Kinder- und Jugendarbeit. Andere AGs veränderten sich in den Jahren (AG Ausländer zu AG Kaleidoskop), sind in den Hintergrund getreten, z.B. AG Stadtteilfest oder neu dazugekommen z.B. AG Arbeitsmarkt. Interessant daran ist, dass dabei Strukturen einer Zusammenarbeit entstanden, die sich durchsetzten und bewährten. Für stadtteilbezogene Soziale Arbeit lassen sich daraus Erkenntnisse gewinnen, wie in selbstorganisierten Runden kooperiert werden kann. Dafür lohnt es sich die Formen der Zusammenarbeit und die Arbeitsweisen genauer anzuschauen, um typische Erfolge und Misserfolge, aber auch typische Konflikte und deren Bearbeitung im Berufsfeld darzustellen und zu untersuchen. Zunächst beziehen sich die Ergebnisse auf den Einzelfall eines ausgewählten sozialen Brennpunktes, einer Großwohnsiedlung der 70er Jahre mit einer langen Tradition der Kooperation unter sozialen Fachkräften. Über den Vergleich mit der Fachliteratur wird aufgezeigt, welche Aspekte der Vernetzung bzw. Zusammenarbeit auf andere Städte und Gemeinden übertragbar sein könnten. Die Wahl fiel auf die AG Kinder- und Jugendarbeit Vahrenheide als stadtteilbezogenes Gremium. Einmal im Monat treffen sich unter diesem Namen Fachleute der Kinder- und Jugendarbeit, um ihre Arbeit im Stadtteil zu koordinieren und gemeinsam neue Projekte anzuregen. Sie organisieren Veranstaltungen, wie z.B. Kinder- und Stadtteilfeste, Ferienfreizeiten, Aktionen für Mädchen, öffentliche Diskussionen und Fortbildungen. Es handelt sich um eine aktive Arbeitgemeinschaft mit 21 Einrichtungen, die über den internen fachlichen Austausch hinaus nach außen handlungsorientiert arbeitet. Neben den kommunalen Einrichtungen (*) sind auch MitarbeiterInnen von Vereinen und Verbänden vertreten: Tabelle 2: Interviewte AG-TeilnehmerInnen nach Institutionen 2 Kirchengemeinden Kath. Kirchengemeinde Ev. Kirchengemeinde 2 Stadtteilkultur-/Gemeinwesenarbeit Kulturtreff (Verein) Kommunale Gemeinwesenarbeit* 2 Kindertagesstätten Hort (AWO) Kita (AWO) 3 Jugendpflege Spielpark* Jugendzentrum* Spielmobil (AWO) 18 2.3 AUSWAHL 6 Sozialdienst/Beratung/Betreuung Kommunaler Sozialdienst* Jugendpsychologischer Dienst* Erziehungsbeistände* Jugendgerichtshilfe* Tagesgruppen* Einzelbetreuung (Ev. Jugendhilfe) 2 Jugendsozialarbeit Berufsorientierung (Verein) Streetwork (AWO) 4 Schulsozialarbeit/Schule Schulsozialarbeit Grundschule Schulsozialarbeit IGS Schulsozialarbeit Gymnasium Orientierungsstufe (*kommunale Einrichtungen) Die interviewten 26 AG-TeilnehmerInnen (N=26) aus 21 Einrichtungen gehören in der Mehrheit den Berufsgruppen ErzieherInnen (5), SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen (18, davon sechs gleichzeitig ErzieherInnen) an. Ebenfalls in pädagogischen Berufen tätig sind ein Religionspädagoge, eine Diakonin und eine Lehrerin. Es nahmen 18 Frauen und acht Männer an den Interviews teil. Die Auswahl der acht Entscheidungsträger (N=8) erfolgte mit dem Ziel, die Akzeptanz und Wirkung dieser Arbeit im kommunalpolitischen Kontext zu überprüfen. Die Ausgewählten tragen in der Stadt Hannover politische und fachliche Verantwortung für Entscheidungen über Kinder- und Jugendarbeit. Mit diesen Personen, vor allem aus (1.) dem Jugendamt, (2.) dem Bezirksrat und (3.) dem Stadtrat hatte die AG häufiger zu tun, wenn sie Projekte entwickelte, Gelder beantragte oder Rechenschaft über ihre Arbeit ablegte. Es wurde Wert darauf gelegt, dass VertreterInnen der Mehrheitsfraktionen vertreten waren, dass Männer und Frauen zu Wort kamen und dass SozialarbeiterInnen und andere Fachleute, also verschiedene Berufsgruppen 0in Leitungs- und Entscheidungsverantwortung vertreten waren. 19 2. DAS FORSCHUNGSPROJEKT Abbildung 1: Schnittpunkte mit den politischen und administrativen Strukturen Schnittpunkte mit den politischen und administrativen Strukturen AG Kinder- und Jugendarbeit Vahrenheide arbeitet für ca. 3.200 junge Menschen im Stadtteil Vahrenheide benötigt Zusammenarbeit bei: Behandelt alle Themen, stadtweit •Entscheidungen über Bauvorhaben und Finanzen (Personal, Ausstattung) Jugendhilfeausschuß ca. 145.000 Kinder/Jugendliche/Junge Volljährige (Junge Menschen, 0-26 Jahre) Behandelt alle Themen junger Menschen, stadtweit •Jugendhilfeplanung (Beschlüsse) •Grundsatzentscheidungen •Beihilfen Jugendamt Bearbeitet Themen junger Menschen, stadtweit •Jugendhilfeplanung (Vorlagen) •Umsetzung politischer Beschlüsse •Fachberatung •Arbeitgeberfunktion der Stadt •Planung/Abstimmung im Stadtbezirk Rat der Stadt ca. 518.000 Einwohner Vernetzte Dienste (13 in Hannover) Vernetzter Dienst städt. Mitarbeiter im Stadtbezirk Bothfeld-Vahrenheide Bearbeitet Themen zu jungen Menschen, Gesundheit, Bildung, Kultur, Soziales im Bezirk Bezirksräte Bezirksrat BothfeldVahrenheide ca. 48.000 Einwohner ca. 15.000 junge Menschen Behandelt Themen aus allen Bereichen im Stadtbezirk (5 Stadtteile) (13 in Hannover) •Öffentliche Diskussion •Anträge an den Rat •Beihilfen (1) Die vier Leitungskräfte in der Verwaltung sind HochschulabsolventInnen der Sozialarbeit oder vergleichbarer Disziplinen, wie z.B. Pädagogik, Soziologie. Sie übten Tätigkeiten aus, mit der sie innerhalb der Hierarchie der Position einer Abteilungsleitung entsprachen. Eine Person nahm Planungs- und Koordinationsaufgaben in einer Stabsstelle wahr. Alle Interviewten waren in stadtweite Planungs- und Entscheidungsprozesse einbezogen, drei davon im Bereich der öffentlichen Jugendhilfe. Über den Jugendhilfeausschuss waren sie nach § 71 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) befasst mit „der Erörterung aktueller Problemlagen junger Menschen und ihrer Familien sowie mit Anregungen und Vorschlägen für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe, der Jugendhilfeplanung und der Förderung der freien Jugendhilfe“ (BMFSFJ 1999b, 74). (2) Die BezirksratspolitikerInnen gehörten keinem Sozialberuf an. Ihre Aufgaben sind unter „Beachtung der Belange der gesamten Stadt“ folgende: Entscheidungen über die „Unterhaltung, Ausstattung und Benutzung der im Stadtbezirk liegenden öffentlichen Einrichtungen“, „Festlegung der Reihenfolge“ von Bauarbeiten an Wegen und Straßen, „Pflege des Ortsbil20 2.4 ZUM FORSCHUNGSDESIGN des“ und der Grünanlagen, „Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Vereinigungen im Stadtbezirk“, „Förderung und Durchführung von Veranstaltungen der Heimatpflege und des Brauchtums sowie Pflege der Kunst“, Pflege von Patenschaften, Märkte, Repräsentationen, Information und Dokumentation zum Stadtbezirk. Der Stadtbezirksrat hat das Entscheidungsrecht über den oben geschilderten eigenen Wirkungskreis. Bei allen anderen Fragen des übertragenen Wirkungskreises steht ihm ein Anhörungs- und Vorschlagsrecht gegenüber dem Stadtrat zu, wenn das Interesse des Stadtbezirks berührt wird (vgl. Thiele 1997). Insbesondere der eigene Etat des Bezirksrats, mit einem Haushalt von ca. 100.000 DM, bewegt viele soziale Fachkräfte zur Zusammenarbeit und Antragsstellung. Zusätzlich sind entsprechend der Einwohnerzahl (1 DM pro Einwohner) 48.000,– DM für die ökologische Spielplatz- und Spielflächenerneuerung unter Beteiligung von Kindern bereitgestellt. (3) Die RatspolitikerInnen für Kinder und Jugendliche von den Mehrheitsfraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen waren gleichzeitig im Jugendhilfeausschuss vertreten. Dort werden alle Themen, die Kinder und Jugendliche in der Stadt angehen, behandelt und beschlossen. Der Finanzrahmen umfasst ohne Personalausgaben 51,2 Millionen DM (3,2%) des städtischen Haushalts, während im Vergleich die Sozialhilfeleistungen 23,5% ausmachen (vgl. Hannoversche Allgemeine Zeitung, 22.2.2002). Eine Kommission bereitet diese Themen vor. Bereits im Vorfeld von Entscheidungen wird die Ausschussarbeit in Arbeitsgemeinschaften vorbereitet. Hier gibt es beispielsweise einen Austausch zwischen den Bereichen Bau, Schule, Finanzen und Jugend. Der Kinder- und Jugendhilfebereich wird als „weiter Bereich“ angesehen aufgrund der verschiedenen Altersgruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, verschiedenen Formen der Betreuung und Hilfen, insbesondere der große Bereich „Hilfe zur Erziehung“, der eine Vielzahl aktueller Problemlagen auffangen muss (vgl. Experteninterview 7, S.1). 2.4 ZUM FORSCHUNGSDESIGN In diesem Forschungsprojekt wird der Begriff Praxis weit gefasst. Die Untersuchung richtet sich nicht nur an die MitarbeiterInnen der Institutionen, sondern auch an Fachleute außerhalb der genannten Einrichtungen, die an Entscheidungen beteiligt sind. Einbezogen sind die Arbeitsaufträge der In21 2. DAS FORSCHUNGSPROJEKT stitutionen und deren Möglichkeiten, sich an Kooperationen zu beteiligen, sowie die Folgen einer Kooperation für die Tätigkeit der Beschäftigten und die Bedeutung für ihre Praxis. Über die reine Wirkungsanalyse hinaus, die häufig von den Trägern in Auftrag gegeben wird, sind für die Praxis andere Fragen relevant, die in dieser Praxisforschung (vgl. Filsinger; Hinte 1988, 44) berücksichtigt werden. Die Voruntersuchung soll einerseits zusammentragen, welche Berichte und Gutachten bisher über den Stadtteil erstellt wurden und welche Themen dort vorkommen. Andererseits sollen typische Strukturen im Stadtteil anhand der relevanten Sozialdaten aufgezeigt werden. Die Entwicklung der Praxis der Sozialen Arbeit soll insbesondere durch Dokumentationen, Protokolle und die sogenannte „graue Literatur“ ausgewertet werden. Die Untersuchung ist als Kontext- und als Prozessforschung angelegt. In der Kontextforschung werden die strukturellen Bedingungen der Praxis in 21 Einrichtungen einer Arbeitsgemeinschaft (AG) erhoben, insbesondere deren Auftrag, Selbstverständnis und Selbstbild und Sichtweisen über den Stadtteil, ferner die Ausstattung, das Fachwissen und die inhaltliche Ausrichtung bzw. das Selbstverständnis der Mitarbeiterinnen. Dabei soll die Bearbeitung von Vorhaben durch Vernetzung bzw. Kooperation als Teil der gesamten Praxis dieser Einrichtung erscheinen. Außerdem wurden die relevanten Felddaten erhoben, so zum Beispiel Strukturdaten, lebensweltliche Charakterisierung des Stadtteils, Fremdbild der Einrichtungen bei Entscheidungskräften der Kommunalpolitik sowie deren Erfahrungen in der Kooperation mit der AG. Dazu dienen Interviews mit Fachleuten in Politik und Verwaltung. In der Prozessforschung wurde der Verlauf des Arbeitsprozesses zweier Kooperationsprojekte der 21 Einrichtungen untersucht, wovon eines, die Zukunftswerkstätten für Kinder und Jugendliche, hier vorgestellt wird. Über den Zeitraum von zwei Jahren wurden Aktionen, Veranstaltungen, Gruppen bzw. Zusammenkünfte ausgewählt und (vorwiegend mit dem Verfahren der Teilnehmenden Beobachtung und des Leitfaden-Interviews) begleitet. Ziele, Arbeitsweisen und Ergebnisse, aber auch Bewertung und Einschätzung von den Fachleuten sind dazu erhoben worden. Leitfaden-Interviews mit den MitarbeiterInnen der 21 ausgewählten Einrichtungen über ihr Arbeitsfeld bzw. den Kontext sowie mit Schlüsselpersonen des Untersuchungsfeldes legen zu Beginn die Komplexität des Arbeitsfeldes mit seinen horizontalen und vertikalen Strukturen offen. Teilnehmende Beobachtung fand bei ausgewählten Praxisteilen statt, so dass Selbst- und Fremdverstehen thematisiert werden können. In Einzel- und Gruppeninterviews 22 2.4 ZUM FORSCHUNGSDESIGN Abbildung 2: Die Forschungsstruktur im Überblick Phasen und Ebenen des Forschungsprojekts Prozessforschung Phase 4 Begleitung Teilnehmende Beobachtung Phase 1 Kontakt und Absprachen Phase 2 Innensicht (Selbstbild) Phase 3 Aussensicht (Fremdbild) Kontakt Information über Praxisforschung • 21 Interviews mit TeilnehmerInnen der AG (N=26) Zwischenbericht • 7 Interviews mit Politik und Verwaltung (N=8) Zwischenbericht Vereinbarung Diskussion Diskussion Sammlung von Strukturdaten Protokoll Protokoll Phase 5 Begleitung • Teilnehmende Beobachtung und • Interviews zur Sitzungsstruktur und zu 2 Projekten Jan.-Juli 98 Aug. 98-Febr. 99 Vorläufiger Abschlussbericht Diskussion Protokoll Zwischenberichte Diskussionen Protokolle Abschlussbericht Kontextforschung Okt.-Dez. 97 Phase 6 Abschluss März-Juli 99 Aug.-Sept. 99 vertiefen sich in der Schlussphase der Forschung bestimmte Fragestellungen zur Projektentwicklung. Hierdurch ist es möglich, einen detaillierteren Zugang zu komplexen Fragestellungen zu erhalten. Die Erhebungsmethoden wurden dem Forschungsprozess angepasst (Methodentriangulation) und die Zwischenergebnisse an die Praxis zurückgekoppelt (kommunikative Validierung). Das ist ein wesentliches Kennzeichen der Praxisforschung. Nicht erst am Ende legen PraxisforscherInnen den PraktikerInnen die erhobenen Daten, Deutungen und die Interpretationen vor. Die PraktikerInnen können ihrerseits zu dem Stellung nehmen, was die ForscherInnen gesehen, gezählt, gehört und verstanden haben. Aus dieser Rückmeldung gewinnen die ForscherInnen weitere Einsichten über Denk- und Arbeitsweisen der Praxis. Dadurch ist Praxisforschung „eine Art Begleitforschung bzw. praxisbegleitender Forschung und damit auch eine Form der Intervention in Praxis“ (Filsinger; Hinte 1988, 43). Die PraktikerInnen werden hineingezogen in einen Prozess der von der Forschung angeregten Aufklärung. In diesem Sinn kommt Praxisforschung in die Nähe der Praxisberatung. Nicht, dass die PraxisforscherInnen den PraktikerInnen raten könnten, wie diese zu handeln hätten. Die Differenz bleibt, anders als bei der Aktionsforschung, bestehen: Die PraxisforscherInnen forschen, entlastet von Handlungsdruck. Die PraktikerInnen behalten die Verantwortung für ihr Handeln. Aber sie werden angeregt, deren Bedingungen, Routinen, Hypothesen und Widersprüche zu überprüfen. 23 2. DAS FORSCHUNGSPROJEKT Tabelle 3: Schematische Darstellung der Forschungsebenen und zentralen Erhebungen Forschungsebene Kontextforschung Prozessforschung Erkenntnisleitende Frage Wie, unter welchen Bedingungen und mit welchem Ergebnis arbeiten Fachleute der Sozialen Arbeit im Stadtteil zusammen? Wie, unter welchen Bedingungen und mit welchem Ergebnis arbeiten Fachleute der Sozialen Arbeit im Stadtteil zusammen, nachdem sie Selbst- und Fremdbild reflektieren und diskutieren konnten? Untersuchungen 1. Leitfaden-Interviews mit Fachleuten der AG 2. Leitfaden-Interviews mit Entscheidungsträgern 3. Fokussierte Interviews mit AG-SprecherInnen 4. Auswertung der Sozialdaten und der vorhandenen Untersuchungen 1. Teilnehmende Beobachtung der Sitzungen 2. Leitfaden-Interviews zu ausgewählten Fragestellungen 3. Untersuchung der Intervention im Forschungsprozess Zentrale Untersuchungsmethode Leitfaden-Interview Teilnehmende Beobachtung Ergänzende Erhebungsmethoden Soziogramm Gruppendiskussions-verfahren Dokumentenanalyse Befragung Forschungstagebuch Leitfaden-Interview Die ersten Ergebnisse der Forschung belegen: Die Fachleute der Sozialen Arbeit sind dergestalt miteinander vernetzt, dass sich innerhalb der AG stabile Kooperationsbeziehungen herausgebildet haben. Die AG Kinder- und Jugendarbeit vernetzt einen großen Bereich sozialer, pädagogischer und kultureller Arbeit miteinander, der auf der städtischen Ebene in viele Fachbereiche, Abteilungen und Zuständigkeiten aufgeteilt wird. In der AG Kinder- und Jugendarbeit werden folgende Arbeitsbereiche miteinander in Verbindung gebracht und können so miteinander kooperieren: 24 2.4 ZUM FORSCHUNGSDESIGN Tabelle 4: Übersicht der untersuchten Arbeitsbereiche Stadt Vereine und Verbände Kindertagesstättenarbeit Kindertagesstättenarbeit Land Sozialdienst Erziehungshilfe Erziehungshilfe Schulsozialarbeit Heimverbund Jugendsozialarbeit Jugendzentrumsarbeit Jugendverbandsarbeit Erziehungsberatung Religionspädagogische Arbeit Gemeinwesenarbeit Kulturarbeit Schulpädagogik Es gibt in der AG durchaus Unterschiede und Abstufungen hinsichtlich der Verbundenheit, den Erfahrungen in gemeinsamer Projektpraxis und den thematischen Überschneidungen. Einfluss auf die Zusammenarbeit haben: Dauer der Tätigkeit im Stadtteil, festgelegte Schwerpunkte, Arbeitszeiten, Leitungs- und Organisationsstruktur des Trägers. Besonders förderlich für die Vernetzung waren Erfolge bei gemeinsamen Aktionen sowie persönliche Sympathien und Vergleichbarkeit der Arbeitsansätze. In der AG gelang eine Zusammenarbeit von der Planung bis zur Umsetzung konkreter Projekte, wie z.B. Drogenprävention, Ferienfahrten, Sommeraktionen, Abendsport und Zukunftswerkstätten. Zur Umsetzung bildeten sich aus der AG heraus Teams für vereinbarte Zeiträume und ausgewählte Aufgaben. Es gelang über die Grenzen von Trägerschaften und üblicherweise strikt aufgeteilten Fachbereichen (Jugendverbandsarbeit, Kinder- und Jugendarbeit, Erziehungshilfe) mit den jeweiligen Finanzmitteln hinweg eine gemeinsame Praxis der Sozialen Arbeit im Stadtteil zu entwickeln. Die Projekte waren insoweit erfolgreich, wie die TeilnehmerInnen der AG Einfluss nehmen konnten und ihre Vorhaben selbst steuerten. Dann bewältigten sie die gestellten Aufgaben mit großem Engagement. Anregungen und Kritik von Externen wurden akzeptiert, wenn ihnen die Personen vertraut waren oder der Kontakt von einer Haltung der Wertschätzung geprägt war. Neue Mo25 2. DAS FORSCHUNGSPROJEKT delle oder Handlungsempfehlungen wurden integriert, soweit wichtige Routinen erhalten blieben und keine Überforderung entstand. Das bedeutet, dass kontinuierliche Kooperationsbeziehungen sowohl intern als auch extern förderlich sind, um eine fachliche Auseinandersetzung anzuregen und Veränderungen zu bewirken. Andererseits lässt sich auch feststellen, dass diese erfolgreiche Kooperation von Fachleuten der Sozialen Arbeit nur bedingt anderen Fachkräften gegenüber geöffnet wurde. Zu fragen ist, ob eine gute interne Vernetzung und Verbundenheit der AG eine starke Abgrenzung nach außen erfordert? Wie und in welcher Form kann es den AG-TeilnehmerInnen gelingen sich gegenüber Fachleuten mit Leitungsfunktionen, PolitikerInnen oder anderen Professionen (Stadtplanungsamt, Polizei, Grünflächenamt), aber auch gegenüber neuen Ideen und Arbeitsweisen zu öffnen? Die gute innere Vernetzung findet sich nicht wieder beim Austausch zu Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung. Allerdings ist das Ansinnen der Außenstehenden nicht immer durchsichtig und es stellt sich die Frage, wer will wen, mit welchem Interesse, zu welchem Zweck vernetzen? Eine Abgrenzung scheint verständlich, denn der AG stellen sich intern genügend Anforderungen, zunächst die vielen Arbeitsbereiche und fachlichen Schwerpunkte zur Kinder- und Jugendhilfe in einer funktionierenden AG zu integrieren. Dennoch sind Fragen zu stellen nach den Voraussetzungen für funktionierende Kooperationen zwischen den Ebenen der Verwaltungshierarchie, den Wohlfahrtsverbänden und der Kommunalpolitik sowie anderen Professionen. 2.5 FORSCHUNGSVERLAUF UND VERZEICHNIS DER PRIMÄRQUELLEN Die Primärquellen sind chronologisch den Erhebungsphasen zugeordnet. Die Leitfaden-Interviews mit PolitikerInnen und Leitungskräften aus Verwaltung sind mit E (=ExpertInnen) bezeichnet. Die Interviews mit den TeilnehmerInnen der AG sind mit F (=Fachkräfte) angegeben. Alle anderen Primärquellen, die den Forschungsprozess begleiten, sind mit V (=Vahrenheide) benannt. Zusätzlich sind alle Notizen und Protokolle unter P aufgeführt, die in den Forschungsprozess einbezogen wurden und wichtige Quellen für Geschichte und Entwicklung der AG-Arbeit darstellen. 26 2.5 FORSCHUNGSVERLAUF UND VERZEICHNIS DER PRIMÄRQUELLEN Tabelle 5: Forschungsverlauf Phase 1 V1 13.11.97 • Gespräch über Fragestellungen, Forschungsmethoden und Forschungsansatz mit der AG Kinder- und Jugendarbeit V2 11.12.97 • Absprachen und Vereinbarung mit AG V1-2 13.11.97 und 11.12.97 • Erwartungen und Befürchtungen zum Forschungsprozess Phase 2 Phase 4 • 21 Interviews/ Kurzbefragungen mit 26 TeilnehmerInnen der AG, jeweils in ihren Einrichtungen • Teilnehmende Beobachtung an den monatlichen AGSitzungen von 11/97 bis 9/ 99 und Aufnahme in die Verteilerliste der AG F1-21 Jan./Febr. 98 V3 14.2.98 • Teilnehmende Beobachtung an der Fortbildung zu Methoden der Zukunftswerkstatt v. 12/13.2.98 V4 8.5.98 • Teilnehmende Beobachtung und Fotodokumentation über Begehung von 10 Spielplätzen am 4.5.98 (zur Auswahl für eine Zukunftswerkstatt mit Kitakindern) V5 4.6.98 • Zwischenauswertung der 21 Interviews V6 27.7.98 • Gruppendiskussionen (11.6. und 16.7.) über das Selbstbild, das Wissen und die Einschätzungen in der AG V7 20. 5.98 • Gruppeninterview zur Geschichte der AG Kinderund Jugendarbeit mit Gründungsmitgliedern 27 2. DAS FORSCHUNGSPROJEKT V8 10.9.98 • Strukturierte, teilnehmende Beobachtung an einer AG-Sitzung V9 12.11.98 • Gruppeninterview mit den SprecherInnen zweier Zukunftswerkstätten über deren Erwartungen, Ziele und Planungen Phase 3 E1-7 Okt./Dez 98 • 7 Leitfaden-Interviews mit 8 Personen aus Politik und Stadtverwaltung über die AG-Arbeit, Kooperationsformen und Erwartungen an die AG V10a 10.12.98 • Kurzbefragung in der AG zu Einschätzungen und Erwartungen gegenüber Politik und Verwaltung V10b 10.12.98 • Zum Forschungsprozess: Befragung in der AG zur Rolle des Forschers V16 29.7.99 Zwischenbericht Phase 5 Phase 5 V11 14.1.99 • Zwischenauswertung der 7 Interviews und der Kurzbefragung V12 15.2.99 • Gruppendiskussionen (14.1. und 11.2.99) über das Fremdbild der AG anhand der Zwischenauswertung V11 V13 24.2.99 • Teilnehmende Beobachtung beim Projekt Abendsport am 13.2.99 V14 22.3.99 • Gruppeninterview mit AG-SprecherInnen am 15.3.99 zu Arbeitsgemeinschaften in Vahrenheide als Arbeitsform der Sozialen Arbeit V14a 30.3.99 • Interview mit einer AGSprecherin über ihre AG 28 2.5 FORSCHUNGSVERLAUF UND VERZEICHNIS DER PRIMÄRQUELLEN V15 7.6.99 • Interview als Vertiefung mit AG-SprecherInnen über die Beteiligung von BewohnerInnen und die Funktion der AGs V16 29.7.99 • Abschlussbericht V17 9.9.99 • Protokoll über die ruppendiskussion zum Abschlussbericht V18 10.9.99 • Zum Forschungsprozess: Erfahrungen mit der Forschung, Veränderungen in der AG und bei den Einzelnen V19 13.9.99 • Diskussion mit dem Team einer Einrichtung (der AG) über die Konkurrenz der zusätzlichen Veranstaltungen im Rahmen des Stadtteildialogs V20 27.9.99 • Gespräch mit einer Leitungskraft des Jugendamtes über ihre Funktion in der Stadt Hannover und beim Stadtteildialog Phase 6 Tabelle 6: Primärquellen Protokolle/Notizen/Dokumente P1 1993-1999 Protokolle der Sitzungen (AG Kinder- und Jugendarbeit Vahrenheide) P2 10/97-9/99 Zweijahresübersicht über die Aktivitäten und Diskussionsthemen der AG P3 1995-1997 Konzepte, Papiere, Drucksachen zum Mitternachts- bzw. Abendsport P4 10/97-9/99 Protokolle über die Zukunftswerkstätten P5 10/97-9/99 Notizen über Kontakte und Kurzgespräche P6 10/97-9/99 Feldnotizen/Beobachtungen im Stadtteil P7 10/97-9/99 Reflexion über das Erleben im Forschungsprozess und die Rolle als Forscher P8 1986-1997 Protokolle des Gesprächskreises Wohnumfeldverbesserung P9 1991-1999 Materialien zum Reformprojekt „Vernetzte Dienste“ P10 10/97-9/99 Memos und Zwischenauswertungen 29 3. Theoretische Bezüge 3.1 LEBENSBEDINGUNGEN IN SOZIALEN BRENNPUNKTEN 3.1.1 Gesellschaftlicher Wandel und allgemeine Lebensbedingungen Beck hat bereits 1986 die allgemeine Entwicklung der Gesellschaft mit dem Begriff der „Risikogesellschaft“ bezeichnet. Es ist bis heute umstritten, ob, wie er meint, sich Klassen und Schichten auflösen und zunehmend gesellschaftlich produzierte wissenschaftlich-technische Risiken der Produktion, Definition und Verteilung im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion stehen (vgl. ebd. 25). Giddens kritisiert Becks Thesen, weil sie vorgeben, frühere vormoderne Gesellschaften wären mit weniger oder keinen Risiken konfrontiert gewesen. Er sieht Risiken eher in der Verflechtung des individuellen Lebens mit der globalen Zukunft (vgl. ebd. 1992, 27). Die Ergebnisse von Handlungen erweisen sich als zunehmend schwerer vorhersehbar, weil sie mit Risiken (sowohl individuellen als auch globalen) und einer Zunahme an Reflexivität verbunden sind. „Die Ausdehnung globaler Interpendenzen führt zu einem ihr entgegengesetzten Effekt – der Akzentuierung lokaler Identitäten“ (Giddens 1992, 30). Es ist für den Einzelnen nicht mehr klar ersichtlich, was die eigenen Handlungen noch bewirken, ob sie Gegebenheiten beeinflussen und verändern können oder sie sich letztlich gegen das Individuum selbst richten. Zwei gegenläufige gesellschaftliche Entwicklungen treffen aufeinander: Unübersichtlichkeit und Komplexität der Gesellschaft erfordern einen Überblick, der kaum zu erreichen ist. Dennoch muss das Individuum sich in der Lebenswelt als Handelnder und Gestalter seines Lebens verstehen. Die Einzelnen müssen lokale Bedingungen berücksichtigen, obwohl globale Kräfte wirken. Das Leben mit seinen alltäglichen Anforderungen ist zu bewältigen; das erfordert eine Vielzahl von Entscheidungen, für die es immer weniger gesellschaftliche Orientierung gibt. Thiersch hat diese gesellschaftliche Entwicklung auf die Soziale Arbeit übertragen und daraus besondere Anforderungen für die Berücksichtigung des Alltags entworfen (vgl. ebd. 1992). Die Wirtschaft in Europa und anderen Industriestaaten verändert sich durch Rückgang der zwei Sektoren Produktgewinnung und Produktverarbeitung sowie durch eine Ausweitung des dritten Sektors der Dienstleistungen. 2000 betrug in Deutschland der Anteil der Erwerbstätigen im Dienstleis30 3.1 LEBENSBEDINGUNGEN IN SOZIALEN BRENNPUNKTEN tungssektor 68,1% und in der Produktverarbeitung 29,3 und der Produktgewinnung 2,5% (vgl. Institut der deutschen Wirtschaft 2001, 13). Die wirtschaftlichen Veränderungen in der Bundesrepublik führten in bestimmten Branchen zu einem Wachstum. Doch nicht alle Bevölkerungsgruppen konnten davon profitieren. Der Anteil der Arbeitsplätze ging etwa in der Land- und Forstwirtschaft und auch in Handwerk und Industrie zurück. Der Verlust von Arbeitsplätzen traf besonders ArbeiterInnen ohne Schul- und Berufsabschluss. Insgesamt ist eine Steigerung des Lebensstandards festzustellen, die jedoch mit einer Ungleichheit bei Einkommen und Besitz und den Lebenschancen verbunden ist. Die Einkommens- und Verbraucherstichprobe (EVS) ergab 1998 in den alten Bundesländern ein durchschnittliches monatliches Haushaltsnettoeinkommen von 5254 DM. Ein Anteil von 12% der Bevölkerung lag unter 2000 DM und 46% zwischen 2000 und 5000 DM (vgl. Hauser 1998, 164). Die Einkommensungleichheit stellt eine sozialpolitische Herausforderung dar, zumal bestimmte Bevölkerungsgruppen in besonderem Maß davon betroffen waren. „Bestimmte Gruppen und Quartiere verfügen aber über eine geringere Dynamik, werden also von der Entwicklung des gesellschaftlichen mainstreams zunehmend abgekoppelt, bleiben als Verlierer gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse zurück“ (Froessler 1994, 14). Wirtschaftliche Umstrukturierungen, kulturell-gesellschaftliche Veränderungen, politische Entscheidungen, Flucht und Vertreibung, internationale Wanderung und Schwächung des Systems der sozialen Sicherung werden als Ursachen für diese Entwicklung genannt (vgl. Dangschat 1993; vgl. Froessler 1994; vgl. Hanesch 1994). Der Wegfall von Fach- und AnlernArbeitsplätzen in der industriellen Produktion, besonders in krisenanfälligen Branchen, führt zu hoher Arbeitslosigkeit in den unteren Bildungsschichten. Die Konkurrenz auf den Arbeitsmärkten stellt höhere Anforderungen an die schulische und berufliche Ausbildung. 3.1.2 Stadtteile als soziale Brennpunkte und Armutszonen Soziale Brennpunkte gibt es in nahezu jeder größeren Stadt Deutschlands. Sie sind Ausdruck einer räumlichen Segregation der Armutsbevölkerung durch die Lage und Verteilung von Sozialwohnungen und der Angebote auf dem Wohnungsmarkt. Typische Brennpunkte waren in der Vergangenheit die Obdachlosensiedlungen an den Rändern der Städte. Dort stellten Kommunen Wohnräume minderer Qualität bereit, um wohnungslose Familien 31 3. THEORETISCHE BEZÜGE unterzubringen. Für allein stehende Personen wurden Wohnheime errichtet. In den 1960er und 70er Jahren waren es Altstadt- oder citynahe Arbeiterquartiere, die durch alte Bausubstanz, hohe Bebauungsdichte und mindere Wohnausstattung zu Sanierungsgebieten wurden und erst dadurch eine Aufwertung erfuhren. Mittlerweile sind die Großwohnanlagen der Trabantensiedlungen zu sozialen Brennpunkten geworden. Der Deutsche Städtetag formulierte dazu folgende Definition: „Soziale Brennpunkte sind Wohngebiete, in denen Faktoren, die die Lebensbedingungen ihrer Bewohner und insbesondere die Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen negativ bestimmen, gehäuft auftreten“ (Deutscher Städtetag 1979, 12). Als typische benachteiligte Stadtviertel benannte 1987 der Deutsche Städtetag: Altbauten in früheren Arbeiterwohngebieten, Schlichtwohnungen der späten 40er oder der 50er Jahre und Großsiedlungen der späten 60er, der 70er und 80er Jahre (vgl. ebd.). Die Zusammensetzung der Bewohnerschaft war in allen Gebieten vergleichbar hinsichtlich des Anteils an Sozialhilfeempfängern, Arbeitslosigkeit, niedriger Bildung und Folgen von Migration. Im Vergleich zu gewachsenen Stadtteilen traten in Großsiedlungen die Probleme massiver auf und konnten wegen der fehlenden wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur nicht aufgefangen werden. Eine Vielzahl von Gründen führte dazu, dass sich diese Gebiete nicht so recht im Sinne der Stadtplaner entwickelten. Desintegrationsprozesse vollzogen sich durch Abwanderung ökonomisch starker Bevölkerung mit Nachzug ökonomisch schwächerer Schichten, durch Kumulation sozialer Probleme (fehlende Infrastruktur, Arbeitslosenquote, Sozialhilfebezug, randständige Wohnlage, Umweltbedingungen) oder durch Strukturwandel mit wirtschaftlicher Benachteiligung ganzer Regionen (vgl. Oelschlägel 1986, 13). In den 1960er und 70er Jahren waren viele PlanerInnen und PolitikerInnen noch davon überzeugt, neue Sozialwohnungen würden nicht nur Wohnungsprobleme lösen, sondern auch zum Abbau sozialer Probleme insgesamt beitragen (vgl. ebd.). Bei der Entstehung der Trabantensiedlungen fehlte jedoch zunächst die notwendige soziale Infrastruktur fast vollständig (Kindertagesstätten, Schulen, Treffpunkte, Freizeitstätten, Beratungsstellen etc.). Proteste und Forderungen von BewohnerInnen und sozialen Organisationen in den 70er und 80er Jahren führten häufig erst nach lange anhaltendem öffentlichem Druck zu Erfolgen, sodass notdürftig nachgebessert wurde. Auch die Differenzierung der Kinder- und Jugendhilfen sowie der gesetzliche Anspruch auf Kindertagesstättenplätze seit den 32 3.1 LEBENSBEDINGUNGEN IN SOZIALEN BRENNPUNKTEN 90er Jahren ergänzten die Einrichtungen in den belasteten Stadtteilen (vgl. Roth 1999). Familien mit Kindern finden zunehmend schwieriger geeigneten Wohnraum zu erschwinglichen Preisen in einer Umgebung, die als kinderfreundlich bezeichnet werden kann (vgl. Hauser 1995). Armut von Kindern und Jugendlichen wird in dreifacher Hinsicht als problematisch angesehen. Strukturell schränken niedrige Einkommen und geringe materielle Ressourcen den Konsum ein, führen zu hoher Verschuldung, schlechter Ernährung, Gesundheitsproblemen, schlechter Wohnraumversorgung und insgesamt zu einem benachteiligenden Wohnumfeld mit eingeschränkten Aktionsräumen. Bildungsspezifisch ergeben sich schlechtere Lernmöglichkeiten und niedrigere Bildungsabschlüsse, und entwicklungspsychologisch entstehen Behinderungen durch Aufwachsen in Haushalten mit belasteten Milieus und Mustern der Lebensbewältigung (vgl. Dangschat 1998, 121). „Die dauerhafte gesellschaftliche Ausgrenzung von Bevölkerungsgruppen schafft ernorme soziale Probleme, gesellschaftliche Spannungen und politische wie wirtschaftliche Folgekosten. Die Suche nach neuen Konzepten zur Überwindung solcher Phänomene ist daher nicht allein eine Frage von gesellschaftlicher Moral und Solidarität, sondern auch von ökonomischer und politischer Vernunft“ (Froessler 1994,17). Als Hauptproblem gilt der hohe Anteil an Sozialwohnungen und damit an Armutsbevölkerung in vielen Großwohnanlagen. Krings-Heckemeier berichtet von einer Studie, die parallel in Ost- und Westdeutschland durchgeführt wurde: „Allein aus der Größe der ostdeutschen Siedlungen wird ihre überragende Bedeutung für die Wohnungsversorgung deutlich: In verschiedenen Städten wohnen bis zu 80% der Bewohner in neu gebauten Großsiedlungen. Eine Konzentration bestimmter Gruppen, wie sie in westdeutschen Siedlungen vorkommt, ist rein statistisch nicht möglich“ (ebd. 1998, 35). Die Bevölkerungsstruktur von Großwohnsiedlungen in Ost- und Westdeutschland unterscheidet sich deutlich voneinander. Die Arbeitslosen in westdeutschen Sozialwohnungen weisen ein geringeres Bildungs- und Qualifikationsniveau auf. Hinzu kommt ein höherer Anteil von MigrantInnen und Aussiedlern. „Überforderte Nachbarschaften“ nennt Krings-Heckemeier die zusammengewürfelte Bewohnerschaft. Die Belegungsbestände sind rückläufig, sodass die weniger Durchsetzungsfähigen in frei werdende Wohnungen vermittelt werden. 33 3. THEORETISCHE BEZÜGE „Je kleiner der Anteil des Sozialwohnungsbestandes, um so mehr werden die Städte gezwungen, nur noch Haushalte, die von einem akuten Wohnungsnotstand betroffen sind, in die Siedlungen einziehen zu lassen. Die Quote der Arbeitslosen oder der Sozialhilfeempfänger erreicht unter solchen Bedingungen Spitzenwerte“ (ebd., 35). Das heißt, es gibt einen Zuzug von Menschen, die nicht mehr in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Alkohol- und Drogenkranke gehören ebenso wie Wohnungssuchende mit psychischen Erkrankungen zum engen Kreis der Bedürftigen. „Viele Mißstände in den Sozialwohnungssiedlungen resultieren aus der Arbeitslosigkeit und der schleichenden Krise des Sozialstaates. Die Makrosozialpolitik wird dominiert von einem wachsenden Mangel, weil die Ansprüche an die Transfersysteme als Folge der Alterung und der Arbeitslosigkeit ständig steigen und die Leistungskraft der Wirtschaft oder der Beitragzahler dahinter zurückbleibt“ (ebd., 38). Die Kommunen allein können die Folgen der Armut in den Siedlungen nicht ausgleichen. Die Probleme benennt Krings-Heckemeier mit der Zersplitterung der angebotenen Dienste, falscher Belegung von Sozialwohnungen, problematischer Sozialarchitektur und Überforderung in der Bewirtschaftung. Die Probleme der Bewohnerschaft führt sie zurück auf: eine allgemeine Überforderung angesichts Problemlagen auf engem Raum, das Zusammenleben von Jugendlichen, besonders arbeitslosen Jugendlichen, das Leben von Sozialhilfe und die Schwierigkeit, der Armutsfalle zu entkommen, arbeitslose Männer und der Alkoholkonsum, Fremdheit bis Feindschaft zwischen Alteingesessenen und Zugezogenen sowie eine Kultur der Lethargie und Feindseligkeit (vgl. ebd.). Diese „begrenzte sozialstrukturelle Heterogenität“ ist der Normalfall in Westdeutschland. Zielvorstellungen der Planer an Mischkonzepte sind kritisch zu sehen (vgl. Herlyn u.a. 1991, 233). BewohnerInnen mit vergleichbaren Lebenslagen können mit öffentlichen Hilfen zur Selbstorganisation gelangen und zur Bewältigung des Lebensalltags ihr lokales Milieu stärken und dann auch Ressourcen entwickeln (vgl. Ebbe, Friese 1989). Besonders für benachteiligte Gruppen ist es von Bedeutung, ob es im Stadtteil soziale Strukturen gibt, die institutionelle und selbstorganisierte, gegenseitige Hilfe ermöglichen. Befragungen belegen, dass honorierte Angebote zur informellen Arbeit im Milieu auch genutzt werden (vgl. Herlyn u.a. 1991, 235). Allerdings steht dem die überwiegende Anrechnung auf die Sozialhilfe entgegen, die wenig Anreiz bietet, selbst geringfügig tätig zu werden. Die 34 3.1 LEBENSBEDINGUNGEN IN SOZIALEN BRENNPUNKTEN Funktionstrennung zwischen Wohnen und Arbeiten erschwert den Zugang zum Arbeitsmarkt für BewohnerInnen am Stadtrand. Die Anforderungen an Ausbildung und Flexibilität im ersten Arbeitsmarkt sind für viele Menschen ohne Bildungsabschlüsse schwer zu erfüllen. Von daher sind lokale Förder- und Beschäftigungsmaßnahmen im zweiten Arbeitsmarkt zu empfehlen, wenn sie den Kreis von Benachteiligten erreichen sollen. 3.1.3 Von sozialen Lagen zu Lebenslagen Um Lebensbedingungen von Menschen in räumlich zusammenhängenden Gebieten zu untersuchen und um Planungsdaten zu erhalten, findet in der Sozial- und Jugendhilfeplanung eine Analyse der Sozialstrukturdaten Verwendung. Dazu werden statistische Daten zur Bevölkerungsentwicklung und Einkommenssicherung herangezogen. Mit Faktorenanalysen werden Belastungsgrade von Wohnquartieren gewichtet, aufeinander bezogen und mit anderen Gebieten verglichen. Mit dieser Analyse lassen sich „soziale Ungleichheiten“ feststellen, und bieten die Grundlagen für eine Finanzund Personalbemessung. Unter „sozialer Ungleichheit“ versteht Hradil „gesellschaftlich hervorgebrachte, relativ dauerhafte Lebensbedingungen, die es bestimmten Menschen besser und anderen schlechter erlauben, so zu handeln, daß allgemein anerkannte Lebensziele für sie in Erfüllung gehen“ (ebd. 1987, 9). Die Betrachtung der „sozialen Lage“, die sich zunächst nur auf die soziale Position (Stellung im Beruf, Erwerbseinkommen, Bildung, Macht) bezieht, wird erweitert. Mit den Strukturdaten werden Lebensziele und Handlungsabsichten in Verbindung gebracht und so vertikale (Stellung im Beruf, Einkommen, usw.) und horizontale Faktoren (Wohn- und Arbeitsbedingungen, demokratische Teilhabe, soziale Absicherung, Gesundheit und Freizeit usw.) zu „Lebenslagen“ verknüpft, z.B. geschlechtsspezifische Aspekte mit Berufswahl und Einkommen, um damit deutlicher die Ungleichheiten innerhalb der sozialen Lagen darzustellen. Zunächst stand der Begriff „Lebenslage“ in einem sozialpolitischen Kontext. Weisser entwickelte 1953 den Begriff und forderte damit eine gesellschaftliche Analyse, aufgrund derer die Sozialpolitik über die materielle Verteilung hinaus allgemeine Lebensumstände in eine Verteilungspolitik einbeziehen sollte. „‚Verteilt‘ wird nicht nur Geldeinkommen. Es handelt sich um alle Umstände der Bedarfsdeckung, in die der einzelne gestellt wird. Verteilt werden Lebenslagen“ (ebd. 1971, 110). 35 3. THEORETISCHE BEZÜGE Nicht nur Einkommen und Vermögen, sondern auch Sicherheit der Lebenshaltung, Selbstbewusstsein durch anerkannte gesellschaftliche Aktivität und Selbstverantwortung bei der Arbeit oder aber Belastungen wie Trennung von der Familie, weite Wege, Gefahren bei der Arbeit etc. werden gesellschaftlich verteilt und sollten in der Sozialpolitik Berücksichtigung finden, wie Weisser meint (vgl. ebd. 111f.). Sozialstrukturanalysen basieren wesentlich auf statistischen Daten, um „objektive“ soziale Lagen zu erheben und sie mit „subjektiven“ intervenierenden Faktoren zu verbinden und darüber sozial relevante Lebensbedingungen zu erfassen (vgl. Hradil ebd., 11). Damit unterscheidet sich diese Art der Analyse von Milieuanalysen (in der Stadtsoziologie), wie Vester u.a. sie vertreten (vgl. ebd. 1993), in denen Lebensstile, Werthaltungen und subjektiven Wahrnehmungen eine stärkere Bedeutung erhalten, weil diese das Alltagsleben und die gesellschaftliche Zusammengehörigkeit bzw. Abgrenzung maßgeblich beeinflussen und für Mesoanalysen z.B. eines Wohnquartiers oder Stadtteils aussagekräftiger erscheinen. Aber auch aus der Sozialen Arbeit gibt es Erklärungsmodelle, um Makro-, Meso- und Mikroebene der Gesellschaft in eine Verbindung zu bringen. Kardorff erweitert den Lebenslagenbegriff, bezieht sich auf die Gesundheitsforschung Baduras (1985) und definiert Lebenslage als allgemeine Lebensbedingungen von denen er typische Formen des Verhaltens wie Lebensweisen oder Lebensstile abgrenzt: „Lebenslage bezieht sich auf die spezifischen, im sozialen Umfeld, angesichts der Arbeitsbedingungen, der Arbeitsmarktlage usw. vorhandenen objektiven Handlungsspielräume sozialer Gruppen, Lebensweise hingegen beschreibt die gesellschaftlich durchschnittlichen, typischen Formen gruppenspezifischen Alltagsverhalten, die Formen der alltäglichen Bewältigung der jeweiligen Lebenslage“ (Kardorff 1988, 76). Der Lebenslagenansatz versucht nicht nur die materielle Verteilung, sondern alle Umstände der Lebensbedingungen zu erfassen und aus den Lebenslagen typischer Bevölkerungsgruppen z.B. die älteren Frauen oder die Alleinerziehenden die Vor- und Nachteile sowie die Handlungsspielräume zu ermitteln und damit auch Dimensionen von sozialer Ungleichheit herauszuarbeiten. Zimmermann sieht die Bedingungen für Lebenslagen mehrdimensional, mit Handlungsspielräumen und deren Grenzen, bezogen auf vorhandene Ressourcen, die tatsächliche und mögliche Versorgung, bezogen auf subjektive Nutzungs- und Handlungskompetenz und bezogen auf kollektive (auch regional bedingte) Rahmenbedingungen (vgl. ebd. 1998, 54). Damit 36 3.1 LEBENSBEDINGUNGEN IN SOZIALEN BRENNPUNKTEN werden die Lebenslagen hinsichtlich ihrer erweiterbaren Ressourcen und Kompetenzen sowie die Individuen bezogen auf ihre Handlungsfähigkeiten und -spielräume betrachtet. Gleichwohl sind Lebenslagen abhängig von den sozioökonomischen Strukturen und damit von Erwerbstätigkeit oder Sozialleistungen, die die Existenzgrundlagen sichern sollen. Risiken wie Arbeitslosigkeit, können zur Bedrohung für die Stabilität der Lebenslagen für Einwohner ganzer Stadtteile werden (vgl. Nohlen 1997, 87f.). 3.1.4 Zum Begriff und zur Theorie der Lebenswelt Lebenswelt beinhaltet die subjektive Ausprägung des individuellen Erlebens bezogen auf ein soziales Feld. Diese Ebene der Betrachtung ist für Fachleute der Sozialen Arbeit sinnvoll, um Handlungsbereitschaft, individuelle Erklärungen von Kindern und Jugendlichen und damit Zugangsweisen und Nutzung von Angeboten zu verstehen. „Unter Lebenswelt lassen sich die subjektiven Interpretationen, sowohl die kognitiven Orientierungen als auch die gefühlsmäßigen ‚Besetzungen‘ des Lebensfeldes durch die verschiedenen dort lebenden Gruppen, ihre Deutungsmuster als Grundlage für ihre ortsbezogenen Identitäten, ihre Ängste, Hoffnungen und Wünsche sowie Handlungsentwürfe verstehen. Lebensfeld umfaßt dabei die objektiv rekonstruierbaren sozialstrukturellen ... und sozialräumlichen ... Infrastrukturen, die Einbindung in spezifische Arbeitsbedingungen und rechtlich-institutionelle Strukturen“ (Kardorff 1988, 75). Der Begriff geht zurück auf die philosophischen Arbeiten Husserls. Schütz und Luckmann haben den phänomenologischen Lebensweltansatz Husserls für die Soziologie übernommen und die „Strukturen der Lebenswelt“ analysiert (vgl. Schütz; Luckmann 1979 und 1984). Dieser theoretische Ansatz vermittelt einen Weg zur empirischen Untersuchung der subjektiven Welt von unmittelbarer Erfahrung. Durch den Blick auf die Subjektivität lassen sich scheinbar unvereinbare Theorieprobleme auflösen. In Konkurrenz dazu stehen die Kommunikationstheorie Habermas und die Systemtheorie Luhmanns. Kritik äußerte Habermas, der sich auf Durkheim bezieht und zwischen System (mit Staat und Wirtschaft) und Lebenswelt (mit Gesellschaft, Kultur und Persönlichkeit) differenziert (vgl. ebd. 1981, 217), fordert eine kritische Gesellschaftstheorie, von der aus ein Diskurs über die subjektive Erfahrung hinaus geführt werden kann. „Die Lebenswelt ist in einem Modus der Selbstverständlichkeit gegeben, der sich nur diesseits der Schwelle grundsätzlich kritisierbarer Überzeugungen erhalten kann“ (Habermas 1981,199). 37 3. THEORETISCHE BEZÜGE Um Lebenswelt zu reflektieren und zu kritisieren, müssen Menschen ihre Lebenswelt historisch und lokal verorten, sich als „kommunikativ Handelnde“ in Begegnungen durch Erzählung und Gespräch zum Kontext der Lebenswelt äußern können (vgl. Habermas 1981, 206). Habermas fragt weiter, inwieweit die von der subjektiven Erfahrung ausgehende Lebensweltperspektive die Chancen auf eine kritische Reflexion der Funktionen von Lebenswelt – kulturelle Reproduktion, soziale Integration und Sozialisation – verstellt. Grundsätzlicher ist die Position Luhmanns, der „Erkenntnis als Konstruktion“ ansieht. Vertreter des radikalen Konstruktivismus zweifeln die Gegenstandsbestimmung in der Wissenschaft an. Es stellt sich die Frage nach der Bestimmung von sozialer Wirklichkeit insbesondere für Phänomene, die das Individuum umgeben (vgl. Welz 1996, 12-13). Inwieweit sind die Lebenswelten Konstruktionen aus Gründen der Selbsterhaltung und konstruieren „soziale Wirklichkeit“ statt sie abzubilden. Welche Rückkopplungsprozesse wirken auf die Lebenswelten von den sie umgebenden Systemen ein? Weiterentwicklungen des Lebensweltbegriffs versuchen die kritischen Punkte aufzugreifen (vgl. Kardorff 1988). Aus der Betrachtung von Lebenslagen und Lebenswelten lässt sich nachvollziehen, unter welchen sozialstrukturellen Bedingungen und in welcher räumlichgebauten Umwelt Kinder und Jugendliche aufwachsen und welche rechtlich-institutionellen Angebote ihnen zur Verfügung stehen. Der Lebensweltansatz bietet Erklärungen, wie die Kinder und Jugendlichen ihre Umgebung sehen und erleben, welche „Handlungsspielräume“ sie entwickeln, ob diese sich erweitern lassen. Im Forschungsvorhaben hat sich als bedeutend herausgestellt, welche Perspektive die Fachleute vor Ort, die PolitikerInnen, die Leitungskräfte der Verwaltung zum Stadtteil und zu Kindern und Jugendlichen einnehmen. Die Analysen differieren und werden nicht miteinander in Verbindung gebracht. Fachkräfte der Sozialen Arbeit sind geradezu gezwungen die Lebenswelten, also die subjektiven Bedeutungsstrukturen herauszuarbeiten, wollen sie durch Beratung, Begleitung, Betreuung oder Netzwerkarbeit auf Lebenslagen einwirken. Statistiken dienen zwar auch als Anhaltspunkte und Orientierung für berufliches Handeln, sinnliche Erfahrungen durch die Summe der Beobachtungen, die Berichte der Betroffenen und die Erfahrungen mit Selbsthilfe und institutioneller Hilfeleistungen und die Reflexion mit FachkollegInnen bieten entscheidende Grundlagen für anschlussfähigere Konzepte. So werden in den selbstorganisierten Netzwerken gemeinwesen- oder stadtteilorientierte Konzepte favorisiert, dagegen werden die Implementierung von Modellen und Konzepten 38 3.1 LEBENSBEDINGUNGEN IN SOZIALEN BRENNPUNKTEN Orts- und Lebensweltunkundiger abgelehnt, weil es eine Vielzahl von Schwierigkeiten für die Ausführenden nach sich zieht, z.B. Fragen nach Glaubwürdigkeit, Authentizität, Vertrauen, Aktualität, Beteiligung, usw. 3.1.5 Handlungsräume von Kindern und Jugendlichen Sozialräumliche Konzepte beziehen sich auf Lebenslagen und Lebenswelten, weil sie „die Entwicklung des Menschen als tätige Auseinandersetzung mit seiner Umwelt, als Aneignung der gegenständlichen und symbolischen Kultur“ verstehen (vgl. Deinet 1999, 29). Es sind sozialökologische Theorieansätze, die stadteilbezogene Konzepte unterstützen und davon ausgehen, dass sich die Handlungsräume von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung vergrößern. Baacke hat das ökologisches Entwicklungsmodell von Bronfenbrenner auf die Jugendarbeit übertragen und unterscheidet in seinem Konzept vier ineinander übergehende ökologische Zonen: „Zentrum, Nahraum, ökologische Ausschnitte, ökologische Peripherie“ (vgl. Baacke 1980, 498-499; Deinet und Sturzenhecker 1996, 10). Daneben wird ein anderes Modell von Helga Zeiher diskutiert, bei dem von Wohninseln als Nahbereich ausgegangen wird, von denen aus andere Inseln, wie Kindergärten, Schulen oder Treffpunkte aufgesucht werden und sich der Handlungsraum im Alltagsleben von Kindern nicht stetig, sondern in einer Inselstruktur erweitert (vgl. ebd. 1999, 51f.). Parallel dazu ist eine „Verhäuslichung“ (vgl. Zinnecker 1990) festzustellen, wodurch die Bewegungen lediglich in von Mauern und Zäunen begrenzten Räumen stattfinden können und daher einseitig feinmotorische Bewegungen gefördert werden. Heiner sieht den sozialökologischen Ansatz mit Verbindungen zur Stadtteil- und Gemeinwesenarbeit als einen Zugang der Sozialen Arbeit zu komplexen Wechselwirkungen diverser sozialer Felder. „Die sozialökologische Rezeption der Systemtheorie konzentriert sich auf die Analyse von verschiedenen Systemebenen und sozialen Feldern kleinerer und mittlerer Größenordnung (Familien, Gruppen, Milieus, Organisationen) bis hin zu größeren institutionellen Kooperationsverbünden (regionale Arbeitsgemeinschaften; ‚Runde Tische‘, Fachverbände) und kann als strukturorientiert charakterisiert werden“ (ebd. 1995b, 525). Davon unterscheidet Heiner den kommunikationstheoretischen Ansatz; dieser bezieht sich „eher auf kleinere Einheiten (Individuen, Familien, peer-groups) und ist stärker prozeß- und kommunikationsorientiert“ (vgl. ebd., 525). 39 3. THEORETISCHE BEZÜGE Die Besonderheit von sozialräumlichen Konzepten ist, dass sie zur Analyse von Lebenslagen und Lebenswelten die Perspektiven von Kindern und Jugendlichen einbeziehen. Dazu nutzt der Ansatz vielfältige abgewandelte Erhebungsmethoden aus der Sozialforschung (vgl. Deinet 1999; Sturzenhecker 1996; Brunsemann u.a. 1997). So können Betroffene sich aktiv daran beteiligen, den Sozialraum und ihre Lebenswelten zu erkunden, zu beschreiben und sich Handlungsräume anzueignen oder zu erweitern. Die Aneignungsdimensionen reichen sogar darüber hinaus und betreffen auch die Erweiterung von Fähigkeiten, die Reaktion auf Situationsveränderungen, die Aneignung sozialer Fähigkeiten und Erfahrungen sowie eine Erweiterung des Verhaltensrepertoires (vgl. Deinet und Sturzenhecker ebd., 13). Für die Konzeptionsentwicklung in der Kinder- und Jugendarbeit bedeutet das eine Vielzahl an Anknüpfungspunkten für Aktivitäten, regelmäßige Angebote und übergreifende Projekte. „Der sozialräumliche Ansatz geht davon aus, daß sich aus dem Zusammenhang zwischen der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und den konkreten ‚Räumen‘, in denen sie leben, Begründungen und Orientierungen der Jugendarbeit ergeben“ (ebd., 9). Auch die Kindheitsforschung betrachtet Sozialisationstheorien kritisch, weil mit Sozialisation zunächst der Prozess gemeint ist, durch den Menschen bestimmte Voraussetzungen erwerben, um auf neue oder veränderte Umweltbedingungen zu reagieren. Entwicklung und Auseinandersetzung als kontinuierlicher Prozess setzt sich als Verständnis von Sozialisation durch. Darüber hinaus ist die „Klärung des Begriffs vergesellschafteter Subjektivität“ erforderlich (vgl. Honig u.a. 1999, 14). Forschung und Sozialpolitik fordern zunehmend die Perspektive und Teilhabe von Kindern. Allerdings ist die Frage, wie eine Kindheitsforschung diese Forderung aufgreifen kann. Welches Wissen können Erwachsene über Kinder in Erfahrung bringen? Dazu schlägt Honig „vier Konzeptionen von Perspektivität“ vor: (1) „die Welt ‚mit den Augen der Kinder‘ wahrzunehmen und diese ‚Perspektive der Kinder‘ zu repräsentieren“; (2) „die Reflexivität der Erwachsenenperspektive, die im Rekurs auf eine ‚Perspektive des Kindes‘ verborgen ist“; (3) das Meadsche Konzept der Kontextualität von Identität, Wissen und Handeln, das zu der These führt, „dass die objektive Realität von Perspektiven in der Unterscheidung von Kindern und Erwachsenen fundiert wird“; und schließlich 40 3.2 VERNETZUNG ALS ANFORDERUNG AN SOZIALE ARBEIT (4) „die generativen Machtunterschiede zwischen den sozialen Kategorien der Erwachsenen und der Kinder festzustellen“ (ebd. 1999, 37f.). Damit entwickelt die Kindheitsforschung Ansätze, um die Machtverhältnisse zwischen Erwachsenen und Kindern, deren jeweilige subjektive Perspektiven und die Kontexte mit jeweiligen Differenzen einzubeziehen. Für handlungstheoretische Ansätze der Sozialen Arbeit können die vier Konzeptionen von Honig eine Orientierung bieten, um sozialräumliche Konzepte zu überprüfen und zu erweitern, weil viele Praxiskonzepte lediglich die Wahrnehmung und Präsentation der „Perspektive des Kindes“ übernahmen und weniger die Verhältnisse von Perspektiven reflektierten. 3.2 VERNETZUNG ALS ANFORDERUNG AN SOZIALE ARBEIT 3.2.1 Zum Verständnis von Institutionen und Organisationen Eine übergreifende Definition bezeichnet Organisationen als „Ordnung von arbeitsteilig und zielgerichtet miteinander arbeitenden Personen und Gruppen“. Gemeint sind damit alle „Institutionen, Gruppen und soziale Gebilde“, die bewusst und auf Dauer auf ein Ziel hinarbeiten und dabei planmäßig und arbeitsteilig vorgehen (vgl. Fuchs-Heinritz u.a. 1994, 478-479). Friedberg wendet sich gegen die allgemein übliche Vereinfachung und Polarisation bei der Betrachtung von Organisationen, die in einen Bereich der „gewollten und eingesetzten Ordnung“ mit „formalisierten, stabilen und klar abgrenzbaren Strukturen“ und einen anderen Bereich von Institutionen, der „mehr oder weniger spontanen sozialen Bewegungen, deren Grenzen ungewiss und deren Strukturen fließend, informal und im Entstehen wären“ eingeteilt werden (ebd. 1995, 4-5). In der vorliegenden Untersuchung kann die Unterscheidung zwischen eingesetzter Ordnung als Organisation mit vorgegebenen Strukturen z.B. Parteien, Stadtverwaltung, Wohlfahrtsverbände und selbstorganisierten, fließenden Strukturen der institutionalisierten Arbeitsgemeinschaft dennoch hilfreich sein, selbst wenn sich Kommunalverwaltungen z.B. durch neue Steuerungsmodelle, Organisationsentwicklung, neue Planungskonzepte, Teamarbeit und ressortübergreifende Netzwerke modernisieren und fließende Strukturen in die Organisation integrieren wollen (vgl. Bassarak 1997). Doch bereits diese übergreifende Definition findet einen Widerspruch durch die neuere Systemtheorie, für die lebende Systeme, also auch Institu41 3. THEORETISCHE BEZÜGE tionen und Organisationen, durch ihre Autonomie und zirkuläre Selbstorganisation gekennzeichnet sind. Damit wird zielgerichtetes Planen und Handeln von Systemen generell in Frage gestellt. Handlungen begründen sich demnach ausschließlich durch die Gesetzmäßigkeiten der Selbsterhaltung von Institutionen und Organisationen (vgl. Luhmann 1985; Maturana, Varela 1990). In einer Kritik der erkenntnistheoretischen Position des radikalen Konstruktivismus weist Heiner darauf hin, dass zwar unser Bewusstsein beim Wahrnehmen und Erkennen die Realität mitgestaltet, allerdings bleibe aus handlungstheoretischer Sicht „menschliches Handeln durch Intentionalität und Intersubjektivität gekennzeichnet“ (vgl. ebd. 1995). Für die Untersuchung von Institutionen und Organisationen würde das bedeuten, dass Handlungsmuster bzw. Handlungslogiken entstehen, die von vielfältigen Motiven und Sinndeutungen bestimmt sind und sich über Aushandlungsprozesse mit der Umwelt, den materiellen Lebensgrundlagen und sozialen Einflüssen durchsetzen. Anhand der Handlungsmuster lassen sich die Einflüsse der Strukturen auf die Subjekte ableiten. In dieser Untersuchung wird auf die Bedeutungsgehalte von Symbolen als Bestandteil von Interaktionen abgehoben, die nach Mead soziales Handeln strukturieren und Verständigung erst möglich machen. Davon würden sich kommunikationstheoretische Analysen unterscheiden, deren Fokus Kommunikation als Steuerungsfunktion ist. Für traditionelle Konzepte mit einer zentralisierten Entscheidungsstruktur dient Kommunikation der störungsfreien Übermittlung der Informationen und damit gleichzeitig einer Verhaltenskontrolle im hierarchischen Gefüge. Neuere dynamische Organisationskonzepte berücksichtigen zwar individuelle Wahrnehmungsunterschiede und Mehrdeutigkeiten, halten aber dennoch am Grundsatz der Kommunikation als Transportmittel von Informationen fest (vgl. Theis 1994, 207-208). 3.2.2 Zum Begriff und zur Entwicklung von Netzwerken Geographische Bilder und Modelle (z.B. Datennetz, Fischernetz oder Spinnennetz) wurden häufiger genutzt, um soziale Beziehungen zwischen Personen und Gruppen anschaulich darzustellen (vgl. Morgan 1997). Damit lassen sich nicht nur Analysen erstellen, sondern auch eigene Überzeugungen abbilden und transportieren. „Das leicht faßbare Bild vernetzter Systeme, Organisationen, Informationen und Menschen eignet sich zur Veranschaulichung komplexer Zusammenhänge 42 3.2 VERNETZUNG ALS ANFORDERUNG AN SOZIALE ARBEIT und als Projektionsfläche gesellschafts- und sozialpolitischer Zielvorstellungen gleichermaßen“ (Kardorff 1995, 402). Der Begriff „Netzwerk“ (Barnes 1954) wurde erstmals in der Untersuchung einer norwegischen Kommune entwickelt und bezeichnete im strukturellen Sinn das soziale Umfeld (Nachbarschaften, Bekanntschaften, Freundschaften), neben der geographischen, politischen und ökonomischen Struktur. „Das Konzept sozialer Netze entstammt der kulturanthropologischen Erforschung der in normalen und kritischen Alltagssituationen beobachteten und erfragten sozialen Beziehungen einzelner innerhalb abgegrenzter gewählter Sozialzusammenhänge“ (Kardorff 1995, 402). Zu unterscheiden sind Untersuchungen von kleinen Landgemeinden oder Kleinstädten, Familien- und Verwandtschaftsbeziehungen, Nachbarschaften und städtischen Submilieus. Merkmale sozialer Netzwerke sind: Form und Struktur von Interaktionen, Inhalte, Qualität, Funktionen und Rollen in Interaktionen (vgl. ebd., 403). Die Zunahme von Netzwerken weist auf vielfältige Steuerungsprobleme aufgrund von Komplexität und Eigendynamik der gesellschaftlichen Sektoren und der Globalisierung der Problemlagen hin. Die Trennung von Staat und Gesellschaft wurde in vielen europäischen neuzeitlichen Staatstheorien vertreten. Mit Hilfe der Verwaltung und der verfassungsgemäß übertragenen Macht sicherte der Staat seine Souveränität. Die Vorstellung von der Planbarkeit und Durchsetzungsfähigkeit von den hierarchischen Spitzen herab wird allerdings zunehmend bezweifelt (vgl. Messner 2000, 28f.). „Zwischen Staat und Markt bekommen (nichtstaatliche d.Verf.) Organisationen und Institutionen Steuerungsfunktionen, weil die Handlungspotentiale, das notwendige Know-how zur Formulierung langfristig orientierter Politiken und die Implementationskapazitäten auf eine Vielzahl von staatlichen, privaten und intermediären Trägerschaften verteilt sind (Unternehmen, Verbände, Wissenschaft, staatliche und private intermediäre Institutionen, Gewerkschaften)“ (ebd., 33). Es gibt in staatlichen Organisationen eine Veränderung zum Einsatz „weicher Steuerungsmittel“ durch gezielte Informationsflüsse, Einigung über Entscheidungsverfahren und Interessenintegration mit der Absicht einer Aktivierung der Gesellschaft herbeizuführen. Die Zunahme von Netzwerken in der sozialen und politischen Arbeit kann als Ausdruck einer Reaktion auf die gesellschaftliche Modernisierung gesehen werden. Es entstehen 43 3. THEORETISCHE BEZÜGE Netzwerke, die organisations- und sektorenübergreifend arbeiten und damit gesellschaftliche Aufgaben der Leistungsoptimierung und Problemlösung wahrnehmen. „Erst ein Mindestmaß an Handlungsautonomie fördert verantwortungsbewußtes Verhalten im Sinne der jeweiligen Organisation. Dies sind Lernprozesse, die sich in strikt hierarchisch gesteuerten Strukturen, in denen dezentrale Entscheidungskompetenzen in Organisationen und gesellschaftlichen Teilsystemen durch zentrale Entscheidungen substituiert werden, nicht entwickeln können. Problemlösungsstrategien in Netzwerken zeichnen sich durch kollektive Entscheidungsfindung aus“ (ebd., 50). Die Handelnden in Netzwerken müssen „in der Lage sein, ihre Eigeninteressen genau zu bestimmen und zu vertreten sowie aus ihrer Perspektive zur Erarbeitung einer möglichst vollständigen Problemanalyse und den darauf aufbauenden Problemlösungen beizutragen ... (und sie müssen) ... zu strategischer Interaktion und zu Kompromissen fähig sein“ (Messner 2000, 50). Das führt dazu, dass die jeweils eigene Organisation optimiert wird, dass eine Interessenvertretung gegenüber dem Staat oder anderen gesellschaftlichen Instanzen stattfindet und staatliche und private Organisationen miteinander verbunden werden. Messner meint: „Im Netzwerk werden – entgegen ... Luhmanns ... Selbstreferentialitätsannahme – Logiken, Codes aus unterschiedlichen Subsystemen miteinander verknüpft“ (ebd., 51). Letztlich stoßen auch diese an Grenzen, wenn Globalisierung der Ökonomie und internationale Übereinkünfte und Verträge nationalstaatliche Entscheidungen bestimmen. 3.2.3 Unterschiedliche Perspektiven zur Vernetzung Der Begriff „Vernetzung“ ist anschaulich, aber er verstellt häufig den Blick auf die unterschiedlichen Ziele und Interessen, die damit verknüpft werden. Über Vernetzung wird in unterschiedlichen Kontexten gesprochen. Häufig suchen die Beteiligten keine Klärung der jeweiligen Positionen und finden dann auch keine gemeinsamen Handlungskonzepte. Kietzell hat den Begriff Vernetzung untersucht (vgl. ebd., 1994a) und ihn in fünf inhaltliche Zusammenhänge gestellt. Diese Unterscheidungen sind für das Forschungsvorhaben wichtig, weil der Begriff innerhalb der Administration, der Politik und den sozialen Institutionen unterschiedliche Verwendung findet. (1) In einer „technokratischen Redeweise von Vernetzung“ sind Bezeichnungen geläufig wie z.B. Verkehrs-, Schienen-, Straßen- oder Datennetz. 44 3.2 VERNETZUNG ALS ANFORDERUNG AN SOZIALE ARBEIT Es sind meist pragmatische Redewendungen für die Beförderung von Menschen, Waren, Informationen oder Dienstleistungen. Bei dieser Form der Vernetzung geht es immer auch um Verteilung von Ressourcen und die Macht, darüber zu entscheiden. Deshalb ist danach zu fragen, wessen Interessen sich durchsetzen und welche Folgen einer solchen Vernetzung sich ergeben. (2) Kritik an einem funktionalen, technokratischen Verständnis von Vernetzung brachte Vester vor. Er wies auf „die Welt als vernetztes System“ hin und dass gewachsene oder organisierte Systeme, die als getrennt angesehen werden, doch miteinander verbunden sind und durch Rückkopplungseffekte aufeinander wirken (vgl. ebd. 1978). Kritik und Widerstand können allerdings innerhalb einer systemischen Sichtweise funktionalisiert werden, sodass es dann sinnvoll ist, Widersprüche und Gegensätze herauszuarbeiten. (3) „Vernetzung von Unterstützungssystemen“ erhalten besonders in Krisenzeiten eine Bedeutung. In der Sozialen Arbeit entwickelte sich daraus ein Arbeitsansatz, der auf einzelne Fälle bezogen die Beziehungsnetze in Hilfeplanung einbezog und andererseits die sozialen Organisationen systematischer miteinander verband. Kritisch ist zu sehen, dass dieser Arbeitsansatz mit der Finanzierungskrise des Staates zusammenfiel und dass die Unterstützungsnetze zunehmend an integrierender Kraft verlieren. (4) „Vernetzung von unten“ hat sich besonders in den sozialen Bewegungen herausgebildet. Viele Bürgerinitiativen in den Bereichen Ökologie, Friedenspolitik, Frauen und Atomenergie waren in den Anfängen basisdemokratisch organisiert. Vollversammlungen dienten als Diskussions- und Entscheidungsgremien. Es wurde bewusst auf Geschäftsführung oder zentrale Anlaufstellen verzichtet. „Wir sind ein Netz, und in einem Netz ist jeder Knoten eine Zentrale“ (vgl. ebd., 5) beschreibt das Selbstverständnis dieser Art der Vernetzung. (5) „Vernetzung als Steuerungsinstrument von oben“. Bisher wurden Finanzmittel und Verwaltungsrichtlinien als Steuerungsmittel in der Kommune eingesetzt. Einflussnahme der Administration bei inhaltlicher Neukonzeption und gleichzeitiger Einsparung von Finanzen, ohne die Qualität zu mindern, erfordert zusätzliche Einflussgrößen. Dazu werden MitarbeiterInnen als Vermittler in Neuorganisationsprozesse integriert, es wird auf die Motivation der Mitarbeiterschaft zurückgegriffen und es werden verlässliche, kleinräumige Daten gesammelt. Daraus entstehen neue Konzepte unter den Vorgaben der Leitung. Fragen der MitarbeiterInnen sowie deren 45 3. THEORETISCHE BEZÜGE Kreativität, Kritik und Selbstkritik, Selbstverantwortung und Eigeninitiative müssen hinter einer Funktionalisierung zurückstehen. 3.2.4 Netzwerke in der Sozialen Arbeit Für die Soziale Arbeit und insbesondere für die Fallarbeit ermöglichen Betrachtungen der primären (z.B. Verwandte, Freunde von Hilfebedürftigen), sekundären (z.B. Institutionen) und tertiären Netzwerke (z.B. Selbsthilfegruppen) eine stärkere Differenzierung bei einer Analyse des sozialen Umfeldes und der sozialen Beziehungen. Eine Gefahr liegt darin, noch detaillierteres Wissen über die Klienten zu sammeln und die selbst gewählten Beziehungen lediglich unter dem Gesichtspunkt der Hilfefunktion zu sehen, einzuplanen und damit zu funktionalisieren. Vernetzung von sozialen Diensten ist ein Ansatz, der Versorgungslücken schließen, und Doppelarbeit vermeiden und zu höherer Effektivität führen soll. Die vorhandenen Angebote sollen für die BürgerInnen transparent werden. Erwartet wird von Verwaltung und Politik eine inhaltliche Zusammenarbeit, um Aktivitäten und Schwerpunkte aufeinander abzustimmen und die trägerübergreifende Information sozialer Dienste in einer Region sicherzustellen, mindestens hinsichtlich der Angebote, Zielgruppen und Öffnungszeiten. Dafür sollen kürzere Verbindungswege entstehen und auf Bedarfe schnell und angemessen reagiert werden. „Netzwerke sind a priori antihierarchisch, geht es diesen doch um horizontale Verbindungen zwischen Personen (interpersonale Netzwerke) oder Institutionen (interorganisationale Netzwerke) ... Mit dem Abbau von Hierarchiestufen und langen Dienstwegen geht auch eine Produktivitätssteigerung der Arbeit einher“ (Bullinger; Nowak 1998, 150). Netzwerke sind zusätzliche Organisationsformen zu internen Verbandsund Amtsstrukturen. Sie sollen die Fachkompetenz erhöhen, Trägerkonkurrenzen überbrücken, gemeinsame Verantwortlichkeit für Arbeitsergebnisse sichern, die Leistung steigern, Mitarbeiterbeteiligung und -motivation fördern und den fachlichen Austausch durch Verzicht auf Hierarchiestufen erleichtern. Gefahren sind zu große Netzwerke, dadurch überlagerte Strukturen, zu große Differenz der Organisationsstrukturen und größere soziale Kontrolle (der MitarbeiterInnen und der KlientInnen) durch dichtere Vernetzung (vgl. ebd., 151) Mutschler untersuchte 1995 die Vernetzung in einer regionalen Arbeitsgemeinschaft der Altenarbeit in Hamburg durch teilnehmende Beobachtung 46 3.2 VERNETZUNG ALS ANFORDERUNG AN SOZIALE ARBEIT und qualitative Interviews (vgl. ebd. 1998). Der Nutzen einer Vernetzung stand dort für die TeilnehmerInnen im Vordergrund. Sie bestimmten selbst, was für sie nützlich war. Das konnte auf ganz unterschiedlichen Ebenen liegen. Die wesentlichen Elemente einer Vernetzung sind nach Mutschler: Einen Blick für den Stadtteil zu entwickeln, die Qualität der Arbeit zu verbessern, Information und Aktion gut zu mischen, eine soziale Gruppe zu bilden, eine Vertrauensbasis zu schaffen sowie Ressourcen zu erschließen. „Das bedeutet, daß diese Ressourcen für die Professionellen sichtbar werden, daß Nutzungsbarrieren abgebaut und Kontakte rascher und problemloser geknüpft werden können, um Hilfeprozesse zu organisieren“ (vgl. ebd., 50). Die Entwicklung eines Netzwerks erfordert jedoch Arbeitskapazität über die Zeit der Sitzungsteilnahme hinaus. Deshalb müssen einzelne Personen die Verantwortung für Impulse, für Organisation und für Umsetzung übernehmen und dafür erhebliche Arbeitsanteile investieren. 3.2.5 Netzwerke aus der Geschlechterperspektive Die Politikwissenschaftlerin Holland-Cunz unterscheidet die Netzwerke in solche mit ausgeprägten Herrschaftsbeziehungen und solche, die eine kritische Haltung dazu einnehmen und nicht nur fachbezogene, sondern auch politische Perspektiven entwickeln. Den Begriff „Netzwerk“ als weniger verbindliche und politische Organisationsform ergänzt sie mit den Begriffen „Koalitionen“, die sich auf eher kurzfristige, genau definierte Ziele beziehen, und „Allianzen“, die längerfristige und weitreichende Veränderungen anstreben. In Koalitionen und Allianzen sind eher Menschen zu finden, die verschieden sind und „denen nicht einfach so politisch zu trauen ist“ (vgl. ebd., 60f.). Als Empfehlungen für gelingende Bündnispolitik schlägt Holland-Cunz vor: „1. Sachlichkeit der Kommunikation 2. Zielgerichtetheit der Arbeit 3. Wechselseitige persönliche Anerkennung 4. Gleiche Rechte des Sprechens und Gehörtwerdens 5. Versuch einer gemeinsamen Machtanalyse“ (vgl. ebd., 71f.). Anders als Bündnisse bieten Netzwerke Solidarität mit einander ähnlichen Personen an. Organisationen von Frauen in Sozialberufen sind Netzwerke, denen sich besonders die Fragen stellen, wie Form und Inhalt miteinander 47 3. THEORETISCHE BEZÜGE verknüpft werden, wie eine Veränderung nach außen und die kollektive Binnenstruktur, langfristige Ziele und alltägliche Praxis zusammenpassen und wie die daraus resultierenden Spannungen in der Organisation bewältigt werden. Für Netzwerke sollte deshalb gelten: Ziele der Organisation konkret und realistisch formulieren, die Fähigkeiten der Einzelnen stimulieren, wechselseitig konstruktives Verhalten unterstellen, Entscheidungsprozesse je nach Beschlussart strukturieren, genaue Absprachen treffen und Krisenlösungsprozeduren einführen (vgl. Holland-Cunz 1998, 60). Dieses Verständnis von Netzwerken wird von anderen Fachleuten geteilt: Bullinger und Nowak gehen ebenfalls davon aus, dass der soziale Wandel in Westeuropa „Institutionalisierungs- und Individualisierungsprozesse“ bedingt, die zu einer Verflechtung des Individuums mit unterschiedlichen sozialen Netzwerken führen (vgl. ebd. 1998, 56). Mit dem Begriff „soziales Netzwerk“ lassen sich die Verbindungen der Mikro- und der Makroebene in den Blick nehmen. Netzwerkanalysen zielen darauf, die personalen und die institutionellen Verbindungen zu untersuchen. Unterstützungspotenziale sollen erfasst und Defizite aufgezeigt werden. „Das Konstrukt ‚soziales Netzwerk‘ und die Befunde der Netzwerkforschung verfolgen tendenziell eine horizontale Blickrichtung, d.h. sie klammern das Problem ‚Macht‘ weitgehend aus. Fragen der Machtdistanz bzw. des Machtgefälles zwischen Menschen bleiben außen vor, so daß das Augenmaß sozialer Ungleichheit oft theoretisch wie auch empirisch nicht erfaßt wird“ (ebd., 91). Zur Untersuchung von Netzwerken empfehlen Brunnengräber und Walk in einer Übersicht die kontinuierlichen und die punktuellen Interaktionen festzuhalten, aber auch die abgebrochenen Kontakte. Die Dichte des Netzwerkes sowie die Formen und Häufigkeiten der Kooperationen sollten veranschaulicht werden. Darüber hinaus sind die dynamischen Prozesse einzubeziehen, weil innere und äußere Einflüsse auf das Netzwerk einwirken und es verändern. Dennoch ist eine Momentaufnahme hilfreich für vertiefende Analysen. Die Netzwerktypen sind zu unterscheiden und mit ihren Handlungslogiken Zielen und Strategien zu erfassen (vgl. ebd. 2000). 48 3.3 ZUR BERUFLICHEN IDENTITÄT VON FACHLEUTEN DER SOZIALEN ARBEIT 3.3 ZUR BERUFLICHEN IDENTITÄT VON FACHLEUTEN DER SOZIALEN ARBEIT 3.3.1 Der Identitätsbegriff von Mead George Herbert Mead war als Sozialpsychologe zunächst in Michigan und später bis 1931 in Chicago tätig. In der nachdarwinistischen Zeit stellte sich für ihn die Frage, wie ein voll entwickelter, reflektiver, schöpferischer und verantwortungsvoller Mensch mit einem Selbstbewusstsein innerhalb der Naturgeschichte des Verhaltens entstanden ist und welchen Anteil daran die Gesellschaft hat? Bis dahin galten Gesten als Ausdruck von Emotionen, Verhalten galt als Reaktion auf einen Reiz (Behaviorismus). Meads Ansatz ist in Verbindung zu sehen mit der verstehenden Soziologie von Max Weber, Georg Simmel und Alfred Schütz, die – im Gegensatz zum naturwissenschaftlichen Verständnis – der sozialen Wirklichkeit eine innere Logik zusprachen. Die „Chicagoer Schule“ um Mead entwickelte ein Handlungsmodell, bei dem es um die Herstellung von Bedeutung bei Interaktionen geht. In ihrer Forschung stellte sie sich „die Aufgabe, selbst zu den Betroffenen zu gehen und aus eigenem Augenschein deren soziale Lage zu erkunden. Es kristallisierte sich so ein eindringlicher und umsichtiger Erkundungs-, Analyseund Berichtsstil ‚aus erster Hand‘ heraus“ (Schütze 1987, 527 zit. n. Garz 1995, 21). Voraussetzung dieses Anspruchs war, die persönlichen Eindrücke der ForscherInnen ebenfalls systematisch zu erheben. Die empirischen Materialien dokumentierten Erfahrungen von Betroffenen und bezogen den Kontext ein, sodass Erfahrungsverarbeitung und Haltungen interpretierbar waren. Die Theorieentwicklung aufgrund der Datenanalyse wurde nachvollziehbar. Meads Theorie nimmt menschliches Handeln als Ausgangspunkt für Untersuchungen. Eine „Handlung“ kann so universal sein, dass viele sie umgebende Objekte oder deren Wirkungen bereits als Stimulus, als Reiz dienen können. Selbst zielgerichtete Handlungen sind beeinflusst von zugeschriebener Bedeutung. Deshalb ist die Bedeutung der Symbole bzw. von anderen Menschen wahrgenommenen Symbolen einzubeziehen. Über die Bedeutung der Symbole untersuchte Meads Ansatz „auch jene Teile der Handlung, die der Beobachtung von außen nicht zugänglich sind“ (Mead 1973, 46). Die Präzisierung ergibt sich erst durch den Kontext, auf den sie bezogen ist. Denn die Erfahrung wird symbolisch formuliert und ist nicht unmit49 3. THEORETISCHE BEZÜGE telbar zugänglich. Die Theorie des Symbolischen Interaktionismus verweist auf die Bedeutungszuschreibung durch alle an Kommunikation und Interaktion Beteiligten. Erst durch Verständigung ist eine gemeinsame Orientierung möglich. Mead unterscheidet drei Ebenen der Verständigung: den Ausdruck als Geste (ein Verhalten, ohne bewusste Vorstellung dazu), das Symbol (verbunden mit einer Vorstellung oder Idee) und ein signifikantes Symbol (eine Verständigung mit anderen über erkennbare Vorstellungen). Erst durch signifikante Symbole erfolgt eine Interaktion, die zur Verständigung wird, wenn andere die gleichen Bedeutungen damit verbinden. „Nur durch Gesten qua signifikante Symbole wird Geist oder Intelligenz möglich, denn nur durch Gesten, die signifikante Symbole sind, kann Denken stattfinden, das einfach ein nach innen verlegtes oder implizites Gespräch des Einzelnen mit sich selbst mit Hilfe solcher Gesten ist“ (ebd., 86). Die Bedeutungen von Symbolen sind nicht im Einzelnen selbst, sondern außen in der Gesellschaft zu finden. Dadurch entsteht die Fähigkeit, in sich selbst die Reaktion auszulösen, die die eigene Geste bei anderen auslöst, und die Reaktion des anderen zur Kontrolle des eigenen Verhaltens einzusetzen. Soweit man Rollen eines anderen übernehmen kann, kann man gegebenenfalls aus dieser Perspektive auf sich selbst zurückblicken und so für sich selbst Objekt werden, z.B. den Standpunkt von Gruppen einnehmen, eigene Impulse beurteilen, Interessen im Hinblick auf gesellschaftliches Wohl beurteilen. Mead sieht die „Rollenübernahme“ als Voraussetzung zur Entwicklung eines „Selbst“, das die Perspektiven anderer einbezieht. Die Rollen anderer werden mitgedacht und mögliche Reaktionen auf eigenes Verhalten eingeschätzt. Dadurch können Individuen sowohl in Bezug auf sich selbst als auch auf andere handeln. Selbst- und Identitätsbildung resultieren aus diesen Prozessen, die mit anderen, also außerhalb des Individuums stattfinden und auf die Beteiligten zurückwirken. Geist oder Bewusstsein, ebenso Identität, so Mead, entstehen ausschließlich in einem gesellschaftlichen Prozess. Wobei sich die Identität (self) aus zwei Elementen dem „me“ als gesellschaftliche Erwartungen und dem „I“, als individuelle, biographische Seite der Persönlichkeit zusammensetzt. Ich-Identität hätte die Aufgabe zwischen sozialer und persönlicher Identität zu vermitteln. Signifikante Gesten entstehen, wenn „die Rolle des anderen“ eingenommen wird. Durch die Hereinnahme des gesellschaftlichen Prozesses der Kommunikation in den Einzelnen entsteht die Fähigkeit, sich selbst die Re50 3.3 ZUR BERUFLICHEN IDENTITÄT VON FACHLEUTEN DER SOZIALEN ARBEIT aktion und die betroffenen Objekte zu vergegenwärtigen, die die eigene Geste für andere bedeutet und die Reaktion in diesem Rahmen zu kontrollieren. „Wo die Reaktion der anderen Person hervorgerufen wird und zu einem Reiz für die Kontrolle der eigenen Handlung wird, tritt der Sinn der Handlung der anderen Person in der eigenen Erfahrung auf“ (ebd. 113). Realität ist symbolisch vermittelte Realität (durch Gesten, die zu Symbolen werden) dadurch haben Sender und Empfänger in einer Kommunikation aktive Rollen. Es geht nicht um Objekte und Realitäten, sondern um deren Umwandlung in Bedeutungszusammenhänge, und deren Einbeziehung in antizipierte Handlungsfolgen. Eine gemeinsame Welt besteht für Mead nur, soweit es eine gemeinsame Erfahrung gibt (vgl. ebd.,129). 3.3.2 Weiterentwicklung des Symbolischen Interaktionismus Die Ansätze von Mead wurden einerseits zu einer Persönlichkeits- und Sozialisationstheorie und andererseits zu einem gesellschaftstheoretischen Ansatz weiterentwickelt. Ebenso wurde der Symbolbegriff erweitert und dadurch auf den Zusammenhang zwischen Objekten, die Bezeichnung für diese und den Bezeichnenden hingewiesen. Symbole können Tiefendimensionen einnehmen und hohe Komplexität, das heißt andere Bedeutungen bei gleicher Bezeichnung beinhalten. Es werden demnach nicht Bedeutungen, sondern nur Symbole bzw. Zeichen vermittelt. Zuordnung und Assoziation hängen von Erfahrungen beim Symbolerwerb und -gebrauch, also von kulturellen Faktoren ab. Das Streben nach Verstehen im Sinne gleicher oder ähnlicher Bedeutungen kann nicht in allen Situationen voraus gesetzt werden. Verstehen und Nichtverstehen kann auch als Ausdruck verschiedener Interessen gelten, wie z.B. bei den Begriffen Vernetzung oder Zusammenarbeit. Wahrnehmungsunterschiede entstehen als Unterschiede im Gebrauch der Symbole oder aufgrund berufsspezifischer Interpretationsmuster. Ein Wechsel der Perspektive kann mit einem Wechsel der Organisationsrolle der Personen und Position zusammenhängen. Es gibt auch die Begriffswahl mit nicht übereinstimmenden Inhalten als „strategische Interaktion“ z.B. bei der Selbstdarstellung oder bei Interessensgegensätzen. Mead unterstellt die Absicht der Verständigung, der Herstellung von „Bedeutungskongruenz“, gebunden an geteilte gemeinsame Erfahrung, die bei Interessenskonflikten selten gegeben ist (vgl. Theis 1993, 51). Es gibt Möglichkeiten, den Ansatz zu erweitern, indem die Wahl 51 3. THEORETISCHE BEZÜGE von Begriffen und deren Verwendungskontexte überprüft und in den Prozess einbezogen werden, wie das in der Untersuchung erfolgte. Basierend auf Meads Theorie hat Griese ein Modell zum Verständnis von Sozialisationsprozessen Erwachsener entwickelt, das Einstellungsänderungen in Abhängigkeit zur Identitätsbildung sieht und eine Spannungsbogen zwischen „den Merkmalen der Persönlichkeit einerseits, der Situation bzw. dem interaktiven Kontext andererseits“ berücksichtigt (vgl. ebd. 1979, 202). Griese geht weiter davon aus: „dass zwischen den vier Aspekten der Identität ... ein Zusammenhang wechselseitiger Beeinflussung und Abhängigkeit“ (vgl. ebd., 201) besteht. Damit bilden persönliche Identität durch die Einzigartigkeit der Biographie und soziale Identität durch die Kommunikation und Interaktion einen Spannungsbogen für Identität. Gleichzeitig besteht die Polarität zwischen Einstellungen, die das Selbstbild begründen und Verhalten, das der Ich-Identität faktischen Ausdruck verleiht. Einstellungsänderungen gehen einher mit Veränderungen des Selbstbildes, aufgrund abweichender Erfahrungen mit sich selbst. Besonders wenn biographische Veränderungen, die wie „Schaltstellen“ wirken, einen Perspektivenwechsel ermöglichen. Bildungsprozesse können zu diesen Zeitpunkten unterstützend wirken, wenn sie dabei drei Komponenten von Einstellungen berücksichtigen, die dem Individuum Orientierungsfunktion und Statussymbole, Reduktion von Komplexität und Gruppenzugehörigkeit ermöglichen. 3.3.3 Identität durch Kommunikation und Interaktion Mead bindet den Bedeutungsbegriff weniger an Personen, sondern vielmehr an die soziale Situation. Die Unterscheidung zwischen Meads Theorie und den nachfolgenden interpretativen Ansätzen liegt in der Betonung gemeinsam geteilter Bedeutungen und Bedeutungskongruenz. Allerdings sind eher kognitive Ausprägungen und personen- und positionsabhängige Bedeutungen zu unterscheiden. Vielfach werden Organisationen gerade hinsichtlich ihrer Kongruenz der Bedeutungen von Symbolen (Begriffen, Perspektiven) untersucht, um deren Strukturen zu verstehen. Es ist ebenso die Frage, ob Organisationskonzepte konflikthaft oder konsensorientiert angelegt sind und ob sie Selbstorganisationsansätze enthalten. Untersuchungen von Organisationen zeigen, dass bereits die Personalauswahl häufig nach dem Prinzip der Ähnlichkeit bzw. Ergänzung erfolgt. Routine und eingespielte Verfahren beleben zwar die Bildung heterogener Organisatio52 3.3 ZUR BERUFLICHEN IDENTITÄT VON FACHLEUTEN DER SOZIALEN ARBEIT nen. Dagegen bildet sich besonders dann eine Kommunikation in Organisationen heraus, wenn Unsicherheiten entstehen und Vertrauensebenen gesucht werden. Verunsicherung verlangt nach Kommunikation (in gemeinsamer Sprache, gleicher Interpretationsbasis). Strittig ist, welcher Grad an Gemeinsamkeit in arbeitsteiligen Organisationen erforderlich ist. Die Arbeit an Leitbildern zu gemeinsamen Werten, Zielen und Situationsbeschreibungen kann eine Handlungskoordination begünstigen. Konsens über die Bedeutung von Symbolen kann eine Voraussetzung für die Lösung von Kommunikationsproblemen sein. Einerseits ist offene Kommunikation immer auch Mitteilung über sich selbst. Andererseits führen häufig indirekte Argumentationen eher zum Konsens als klar formulierte Vorstellungen. Was führt zur Problemlösung, was zur Problemverschärfung? Sicher ist der Kontext unabdingbar für die Zuschreibung von Bedeutung (vgl. Theis, 57). Allerdings würde eine größere Klarheit und Deutlichkeit die Interpretationsbreite bei den Empfängern einschränken, was nicht immer gewünscht ist, wie es beim Begriff Vernetzung deutlich wird. Gerade das Vermeiden von Kommunikation oder die Verwendung von Ambiguität zur Durchsetzung von Interessen sind in Organisationen verbreitete Strategien. Die Verschiedenheit der Interpretationen von Wirklichkeit verlangt eine genauere Klärung der kultur- und gruppenspezifischen Erfahrungszusammenhänge, besonders in heterogenen Organisationen. Aus der Organisationssoziologie wurden dazu systemtheoretische Ansätze entwickelt, die immer dann zur Geltung kommen, wenn der Blick auf Großgruppen und Organisationen, also auch die Meso-Ebene gerichtet wird. 3.3.4 Zur beruflichen Identität in der Sozialen Arbeit In der Fachliteratur sind drei zentrale Ansätze festzustellen, mit denen berufliche Identität in der Sozialen Arbeit und daran geknüpfte Kompetenzen beschrieben werden. • Im Vordergrund des ersten Ansatzes stehen die funktionalen Anteile des Berufs der SozialarbeiterIn. Kennzeichnend ist eine historische Einordnung der Profession, die ihre Wurzeln u.a. in der zunächst ehrenamtlichen und später beruflichen Fürsorge und Wohlfahrtspflege für Armutsbevölkerung hat (vgl. Wendt 1995, 19f.). Über eine Analyse der gesellschaftlichen Funktion von Sozialer Arbeit werden Anforderungsprofile erstellt, denen Arbeitsschritte zugeordnet werden, die vermittelbar und kontrollierbar sind. Dieser Ansatz verbindet sich mit berufsständischen 53 3. THEORETISCHE BEZÜGE Forderungen nach größerer gesellschaftlicher Anerkennung; seine VertreterInnen sind aktiv an der Diskussion um Professionalisierung von Sozialer Arbeit und der Begründung einer Sozialarbeitswissenschaft beteiligt (vgl. Engelke 1992; Staub-Bernasconi 1995; Wendt 1995). • ErziehungswissenschaftlerInnen kritisieren den Ansatz und fordern einen stärkeren theoretischen Bezug zur Pädagogik (vgl. Müller 1988). Sie sehen historische Bezüge in der Sozialpädagogik „als dritte Erziehungsinstanz“ (vgl. Dewe u.a. 1996), die selbst in der Armenpflege und Wohlfahrt Erziehungsfunktionen aufweist. Darüber hinaus soll auf die Verbindungen zu den Bezugswissenschaften nicht verzichtet werden. Schon mit der Begriffswahl (entweder Soziale Arbeit oder Sozialpädagogik) werden die inhaltlichen Positionen markiert. • Biographien bieten einen dritten Bezugspunkt für Aussagen zur beruflichen Identität. In biographischen Interviews fragte Heinemeier „nach den typischen biographischen Zusammenhängen, in denen Berufswahlentscheidungen. Studium und Zukunftsentwürfe von bereits berufstätigen SozialarbeiterInnen stehen: Welche biographischen Wurzeln hat die Motivation, Sozialarbeit zu studieren und als Beruf auszuüben?“ (ebd. 1994, 174). Einen ähnlichen Ansatz wählte Nagel (vgl. ebd., 1997), um aus biographischen Interviews typische Paradoxien und Konflikte zwischen den gesellschaftlichen Funktionen des Berufes, den institutionell gestellten Aufgaben und der jeweiligen Person herauszuarbeiten. Mit der Möglichkeit des „Abstandhaltens“ und des „Dahinterstehens“ nach eigenen konzeptionellen Entscheidungen benennt sie hilfreiche Komponenten für eine berufliche Identität. Sie fasst diese in einem Begriff als „engagierte Rollendistanz“ zusammen. • Die Geschlechterperspektive (vgl. Dietzen 1993; Carrigan 1996) und die Fragen zur Widerständigkeit (vgl. Krahulec 1999; Esser u.a. 1996) in Organisationen ergänzen die den Blick auf berufliche Identität. (1) Gesellschaftliche Funktion von Sozialer Arbeit Trägerstrukturen der Sozialen Arbeit verändern sich hin zu stärkerer Marktorientierung und dem Abbau kommunaler Dienste. Es besteht die Gefahr eingeschränkter Kundenmitsprache und geringerer Qualität. Von den Sozialen Diensten werden grundsätzliche Qualitätsstandards wie Befähigung, Zuständigkeit und Effektivität erwartet. Die Ergebnisse sollen 54 3.3 ZUR BERUFLICHEN IDENTITÄT VON FACHLEUTEN DER SOZIALEN ARBEIT durch Öffentlichkeitsarbeit glaubhaft dargestellt und durch interne und externe Evaluation überprüft werden. Die Fachkräfte sollen über persönliche Kompetenz (d.h. keine Problemfreiheit, aber Problemlösefähigkeit trotz Selbstbetroffenheit), soziale und kommunikative Kompetenz (z.B. Streitkultur) und fachliche Kompetenz (z.B. durch Wissen, Fertigkeiten bzw. Methoden) verfügen. Es wird das Einnehmen verschiedener Perspektiven gefordert, um den Blick auf die Gesellschaft, die Lebenswelt, die Betroffenen, sich selbst (Selbstreflexivität) und die eigene Organisation richten zu können. Zentraler Aspekt ist dabei das in Beratungen oder der Öffentlichkeit geäußerte „Fremdverständnis“ für den Hilfebedarf (vgl. Wendt 1995, 16). Die Einnahme verschiedener Rollen gehört zum Standard, z.B. als GesprächspartnerInnen beim Beraten und Verhandeln, AnwaltInnen von Klienten, ZwischenhändlerInnen von Sozialleistungen, MittlerInnen in Konflikten und Ausübung eines Wächteramtes (vgl. ebd., 15). Die Nähe zur Armutsbevölkerung und zu Randgruppen muss nicht zwangsläufig stigmatisieren, wie es bei den Berufsbildern von ÄrztInnen und AnwältInnen zu sehen ist. Ein positives Selbstbild von Sozialer Arbeit könnte sich auf die Geschichte, die Ziele und auf die Kompetenzen beziehen. Doch die Funktion von Sozialer Arbeit birgt Widersprüche bei dem Versuch, gesellschaftliche Konflikte zu entschärfen, indem Anpassung und Systemloyalität gefördert werden. Gesellschaftliche Reaktionen darauf sind Vereinnahmung oder Abwehr, weniger die der Anerkennung. Es gibt Schwierigkeiten bei der Identitätsbildung, weil Fremddefinitionen erfolgen, eine Leitwissenschaft, klare Selbstdefinitionen und wissenschaftlich ausgewertete Handlungsergebnisse fehlen (vgl. Mühlum 1995, 115f.) Staub-Bernasconi stellt Konzepte vor, die daran anschließen und die das Theorie-Praxis-Problem für die Sozialarbeit bearbeiten. Alltagserfahrung und Alltagsbezug werden stärker berücksichtigt und dadurch ein „einseitiges, technokratisches Spezialistentum“ entschärft, was aber auch zum Bedeutungsverlust von Theorie und Handlungswissen für Soziale Arbeit führt (vgl. ebd. 1995, 74). Dazu entwickelt sie einen sozialarbeitstheoretischen Bezugsrahmen, der praxisrelevant ist und von Klienten und sozialen Fachleuten gleichermaßen verstanden und benutzt werden kann. Das erfordert allerdings eine Weiterentwicklung der Konzeptionen zur Sozialen Arbeit und des methodischen Arbeitens, denn „wer keinen Bezugsrahmen hat, wird versucht sein, das Fehlende durch Funktionsbeschreibungen, institutionelle Zwecksetzungen, Normen und Gesetze, Theorie-, Therapie- und Managementmethoden oder eventuell gar durch Sta- 55 3. THEORETISCHE BEZÜGE tusattribute und -diskussionen zu ersetzen. Darin scheint mir aber die größere „technologische Gefahr“ zu liegen, als im sensiblen Umgang mit verschiedenen Wissensformen“ (ebd, 101). Staub-Bernasconi fordert für die Soziale Arbeit den Bezug auf internationale Sozial- und Menschenrechte, um verdeckte „traditionell-repressive Werte und Machtstrukturen, Machtausübung und Kolonialisierung“ (ebd. 1995, 74) zu erkennen und zu unterscheiden. Dadurch können SozialarbeiterInnen „die Berücksichtigung realer, beispielsweise schicht- und geschlechtsbezogener oder ethischer und religiöser Unterschiede in der Lebenssituation und Ausstattung verlangen, um ausgleichende oder wiedergutmachende Gerechtigkeit einzufordern“ (ebd., 74). Ein zweiter Ansatz sieht einen Weg in einem stärkeren Theoriebezug bei der Wissensvermittlung, ohne dass daraus direkt eine Anwendung für die Praxis abgeleitet würde. „Wir sagen ..., daß wissenschaftliche Theorien das Handeln nicht direkt anleiten können, und daß (sozial)pädagogisches Handeln nicht in der schlichten Anwendung von Regeln besteht, die Sätzen stringent abgeleitet werden können“ (Dewe u.a. 1995, 11). Eine Verschränkung von theoretischer Analyse und Erfahrungswissen wird als sinnvoll, jedoch nicht als wissenschaftlich angesehen. Die Gleichberechtigung von Wissenschaft und Praxis wird betont, allerdings sollen die Funktionen „Wissensproduzenten“ und „Wissenverwender“ bestehen bleiben. Handlungsanleitende Empfehlungen sollen nicht erfolgen, weil die Wissenschaft nur „Reflexionswissen“ zur Verfügung stellt. So sollen Begriffe und Kategorien der Praxis auf konkrete Situationen bezogen bleiben und sich unterscheiden von Begrifflichkeiten der jeweiligen Bezugswissenschaften. „Eine so verstandene Professionalität bearbeitet die Differenzen von Wissenschaft und Handeln, Theorie und Praxis, Hochschule und Beruf dadurch, daß sie als genuine Kompetenz des Professionellen eine ‚Kunstlehre des Fallverstehens in verändernder Absicht‘ reklamiert, welche sozialwissenschaftliche Kompetenzen erfordert, aber gerade nicht in der bloßen Anwendung sozialwissenschaftlichen Wissens aufgeht. Denn der Sozialpädagoge ist insofern Wissenschaftler und Praktiker zugleich, denn sozialwissenschaftlich inspirierte Fallanalyse und konkretes pädagogisches Handeln sind – idealiter – gleichberechtigte Bestandteile seiner Berufspraxis“ (Dewe u.a. 1996, 121). 56 3.3 ZUR BERUFLICHEN IDENTITÄT VON FACHLEUTEN DER SOZIALEN ARBEIT (2) Berufliche Identität als biographische Einbettung Heinemeier untersuchte in narrativen Interviews Berufsbiographien von SozialarbeiterInnen und arbeitete „typische Muster der biographischen Einbettung von Studium und Beruf der Sozialarbeit“ heraus (vgl. ebd. 1994, 173f.). Erste Erfahrungen mit dem Berufsbild erfolgen häufig über Praktika oder andere Kontakte mit SozialarbeiterInnen. Einige Interviewte identifizierten sich mit Vorbildern aus ihrer Jugend (JugendleiterIn, FerienbetreuerInnen o.ä.). Der Wunsch mit Menschen zu arbeiten, möglichst in einem Team, verbindet viele. Für einige steht dieser Berufwunsch frühzeitig fest. Andere nutzen das Berufsziel als biographische Auffanglinie, ohne sich festlegen zu wollen. Wieder andere wechseln später aus der Sozialarbeit in einen anderen Beruf. Deshalb „dürfte die Attraktivität der Studienperspektive Sozialarbeit darauf beruhen, daß sie für Studierende biographische Festlegung ermöglicht und gleichzeitig Nicht-Festlegung“ (ebd., 212). Die Offenheit des Berufsbildes, ohne sich genau festlegen zu müssen, hatte für die meisten einen Reiz. Die Ausbildungszeit wird deshalb auch als Zeit zur persönlichen Entwicklung gesehen. Heinemeier arbeitete fünf typische Haltungen zum Berufsbild heraus. Sozialarbeit wurde tendenziell gesehen als: • „‚Königsweg‘ in die eigene berufliche Zukunft“ (ebd., 183); • „Möglichkeit der Befreiung aus fremdbestimmten Erwartungen für die Gestaltung des eigenen Lebens“ (ebd., 190); • „akzeptabler Ausweg aus Orientierungsproblemen und Entscheidungsdilemmata“ (ebd., 197); • „keine ,Ideallinie‘, sondern eher eine Sicherheits- und Auffanglinie nach Erfahrungen des Scheiterns“ (ebd., 203); • „Umweg zu anderen biographischen Zielen“ (ebd., 209). Für viele steht Sozialarbeit als Beruf in Abgrenzung zu Berufsvorschlägen der Eltern. Andere sehen eine Alternative zu den als unattraktiv angesehenen Berufen (z.B. „irgendein Bürojob“) bzw. für sie nicht erfüllbaren Berufsbildern im wirtschaftlichen (z.B. „Marketing“) oder technischen Bereich (z.B. „Innenarchitektur“). Gemeinsam ist den Studierenden der Sozialen Arbeit, dass sie selbst Lebens- oder Orientierungskrisen erlebten und diese Erfahrungen ein Grund für die Wahl eines helfenden Berufes darstellt. Andere grenzen sich ab von üblicher „Normalität und Alltagsroutine“. Dabei geht es auch darum, eigene Lebensentwürfe zu erproben und „etwas Sinnvolles“ zu machen. Die tägliche Arbeit soll einen „Handlungs57 3. THEORETISCHE BEZÜGE spielraum“ zulassen, in dem die Persönlichkeit sich entfalten kann. Dem kommt entgegen, dass handwerkliches, künstlerisches, organisatorisches Geschick sowie praktische und kommunikative Fähigkeiten sich häufig in den Beruf integrieren lassen, sodass die Arbeit auch Spaß machen kann. „Gerade weil Sozialarbeit eine Welt mit buntscheckigen Berufslandschaften, schillernden Kompetenzerwartungen und vielfältigen Identifikationsmöglichkeiten ist, bietet sie sich als ein Projektionsfeld für multiple Erwartungen an“ (ebd., 212). Für die berufliche Identität der SozialarbeiterInnen scheinen der „Handlungsspielraum“ und die „Eigenständigkeit in der Arbeit“ aus unterschiedlichen Beweggründen zentrale Aspekte zu sein. Zu erwarten sind Konflikte mit politischen und institutionellen Vorgaben, die die Entscheidungsspielräume begrenzen. Teamarbeit kann einen emotionalen und fachlichen Rückhalt für Handlungsfähigkeit geben, um sich pragmatisch und kreativ für Menschen einsetzen zu können, selbst wenn Konflikte zu erwarten sind. (3) Biographien und Funktionen in helfenden Berufen Nagel hat anhand von 45 offenen Interviews in den Jahren 1989/90 Berufsrollen in der Sozialarbeit untersucht und den Begriff „engagierte Rollendistanz“ entwickelt (vgl. ebd. 1997), um die Berufskonzeption in helfenden Berufen zu erklären. „Eines der großen Themen in den Interviews mit dem Nachwuchs in der Sozialarbeit – nicht dagegen in der Professionalisierungsdebatte der Sozialarbeit – ist das Problem des Abstandhaltens, was heißt, daß es offensichtlich schwierig ist, ein biographisch praktikables Verhältnis zum Beruf zu sichern, ein solches, das weder die Person emphatisch in der Rolle aufgehen und ausbrennen läßt, noch die Rolle technokratisiert“ (ebd., 149). Die typischen Berufsrisiken der Sozialen Arbeit bestehen darin, Engagement für und Distanz zu Klienten zu vereinbaren. Der Mangel an eigenen wissenschaftlichen Untersuchungen führt häufig zu unkritischen Haltungen und zur unvollständigen Übernahme von Theorien. Ausreichende empirische Befunde für Prognosen fehlen. Schütze ergänzt weitere „Paradoxien“ (vgl. ebd. 1992, 132f.) in der Dynamik von helfenden Beziehungen: Andere Berufe trennen die Rolle von der Person äußerlich sichtbar durch Arbeitsgeräte und Kleidung, aber auch inhaltlich erfolgt eine stärkere Abgrenzung. Dadurch lassen sich ungewollte Grenzüberschreitungen frühzeitiger erkennen. Möglichkeiten des Umgangs mit der Berufsrolle liegen laut Nagel darin, dass die Berufsbiographie langfristig einem Lernprozess un58 3.3 ZUR BERUFLICHEN IDENTITÄT VON FACHLEUTEN DER SOZIALEN ARBEIT terliegt, in dem die Paradoxien sozialarbeiterischer Hilfe, die biographischen Risiken und die Notwendigkeit dauerhaften Schutzes thematisiert werden. „Es ergibt sich so die paradoxe Situation, daß sich die Identität der Person mit sich selbst als SozialarbeiterIn gerade dadurch konstituiert, daß sich ein Modus der Distanzierung von den persönlichen Emotionen verfestigt. Es ist dieses Verhältnis, das durch die Supervision der Gefühle errichtet wird, die Gewohnheit, ... die Wirklichkeit bzw. eine bestimmte Problematik darin zu befragen und diese Gewohnheit als eigenständige Handlungsressource auf Dauer zu sichern“ (ebd., 182). Eine Gewissheit über den Besitz des richtigen Praxisbezuges allein reicht nicht aus. Auch genügend Theoriekenntnisse und praxisbezogenes Fachwissen (Methoden und Techniken) sichern nicht die Identifikation mit der Berufsrolle. Berufliche Professionalität und Identitätsbalance können nur als Ergebnis von Weiterbildung, Selbstkritik, Selbstreflexion, kollegialem Diskurs und Kooperativität erreicht werden. Die Subjektivität (die persönlichen Anteile in einem Fall) lässt sich kontrollieren, wenn komplexe Sachverhalte als solche dargestellt werden. Die Beschäftigung mit der eigenen ursprünglichen Idee von Sozialarbeit, erste Berufserfahrungen und den Veränderungen in den Berufsjahren gehören zur professionellen Identität dazu. „Die Verpflichtung der sozialarbeiterischen Hilfeleistung ... versetzt diejenigen, die sich beruflich auf sie einlassen, systematisch in die Zwangslage, die subjektive Verstehensbasis der Person einerseits als Handlungsressource zu nutzen, sie aber zugleich rollenspezifisch zu realisieren, um die Beratung oder Behandlung des Falles nicht in die Gefangenschaft der eigenen Gefühle und evtl. Vorurteile geraten zu lassen“ (ebd., 206). Die gesellschaftliche Stellung von Sozialarbeit als Feld mit wenig Aufstiegschancen, wenig Prestige und Anerkennung und geringer materieller Entlohnung trotz Erbringens von professioneller Leistung kann dadurch ausgeglichen werden, dass das berufliche Handeln einen Sinn hat. Das breite Sektrum der Tätigkeiten, die umfangreichen Kenntnisse darüber, die Möglichkeit eines – wenn auch begrenzten – Engagements, die Eigenverantwortlichkeit für Hilfeprozesse (trotz hierarchischer Einbindung) und die Versöhnung mit den Hilfemöglichkeiten erleichtern ein Zurechtfinden in der Berufsrolle. „Für die Wahrnehmung der Berufsrolle ist insofern eine Position und Organisation Voraussetzung, die einen weiten Gestaltungsspielraum läßt, d.h. durch ein 59 3. THEORETISCHE BEZÜGE Minimum an formalen Vorgaben reguliert ist. Wenn ein solcher Gestaltungsspielraum vorhanden ist, dann können die SozialarbeiterInnen mit ihrer ganzen Person zum Einsatz kommen, sie können die Arbeit nach ihrer Konzeption gestalten und sich mit ihr identifizieren“ (ebd., 209). Der Konflikt liegt darin, dass strukturelle Vorgaben im System Sozialarbeit häufig verhindern, dass SozialarbeiterInnen ganz hinter ihrem Handeln stehen und so wirksame Hilfe leisten können. In einer Untersuchung der Fachhochschule Wiesbaden wurden berufstätige SozialarbeiterInnen zu Weiterbildungsinhalten interviewt (vgl. Hauer 1990). Die TeilnehmerInnen äußerten sich skeptisch darüber, ob es sinnvoll sei, die Identitätsbildung durch Reflexion zum überwiegenden Thema von Fortbildungen zu machen. Einerseits sollten die Fortbildungen „nicht zu sehr ans Eingemachte“ gehen, weniger die Alltagsprobleme ansprechen und wenig Selbsterfahrungsanteile enthalten. Andererseits sollten die Themen nicht zu abgehoben sein. Gewünscht wurden neue Methoden und Techniken, die anwendbar sind. Dabei wurde die Uneindeutigkeit der bisherigen Angebote kritisiert. Die Befragten befürchteten, dass eine Kompetenzerweiterung nicht stattfindet und die Handlungsfähigkeit durch zuviel Selbstreflexion gelähmt werde. Ein stärkerer Arbeitsfeldbezug wurde gefordert, in dem Konkretion, Sachbezug und Organisationsaspekte vorkommen (ebd. 1990, 108f.). Reflexion der Berufsrolle als Teil der Arbeit zu sehen und sich darin fortzubilden, scheint nur wenig Interesse zu finden und auf Abwehr zu stoßen, besonders dann, wenn das Thema nicht schon Teil des Ausbildungsprozesses war. 3.3.5 Ergänzende Aspekte zur beruflichen Identität Forschungsansätze zur beruflichen Identität beziehen sich meist auf Berufsbiographien und Funktionen in Organisationen und den Grad der Professionalisierung. Nicht enthalten sind häufig Fragen zum Geschlechterverhältnis und Fragen nach Macht und Widerstand. (1) In der Diskussion um berufliche Identität sind die Geschlechterverhältnisse zu berücksichtigen, da sich gesellschaftliche Macht darüber herstellt. „Kulturelle Typisierungsschemata von Männlichkeit und Weiblichkeit sind normativ, weil sie festlegen, was als ‚angemessenes, wünschenswertes, typisches, ideales normales‘ Verhalten bei dem jeweiligen Geschlecht gilt. Diese Orientierungen bleiben nicht einfach äußerlich, sondern sind Bestandteil geschlechtlicher Selbstbilder“ (Dietzen 1993, 76). 60 3.3 ZUR BERUFLICHEN IDENTITÄT VON FACHLEUTEN DER SOZIALEN ARBEIT Geschlechtsidentität ist zunächst eine individuelle Wahrnehmung und wird selten von Männern und Frauen in gleicher Weise hinterfragt. Dietzen verweist auf Verknüpfungen der Identität zu den Geschlechterverhältnissen, anhand derer Bedingungen und Wirkungen analysiert werden können. Sie fragt nach den Bedingungen, unter denen Geschlechtszugehörigkeit • „zu Interpretationen anregt, • Handlungen beeinflusst, • soziale Kontexte als zugehörig gelten und • Geschlechtsbilder verstärken, dass sie sich verfestigen“ (ebd., 91). Das Erlangen und Sichern von Macht erfolgt weniger durch öffentlichen Diskurs und Aushandlungsprozesse, als über ein differenziertes System durch Bildung von Gruppierungen und Bündnissen, in denen über Zugehörigkeit entschieden wird und welche die Geschlechterverhältnisse reproduzieren. Carrigan u.a. meinen, dass „die Dichotomie homosexuell/heterosexuell als zentrales Symbol in allen Männlichkeitsskalen fungiert. Jede Art von Machtlosigkeit oder Verweigerung des Konkurrierens wird unter Männern sofort mit homosexueller Metaphorik in Verbindung gebracht“ (ebd. 1996, 55-56). Auch „Männlichkeit“ unterliegt individuellen Erfahrungen von verinnerlichtem gesellschaftlichem Druck und dient als Kategorie zur Stabilisierung der Geschlechter- und Machtverhältnisse. Brüche und Abweichungen werden sanktioniert. Carrigan u.a. suchen nach Möglichkeiten, „Männlichkeit und die dort anzutreffenden Machtverhältnisse“ zu analysieren. Dazu „müssen die Beziehungen zwischen hetero- und homosexuellen Männern untersucht werden“, weil sich darin „die Grundstruktur von Männlichkeit als politische Ordnung“ abbildet (ebd., 40). Daneben bestätigt die Analyse der „geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, der geschlechtsspezifischen Arbeitsmarktpolitik und dem Zusammenwirken von Geschlechter- mit Klassenverhältnissen“ (ebd., 40) den Zusammenhang von Männlichkeit und Macht. (2) Ein weiterer Aspekt der beruflichen Identität ist die „Widerstandsfähigkeit“ (vgl. Esser u.a. 1996, 230) um auf das zunehmende Risikopotenzial der Gesellschaft (vgl. Beck 1986) und dessen Funktion darin reagieren zu können. Mit Widerstandsfähigkeit ist gemeint: „Bedingungen, eigene Betroffenheiten und potentielle Konsequenzen von sozialen Handlungen und Problemen entschlüsseln zu können; aber auch dadurch, 61 3. THEORETISCHE BEZÜGE alternative Anstöße zu geben und Gegenmaßnahmen mit anderen zu entwickeln“ (Esser u.a. 1996, 230). Aus Berichten über den Holocaust und Beschreibungen von Überlebenden leitet Krahulec ab, dass altruistische Helfer in hohem Maße eine „Selbstwirksamkeitskompetenz“ erworben haben. Er fragt: „Welchen Erfahrungsraum bieten wir also (hoch-)schulisch und außerschulisch für widerständiges Einmischen und prosoziales Verhalten?“ (ebd. 1999, 12). Die Helferpersonen haben die Fähigkeiten erworben, Ungerechtigkeit und Unmenschlichkeit wahrzunehmen, ihre „soziale Hemmung in unstrukturierten Gruppen“ zu überwinden. Sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, und ihnen stehen geeignete Handlungsalternativen zur Verfügung, die sie auch umsetzen können. Die Macht anderer und Gefühle eigener Ohnmacht lähmen oder blockieren nicht die Handlungsbereitschaft (vgl. ebd., 12). „Bei Menschen, die Bürgermut wagen, bestimmt nicht nur der unmittelbare Nutzen das Handeln, sondern der Sinn, den sie ihrem Engagement verleihen. Diese Sinngebung ist bedeutsam, um die Einsamkeit zu ertragen, die mit zivilcouragierter Mitsprache verbunden ist ... Das Haltgebende kann in Idealen und Vorbildern bestehen, in menschlichen Beziehungen, in humanen Wertvorstellungen, in religiöser Bindung“ (Singer 1997, 29). Zivilcourage setzt voraus, dass Menschen bereit sind, ihre „Autoritätsangst zu bearbeiten“ (ebd., 21). Menschen „lassen sich in ihrem Handeln von Werten leiten, die ihnen etwas bedeuten, und treten für ihre Überzeugung öffentlich ein“ (ebd., 25). Wenn Menschen aus ihrem Umfeld anders denken, droht häufig der Bruch mit KollegInnen, FreundInnen, Verwandten, und das macht Angst. „Manche Menschen erleben sich in Alltagssituationen in einem Zwiespalt. Sie möchten nach ihren persönlichen Wertvorstellungen handeln, auch wenn Vorgesetzte anders denken als sie. Gleichzeitig neigen sie dazu, sich anzupassen, um keine Konflikte mit der Obrigkeit auszulösen“ (ebd., 79-80). Es geht um Überzeugungen, Wertmaßstäbe und Urteilsfähigkeit der Handelnden. Dazu ist es erforderlich, ein Mitgefühl zu entwickeln, eigene Gefühle wahrzunehmen und sich unabhängiges Denken zu gestatten. Der Austausch darüber und schließlich das Handeln sind die notwendigen Konsequenzen. „Autoritätsangst zu überwinden beginnt damit, die Angst vor dem Widerspruch nicht zu verleugnen, sondern aufzudecken und zuzulassen. Das vermindert zunächst die Selbstachtung – aber es eröffnet die Chance, den inneren Anpassungszwang zu verstehen ... ihn aufzulösen und schließlich mit der Angst den 62 3.3 ZUR BERUFLICHEN IDENTITÄT VON FACHLEUTEN DER SOZIALEN ARBEIT Konflikt zu riskieren. Dazu ist es notwendig, sich mit Hilfe der Scham auf den moralischen Konflikt in einem selbst einzulassen. Das schafft die persönliche Freiheit, sich seinem ‚identischen‘ Handeln anzunähern“ (ebd., 81). 63 4. Perspektiven zum Stadtteil 4.1 DIE SOZIALSTRUKTUR DES STADTTEILS HANNOVER-VAHRENHEIDE Um der Frage nachzugehen, welche Kontextbedingungen die Vernetzung von Sozialer Arbeit im Stadtteil beeinflussen, soll zunächst Hannover-Vahrenheide mit seiner geschichtlichen Entwicklung und den wesentlichen Sozialstrukturdaten dargestellt werden. Dazu dienen Darstellungen von Bevölkerungsstruktur, Bildungsabschlüssen und Erwerbstätigkeit, Verteilung des Wohnraums, Ausstattung und Gestaltung des Wohnumfeldes sowie wirtschaftlicher Lage und Wahlergebnissen. Diese erste Auswertung der Daten lässt bereits eine räumliche Segregation von Armutsbevölkerung erkennbar werden. Die Strukturdaten sollen mit Sichtweisen der AG-TeilnehmerInnen, der PolitikerInnen und der Leitungskräfte des Jugendamtes verglichen werden. 4.1.1 Zur Geschichte und Struktur des Stadtteils Der Stadtteil mit ca. 10.000 Einwohnern liegt im Norden Hannovers an der Stadtgrenze, zwischen dem Mittellandkanal mit seinen angrenzenden Kleingärten und der Bundesautobahn A2 Dortmund–Berlin. Ein großes Industriegebiet im Westen und eine Großwohnanlage des benachbarten Stadtteils Sahlkamp im Osten begrenzen Vahrenheide. Das Stadtzentrum Hannovers liegt ca. 6 Kilometer Luftlinie entfernt. Das Gebiet der „Vahrenwalder Heide“ war früher eine große Sandfläche, durchsetzt mit wild gewachsenen Gehölzen. Bereits um 1850 lag dort der „Exerzierplatz der Hannoverschen Garnison“. Um die Jahrhundertwende unternahm Flugpionier Karl Jatho in der Heide erste Flugversuche und gründete die „Hannoverschen Flugzeugwerke“, die nur kurze Zeit bestanden. 1910 wurde in dem Gebiet ein Fliegerbataillon stationiert, Luftschiffe starteten und landeten dort. Ab 1923 wurde im Westen ein ziviler Flughafen eingerichtet, der wichtige Flugstrecken miteinander verband. Im zweiten Weltkrieg wurde der Flughafen fast vollständig zerstört. Teile des alten Flughafengeländes und des alten Gebäudebestandes wurden von der Bundeswehr übernommen. Das restliche Gelände ist 1959 zum Gewerbegebiet geworden (vgl. Bultmann u.a. 1989, 175f.). Wie in anderen Großstädten auch, wurden in Hannover neue Stadtteile an den Stadträndern gebaut, um in den 1960er und 70er Jahren den Bedarf an 64 4.1 DIE SOZIALSTRUKTUR DES STADTTEILS HANNOVER-VAHRENHEIDE Sozialwohnungen zu decken. Durch Verlagerung des militärischen Übungsgeländes und des Flughafens in den 60erJahren standen weitere große Flächen zur Verfügung, die von der Stadt für Wohnungsbau genutzt wurden. Vahrenheide besteht aus einer Einfamilien- und Reihenhaussiedlung (Vahrenheide-West) sowie drei- bis viergeschossigen Zeilenbauten der späten 50er und frühen 60er Jahre und einer Erweiterung aus den beginnenden 70er Jahren durch verdichtete Geschosswohnungsbauten mit 7 bis 18 Wohngeschossen (Vahrenheide-Ost). Vermieter der dortigen Sozialwohnungen sind im Wesentlichen zwei Baugesellschaften (GBH Gesellschaft für Bauen und Wohnen und die Deutsche BauBeCon). „Während ähnliche Entwicklungen an anderen Stadtrandabschnitten immerhin einen Kristallisationspunkt aus der Vergangenheit anzubieten hatten, musste hier alles neu entwickelt, ein ‚Zentrum‘ erfunden werden, das mit seinen Einkaufsmöglichkeiten, mit Kirche, Schule und etlichen Verwaltungsbauten das Ganze zusammenhalten soll“ (Hannoversche Allgemeine Zeitung, 17.9.1958). Die Verkehrsanbindung vom Stadtzentrum erfolgt über zwei Buslinien zum östlichen Teil und über eine Stadtbahnlinie zum nordwestlichen Teil. Im Stadtteil gibt es neben der Grundschule eine Hauptschule, eine Orientierungsstufe und ein Gymnasium. Zukünftig wird jahrgangsweise eine Integrierte Gesamtschule aufgebaut. Ein Freischwimmbad liegt in etwa zwei Kilometer Entfernung. Eine Polizeistation gibt es seit 1996, nachdem sich Jugendliche verschiedener Cliquen auf Straßen und Plätzen heftige Auseinandersetzungen geliefert hatten. Durch die Lage an der Stadtgrenze hat Vahrenheide direkten Zugang zu Naherholungsgebieten. Im Stadtteil selbst gibt es einen großen Anteil öffentlicher Grünflächen, die mittlerweile, 30 Jahre nach der Bebauung, mit hohen Büschen und Bäumen bewachsen sind. Vahrenheide bietet ein Bild heute, wie andere Großsiedlungen auch, mit typischen städtebaulichen Erscheinungsformen. Breite Erschließungsstraßen führen an den Rand des Gebietes. Kleinere Stich- und Wohnstraßen führen zu den langgezogenen Zeilenbauten und zu den Hochhäusern. Markant für den Stadtteil ist ein Marktplatz, eingerahmt von einem Hochhauskomplex – teilweise mit Eigentumswohnungen – im westlichen Teil und einem weiteren 18-geschossigen Wohnblock am östlichen Rand. Im östlichen Teil führte die Art der Finanzierung zum Bau von Sozialwohnungen und über die Belegung zu einer einseitigen Mieterstruktur, die bis heute besteht (vgl. Döschner, Urban 1982, 7-15; Landeshauptstadt Hannover 1997a). Geschäfte des täglichen Bedarfs befinden sich in drei Ladenzeilen verteilt, in deren Nähe es auch diverse Arztpraxen gibt. Besonders in Vahrenheide65 4. PERSPEKTIVEN ZUM STADTTEIL Ost wechselten die Filialen häufiger die Besitzer und sind mittlerweile geschlossen. Zuvor hatte es dort Probleme mit Einbrüchen, Diebstählen und massiven Bedrohungen der Mitarbeiter gegeben. Der Umsatz ging zurück, die Kunden wechselten zu Geschäften am Vahrenheider Markt, Großmärkten im Industriegebiet oder benachbarten Stadtteilen. Eine belebte Einkaufsatmosphäre herrscht lediglich am Vahrenheider Markt, in der Nähe der Stadtbahnhaltestelle. Dort befinden sich die wenigen Kneipen, Kioske, Bäcker, Schlachter, eine Eisdiele, ein Café und kleinere Einkaufsmärkte des Stadtteils. Die nachfolgenden Presseauszüge verdeutlichen die damalige Aufbruchstimmung und damit verbundene Hoffnungen der Stadtplaner und Politiker. „Die Vahrenheide wandelt ihr Gesicht in beinahe atemberaubendem Tempo. Wo noch vor Monaten Heide wucherte, ziehen sich jetzt glatte Asphaltstraßen mit hellen Häusern in ein-, drei- und fünfgeschossigem Rhythmus entlang“ (Hannoversche Allgemeine Zeitung: 14.9.1960). „Jetzt fällt schon auf, daß es eine sehr moderne Stadt sein wird. Es gibt viel Platz da draußen. Es gibt große Grünflächen zwischen den Häusern, es gibt an allen Ecken und Enden Spielplätze und Sandkästen für die Kinder. Am Sand fehlt es ja nicht. Aber es fehlt auch nicht am Willen, die neue Stadt so gut, so schön, so gesund wie nur möglich zu machen, draußen in der Vahrenheide“ (Hannoversche Allgemeine Zeitung, 7./8.10.1961). In den Folgejahren zählten der Anschluss an den Öffentlichen Nahverkehr, Rad- und Fußwegverbindungen, die Sicherheit, der Müll an den Straßenrändern, die fehlende Infrastruktur an sozialen Einrichtungen und Ärzten, ein fehlender Wochenmarkt, Verkehrsführung und fehlende Einkaufsmöglichkeiten zu den öffentlich diskutierten Problemen. „Wohnen nach Maß“ war das anfängliche Motto des Bauträgers in einem „lebendigen Stadtteil mit weiterhin aufstrebender Tendenz“ (vgl. Hannoversche Allgemeine Zeitung, 18.2.1971). Doch bereits 1973 fragt die örtliche Presse in einem Artikel „Eine Großsiedlung zum Beispiel – damals modern, heute überholt?“ Von „auswechselbarer Großstadtsiedlung“, „Monotonie“, „einheitlicher Einfallslosigkeit“ ist die Rede und dass die Häuser wie Windkanäle wirken, den Lärm verstärken und in Zeilen wie Kompanien aufgereiht sind (vgl. Hannoversche Allgemeine Zeitung, 20.3.1973). 66 4.1 DIE SOZIALSTRUKTUR DES STADTTEILS HANNOVER-VAHRENHEIDE 4.1.2 Wohnumfeldverbesserung und Sanierung Hannover stellte 1985 bis 1986 Haushaltsmittel für Gutachten zur Verbesserung von Wohngebieten der 60er und 70er Jahre bereit. Es ging der Stadt dabei um „präzises Sachwissen“. Man befürchtete „Wohnungsleerstände“, „hohe Fluktuationen“, eine „soziale Entmischung“ und „negatives Ansehen“. Der Bauträger sorgte sich um die Vermietbarkeit, wofür zumindest 1986 und 1989 aufgrund der starken Wohnungsnachfrage kein Anlass bestand. Die zentrale Frage war, welche Maßnahmen geeignet sein würden, die Großwohnsiedlungen attraktiver zu gestalten. Federführend bei der Vergabe der Gutachten und Auswertung war das Stadtplanungsamt. Folgende Themen sollten bearbeitet werden: „Zuzüge von Sozialmietern und Beratungs- bzw. Betreuungsbedarf, Leerstände, Fluktuation und Betriebskosten, Kostenermittlung von Wohnumfeldmaßnahmen, Umnutzung von Hochgaragen, Defizite an Gemeinschaftseinrichtungen, Aufenthaltsmöglichkeiten für Jugendliche sowie Kinderspiel in verschiedenen Wohngebieten“ (P8). Die BewohnerInnen nannten bereits 1986 Themen, die bis heute als problematisch gelten: Störend fanden sie besonders in Hochhausblöcken den Lärm und die Verschmutzung. Ferner bemängelten sie, Kinder und Jugendliche großer Familien hätten keine eigenen Räume und lebten beengt. Problemmieter zögen in das Viertel, wie z.B. Drogenabhängige, psychisch Kranke, Strafentlassene, Alleinerziehende ohne eigenes Einkommen, ebenso „Multiproblemfamilien“ mit Schulden-, Alkohol- und Drogenproblemen. Auch unsoziales Verhalten wurde als Problem genannt. Die Bereitschaft zur Beteiligung erwies sich als sehr begrenzt. Ein Forscher äußerte sich über seine Erfahrungen bei einer Befragung: Es hätten sich 40 bis 50% der Leute geweigert, an den Gesprächen teilzunehmen (vgl. P8/Protokoll v. 27.5.86). Das Stadtplanungsamt gründete im April 1986 einen interdisziplinären „Gesprächskreis Wohnumfeldverbesserung“ mit dem Ziel, die Untersuchungen zu begleiten. Das Besondere dieses Gesprächskreises waren das finanzielle und personelle Engagement von Stadt, Baugesellschaft, MieterInnen und Initiativgruppen, das Zusammenwirken von städtebaulichen, baulichen und sozialen Fachkräften im Planungsprozess sowie das Bestreben, über Einzelmaßnahmen hinaus Verbesserungen des Wohngebietes zu erzielen. Erreicht wurde das durch regelmäßige monatliche Zusammenkünfte mit wirksamer Diskussion und Abstimmung der Verfahrensschritte und sicher auch durch einen fachlich versierten und geschickten Koordinator der Sanierungsabteilung. 67 4. PERSPEKTIVEN ZUM STADTTEIL Zunächst standen eher stadt- oder grünplanerische Projekte zur Diskussion, wie z.B. Bau oder Erneuerung von Spielplätzen, Aufpflasterung/Verkehrsberuhigung von Überwegen und Schaffung neuer Fußwege, Anlegen von Mietergärten, Verschönerung von Hauseingängen, Pflanzen von Bäumen (vgl. P8, Protokoll vom 19.3.86). Durch die regelmäßige Beteiligung von SozialarbeiterInnen am Planungsprozess wurden soziale Projekte diskutiert und in den folgenden Jahren auch verwirklicht. So wurden ein Grünpflegeprojekt mit Pflanzfläche und Gewächshäusern als Beschäftigungsprojekt, ein Hochgaragenumbau für eine Nachbarschaftsinitiative und ein Jugendtreff sowie ein weiterer Umbau einer Hochgarage für eine Kindertagestätte und andere soziale Einrichtungen gefördert (vgl. P8, Protokoll vom 5.4.91). Die Sanierungssatzung wurde nach fast 10-jähriger Vorbereitung 1998 beschlossen und legte damit das Sanierungsgebiet Vahrenheide-Ost fest. Das Gebiet umfasst 82 Hektar, 3.639 Wohnungen und 8.266 Einwohner. Das Land Niedersachsen nahm damit erstmalig einen Stadtteil der 70er Jahre in die Landesförderung auf (vgl. Landeshauptstadt Hannover; GBH 1998, 45). Über einen Zeitraum von 15 Jahren sollen 30 Millionen als Städtebauförderung in bauliche Investitionen fließen. Flankierende Maßnahmen sollen für Beschäftigung und Qualifizierung sorgen, soziale und kulturelle Stadtteilarbeit durch zusätzliche finanzielle Mittel umgesetzt werden. Durch das Wohnumfeldprogramm von 1986 bis 1997 ist bereits an vielen Stellen der Aufbau der sozialen Infrastruktur, die Nutzung öffentlicher Flächen und in Ansätzen die Beteiligung der BewohnerInnen gefördert worden. Als zentrale Probleme und Defizite gelten: der große Anteil von 85% Sozialwohnungen mit Belegrechten des Wohnungsamtes und dessen Folgen mit hoher Abnutzung der Wohnungen, Belastungen der Infrastruktur und sozialen Spannungen. Das von der Landeshauptstadt Hannover als Sanierungsträger und der Gesellschaft für Bauen und Wohnen als Eigentümerin entwickelte Konzept sieht eine „Integrierte Sanierung“ wie folgt vor: „Durch die Bündelung städtebaulicher, sozialer und wirtschaftlicher Handlungsfelder zu einem integrativen Konzept sollen • die Wohnqualität verbessert, • ökologische Erfordernisse (z.B. Agenda 21) berücksichtigt, • die Bewohnerstruktur stabilisiert, • die soziale und kulturelle Stadtteilarbeit intensiver gestaltet, • kleinteilige, im Wohnquartier verankerte Weiterbildungs-, Qualifizierungsund Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden“ (LHH 1997b, 3). 68 4.1 DIE SOZIALSTRUKTUR DES STADTTEILS HANNOVER-VAHRENHEIDE Zur Umsetzung wurde ein Bürgerforum gegründet, das alle zwei Wochen in einer offenen Versammlung tagt. Es beschäftigt sich mit Fragen der Sanierung und gibt dazu gegenüber der Sanierungskommission Positionen und Einschätzungen ab. Diese Kommission ist vom Stadtrat eingesetzt, um alle Entscheidungen zur Sanierung vorzubereiten, die dann im Bezirksrat beraten und im Stadtrat beschlossen werden. Das Verfahren für kommunalpolitische Belange hat sich durch diese zwei zusätzlichen politischen Gremien verändert. Vorschläge durchlaufen nacheinander die folgenden vier Ebenen: Tabelle 7: Gremien zur Meinungsbildung und Entscheidung in Vahrenheide Bürgerforum: (offenes Forum im Stadtteil mit SprecherIn): Sanierungskommission Vahrenheide: (als Ratsausschuss mit 8 Rats- und Bezirksratsmitgliedern und 8 von Parteien benannten BürgervertreterInnen plus 1 Sitz): 8 SPD, 6 CDU, 2 Bündnis 90/Die Grünen, 1 FDP (stimmloses Grundmandat) Bezirksrat: 9 CDU, 9 SPD, 1 Bündnis90/Die Grünen, 1 FDP, 1 Wir für Hannover Rat der Stadt: 30 SPD, 22 CDU, 6 Bündnis90/Die Grünen, 4 FDP, 1 Wir für Hannover, 1 PDS (vgl. Landeshauptstadt Hannover 2001a). 4.1.3 Zur Bevölkerung Vahrenheides (1) Wohnbevölkerung nach Altersgruppen Vahrenheide ist ein junger Stadtteil mit relativ vielen Kindern und Jugendlichen, obwohl gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang der Altersgruppen unter 18 Jahren von ca. 4 bis 5% zu verzeichnen ist (vgl. Landeshauptstadt Hannover 1998a). Die Zahl der Einwohner ist in Vahrenheide erstmalig unter 10.000 gesunken. 69 4. PERSPEKTIVEN ZUM STADTTEIL Tabelle 8: Bevölkerungsstruktur nach Altersgruppen Altersgruppen (in Jahren) Vahrenheide Hannover m W Gesamt in % in % 0-2 175 195 370 3,8 2,9 3-5 204 190 394 4,0 2,5 6-9 257 200 457 4,7 3,3 10-15 350 333 683 7,0 4,8 16-17 123 116 239 2,4 1,7 18-29 741 751 1492 15,2 17,4 30-44 1.157 929 2.086 21,3 25,0 45-64 1.190 1.196 2.386 24,3 24,7 65-74 428 605 1.033 10,5 9,2 75 u.ä. 196 471 667 6,8 8,6 4.821 4.986 9.807 100,0 100,0 Gesamt (Landeshauptstadt Hannover 1999) Die Wohnungsgesellschaften als Vermieter sorgen sich wie schon in den 90er Jahren um Leerstände und die Vermietbarkeit der Wohnungen. Prognosen über die Einwohnerentwicklung sagen für die Jahre bis 2010 eine Abnahme der Zahl von Kindern bis 11 Jahren je nach Altersgruppe um 20 bis 30% voraus. Ein Rückgang bei den 20- bis 34-Jährigen um 1062, also 18,8%, wird erwartet, bei den 35- bis 59-Jährigen sollen es 964, also 11,5% sein. Dagegen ist eine erhebliche Zunahme von älteren Menschen zu erwarten: Die Zahl der 65- bis 74-Jährigen wird um 46,8% ansteigen. Ähnliches ist auch für die über 74-Jährigen zu erwarten (vgl. Kommunalverband Großraum Hannover u.a. 1993). (2) MigrantInnen in Vahrenheide Eine Zuordnung von Staatsangehörigkeiten der Bewohnerschaft nach statistischen Bezirken erlaubt die Aussage, dass MigrantInnen vorrangig in dem Hochhausgebiet (mit Sozialwohnungen) und dessen näherer Umgebung leben. 70 4.1 DIE SOZIALSTRUKTUR DES STADTTEILS HANNOVER-VAHRENHEIDE Tabelle 9: Bevölkerungsstruktur nach deutscher und anderer Staatsangehörigkeit Bevölkerung/Nationalität Deutsch Andere alle Vahrenheide- West 1.617 420 2.037 Vahrenheide- Ost 4.990 2.736 7.726 41 3 44 6.948 2.859 9.807 Vahrenheide- Nordwest Gesamt (vgl. Landeshauptstadt Hannover 1999) In fünf Teilbereichen der Stadt sind Aussiedler räumlich konzentriert. Dazu gehören die benachbarten Stadtteile Vahrenheide und Sahlkamp. Zugang und Verteilung auf dem Wohnungsmarkt scheinen die soziale Segregation zu fördern (vgl. Heinelt; Lohmann 1992, 153f.). Die Verteilung ist aus den statistischen Angaben nicht genau ersichtlich, da Aussiedler als Deutsche geführt werden. Dennoch entstehen aus der Segregationsanalyse Anforderungen an die Sozialpolitik hinsichtlich Beratung, Bildung und gesellschaftlicher Partizipation. Die Statistik über die MigrantInnen aufgeschlüsselt nach Nationalitäten gibt eine erste Tendenz an und erlaubt Schlüsse über den jeweiligen rechtlichen Status. Sie sagt allerdings wenig darüber aus, wie sich die Menschen z.B. sprachlich, ethnisch oder sozial orientieren. In dem Zusammenhang ist auch die im Vergleich zu Arbeiterstadtteilen ähnlich hohe Zahl der dem Islam angehörenden Menschen (1196) zu sehen. Nichtdeutsche im Verhältnis zu Deutschen sind in den Altersgruppen zwischen 0 bis 5 Jahren in absoluten Zahlen nahezu gleich stark (386/384), bei den 6- bis 9-Jährigen (242/215) sind sie etwas stärker vertreten. Bei den 10bis 15-jährigen gibt es etwa 60% Deutsche im Verhältnis zu Nicht-Deutschen (276/407). Die 16- und 17-Jährigen sind wieder in nahezu gleicher Anzahl vertreten (118/121). Hervorzuheben ist die mit steigendem Alter abnehmende Zahl von MigrantInnen, z.B. bei den 65- bis 74-Jährigen (95/ 938) (vgl. ebd. 1999a). 71 4. PERSPEKTIVEN ZUM STADTTEIL Tabelle 10: Bevölkerungsstruktur nach Nationalitäten Nationalitäten in Vahrenheide West und Nord Ost Gesamt 1.658 4.990 6.648 Italiener 3 43 46 Spanier 20 27 47 eh. Jugoslawen 95 240 335 Griechen 13 49 62 204 1.349 1.553 Polen 14 81 95 übr. Europa 31 325 356 Afrikaner 12 84 96 1 3 4 29 450 479 1 85 86 2.081 7.726 9.807 Deutsche Türken USA/Kanadier Asiaten (incl. Iran) Sonstige Gesamt (vgl. Landeshauptstadt Hannover 1999) (3) Bildungsabschlüsse Die Angaben sind aus einer umfassenden Bestandsaufnahme der Sozialstruktur der Stadtteile Hannovers aus dem Mikrozensus der Volkszählung von 1987 entnommen. Aktualisierte Zahlen liegen jeweils nur für Teilaspekte vor. Die Tendenz ist jedoch für den Stadtteil Vahrenheide weiterhin gültig. Für Vahrenheide-Ost sind die Tendenzen jeweils verstärkt anzunehmen. 72 4.1 DIE SOZIALSTRUKTUR DES STADTTEILS HANNOVER-VAHRENHEIDE Tabelle 11: Bildungsabschlüsse in Vahrenheide und Hannover Stand 1987 Vahrenheide Hannover Hauptschulabschluss 71,4% 52,4% Realschulabschluss 17,5% 24,5% Hochschulreife 11,0% 23,1% 6,0% 12,8% Hochschulabschluss (Vgl. Hermann 1992, 26-35) Die geringste Abnahme an Hauptschulabschlüssen in den Jahren der Bildungsreform ist in Vahrenheide festzustellen. Neben zwei Industriegebieten (Misburg-Süd 9,9% und Brink-Hafen 5,2%) war Vahrenheide-Ost der Stadtteil mit den geringsten Prozentzahlen an Abiturienten (8,5%). Auch 1998 gab es noch überdurchschnittliche Quoten von Hauptschulabsolventen im Stadtbezirk Bothfeld-Vahrenheide und besonders in VahrenheideOst im Vergleich zur Hannover. Durch Gründung einer Integrierten Gesamtschule im Jahr 1995 wird hier langfristig eine Veränderung erwartet. Die Entwicklung der Schulabschlüsse lässt sich noch nicht auswerten. Im Schuljahr 2000/2001 besuchten bereits 42% aller Schüler Vahrenheides die IGS, während lediglich 11% der Schüler eine Realschule und 17% ein Gymnasium besuchten. Im Regierungsbezirks Hannover war der Schulbesuch mit 17% in Gesamtschulen, 18% in Realschulen und 28% in Gymnasium anders verteilt (vgl. Geiling u.a. 2001). Eine Gesamtschule scheint für einen sozialen Brennpunkt eine Bildungschance darzustellen. Unterdurchschnittliche Besuchszahlen bei den Kursen der VHS bestätigen das Bildungsgefälle innerhalb des Stadtteils und gegenüber dem Stadtdurchschnitt. Gleichzeitig sind über die Hälfte aller VHS-TeilnehmerInnen aus Vahrenheide auf Ermäßigung aufgrund von Arbeitslosigkeit angewiesen (vgl. Landeshauptstadt Hannover 1998b, 61f.). Es stellt sich die Frage, inwieweit außerschulische Bildungseinrichtungen für Familien oder Erwachsene den Bildungsdefiziten entgegenwirken können und welche Voraussetzungen dafür erforderlich sind. (4) Erwerbstätigkeit Verglichen mit anderen Stadtteilen im Westen und Norden Hannovers (angrenzende Gewerbegebiete) waren 1998 von den Erwerbstätigen besonders 73 4. PERSPEKTIVEN ZUM STADTTEIL in Vahrenheide überdurchschnittlich viele Arbeiter vertreten (vgl. LHH 1998b). In Vahrenheide-Ost war 1997 ein hoher Anteil der Berufstätigen (1215) im produzierenden Gewerbe und ein geringer Teil im Dienstleistungssektor (494) tätig. Die Verteilung von Schulabschlüssen und die Stellung im Beruf korrespondieren auch in Vahrenheide miteinander. Vahrenheide-West grenzt unmittelbar an ein großes Gewerbegebiet. Das hat wenig Auswirkungen auf die Erwerbstätigkeit der BewohnerInnen, die den gesellschaftlichen Randgruppen zugerechnet werden. Vahrenheide kann als Arbeiterstadtteil ohne Zugang zu Arbeitsstätten und ohne Arbeit bezeichnet werden. Es waren im Jahr 1997 für Vahrenheide-West 71 (1998:92) und für Vahrenheide-Ost 916 (1998:1.076) Personen als erwerbslos gemeldet, davon war nahezu jeder Dritte (440) länger als ein Jahr arbeitslos. Unter den Arbeitslosen in Vahrenheide waren 894 Arbeiter (vgl. Landeshauptstadt Hannover 1998b). Tabelle 12: Erwerbstätigkeit in Vahrenheide Vahrenheide Nord West Ost Erwerbstätige 36 936 2651 Selbstständige 2 68 79 Angestellte/Beamte 19 628 914 Arbeiter 15 240 1658 Schüler 4 229 1229 Erwerbslose – 71 916 Produzierendem Gewerbe 7 200 1215 Dienstleistungssektor 9 169 494 20 567 942 Davon beschäftigt in: übrig.Wirtschaftsbereichen (vgl. Landeshauptstadt Hannover 1997a) Wie auch in anderen Stadtteilen mit hohem Anteil an Arbeitern bedeutet der Rückgang der Beschäftigungszahlen im zweiten Sektor eine Zunahme der Arbeitslosigkeit, soweit nicht in Dienstleistungsbereiche umgeschult 74 4.1 DIE SOZIALSTRUKTUR DES STADTTEILS HANNOVER-VAHRENHEIDE bzw. gewechselt werden kann. Denn gerade im dritten Sektor entwickelten sich in den vergangenen Jahren neue Arbeitsstellen, die allerdings auch neue und qualifizierte Bildungsabschlüsse erforderlich machten. Dies gelang nicht für das Wohnquartier Vahrenheide-Ost, denn ca. ein Drittel der BewohnerInnen im arbeitsfähigen Alter ist unmittelbar von Arbeitslosigkeit und ihren Folgen betroffen. Anzunehmen ist, dass zusätzlich zur statistischen Quote weit mehr BewohnerInnen über kurze Zeit Arbeitslosigkeit erfahren haben. Ein Rückgang der Erwerbstätigkeit im produzierenden Gewerbe ist bereits seit 20 bis 30 Jahren festzustellen. Die Kommunalpolitik hatte lange Zeit die Zuständigkeit abgelehnt und auf die Bundespolitik verwiesen. Das hat sich partiell verändert, die Integrierte Sanierung versucht die Problematik aufzugreifen und organisiert Beschäftigungsförderung von gering Qualifizierten (vgl. Sanierungsbüro Vahrenheide-Ost 2000). (5) Wohnen und Wohnumfeld Der Stadtteil Vahrenheide umfasst eine Größe von 4,6 Quadratkilometern oder 463 Hektar (das entspricht der Fläche von 5.000 Fußballfeldern). Die Wohndichte beträgt 22,3 Personen/Hektar. Der Wert liegt in der Nähe des städtischen Durchschnitts (22,4). Im Stadtteil Vahrenheide stehen den BewohnerInnen großzügige Grünflächen zur Verfügung. Nur wenige Stadtteile liegen in den Werten erheblich darüber. Diese sind als „gehobene Wohnviertel“ Hannovers einzustufen. Beim Vergleich zwischen VahrenheideWest und -Ost fällt auf, dass in Vahrenheide-Ost fünfmal mehr Menschen auf gleicher Fläche leben (2.037 Einwohner in Vahrenheide-West mit 174ha, 7.726 Einwohnern in Vahrenheide-Ost mit 139ha und 44 Einwohner in Vahrenheide-Nord-West als Industriegebiet mit 151ha). Die vorhandenen Freiflächen sind vorwiegend öffentliches Grün. Als sogenannte „Abstandsflächen“ sind sie zwischen den Wohnhäusern mit Bäumen und Büschen bepflanzt. Sie haben überwiegend keine spezielle Nutzungsfunktion (vgl. Hermann 1992, 184-187). In Vahrenheide sind die höchsten Geburtenziffern Hannovers festzustellen. Die Zahl der nichtehelichen Geburten liegt mit 28,7% über dem städtischen Durchschnitt von ca. 20%. (vgl. LHH 1993, 23f.). Durch die neuen Formen des Zusammenlebens bedeutet das nicht zwangsläufig eine Benachteiligung. Allerdings ist auffällig, dass etwa die Hälfte aller Familien mit Kindern auf die Hilfe des Kommunalen Sozialdienstes in Vahrenheide angewiesen war (vgl. ebd., 85). Es gibt in Vahrenheide eine mit 722 (15,2%) 75 4. PERSPEKTIVEN ZUM STADTTEIL hohe Zahl von Vier- und Mehrpersonenhaushalten. Die Wohnfläche je Person beträgt für Vahrenheide 30,2 qm, für Vahrenheide-West 37,2 qm, für V.-Nord 38,8qm und für V.-Ost 28,6 qm (LHH 1998b, 54). Vahrenheide ist der Stadtteil, in dem die meisten Familien mit kleinen Wohnungen auskommen müssen. Die Wohnfläche pro Kopf liegt hier stadtweit am niedrigsten (vgl. Hermann 1992, 140-145). Die Konzentration von Belegrechtswohnungen liegt in Vahrenheide bei 64%, in Vahrenheide-Ost bei 85%, stadtweit bei 12%. In vier weiteren Stadteilen liegt der Anteil über 30% (vgl. LHH 1998b, 54f.). Beim Kronsberg, einem neu entstehenden Wohnquartier in der Nähe des EXPO-2000-Ausstellungsgeländes, wurde darauf geachtet werden, dass der Anteil 30% nicht überschreitet. (6) Ausprägung von Armut Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe) erhielten am 31.12.98 in Vahrenheide 19,1% der Bevölkerung, das sind 1.850 Empfänger. Das ist im Vergleich mit anderen Stadtteilen eine hohe Anzahl und ein hoher Anteil an den Haushalten im Stadtteil. Familien, vor allem Alleinziehende mit Kindern, sind besonders häufig auf diese Hilfe angewiesen. Vahrenheide hat stadtweit einen der höchsten Anteile von Alleinerziehenden; über die Hälfte (57,1%) sind auf Sozialhilfe angewiesen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren leben zu 31,7% in Empfängerhaushalten, ebenso nicht-deutsche Kinder mit 35%. In Vahrenheide erhalten 7,6% der über 60-jährigen Menschen Sozialhilfe. Das ist deutlich mehr, als in anderen Stadtteilen (vgl. LHH 1998b, 28f.). Ergebnisse ersten Sozialberichts von 1993 sind: In Hannover zeichnen sich Armutszonen ab, die sich in innenstadtnahe Gebiete, Stadtrandgebiete und Großsiedlungen aufteilen. Großsiedlungen weisen nur wenige Dienstleistungsbetriebe und kommunale Infrastruktur auf. Die Nutzung ist häufig auf reines Wohnen beschränkt und durch Belegrechte an Wohnungen „sozial entmischt“. Zusätzlich kommen in Großsiedlungen drei Faktoren erschwerend zusammen. Ein absolut hoher Anteil an Sozialhilfeempfängern, ein relativ hoher Empfängeranteil an der Bevölkerung und ein hoher Empfängeranteil Nichtdeutscher. Dadurch werden bestimmte Quartiere als „Armutsviertel“ identifiziert und stigmatisiert. Armutsbekämpfung muss besonders in den Großsiedlungen ansetzen, lautete das Fazit (vgl. ebd., 52f.). 76 4.1 DIE SOZIALSTRUKTUR DES STADTTEILS HANNOVER-VAHRENHEIDE (7) Wahlen und Beteiligung Wahlverhalten und Wahlbeteiligung stehen in einem engen Zusammenhang mit dem jeweiligen sozialen und städtebaulichen Umfeld. In Hannover ist eine hohe Wahlbeteiligung eher in den „Wohlstandsstadtteilen“ festzustellen. Diese sind Hochburgen von CDU- und FDP-WählerInnen. Sozial benachteiligte Stadtteile stellen eher die Wählerschaft von SPD und Republikanern. Die Republikaner erreichten in Wahlbezirken mit hohem Sozialwohnungsanteil überdurchschnittlich hohe Stimmenanteile. Bündnis 90/ Die Grünen liegen quer zu dieser Aufteilung, haben jedoch ihre höchsten Anteile in innenstadtnahen Altbauquartieren (vgl. Landeshauptstadt, Landkreis Hannover u.a. 1998). Dazu sind die Wahlen der letzten 10 Jahre ausgewertet worden, um typische Trends für den Stadtteil Vahrenheide aufzuzeigen. Im Folgenden sind die Ergebnisse der letzten Landtags- und Bundestagswahl dargestellt, es handelt sich jeweils um Erststimmenergebnisse. Tabelle 13: Landtagswahl Niedersachen 1.3.1998 Vahrenheide Hannover Wahlbeteiligung 60,3 % 73,3 % ungült. Stimmen 4,2 % 2,2 % SPD 56,0 % 50.4 % CDU 36,4 % 33,5 % B90/Grüne 4,6 % 12,0 % FDP 3,1 % 3,1 % Republikaner 0% 0,4 % ÖDP 0% 0,1 % (Landeshauptstadt Hannover 1998c) Auffallend ist der relativ hohe Anteil von ungültigen Stimmen, der in einigen Stimmbezirken bis zu 6,3% erreicht. Gegenüber früheren Wahlen sind im Jahr 1998 Stimmenanteile für andere kleine Parteien, u.a. für Republikaner (über 3% in Vahrenheide und 2,1% stadtweit) deutlich zurückgegangen. Auffällig ist die niedrige Wahlbeteiligung im Vergleich zum Stadtdurchschnitt. In einigen Bezirken liegt sie um 50% und geht im Hochhaus77 4. PERSPEKTIVEN ZUM STADTTEIL gebiet (Vahrenheide-Ost) bis auf 39,9% zurück. In drei Bezirken mit Einfamilienhäusern steigen die CDU-Stimmenanteile auf bis zu 47,4% und die der Bündnis90/Die Grünen bis 6,7% an. Tabelle 14: Bundestagswahl 27.9.98 Vahrenheide Hannover Wahlbeteiligung 73,5 % 83,3 % ungült. Stimmen 1,8 % 1,0 % SPD 56,3 % 54,1 % CDU 35,0 % 32,9 % B90/Grüne 2,7 % 6,8 % FDP 1,8 % 2,4 % Republikaner 2,9 % 1,6 % Sonstige 1,4 % 2,0 % (Landeshauptstadt Hannover 1998d) Bei den Zweitstimmen der Bundestagswahl 1998 sind Republikaner, DVU und NPD zusammen mit lediglich 3,5% der Stimmen gewählt worden. In den Hochhäusern (Vahrenheide-Ost) erlangte die CDU nur 23,2% der Stimmen, die SPD 66,2%. Und in zwei Stimmbezirken (Vahrenheide-West) erreichte die CDU annähernd gleich hohe Ergebnisse wie die SPD (SPD/CDU 49,0/43,1% und 46,9/43,5%) (vgl. ebd. 1998d). Aus den Wahlergebnissen geht hervor, dass sich eine Teilung des Stadtteils in West und Ost nicht nur in der sozialen Lage der Bewohnerschaft (Sozialleistungsbezug/Arbeitslosigkeit/beruflicher Status), sondern auch im Wahlverhalten widerspiegelt. Hier sind unterschiedliche Milieus erkennbar, deren Trennungs- und Verbindungslinien auch Auswirkungen auf die Arbeit der sozialen Einrichtungen haben. Für Vahrenheide sind folgende Tendenzen bei den Wahlen erkennbar: Die Wahlbeteiligung gehört zu den niedrigsten in Hannover. Der Anteil der ungültigen Stimmen ist hier am höchsten. Die Republikaner erhalten in Vahrenheide im Vergleich zu anderen Stadtteilen regelmäßig die höchsten Anteile. Allgemeine politische Trends erfahren hier jeweils eine besondere Ausprägung. Diese äußern sich im Wahlverhalten als folgende Alternati78 4.1 DIE SOZIALSTRUKTUR DES STADTTEILS HANNOVER-VAHRENHEIDE ven: Nichtwählen oder ungültig abstimmen, SPD wählen oder Republikaner bzw. andere kleine Parteien wählen. Für Vahrenheide-Ost ergibt sich eine besondere Polarität zwischen dem hohen Anteil an Rechtswählern (DVU, NPD, REP), ihren Ressentiments gegen Ausländer und andere gesellschaftliche Randgruppen einerseits und einer Wohnbevölkerung, die nahezu zur Hälfte aus Nichtdeutschen besteht. Wahlanalysen zeigen einen Zusammenhang zwischen Wahlverhalten und Sozialstrukturen. Ebenso beeinflussen Bildung, berufliche und Wohnsituation sowie Haushaltsstrukturen die Wahlergebnisse. Die soziale Teilung der Stadt spiegelt sich auch im Wahlverhalten wieder. Bei der Betrachtung von Bezirken mit hohen Anteilen an REP-Wählern lassen sich folgende sozialstrukturelle Faktoren feststellen: • Hoher Anteil von Arbeitern bzw. Erwerbstätigen im produzierenden Gewerbe sowie Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger; • Wohnungen aus den 60er Jahren, hohe Belegquote und Hauptschulabschluss als Bildungsmerkmal (vgl. Landeshauptstadt Hannover u.a. 1998, 80-91). 4.1.4 Organisationen der BewohnerInnen Die BewohnerInnen treten bei öffentlichen Diskussionen nur selten in Erscheinung. Es gibt nur einzelne Organisationen, in denen sie aktiv sind. Die Bürgerinitiative in Vahrenheide-West und die Nachbarschaftsinitiative in Vahrenheide-Ost sind Organisationen, die sich auch an Diskussionen im Stadtteil beteiligen. „Aber man muß dazu sagen, auch die Nachbarschaftsinitiative als Verein, da kommen nur die Hauptamtlichen, nur die Fachleute und nehmen an diesen Runden teil und nicht der normale Bürger, der vielleicht auch mit im Vorstand is’“ (V14, 9). Daneben gibt es in Vahrenheide traditionelle Vereine. Ein Teil davon hat seine Vereinshäuser bzw. Spielflächen in anderen Stadtteilen. Die Vereine sind im Stadtteil, in den Runden, Arbeitsgemeinschaften und bei öffentlichen Veranstaltungen wenig präsent. Zu nennen sind folgende Vereine: „Kleingartenverein, Reitverein, Fanfarencorps Vahrenheide, Schießsportverein Vahrenheide, SV Borussia, SV Kikkers Vahrenheide, TuS Vahrenwald“ (vgl. Landeshauptstadt Hannover, 1997a). 79 4. PERSPEKTIVEN ZUM STADTTEIL Ferner gibt es soziale Vereine, die ähnlich wie die Nachbarschaftsinitiative mit Hilfe und unter Beteiligung von Fachleuten gegründet wurden. Meist sind es Trägervereine von Beschäftigungsmaßnahmen, die den Zweck haben, den Vereinsmitgliedern und dem Umfeld soziale, kulturelle oder pädagogische Dienste z.B. als Treffpunkt, Betreuung oder Beratung anzubieten. Zu nennen sind z.B. der Kulturtreff Vahrenheide und die Wohnungsgenossenschaft. Für MigrantInnen gibt es den „Freundschaftskreis deutscher und ausländischer Familien“, ein Kreis von acht bis zehn Paaren verschiedener ethnischer Herkunft, die sich monatlich treffen, und den „Verein zur Demokratischen Erziehung und Kultur e.V.“, ein Verein von Menschen türkischer Herkunft, die als Familien regelmäßig an Wochenenden im Nachbarstadtteil zusammen kommen. 4.1.5 Stadtentwicklung und Soziale Einrichtungen in Vahrenheide Neben den Schulen als öffentliche Institutionen entstanden soziale Einrichtungen als kontinuierliche Angebote im Stadtteil. In der nachfolgenden Tabelle sind die sozialen Einrichtungen den wichtigsten Phasen der Stadtteilentwicklung zugeordnet. Es sind in Klammern Gründungs- bzw. Umzugsjahr (*) in den Stadtteil und die Trägerschaft angegeben. Die Einrichtungen ohne Angabe des Trägers werden von der Stadt Hannover oder als Schulsozialarbeit vom Land Niedersachsen getragen. Tabelle 15: Zusammenhang Stadtteilentwicklung und soziale Infrastruktur Phasen der StadtteilEntwicklung Einrichtungen für Kinder 1959 – 1969 Gründung und Aufbau des Stadtteils • Kita der Ev. Kir- • Jugendzentrum che, 25 Kinder, (1968) halbtags (1964) • Kita der AWO, 80 Kinder und • Krabbelgruppe für 15 Kinder (1965) • Kita der Caritas, 72 Kinder und Hort für 34 Kinder (1965) 80 für Jugendliche für Erwachsene/ Familien • Kath. Kirche (1961) • Ev. Kirche (1964) • Wohnhaus der AWO für alleinerziehende Mütter und Väter (1965) • Altenheim vom Deutschen Roten Kreuz (1966) 4.1 DIE SOZIALSTRUKTUR DES STADTTEILS HANNOVER-VAHRENHEIDE 1970 – 1985 Erweiterung der Infrastruktur • Spielpark (1977) • Jugendwerkstätten Ev. Kirche u.a. (1979) • Altenbegegnungsstätte (1974) • Gemeinwesenarbeit (1977) 1986 – 1997 Wohnumfeld programm/ Nachbesserung • Spielmobil der AWO (1987) • Schulsozialarbeit an der Grundschule (1992) • Kita der Ev. Kirche 65 Kinder und Hort für 20 Kinder (1993) • Kids-Club vom Jugendverband der Ev. Freikirchen (1995) • Krabbelstube für 15 Kinder e.V. (1995) • Hort der AWO an der Grundschule für 40 Kinder (1996) • Kita-Außengruppe für 16 Kinder (1996) • Berufsförderung Ev. Kirche u.a. (1994) • Schulsozialarbeit am Gymnasium (1994) • Schulsozialarbeit an der IGS (1995) • AWO Streetwork (1995) und Kontaktladen (1998) • Sozialpädagogische Einzelbetreuung Ev. Jugendhilfe (1997*) • Kulturtreff e.V. (1986) • Nachbarschaftsinitiative e.V. (1987) • Cafe Kochkunst GmbH (1993-97) • Metallbau GmbH (1993) • Grünpflege e.V. (1995) • Sozialstation Diakonisches Werk (1995*) • Kommunaler Sozialdienst (1995*) • Jugendpsychologischer Dienst (1995*) • Sozialpsychiatrischer Dienst (1995*) • Jobbörse der AWO (1998) • Abfallprojekt Drecksarbeit e.V. (1998) • Tauschbörse e.V. (1998) • Bürgerservice e.V. (1998) 1998 – 2007 Integrierte Sanierung Die Entstehung neuer Einrichtungen in den letzten zehn Jahren wurde u.a. gefördert durch: • Änderungen des Kinder- und Jugendhilfegesetz (seit 1990), mit Ausdifferenzierung und Erweiterung der Jugendhilfen, Dezentralisierung von sozialer Dienste sowie 1996 Erweiterung des §24 KJHG (Anspruch auf Kitaplatz) 81 4. PERSPEKTIVEN ZUM STADTTEIL • Wohnumfeldprogramm der Stadt, das Büro- und Gruppenräume durch Umbau von Hochgaragen schuf; dadurch konnten regionale Dienststellen aus einem Nachbarstadtteil nach Vahrenheide verlagert werden • Ausweitung von Schulsozialarbeit in sozialen Brennpunkten als besonderes Angebot der Schulträger • verstärkte Förderung sozialer Betriebe und Beschäftigungsprojekte durch Arbeitsamt, Stadt, Land und EU (vgl. BMFSFJ 1999b; Roth 1999). 4.1.6 Zusammenfassung Der Stadtteil Vahrenheide hat viele Kennzeichen eines sozialen Brennpunktes. Die Lebensbedingungen sind hier erheblich schlechter als in anderen Stadtteilen. Familien mit Kindern und Jugendlichen leiden unter strukturellen Benachteiligungen des Stadtteils. In vielen Bereichen wurde nachgebessert, insbesondere beim Umbau von Hochgaragen in Treffpunkte und soziale Einrichtungen, bei Spielplätzen, Fußwegen und Grünanlagen. Dennoch bleibt die materielle Existenz auf ein Minimum begrenzt und schränkt gesellschaftliche Teilhabe wesentlich ein. Erst massive Proteste von sozialen Fachleuten und der Hinweis auf die Häufung von Problemen mit Kindern und Jugendlichen führten zu weiteren sozialen Einrichtungen. In den 1980er und 90er Jahren erweiterten sich durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz die Angebote an Sozialer Arbeit in Schule, Beruf und Freizeit (vgl. BMFSFJ 1999b). Die Sorge der Baugesellschaft und der Politik um den Ruf des Stadtteils, die Vermietbarkeit der Wohnungen und den Erhalt des Wohnungsbestandes führten zur städtisch geförderter Wohnumfeldverbesserungen und aktuell zur „Integrierten Sanierung“. Bedenklich ist die Entwicklung, dass die Sozialpolitik neue Aufgaben zunehmend den Beschäftigungsprojekten (über ABM oder § 19 BSHG) überträgt. Dadurch geraten Betroffene und Träger auf verschiedene Weise unter Konkurrenzdruck: Durch die Vorfinanzierung von Projekten, die Schaffung befristeter Arbeitsverhältnisse mit niedriger Vergütung, durch den Abbau bestehender Arbeitsplätze, durch persönliche Vorleistungen oder zusätzliche Anforderungen, durch die Kopplung von Lebensperspektiven Einzelner mit Erfolg oder Misserfolg von Projekten und durch Verzicht auf Absprachen im Stadtteil zur besseren Durchsetzung und Finanzierung eigener Projekte. 82 4.2 PERSPEKTIVEN UND ZUGÄNGE SOZIALER FACHKRÄFTE Standen in der Vergangenheit die baulichen Belange im Vordergrund, so richtet sich die Aufmerksamkeit in der „Integrierten Sanierung“ in vergleichbaren Förderprogrammen auf bauliche ebenso wie auf soziale Maßnahmen. Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Planungsamt und Sozialbereich beim 10-jährigen Wohnumfeldprogramm war durch das Engagement einzelner Personen, durch die Berücksichtigung der jeweils spezifischen Fachlichkeiten geprägt und ist nicht ohne weiteres auf die Sanierung zu übertragen. Die Tendenz von ArchitektInnen, Städte- und GrünplanerInnen, auch soziale Themen durch Planungsvorgaben oder durch ausgewählte externe Experten zu dominieren, bleibt ein kritischer Punkt, weil dadurch oftmals das Erfahrungswissen der Fachleute vor Ort gering geschätzt wird. Grundsätzlich sind Erwachsene im Stadtteil Vahrenheide nur in geringem Maße an öffentlichen Debatten beteiligt und auch nur in geringer Zahl in Vereinen oder Initiativen organisiert. Im Stadtteil nehmen Fachkräfte der Sozialen Arbeit an vielen Stellen stellvertretende Funktionen für fehlendes Bürgerengagement ein. ExpertInnen anderer Fachgebiete sind an den Diskussionen weniger kontinuierlich beteiligt; das könnte auch dazu geführt haben, dass Fachgebiete wie z.B. Wirtschaft, Familien- und Erwachsenenbildung, Gesundheitsförderung, interkulturelle Arbeit inhaltlich und personell nicht vertreten sind. Sicherlich fehlen in dem Wohngebiet ansprechende Räume für Vereine, Treffpunkte und kleine Betriebe sowie die entsprechenden Eigenaktivitäten, um diese auch zu nutzen. Es ist die Frage, in welchem Maße BürgerInnen in sozialen Brennpunkten soziales und kommunalpolitisches Engagement übernehmen können und wie dies zu fördern ist. Die Sanierung hat sich eine stärkere Beteiligung der BürgerInnen zum Ziel gesetzt. Dazu sollen Vereine das Stadtteilleben bereichern und sich um Tauschbörsen, Beschäftigungsprojekte, Nachbarschaftszentrum und Hausverwaltung kümmern. Es besteht die Hoffnung, dass mit der Umsetzung des Konzepts der „Integrierten Sanierung“ insgesamt die Bereitschaft zunimmt, sich zu beteiligen und Verantwortung zu übernehmen. Das könnte auch für die kontinuierliche Beteiligung von Kindern und Jugendlichen förderlich sein. 4.2 PERSPEKTIVEN UND ZUGÄNGE SOZIALER FACHKRÄFTE Die Sozialstrukturanalyse ist ein verbreitetes Untersuchungsinstrument in der Jugendhilfe- und Sozialplanung, der Stadtentwicklung und Stadtpla83 4. PERSPEKTIVEN ZUM STADTTEIL nung. Über die Erhebung relevanter (quantitativer) Merkmale von sozialen Lagen und Lebenslagen scheinen eine gleichmäßige Verteilung der personellen und finanziellen Ressourcen in der Kommune möglich zu sein. Die aus den Sozialdaten herausgearbeiteten typischen Merkmale des Stadtteils lassen sich auch in alltäglichen Beobachtungen und in Beschreibungen der sozialen Fachkräfte wiederfinden. Allerdings enthalten in der AG Kinderund Jugendarbeit diskutierte Beiträge stets Anknüpfungspunkte für Handlungsansätze und beziehen deshalb kleinräumige Besonderheiten mit ein. Insofern besteht zwar in vielen Punkten mit Entscheidungsträgern Übereinstimmung. Dennoch äußern Fachkräfte der Sozialen Arbeit Kritik an einer einseitig durch statistische Zahlen legitimierte Sicht auf die Lebensverhältnisse der BewohnerInnen. 4.2.1 Kritik an statistischen Erhebungen Bereits zu Beginn dieses Forschungsprojektes wurde eine gründliche Sozialstrukturanalyse von den Fachleuten der AG abgelehnt, weil die Zahlen hinreichend bekannt und untersucht worden seien. Die Auswertung der beruflichen Erfahrungen würde dabei jedoch stets vernachlässigt und dies solle zunächst im Mittelpunkt der Erhebung stehen. Die interviewten Fachleute konnten auf Anhieb eine Vielzahl von sozialen und städtebaulichen Problemen benennen. Lediglich zwei Einrichtungen verwenden zur Begründung ihrer Arbeit zusätzlich zu erfahrungsbezogenen Argumenten statistische Zahlen. Auf diese Besonderheit angesprochen, antworteten die Fachleute: • „Daten aus Statistiken sind häufig nicht hilfreich, um mit bestimmten Gruppen zu arbeiten.“ • „Es geht eher um Arbeitskreise, um Schüler, um Projekte, also konkret um die Menschen.“ • „In Runden werden wir immer gefragt, wie hoch ist denn der Ausländeranteil in der Kita. Dann sage ich 85 Prozent. ‚Mann, ist das schlimm‘, ist dann die Antwort. Dann versuche ich zu erklären, daß das gar nicht mein Thema ist und auch kein Problem.“ • „Manchmal reicht auch schon, wenn ich sage, ich arbeite in Vahrenheide. ‚Ziemlich schlimm, ich weiß schon Bescheid‘, ist die Reaktion, die sich allein auf %-Zahlen oder den Blick von Außen bezieht.“ • „Dann fallen Themen wie ‚Sozialhilfeempfänger, Alleinerziehende‘ – aber was sagt das aus?“ 84 4.2 PERSPEKTIVEN UND ZUGÄNGE SOZIALER FACHKRÄFTE • „Ich muß sowieso genauer gucken und differenzieren.“ • „Für die Kitaplanung ist es aber schon wichtig, wie viele Plätze fehlen.“ • „Das hilft aber auch nicht, wenn ich sage, in Vahrenheide fehlen 300 Plätze für die Kita und Hort. Dann bleibt alles beim Alten.“ • „Oder an wen werden Wohnungen vergeben, das wäre eine interessante Angabe. Aber ich ahne doch schon, wie es wird, wenn die leeren Wohnungen wieder belegt werden.“ • „Wir haben das schon beim Jugendkontaktladen gesehen. Da wurde gesagt, soviel Plätze im Spielpark, im Jugendzentrum und noch Gruppen hier und dort. Da brauchen wir keinen neuen Treff. Fakt war, daß er notwendig war, aus anderen Gründen. Das läßt sich mit Verteilung nicht abhandeln.“ • „Oder bei Einelternfamilien, da sind Fragen: Arbeiten die? In welcher Lage sind die? Was brauchen sie? Die Gießkannenstatistik hilft da nicht weiter.“ • „Wie wird das erhoben, ist zu kritisieren, und es müßte anders erhoben werden. Das wäre ein Thema, ansonsten ist der Statistik nicht zu trauen.“ • „Die GWA holt sich aus den zugänglichen statistischen Zahlen was raus, das ist aber richtig Arbeit.“ • „Aber ‚soviel Prozent Armut‘ ist auch keine Kategorie, um damit arbeiten zu können, weil bei vielen Familien mehrfache Problemlagen bestehen und in einander greifen“ (V6, 4-5). Die Kritik der sozialen Fachkräfte lässt sich wie folgt zusammenfassen: (1) Die Kriterien für die Erhebung beeinflussten wesentlich die Ergebnisse und müssten von den Fachleuten im Stadtteil mit ausgewählt werden können. (2) Statistiken seien interpretierbar, dienten häufig politischen Interessen und Argumente über statistische Durchschnittswerte wehrten Bedürfnisse der Betroffenen ab, die selten gründlich erhoben würden. (3) Sozialstrukturdaten eines Stadtteils dienten dazu, einen Überblick zu gewinnen. Das könne benachteiligte Wohngebiete mit einem zusätzlichen Stigma versehen, wenn eine differenzierte Sichtweise vernachlässigt würde. (4) Für die Arbeit im Stadtteil seien häufig andere, eher handlungsorientierte Fragen relevant, die auf die Akzeptanz, Beteiligungsbereitschaft und Nützlichkeit von Maßnahmen zielten. (5) Durch eine einseitige Fixierung auf Strukturdaten gehe häufig der Blick auf die Vielzahl der Eindrücke verloren, die aus der Reflexion beruflicher Erfahrungen gewonnen werden und mit denen gearbeitet werden müsse. 85 4. PERSPEKTIVEN ZUM STADTTEIL (6) Statistische Zahlen böten selten Anknüpfungspunkte, um mit Betroffenen zu arbeiten. Dafür seien stets direkte Kontakte, Kommunikation und Interaktion von Bedeutung, die zu anderen Fragen führten. 4.2.2 Berufserfahrung und Diskurs als Ausgangpunkte Es entstehen andere Sichtweisen, wenn Fachleute, die in einem Stadtteil tätig sind, Analysen erstellen. Teilweise kommt es zu reichhaltigem Detailwissen und vielfach auch zu anderen Einschätzungen und Bewertungen, als es die Auswertung von Sozialstrukturdaten allein erlauben. Wie würden Fachleute der Sozialen Arbeit einen Stadtteil beschreiben und analysieren? Worauf legen sie ihre Schwerpunkte? Woraus ziehen sie Folgerungen für Handlungsansätze und sozialpolitische Forderungen? Wo sehen sie Grenzen und Chancen von Sozialer Arbeit in ihrem jeweiligen Aufgabenfeld und für den Stadtteil insgesamt? Die Angaben der interviewten Fachleute aus dem Stadtteil lassen sich zu fünf Themenschwerpunkten bündeln. Wohnen in einer Großwohnanlage Besonders für Familien ist das Wohnen in Vahrenheide problematisch. Kinder haben für sich keine Rückzugsmöglichkeiten. Die Wohnungen sind zu eng und für Schularbeiten fehlt der Platz. „Statistisch sind ja in beiden Straßenzügen (Hochhäuser in Vahrenheide-Ost) 560 Kinder und Jugendliche erfaßt, im Alter von 14 bis 27 ... und wenn man am Vahrenheider Markt mal langgeht, man trifft überall die Jugendlichen“ (F20, 1). Nahezu ein Drittel der Interviewten benannte folgende Probleme: Die konzentrierten Belegungsrechte der Stadt führten zu einer einseitigen Bevölkerungsstruktur. Trotz der Sozialmieten bewirkten die hohen Nebenkosten, dass Familien mit geringem Einkommen nicht ohne Sozialhilfe leben können. Man könne von einem Ghetto „sozial schwacher Familien“, einer „Massierung von Problemfamilien“ sprechen. Viele kinderreiche Familien wollten schnell wieder wegziehen. Der ständige Müll im Treppenhaus, Lärm, fehlende Infrastruktur und mangelnde Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe störten. Junge Erwachsene könnten sich nicht von der Familie lösen, weil es keine preiswerten Wohnungen in der Nähe gebe. Städtebaulich sei die Bebauung mit Hochhäusern im Klingenthal eine Katastrophe, das erzeuge einen Mangel an Identifikation mit dem Stadtteil; niemand gebe gern zu, dass er dort wohne, es sei ein tristes Feld, abends sei 86 4.2 PERSPEKTIVEN UND ZUGÄNGE SOZIALER FACHKRÄFTE nichts los. Es gebe viel Vandalismus und Zerstörung durch Jugendliche (vgl. F1-21). Von vielen AG-TeilnehmerInnen wird bestätigt: „Es ist eine trostlose, kalte Atmosphäre an den meisten Ecken und Enden ... lieblos und vernachlässigt“ (F4, 5). Die Wohnumgebung wurde nicht als kinderfreundlich angesehen. Es fehlten Spiel- und Freizeitmöglichkeiten. Kinder und Jugendliche würden von Grünanlagen und Plätzen vertrieben. Man wolle sie nirgendwo haben. Es sei unklar, was die Kinder in der Freizeit Sinnvolles tun könnten. „Es gibt zwar ‘ne Menge Grün und Raum, aber die Flächen sind nicht sehr kinderfreundlich gestaltet ... für kleine Kinder ist da in dem Bereich wenig“ (F3, 5). Einkommensarmut und Teilhabe Die materielle Armut und die fehlenden Chancen der gesellschaftlichen Teilhabe wurden von nahezu allen Fachleuten als Problem für die BewohnerInnen in Vahrenheide genannt. „Es gab ja mal über Vahrenheide diesen Bericht: Ist Armut vererbbar – macht Armut krank? Reichtum ist vererbbar und Armut natürlich genauso ... denn diese Hilfe zum Lebensunterhalt, die kommt ja oft gar nicht mehr bei den Kindern an“ (F15, 8). Vahrenheide als Armutsgebiet wird von vielen Fachleuten der AG zusammengefasst: Es gibt einen hohen Anteil von Sozialhilfeempfängern, besonders in Vahrenheide-Ost. Viele der heutigen Eltern wuchsen selbst in armen Familien auf und wurden als Kinder nicht richtig versorgt. Für viele Kinder bedeutet das: Aufwachsen mit Langzeitarbeitslosigkeit, mit Suchtproblemen wie Drogen oder Alkohol und besonders mit Gewalt und Gewaltbereitschaft. Der Mangel an finanziellen Mitteln hat trotz Sozialhilfe zur Folge, dass viele Familien zusätzlich Anträge stellen müssen, um Essen, Bekleidung und Nebenkosten bezahlen zu können und dass stets das Geld nicht ausreicht, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Versorgung und Erziehung der Kinder Kinder kämen ohne Frühstück zu Veranstaltungen am Morgen, sie würden von Zuhause nicht geschickt, die Eltern kümmerten sich häufig nicht, konnten sieben Einrichtungen aus eigener Anschauung berichten. Die grundlegenden Bedürfnisse, z.B. das regelmäßige Essen fehlt, werden nicht befriedigt. „Probleme unserer Kinder in den Familien, wenn das so ganz einfache Sachen sind, wie (z.B.) kriegen die ein Frühstück mit oder kommen die auf den Weg? 87 4. PERSPEKTIVEN ZUM STADTTEIL Wer kümmert sich da? Ich hab also Kinder, die wochenlang ohne Frühstück ankommen oder Kinder, die alleine aufstehen müssen, weil keiner mal kommt. Oder daß man das Gefühl hat, daß sich emotional niemand um sie kümmert“ (21/5). Das Erziehungsverhalten der Eltern lässt den Kindern außerhalb der Familie viel Freiraum. Es besteht ein Mangel an zuverlässigen erwachsenen Bezugspersonen, weil Eltern sich zu wenig kümmern. In gravierenden Fällen führt das zu existenzieller Vernachlässigung. Die Not vieler Kinder besteht dann in „seelischer Armut“. „Als ich noch ... an den Konferenzen aller Schulen teilnahm, andere Schulen waren viel weiter, weil die vielmehr auf Leistung (setzen), nicht alle ... Die brauchen nicht so viel Rücksicht auf die Probleme zu nehmen, weil die Kinder sie effektiv nicht so stark haben. Wenn ich Zeit geben muß, wenn die Kinder von der Pause völlig aufgelöst reinkommen oder auch von zu Hause verstört zur Schule kommen, dann kann ich mit denen nicht anfangen zu arbeiten. Die können dann einfach nicht denken, (die) sind blockiert“ (F21, 6). Kindererziehung ist in vielen Familien Nebensache und die Wünsche und Träume der Kinder und Jugendlichen werden nicht berücksichtigt. Die Folgen sind dann im fehlenden Sozialverhalten der Kinder zu beobachten. Sie treffen sich draußen mit anderen und sind unter sich. Dort lernen sie, dass der Stärkere sich durchsetzt. Es bilden sich Stadtteilcliquen, die ihre Macht ausspielen, um zu stehlen oder zu erpressen. Das verschafft ihnen Ansehen. Kinder, die nicht mitmachen, haben Angst sich im Stadtteil zu bewegen, Angst vor Belästigung, Angst vor Bedrohung und Kriminalität. Ein höherer Anteil beim Sonderschulbesuch von 15 bis 20% ist für die Fachleute nicht verwunderlich (vgl. F1-21). MigrantInnen im Stadtteil Zusätzlich hoben sechs Fachleute den Bedarf an Angeboten für MigrantInnen hervor. Es fehlten: Asylberatung, psychische und gesundheitliche Beratung für MigrantInnen, Übersetzungen, zweisprachige MigrantInnen als Fachkräfte, Beratung für ausländische Mädchen, Ausbildungsplätze besonders für türkische Jugendliche, Stabilisierung der sich auflösende Familienstrukturen, Angebote zur Orientierung und zur Sprachförderung. Die Fachleute wurden darauf angesprochen, aus welchen Gründen nur etwa ein Viertel der AG-TeilnehmerInnen das Thema Migration und die Folgen bedeutsam für Vahrenheide findet. Sie antworteten: • „Wir arbeiten mit Kindern und Jugendlichen, da gehören MigrantInnen dazu.“ 88 4.2 PERSPEKTIVEN UND ZUGÄNGE SOZIALER FACHKRÄFTE • „In der Kita sind ca. 90 Prozent MigrantInnen. Wenn wir von Kita reden, meinen wir die mit. Wieso sollen wir die hervorheben. Da wären die Deutschen eher zu nennen, weil es da z.B. häufiger Probleme zwischen Eltern und Kindern gibt, die bei MigrantInnen so nicht da sind, weil deren Familien häufig noch funktionieren.“ • „Allerdings in den Jugendwerkstätten, da sind es eben doch die ausländischen Jugendlichen, die schwerer zu vermitteln sind.“ • „Es geht in Vahrenheide eher um die Grundprobleme Armut, Arbeitslosigkeit usw., und das betrifft alle. Und als Folge sind es eher Eltern-Kind Themen.“ • „In unserer Schule haben wir muslimische Mädchen, die jetzt einen eigenen Sportunterricht erhalten und auch sonst werden die Besonderheiten berücksichtigt, keine Benotung in der Übergangszeit des Spracherwerbs usw.“ • „Es gibt auch noch die AG Kaleidoskop, die langfristig an dem Thema Migration arbeitet.” (V6, 5). Migration ist in vielen Bereichen der Sozialen Arbeit eher ein Randthema, weil für Soziale Arbeit zunächst die Vorschriften des KJHG und des BSHG gelten. Das sichert eine kontinuierliche Finanzierung der Arbeitsaufträge. Soziale Arbeit für MigrantInnen hat in den Kommunen einen Sonderstatus erhalten, der eine Unterstützung über Sprach-, Kultur- und Vereinsförderung vorsieht. Insofern kann der Arbeitskreis Kaleidoskop, mit seinen Projekten und Initiativen als eine erste praktische Umsetzung des Anliegens angesehen werden. Der schlechte Ruf des Stadtteils Die vielen Benachteiligungen im Stadtteil Vahrenheide haben auch dazu geführt, dass der Ruf des Stadtteils nicht der beste ist. Medien, Politik, Verwaltung und Polizei sind sich dessen bewusst. „Was ich aus anderen Stadtteilen mitkriege ist, daß Vahrenheide in der Abstufung die letzte Kategorie ist“ (F1, 6). „Der schlechte Ruf, mit dem haben besonders Jugendliche zu kämpfen, wenn sie z.B. jemanden in der Disco kennen lernen, dann wollen sie meistens nicht sagen, wo sie wohnen, weil sie dann abgelehnt werden“ (F2, 6). „Nicht nur Vahrenheide, auch Einrichtungen haben mit dem schlechten Ruf zu kämpfen“ (F17, 10). Die Fachleute der AG Kinder- und Jugendarbeit sehen Möglichkeiten, dem schlechten Ruf entgegenzuwirken. Sie wollen mit niedrigschwelligen Angeboten, besonders im Sport, großzügigen Öffnungszeiten und Anlaufstellen 89 4. PERSPEKTIVEN ZUM STADTTEIL auch an Wochenenden Kinder und Jugendliche ansprechen. Durch eine Förderung der Mitsprache und Stärkung der Elternschaft sollen auch die Familien angesprochen werden. Sozial verträgliches Wohnen könnte den Alltag erträglicher werden lassen. Darüber hinaus müsste Armut durch Schuldnerberatung im Stadtteil sowie durch Werkstätten und Beschäftigungsprojekte bekämpft werden, die den Zugang zu Arbeit erleichtern. 4.2.3 Zusammenfassung Die Sichtweisen der Fachleute zum Stadtteil und seinen BewohnerInnen ergeben ein differenziertes Bild. Viele Einschätzungen sind lebensnah und eindrucksvoll. Es sind oft die beruflichen Erfahrungen, die Sozialdaten erst anschaulich werden lassen. Dennoch distanzieren sich die Fachleute der AG von Sozialdaten oder wollen sich zumindest nicht allein darauf verlassen. Andererseits ist bemerkenswert, dass dennoch Schlussfolgerungen aus den Sozialstrukturdaten abgeleitet werden. Dabei wird eine methodische Unsicherheit deutlich, weil unklar bliebt, welche Erkenntnisse sich aus Erfahrungen und welche aus den Statistiken ableiten und welche fachliche Positionen sich damit begründen lassen. Es fällt weiterhin auf, dass fast ausnahmslos sozialpädagogische und sozialarbeiterische Konzepte den Problemlagen entgegengesetzt werden. Familien- oder Erwachsenenbildung oder ökonomische Interventionen werden zunächst nicht in Erwägung gezogen. Zu vermuten ist, dass interdisziplinäre Fachrunden zu anderen Ergebnissen gelangen würden. Interessant ist, dass die allgemeinen Ziele und geplanten Maßnahmen der „Integrierten Sanierung“ in wesentlichen Teilen mit den Vorschlägen der Fachleute übereinstimmen. Umstritten zwischen AG und Sanierungsbüro sind der Grad der Beteiligung, die Wege zur Konzeptionsentwicklung und die Formen der Umsetzung. Eine städtische Gesamtplanung für die in der AG repräsentierten Arbeitsfelder gibt es noch nicht. Auch das Wissen über stadtteiltypische und stadtteilbezogene Besonderheiten ist nicht dokumentiert und verfügbar. Einzelne müssen sich selbst über Gespräche oder Aktionen kundig machen. In der praktischen Arbeit sind Trennungslinien zwischen Erziehungshilfe und offener Kinder- und Jugendarbeit sowie Kulturarbeit erkennbar. Verstärkt wird das einerseits durch die organisatorische Aufspaltung der Jugendhilfebereiche und durch die Ansicht, das eine sei Feld-, das andere eher Verwaltungsarbeit. Der Praxisforscher machte auf die fehlende Kooperation der Arbeitsbereiche aufmerksam. Die AG-TeilnehmerInnen betonten, es 90 4.3 PERSPEKTIVEN DER POLITIKERINNEN UND VERWALTUNGSLEITUNG gäbe jedoch grundsätzlich gute Erfahrungen der Zusammenarbeit zwischen Erziehungshilfe und Jugendarbeit. 4.3 PERSPEKTIVEN DER POLITIKERINNEN UND VERWALTUNGSLEITUNG ZUM STADTTEIL Die Problemanalysen beziehen sich häufig auf typische Erscheinungen in vergleichbaren Stadtteilen. Die Antworten sind eher allgemein gehalten. In Einzelfällen werden Erfahrungen, Themen und Projekte wiedergegeben, mit denen sich die Interviewten beschäftigten. „Gerade Vahrenheide ist ja als Brennpunktstadtteil schon seit Jahren bekannt. Also die 70er Jahre-Bauweise gekoppelt mit ungeheuer vielen sozialen Randgruppen als auch ausländischen Familien, Arbeitslosen, Sozialhilfeempfänger, Aussiedler und und und ... also alle diese Problematiken, die wir in anderen Stadtteilen auch haben, haben wir halt in Vahrenheide geballt“ (E6, 2). Einige konnten die allgemeine Sicht differenzieren: „Als Probleme sind zunächst zu nennen, die Belegrechte, die dazu führen, daß Menschen dort erstmal untergebracht werden und die dichte Bebauung“ (E2, 1). „Die hohe Zahl der Rechtswähler bei der Europawahl, Auseinandersetzung zwischen jugendlichen Gruppen vor zwei bis drei Jahren“ (E3, 4). „... wenn man sich Bewohnerversammlungen, auch der GBH, vor vielen Jahren und auch heute anguckt, sind das nicht viele Menschen, die sich beteiligen ... es gibt wenig direkte Beteiligung ... es sind überwiegend Fachleute (in Versammlungen und Runden)“ (E4, 7). RatspolitikerInnen nannten auch Beispiele aus dem benachbarten Stadtteil Sahlkamp und ordneten sie Vahrenheide zu. Das ist ein Beleg dafür, dass für viele Verantwortliche die Grenzen der Stadtteile verschwimmen. Für die politisch Verantwortlichen ist es offensichtlich nicht einfach, die Grenzen des Stadtteils zu markieren, wenn sie nicht selbst dort leben und sie für mehrere Stadtteile oder ganz Hannover zuständig sind. „Wir sagen immer Vahrenheide/Sahlkamp (zwei Stadtteile mit sozialem Wohnungsbau in Großwohnsiedlungen) als Einheit, sicher wird im Einzelnen noch weiter differenziert, aber zunächst ist es für uns eine Einheit mit annähernd ähnlicher Struktur“ (E2, 1). „Für mich gehört immer Vahrenheide und Sahlkamp (zusammen), ich kriege das immer schlecht auseinander und teilweise vermischen sich ja auch die Personen“ (E6, 2). 91 4. PERSPEKTIVEN ZUM STADTTEIL Das Wissen über den Stadtteil ist nahezu gleichzusetzen mit Wissen über neue Projekte und die Gründe für deren Bedarf. Bekannt waren zunächst die Projekte und Themen, an denen im Rat gearbeitet wird, über die informiert und beschlossen wird. Von der Arbeit einzelner Einrichtungen bestanden kaum Vorstellungen, mit Ausnahme von besonderen Ereignissen, Begebenheiten, brisanten Defiziten im Stadtteil oder gestellten Finanzanträgen. „Nehmen wir den sozialpädagogischen Mittagstisch. Wir haben aufgenommen, daß es vagabundierende Kinder gibt, ... daß Lehrer hilflos sind gegenüber Kindern, die offensichtlich Kohldampf schieben ... und wir haben auch festgestellt aus Erzählungen der Experten vor Ort ..., daß Kinder nicht in ihre Wohnungen können nach der Schule und haben gesagt, da gehört ein Mittagstisch hin“ (E3, 5). RatspolitikerInnen und Leitungskräfte thematisierten wenige Projekte und Vorhaben, die speziell auf den Stadtteil zugeschnitten waren. Bei ihnen fehlten im Gegensatz zu den PraktikerInnen Aussagen zu neuen Projekten und Wünschen für Vahrenheide. Benannt wurden dagegen stadtweite Themen wie Kitaplätze, Mitternachtssport, Beteiligungsprojekte, Spielplätze usw., die kommunalpolitisch diskutiert wurden oder bei denen Beschlüsse im Stadtrat und in Ausschüssen zur Bewilligung von Fördermitteln führten. In Verbindung mit Vahrenheide wurden folgende Themen genannt: • Förderung des Arbeitsmarktes, Beschäftigung für Jugendliche, • Versorgung von Kindern über 3 Jahre, • stadtteilbezogene Drogenarbeit, • Angebote von sozialpädagogischen Mittagstischen, • bewegungs-/sportorientierte Kinder- und Jugendarbeit, Skateboardanlagen, • Betreuung/Versorgung von 3-6-Jährigen, Unterstützung von Frauen mit Kindern, • Sanierung, Wohnungsgenossenschaft, Spielplatzerneuerung, • Zukunftswerkstatt, • Gewalt von Kindern und Verunsicherung von älteren Menschen (vgl. E1-7). Beschlüsse des Rates stellten einen Rahmen für stadtweite Entwicklungen in der Kinder- und Jugendpolitik dar und boten Anlässe, um Kenntnisse über den Stadtteil zu erhalten. Die Ausgestaltung und Umsetzung von po92 4.3 PERSPEKTIVEN DER POLITIKERINNEN UND VERWALTUNGSLEITUNG litischen Beschlüssen vor Ort durch Mitarbeit oder Verweigerung, also die Form der Zusammenarbeit, blieben besonders RatspolitikerInnen und Leitungskräften der Stadtverwaltung in Erinnerung, wie z.B. die Ablehnung des Mitternachtssport durch die AG und die Entwicklung einer alternativen Konzeption. 4.3.2 Zusammenfassung Von den Leitungskräften der Verwaltung wurde Vahrenheide zwar als Stadtteil wahrgenommen und von benachbarten unterschieden, jedoch fehlten besondere Detailkenntnisse. Diskutiert wurden auf einer allgemeinen Ebene Planungsverfahren, Konzeptionen und aktuelle soziale und politische Entwicklungen. Die Beschreibungen der Problemlagen von Vahrenheide bezogen sich auf typische Erscheinungen in Stadtteilen mit verdichteter Bauweise und hohem Anteil von Sozialwohnungen. Benannt wurden eher stadtweite Themen. Leitungskräfte und PolitikerInnen konnten sich auf allgemeine Konzepte verständigen, es störte dabei nicht, dass RatspolitikerInnen Vahrenheide/Sahlkamp, also zwei unterschiedliche Stadtteile als Einheit im Blick hatten. Die Anforderungen an eine Kinder- und Jugendhilfeplanung haben sich gewandelt. Die Skepsis und Distanz der Fachleute im Stadtteil gegenüber statistischen Zahlen wurde von den interviewten PolitikerInnen und Leitungskräften nicht geteilt. „Natürlich müssen wir wissen, wie viele freien Träger wir haben, wie viele Einrichtungen wir haben, wie die demographische Entwicklung ist, so wie der Armutsbericht aufgebaut ist, der Sozialbericht, zum Thema Armut muß man schon wissen, wo sind die SozialhilfeempfängerInnen und Alleinerziehende und welches Angebot macht da Sinn und kann man da erfolgreich unterstützen, damit nehme ich das (Berichte der Fachleute im Stadtteil) nicht vom Tisch. Ich glaube aber, daß die lebendige Stadtteilbeschreibung, angereichert mit einigen Daten, der bessere Weg ist, um Entscheidungen zu treffen“ (E3, 6). Allerdings erwarteten PolitikerInnen eine Verknüpfung der unterschiedlichen Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe und eine angemessene Diskussion zwischen den Einrichtungen des Stadtteils und neben Strukturdaten auch Beschreibungen von Einzelfällen oder Zielgruppen. „Wir haben es damals in unseren Fachplan geschrieben, 1995, über demographische, statistische Zahlen zu gehen, hilft nicht unbedingt weiter. Die Gefahr, daß man Datenfriedhöfe schafft, ist sehr groß ... Sondern man muß das Wissen 93 4. PERSPEKTIVEN ZUM STADTTEIL derjenigen, die im Stadtteil tagtäglich arbeiten, mobilisieren, für bestimmte Projekte und Gedankengänge. Die wissen viel stärker, ... wo Problembereiche sind, bis hin zu den Kindern, die wissen, wo ist Spielen gut, wo ist Spielen schlecht, wo habe ich Angst, wenn ich langgehe, und wo kann ich mich aufhalten, welche Cliquen gibt es dort und wo muß ich mich vorsehen, wo kann ich drauf zugehen. Dieses Wissen ist viel relevanter für Planungsentscheidungen, wenn man sich auch darauf einläßt, das auch mit hinterfragen zu lassen als Stadtteil. Man kann natürlich das Wissen als Institution (Jugendamt) nicht unreflektiert übernehmen. Aber es sind im Prinzip Goldadern für Planungen, das Expertenwissen derjenigen, die täglich dort mit Kindern und Familien und Jugendlichen zu tun haben. Das ist inzwischen Allgemeingut im Jugendamt“ (E3, 6). Die Strukturdaten wurden auch von PolitikerInnen nicht als einziges Kriterium für die Planung angesehen, sondern die Intensität und das Ausmaß von Problemen sollten ebenso berücksichtigt werden. „Es kann sein, daß ein Stadtteil nur sehr wenige Kinder oder Jugendliche einer Altersgruppe hat, aber diese Kinder hochproblematisch sind. Dann würde ich sagen, diese Kinder brauchen Räume, diese Kinder brauchen Personal, diese Kinder brauchen vielleicht mehr Räume und mehr Personal als in einem Stadtteil, wo es wesentlich mehr Kinder dieser Altergruppe gibt. Weil sie einfach mehr Zuwendung von ihrer Situation her brauchen. Deswegen muß es eine Kombination sein, aus Zahlen und inhaltlicher Beschreibung“ (E7, 6). Aber es wurde auch gefordert, dass zukünftig der Bedarf durch Umschichtung gedeckt und dass geprüft werden müsse, wie die vorhandenen Kräfte eingesetzt werden könnten. „Und es muß für mich umfassend sein. Es muß zeigen, was ist da, wo kann es vernetzt werden, welche Selbsthilfepotentiale sind da und welche Potentiale müssen von außen reingebracht werden? Und dann sind wir natürlich wieder dabei, daß auch mal kritisch geguckt werden muß, ist das, was da ist, das was für den Stadtteil paßt? Oder gibt es aus dem Stadtteil Vorschläge, das was wir haben, müssen wir umstrukturieren, aber wir brauchen noch zusätzlich und, und, und“ (E7, 6). 4.4 ZUSAMMENFASSENDER VERGLEICH DER PERSPEKTIVEN ZUM STADTTEIL Unterschiede in Fachkenntnissen und Fachwissen von RatspolitikerInnen bzw. Leitungskräften einerseits und Fachleuten der AG andererseits traten bei der Stadtteilanalyse deutlich zutage. Die übergreifenden Themen Armut und Armutsstadtteil samt notwendigen Maßnahmen wurden nur von den Fachleuten im Stadtteil für dringlich gehalten, während PolitikerInnen 94 4.4 ZUSAMMENFASSENDER VERGLEICH DER PERSPEKTIVEN ZUM STADTTEIL und Verwaltungsleitung sich auf Teilthemen bezogen. Ähnlich verhielt es sich mit dem neu erkannten Bedarf an Mädchenarbeit und interkultureller Arbeit. Diese und andere auf den Stadtteil bezogene Impulse wurden überwiegend aus den im Stadtteil tätigen Fachkräften geäußert und über die AG Kinder- und Jugendarbeit an Leitungskräfte oder PolitikerInnen weitergetragen. Fachleute vor Ort trafen generell differenziertere Aussagen zu Problemlagen in Vahrenheide, die von ihnen empfohlenen Projekte bezogen dann auch darauf. Die AG-TeilnehmerInnen bestätigten die Unterschiede des Wissens, sahen allerdings, anders als die Leitungskräfte, wenig Bereicherung in einer Verbindung der Entscheidungs- und Ausführungsebene. Leitungskräfte dagegen schätzten das Wissen vor Ort als „Goldadern“ ein, wollten allerdings, wie die PolitikerInnen auch, die Entscheidungsbefugnisse nicht teilen. Die AG TeilnehmerInnen meinten dazu: • „Die (Leitungskräfte und PolitikerInnen) haben schon pädagogisches Wissen und Erfahrungen, verfügen über besondere Informationen. Sie haben allerdings andere Grundgedanken, Einstellungen, andere Haltungen als wir.“ • „Die PolitikerInnen haben andere Ansätze zur Problemlösung, die entwickeln das in den Fraktionen mit pauschalen Wegen.“ • „Was gut läuft, wird als Modell übertragen.“ • „Dafür wird Erfolgreiches übernommen und verallgemeinert. Das muß dann auch woanders gut sein.“ • „Politik reagiert eher und leitet Maßnahmen ein, wenn Probleme auftreten.“ • „Die haben auch ihre Mittelsleute, die sie beraten, meist von der Uni, die machen Gutachten, Untersuchungen und empfehlen etwas.“ • „Das kommt aber nicht aus der Praxis.“ • „Die meisten (Entscheidungsträger) sind nicht vor Ort und können wenig präventiv entwickeln.“ • „Nur wenn Druck von unten kommt, werden Basisideen aufgenommen.“ • „Politik reagiert, wenn wir öffentliche Stellungnahmen abgeben, Anträge stellen oder Gelder zu verteilen sind. Eigene Ideen von ihnen, die sich auf den Stadtteil beziehen gibt es kaum. Und daß die selber was Eigenes durchführen, sehe ich nicht.“ • „Die PolitikerInnen wollen eher Mitglieder oder Wähler sammeln, dazu dient auch die Unterstützung des aktuellen Trends zur Beteiligung. • „Meistens geben Leute aus der Praxis etwas vor. Wenn es gut läuft, dann wird es unterstützt, so ist das eben.“ 95 4. PERSPEKTIVEN ZUM STADTTEIL • „Dabei zählt auch der Machtfaktor, die wollen was verändern oder Entscheidungen treffen und dadurch Geltung erreichen. Das ist ihre Realität und ihr Selbstverständnis.“ • „Es ist und bleibt ein mühsames Geschäft, bei guten Vorhaben der Praxis um Zustimmung und Interesse bei den PolitikerInnen und Leitungskräften zu werben“ (V12, 5-6). Die Arbeit einzelner Einrichtungen, Vereine und Initiativen wird, so die Äußerungen von PolitikerInnen, auf Stadtebene kaum wahrgenommen. Die AG-Arbeit werde inhaltlich nur dort erinnert, wo Konflikte aufträten, wo Neues ausprobiert worden sei, wo sich Entscheidungskräfte auch persönlich engagierten, in Prozesse einbezogen gewesen seien oder Anstöße gegeben hätten. Informationspapiere erzielten wenig Wirkung. Anders sei das bei persönlichen Kontakten oder der persönlichen Vorstellung von Projekten. Das ist den AG-TeilnehmerInnen vertraut: „Persönliche Kontakte sind wichtig, das kann ich mir vorstellen ... und mit den Konflikten, das ist klar, die bleiben in Erinnerung“ (V12, 2). 4.4.1 Lebensweltbezug beeinflusst die Perspektiven Interessant sind zunächst die Unterschiede in der Wahrnehmung von sozialen Problemen im Stadtteil Vahrenheide. RatspolitikerInnen und Leitungskräfte der Stadtverwaltung sahen den Stadtteil distanziert, ohne eigene Erfahrungen im Stadtteil, ihre Vorschläge könnten auch für andere Problemstadtteile gelten (vgl. V11, 18-19). Ihnen waren finanziell geförderte Projekte bekannt, und sie hatten einen Überblick über die wichtigsten Daten zur Sozialstruktur. Sie benannten aktuelle Themen und Vorhaben, die konzeptionell und politisch in der Stadt diskutiert wurden. Sie stellten kritische Anfragen zur Beteiligung von Kindern und erläuterten dazu differenziert ihren Demokratiebegriff. Sie hatten Kenntnisse über neue landes- und bundesweite Entwicklungen durch Presse- und Fachartikel, Tagungen oder Fortbildungen. Ihre Interessen lagen bei der Entwicklung von Modellen für Hannover, um neue Impulse für die Kinder- und Jugendhilfe zu setzen. Die Fachgespräche der AG-TeilnehmerInnen hatten begrenztere Perspektiven, stets verbunden mit beruflichen Erfahrungen. Sie bezogen sich in Fachgesprächen nicht nur auf die Lebenslagen, sondern deutlicher auf die Lebenswelten der BewohnerInnen von Vahrenheide. Die Vorschläge zur Bearbeitung von Problemen wiesen viele Facetten der Kinder- und Jugendhilfe auf und waren auf das räumliche Umfeld und mit den Zielgruppen abge96 4.4 ZUSAMMENFASSENDER VERGLEICH DER PERSPEKTIVEN ZUM STADTTEIL stimmt. Dadurch entstand ein differenzierteres Bild vom Lebensalltag der Kinder und Jugendlichen, deren Wahrnehmung und Bewältigung sowie von möglichen Handlungsansätzen der Kinder- und Jugendhilfe. Den Sichtweisen und Vorschlägen der AG-TeilnehmerInnen konnten die BezirksratspolitikerInnen in wesentlichen Bereichen zustimmen. Dagegen waren die Leitungskräfte der Verwaltung und die RatspolitikerInnen weniger an Details, sondern vorrangig an einer gleichmäßigen und gerechten Verteilung der Mittel in der gesamten Stadt interessiert. Themen und Probleme der Stadtteile sollten miteinander vergleichbar werden, um Schwerpunkte bzw. Prioritäten bilden und entscheiden zu können. Sie bevorzugten ein modellhaftes Vorgehen, anders als die Fachleute vor Ort. In folgender Übersicht sind die verschiedene Sichtweisen zum Stadtteil Vahrenheide zusammengefasst: Tabelle 16: Vergleich der Perspektiven zum Stadtteil PolitikerInnen und Leitungskräfte der Verwaltung sagen, es gebe ... (vgl. E1-7) die sozialen Fachleute sagen, es gebe... die Kinder sagen ... (vgl. F1-21) (vgl. P4) viele Randgruppen Armut in Vahrenheide Warum ist das hier so dreckig? Die Häuser sind schmutzig. Überall liegt Müll rum. Fehlende Suchtberatung Alkohol- und Drogenprobleme Es sind viele Betrunkene und Penner zu sehen. beengtes Wohnen in Großwohnanlagen Es gibt zu viele Hochhäuser, im Klingenthal sind sie grau und dreckig, es ist eher hässlich. Vandalismus und Zerstörung Es wird viel kaputt gemacht, überall wird gebaut. Es gibt zu wenige Wiesen, wenige Fußballplätze, zu wenige Spielplätze. Bedarf an bewegungsund sportorientierter Jugendarbeit 97 4. PERSPEKTIVEN ZUM STADTTEIL PolitikerInnen und Leitungskräfte der Verwaltung sagen, es gebe ... (vgl. E1-7) die sozialen Fachleute sagen, es gebe... die Kinder sagen ... (vgl. F1-21) (vgl. P4) Gewalt von Kindern und Jugendlichen, Angst der Älteren fehlendes Sozialverhalten der Kinder Die großen Kinder schlagen die Kleinen, da ist zuviel Hauerei. Hortplätze fehlen, Bedarf Kinder werden nicht versorgt an sozialpäd. Mittagstischen Fehlende Unterstützung von Eltern Erziehungsverhalten der Eltern ist unzureichend Es gibt Leute, die Kinder schlagen, viele prügeln sich. Bedarf an Beratung für MigrantInnen den schlechten Ruf Förderung des Arbeitsmarktes Der Ruf ist so schlecht. fehlende Ausbildung für Jugendliche fehlende Spiel- und Freizeitmöglichkeiten Es fehlen schöne Treffpunkte. Es fällt auf, dass die Fachkräfte der AG sich zunächst nicht auf die Sozialdaten beziehen, um Probleme zu untersuchen, sondern auf konkrete Personen, Situationen, Räume und Erfahrungen mit diesen Gegebenheiten (V6, 18-19). Mit ihrer Sprache und ihren Begriffen stehen sie den Aussagen der Kinder noch am nächsten. In der Aussage „es gibt Armut in Vahrenheide“ wird eine Problemanzeige zunächst nicht den Menschen zugeschrieben. Die AG-TeilnehmerInnen können mit dieser Formulierung den Menschen im Stadtteil weiterhin offen gegenübertreten, mit ihnen in Kontakt bleiben und gleichzeitig in die Öffentlichkeit gehen und gezielte Forderungen stellen. Die Kinder beschreiben den Ausdruck von Armut, ohne dass sie eigenes Leid benennen müssen. Ihre Aussagen stehen für hautnahe Erfahrungen in einem sozialen Brennpunkt. Sie schaffen es häufig nicht, sich soweit wie die Professionellen zu distanzieren. Bei den Aussagen der Leitungskräfte wird die große Distanz zu den Betroffenen und deren Alltagserfahrungen deutlich, da in Begriffen der Problembeschreibung (ggf. auch Zuschreibun98 4.4 ZUSAMMENFASSENDER VERGLEICH DER PERSPEKTIVEN ZUM STADTTEIL gen) und Maßnahmen eine Routine von Entscheidungsprozessen erkennbar wird. Darin liegt die Gefahr größere Differenzierungen nicht mehr vorzunehmen und dadurch auch die BewohnerInnen zu stigmatisieren, weil allgemeine Problembeschreibungen getroffen werden, auf die mit Modellen reagiert wird. 4.4.2 Entscheidungs- und Steuerungsbefugnisse beeinflussen die Perspektiven Wer kann Bedürfnisse im Stadtteil am besten ermitteln und daraus Bedarfe für die Planung formulieren? Darüber herrscht grundsätzlicher Dissens. Sind es die MitarbeiterInnen in den Einrichtungen des Stadtteils? Sie haben regelmäßig mit den Kindern und Jugendlichen zu tun, bekommen den Lebensalltag und die Folgen struktureller Defizite hautnah mit. Andererseits haben sie auch ein Interesse daran, ihren Arbeitsplatz zu sichern und angenehm zu gestalten, so lautet die Kritik von Leitungskräften und Politik. Es fehle an nötiger Distanz zur Planung und zur Objektivität, weil Eigeninteressen mitschwingen. Andererseits wollen Jugendamtsleitung und die JugendpolitikerInnen ihre Konzepte umsetzen, die von den MitarbeiterInnen vor Ort oft als praxisfern und wenig wirkungsvoll angesehen werden. Sie kritisieren das Übertragen von angeblich erfolgreichen Modellen aus anderen Städten, besonders dann, wenn einzelne PolitikerInnen oder Leitungskräfte sich damit profilieren wollen. Andererseits sind persönliche Bezüge von Entscheidungsträgern notwendig, um die langen Zeiträume von Finanzierung und Umsetzung bei größeren Projekten institutionell abzusichern. Das ist der AG Kinder- und Jugendarbeit Vahrenheide in den letzten Jahren weniger gelungen. In der Verwaltung gab es Vorbehalte, Stadtteilrunden oder Arbeitsgemeinschaften als Selbstorganisation der Fachleute zu beteiligen. Sie galten als nicht einschätzbar, die Arbeitsformen als oft nicht transparent und wenig verbindlich. Stadtteilrunden arbeiteten in der Stadt Hannover derart verschieden (hinsichtlich ihrer Zusammensetzung, Regeln, Inhalte), dass sie nicht in das Verwaltungshandeln einzubeziehen waren, so lautete das Ergebnis einer Reihe von Workshops städtischer MitarbeiterInnen (vgl. LHH 1996a/b). Deshalb wurden die „Vernetzten Dienste“ als städtische Organisationsform geschaffen, um eine Lücke zu schließen zwischen den einzelnen Dienststellen vor Ort und der zentralen Verwaltung. Das Verhältnis und Zusammenspiel zwischen dieser neuen Organisationsform (Vernetzte 99 4. PERSPEKTIVEN ZUM STADTTEIL Dienste der Stadt Hannover), anderen Trägern und den selbstorganisierten AGs und Runden ist noch zu klären (vgl. Gebert; Seeberg 2001). Dabei werden Spannungspunkte der Zusammenarbeit bestehen bleiben: die Vereinbarkeit von dezentraler Planung im Stadtteil und zentraler, stadtweiter Planung, Fragen nach der Urheberschaft von Ideen und deren Umsetzbarkeit, dem Verhältnis und der Wertschätzung von unmittelbarer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und Leitungs- und Planungsaufgaben. Zukünftig werden Stadtteilanalysen unter Einbeziehung unterschiedlicher Perspektiven und öffentlicher Diskussion der Problemlagen gefragt sein. Offen bleibt, welcher Anteil an Steuerung durch Leitung und Politik bzw. welcher Anteil an Selbstorganisation sinnvoll ist und wie diese sich verbinden lassen. 4.4.3 Sozialpolitische Trends beeinflussen die Perspektiven Trotz grundsätzlicher Kritik der Fachleute im Stadtteil an Statistiken trug der Sozialbericht 1993 eine andere Handschrift. Er war getragen von wissenschaftlicher Gründlichkeit und sozialpolitischem Interesse die gesellschaftlichen Ursachen der Armut zu benennen. Hier konnten die Fachleute in den Brennpunktgebieten Hannovers Argumentationshilfen für ihre Arbeit gewinnen, so auch in Vahrenheide. Der Sozialbericht 1993 nimmt eine Differenzierung vor zwischen Einkommensarmut und Teilhabearmut. Die Strategien zur Bekämpfung sind materielle Unterstützung und Ausbau der sozialen Infrastruktur. Der Bericht benennt deutlich Faktoren, die Stadtteile zu Armutsquartieren machen. Vahrenheide, insbesondere Vahrenheide-Ost zählt dazu. Aus dem Bericht 1993 lassen sich Sozialdaten für einzelne Stadtteile herausarbeiten, um kleinräumige Analysen zu erstellen. Mit Fallbeispielen werden die quantitativen Daten ergänzt. Der Sozialbericht 1998 enthält kleinräumige und fallbezogene Betrachtung nicht mehr in so einer Vollständigkeit. Es geht darin stärker um die Lebenslagen in Hannover insgesamt. Neue Begriffe, wie „kinderreiche und kinderarme Stadtteile“ und „Lohnabstandsgebot“ werden aufgenommen. Der Begriff „Armutsinseln“ weckt Assoziationen an Urlaub und an die Diskussionen um die „soziale Hängematte“. Die Analyse der sozialen Ungleichheit steht im Vordergrund, weil nicht mehr „Armutsstadtteile“ oder „Zonen der Armut“ angenommen werden. Es fehlen Begriffe wie Teilhabearmut oder Armutsbekämpfung, und es wird von anderen Prämissen ausgegangen. Der Sozialbericht 1998 kommt auch zu anderen Schlüssen: 100 4.4 ZUSAMMENFASSENDER VERGLEICH DER PERSPEKTIVEN ZUM STADTTEIL „Wege aus der Armut müssen individuell angelegt sein, um der spezifischen Lebenslage ... zu entsprechen ... Die Bildung von Armutsinseln korrespondiert mit dem Wohnungsbestand“ (LHH 1998b, 87). Eine Obergrenze von 30% Sozialwohnungen solle im Stadtteil gesetzt werden. Gefördert werden solle das „intensive Zusammenwirken aller“, es müsse da einsetzen, wo soziale Problemlagen konzentriert auftreten und damit „den Kreislauf von Armut und Ausgrenzung“ unterbrechen. „Die Beteiligung von Betroffenen ... ist geeignet zur Vermeidung von Gewalt und Vandalismus“ (vgl. ebd., 88). Im Sozialbericht 1998 wird Armut nicht mehr nach Einkommens- und Teilhabearmut differenziert. Die Lebenslagen werden mit unscharfen Begriffen bezeichnet und soziale Problemlagen individualisiert. Dadurch bleiben die Risiken von Migration mit rechtlichen und sozialen Folgen oder städtebaulicher Segregation der Armutsbevölkerung unberücksichtigt. Weil Armut individuell betrachtet wird, können Hilfeempfänger an vorhandene Institutionen verwiesen werden. Dies kann erfolgen ohne finanziell aufwändige, sozialpolitische Maßnahmen entwickeln zu müssen. Der Sozialbericht 1998 schlägt vor: Dezentralisierung von Belegrechtswohnungen, Selbsthilfepotenziale, soziale Netzwerke, Kooperation und Vernetzung anregen, sozialen Lastenausgleich zwischen Arm und Reich herstellen, kinderfreundliches Wohnumfeld fördern, Berücksichtigung besonderer Lebenslagen, zielgruppenorientierte Unterstützung, Beratung und individuelle Förderung anbieten, Wohnraum für untere Einkommensgruppen, Qualifizierung und Beschäftigung schaffen (vgl. LHH 1998b). Der Bericht der Verwaltung gibt eine eher konservative sozialpolitische Tendenz vor. Die Ratsfraktion aus SPD und Bündnis90/Die Grünen zusammen mit Wohnungsbauträgern kommen jedoch zu anderen Beschlüssen. Stadtteilbezogene Ansätze für soziale Brennpunkte erhalten Förderungen, ergänzt durch Landesund Bundesprogramme zur „Integrierten Sanierung“ und „Sozialen Stadt“, um die Armut gerade nicht individuell zu bekämpfen. Der Rat der Stadt Hannover beschloss im Jahr 2000 stadtteilbezogene Maßnahmen in weiteren drei Brennpunktstadtteilen. Diese Entscheidung ist wesentlich beeinflusst von den erwarteten Bundes- und Landesmitteln, die den defizitären städtischen Haushalt der Stadt entlasten sollen. Stellenabbau und Aufgabenreduzierung der Kommune konnten die finanziellen Belastungen durch die seit etwa 10 Jahren wirkenden Haushalts- und Strukturreformen nicht ausgleichen. 101 5. Ergebnisse der Praxisforschung 5.1 SITZUNGSKULTUR UND ARBEITSWEISE IN DER SELBSTORGANISATION Leitungskräfte der Stadtverwaltung, Professionelle anderer Fachbereiche und PolitikerInnen halten den MitarbeiterInnen der AG vor, sie seien nicht ausreichend vernetzt. Gäste verstehen nicht, dass das gleiche Thema zweioder dreimal auf der Tagesordnung steht. Andere wundern sich, dass Sachverhalte nicht klar ausdiskutiert werden; sie vermissen zudem eine intellektuelle Auseinandersetzung mit Begriffen und Theorien. Leitungskräfte bemängeln die wenig konfrontative Form der Diskussion. Was ist an den Vorwürfen dran? Was passiert auf den monatlichen Sitzungen, die nur den im Stadtteil Tätigen vorbehalten sind? Worüber wird geredet, welche Informationen werden ausgetauscht und wie wird diskutiert? Wie werden Entscheidungen getroffen und umgesetzt? 5.1.1 Freiwillige Zusammenarbeit Die AG Kinder- und Jugendarbeit setzt sich zusammen aus sozialen und pädagogischen Fachkräften vieler Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe. Die Sitzungen sind freiwillig und selbst organisiert und finden zusätzlich zu den Dienstbesprechungen der jeweiligen Institutionen statt. Das bedeutet auch, dass die TeilnehmerInnen einen Nutzen für sich erkennen, die Zusammenkünfte als zweckmäßig betrachten und den Zeitaufwand und das Engagement dafür aufbringen, um folgende selbstgesteckte Ziele zu verfolgen: „1. Verbesserung der Lebensqualität der Kinder und Jugendlichen in ihrem Wohnumfeld. 2. Förderung von Beteiligungsmöglichkeiten und die Schaffung eines kinder- und jugendfreundlichen Stadtteils. 3. Bedarfe aufzeigen und gezielte Angebote entwickeln durch Absprachen der AG-TeilnehmerInnen untereinander. 4. Kollegialer Austausch. 5. Intensive Kooperation und Vernetzung, um Ressourcen optimal zu nutzen“ (vgl. P2, Selbstdarstellung). Einzelne Einrichtungen können für ihre neuen Vorhaben in der AG Beratung und Unterstützung finden. Gemeinsame Projekte entstehen aufgrund festgestellter Bedarfe. Dazu werden Konzepte entwickelt, fachliche Stellungnahmen abgegeben, Finanzanträge gestellt und Maßnahmen umgesetzt. Nicht alle können in dieser intensiven Weise mitarbeiten. Kleinste gemeinsame Nenner sind immer noch der Austausch von Informationen und 102 5.1 SITZUNGSKULTUR UND ARBEITSWEISE IN DER SELBSTORGANISATION die direkten Kontakte zu FachkollegInnen. Die Form dieses Austauschs gleicht eher einer behutsamen Annäherung an komplexe Themenfelder. Dabei wird nach dem Konsensprinzip verfahren und weniger strittig diskutiert. Grundsätzliches Ziel ist es, nach eingehender fachlicher Erörterung schnelle Verfahrens- und Handlungswege zu entwickeln und umzusetzen. 5.1.2 Ablauf der Sitzungen Die AG Kinder- und Jugendarbeit trifft sich regelmäßig einmal im Monat vormittags für zwei Stunden. Es werden keine Einladungen verschickt. Geänderte oder zusätzliche Termine sowie der jeweilige Sitzungsort werden monatlich am Ende der Sitzung verabredet. Das Protokoll soll mit einer TeilnehmerInnenliste bis zur nächsten Sitzung verschickt sein, was überwiegend auch geschieht. Dieser halböffentliche Rahmen erschwert den Zugang für neue Fachleute. Am Anfang der Forschung rotierten überdies die Ansprechpartner, und Arbeitsweisen waren nicht schriftlich festgelegt und somit schwer nachvollziehbar. Die Sitzungen fanden in Einrichtungen mit größeren Versammlungsräumen statt. Bis auf einzelne Ausnahmen waren das drei Einrichtungen im Wechsel. Die dort tätigen Mitarbeiterinnen, ausnahmslos Frauen, richteten die Räume her und trafen die Sitzungsvorbereitungen. Die Tischgruppe in Form eines Rechtecks bot Platz für 20 bis 30 Personen. Im Untersuchungszeitraum nahmen anfangs 21, später 24 Einrichtungen teil, davon 17 regelmäßig, vier nur gelegentlich, und drei informierten sich über die Protokolle oder telefonisch. Es kamen ein bis zwei Personen pro Einrichtung. Im Forschungszeitraum waren es im Durchschnitt 18 TeilnehmerInnen. Davon waren 13 Frauen (Streuung: 9-17) und fünf Männer (Streuung: 2-8) (vgl. P2). Gelegentlich wurden Gäste (PolitikerInnen, Leitungskräfte, andere Fachleute z.B. Kontaktbereichsbeamte, Stadt- und Grünplaner) eingeladen. Tee und Kaffee, meistens auch Kekse standen entweder auf einem zusätzlichen Tisch bereit oder waren bereits auf die angeordneten Tische verteilt. 5.1.3 Verbindungen zu anderen Gremien Nahezu alle AG-TeilnehmerInnen arbeiten in anderen stadtteilbezogenen Gremien mit. Die hohe zusätzliche Teilnahme an der Koordinationsrunde für Soziale Fachkräfte (KO-Runde) (14, über die Hälfte der AG) weist auf die Bedeutung der Runde für die Soziale Arbeit im Stadtteil hin. Auffällig ist die geringe Teilnahme an den Sitzungen des Stadtbezirksrates. 103 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG Bei der Mitarbeit in stadtweiten trägerbezogenen Gremien heben sich die städtischen Einrichtungen und die der AWO von anderen ab. Sie haben mehr trägerinterne Treffen, um die Arbeit auch stadtweit zu koordinieren. Die Mitarbeit in stadtweiten übergreifenden Gremien besteht aus Treffen z.B. zur Fachplanung, Jugendhilfeplanung, Bürgerbeteiligung, Agenda 21, zur kinderfreundlichen Stadt und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Hier vertreten lediglich zwei Fachleute, jeweils die AG in stadtweiten Gremien. Darüber hinaus gibt es Fachthemen z.B. zur Hortarbeit oder zur Berufsorientierung, zu denen sich einzelne auf Stadtebene engagieren. Die Entscheidung zur Mitarbeit in diesen Gremien liegt bei den Einzelnen. Eine thematische Festlegung oder Prioritäten der AG gibt es nicht. Der Informationsfluss aus den jeweiligen Gremien in die AG war jedoch dem Zufall überlassen. Die im April 1998 gewählte Sprecherin gab Informationen aus der Koordinationsrunde (Stadtteilrunde) und dem Bezirksrat weiter. Die AG erhielt keine regelmäßigen Informationen aus dem Jugendhilfeausschuss oder über Planungen des Jugendamtes. Sie war keinem entsprechenden Verteiler angeschlossen, so dass kontinuierliche Informationen über stadtweite Entwicklungen nicht gewährleistet waren. Die AG Kinder- und Jugendarbeit nahm keine Weisungen von Politik und Administration entgegen. Die TeilnehmerInnen entschieden selbst über zu bearbeitende Schwerpunkte. Das entlastete die AG vom Außendruck und von der zu bearbeitenden Informationsfülle, die andernorts offizielle Dienstwege und Dienstbesprechungen bestimmen. Andererseits hatte die AG dadurch den Ruf, sie grenze sich gegenüber anderen Institutionen ab und sei nicht zur Zusammenarbeit mit Außenstehenden bereit. 5.1.4 Funktionen der AG-Sitzungen Durch die Vielfalt der Einrichtungen und den weiten thematischen Bereich der Kinder- und Jugendhilfe waren auch die behandelten Themen weit gesteckt. Nicht die stadtweiten jugendpolitischen Themen kamen zur Sprache, sondern diejenigen, die sich aus den subjektiven Erfahrungen in den Einrichtungen ergaben. Daraus formulierten die AG-TeilnehmerInnen Fragen und verarbeiteten ihre Erfahrungen im Austausch mit FachkollegInnen zu allgemein gültigen Erkenntnissen. In der Diskussion entwickelten sich Anregungen und Impulse für die weitere Arbeit. Viele Themen fanden sich über einen längeren Zeitraum in den Sitzungen wieder. Es waren insbesondere selbst gewählte Projekte wie z.B. Mädchen104 5.1 SITZUNGSKULTUR UND ARBEITSWEISE IN DER SELBSTORGANISATION haus, Abendsport und Zukunftswerkstätten, die einen Austausch erforderten. Regelmäßig besprochen wurden die aktuellen Bedarfe in den Einrichtungen und im Stadtteil. Problemanzeigen, wie z.B. Drogenkonsum im Stadtteil oder sexueller Missbrauch, führten wiederholt zu Beratungen und zu Kleingruppenarbeit. Anhand der thematischen Schwerpunkte ließen sich verschiedene Funktionen herausarbeiten, die in den Sitzungen erfüllt wurden. (1) Informationen und Vorstellung neuer Arbeitsgebiete Wenn sich die AG mit neuen Themen beschäftigte, wurde Offenheit von den TeilnehmerInnen erwartet. Offene Fragestellungen waren häufig auch mit Variationen des Vorgehens verbunden. Es gab verschiedene Möglichkeiten, die Themen zu vertiefen. Entweder wurden Gäste eingeladen oder längere Gesprächsphasen vereinbart, zu denen einzelne sich vorbereiteten oder zu denen Kleingruppen Diskussionsvorlagen erarbeiteten. Aber auch Einrichtungen der AG stellten sich mit Konzepten den anderen vor. Dann wiederum gab es Sitzungsphasen, die Informationscharakter hatten, wo kurz und prägnant Termine oder Adressen mitgeteilt wurden. Dazu gab es kurze mündliche Erläuterungen und evtl. Informationsblätter. (2) Bedarfserhebung und Planung Eine andere Form des Austauschs und eine Besonderheit der AG war die Verarbeitung der beruflichen Erfahrungen der TeilnehmerInnen. Das geschah in einer praxisbezogenen Sprache, in der sich Sichtweisen der Fachleute als reflektierter und analytischer Fachbeitrag mit Erlebnisberichten und Stimmungs- und Meinungsbildern der Kinder und Jugendlichen vermischten. Den Anwesenden waren die Ebenen verständlich, auch ohne dass sie expliziert angekündigt wurden. Sie erhielten so ein komplexes Bild von bestimmten Sachverhalten. Die Atmosphäre ermöglichte „lautes Denken“; das bedeutet, sich dem Thema assoziativ zu nähern, weniger zu kritisieren, sondern eher zuzuhören und zu ergänzen. Ziel dieser Rundgespräche ist es, ein möglichst umfassendes Meinungsbild über einen Themenbereich herzustellen und darüber hinaus sich gedanklich die Anwendung oder Umsetzung in der eigenen Einrichtung vorzustellen sowie das Für und Wider abzuwägen. 105 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG (3) Konzeptentwicklung Es gab Themen, die sich nicht in einer Sitzung abarbeiten ließen, sondern die gründliche Vorbereitung, konzeptionelle Vorarbeit, Abstimmung mit anderen Trägern, Finanzanträge, kontinuierliche Begleitung usw. benötigten. Hier bildete die AG zusätzliche Unter-Arbeitsgruppen aus mehreren Einrichtungen, die sich befristet über einen Zeitraum nur zu einem Thema trafen und dann auch die Verantwortung für das Ergebnis und die Umsetzung übernahmen. Dennoch wurden Entscheidungen jeweils zur Abstimmung noch einmal in der AG vorgestellt: (4) Werbung um Mitarbeit Die Arbeitsgruppen stellten ihre Konzepte vor und erfragten abschließend die Bereitschaft zur Mitarbeit. Zur Umsetzung der Projekte wurden Aktive gesucht, eine nicht immer leichte Aufgabe, weil eine Zusage erheblichen zeitlichen Aufwand und den persönlichen Einsatz erforderte. An diesem Punkt schieden sich die Geister. Es begann jedes Mal wieder ein schwieriges Abwägen. Jede Fachkraft musste nun klären, inwieweit sich Arbeitsanteile für das konkrete Projekt, z.B. Abendsport, Mädchenhaus oder Zukunftswerkstatt, als stadtteilorientierte Maßnahmen in die Strukturen der eigenen Arbeit integrieren ließen und ob eine grundsätzliche Bereitschaft bestand, sich mit dem Thema auseinander zu setzen. Jedes Thema teilte die AG in TeilnehmerInnen, die sich lediglich informierten oder mitdiskutierten und in andere, die Ergebnisse direkt anwenden und mit Kindern und Jugendlichen umsetzen wollten. Die Grenze blieb jeder Person überlassen. Es gab allerdings die Erwartung, über die Tätigkeit in der jeweils eigenen Einrichtung hinaus auch Zeit in gemeinsame Projekte zu investieren. (5) Sachstandsberichte und Auswertungen Vertiefte Diskussionen entstanden, wenn Projekte und Aktionen ausgewertet und der AG vorgestellt wurden. Aber auch Sachstandsberichte ließen Raum für Meinungsäußerung und Fragen. Die große Runde der Fachleute bot die Möglichkeit, Erfahrungen aus unterschiedlichen Perspektiven zu reflektieren. In Kleingruppen konnten Themen vertieft und Konzepte erarbeitet werden. Ergebnisse wurden entweder gemeinsam als AG oder in den betroffenen Einrichtungen umgesetzt. Die Autonomie der Einrichtungen wurde dabei strikt respektiert. 106 5.1 SITZUNGSKULTUR UND ARBEITSWEISE IN DER SELBSTORGANISATION (6) Interne Absprachen und Kontroversen Vereinbarungen, die den Ablauf der Sitzungen betrafen, hatte es in der Vergangenheit nur wenige gegeben. Die Treffen hatten sich eingespielt. Sie fanden statt „wie immer“. Es gab nur wenige Verfahrensfragen, die der Klärung bedurften. So war einigen TeilnehmerInnen der AG nicht klar, wie es zur Entscheidung für das gemeinsame Vorhaben „Zukunftswerkstätten und Beteiligungsprojekte“ gekommen war. Dazu wurde die Geschichte der AG für die Neuen zusammengefasst und bisherige Absprachen im Protokoll festgehalten. Die Zukunftswerkstätten erforderten eine stärkere Außenvertretung und gleichzeitig regten die Interviews dieses Forschungsprojekts an, über die innere Struktur der AG nachzudenken. Es wurde erstmals eine Sprecherin sowie eine Stellvertreterin gewählt. Weiterhin erfolgte die Einigung auf eine Reihenfolge bei der Sitzungsleitung und Protokollführung. Ein weiterer Punkt war die Überlegung einer Vereinsgründung als Arbeitsgemeinschaft, um Projekte finanziell besser absichern zu können, die jedoch nicht umgesetzt wurde. Auffällig war, dass sich im Untersuchungszeitraum eine deutlichere Struktur der AG herausbildete. Dadurch wurden interne Regeln transparenter und Absprachen mit außenstehenden Fachleuten leichter. Insgesamt lässt sich die typische Vorgehensweise der AG in sieben Schritten darstellen, aus denen sich wechselnde Anforderungen an die Sitzungsleitung ergeben. Die unten aufgeführte Tabelle zeigt die Bearbeitung eines Themas von der Information bis zur Umsetzung für die Kinder und Jugendlichen. Die Arbeitsschritte waren vielen TeilnehmerInnen nicht bewusst, obwohl sie sich in den Sitzungen wiederholten. Die Moderation achtete auf das Verfahren und verfolgte die Bearbeitung und Klärung der einzelnen Schritte. Die TeilnehmerInnen der AG unterstützten das Verfahren durch ihre Beiträge. Um die Verfahrensweisen zu klären, wurde häufig von der ModeratorIn gefragt: „Wie weiter?“ Für die inhaltliche Ebene wurde zu weiteren thematischen Äußerungen aufgefordert: „Gibt es dazu noch Beiträge?“ Oder es wurden bisherige Positionen als Zwischenbilanz zusammengefasst. Die Schritte A bis G konnten ggf. verkürzt oder auch übersprungen werden oder sich über mehrere Sitzungen verteilen. Am Ende war ein Thema inhaltlich diskutiert, die AG hatte konzeptionelle Entscheidungen getroffen, und die Ergebnisse waren in Projekte und Aktionen umgesetzt worden. Danach gab es einen Bericht; der Sachstand konnte als Impuls für eine Weiterarbeit gesehen werden und mündete dann wieder in die Schritte B bis G. 107 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG Tabelle 17: Arbeitsschritte der AG zur Entwicklung von Projekten 7 Schritte Tätigkeiten Zentrale Fragen A Thema einbringen Thema vorstellen, Informationen geben Reichen die Informationen oder Soll das Thema vertieft werden? B Meinungsbild herstellen Informationen ergänzen, Erfahrungen berichten, Fragen stellen, ... Fehlen weitere Informationen? Gibt es Handlungsbedarf? C Thema vertiefen (Diskussion) kurz diskutieren oder ausführlich diskutieren oder Thesenpapier diskutieren oder ExpertInnen anhören oder... Benötigt das Thema Feinplanung oder lassen sich Ergebnisse bereits umsetzen? Findet das Konzept ZustimD Konzept erstellen Bedarf erheben, mung oder gibt es (Arbeitsgruppe) Maßnahmen vorschlagen, Vorhandenes einbeziehen,... Änderungswünsche? E Beschluss/ Konsens herbeiführen Konsens erzielen oder Abstimmung durchführen Wer beteiligt sich an der Umsetzung? Welche Ressourcen werden benötigt? F Ergebnisse umsetzen in den Einrichtungen berücksichtigen oder Stellungnahmen schreiben oder Anträge stellen oder Projekte entwickeln und umsetzen oder... Wie verläuft die Umsetzung? Wo gibt es Hindernisse? Wo braucht das Vorhaben Unterstützung? G Sachstand berichten (ggf. weiter bei B) Entwicklung zusammenfas- Reichen die Informationen oder sen, Sachstand wiedergeSoll das Thema weiter verben,... tieft werden? (vgl. Beobachtungen P2) 108 5.1 SITZUNGSKULTUR UND ARBEITSWEISE IN DER SELBSTORGANISATION 5.1.5 Die AG veränderte ihre Struktur Die AG Kinder- und Jugendarbeit entwickelte im Forschungszeitraum nicht nur eine deutlichere Struktur, was die Moderation der Sitzungen betraf. Man einigte sich zudem auf regelmäßige Kontakte zum Bezirksrat. Zu einigen Personen in der Stadtverwaltung war über die Zusammenarbeit bei den Zukunftswerkstätten (Anträge auf Fortbildung und Projektgelder) eine verbindlichere Form der Zusammenarbeit entstanden. Frauen gehörten mehrheitlich zu den GründerInnen der AG und prägten über lange Jahre die Aktivitäten der AG. Daher wurden auch zwei Frauen als SprecherInnen gewählt. Neben allgemeinen Themen hat sich Mädchenarbeit in Vahrenheide zu einem festen Bestandteil der AG-Arbeit entwickelt. Hierzu trafen sich seit einigen Jahren zusätzlich zur AG-Sitzung Frauen aus fünf Einrichtungen (Gemeinwesenarbeit, Spielmobil, Ev. Tituskirchengemeinde, Jugendzentrum und Kulturtreff). In kontinuierlicher Arbeit entwickelten sie Mädchengruppen, Mädchenfreizeiten, Mädchen- und Frauenprojekte. Nach einigen Jahren der Zusammenarbeit erreichte dieses Bündnis durch einen Trägerverbund die Umsetzung eines Mädchenhauses, indem jede Einrichtung sich für bestimmte Öffnungszeiten zuständig erklärt. Trotz knapper öffentlicher Kassen wurden Investitionsmittel bei Stadt und Land beantragt und Personalbudgets aus den Einrichtungen umgeschichtet. In diesem Projekt konnten die Sozialarbeiterinnen ihre Rolle als „Frau in der Sozialen Arbeit“ reflektieren und mit konkreten Arbeitsschwerpunkten gestalten. Die Männer in der AG Kinder- und Jugendarbeit waren thematisch nicht in gleicher Weise miteinander verbunden. Es gab keine Gesprächskreise zur Jungen- oder Männerarbeit. „Wir machen sowieso Jungenarbeit, weil wir täglich überwiegend mit Jungen arbeiten“, berichtete ein Mitarbeiter (P5). Innerhalb der AG hatten die Männer nur in Einzelfällen und vorübergehend koordinierende oder leitende Aufgaben übernommen. Nahezu alle Männer waren entweder in der eigenen Einrichtung mit Leitungsaufgaben betraut oder sie konnten sich auf andere Bündnisse parallel zur AG mit vergleichbaren oder ergänzenden Themenbereichen beziehen. Eine Vielzahl der männlichen Fachkräfte besuchte die KO-Runde (Stadtteilrunde), deren Thematik übergreifender und weiter gefasst war, jedoch nicht in die Umsetzung von Projekten mündete. An der KO-Runde/Stadtteilrunde nahmen 20 bis 30 Personen teil, im Schnitt 25 von 50 eingeladenen Institutionen. Dort waren Männer zu 52% beteiligt (vgl. P5). 109 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG 5.1.6 Verschiedene Formen der Vernetzung In den wesentlichen Merkmalen Zusammensetzung, Struktur, Aufgaben, Ziele, Handlungsebenen und bei erreichten Ergebnissen gibt es gravierende Unterschiede zwischen der AG Kinder und Jugendarbeit und anderen Vernetzungsrunden. Wesentliches Kennzeichen ist der Grad an Selbstorganisation und die Nähe bzw. Distanz zu Institutionen bzw. Betroffenen sowie die Bereitschaft, sich auf das Planen und Umsetzen von Maßnahmen einzulassen. Innerhalb des Forschungsprozesses waren folgende vier Typen der Vernetzung in der Kinder- und Jugendhilfe auszumachen: Typ A (AG Kinder- und Jugendarbeit): Fachkräfte vor Ort schließen sich zusammen, um sich fachlich auszutauschen, Maßnahmen zu planen und umzusetzen. Teilnehmen können alle Fachkräfte, die selbst unmittelbar mit den Zielgruppen arbeiten. Die Arbeit wird reflektiert, Fachlichkeit verschiedener Bereiche fließt in die Diskussion ein. Die Qualität der Arbeit wird erhöht. Häufig entstehen Gegenpositionen zu Planungen der Runden von Typ C und D. Durch öffentliche Kritik, Gegenpositionen und eigene Konzepte wird ein politisches Mandat auf Sozialpolitik und administratives Handeln ausgeübt. Tabelle 18: Vier typische Strukturen von Netzwerken AG Kinder und Jugendarbeit KO-Runde Stadtteilrunde Vernetzte Dienste Kriminalpräventiver Rat Entscheidungen Zusammensetzung MitarbeiterInnen von Kinder- und Jugendeinrichtungen MitarbeiterIn- 1 bis 2 Delenen von sozia- gierte städtischer Ämter len Einrichtungen im Stadtteil Leitungskräfte, Beauftragte und ausgewählte MitarbeiterInnen Geschäftsfüh- Fachleute vor rung bestimmt Ort durch Fachleute vor Ort Leitungskräfte Leitungskräfte Fachleute vor Ort Fachleute vor Ort Fachleute vor Ort/Leitungskräfte Themenauswahl bestimmt durch 110 Leitungskräfte 5.1 SITZUNGSKULTUR UND ARBEITSWEISE IN DER SELBSTORGANISATION Funktionen Info-Austausch Ja Ja Ja Ja Projektplanung Ja Nein Ja Ja Öffentliche Stellungnahmen Ja, gegenüber Politik und Verwaltung Ja, gegenüber Politik und Verwaltung Nein, nur gegenüber Amtsleitung Ja, durch Leitung Gemeinsame Umsetzung Ja Nein Teilweise Ja, über Vereinbarungen/ Anweisungen Schwerpunkte der Runden Austausch und selbständiges Planen und Handeln im Stadtteil Austausch und Diskussion Austausch und Empfehlungen – teilweise Umsetzung im Stadtbezirk Austausch, stadtweite Konzeption und Umsetzung Typ B (z.B. KO-Runde/Stadtteilrunde): Fachleute vor Ort schließen sich zusammen, um sich fachlich auszutauschen. Die Arbeit wird reflektiert. Alle können für ihre Bereiche Anregungen erhalten. Diese Runde verzichtet auf die Umsetzung von gemeinsamen Projekten oder übernimmt kein politisches Mandat. Sie dient vorrangig dem Austausch und der Information. Typ C (z.B. Vernetzte Dienste, ämterübergreifende Planungsrunden): Die Stadtverwaltung oder ein anderer Träger beschließt zur effektiveren Wahrnehmung von Aufgaben eine zusätzliche Organisationsform zu schaffen, um die Hierarchie abzuflachen und interne Kommunikationswege zu verkürzen. Planungen lassen sich so besser koordinieren und schneller umsetzen. Typ D (z.B. Kriminalpräventionsräte): Fachleute verschiedener Bereiche, aus allen Hierarchieebenen, von öffentlichen und privaten Trägern tauschen sich aus, bearbeiten ein öffentliches Problem und vereinbaren Arbeitsschritte, die in den jeweiligen Bereichen (als Vertrag mit der Runde, über Anweisungen in den Organisationen) umgesetzt werden. Dabei müssen die Leitungskräfte über Richtlinienkompetenzen verfügen, um Maßnahmen umzusetzen. 111 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG Die Stärke der AG Kinder- und Jugendarbeit ist, dass sie über Struktur der Sitzung und Zusammensetzung der Teilnehmerrunde selbst entscheidet. Ebenso behält sie alle Schritte von der Analyse bis zur Planung und Umsetzung in den Händen. Sie kann als ein Bündnis zur Realisierung von Maßnahmen, aber auch für politische Stellungnahmen und ein Netzwerk zum fachlichen Austausch bezeichnet werden (vgl. Holland-Cunz 1998). Die Schwierigkeit besteht darin, alle Funktionen intern zu erfüllen. Bündnisse erfordern Entscheidungen, um handlungsfähig zu bleiben. Dadurch ist eine wesentliche Voraussetzung ein hoher Grad an Verbindlichkeit, der bei strittigen Themen nicht ohne weiteres gegeben ist. Bündnisse beziehen eher nur Teile der AG ein, wie z.B. bei der Mädchenarbeit. Ein weiteres Problem ist die fehlende Klärung, unter welchen Bedingungen TeilnehmerInnen des Netzwerks in ein Bündnis wechseln und mit welchem Verantwortungsgrad. Über zusätzliche kleine Arbeitsgruppen zu den Themen Zukunftswerkstätten und Mädchenarbeit wurde eine Abgrenzung unternommen und höhere Verbindlichkeit hergestellt. Für Außenstehende blieb jedoch unklar, wer für das Netzwerk und wer für das Bündnis spricht. Die Sprecherinnen waren sich der Reichweite ihrer Kompetenzen häufig nicht bewusst, bzw. diese waren nicht festgelegt. Das erforderte häufige Rücksprachen, sodass zwischen den monatlichen Treffen keine Entscheidungen möglich waren. Das schwächt die Außenvertretungs- und Durchsetzungsfähigkeit dieser Organisationsform. Nicht alle Vorhaben und Planungen im Stadtteil lassen sich ohne Zustimmung von Leitungskräften im Jugendamt oder ohne notwendige Finanzen der Kommune durchsetzen. Hier ist zu fragen, welche Bündnisse mit Administration und Politik geschlossen werden können, und inwieweit sich dabei Arbeitsformen und Ziele der AG aufrecht erhalten lassen. 5.1.7 Zusammenfassende Beurteilung der Arbeitsweise Im Gegensatz zu anderen selbst organisierten Runden, die sich nur austauschen und informieren, ist diese AG handlungsorientiert und gewinnt Bedeutung durch die Wahrnehmung eines politischen Mandats. Das Mandat nimmt sie aufgrund kollegialer Praxisreflexion und fachlicher Analyse wahr, wodurch der Stadtteil als Armutszone ausgemacht wird, die mangelnde Selbstorganisation, Bürgerengagement und politische Partizipation nach sich zieht. Die AG distanziert sich von „Laberrunden“, in denen Ideen und Konzepte nicht in sozialpädagogisches und politisches Handeln umge112 5.1 SITZUNGSKULTUR UND ARBEITSWEISE IN DER SELBSTORGANISATION setzt werden. Sie ist nicht in die Hierarchie eines Trägers eingebunden und nimmt keine Weisungen entgegen. Sie erhält damit die Beweglichkeit, Themen eigenständig zu bestimmen und sich Kooperations- und Bündnispartner selbst auszuwählen. Auch kann sie sich mit Stellungnahmen und Gesprächen an jede Institution und jedes Gremium wenden. Die Organisation der AG ist handlungsorientiert, wenig hierarchisch, konsensorientiert und lässt wenig Spielraum für exponierte Positionen einzelner TeilnehmerInnen. Frauen übernehmen in der Organisation des Typs A wesentliche Funktionen und stellen ca. zwei Drittel der TeilnehmerInnen. Frauen können sich durch Mädchen- und Frauenarbeit mit ihrer beruflichen Identität in der Sozialen Arbeit auseinandersetzen und dadurch an Sicherheit gewinnen (vgl. Dietzen 1993). Männer nutzen weniger den Weg der inhaltlichen Auseinandersetzung über Jungen- und Männerarbeit. Sie wählen dazu weitgehend traditionelle Wege, durch Distanz zu konkreten Aktionen und Bevorzugung von konzeptioneller Arbeit, Bündnissen mit oder Engagement in gewerkschaftlichen Organisationen, informeller Kontakte zu Funktionsträgern in der Hierarchie oder Übernahme von Leitungsaufgaben. Männer halten über persönliche Verbindungen den Kontakt zu anderen Runden und nutzen weniger die von Frauen bestimmte Außenvertretung der AG. Diese Form der beruflichen Interaktion von Männern fanden auch Höyng und Puchert in der öffentlichen Verwaltung bestätigt (vgl. ebd. 1998). Die AG als Arbeitsform scheint mit vielen anderen Organisationen in Politik und Verwaltung hinsichtlich der wenig strukturierten Leitung und des hohen Grades an Selbstbestimmung nicht kompatibel zu sein. Anhand des Umgangs mit Gästen lässt sich gut ein Stimmungsbogen der AG abbilden, der als Spiegel für die Werte und Normen der AG gelten kann, denn bei der Behandlung waren klare Unterschiede festzustellen. Mit Lehrkräften, die einen projektorientierten Ansatz verfolgten, die AG rechtzeitig informierten und einbezogen, ging man respektvoll um. Der Umgang mit Polizeibeamten, die sich auch sozialen Problemen widmen wollten und engere Kooperation anstrebten, war aufgrund der Abgrenzung zur Kontrolle und Ordnungspolitik eher distanziert. Mit Grünplanern gab es kooperative Formen des Umgangs, weil beide Seiten Beteiligung von Kindern und Jugendlichen anstrebten. Leitungskräfte des Jugendamtes wurden höflich und distanziert behandelt, ohne jedoch auf deren Anliegen einzugehen, da hier die Rollen nicht geklärt waren hinsichtlich der Geltung des jeweiligen Fachwissens und der Berufserfahrung, Entscheidungskompetenz und Mitbestimmung sowie Aufgabenverteilung und Über-/Unterordnung im hierarchischen Gefüge der Ämter und Verbände. 113 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG Es gab in der AG die stillschweigende Übereinkunft, sich hinsichtlich der Konzeptionen und Arbeitsweisen nicht gegenseitig „reinzureden“. Jeder Einrichtung wurde Autonomie bei Fragen der Konzeption, Schwerpunktsetzung und Methodenwahl zugestanden und weitgehend respektiert. Andererseits gab es auch MitarbeiterInnen, die Solidarität bei der AG einklagten, um personelle oder räumliche Defizite ihrer Einrichtung mit Hilfe der anderen zu lösen. Die AG verhielt sich in diesen Konflikten neutral. Es gab neben den AG-Sitzungen zwar noch partielle Bündnisse mit stärkerer Verantwortlichkeit, diese waren aber projektbezogen, auf Gegenseitigkeit angelegt und in häufig personenabhängig. Was kann diese Form der Kooperation leisten? Ist es sinnvoll, offensichtliche Versäumnisse oder Fehlentwicklungen einzelner Einrichtungen nicht anzusprechen? Die Stärken der AG sind die Meinungsbildung über komplexe Themen, das Abwägen möglicher Handlungskonzepte und die Berücksichtigung von Bedingungen der Zielgruppen und des Umfeldes. Darin ist die Arbeitsform dieser Arbeitsgemeinschaft wirkungsvoll und effektiv. Für die Sitzungen der AG ist die Zeit von zwei Stunden im Monat knapp bemessen. Das ist gerade ausreichend, um die wichtigsten Funktionen zu erfüllen. Es ist auch ein Zeitraum, auf den sich alle Einrichtungen einstellen können. Die Bearbeitung von internen konfliktbesetzten Themen würde einen anderen Rahmen erfordern und die Handlungsfähigkeit zumindest zeitweilig beeinträchtigen. Dadurch würden sich die thematischen Schwerpunkte der AG verschieben. Pädagogische und psychologische Themen (Beziehungen zueinander, Selbst- und Fremdbild einzelner Einrichtungen, usw.) könnten so in den Vordergrund treten, dagegen würden sozialpolitische Themen seltener diskutiert. Damit würde sich allerdings das Selbstverständnis der AG grundlegend verändern, und es ist fraglich, ob die AG dann noch eigene zeitaufwendige Projekte durchführen könnte. Fehlende Absprachen bei der Öffentlichkeitsarbeit und neuen Projekten bilden ein großes Konfliktpotenzial. Die AG scheint zu befürchten, dass kontroverse Positionen im Stadtteil nach außen sichtbar werden und dies die Konsensfindung erschweren und die Durchsetzungsfähigkeit der AG schwächen könnte. Andererseits würden Wandel und Beweglichkeit neue Bündnisse ermöglichen. Die AG erführe auf der Beziehungsebene Entlastung und könnte auch Auseinandersetzungen mit Entscheidungsträgern eingehen, ohne einen Verlust an Durchsetzungskraft befürchten zu müssen. Voraussetzung wäre allerdings, dass der Wert der eigenen Arbeit realistisch eingeschätzt und vertreten werden kann und dass die AG ihr Selbstver114 5.2 ZUKUNFTSWERKSTÄTTEN UND BETEILIGUNGSPROJEKTE ständnis zu einem Netzwerk verändert, in dem kontroverse Standpunkte und unterschiedliche Bündnisse akzeptiert werden. Die AG könnte sich als Netzwerk für Austausch und Diskussion begreifen und Bündnisse zur Durchsetzung von Projekten quer durch die Organisationsstrukturen schließen. Dadurch wäre die grundsätzliche Polarisierung zwischen Stadtteil und Entscheidungsträgern in Stadtverwaltung und Politik in Frage gestellt. Das würde auch Fragen auslösen nach der bisherigen Arbeitsverteilung. Die AG erfordert vielfach Mehrarbeit, was die Gefahr der Überforderung birgt. Es ist schwer messbar, welche Erfolge mit welchem Aufwand erreicht wurden. Daher ist zu fragen, wie es den Einzelnen mit der zusätzlichen Anforderung der Projektarbeit im Stadtteil geht, in welchem Maß dafür zeitliche Kapazitäten vom Träger bereitgestellt werden, in welcher Weise die TeilnehmerInnen mit den Enttäuschungen umgehen, wenn die Polarisierungen auf den Organisationsebenen Erfolge und Anerkennung verhindern und welche Schlüsse die AG-TeilnehmerInnen daraus ziehen. 5.2 ZUKUNFTSWERKSTÄTTEN UND BETEILIGUNGSPROJEKTE Wie in anderen Städten und Gemeinden auch, gibt es in Hannover allgemein Bestrebungen der Fachleute in Grün- und Bauplanung, Kultur- und Sozialarbeit, jeweils für ihre Bereiche Beteiligungskonzepte zu erproben und umzusetzen. In der Stadtverwaltung Hannover wird bzw. wurde BürgerInnenbeteiligung in Planungsprozessen zur Sanierung und Stadtentwicklung, bei Umweltfragen zur Agenda 21 oder bei den EXPO-Vor- und Nachbereitungen durch ein Bürgerbüro Stadtentwicklung unterstützt. In der „Integrierten Sanierung“ Vahrenheides versuchen Planungsamt und Bauträger mit Bürgerforum und Bewohnervereinen geeignete Formen zur Beteiligung der BewohnerInnen zu finden. Eine Kindertagestätte in Vahrenheide setzte Projektwochen mit einer Befragung zu Freizeitverhalten und Wünschen um, wobei Kinder Fragende und Befragte waren. Jugendliche im Jugendzentrum waren an der Entscheidung über die Gestaltung dortiger Räume und Freiflächen beteiligt. Die Diskussion in der AG Kinder- und Jugendarbeit ging noch darüber hinaus und fragte nach Möglichkeiten für eine trägerübergreifende Lobbyarbeit. Die Sichtweisen von Kindern und Jugendlichen sollten langfristig stärker zur Geltung kommen. Es sollte nicht nur darum gehen, Forderungen einzelner Träger zu verfolgen, sondern auf die Bilanz der 30-jährigen Ent115 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG wicklung Vahrenheides reagiert werden, die eine nahezu unveränderte Sozialstruktur der Bewohnerschaft ergab, mit gehäuften Problemen durch Arbeitslosigkeit, Armut und verdichteten Wohnformen. Das fehlende Engagement von Erwachsenen, deren mangelnde Beteiligung, Selbstorganisation und Selbsthilfe wurden als starkes Hindernis aus allen Einrichtungen gemeldet. Diese Problematik wollten die Fachleute der AG Kinder- und Jugendarbeit mit Zukunftswerkstätten und anschließenden Beteiligungsprojekten aufgreifen. Vorbild war ein in Schleswig-Holstein erprobtes Verfahren, das die von Robert Jungk und Norbert R. Müllert beschriebene Methode Zukunftswerkstatt zu einem Planungsverfahren für Kinder entwickelte. In ihrer ursprünglichen Form besteht die Zukunftswerkstatt aus drei Phasen: Kritik-/Beschwerdephase, Phantasie-/Utopiephase und Planungs-/Umsetzungsphase (vgl. ebd. 1989, 44). Die aktive Teilnahme soll BürgerInnen helfen, Resignation zu überwinden, weil die Lebenserfahrung in die Zukunftsgestaltung einfließen kann. Als demokratische Praxis wird das Annehmen und Wiedergeben von Informationen und Argumenten geübt, gleichzeitig soll Phantasie zur Ideenfindung und Veränderung geweckt werden. Das Arbeiten an Zukunftsperspektiven schafft eine starke Verbindung zwischen den TeilnehmerInnen (vgl. Jungk; Müllert 1989, 21). „Die Zukunftswerkstatt ist als ein Ort zu verstehen, an dem die eingeschliffenen Denk- und Verhaltensbahnen verlassen werden, wo jeder Teilnehmer seine Ansprüche ungezwungen aussprechen kann. Hier kommen Betroffene oder an einem Mißstand Interessierte zusammen, die gemeinsam ohne Vorbehalte zukunftsorientiert nach Lösungen suchen und damit beginnen, ihr Dasein endlich selbständig zu gestalten“ (ebd., 45). Die Übertragung auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen erfolgt durch altersgerechte Kreativ-, Visualisierungs- und Moderationsmethoden für die Gruppenarbeit sowie durch Spiele und Arbeitsformen, die anregen und Spaß machen und einem anderen Ablauf. Kritik- und Phantasiephase können auch in einem Ein- oder Zweitageseminar ablaufen, aber die Planungsphase wird in einem „Planungszirkel“ einer Arbeitsgruppe mit kontinuierlichen Treffen durchgeführt, dem die Umsetzungsphase folgt. Alle vier Phasen werden „Beteiligungsspirale“ genannt, weil über einen längeren Zeitraum auf verschiedenen Ebenen ein Problem bzw. Thema bearbeitet wird und die TeilnehmerInnen sich dem Thema spiralförmig nähern (vgl. Stange 1997). 116 5.2 ZUKUNFTSWERKSTÄTTEN UND BETEILIGUNGSPROJEKTE 5.2.1 Die Zukunftswerkstätten in Vahrenheide Erstmalig für Hannover wurde in Vahrenheide über einen Zeitraum von ca. zwei Jahren Beteiligung für die 4- bis18-Jährigen als Angebot für einen ganzen Stadtteil organisiert. Verwaltungsstellen und PolitikerInnen wurden in Fachgesprächen mit diesem Vorhaben vertraut gemacht und von der Notwendigkeit überzeugt, Gelder bereitzustellen. In der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendarbeit einigten sich die Fachleute auf ein Konzept. Bemerkenswert ist, dass verschiedene Träger und Bereiche trotz Konkurrenz einen Konsens erzielten. Die beteiligten MitarbeiterInnen vereinbarten Arbeitsanteile und den Einsatz von Finanzen und Arbeitsmaterialien aus den Budgets der einzelnen Einrichtungen. Die Kinder und Jugendlichen wurden in vier Zukunftswerkstätten nach ihrer Kritik und ihren Veränderungswünschen gefragt und sollten in anschließenden Planungsgruppen an Entwicklung und Umsetzung ihrer Vorschläge mitarbeiten. Die Auswahl der Kinder und Jugendlichen erfolgte nach Altersgruppen bzw. Schulzugehörigkeit. Die Aufteilung enthält zum Teil Überschneidungen, um die Zuordnung für die Kinder und Jugendlichen an den Altersgrenzen zu erleichtern. Folgende Zukunftswerkstätten, der Reihe nach geordnet, fanden statt: Tabelle 19: Übersicht der TeilnehmerInnen an den Zukunftswerkstätten 11- bis 14-Jährige Orientierungsstufe, Gesamt- oder Hauptschule Juli 1998 4- bis 7-Jährige Kindergartenalter bis zur Aug. 1998 Einschulung 6- bis 10-Jährige Hort- und Grundschulalter Mai 1999 14- bis 18-Jährige Haupt-/Realschule und Berufsorientierung oder Oberstufe Juli 1999 Regelmäßig dabei waren elf Einrichtungen der AG, nämlich die Kindertagesstätten, die Schulsozialarbeit, die Kirchengemeinden, die Jugendeinrichtungen und die sonstigen Freizeiteinrichtungen, die regelmäßig mit Gruppen und offenen Angeboten arbeiten. Einrichtungen, die überwiegend 117 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG in der Einzelfallhilfe tätig sind, beteiligten sich mit wenigen Ausnahmen nicht an der Durchführung der Zukunftswerkstätten. Es gelang nicht, die anderen Einrichtungen auch noch in die Mitarbeit einzubeziehen. Allerdings waren alle AG-TeilnehmerInnen über Protokolle über die Entwicklungen informiert und unterstützten die Maßnahmen ideell. Folgende Schritte unternahm die AG Kinder- und Jugendarbeit, um sich auf das Vorhaben „Zukunftswerkstätten und Beteiligungsprojekte“ zu einigen und es durchzusetzen: Tabelle 20: Zeit Arbeitsschritte Zukunftswerkstätten und Beteiligungsprojekte Aktivitäten: Funktionen Konzeption: Januar 97 Film und Vortrag über die Methoden Zukunftswerkstatt und Planungszirkel Information Mai 97 Entscheidung der AG für einen Antrag beim Hannover-2001-Programm (150.000 DM) zur Beteiligung Antragstellung Mai 97 Prioritätensetzung der AG für Zukunftswerkstätten und Beteiligungsprojekte gegen Ausbau des Spielparks Entscheidung Februar 98 Fortbildung zur Methode „Zukunftswerkstätten für Kinder und Jugendliche“ Fortbildung Umsetzung: März – Juni 98 Vorbereitung der 1. Zukunftswerkstatt (ZW) Juli 98 1. Zukunftswerkstatt mit 11- bis Moderation 14-Jährigen, um den Stadtteil zu verbessern. Ergebnis: Treffpunktuhr September – März 98 Planungsphase der 1. ZW und Vorstellung in Gremien 118 Planung Begleitung 5.2 ZUKUNFTSWERKSTÄTTEN UND BETEILIGUNGSPROJEKTE ab September 98 2. Zukunftswerkstatt mit 4- bis Moderation (Vorbereitung, Planungsphase) 7-Jährigen, um einen Spielplatz umzubauen. Ergebnis: Riesentunnelrutsche November 98 (V9) Zwischenbilanz ab März 99 3. Zukunftswerkstatt mit 6- bis Moderation (Vorbereitung, Planungsphase) 10-Jährigen, um Treffpunkte umzugestalten. Ergebnis: Seilbahn und Trampolin ab Juli 99 4. Zukunftswerkstatt mit 14- bis Moderation (Vorbereitung, Planungsphase) 18-Jährigen, um sich mit dem Leben in Vahrenheide auseinander zu setzen. Ergebnis: ca. 50 Kunstobjekte auf Backblechen zum Thema „Voll das Leben“ Auswertung: März-Juli 2000 Bericht Auf einem Spielplatz wurden die Riesentunnelrutsche (2. ZW) (4 Kurzberichte s.u.) und das Trampolin (3. ZW) gebaut Durch die Mitarbeit bei den Zukunftswerkstätten übernahmen die Fachkräfte, weniger die Institutionen, freiwillig ein hohes Maß an Verantwortung. Oft bedeutete das auch zusätzliche Arbeitszeit, denn nicht alle Stunden ließen sich in die reguläre Arbeitszeit integrieren. Die MitarbeiterInnen der vier Zukunftswerkstätten trafen sich zusätzlich in einer Runde, um die Planungen vorzunehmen und Erfahrungen auszuwerten. Die MitarbeiterInnen wünschten sich, dass Zukunftswerkstätten und Beteiligung einen Nutzen zeigen, den auch PolitikerInnen anerkennen. Allerdings ist es fraglich, ob sich eindeutige Zusammenhänge von Ursache und Wirkung ermitteln lassen. „Ich hab immer noch diese Sachen im Kopf, die früher in der Arbeit galten: ‚wenn die das selber machen, dann machen sie das auch nicht kaputt‘. Diese Geschichte. Das hab ich so im Kopf, das stimmt sicherlich auch, aber hier ist es 119 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG noch mal ein anderer Schritt, hier ist es wirklich so, sie machen es wie die Großen!“ (V9, 3). Die Qualität von Zukunftswerkstätten ist nicht allein an den umgesetzten Ergebnissen messbar. Es gibt auch Auswirkungen, die in Gruppenprozessen und persönlichen Entwicklung der Kinder stattfinden. Viele Erfahrungen dieser Art selbstverständlich auch mit sichtbaren Ergebnissen von gestalteter Umwelt brauchen Kinder, um ihre Lebenswelt als förderlich zu erleben und sich auf Diskussionen und Auseinandersetzungen mit Gleichaltrigen und auf die Welt der Erwachsenen einzulassen. „Das können kleine Sachen sein, große Sachen, daran zu planen und zu merken ... das ist im Prinzip ein Stück Demokratisierung, einfach Leute so in ihrem Selbstwertgefühl zu stärken, daß sie sich auch trauen, ihre Meinung zu sagen. Man muß das erstmal bei Kindern in geeigneter Form bringen und dafür ist so ne Zukunftswerkstatt, oder auch wenn man Projekte macht, wo man sie beteiligt, wo sie sehen, da passiert dann auch wirklich was, das ist ein gutes Lernfeld erstmal“ (V9, 4). Damit verbunden ist die Hoffnung, dass Kinder sich später als Erwachsene für ihr Umfeld verantwortlich fühlen. Daran herrscht derzeit in Vahrenheide ein großer Mangel. „Wenn sie älter werden, hoffe ich zumindest, werden sie sich trauen, ihre Meinung zu sagen und ein Interesse daran haben und nicht gleich sagen, ‚ach, ob ich was sage oder nicht, also da hört sowieso keiner drauf‘. Was ja auch so ’ne gängige Meinung ist. ‚Die machen ja sowieso was sie wollen‘, das sagen ja viele. Und ich denke, da muß man schon früh anfangen, daß das nicht so bleibt“ (V9, 4). In Vahrenheide wird an vielen Stellen für eine Ausweitung der Bewohnerbeteiligung gearbeitet, z.B. in der Wohnungsgenossenschaft, in Beschäftigungsprojekten, in der Grünflächenplanung, bei der Spielplatzerneuerung und in der Sanierung. Wenn sich die Fachleute aus der Sanierungsplanung und der Kinder- und Jugendhilfe zusammentäten, könnten interessante Entwicklungen angestoßen werden, bisher setzen viele dieser Projekte jedoch nur bei den Erwachsenen an. 5.2.2 Erfahrungen aus den ersten beiden Zukunftswerkstätten Die erste Zukunftswerkstatt arbeitete mit Kindern „von den Hecken und Zäunen“, wie es ein Mitarbeiter formulierte. Sie sollte für alle in der Altersgruppe zugänglich sein. Dazu musste im Vorfeld viel geworben werden. 120 5.2 ZUKUNFTSWERKSTÄTTEN UND BETEILIGUNGSPROJEKTE MitarbeiterInnen in den Kinder- und Jugendeinrichtungen taten dies durch Gespräch und Ermunterung. Das führte dazu, dass sich Kinder aus allen Teilen Vahrenheides beteiligten und eine Gruppenbildung erst noch erfolgen musste. Das Thema war offen gehalten, nicht eingegrenzt. Die Kinder entwickelten Ideen zunächst für ihre jeweilige Umgebung, für Bezugspunkte in der Nähe ihrer Wohnung, für ihnen bekannte Plätze und Einrichtungen. Ergebnisse bezogen sich z.B. auf den Marktplatz in der Nähe der Integrierten Gesamtschule mit dem Wunsch nach einer „Treffpunktuhr“. Dies war eine bunte Phantasieuhr im Stil Hundertwassers mit Ornamenten und eingebauten Bänken. Für die Hochhäuser im Osten des Stadtteils wurde ein Panoramasee und der Umbau einer Hochgarage zu einem Sportzentrum gewünscht. Die sonst übliche Teilung Vahrenheides in West und Ost wiederholte sich hier aus pragmatischen Gründen, nämlich der Nähe zwischen Wohnort und Planungsvorhaben. Das erschwerte in der Folge die Arbeit mit der Gesamtgruppe. Die Pläne für eine Treffpunktuhr erhielten bei einer Abstimmung die Mehrheit und wurden verfolgt. Das Einschätzen der Umsetzbarkeit der Vorschläge gefiel vielen Kindern nicht, weil sich ihre Ideen zum Teil nicht sofort durchsetzten. So sollte der Vorschlag zum Umbau der Hochgarage erst später in die Sanierung einfließen. Es kam nach den ersten Treffen in der Planungsgruppe zur Gruppenteilung. Die Kinder aus Vahrenheide-Ost waren langfristig nicht zu einer Mitarbeit an der Treffpunktuhr zu gewinnen. Die begleitende Einrichtung aus Vahrenheide-Ost zog sich aus der Planungsgruppe zurück. Prioritätensetzung durch Punktwertung kommt einer Abstimmung gleich, die als Niederlage gelten und demotivierend sein kann. Außerdem sind Vorschläge weniger motivierend, wenn sie sich nicht auf das unmittelbare Lebensumfeld beziehen, sondern auf den Stadtteil insgesamt. In Vahrenheide war es Absicht, dass an der ersten Zukunftswerkstatt möglichst viele MitarbeiterInnen teilnahmen, die als Multiplikatoren dann in den restlichen drei Werkstätten Strukturen und Konzepte sicherer umsetzen würden. In der zweiten Zukunftswerkstatt arbeiteten drei Kindertagesstätten an einer Spielplatzumgestaltung. Hier bewährten sich die vorherigen Erfahrungen: Das Thema war eingegrenzt, für das Alter der 4- bis 7-Jährigen angemessen und griff nicht in andere stadtteilpolitische Interessen ein. Die ErzieherInnen der Kitas hatten zu den Kindern bereits Kontakte. Es gab feste Ansprechpersonen für die bereits bestehenden Kindergruppen. Der Ablauf war gut vorbereitet und gut durchstrukturiert, was die Zusammenarbeit der MitarbeiterInnen aus drei Kitas erleichterte. Es hat allen, besonders den Kindern, sehr viel Spaß gemacht. Eine Riesentunnelrutsche in 121 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG Form einer Schlange war Ergebnis dieser Zukunftswerkstatt, an der 35 Kinder der drei Kindertagestätten arbeiteten. Bei einer Spielplatzbegehung einige Monate vorher wurde von zehn Spielplätzen ein unattraktiver Spielplatz ausgesucht und in Abstimmung mit PlanerInnen und PolitikerInnen als Thema vorgeschlagen. Mitten in die weitere Planung kamen ablehnende Reaktionen eines Ratsherrn auf die Ergebnisse der ersten Zukunftswerkstatt. Das Modell der Treffpunktuhr war in der Öffentlichkeit präsentiert worden und fand im Bürgerforum sowie im Bezirksrat Unterstützung. Einzelne AnwohnerInnen sprachen sich zwar auf einer Bezirksratssitzung gegen die Treffpunktuhr aus. Zur Umsetzung und Einbeziehung von AnwohnerInnen fanden vorbereitende Gespräche mit Fachleuten (KünstlerInnen, BahnhofsmitarbeiterInnen und StadtplanerInnen) statt. Mit ihnen wurden planerische und technische Probleme bei der Umsetzung erörtert. Der Ratsherr, Mitglied des Bauausschusses lehnte energisch die Treffpunktuhr ab. Er bemängelte die mit ca. 25.000 bis 40.000 Mark zu hohen Kosten und den geplanten Standort auf dem zentralen Marktplatz. Mit einem interfraktionellen Antrag der Sanierungskommission folgten SPD, CDU und Grüne der Kritik und schlugen eine nahezu 50% Kürzung der gesamten Mittel vor. Die Umgestaltung eines Spielplatzes, wie in der zweiten Zukunftswerkstatt vorgeschlagen, erschien vielen sinnvoller, vernünftiger und deshalb auch unterstützenswert. In Diskussionen über die Ablehnung der Treffpunktuhr wurden andere Überlegungen zur Umgestaltung des Marktplatzes bekannt. Der Platz solle privatisiert bzw. neu gestaltet werden, hieß es. Darüber hinaus benötigte die Vahrenheider Grundschule für ein Freilichtforum 325.000 Mark. Fachleute im Stadtteil sahen die Parteikontakte zwischen dem Schulleiter und dem einflussreichen Ratsmitglied als einen entscheidenden Grund für dieses Argument an, dem die anderen PolitikerInnen folgten. „... (so) soll der ursprünglich mit 150.000 DM von der Verwaltung vorgesehene Ansatz im Hannover-Programm 2001 für Zukunftswerkstätten für Kinder und Jugendliche auf 80.000 DM zu Gunsten einer Schule reduziert werden, da in der Schule bereits ein ganz wesentlicher Anteil konkreter Kinder- und Jugendarbeit erbracht wird. Da dem Ansatz für die Zukunftswerkstätten keine präzisen Kalkulationen zu Grunde liegen, sollten zunächst anhand konkreter Arbeitsergebnisse eine Kostenermittlung und anschließend eine öffentliche Diskussion mit abschließender politischer Bewertung erfolgen“ (P4, Sitzungsprotokoll der Sanierungskommission 1999). Die Bezirksräte äußerten zwar ihr Bedauern, sie sähen jedoch keine Möglichkeit, ihre Beschlüsse gegen das Votum von Ratsmitgliedern durchzu122 5.2 ZUKUNFTSWERKSTÄTTEN UND BETEILIGUNGSPROJEKTE setzen. VertreterInnen von Stadtverwaltung und Bauträger sowie der CDU kritisierten die Sonderwege quer zum Verfahren des Hannover-2001-Programms. Die MitarbeiterInnen in der AG Kinder- und Jugendarbeit und besonders die TeamerInnen der Zukunftswerkstätten waren darüber wütend und empört, sie schwankten zwischen Aufgabe und Fortführung ihrer Vorhaben (vgl. P5). Sie machten weiter, mit der Folge, dass für die 14- bis 18Jährigen Jugendlichen kein Geld mehr für die Umsetzung von Projekten zur Verfügung stand (vgl. P4). 5.2.3 Auswertung der vier Zukunftswerkstätten Die AG Kinder und Jugendarbeit organisierten einen Workshop zur Auswertung der vier Zukunftswerkstätten und kamen zu folgenden Ergebnissen (vgl. AG Kinder- und Jugendarbeit Vahrenheide 2001): Die 1. Zukunftswerkstatt war für die Altergruppe der 10- bis 14-Jährigen bestimmt und fand vom 10. bis 11. Juli 1998 im Jugendzentrum statt. Das Thema war Stadtteilentwicklung aus Sicht von 10- bis 14-Jährigen – ihre Kritik und ihre Wünsche. Ziele: Beteiligung von 10- bis 14-Jährigen an Planung und Entwicklung im Stadtteil. Kritische Auseinandersetzung mit dem Wohnumfeld und Entwicklung von positiven Gestaltungsmöglichkeiten Die Werbung erfolgte durch Handzettel und Plakate und auf einer Infoparty eine Woche vor der Zukunftswerkstatt. Darüber und durch persönliche Ansprache wurden acht Mädchen und zwölf Jungen aus ganz Vahrenheide erreicht. Die Angebote bestanden aus: (a) der Infoparty, (b) der zweitägigen Zukunftswerkstatt mit Verpflegung und abschließender öffentlicher Präsentation und (c) mehreren Treffen in einer Arbeitsgruppe Das Team bestand aus neun Leuten von sieben Einrichtungen sowie einem externen Berater und später zwei Personen für die AG-Arbeit. Die Ergebnisse aus Sicht der Kinder waren: (a) Kinder konnten ihre kritische Sicht zur Lebenslage in Vahrenheide äußern: problembelastete Familien durch Alkohol und beengte Wohnverhältnisse, wenig Umweltbewusstsein (Müll, Schmierereien, Zerstörung), alkoholisierte Männer (z.B. am Vahrenheider Markt), viel Gewalt; (b) gute Stellen zum Treffen und Spielen sind vor allem abhängig von den gewählten Treffpunkten mit FreundInnen, bessere Stellen sind bei den zwei Jugendeinrichtungen und dem Sportplatz; 123 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG (c) besonderer Bedarf wird gesehen bei Räumen für Mädchen, Räume für jüngere Jugendliche, niedrigschwellige Sportmöglichkeiten (z.B. Parkgarage zu Turnhalle umbauen), Grillmöglichkeit und angenehme Gestaltung eines Treffpunktes am See im Nachbarstadtteil (z.B. bunte Mülleimer), Treffpunkte sollten attraktiver gestaltet werden (z.B. mit einer Uhr auf dem Vahrenheider Markt, bunt und selbstgestaltet, zur Identifikation mit dem Stadtteil); Gewünscht werden angenehmere Gestaltung des Wohnumfeldes insgesamt (statt grauen Hochhäusern, Müll ...), mehr Spielmöglichkeiten schaffen und den schlechten Ruf verbessern; (d) Reihenfolge der Vorschläge: Turnhalle bauen, eigenen Stadtteil-PanoramaSee schaffen, Mädchentreff eröffnen, Treffpunktuhr am Marktplatz aufstellen ... Einschätzung der AG-TeilnehmerInnen: Es war viel Stress, aber hat auch viel Spaß gemacht. Es war eine gute Atmosphäre zwischen Kindern und Erwachsenen und auch im Team. Die Infoparty eine Woche vorher war unnötig. Weiterarbeit in verschiedenen AGs wäre nötig gewesen, um alle Themen zu verfolgen. Die Kinder aus Vahrenheide-Ost sind nicht mehr zu den AG-Treffen gekommen, weil deren Themen sich zunächst nicht realisieren ließen. Mitarbeiter konnten erstmalig theoretisches Wissen über Beteiligung praktisch anwenden. Für die Kinder ist der Planungsprozess zur Treffpunktuhr abgebrochen worden, für sie scheint nichts dabei rausgekommen zu sein. Einige haben sich sehr engagiert, aber dadurch eine Niederlage erlebt. Mädchen haben erfahren, wie ein Mädchentreff entstand und so die Erfahrung gemacht, ernst genommen zu werden, auch wenn das Projekt unabhängig von den Zukunftswerkstätten entstand und einen längeren Vorlauf hatte. Negativ war die Diffamierung der Treffpunktuhr als unsinnige Idee (durch Politiker) und letztlich die grundsätzliche Ablehnung. Positiv war, dass Kinder vehement ihre Anliegen auf dem Bürgerforum vertreten haben. Negativ war, dass der Bezirksrat danach einstimmig die Mittel von 150 000,– DM auf 80.000 DM gekürzt hat. Negativ war, dass die anderen Ergebnisse dieser Zukunftswerkstatt nicht weiter verfolgt wurden. Positiv waren die häufigen Planungstreffen mit den Kindern, die ein Stück Demokratie darstellten, weil sie den Planungsprozess bestimmten, Fachgespräche mit KünstlerInnen und PlanerInnen und PolitikerInnen führten, auch wenn das Ergebnis letztlich nicht umsetzbar war. Die 2. Zukunftswerkstatt war für die Altergruppe der 5- bis 7-Jährigen bestimmt und fand vom 22. bis 23. September 1998 auf einem Spielplatz und in dem Gemeindehaus der St. Franziskuskirche statt. Das Thema war Spielplatzgestaltung, der Zugang erfolgte über das spielerische Thema „Gespenster“. 124 5.2 ZUKUNFTSWERKSTÄTTEN UND BETEILIGUNGSPROJEKTE Ziele: Über die nähere Umgebung nachdenken, dazu Wünsche äußern, angehört und ernstgenommen werden, Mitbestimmung erleben durch das Sammeln von Ideen, durch Planen und Umgestaltung eines Spielplatzes. Die Werbung erfolgte durch persönliche Ansprache in den drei beteiligten Kitas. ca. 50-60 Kinder nahmen am Spielplatzfest teil und 35 (Mädchen/Jungen ca. 50/ 50%) beteiligten sich an der Zukunftswerkstatt. Die Angebote bestanden aus: (a) dem Spielplatzfest an einem Vormittag, (b) der 2-tägigen Zukunftswerkstatt mit Verpflegung und abschließender öffentlicher Präsentation und (c) mehreren Treffen in verschiedenen Arbeitsgruppen Das Team bestand aus: 8 Mitarbeiterinnen verschiedener Kitas und Horte. Als Berater und Helfer nahmen 7 MitarbeiterInnen verschiedener Einrichtungen teil: Die Ergebnisse aus Sicht der Kinder waren: (a) Negativ wird gesehen, auf dem Spielplatz ist vieles kaputt und wird nicht heile gemacht. Es ist schmutzig und es liegen Scherben und Blätter im Sand (b) Es fehlen neue Geräte, mehr Grün, Mülleimer und Geräte für ganz kleine Kinder. (c) Die Reihenfolge der Vorschläge war: Rutsche/Tunnelrutsche, Fußballfeld, Etwas mit Wasser und ein Spielhaus. Es hat sich darüber hinaus eine regelmäßige Zusammenarbeit der Kitas entwickelt. Bei guter Vorbereitung und Begleitung ist es möglich ein solches Thema auch mit 5- bis 7-Jährigen zu bearbeiten. Einschätzung der AG-TeilnehmerInnen: Es hat sich gelohnt, mit mehreren Kitas/Horten an einem Thema im Stadtteil zu arbeiten. Es ist wichtig, längere Zeit (zwei Tage) hintereinander am Thema zu bleiben und spielerisch und altersgerecht auf das Thema mit Buttons herstellen, Spielen, Fotografieren, Phantasiegeschichten, Erzählen, Malen und Modellbau einzugehen. Die Vielzahl der Mitarbeiter war notwendig. Aus den Kitas und Horten waren acht Mitarbeiterinnen dabei, die als Bezugspersonen und Sekretäre Gespräche führten und die Äußerungen der Kinder aufschrieben. Sieben externe Mitarbeiter unterstützen die Organisation (Versorgung mit Material, Essen, Trinken, Abwaschen ...). So konnten 35 Kinder in sieben Fünfer-Gruppen auch konkrete Ergebnisse erarbeiten. Die Kinder waren interessiert und konnten mit Spaß dabei sein. Von der Planung September 1998 bis zur Bauzeit Frühjahr 2000 ist ein zu langer Zeitraum für 5- bis 7-jährige Kinder. Außerdem besteht die große Gefahr, dass die Pläne und Ideen im letzten Moment doch noch von Verwaltungsstellen oder PolitikerInnen gekippt werden. Die Fußballtore sind fertig und die Rutsche wurde mit einem Fest auf dem Spielplatz eingeweiht. Manches, wie Spielhaus oder Wasserpumpe ließ sich nicht verwirklichen, obwohl es für Kinder sinnvoll ist. 125 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG Die 3. Zukunftswerkstatt war für die Altergruppe der 8- bis 10-Jährigen bestimmt und fand vom 29. bis 30. April 1999 statt. Das Thema war „Pirateninsel Vahrenheide“ – Kinder erkunden ihren Stadtteil. Ziele: Kinder grundsätzlich an der Stadtteilplanung beteiligen. Kinderwünsche einbeziehen und gegenüber Politik äußern. Gemeinsame Ziele für Veränderungen erarbeiten trotz unterschiedlicher Institutionen. Kinder sollen Verantwortung für umgesetzte Wünsche übernehmen. Kinder untersuchen bestimmte Ecken im Stadtteil und erarbeiten Vorschläge zur Verbesserung Die Werbung erfolgte durch persönliche Ansprache in den beteiligten zwei Kitas und der Schulklasse. 24 Kinder (13 Jungen und 11 Mädchen) nahmen teil. Die Angebote bestanden aus: (a) einer zweitägigen Zukunftswerkstatt mit Frühstück, Mittag und Zwischenimbiss sowie abschließender öffentlicher Präsentation. Das Team bestand aus: vier Mitarbeiterinnen aus Kita und Schule, als Berater und Helfer nahmen sechs weitere Fachkräfte aus anderen Einrichtungen teil. Die Ergebnisse aus Sicht der Kinder waren: (a) Die vorhandenen Spielplätze sind eher für kleine Kinder ein Thema (bis acht Jahren). Für Ältere sind bespielbare Flächen interessanter. Es gibt viele „tote Plätze“ und viel Dreck im Stadtteil. Es gibt einzelne, schöne Spielplätze. Doch die jüngeren Kinder spielen eher dort, wo sie wohnen. (b) Es fehlen altersgemäße Spielgeräte. Die Wiesen sollten belebt und verschönert werden. Die Spielgeräte sollten heil und funktionstüchtig sein. (c) Die Vorschläge in Reihenfolge: Seilbahn, Trampolin, Rutsche sollen realisiert werden. Einschätzung der AG-TeilnehmerInnen: Es war eine gute Atmosphäre unter den Kindern. Einige Kinder waren zeitweise etwas lustlos. Kinder und Erwachsene hatten viel Spaß zusammen. Für MitarbeiterInnen war es sehr anstrengend, es war viel Arbeit durch Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung. Es gab teilweise Stress durch Zeitdruck. Einige Kinder waren schwierig, aber die meisten waren ausgeglichen und motiviert dabei. Diese Zukunftswerkstatt brauchte viel Arbeitszeit, es war anstrengend und mühsam, sie zusätzlich zur Alltagsarbeit durchzuführen. Positiv war, dass alle MitarbeiterInnen schon Erfahrung aus einer anderen Zukunftswerkstatt hatten. Die Kinder konnten realistische Wünsche und Bedürfnisse entwickeln, äußern und vertreten. Nicht jeder Wunsch kann verwirklicht werden. Wünsche durchzusetzen ist mühsam. Die Umsetzung der Ergebnisse dauert für diese Altergruppe zu lang. Rückblickend war es für die Kinder zuviel Kopfarbeit und zuwenig spielerisch. Die Notwendigkeit von Zukunftswerkstätten für Demokratieentwicklung und deren 126 5.2 ZUKUNFTSWERKSTÄTTEN UND BETEILIGUNGSPROJEKTE Arbeitsaufwand ist noch nicht in den Köpfen von PolitikerInnen angekommen. Es gibt zu wenig Unterstützung von ihnen. Die 4. Zukunftswerkstatt war für die Altergruppe der 14- bis 18-Jährigen bestimmt und fand vom 16.7. bis 10.9.99, je einmal wöchentlich im Jugendzentrum Camp Vahrenheide und im AWO Jugendkontaktladen. Das Thema war: „Voll das Leben“. Ziele: Künstlerische Auseinandersetzung mit sich, den eigenen Gedanken, Gefühlen, Lebensumständen und dem Wohnumfeld Vahrenheides zu führen sowie eigenen Ideen mit Hilfe verschiedener Materialien Ausdruck zu verschaffen. Die Werbung erfolgte durch Pressemitteilung und Einladungskarten im Stadtteil insbesondere über die drei Jugendeinrichtungen. Ca. 40-50 Jugendliche (70% Jungen und 30% Mädchen) nahmen teil. Die Angebote bestanden aus: (a) Workshops mit Verköstigung und (b) wöchentlicher Arbeit in zwei Einrichtungen des Stadtteils (Vahrenheide West und Ost) sowie (c) einer öffentlichen Präsentation mit Gesprächen auf dem Marktplatz. Das Team bestand aus: vier MitarbeiterInnen dreier Jugendeinrichtungen sowie einem externen Berater und der Künstlerin. Die Ergebnisse aus Sicht der Jugendlichen: Interessante Kunstobjekte wurden auf Backblechen modelliert und auf dem Boden des Vahrenheider Marktes präsentiert. Die Jugendlichen brachten zum Ausdruck, dass ihre allgemeine Lebenssituation angenehmer und freundlicher werden soll und sie ernster genommen werden wollen. Sie wollen, dass Erwachsene ihnen zuhören und ihre Sichtweisen mitbekommen und verstehen. Nur wenige Erwachsene waren bereit sich mit den Jugendlichen auseinander zu setzen. Erwachsene äußerten Unverständnis und wehrten sich gegen die kritischen Äußerungen der Jugendlichen zum Stadtteil. Einschätzung der AG-TeilnehmerInnen: Die Atmosphäre unter den Jugendlichen entwickelte sich von anfänglicher Skepsis zu wahrer Begeisterung. Viele Jugendliche kamen erst später noch dazu. Die relativ offene Arbeitsform mit wöchentlichen Terminen im jeweiligen Wohnviertel und der künstlerische Zugang scheint eine günstige Voraussetzungen zu sein. Negativ war, dass das zugesagte Geld vom Bezirksrat (CDU, SPD, Grüne) für eine Umsetzung gestrichen wurde und für einen anderen Zweck (EXPO-Schule) verwendet wurde. Negativ war auch, dass eine Jugendeinrichtung mit der gleichen Altersgruppe eine Konkurrenzveranstaltung durchführte. Negativ war ebenso das Unverständnis der Erwachsenen gegenüber Kulturarbeit als Ausdrucksmittel der Jugendlichen. Über die Präsentation und die Gespräche wurde 127 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG deutlich, wie stark die Jugendlichen im Stadtteil als Blitzableiter für alle möglichen Vorurteile herhalten müssen. Positiv war, dass dennoch über eine künstlerische Auseinandersetzung das Lebensgefühl der Jugendlichen zum Ausdruck kam. Es ist zu überlegen, ob diese Zukunftswerkstatt in abgewandelter Form (mit künstlerischem Anteil und wöchentlichen Treffen) für Jugendliche besser geeignet ist, um sich zu beteiligen. Sodass die Ideen langsam entstehen können, ohne zu schnell in einen Wettbewerb zu geraten, wie das bei einer ergebnisorientierten Form eher der Fall ist. Bewährt hat sich das Anbieten von zwei Orten (dem jeweiligen Wohnquartier) und das Vorhalten von Materialen, weil so nach kurzen Anleitungsphasen immer eine eigenständige Arbeit mit eigener Zeiteinteilung möglich war. 5.2.4 Reflexion über die Kooperation der Fachleute Ein Nachteil dieser Zusammenarbeit ist, dass die besonderen Aktivitäten einzelner Einrichtungen nicht herausgestellt werden. Für die Öffentlichkeit, aber auch für den jeweiligen Arbeitgeber könnte das zu wenig transparent sein. Im Berufsalltag scheinen andere Prioritäten zu gelten. „Es gab einen Zeitungsartikel, den wir für die Sanierungszeitung gemacht haben, wo alle, wirklich alle beteiligten Einrichtungen namentlich genannt wurden. Wir haben den Artikel geschrieben, ... damit man mal sieht, wer alles dahintersteht. Die Veröffentlichung finde ich weniger wichtig, denn es ist wichtiger, daß die Zusammenarbeit so gut klappt“ (V9, 11-12). Es gibt sicher noch andere, weniger aufwändigere Methoden, um Kinder und Jugendliche zu beteiligen. Aber dann besteht, wie es eine Mitarbeiterin ausdrückt, die Gefahr der „Cliquenwirtschaft“. Das Besondere an diesem Vorhaben ist die gemeinsame Blickrichtung auf den Stadtteil und über die jeweilige Einrichtungen hinaus. „Wir haben einen Aufkleber, auf dem auch draufsteht: Kinder mischen mit – AG Kinder- und Jugendarbeit Vahrenheide. Also, es läuft nicht unter soziale Einrichtungen im Stadtteil, sondern als AG. Und mein Eindruck ist, ... da fühlen sich auch alle wie unter ‘nem Dach. Das ist so der Dachverband oder die Dachorganisation. Und alle können diese Form akzeptieren. Das ist nicht wichtig, ob ich jetzt mit ‘nem AWO-Bus Sachen transportiere oder die Caritas fährt und holt sie. Da wird auch nicht auf den Pfennig oder die Minute geguckt, bei Sprit oder Arbeitszeit“ (V9, 12). Weil das Thema wichtig war und durch die Vereinbarung, es gemeinsam anzugehen, wurden Trägerinteressen zeitweise zurückgestellt. So konnten Arbeitszeit und Materialien in gemeinsame Projekte einfließen. 128 5.2 ZUKUNFTSWERKSTÄTTEN UND BETEILIGUNGSPROJEKTE „Da weiß ich auch, ich kann Leute belasten. Ich kann sagen, kannst Du das für mich holen. Und ich weiß auch, daß der andere, das macht und dafür beim nächsten Mal sagt, ... kannst Du etwas erledigen. Für meinen institutionellen Arbeitsbereich, da ist das nicht selbstverständlich. Deshalb ist das ja auch so, daß ich diese Arbeitsweise genieße und sogar freie Zeit da mit reingebe“ (V9, 12). In einigen Einrichtungen wurde der grundsätzliche Gedanke, der Beteiligung an Projekten über die jeweilige Einrichtung hinaus, nicht verstanden. Die MitarbeiterInnen dort sahen zunächst auf die Verbesserung der eigenen Einrichtung und bereiteten die Kinder entsprechend vor. „Da war eine Einrichtung, die ganz klar sagte, wir wollen unsere Ziele darüber auch durchsetzen, es gibt Geld, wir haben Kinder. Ich will das nicht böse sagen, aber die man dann (beeinflußte) ... bei uns hier ist es doch schön, wenn wir das und das noch hätten, dann wäre es doch noch schöner. Etwas subtil und Kinder springen da drauf an und lieben ihre Erwachsenen meistens. Die springen darauf an und die wollen das auch so. Das ist nicht Sinn unseres Konzepts. Sinn dieser Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist, herauszufinden, was sie im Stadtteil wollen unabhängig vom Träger“ (V9, 13). Auch nach der zweiten Zukunftswerkstatt wurden die Erfahrungen ausgetauscht, um das Vorgehen und die Zusammenarbeit im Team zu reflektieren. Die Arbeit in einem Team der AG-TeilnehmerInnen schützt zwar davor, einseitig einzelne Einrichtungen zu begünstigen. Dennoch sollten regelmäßige Reflexionen das Vorgehen und die Methoden kontrollieren, den Beteiligungsprozess selbstkritisch verfolgen und dadurch der Teamarbeit eine Transparenz geben und Veränderbarkeit ermöglichen. Mit der Beantragung der Gelder haben die AG und ihre KoordinatorInnen der Zukunftswerkstätten auch der Öffentlichkeit gegenüber Verantwortung übernommen. „Also ich finde auch, es sind Verpflichtungen zu verschiedenen Seiten, einmal natürlich den Kindern gegenüber, daß man das auch weiter begleitet und zum andern aber auch gegenüber Geldgebern, Bezirksrat, Politiker, die Öffentlichkeit im Stadtteil. Da ist man in der Verantwortung, da muß jetzt auch was bei rumkommen. Das zum einen und das setzt natürlich einen gewissen Druck sag’ ich mal. Ich fühle mich auch im hohen Grade verantwortlich“ (V9, 8). Zu Beginn ist die Arbeit noch lustbetont und macht viel Spaß. Alle gehen dabei eine Selbstverpflichtung für eine Menge Arbeit ein. Ein vorzeitiges Ende würde den fachlichen Ruf stark beeinträchtigen. Man würde als unzuverlässig gelten. 129 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG „Da macht man sich natürlich auch lächerlich und da steht man dann ja auch in der Verantwortung und wir haben ja auch diese Anträge gestellt und sind damit nach außen gegangen über die Presse. Und da denk ich, da haben wir ganz klar jetzt auch ’ne Verpflichtung“ (V9, 8). Manchmal hilft es, sich zu beruhigen und die eigenen Anforderungen nicht zu hoch zu stecken. Dennoch bleibt das Risiko der Freiwilligkeit. Das heißt immer wieder, sich überraschen zu lassen, ob das Eigeninteresse der Kinder und Jugendlichen trägt, ein Projekt auch durchzuhalten. „Das haben wir im Vorfeld auch gesagt, daß es bei den Kindern freiwillig und offen ist und daß wir nie im Vorfeld wissen, wieviele kommen. Das ist wie bei Erwachsenen im Stadtteil. Du weißt nicht, kommen da zehn oder kommen da zwei oder eine. Das ist natürlich besser, wenn Du Kontaktpersonen hast, wie z.B. die Erzieherinnen über die Kita. Dann läuft das natürlich, ganz klar ... Dann kommen zehn Kinder mit und fertig“. (V9, 8). Die Reflexionen der AG-TeilnehmerInnen zeigten, dass weniger grundsätzliche Diskussionen über Demokratieverständnis, politisches Mandat, etc. die Inhalte bestimmten, als vielmehr die pragmatischen und methodischen Fragen: Welche Themen lassen sich in welchen Zeiträumen bearbeiten? Was ist mit den angesprochenen Kindern und Jugendlichen umsetzbar? Welche Beteiligungsform ist für welches Alter sinnvoll? Welche Interessengruppen sind schon im Vorfeld erkennbar und welche Einflussgrößen sind zu berücksichtigen? Welche Orte werden von Politik und Verwaltung zur Gestaltung akzeptiert? Wie erreicht man freie Zeitkapazitäten für diese Sonderaufgaben vom Team und Träger der Einrichtung? Wie kann die Fachlichkeit der MitarbeiterInnen durch Fort- und Weiterbildung gestärkt werden? Wie kann die Finanzierung (nicht nur für die Projekte, auch für Zukunftswerkstätten) abgesichert werden? Wann holt man Beratung von Externen ein? Wie lassen sich gescheiterte Projekte gegenüber Kindern und Jugendlichen, KollegInnen, Verwaltung und PolitikerInnen vertreten? 5.2.5 Zustimmung von PolitikerInnen und Leitungskräften im Jugendamt Die Beteiligungsmodelle in Vahrenheide fanden überwiegend Unterstützung in Politik und Verwaltung. Die Mehrheit, vor allem die politischen Mehrheitsfraktionen (SPD und B90/Die Grünen), will die Niedersächsische Gemeindeordnung großzügig auslegen und unterstützt eine weitreichende Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, wenn sie methodisch versiert umgesetzt wird. Eine Politikerin äußert sich: 130 5.2 ZUKUNFTSWERKSTÄTTEN UND BETEILIGUNGSPROJEKTE „... grundsätzlich ist es überall sinnvoll, Kinder und Jugendliche zu beteiligen ... in der Form, in der sie auch beteiligt werden können und das was sie auch betrifft. ... ich finde das auf jeden Fall sinnvoll, für die Kinder, die sich daran beteiligen, die werden eine Menge gelernt haben. Die werden eine Menge an Demokratieverständnis entwickelt haben. Und ich denke, das ist auch eine Herausforderung für alle Beteiligten, mit den Kindern dort etwas durchzuführen, solche Projekte durchzuführen“ (E6, 3). Es werden von PolitikerInnen und Leitungskräften viele Argumente vorgebracht, die eine Nützlichkeit erklären. Kinder könnten über Mitsprache und Mitbestimmung eine „eigenständige Persönlichkeit aufbauen und auch politische Strukturen kennen lernen“ (E7, 12). Es wurde ein lebensweltlicher Ansatz empfohlen, damit die Vorhaben auch an die „Lebenswirklichkeit der Kinder“ (E3, 4) anschließen und nicht aufgesetzt sind, etwa weil es zur Zeit einen Trend gibt, Zukunftswerkstätten abzuhalten. Unterstützenswert sind Beteiligungsprojekte besonders, weil sie die Identität und das Demokratieverständnis von Kindern und Jugendlichen fördern. Wenn Kinder und Jugendliche sich mit ihren Projekten auch identifizieren, werden sie Einrichtungen, Räume, Grünflächen und Spielgeräte pfleglicher behandeln, so lautet ein Wunsch. „... ich denke, daß Beteiligungsprojekte immer unter dem Aspekt, ... daß es innerhalb des Stadtteils auch ’ne Menge ... Zerstörung gibt und Aggression. Und ich mir schon vorstellen kann, ... wenn Kinder und Jugendliche ... selbst daran beteiligt waren, ... daß dann einfach ’ne etwas andere Identität damit besteht“ (E4a, 4). Leitungskräften im Jugendamt und PolitikerInnen erwarten, dass Beteiligung sich nicht nur auf ausgewählte, bildungsinteressierte Kinder und Jugendliche beschränkt. Auf jeden Fall sollten die Fachkräfte im Stadtteil die Enttäuschungen begleiten, die immer entstehen, wenn Wünsche und Ideen auf Grenzen stoßen. Wichtig ist jedoch schon vorher zu überlegen, woher das Geld für die Umsetzung kommt. „Ich denke mir schon, daß das ein sinnvoller Ansatz sein kann. Bloß wenn man nicht nur einen bestimmten Kreis anspricht, sondern wenn man versucht eine breite Basis zu schaffen und die auch wirklich begeistern und motivieren kann, da mitzuarbeiten und die konkrete Vorschläge machen zu lassen und denen auch signalisiert, da wird denn auch was draus, in einem bestimmten Zeitrahmen, dann glaube ich schon, daß das ganz nützlich ist. ... diese Beteiligungsgeschichten kranken oft daran, daß man zwar schöne Vorschläge macht, aber am Ende nicht weiß, wo man das Geld herkriegen soll. Und ich finde das ganz gut, daß man einen Mindestfonds hat, so haben wir das genannt, der auf jeden Fall zur Verfügung gestellt wird“ (E1, 4). 131 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG Die Zusammenarbeit verschiedener Institutionen wurde positiv eingeschätzt. Als besonders vorteilhaft galt, dass „die Fachkräfte, die Experten des Stadtteils sich für die Zielgruppe und um die Zielgruppe gemeinsam engagieren, ohne in Konkurrenz zueinander zu treten, so sieht es erst einmal aus“ (E 3, 4). Allerdings wurde die Befürchtung geäußert, „daß man zwar schöne Vorschläge macht, aber am Ende nicht weiß, wo man das Geld herkriegen soll“ (E1, 4). In anderen Ämtern der Stadtverwaltung waren eher skeptische bis ablehnende Haltungen zur Beteiligung verbreitet. Dort wurden durch Gleichgültigkeit, Nachlässigkeit oder aktive Behinderung entsprechende Vorhaben gebremst. Verwaltung versteht sich nicht nur als ausführendes Organ politischer Beschlüsse, sondern übernimmt selbst Planungs- und Gestaltungsaufgaben in der Kommunalpolitik. Nicht nur PolitikerInnen müssen von Beteiligungsvorhaben überzeugt werden, sondern auch MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung. Ein Mitarbeiter der Verwaltung dazu: „... es gibt Teile in der Verwaltung, die wollen das nicht, wirklich ernsthaft, weil es ihnen zu lästig ist, zu anstrengend und überhaupt ... Ich glaube, daß das so ist. Das würden die Leute natürlich so nicht zugeben, das würde kein Mensch zugeben, aber ich glaube, daß man mit diesen Haltungen rechnen muß, ... aber es ist im Grunde genommen neben diesem materiellen der zweite Punkt, es müßte in den Köpfen aufgebrochen werden, daß die Leute auch mal was zulassen, umzusetzen im Sinne einer Dienstleistung, eines Services, daß es nicht unbedingt hundertprozentig ihren eigenen Vorstellungen entspricht. Denn die Planer haben Gestaltungsvorstellungen“ (E1, 5-6). Nur von einzelnen wurde erkannt, dass es eine neue Herausforderung für alle Beteiligten bedeutet, all den Anforderungen zu genügen und dass viel Arbeit damit verbunden ist, nicht nur zu planen, sondern die Ergebnisse auch umzusetzen. „Dann muß man auch sehen, daß es mit sehr viel Aufwand zu tun hat ... Sagen wir mal, von oben wird es sowieso keiner machen. Also wenn, dann muß es von unten kommen, von unten wachsen“ (E1, 5). 5.2.6 Kritische Anfragen von PolitikerInnen Allerdings gibt es Bedenken im Hinblick auf und Anregungen für die Umsetzung. Die Gedankenwelt der Kinder ist anders, sie kann von Erwachsenen leicht verfälscht werden. Vielfach fehlen Vorstellungen, wie altersgerechte Beteiligung aussehen und was man machen kann. Methodische Kenntnisse sind nötig. 132 5.2 ZUKUNFTSWERKSTÄTTEN UND BETEILIGUNGSPROJEKTE „Soviel wie möglich sollten Kinder selber zu Wort kommen und sollten selber sagen können, was sie brauchen. Auf der einen Seite finde ich es natürlich gut, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da, wo Kinder und Jugendliche sich nicht selber zu Wort melden können, diese Funktion übernehmen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, daß sie auch ihre eigenen beruflichen Interessen gleich mit vertreten. Das macht es immer zweischneidig. Ist es nun für die Kinder und Jugendlichen oder ist es das Interesse am eigenen Arbeitsplatz, an der Ausgestaltung des eigenen Bereichs“ (E7, 6-7). Eine Politikerin vermutete, dass Fachkräfte der Sozialen Arbeit immer auch Interessen am eigenen Arbeitsplatz und der Ausgestaltung des eigenen Bereichs im Blick haben. Diese Gefahr sahen andere PolitikerInnen und Leitungskräfte der Verwaltung auch. Doch selbst wer mit methodisch transparenten Verfahren zu Ergebnissen gelangt ist, wie es in Vahrenheide der Fall war, muss seine Ergebnisse anzweifeln lassen. PolitikerInnen behalten sich bis zuletzt die Entscheidung über Finanzen vor. Die Vermutung der Beeinflussung durch PädagogInnen und SozialarbeiterInnen kann leicht als Legitimation benutzt werden, um sich gegen Wünsche der Kinder und Jugendlichen zu entscheiden. Andererseits stellt das Trägerinteresse in der Tat ein Einflussfaktor dar. „... und was ist, wenn die Jugendlichen sagen, ‚Euer Treff ist absolut scheiße, den könnt ihr Euch an die Backe nageln.‘ Was macht dann der Träger, der diesen Treff da vorhält? Gibt er dann diesen Treff auf und sagt, wir stellen das zur Disposition und entwickeln was ganz anderes? ... Oder lenkt man es. Man kann ja auch durch Fragen sehr gut lenken, oder lenkt man es von vornherein durch Fragen so, daß solche Antworten von Jugendlichen gar nicht kommen. Und deswegen würde ich schon dafür plädieren, wenn das Geld da ist, sollte man wirklich gucken, daß man Leute von außen reinholt, die nicht aus dem Stadtteil und nicht eben mit diesen möglicherweise anderen Interessen behaftet das Ganze begleiten“ (E7, 13). Viele PolitikerInnen bezweifeln grundsätzlich, dass Kinder über Stadtplanung und Finanzen entscheiden können. „Da bin ich skeptisch, wieviel Verantwortung können Kinder und Jugendliche übernehmen, können sie Stadtplanung machen, können sie verantwortlich über Gelder entscheiden? Sicher können sie Vorschläge machen, aber der Bezirksrat bzw. Stadtrat trägt die Verantwortung“ (E2, 2). 133 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG 5.2.7 Zusammenfassung der Ergebnisse zur Beteiligung Die vier Zukunftswerkstätten für die Altersgruppen der 3-18-Jährigen bilden eine Bestandsaufnahme der Wünsche und Ideen zur Veränderung des Stadtteils Vahrenheide aus Sicht der Kinder und Jugendlichen. Die Zustimmung der Politik und die Bereitstellung von Finanzmitteln (für Zukunftswerkstätten und Umsetzung der Planungsideen) waren wesentliche Voraussetzungen für den Beginn des Vorhabens. Die TeilnehmerInnen der AG Kinder- und Jugendarbeit haben sich damit einem Paradigmawechsel im Selbstverständnis ihrer Arbeit ausgesetzt. Waren die Fachleute bisher eher anwaltlich für Kinder und Jugendliche tätig, bekommt die Wahrnehmung von Entscheidungs- und Gestaltungsspielräumen der Betroffenen grundsätzlich mehr Bedeutung und wird zum Maßstab in vielen Bereichen der alltäglichen Arbeit. Das Vorgehen steht im Einklang mit dem Kinder- und Jugendhilfegesetz, bei dem die Beteiligung und Einbeziehung von Kindern- und Jugendlichen einen hohen Stellenwert erhält, um dadurch u.a. Selbstbewusstsein, Sozialverhalten, Demokratieverständnis, Identifikation und Verantwortlichkeit für das Wohnumfeld zu fördern. Kinder und Jugendliche sollen frühzeitig lernen, sich von ihrem Lebensalltag ausgehend mit der Gesellschaft auseinander zu setzen. Die Fachleute der Sozialen Arbeit benötigen ein Methodenrepertoire, um kreative und fantasievolle Impulse zur Veränderung und Gestaltung verschiedener Altergruppen aufzugreifen und in kommunalpolitische Planungsprozesse einzubringen. Die stadtteilbezogenen Beteiligungsprojekte in Vahrenheide sind auch vor dem Hintergrund von Bestrebungen der Politik zu sehen, kommunalpolitische Beteiligungsformen zu erweitern. Hierbei können die Fachleute der Sozialen Arbeit für Kommunalpolitik zu wichtigen Kooperationspartnern werden. In Hannover gibt es eine lange Tradition der Bürgerbeteiligung. In der Sanierung und Wohnumfelderneuerung von Stadtteilen werden seit den 80er Jahren verschiedene Formen der Beteiligung umgesetzt. Dies war in der Vergangenheit überwiegend den erwachsenen vorbehalten. In den 90er Jahren und später folgten stadtweite Programme zur Beteiligung, auch für Kinder und Jugendlichen, so z.B. u.a. ein Hannoverprogramm 2001-2005 mit Plänen zur „Demokratischen Teilhabe“ für die Zeit nach der EXPO 2000 und ein Programm zum Umbau von Plätzen „Hannover schafft Platz“. Diese Programme haben einerseits repräsentative und legitimatorische Funktionen und dienen anderseits der Stadtentwicklung. Beteiligung rich134 5.2 ZUKUNFTSWERKSTÄTTEN UND BETEILIGUNGSPROJEKTE tet sich hier zunächst an die BürgerInnen der gesamten Stadt und erfährt erst im nächsten Schritt eine Umsetzung auf kleinräumigen Ebenen und mit Bezug auf diverse Zielgruppen. Die hier untersuchte Beteiligung in Vahrenheide unterscheidet sich davon wesentlich in zwei Punkten. Einerseits knüpfen die Beteiligungsprojekte deutlicher am Lebensalltag und den Lebensbedingungen der Betroffenen an, andererseits erhalten die wenig repräsentativen Projekte auch nur eine geringe Unterstützung in der Öffentlichkeit und Politik. Vor diesem Hintergrund sind die folgenden Teilergebnisse dieser Untersuchung zu verstehen. (1) Durch den Blick über Institutionsgrenzen und enge Teamzugehörigkeit hinaus wurden die Kooperationsfähigkeit der Fachleute herausgefordert und die Arbeitsweisen erweitert. Die TeilnehmerInnen haben durch das gemeinsame Vorhaben der AG eine starke Verbundenheit entwickelt, wodurch ein Engagement entstand, das eine Umsetzung trotz Hindernisse ermöglichte. Die Beteiligung der MitarbeiterInnen in einer selbstorganisierten AG hat insofern auch einen Nutzen für die Bevölkerung. Die MitarbeiterInnen erproben Beteiligungsformen in der eigenen Kooperation und können diese auf die Stadtteilentwicklung mit den Betroffenen übertragen. Die Methodenkenntnisse und die Reflexion der Erfahrungen erleichtern zudem eine Umsetzung in den jeweiligen Einrichtungen. Leider waren lediglich die MitarbeiterInnen der offenen Kinder- und Jugendarbeit aktiv mit einbezogen, während sich andere Bereiche der Kinderund Jugendhilfe zurückhielten. Bedauerlich ist auch, dass die institutionelle Verankerung von Beteiligung bisher nicht gelungen ist. (2) Die TeilnehmerInnen konnten durch ein derart umfassendes Vorhaben ihre Rolle von einer anwaltlichen Vertretung verändern zu OrganisatorInnen einer Aktivierung der Betroffenen. Dadurch erhielten die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit sich mit ihrem Umfeld, ihrem Stadtteil und den kommunalpolitischen Realitäten auseinander zu setzen sowie eigene Positionen zu entwickeln und öffentlich zu vertreten. (3) Die Umsetzbarkeit der Ergebnisse gelangte an Grenzen von Politik, wenn Veränderungswünsche über den engen Bereich typischer Kinder- und Jugendarbeit hinausreichten, also in die Stadtteilplanung eingriffen oder andererseits wenn die Finanzen von konkurrierenden Trägern streitig gemacht wurden. Es passierte auch, dass sich nicht alle Einrichtungen in ein solches Vernetzungsprojekt integrierten. Selbst wenn sich Einzelne zunächst zurückhielten, scherten sie später aus, um mit eigenen Aktionen in 135 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG die Öffentlichkeit zu gelangen. Damit war das gemeinsame Projekt tendenziell in Frage gestellt und es wurde die Tragfähigkeit der Vernetzung mit Politik und Verwaltung ernsthaft geprüft. Die Arbeitsgemeinschaft hat sich besonders bei den Zukunftswerkstätten gut untereinander vernetzt. Die Verbindungen zur Politik waren jedoch nicht sehr ausgeprägt, sodass einzelne PolitikerInnen sich wenig einbezogen und daher nicht an Absprachen gebunden fühlten. Die Koordination der Ergebnisse mit dem politischen Raum, in den Entscheidungsebenen, wies Schwierigkeiten auf. Offizielle Äußerungen zu BürgerInnenbeteiligung von Politik und Verwaltung haben häufig symbolischen Charakter und stehen im Widerspruch zur Finanzverteilung. Es wird bekundet, dass kleine Beteiligungsprojekte im Wohnumfeld und im Lebensalltag immens wichtig seien für Demokratieentwicklung und dass Aushandlungsprozesse mit Konsensfindung als wesentliche Voraussetzung kommunalpolitischer Förderung angesehen werden. Häufiger setzen sich jedoch partielle Interessen durch und eben nicht die gemeinsam entwickelten und ausgehandelten Ergebnisse. Dies mussten die AG-TeilnehmerInnen bei zwei der geplanten Projekte erleben, denen die Finanzen trotz Zusagen und umfangreiche Beteiligungsverfahren kurzfristig gestrichen wurden. Für BürgerInnen und besonders für Kinder und Jugendliche ist nicht sicher, ob sie sich auf Zusagen von PolitikerInnen verlassen können. Die Ergebnisse des Forschungsprojektes zeigen, dass konkurrierende Interessen nicht immer öffentlich ausgehandelt werden, sondern sich über individuelle Kontakte zur Politik durchsetzen können. Wenn aber Zusagen nicht eingehalten werden, ist es für MitarbeiterInnen an der Basis schwer, glaubwürdig zu bleiben, wollen sie Beteiligungsprojekte initiieren. Verständlich ist, dass in Beteiligungsprozessen die Wünsche von Kindern und Jugendlichen in einem öffentlichen Diskurs abgewogen werden und Ablehnung erfahren können. Allerdings ziehen PolitikerInnen Entscheidungen wieder an sich, wenn Interessenskonflikte für sie unüberschaubar werden. Dann berufen sich PolitikerInnen auf ihren Entscheidungsvorbehalt, den sie in Verantwortung gegenüber der jeweiligen Gemeindeordnung des Landes, aber auch gegenüber den SteuerzahlerInnen bzw. WählerInnen haben. Stadtweite Programme mit Elementen der Bürgerbeteiligung können zwar Impulse für die Kommunalpolitik bieten. Auch kann eine Stadtentwicklung vielfältige Formen der Beteiligung anregen und damit Demokratisierung fördern. Aktive Mitarbeit der Betroffenen an Planung und Umsetzung von Projekten aber, bietet darüber hinaus die Chance, dass Demokratie für Ein136 5.2 ZUKUNFTSWERKSTÄTTEN UND BETEILIGUNGSPROJEKTE zelne erlebbar wird. Um diese unmittelbare Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Kommunalpolitik zu organisieren, sind Fachleute und in den meisten Fällen auch Institutionen notwendig. Förderlich ist, wenn sich bereits verlässliche Kooperationsformen der Fachleute herausgebildet haben, auf die dabei zurückgegriffen werden kann. Vorerfahrungen mit Stadtteilentwicklung und Projektplanung sowie der Kommunalpolitik und Verwaltung erleichtern es, Kinder und Jugendliche bei ihren Plänen zu begleiten, vorhaben realistisch einzuschätzen, Hindernisse auszuräumen und Ergebnisse auch umzusetzen. Die AG Kinder- und Jugendarbeit und vergleichbare Runden bieten den Kindern und Jugendlichen den Rahmen dafür, solche Erfahrungen zu machen. Allerdings haben die MitarbeiterInnen in der jeweiligen Organisation einen offiziellem Auftrag und mit zugewiesenen Funktionen, woraus spezifische Eigeninteressen des Anstellungsträgers oder seiner MitarbeiterInnen resultieren. Ohne Rechenschaft über den Prozess und die Entstehung der Ergebnisse ist die Gefahr groß, dass die Wünsche der Einrichtungen auch zu Wünschen der Kinder werden. Hilfreich ist eine Moderation von außen oder ein Team, bestehend aus VertreterInnen mehrerer Einrichtungen, die sich im Verfahren gegenseitig überprüfen. Die AG wählte zwei Verfahren aus, um Zukunftswerkstätten durchzuführen. Sie zog externe Moderatoren hinzu und führte die Zukunftswerkstätten einrichtungsübergreifend und zu stadtteilbezogenen Themen durch. Wie die Ergebnisse dieser Prozessforschung zeigen, kann die AG Kinderund Jugendarbeit am Beispiel der Beteiligungsprojekte als Initiatorin und Gestalterin von neuen Entwicklungen in der Kinder- und Jugendhilfe betrachtet werden. Darin kommen vielfältige Aufgaben zum Vorschein, die zunächst keine andere Instanz übernimmt. Eine gelingende Selbstorganisation und Vernetzung ist Voraussetzung für gelingende Beteiligungsprojekte und darüber hinaus für stadtteilbezogene Soziale Arbeit. Typische Voraussetzungen und Bedingungen dieser Selbstorganisation, die als Standard für Soziale Arbeit gilt, sollen in den nächsten Kapiteln herausgearbeitet werden. Dafür werden die Selbstsicht und Fremdsicht einer solchen Vernetzungsrunde im kommunalpolitischen Raum erhoben, damit soll das Kräftefeld von Kommunalpolitik und die Auswirkungen auf Soziale Arbeit beispielhaft offengelegt und übertragbare Folgerungen für die Profession abgeleitet werden. 137 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG 5.3 SELBSTSICHT AUF DIE KOOPERATION DER AG KINDER- UND JUGENDARBEIT In 21 ca. einstündigen Leitfaden-Interviews, aufgenommen in den Arbeitsstätten, verbunden mit einer Besichtigung der Räumlichkeiten, hatten alle AG-TeilnehmerInnen die Möglichkeit, sich zu ihrem Tätigkeitsfeld, zu Aufgaben und Auftrag zu äußern. Gefragt wurde nach der räumlichen Zuständigkeit und dem Stadtteilbezug der Arbeit. Die verschiedenen Formen der Zusammenarbeit, die Anlässe und Inhalte wurden angesprochen. Darüber hinaus sollten der Stadtteil und seine Bewohner problematisiert, aber auch die Stärken und Chancen des Stadtteils eingeschätzt werden. Ergänzt wurde der Leitfaden-Interview durch einen Fragebogen über Alter, Berufsausbildung, Dauer der Berufstätigkeit und Aufnahme der Arbeit im Stadtteil. Die Zusammenfassung der Ergebnisse bot der AG die einmalige Gelegenheit, einen Überblick über alle Arbeitsbereiche der Kinder- und Jugendarbeit zu bekommen, verbunden mit der Einschätzung oder Bewertung von Kooperationen. Die Ergebnisse wurden in AG-Sitzungen vorgestellt und von den TeilnehmerInnen kommentiert. 5.3.1 Ziele der Kooperation Auch wenn sich die AG-TeilnehmerInnen verschiedenen Arbeitsgebieten zuordnen und sie in unterschiedlicher Intensität miteinander kooperieren, ergeben sich Ziele, die von nahezu allen Unterstützung finden: • Informationen verteilen und austauschen • Angebote abstimmen und soziale Infrastruktur verbessern • Neue Projekte planen und umsetzen • Reflexion der Arbeit in einer stadtteilbezogenen Fachrunde • Lobbyarbeit mit Blick auf den Stadtteil betreiben (vgl. V5, 11-12). Interessant an den Angaben ist, dass die projektbezogene Zusammenarbeit auch in den Beobachtungen der Sitzungen einen großen Raum einnimmt. Lobbyarbeit jedoch war in den Sitzungen nicht zu beobachten. Hier wird vermutet, dass diese Arbeit viele zusätzliche Einzelgespräche erfordert, um Konsens über Aktionsweisen abzusprechen. 138 5.3 SELBSTSICHT AUF DIE KOOPERATION DER AG KINDER- UND JUGENDARBEIT 5.3.2 Wirkung der Kooperation Fast alle Befragten können ein bis zwei Themen benennen, die als erfolgreiche Arbeit in Erinnerung bleiben und die auch nach außen wirken. Die Neuen äußern sich eher vorsichtig. Aber auch den Gründungsmitgliedern fielen auf Anhieb nur jeweils ein bis zwei Punkte ein. Dennoch lassen sich zentrale Aspekte über die Außenwirkung herausarbeiten. Folgende Punkte wurden angesprochen: (1) Entstehung von Projekten fördern und begleiten Die AG TeilnehmerInnen konnten jeweils ein bis zwei Punkte benennen (vgl. F1-21): • Sommerfeste am Vahrenheider Markt • Informationsveranstaltungen • Diskussionen um AWO-Hort in der Grundschule „Wir sind aus der Kita Dunantstraße erwachsen. Die haben vorher altersgemischte Gruppen gehabt und im Zuge des Rechtsanspruchs mußten alle Hortkinder raus aus der Dunantstraße. Das sind jetzt wir. Da hat es ganz viel Ärger drum gegeben. Weil man die altersgemischten Gruppen behalten wollte, weil man es sinnvoll fand, daß auch Hortkinder mit Kindergartenkindern zusammen kommen. Und es war ein langer Prozeß, der sich da abspielte. Und der ist ganz wesentlich von der AG Kinder und Jugendliche begleitet worden ... Das hat zwar nicht nach außen gewirkt, aber es war auch für die Beteiligten einfach eine große Unterstützung, ihre Probleme und Sorgen diskutieren zu können“ (F14, 11). • Pädagogische Reaktion auf Gewalt im Stadtteil • Streetwork-Projekt „... anzumerken ist, daß aus der AG heraus sozusagen dieser Jugendtreff entstanden ist“ (F2, 6). • Zukunftswerkstätten mit Beteiligungsprojekten über das Hannover2001-(Förder)-Programm • Vahrenheider Wohnungsgenossenschaft „... das Mädchenprojekt, das ist auch in der Kinder und Jugend AG entstanden. Daß wir uns zusammengesetzt haben, die Kolleginnen, eigentlich könnten wir mal ein Mädchenprojekt machen, und haben überlegt, gut, wie machen wir’s, woher kriegen wir Geld, wie setzen wir das um?“ (F1, 4). 139 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG (2) Die AG als Anlaufstelle und Gesprächspartnerin Die AG grenzt sich von Überorganisation und abgehobenen Runden ab durch den Anspruch zu reden und zu handeln, statt nur zu reden und das Handeln an andere zu delegieren. „Die AG ist anerkannt, als ein Kreis von Fachleuten, die was machen können, wenn es brennt“ (F18, 5). Die AG will Ansprechpartnerin sein, auf Probleme aufmerksam machen, akute Probleme aufgreifen. Sie glaubt einen guten Ruf auch in der Politik zu haben und nimmt an, sie habe „die Dinge gut durchstrukturiert“, so dass „Termine innerhalb von zehn Minuten stehen“ (F19, 8). In der Diskussion werden jedoch Zweifel laut, inwieweit PolitikerInnen dem Selbstbild der AG zustimmen. Die Zweifel beziehen sich auch darauf, ob die Fachleute bei kritischen Anfragen von Verwaltung und Politik durchsetzungsfähig bleiben und der „gute Ruf“ über Einzelfälle hinaus anerkannt ist. (3) Fachliche Stellungnahmen in der Öffentlichkeit Die TeilnehmerInnen haben folgende Themen genannt, bei denen sie sich in der Öffentlichkeit äußerten (vgl. F1-21): • Stellungnahme gegen die Pläne, eine Grünfläche mit Erholungswert zu bebauen • Stellungnahmen gegen einseitige, negative Presseberichte über den Stadtteil „Und dieser Artikel, der war so, da wehrt sich auch immer der Stadtteil gegen, gegen diese Stigmatisierung. So als wär’ das hier wie in der Bronx“ (F20, 6) • Fachliche Reaktion auf Spannungen zwischen Jugendlichen im Stadtteil • Stellungnahmen zur Kinder- und Jugendkriminalität in Vahrenheide • gegen übergroßes Polizeiaufgebot protestieren „Ja, also, es war vor einem Jahr die Situation, daß wir hier plötzlich ein unheimlich großes Polizeiaufgebot hatten, vier Wochen lang. Wo berittene Polizei, Polizeihubschrauber und der ganze Stadtteil ... und es waren mehrere Artikel in der Zeitung. Das ist halt dieses ‚Law und Order-Prinzip‘ – durchgreifen. Und das hat viele im Stadtteil sehr geärgert. Und das ist schon in den letzten drei Jahren des öfteren passiert“ (F20, 6). • Gegendarstellungen gegen das von Presse verbreitete Image über den Stadtteil 140 5.3 SELBSTSICHT AUF DIE KOOPERATION DER AG KINDER- UND JUGENDARBEIT „Daß wir uns halt dagegen wehren, ... daß man hier jetzt plötzlich mit so ’nem Polizeiaufgebot ankommt. Und ... das so dahin stellt, als wenn nicht schon Einrichtungen seit Jahren vor Ort sind und gute Arbeit leisten“ (F20, 6). (4) Berichte über den Stadtteil Einige Fachleute müssen über Kinder und Jugendliche, aber auch über den Stadtteil Berichte schreiben. Was wird über den Stadtteil geschrieben, was in zentralen Behörden und Institutionen zur Meinungsbildung beitragen kann? Gibt es eine Verständigung darüber, wie der Stadtteil zu sehen ist? Welche Perspektive wird von den meisten Fachleuten geteilt? Aber auch in der Formulierung von Anträgen für Projektgelder wird der Stadtteil dargestellt. „Und bei diesen Berichten muß halt auch die Lebenswelt der Jugendlichen und Heranwachsenden berücksichtigt werden. Wo werden die groß? Welche Sozialisationsmechanismen greifen da? Welche Schule besuchen sie im Stadtteil?“ (F16, 1). „Da ist man denn auch sehr zwiespältig. Eigentlich möchte man nicht, daß Vahrenheide so negativ in der Presse oder in anderen Medien dargestellt wird, verglichen wird mit der Bronx z.B., oder in Vahrenheide wird nur geklaut und nur getrunken und nur randaliert. Auf der anderen Seite, wenn man was bestimmtes vorhat und bestimmte Gelder dafür beantragen möchte, dann hängt man das natürlich ganz besonders raus, daß man solche Probleme durch das Projekt, das man vorhat bewältigen kann, um diese Gelder zu kriegen“ (F7, 9). Die AG-TeilnehmerInnen wurden auf diesen Widerspruch aufmerksam gemacht. Sie erklärten: • „Die fachlichen Stellungnahmen der Sozialarbeiter sind vertraulich und das wird schon fachlich korrekt gehandhabt. Das ist eine ganz andere Ebene.“ • „Es ist wichtig, daß beide Seiten des Stadtteils dargestellt werden.“ • „Schlimm ist die Einseitigkeit und die Form der Darstellung in der Presse.“ • „Problematisch sind sensationelle Berichte in der Presse, die stören häufig nur die Zusammenarbeit im Stadtteil.“ • „Wir haben grundsätzlich keine Bedenken bei sachlichen Berichten, aber kein ‚Bild-Zeitungs-Stil‘. Eine sachliche Darstellung ist wichtig” (V6, 3). Auf die Gratwanderung, dass Stigmatisierung eine Ressource sein kann, um durch die zugespitzte Darstellung von Stadtteilproblemen höhere Zuschüsse zu erzielen, ging niemand ein. Fragen der Verteilungsgerechtigkeit für die sozialen Brennpunkte angesichts des Mangels an städtischen Mitteln bleibt dem Rat und der Verwaltungsleitung überlassen. 141 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG 5.3.3 Spannungsverhältnisse in der Kooperation (1) Stadtteilbezug – ein gemeinsamer Arbeitsbegriff? Unterschiedliche Vorstellungen und Erwartungen sind an den Stadtteilbezug geknüpft. Zu berücksichtigen ist für die Einrichtungen zwar die Verschiedenheit der formalen Anforderungen: • Aufgaben, z.B. Erziehungshilfe, Freizeitangebote • Zielgruppen, z.B. Schulklassen, Altersgruppen, Mädchengruppen • Arbeitszeiten und Präsenzpflichten, z.B. Beratung, offene Tür, Unterricht • regionale Zuständigkeiten, z.B. Bezirke, Stadtteil, Straßen Hier können sich auch Interessen widersprechen, wenn z.B. stadtweit Personal und Mittel verteilt werden müssen und Bewohner einiger Straßen besondere Forderungen an die Kommune stellen. All diese Gegensätze müssen in einer Arbeitsgemeinschaft überbrückt, teilweise ausgeklammert oder ausgehandelt werden, um eine Zusammenarbeit zu ermöglichen. Die AG-TeilnehmerInnen kommentieren die obige Zusammenfassung: Ihrer Meinung nach gibt es neben den o.g. einrichtungs- auch stadtteilbezogenen Grenzen und die Grenzen der Kinder und Jugendlichen, die sich nach den Orten richten, an denen sie sich aufhalten. Daran müssen sich Konzepte orientieren. • „Aber auch der Stadtteil gibt Grenzen vor. Die Leute sehen eine Straße zwischen den Stadtteilen Vahrenheide und Sahlkamp als Grenze, die sie nicht überschreiten.“ • „Zur anderen Seite ist es Vahrenheide-West. Das wird von der Stadtbahn abgegrenzt.“ • „In unserer Kita haben wir keine Anmeldungen von dem benachbarten Stadtteil, auch jenseits der Stadtbahn sind es nur wenige.“ • „Allerdings ist das beim Thema Drogen anders, das ist z.B. grenzüberschreitend. Da arbeiten wir mit dem Nachbarstadtteil zusammen.“ • „Wir in unserer Schule sind ohnehin stärker auf unsere Einrichtung konzentriert, einmal wegen der personellen Ausstattung mit nur zwei halben Stellen und wegen der Lage am Rande des Stadtbezirks.“ • „Weil wir drei Stadtteile zu versorgen haben, wählen wir Schwerpunkte. Wir können nicht überall mitarbeiten.“ 142 5.3 SELBSTSICHT AUF DIE KOOPERATION DER AG KINDER- UND JUGENDARBEIT • „Wir, die zentralen Dienste, orientieren uns nach den Betreuten und deren aktuellen Wohnort. Der kann wechseln, so daß dann mehrere Kinder und Jugendliche aus anderen Stadtteilen kommen. Nach den Anmeldungen orientieren wir uns“ (V6, 4-5). (2) Die Größe und Struktur der AG Es herrscht Unzufriedenheit über die Struktur der AG. Einige finden, es gebe insgesamt zu viele AG-Treffen. Aber auch der Sinn mancher Treffen der AG Kinder- und Jugendarbeit wird in frage gestellt. „Es gab auch schon Treffen, wo ich mich gefragt habe, was mache ich hier eigentlich. Aber ich weiß nicht, ob das so normal ist, für solche Gruppen. Also, ich würd’ mir manchmal wünschen, es gäbe eine Person, die das koordiniert“ (F5, 3). „... dann sind mir die Runden zu groß, dadurch nicht intensiv genug. Dann sind da Leute drin, die da nichts zu suchen haben. Dann sind’s zu viele Runden“ (F15, 6). „Der Kreis war ja (früher) relativ klein. Er war eigentlich im nachhinein, wenn ich es richtig nehme, war er auch effektiver“ (F17, 8). Besonders die TeilnehmerInnen, die stärker mit Einzelfallhilfe arbeiten, hegen den Wunsch, zusätzliche Untergruppen zur AG zu bilden. „Ich denke, je größer die Gruppe ist, desto schwieriger wird es auch arbeitsfähig zu sein. Ja wenn da eine Riesenrunde ist, dann ist da eher so das Schweigen. Dass man sagt, meine Güte, wir sind ja so viele, die Zeit ist so knapp, wir können nicht alle Kleinigkeiten durchsprechen“ (F12, 6). „Wenn man in Kontakt kommt, find ich, ist (es) fast immer positiv. Wenn man die Gesprächssituation sucht und es auch schafft, hab ich die Resonanz immer als positiv empfunden und es gab auch so ’ne Blickwinkelerweiterung für die Arbeit“ (F6, 5). Die Sitzungen allein reichen nicht aus, um Kooperationen zu beginnen. Zusätzlich wird zu Einzelnen Kontakt aufgenommen, das Gespräch gesucht und Absprachen getroffen. (3) Neu sein in der AG Acht Einrichtungen haben die AG 1993 gegründet, davon waren sieben noch in der AG vertreten. Allerdings sind weitere VertreterInnen von Einrichtungen hinzugekommen. Zwischen 1996 und 1998 waren es 15 Perso- 143 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG nen. Nach Abschluss der Forschungsarbeit hatten erneut neun Leute in der AG gewechselt. Tabelle 21: 26 Befragte Dauer der Berufstätigkeit im Stadtteil sind im Stadtteil Vahrenheide tätig 2 seit 14 und mehr Jahren 3 seit 8 bis 10 Jahren 6 seit 4 bis 6 Jahren 4 bis zu 3 Jahren 4 bis zu 2 Jahren 7 bis zu 1 Jahr (vgl. F1-21) Es gibt, allgemein gesagt, „die Neuen“ und „die Alten“. Einige sind mit dieser relativ schnellen Erweiterung der AG nicht zufrieden. „Zu viele Leute, die Runde ist zu groß“, lautet die Kritik. Neue Leute beklagen, dass es nicht immer leicht ist, zu der immer größer werdenden Runde dazu zu stoßen. Die neuen AG-TeilnehmerInnen äußerten sich folgendermaßen zu dieser Situation: • „Wir sind 1½ Jahre dabei und es sind immer viele neue Gesichter hier. Ich bin froh über die regelmäßige Vorstellungsrunde zu Beginn jeder Sitzung.“ • „Ich bin ein halbes Jahr hier und aus der AG entwickeln sich neue Dinge, das ist erfrischend.“ • „Es gibt ja auch Untergruppen, dort kann man sich besser kennen lernen.“ • „Ich bin auch schon in anderen AGs. Die Zukunftswerkstatt (Fortbildung) war interessant, also bin ich in diese AG hier gekommen. Ich kannte aber schon einige Leute vorher.“ • „Die AG ist für uns hauptsächlich zur Information da. Wir als Kita haben wenig zusätzliche Kapazitäten. Eine regelmäßige Teilnahme ist durch die Arbeitsbelastung schwierig. Mitarbeit in Projekten ist für uns gar nicht möglich“ (V6, 1). Die AG bietet eine kollegiale Arbeitsatmosphäre, wo Anknüpfungspunkte geboten werden, die eine Kontaktaufnahme erleichtern. Der Informationsaustausch wird als kleinster gemeinsame Nenner gesehen, gerade wenn nur 144 5.3 SELBSTSICHT AUF DIE KOOPERATION DER AG KINDER- UND JUGENDARBEIT geringe zeitliche Kapazitäten übrig sind. Für die Neuen besteht oft zusätzlicher Bedarf an Orientierung im Arbeitsfeld, um Stadtteil und Institutionen kennen zu lernen. Fachleute, die schon länger im Stadtteil tätig sind, könnten hier Kenntnisse vermitteln. • „Die AG ist eine Möglichkeit, etwas über den Stadtteil zu erfahren und sich mit anderen Sozialarbeitern zu treffen, dadurch wird die eigene Arbeit in einen Zusammenhang gestellt. Wenn sich dann Zusammenarbeit ergibt, ist es gut“ (V6, 1). (4) Persönliche Bezüge und gleiches Berufsverständnis in der Arbeit Die einen halten persönliche und berufliche Kontakte für die Zusammenarbeit für eher förderlich, für andere stellen sie ein Hindernis dar. „Ich hab das große Glück, daß ich mit diesen privaten Kontakten ... einfach auch ganz viele Mitarbeiter der AG schon vorher kennengelernt hab’“ (F19, 4). „... also, das Organisieren läuft über persönliche Kontakte ganz viel ... Also ich denke, es ist schon gleiches Berufsverständnis, wobei wir ja nicht unbedingt immer die gleichen Arbeitsinhalte haben. Aber nichtsdestotrotz machen wir ja viele Projekte zusammen und die klappen super. Und was ich vorhin sagte, das macht auch Spaß. Das hat was mit Berufsverständnis zu tun“ (F1, 5). Diese Form der Zusammenarbeit gefällt einigen nicht, die die Arbeitsbeziehungen von der freundschaftlichen Ebene trennen wollen. „Es gibt hier einzelne Leute aus Einrichtungen, die unheimlich zusammenklucken, die halt private Kontakte haben und arbeitsmäßig auch verknüpft sind, so’n Klüngel“ (F15, 6). Zusammenarbeit müsse auch Spaß machen, meinen einige, weil sich auf diese Weise der graue Berufsalltag besser meistern und kreatives Potenzial besser fördern lasse. „Und für mich ist das auch eine AG, wo ich gemerkt hab, da kann man viel machen, da sind viele kreative Köpfe. Und Leute, die viele Ideen haben und Spaß an ihrer Arbeit haben und da kann man gemeinsam was entwickeln“ (F19, 5). Das schließt ebenso ein, dass die schwierigeren Kooperationspartner draußen vor bleiben, weil die Auswahl persönlich entschieden wird. Anders ist es in den Teams der Einrichtungen, die aufeinander angewiesen sind und für die eine Zusammenarbeit vorgeschrieben ist. „Als Neuling seh’ ich, daß viele Kollegen, die bisher zusammengearbeitet haben, auch dann wieder zusammenarbeiten. Weil die sagen, das ist meine Wel- 145 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG lenlänge, da braucht man nicht viel reden, das ist klar. Natürlich, wenn immer dieselben zusammenarbeiten, (sind) auch andere draußen gelassen. Ich glaube, das ist nicht böse (gemeint), garantiert nicht“ (F19, 6). Wenn Aktionen nicht gelingen, erfolgen Schuldzuschreibungen recht schnell. Ist persönliche Distanz vorhanden, weil die Zusammenarbeit frei gewählt ist, können Konflikte auch ungeklärt bleiben, und man wendet sich anderen Kooperationspartnern zu. „Wir konnten uns (bei einer gemeinsamen Aktionen) nicht auf die Mitarbeiter im Stadtteil verlassen. Deswegen ist vielleicht auch so ’n kleiner Unmut da ... Und dann kommt nämlich die Frage, wie läuft denn die Aktion ... Und das kommt dann von solchen Leuten, die auch gesagt haben, daß sie mitmachen wollen“ (F15, 6). Auch die Erwartungen an Unterstützungsmaßnahmen können eine Zusammenarbeit überfordern. Wenn es sich um ein Netzwerk handelt, bei dem Arbeitsbedingungen einzelner Einrichtungen ausgeklammert bleiben, stoßen Appelle auf keine Resonanz. „Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, da gehört hier im Stadtteil auch mehr Solidarität dazu. Die erfahr ich aber nich’ ..., alle wissen, daß unser Haus hier aus allen Nähten platzt, daß es rappeldickevoll is’, aber Unterstützung erfahre ich nicht“ (F15, 4). Wenn Fachleute in ein Kooperationsnetz eingebunden sind, erleben sie die Zusammenarbeit als durchaus positiv. „Ich merk, mein ganzes Denkverhalten richtet sich schon auf ’nen solidarisches Miteinander in dieser AG aus“ (F19, 4). 5.3.4 Struktur der Vernetzung Im Erstinterview mit den AG-TeilnehmerInnen (vgl. F1-21) wurde u.a. die Frage gestellt: „Mit welcher Einrichtung der AG arbeitest du häufig zusammen?“ Die Antworten wurden mit Hilfe eines Soziogramms ausgewertet. Jede Einrichtung wird durch einen Kreis symbolisiert, der eine Ziffer von 1 bis 21 trägt. Die benannten Kooperationsbeziehungen weisen Pfeile auf. Erwiderte Beziehungen tragen Pfeile in beiden Richtungen und sind mit breiten Linien versehen. Bei genauer Betrachtung zeigt sich folgende Struktur der Vernetzung (siehe Abbildung unten), die durch die Prozessforschung bestätigt wurde: In dem untersuchten Netzwerk sind drei unterschiedliche Gruppierungen erkennbar, die sich voneinander insbesondere durch die Teilnahme bzw. 146 5.3 SELBSTSICHT AUF DIE KOOPERATION DER AG KINDER- UND JUGENDARBEIT Zurückhaltung bei Aktivitäten im Netzwerk unterscheiden, die aber in unterschiedlicher Weise die Dynamik des Netzwerkes garantieren. (1) Eine Gruppierung stellen die „Neuen-Netzwerkpassiven“ dar, die sich entweder im Stadtteil oder im Beruf neu orientieren müssen. Sie nutzen zunächst das breite Spektrum der Informationen, die Kontakte zu anderen Fachleuten der Sozialen Arbeit, die stadtteilbezogenen Erfahrungen der anderen zur Orientierung bzw. Einarbeitung und sammeln bei kleinen Vorhaben, eigene Kooperationserfahrungen mit den AG-TeilnehmerInnen. Sie bringen neue Energie in das Netzwerk ein, durch Impulse, Anfragen, Kritik und Veränderungswünsche. Dennoch sind sie lediglich einseitig und vereinzelt mit anderen im Netz verbunden (N=10 Einrichtungen; F 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 21). (2) Die Themenbreite und Vertiefung, garantiert die zweite Gruppierung. Es sind die „Berufserfahrenen-Netzwerkteilaktiven“, die sich über die o.g. Tätigkeiten hinaus als AnsprechpartnerInnen für eine Vielzahl von Themen (z.B. Zielgruppenbezug, methodische Ansätze, Erklärungen und Lösungsversuche sozialer Probleme) anbieten. Die Zusammenarbeit erfolgt über fachlichen Austausch, fallbezogene Kontakte, kollegiale Unterstützung und gemeinsame Projekte. Hier sind diejenigen anzutreffen, die ihre Aktivitäten im Stadtteil oder im Netzwerk begrenzen wollen oder müssen. Dies geschieht entweder aus persönlichen, familiären Gründen, oder weil sie andere fachliche Schwerpunkte (durch Sonderaufgaben oder Funktionen in der eigenen Organisation) gesetzt haben oder auch weil sie zu sympathieabhängigen Arbeitsformen auf Distanz gehen. Typisches Kennzeichen dieser Gruppierung sind die einseitigen Arbeitsbeziehungen mit mehreren TeilnehmerInnen des Netzwerkes (N=6 Einrichtungen; F 5, 14, 15, 17, 19, 20). (3) Den Motor, also die Funktionsfähigkeit und Kontinuität des selbstorganisierten Netzwerkes garantiert eine Anzahl von Personen, die als Kleingruppe bezeichnet werden kann. Sie haben einseitige Kontakte zu TeilnehmerInnen, stehen aber darüber hinaus in wechselseitiger Arbeitsbeziehung und zu anderen, sind also nicht nur in einseitigen Arbeitsbeziehungen, wie die anderen TeilnehmerInnen vernetzt. Daraus folgt, dass sich für die „Berufserfahrenen-Netzwerkaktiven“ ein Norm- und Rollengefüge entwickelt und gefestigt hat, innerhalb dessen sie agieren. Das bietet ihnen Orientierung für ihre berufliche Identität, die sich auf kontinuierliche Zusammenarbeit, fachlichen Austausch und Reflexion sowie Kollegialität zurückführen lässt. Zentraler Aspekt der engen Kooperation in der Kleingruppe ist eine gegenseitige Sympathie und vergleichbares Berufsverständnis. Fachliche 147 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG Positionen bekommen eine größere Unabhängigkeit von der Organisation des Anstellungsträgers und Auftraggebers. Die Gruppenmitglieder gewinnen damit Handlungsspielraum, über die offizielle Funktion hinaus erhalten sie Unterstützung bei den Risiken von Veränderung, Verweigerung, Konfrontation oder Disput. Die Zugehörigkeit zu der Kleingruppe ist mit einer Funktionsübernahme im Netzwerk verbunden und bedeutet erheblichen Arbeitsaufwand. Überschneidungen mit Stellen- und Funktionsbeschreibungen der Organisation können die Mitarbeit als Netzwerkaktive begünstigen, etwa wenn Stadtteilarbeit oder Vernetzung der Arbeitsplatzbeschreibung zugeordnet werden (N=5 Einrichtungen; F 1, 2, 3, 7, 11). Gemeinsam ist allen TeilnehmerInnen, dass sie mindestens 2 Erfolge dieser Vernetzungsrunde benennen können. Das bedeutet, die Runde weist einen eindeutigen Nutzwert, als ein Aspekt des Zusammenhalts auf. Die Bedeutung der genannten Erfolge ist jeweils subjektiv geprägt und wird unterschiedlich gewichtet. In einigen Fällen sind es faktische Veränderungen, in anderen die stadtteilbezogenen Informationen, die als Erfolg gesehen werden. Versuche, die Berufspraxis mit Begriffen wie Stadtteilbezug, sozialräumliche Arbeit, Gemeinwesen- oder Stadtteilarbeit zu charakterisieren führen bei den AG-Teilnehmenden eher zu einer weiteren Ausdifferenzierung und Unterscheidung, weil die Selbstdefinitionen über andere Kategorien begründet werden (z.B. gesetzlich, methodisch, institutionell, zielgruppenbezogen, regional). Als verbindende Elemente und als gemeinsame Tendenzen im Netzwerk lassen sich folgende Positionen feststellen. Nahezu allen TeilnehmerInnen ist es wichtig, dass: (1) Bedarfs- und Problemanalysen der Fachleute im Stadtteil angemessen in Planungs- und Entscheidungsprozesse einfließen; (2) Projekte eigenständig geplant und durchgeführt sowie dafür Finanzen beantragt werden; (3) die Beteiligung der Fachleute und der Betroffenen einen hohen Stellenwert erhält; (4) die Stadtteilöffentlichkeit (BürgerInnen und PolitikerInnen) über Erkenntnisse aus der Reflexion beruflicher Praxis mit Analysen, Vorschlägen und Kritik direkt informiert wird. Es scheint ein tragendes Element des selbstorganisierten Netzwerks der Sozialen Arbeit zu sein, fachliche Positionen unabhängig von Hierarchie und Bürokratie äußern zu können. 148 5.3 SELBSTSICHT AUF DIE KOOPERATION DER AG KINDER- UND JUGENDARBEIT Abbildung 3: Netzwerk stadtteilbezogener Kinder- und Jugendhilfe Netzwerk stadtteilbezogener Kinder- und Jugendhilfe 21 (0/1) 10 11 (1/3) (6/5) 12 13 (0/1) (0/3) Anzahl der Kooperationen: (9/-) wird als Kooperationspartner gewählt (passiv) (-/5 ) wählt als Kooperationspartner (aktiv) 18 (0/2) 14 15 (2/5) 19 6 5 (3/3) (8/2) 4 (6/0) (5/2) 2 8 (9/5) (1/1) 9 (0/2) (1/3) 1 (5/4) 7 20 (1/5) (8/6) 3 (6/8) 17 (5/3) 16 (1/3) Träger des Netzwerks: Bedeutung durch hohe Anzahl einseitig benannter Kooperationen (5-8x) Schlüsselfunktion durch hohe Anzahl wechselseitig benannter Kooperationen (4x) 5.3.5 Zusammenfassung des Selbstbildes der AG Die Darstellung des Selbstbildes der AG durch den Praxisforscher stieß bei den TeilnehmerInnen weitgehend auf Zustimmung. Besonders den neuen AG-TeilnehmerInnen gab der Zwischenbericht Orientierung. Aber auch die Gründungsmitglieder erhielten erstmalig einen Überblick über das Selbstverständnis, die Arbeitsweise und Regeln der Großgruppe. Die Perspektiven aller Beteiligten, einschließlich der Differenzen, waren erstmals nachlesbar. Damit wird allerdings ein Defizit Sozialer Arbeit deutlich, dass vielfach Selbstverständnis, Arbeitsweisen und Positionen nicht schriftlich vorliegen und sich der Einsicht für Außenstehende oder einer Überprüfung entziehen. Auch im Forschungsprojekt wurden Hinweise auf Unstimmigkeiten mit kurzen Erklärungen beantwortet oder von der Mehrheit nicht als Widerspruch wahrgenommen bzw. so akzeptiert. Die Ausrichtung der AG auf Handlungsfähigkeit schränkte die Kritisierbarkeit und die Reflexion widersprüchlicher Aspekte erheblich ein. Es war zunächst nicht möglich, diese Themen weiter zu vertiefen, so dass sie erst in der Prozessforschung erneut 149 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG aufgegriffen wurden. Es gehört zwar auch zur Professionalität in der Sozialen Arbeit, aufgrund von vorläufigen Annahmen situativ angemessen zu handeln. Für die Forschung blieben jedoch Fragen nach konzeptionellen Grundlagen offen: Gibt es zu Schwerpunktthemen schriftliche Konzeptionen? Welche Bedeutung haben dabei Strukturdaten? Wie wird mit Neuen umgegangen und wie wird die Weitergabe des stadtteilbezogenen Wissens organisiert? Welche Außenkontakte werden kontinuierlich gepflegt? Wie entwickelt sich der Informationsfluss von und zu den Entscheidungsebenen? Die AG vertritt eine große Bandbreite an sozialer, kultureller und pädagogischer Arbeit. Die Zusammenarbeit unterliegt dabei vielfältigen Bedingungen und Einflüssen. Allen TeilnehmerInnen ist wichtig, dass die AG selbst organisiert wird und in Inhalt und Form selbst bestimmt werden kann. Daraus resultiert ein großes Maß an Wahlfreiheit, das der Motivation und dem Engagement der Einzelnen zu Gute kommt. Ein zentraler Punkt für die Position und den Grad der Verbindlichkeit ist die Dauer der Mitarbeit, weil sich dadurch Kooperationsbeziehungen entwickelten, die sich gegenseitig ergänzen und aufeinander beziehen. In dieses Beziehungsnetz müssen Neue eingebunden werden, wenn sie über Informationen hinaus partizipieren wollen. Der Sitzungsablauf kann darauf Rücksicht nehmen und eine integrierende Funktion erhalten, wenn neue Projekte sich vorstellen oder die Anliegen und Anregungen der Neuen einbezogen werden. Auch vielfältige Vorhaben sind geeignet weitere AG-TeilnehmerInnen an der Zusammenarbeit zu beteiligen. Die kurze Vorstellungsrunde zu Beginn von Sitzungen mag als Routine eintönig wirken, wird jedoch von vielen als hilfreich bezeichnet. Auch über die wesentlichen Inhalte der Zusammenarbeit innerhalb der AG besteht Konsens: Austausch und Diskussion, Abstimmung von Angeboten, Entwicklung und Umsetzung von Projekten, Funktion als AnsprechpartnerIn, Lobbyarbeit. Der Austausch bezieht sich zunächst nur auf Fachleute aus sozialen und pädagogischen Arbeitsfeldern. Typische Arbeitsfelder, in denen sich Arbeitsbereiche der 21 Institutionen überschneiden, wo Projekte entstehen können sind: • Erziehungshilfe, Beratung, Betreuung, • Kinder- und Jugendarbeit, • Treffpunkte und Zentren. Eine Gesamtplanung der Arbeitsfelder gibt es noch nicht. Auch das Wissen über stadtteiltypische und stadtteilbezogene Besonderheiten ist nicht dokumentiert und verfügbar. Einzelne müssen sich selbst über Gespräche oder 150 5.4 FREMDSICHT AUF DIE KOOPERATION DER AG KINDER- UND JUGENDARBEIT Aktionen kundig machen. In der praktischen Arbeit sind die Trennungslinien zwischen Erziehungshilfe und offener Jugendarbeit erkennbar. Verstärkt wird das durch die Ansicht, das eine sei Feld-, das andere eher Verwaltungsarbeit. Der Praxisforscher machte auf die fehlende Kooperation der Arbeitsbereiche aufmerksam. Die AG-TeilnehmerInnen betonten, es gäbe jedoch grundsätzlich gute Erfahrungen der Zusammenarbeit zwischen Erziehungshilfe und Jugendarbeit. Grenzen der Zusammenarbeit im Stadtteil entstehen durch den Auftrag, die verschiedenen Alters- bzw. Zielgruppen, die Arbeitsbedingungen und Zeitbudgets auf der formalen Seite. Persönliche Bezüge und gleiches Berufsverständnis als personale Bedingungen erleichtern die Arbeit andererseits. Spaß an der Arbeit beflügelt auch die Kooperation. Die Wahlfreiheit der Kooperationspartner fördert Kreativität und Motivation, führt aber auch dazu, dass nicht alle gleichermaßen einbezogen sind. Dennoch hat diese Form der Selbstorganisation fördernde Auswirkungen auf das Engagement und auf die Authentizität und Glaubwürdigkeit beim Kontakt mit Kindern und Jugendlichen. Diese Dynamik der Zusammenarbeit steht in Widerspruch zu rein funktionalen Betrachtungen, wie sie von Leitungskräften und PolitikerInnen geäußert werden. Aber auch in der Arbeitsgemeinschaft wird Solidarität unterschiedlich erlebt und ist in Form von erwiderter Kooperation nur bei Fachleuten zu finden, bei denen sich wichtige Funktionen für den Erhalt der AG bündeln. Wo sich ausgeprägte Solidarität findet, ist sie überwiegend personenbezogen, lediglich in einem Fall aufgabenbedingt und leitet sich nicht aus einer Zugehörigkeit etwa zu einer bestimmten Abteilung, demselben Träger oder zu einer Gewerkschaft ab. Die Größe und Struktur der AG kann die Arbeit erschweren, wenn mit steigender TeilnehmerInnenzahl keine neuen Arbeitsformen gefunden werden. Die Frage nach einer Leitung wurde aufgeworfen, als die Umsetzung von Projekten verbindliche Ansprechpartner verlangte und durch eine Sprecherinnenwahl gelöst. Gleichwohl wurde Wert darauf gelegt, nur eine geringe Formalisierung mit wenigen Funktionen festzulegen, um eine Durchlässigkeit bei der Übernahme von Aufgaben und Funktionen zu erleichtern. 5.4 FREMDSICHT AUF DIE KOOPERATION DER AG KINDER- UND JUGENDARBEIT Eine zentrale Frage stellte sich den AG-TeilnehmerInnen, die sie sich nicht selbst erklären konnten und zu der sie Antworten wünschten. Würden Po151 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG litikerInnen und Leitungskräfte in der Stadtverwaltung die Selbstsicht der AG teilen? Die TeilnehmerInnen der AG hatten in vielen Jahren freiwillig einen Stadtteilbezug für die Soziale Arbeit organisiert und dabei wichtige übergreifende Arbeiten übernommen, was mit zusätzlichem Engagement verbunden war. Das erweiterte die Fachkompetenz und brachte Ergebnisse, die über die Arbeit Einzelner hinausreichten. Die AG wertete dies als Erfolg, erhielt jedoch von Leitungskräften oder PolitikerInnen keine Wertschätzung und Anerkennung dafür. Stattdessen war die Kritik zu hören, in den Runden würde nur die Zeit abgesessen und Kaffee getrunken oder es fehle insgesamt eine bessere Vernetzung. Die Kritik war zunächst nicht nachvollziehbar, denn durch Diskussionen über Verwaltungsreformen der Kommunen sowie Veränderung und Entwicklung sozialer Organisationen gehören mittlerweile Kooperationsrunden zum Standard von Sozialer Arbeit, und für bestimmte Runden wird die Teilnahme sogar verpflichtend vorgeschrieben. Die Hintergründe der Kritik und die geringe Wertschätzung des Engagements der AG-TeilnehmerInnen sollten in Interviews mit externen ExpertInnen eruiert werden und insgesamt ein Fremdbild der AG ergeben. Stellvertretend für die Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung wurden 8 Personen ausgewählt, die im Stadtbezirksrat, im Stadtrat und in der Stadtverwaltung, insbesondere im Jugendamt Planungs- und Entscheidungsverantwortung trugen. 5.4.1 Kooperation zwischen PolitikerInnen, Verwaltungsleitung und der AG Für alle Interviewten aus Politik und Verwaltung war die Struktur der AG nicht nachvollziehbar. Die Zusammensetzung, die Ansprechpersonen, die Ziele und Aufgaben schienen ihnen nur ansatzweise erkennbar. Dies stellt die Außenwirkung der AG Kinder- und Jugendarbeit in Frage. Dazu ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung: „... wenn man mal zu Vahrenheide kommt, bin ich der Auffassung, daß die sich doch stärker miteinander abstimmen müssen. Es gibt ’ne ganze Reihe an Arbeitsgruppen und Gremien und Kreisen, die entstehen. Dann sind die auch noch vertreten in der Koordinationsrunde. Das mag jetzt den einzelnen Leuten, die das da so betreiben, so für sich auch einsehbar und überschaubar sein. Aber wenn man das mit dem Anspruch der Stadtteilentwicklung betrachtet, die so nicht aus der Froschperspektive kommt, ist es zum Teil überhaupt nicht (deutlich) ... da steigt man überhaupt nicht durch. Es ist auch nicht klar, wer eigentlich in welchen Zusammenhängen wie verbindlich mit wem zusammenarbeitet“ (E1, 9). 152 5.4 FREMDSICHT AUF DIE KOOPERATION DER AG KINDER- UND JUGENDARBEIT PolitikerInnen und Leitungskräfte der Verwaltung hatten Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit mit Gruppen, die sich selbst organisieren und nur wenig formale Strukturen aufweisen. Ihnen fehlten Ansprechpartner, Verbindlichkeit und verlässliche Absprachen. Die AG-TeilnehmerInnen haben von ihrer Organisation kein Mandat, um mit PolitikerInnen oder Verwaltungsleitung zu verhandeln oder Äußerungen abzugeben. Das erschwert eine direkte Kontaktaufnahme und erklärt die Zurückhaltung der Einzelnen. Außenstehende nehmen das entsprechend wahr. „Sie wollen über ... alles ... befragt werden, und wehe sie können nachweisen, daß sie, jetzt übertreibe ich mal, nicht einbezogen sind, ... kommt man aber hin und sagt, ich möchte aber ’ne gewissen verbindlichen Organisationsweg, dann sind sie nicht der Ansprechpartner, dann sind es plötzlich alles einzelne Leute“ (E1, 9). Die Zusammenarbeit mit PolitikerInnen ist vielen Fachleuten vor Ort durch die Festlegung in Arbeitsrichtlinien und Dienstanweisungen nicht erlaubt. In Kommunalverwaltungen, aber auch in anderen sozialen Organisationen ist die Außenvertretung der Leitung oder von ihr Beauftragten vorbehalten. Die AG stellt eine Möglichkeit dar, nicht als Person oder Einrichtung einzeln in Erscheinung treten zu müssen und dennoch fachliche Positionen zu äußern. „Und natürlich wissen wir, daß Mitarbeiter (der Stadt) keine Anträge stellen dürfen an Bezirksräte, um an Mittel heranzukommen. Aber wir wissen auch, daß es Gesprächslagen gibt und Bezirksräte sich dann dieser Dinge annehmen. Und ich glaube, daß bestimmte Fachforen auf Stadtteilebene eine gute Beziehung auch zu den politischen Bereichen weiterhin haben sollten ... daß diese Gruppen, weil sie eben auch Experten sind für bestimmte Problemlagen im Stadtteil, daß sie Kanäle haben müssen in die Politik. Eben weil man soviel weiß, ist es wichtig, damit Politik gestalten kann, daß Politik auch Informationen bekommt. Das ist ein verdecktes Regelwerk oder ein verdecktes Prinzip, das ist Wirklichkeit“ (E3, 11). Leitungskräfte der Verwaltung weisen häufiger darauf hin, dass anders als in der Stadtverwaltung die Übernahme von Aufgaben oder die Zusammenarbeit der AG mit anderen Stellen nicht angewiesen werden kann und beklagen den Mangel an Steuerungsfähigkeit. „... es ist immer auf der Basis von Überzeugungsarbeit, von Fördermöglichkeiten im Hintergrund, wenn es denn geschieht. Aber niemand, auch nicht der Amtsleiter kann es anweisen, ... seine Mitarbeiter, ... die Fachkräfte können angewiesen werden. Aber die AG hat immer noch die Möglichkeit zu sagen, machen wir nicht“ (E3, 7). 153 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG Ein Kooperationsvertrag aller Träger könnte das zwar erreichen, würde dann aber die Elemente von Freiwilligkeit und Selbstorganisation verlieren und den Charakter und das Engagement verändern. Für Leitungskräfte ist das Steuern der Mitarbeiterschaft ein zentrales Anliegen und steht einer Selbststeuerung vielfach entgegen. Es ist die Frage, ob sich die erfolgreiche Kooperation aller Fachleute anweisen lässt, wie es beim Kontraktmanagement (vgl. KGST 1998) angestrebt wird. Die Leitungskräfte des Jugendamtes wünschen gegenseitige Akzeptanz und verbindliche Kooperation. Sie appellieren an die MitarbeiterInnen, die Haltung ihnen gegenüber zu ändern. „Also ich ... fänd’ es gut, wenn auf beiden Ebenen, sowohl bei den Mitarbeitern als auch in den Zentralen sich die Erkenntnis durchsetzt, wir alleine haben nicht den Stein des Weisen und wenn man vor dieser Erkenntnis vor sich selber dann auch in der Lage ist, zu versuchen, miteinander Lösungen zu finden und sich auch mal einzugestehen, man weiß auch im Prinzip nicht weiter und auch die Grenzen des andern auch akzeptieren kann. Also ich denke, daß da auf beiden Ebenen auch viel Unkenntnis und viel Mißtrauen vorhanden ist“ (E4, 9). Die Schilderungen der Erfahrungen mit der AG geben erheblichen Anlass zur Kritik. So nennen die PolitikerInnen und Leitungskräfte selten konkrete Beispiele für Auseinandersetzungen. Häufiger werden mehrere Einzelfälle zusammengefasst. Als Verbesserungsvorschläge vorgetragen, vermittelt das den Eindruck, dass die Interviewten eine überlegene Position einnehmen und etwas „besser wissen“. Dazu äußerten die AG-TeilnehmerInnen in gereizter Stimmung und mit Vorbehalten besonders gegenüber Leitungskräften der Stadtverwaltung: • „Das ist eben ein anderes Interesse, die haben Veränderungswünsche, manches dient auch dem Machterhalt und der Festigung ihrer Position. Da gibt es unterschiedliche Interessen, dabei gibt es auch Ärger, ist ganz normal.“ • „Wenn die Entscheidungsträger uns ernsthaft beteiligen wollen, dann finden wir auch eine Ebene der Zusammenarbeit, doch das sieht bisher nicht so aus.“ • „Die wollen sich hier alles anhören, uns aber keine Beteiligung einräumen.“ • „Wenn es ernsthaft wäre, fände sich auch ein Weg, und wir würden die Positionen und Vorstellungen austauschen und sicher auch Kompromisse finden.“ • „Aber die Interessen der Leitungskräfte sind nicht klar.“ • „Viele haben die Einstellung, hierher zu kommen, sich alles anzuhören, um besser kontrollieren und später uns Dinge aufdrücken zu können.“ • „Ein gutes Miteinander, daß beide Seiten ihre Erfahrungen reingeben, verschiedene Sichtweisen austauschen, das wäre was.“ 154 5.4 FREMDSICHT AUF DIE KOOPERATION DER AG KINDER- UND JUGENDARBEIT • „Es dürfte nicht nur das Delegieren sein und wir wären das Ausführungsorgan.“ • „Das hängt auch von der Person ab, wie sehen sie ihre Arbeit und welche Haltung haben sie uns gegenüber.“ • „Bei den Zukunftswerkstätten lief es anders. Das war eine gemeinsame Entscheidungsfindung, mit Unterstützung unserer Ideen.“ • „Da gab es auch gemeinsame Interessen.“ • „Es war ein begrenztes Vorhaben.“ • „Letztlich stellt sich für uns auch die Frage, wie können wir in der Praxis etwas besser erreichen“ (V12, 7). 5.4.2 Anlässe der Kooperation Persönliches Engagement und Urheberschaft von Ideen seitens der Leitungskräfte und PolitikerInnen haben einen hohen Stellenwert und sind Voraussetzung für die Unterstützung von Projekten. Wenn der eigene Namen nicht mit einem Projekte in Verbindung gebracht werden kann oder gar ein Konkurrent die Urheberschaft reklamiert, lässt das Interesse nach. „Ich finde, das kann jetzt auch subjektiv sein, weil ich, verglichen mit anderen Stadtteilen, mich in Vahrenheide öfter persönlich engagiert habe“ (E3, 2). „... wir, die Kollegen, ... haben gesagt, wir müssen auch Maßnahmen für den sozialen Ausgleich schaffen. Also nicht nur Steintor bauen ... Plätze bauen und Beton ... U.a. eben haben wir gesagt, wir müssen unbedingt etwas für Vahrenheide/Sahlkamp tun“ (E1, 2). Anträge auf Zuschüsse des Bezirksrats und Beihilfen des Rates bleiben in Erinnerung, auch weil es verschiedene Verfahren gibt, um Geld zu beantragen. Hier besteht die Befürchtung, dass Gelder vom Bezirksrat, vom Stadtrat (aus dem Sozial- oder dem Jugendetat) oder anderen Fördertöpfen gleichzeitig in Anspruch genommen werden. Der Überblick geht den politisch Verantwortlichen einer Großstadt verloren, daher bleibt ein Misstrauen bei Finanzanträgen. Dazu die PolitikerInnen: „Wir erhalten jedes Jahr Informationen über die städtischen Beihilfen an die Vereine und Verbände, das sind Mittel des Rates und es sind sehr viele Beihilfen in Vahrenheide“ (E2, 2). „Ich hab von der AG und Kinder- und Jugendarbeit gehört, aber nur soviel, daß es sie gibt und daß sie auch ziemlich engagiert arbeitet, aber was nun so konkret dabei rauskommt, kann auch sein, daß ich wirklich mal Papiere gekriegt hab, 155 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG aber ich kann Ihnen das wirklich mal zeigen, in meinem kleinen Zimmer oben stapeln sich 50 Ordner, solche Stapel Papiere zu Jugend und ...“ (E7, 10). Übergreifende Kooperation kann sich durch politisch beschlossene Projekte ergeben, wie beim „... Stadtteilentwicklungsprojekt für Vahrenheide/Sahlkamp ... Förderung der sozialen und kulturellen Infrastruktur für die Stadtteile Vahrenheide und Sahlkamp ... 3,5 Mark für Ökomaßnahmen ... und 4 Mill. Mark für die sozialen und kulturellen Einrichtungen ...“ (E1, 1-2). Bei diesem Teil des Hannover-Programm-2001 waren verschiedene Fachbereiche und Hierarchiestufen der Stadt beteiligt, die Politik wurde ebenfalls regelmäßig informiert und einbezogen. Eine Garantie für erfolgreiche Umsetzung ist aber auch das nicht, weil parteipolitische Prioritäten bereits getroffene Absprachen in Planungsrunden jederzeit verändern können. Das erklärt auch die Skepsis von BürgerInnen gegenüber langwierigen Planungsverfahren mit langen Abstimmungsprozessen in der Kommunalpolitik. Dagegen sind die Planungen der AG bescheidener, lassen sich aber häufig in kurzen Zeiträumen umsetzen. Eine Frage, die die AG immer wieder beschäftigt, ist: Welche Informationswege sind geeignet und erfolgreich, um Projekte darzustellen und die politische Unterstützung zu erhalten? „Es müssen ... natürlich die Initiativen selber ... an Politik herantreten bzw. an Verwaltung und sich bekannt machen ... Oder sich in irgendwelchen öffentlichen Diskussionen einklinken und uns halt dadurch bekannt werden“ (E6, 1). „Ja, sie müssen einem schon vorgestellt werden, so ohne weiteres sieht man die nicht“ (E6, 4). Die Rats- und Bezirksratsmitglieder sind überdurchschnittlich stark von Oktober bis Dezember in Haushaltsplanberatungen eingespannt, da bleibt wenig Zeit für Kontakte und inhaltliche Auseinandersetzung. „Günstig ist ja, so etwas gebündelt vorzustellen und nicht jeden einzeln einzuladen. Und da bietet sich ja zum einen mal die Kommission selber an, also die Kinder- und Jugendhilfeplanungskommission ... weil man auf diese Weise auch in die Stadtteile kommt und eine ganz andere sinnliche Erfahrung damit macht ... Wir haben eine ganze Menge zu tun, aber dennoch versuchen wir immer wieder solche Einladungen auch einfach wahrzunehmen ... Muß man gucken, daß es nicht gerade ein Sitzungstermin ist. Es gibt ja eine Terminliste bei der Stadt“ (E6, 5). Über die örtliche Presse und Info-Schreiben oder Einladungen sind besonders PolitikerInnen informiert, auch wenn sich dagegen die persönliche Präsenz nachhaltiger auswirkt. 156 5.4 FREMDSICHT AUF DIE KOOPERATION DER AG KINDER- UND JUGENDARBEIT „Wir kriegen ja regelmäßig alle Stadtteilzeitungen, aber ich kann es nur nochmal sagen, diesen Kinder- und Jugendbereich in seinen ganzen Facetten zu bearbeiten über das ganze Stadtgebiet, es ist für jemanden, der als Sprecherin einer Fraktion auch eine Arbeitsgruppe leitet und in der Fraktion die Sachverhalte darstellt und da auch Prioritäten setzen muß, unheimlich schwierig“ (E7, 10). Die schriftliche Form ist wenig hilfreich, meint eine Politikerin „... die gibt zwar Sachinformationen, ist aber wenig plastisch. Ich möchte das Projekt sehen, die Leute, die dafür stehen, kennenlernen“ (E2, 2). Hiervon unterscheiden sich die Leitungskräfte im Jugendamt, da sie auf ein Fachgebiet und auf bestimmte Einrichtungen bezogen arbeiten und sich dadurch auch regelmäßige Kontakte mit Einrichtungen ergeben. Die Praxiskontakte blieben jedoch häufig einseitig auf das Fachgebiet beschränkt. Einschätzungen über Bedarfserhebung, Maßnahmen und Umsetzung stoßen auf gegensätzliche Positionen, die häufig die Leitungskräfte und Fachleute vor Ort polarisieren. Verschiedene Interessen und Ziele stehen zur Diskussion. Hier besteht die Erwartung von Leitung und Politik, dass die Diskussion mit der AG auch bei strittigen Themen nicht abbricht. Es ist häufig so, dass ungeklärte Debatten zwischen Einrichtungen im Stadtteil auf anderen Ebenen der Stadtpolitik fortgesetzt werden. Diese verbinden sich mit politischen Trends und lassen sich schwer begrenzen. Über Gerüchte und Fehlinformationen können sich so Vorurteile verfestigen. „... eine Gesprächskultur auf der bezirklichen Ebene wäre für mich keine qualitative Weiterentwicklung ... Wenn wir nur sagen, wir finden uns zusammen für das Schöne und Gute und über die Schwachpunkte, da reden wir nicht drüber, weil das könnte mich ja irgendwann auch mal treffen“ (E4, 8). Gemeint sind Schwachpunkte auf beiden Seiten, also auch bei den AGTeilnehmerInnen. Leitungskräfte der Verwaltung, die stark in die Hierarchie eingebunden sind, sehen sich und ihr Verhalten häufig mit unbeliebten Entscheidungen, Fehlplanungen und Machtansprüchen gleichgesetzt, was die Kommunikation beeinträchtigt. Es stört sie, dass nicht differenziert wird zwischen den Personen und Funktionen innerhalb der Institution und den Möglichkeiten, die eine Zusammenarbeit bieten könnte. „Aber auch bei den Mitarbeitern vor Ort ist es wichtig zu gucken, welche Spielräume gibt es auch innerhalb der Verwaltung. Und nicht alles was von der Verwaltung oder was von den Zentralen nicht gemacht wird, als sozusagen bösen Willen zu interpretieren. Sondern auch da zu gucken, daß für bestimmte Dinge das Geld nicht da ist oder die Stellen nicht da sind oder ... daß man auf dieser Ebene auch guckt auf die Möglichkeiten, die jeweils der andere hat“ (E4, 10). 157 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG Die vorhandene Polarisierung zwischen „denen da oben und denen da unten“ wirft an die TeilnehmerInnen der AG die Frage auf, wie sie sich die Zusammenarbeit mit der Hierarchie und den Entscheidungsebenen vorstellen. Die PolitikerInnen meinten: „Also, die Chance besteht einfach, indem man miteinander kommuniziert, und nicht, indem man Vorurteile aufrechterhält. Ich bin davon überzeugt, daß es immer noch ein paar Mitarbeiter des Jugendamtes gibt, die sich ganz gerne ‚da oben‘ sehen und dementsprechend auch unnahbar sind. Aber ich kenne ganz viele im Jugendamt, die sich gar nicht so sehen. Die sich immer als Ansprechpartner empfinden für alle Gruppen außerhalb. Ich denke, wenn man ohne diese Vorurteile, die ja nun jahrzehntelang gepflegt waren, nur einfach auf die Leute zugeht, wird man sehen, was man davon hat. Ich glaube ein anderes Selbstverständnis von Kommunikation untereinander herzustellen, muß von beiden Seiten kommen“ (E6, 10). Die Stadtverwaltung, insbesondere das Jugendamt habe sich verändert, meinten die PolitikerInnen. Das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz, der Kostendruck, die Konsolidierung des Haushalts, in Hannover mit geringen Kürzungen im Kinder- und Jugendbereich, habe eine Veränderung in der Verwaltung zu mehr Kooperation mit der Ratspolitik ergeben. „... was das Jugendamt nochmal besonders auszeichnet, ist, daß schon lange bevor dieses Leitbild (der Verwaltungsreform) der Stadt Hannover entwickelt wurde, sich dort einzelne Projekte ... angeboten haben und Personal- und Organisationsentwicklung durchgeführt wurde, daß Kompetenzen auch nach unten weitergegeben worden sind“ (E6, 11). „... daß (es) insgesamt ’ne Richtungsänderung gibt, hin zu mehr Bürgerbeteiligung, nicht nur Kinder- und Jugendbeteiligung, sondern Betroffenenbeteiligung“ (E7, 9). Diese Ansicht teilte die AG nicht, da das Spannungsfeld zwischen Leitungskräften im Jugendamt und Fachleuten vor Ort fortbestand. Es fehle an grundsätzlicher Anerkennung des alltagspraktischen Wissens, die beruflichen Erfahrungen flössen selten in Planungsprozesse ein und erhielten keinen Einfluss auf Entscheidungen. Überdies mangele es an Kontinuität in der fachlichen Auseinandersetzung, ein Ansprechpartner für die Gesamtheit der Kinder- und Jugendbelange eines Stadtteils insbesondere für den sozialen Brennpunkt, sei nicht genannt worden. Die Aufteilung der Ämter und Abteilungen nach Fachbereichen (Kitas, Jugendzentren, Jugendverbände, Stadtteilkultur, Erziehungshilfe, Beratung, Bildung usw.) erschwere die Durchsetzung stadtteilbezogener Konzepte. Allerdings seien Bündnisse zwischen Leitungskräften des Jugendamts und RatspolitikerInnen zu beob158 5.4 FREMDSICHT AUF DIE KOOPERATION DER AG KINDER- UND JUGENDARBEIT achten, die zwar die Durchsetzung stadtweiter Vorhaben begünstigten, aber die Positionen von Bezirksräten und Fachleuten vor Ort schwächten. 5.4.3 Erwartungen an die sozialen Fachleute Alle Interviewten erwarteten, dass die AG Ansprechpersonen benennt und direkte Kontakte herstellt. „Ja, das ist ganz wichtig, daß man nicht ständig mit wechselnden Partnern zu tun hat, weil das kriegt man dann irgendwann nicht mehr auf die Reihe, wenn man da nicht direkt wohnt und das ständig miterlebt“ (E6, 9). Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit bedeute, dass Absprachen und Informationen auch weitergegeben würden und für die AG insgesamt gelten müssten. „Und es müßte auch ’ne verbindliche Rolle für so ’n Sprecher geben oder wie soll ich den nennen, der ’ne bestimmte Rolle der Innen- und Außenvertretung übernimmt. Den man wirklich ansprechen kann und sicher sein kann, daß er bestimmte Sachen auch wirklich weiterträgt“ (E1, 9). Konkret wünschten die BezirksratspolitikerInnen eine Teilnahme von Fachleuten vor Ort an Bezirksratssitzungen. Ein Grund dafür war die Erfahrung, dass die Kontakte in der Mehrzahl lediglich in Verbindung mit Finanzanträgen erfolgten und eine kontinuierliche Zusammenarbeit fehlte. „Ich wünsche, daß ein Vertreter der AG die Bezirksratsitzungen auch bis zum Ende mitmachen würde, um das umfassende Arbeitsfeld zu verstehen und einzuschätzen ... Hilfreich wäre auch, wenn dann mehr Offenheit entsteht, auch ein bis zweimal im Jahr eine Einladung an uns auszusprechen und Mitglieder des Bezirksrates über die Arbeit zu informieren“ (E2, 3). Besonders die BezirksratspolitikerInnen erwarteten von den Fachleuten, dass sie die soziale Lage präzise einschätzen und, entgegen den Anweisungen der Organisationen, diese im Stadtteil auch äußern und Vorschläge machen sollten, wie darauf reagiert werden kann. „Und was wirklich wichtig ist, in sozialen Brennpunkten ist es notwendig, die Probleme nicht aufhäufen zu lassen. Soziale Dienste sind angehalten, rechtzeitig die Politiker über Entwicklungen zu informieren, sie müßten erkennen und informieren, wenn sich Konflikte zuspitzen“ (E2, 3-4). Persönliche Kontakte zu PolitikerInnen wurden für unerlässlich gehalten, aber anders als die BezirksratspolitikerInnen, die die Arbeit der Einrichtungen aufgrund des Einblicks im Alltag einschätzen können, erwarteten RatspolitikerInnen auch kollektive Absprachen im Stadtteil, dass zunächst eine 159 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG Vernetzung stattfindet, damit Anträge erst nach Abstimmungsprozessen und Konsenssuche eingereicht werden. „Also ein Antrag, der nur als Antrag hereinkommt, da kann die Arbeit noch so gut sein, der wird meistens nicht beachtet ... (Erwartet wird) ... daß Kontakte hergestellt wurden, daß man über dieses Projekt auch schon mal geredet hat, daß in dem Stadtteil selbst eine Akzeptanz dafür da ist. Wenn z.B. Stadtteilforen oder Kinder- und Jugendforen im Stadtteilen existieren, daß sich diese Foren damit beschäftigt haben und das unterstützen. Also nur einfach Geld, weil wir brauchen in dem Stadtteil was, die Zeiten sind vorbei“ (E6, 6). Die Leitungskräfte erwarteten, dass die AG ihre Kritik aufnehmen und diskutieren möge. Sie beklagten, dass sie keinen generellen Zugang zur AG haben und ihre Kritik oder Vorschläge bislang wenig Resonanz fanden. Eine Ebene für die Auseinandersetzung fehle, es bedürfe „... mehr Akzeptanz und Wohlwollen. Daß es Widersprüche gibt oder auch Streit gibt, zu bestimmten Einschätzungsfragen, da hab ich keine Probleme mit. Aber allein die Tatsache, wenn ich mich strittig stelle, gleich in eine Ecke gestellt zu werden, als des Nicht-Kooperativen, das find ich recht schwierig. Und da ist manchmal für mich der Schritt sehr weit, von dort nach hier (vom Stadtteil zur Zentrale) und umgekehrt“ (E4, 9). Gemeinsam erwarteten Leitungskräfte und PolitikerInnen von der AG eine selbstkritische Haltung und Beweglichkeit, um die Ideen und Vorhaben aus dem Stadtteil auch an gesamtstädtische Planung anzupassen. „Diesen kritischeren Blick auf das, was im Stadtteil getan wird, zuzulassen, und sich auch gegenseitig stärker zu hinterfragen und auch mutig sein, neue Entscheidungen zu treffen, zu sagen, wir lassen das und machen dafür etwas anderes“ (E3, 11). Aber die AG erhält umgekehrt keinen Zugang zu den Diskussionsebenen der Amts- und Abteilungsleitung im Jugendamt. So haben ihre VertreterInnen keine Möglichkeit, Einfluss auf gesamtstädtische Planungen zu nehmen. Diese strukturelle Ausgrenzung nahmen Leitungskräften nicht als problematisch wahr. Den Fachleuten vor Ort wurde allgemein zwar zugestanden, ihre Kompetenzen, ihr Wissen in die Planung für den Stadtteil einzubringen, aber ohne verbindliche Funktion. Allerdings erhoffte man sich von neuen Vorschlägen der AG auch eine Umverteilung der Fachkräfte und Finanzen. Von der gegenteiligen Erfahrung berichteten die Leitungskräfte: Sie würden überwiegend mit neuen Anträgen und Forderungen konfrontiert, deren Berechtigung sie durchaus einsähen, allerdings müssten sie mit begrenztem Budget haushalten. 160 5.4 FREMDSICHT AUF DIE KOOPERATION DER AG KINDER- UND JUGENDARBEIT „Ich finde, daß das, was wir mit der Jugendhilfeplanung verbinden, nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz, nämlich Bestand, Bedarfe, Maßnahmen, in diesem Dreischritt, das sollten wir stärker im Blick behalten. Aber nicht nur mit dem Aspekt wir brauchen noch dies und wir brauchen noch das, sondern auch zu gucken, worauf können wir verzichten? Können wir Ressourcen umschichten, umlagern, weil es sich überholt hat, um etwas, was nicht ohne weiteres finanzierbar ist, dann doch zu ermöglichen“ (E3, 8). Einerseits wurde stadtteilbezogene Jugendhilfeplanung von RatspolitikerInnen und Leitungskräften als sinnvoll angesehen, andererseits war die Frage, wer erarbeitet und aktualisiert die Stadtteilanalysen? Hier erwarteten RatspolitikerInnen eine höhere Fachkompetenz von den AG-TeilnehmerInnen, aber auch von Leitungskräften. „Ich denke, daß die großen Stadtteile zwischenzeitlich so komplex sind, daß es so etwas wie eine Stadtteiljugendhilfeplanung geben muß. Und da wären die Partner dann gefragt. Aber es gibt nicht diese verbindliche Organisationsform bisher. Es hat manchmal eher den Anschein, auch wenn ich es manchmal mit anrege, daß dann etwas aufgegriffen wird, was sicherlich bedarfsorientiert ist, aber es ist nicht unbedingt immer so systematisch. Ich glaube auch, daß die Stadtteilanalysen nicht systematisch fortgeschrieben werden“ (E3, 8). Die Positionen zur Kinder- und Jugendhilfe und die von den Interviewten formulierten Erwartungen sind deutlich zu erkennen. Dabei lassen sich viele Gegensätze feststellen, ohne dass erkennbar wäre, wie es zu Diskussionen, Aushandlungsprozesse und Vereinbarungen kommen könnte. Von PolitikerInnen und Leitungskräften der Verwaltung wurden drei wesentliche Punkte von der „AG Kinder- und Jugendarbeit Vahrenheide“ erwartet bzw. gewünscht, die von den AG-TeilnehmerInnen kommentiert wurden: 1. Direkten Kontakt aufnehmen und Ansprechperson benennen • „Ich verstehe die Kritik nicht, es gibt eine Kontaktadresse für die AG.“ • „Wenn die Fachleute aus dem Jugendamt erwarten, daß Anfragen innerhalb einiger Tage oder in einer Woche bearbeitet werden, dann geht das so nicht. Unser Tagungsrhythmus ist monatlich.“ • „Und die AG ist nicht in den Verwaltungsablauf eingebunden. Hier kann die Erwartung der Hierarchie nicht erfüllt werden.“ • „Die AG vertritt verschiedene Träger mit Interessen (Geld, Stellen usw.).“ • „Die Koordination der freien Träger ist eine andere Sache als nur die Rückmeldung von Verwaltungsstellen.“ 161 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG • „Die Hierarchie will häufig einfach Aufgaben delegieren und nicht darüber reden.“ • „Die Zusammenarbeit hängt von Personen ab, von der konkreten praktischen Arbeit. Unkorrekt und inkompetent sollten Leitungs- und Entscheidungskräfte auch nicht sein.“ • „Mit dem Bezirksrat zusammen zu arbeiten ist in Ordnung und weniger problematisch“ (V12, 3-4) Die nächste Erwartung löste in der AG eine allgemeine Heiterkeit aus. 2. Neue Aufgaben bewältigen, ohne neue Finanzen zu fordern • „Ja, das können wir uns gut vorstellen, daß die das erwarten.“ • „Gehört dazu auch, Altes aufzugeben oder soll Neues zusätzlich kommen?“ • „Manches an Aufgaben ist vielleicht nicht mehr zeitgemäß, da kann ich verstehen, neue Aufgaben zu entwickeln und zu übernehmen.“ • „Oft sollen wir (städtische MitarbeiterInnen) nur die Ideen der Abteilung umsetzen.“ • „Es fragt keiner, ob wir auch inhaltlich dahinter stehen können.“ • „Wir sollen auch an Wochenenden arbeiten.“ • „Dann wird Druck gemacht, damit wir Neues übernehmen.“ • „Oft wird das auf Biegen und Brechen durchgesetzt.“ • „Damit in der Öffentlichkeit ein gutes Bild entsteht.“ • „Von Oben wird etwas angewiesen und Prioritäten setzen muß jede/r für sich.“ • „... dabei wäre eine Unterstützung durch die Leitung gut.“ • „In den Heimen haben wir das schon hinter uns. Die Großheime wurden aufgelöst und es mußten für weniger Geld die gleichen Aufgaben und noch neue dazu angeboten werden (ambulante Hilfen, bedarfsorientiert usw.).“ • „Das ist damals von den Heimleitern umgesetzt worden, die waren aber in den Einrichtungen vor Ort, also selbst betroffen.“ • „Es sollen kleine Jugendtreffs angeboten werden, neue Konzepte werden erwartet.“ • „Oft wird auch die eigene Existenz bedroht und mit Schließung der Einrichtung gedroht, das ist fast schon Erpressung” (V12, 5-6). Die MitarbeiterInnen sprachen ein Problem an, das die alltägliche Arbeit beeinflusst und es schwieriger macht, zusätzliche Aufgaben zu überneh162 5.4 FREMDSICHT AUF DIE KOOPERATION DER AG KINDER- UND JUGENDARBEIT men, weil die Spielräume enger werden - wie bei Budget, Ausstattung und Personal. • „Neue Mitarbeiter werden häufig nur auf Zeit eingesetzt.“ • „Teambildung ist kein Thema, obwohl es in bestimmten Arbeitsfeldern besonders wichtig wäre, ein gut eingespieltes Team zu haben.“ • „Es gibt Regeln dafür, in welchen Zeiträumen Leute wieder auf ihren Platz zurückkommen und wann andere dort eingesetzt werden können. Das dient auch der Arbeitsplatzsicherheit für Festangestellte.“ • „Das ist schon seit 1984 so.“ • „Von außen haben die Leute ohnehin keine Chance eingestellt zu werden.“ • „Das reduziert die Auswahl, neue gute Leute können nicht genommen werden.“ • „Aber der Erhalt des Arbeitsplatzes ist auch sinnvoll, das bietet Sicherheit.“ • „Es ist positiv einen Erziehungsurlaub zu nehmen oder Fortbildungen machen zu können.“ • „Aber viele arbeiten mit Zeitverträgen und wissen nicht, was sie im nächsten Monat machen.“ • „In bestimmten Arbeitsbereichen wechseln die Teams ohnehin ständig.“ • „Ob dann die richtige Kompetenz am richtigen Platz ist, ist die Frage.“ • „Es gibt auch Fälle, wo Leute wegen des Alters oder aus anderen Gründen wechseln müssen.“ • „Aber wenn das Team gut sein muß und immer wieder vier- bis sechswöchige Zeitverträge vergeben werden, häufige Einarbeitung ansteht, dann bedeutet das Streß für die anderen im Team, die vieles auffangen müssen.“ • „Neue Mitarbeiter werden häufig richtig ausgetestet.“ • „Warum kann die Auswahl nicht so getroffen werden, daß ein Team gut harmoniert?“ • „Das ist wohl Personalwirtschaft, da wird man nichts dran ändern können.“ • „Wieso haben wir jetzt so lange über Personal und Teams geredet, auf die Frage, ob wir neue Aufgaben mit gleichem Personal übernehmen würden? Man merkt eben, es drängt und drückt an ganz anderer Stelle und doch hängt beides zusammen.“ • „Die gleiche Diskussion gibt es an der Schule, dort sollen auch neue Aufgaben, bessere Angebote mit nahezu gleichem Personal angeboten werden.“ • „Man merkt, vieles ist von oben aufgesetzt und die Basis wird zur Struktur wenig gefragt” (V12, 7-8) 163 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG 3. Kritik zulassen und die Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung ausbauen Die Fachleute der AG antworteten darauf: • „Auseinandersetzung ist schön und gut, aber es braucht Zeit, sich kennenzulernen. Die Leute in Politik und Verwaltung haben verschiedene Sachgebiete oder Regionen und es kommt gelegentlich mal zu einem Treffen. Wie kann da Kommunikation laufen?“ • „Ich habe noch nie jemanden gesehen, es müßte auch das Bemühen und die Anstrengung sichtbar werden, hierher zu kommen.“ • „Beim Bezirksrat kann ich mir das gut vorstellen, sich auseinanderzusetzen, aber bei den Leitungen? Die sind nie hier.“ • „Was genau wollen die?“ • „Ich kann mich erinnern, wir haben beschlossen, daß keine Leitungskräfte hier teilnehmen sollen, das ist schon etwas her. Wir wollten unter uns sein und uns austauschen.“ • „Ich sehe nicht die Notwendigkeit, daß die hierherkommen, ist die KORunde nicht geeigneter für einen Austausch?“ (V12, 9-10) So wird einerseits über fehlendes Interesse und Auseinandersetzungen zwischen Planungs- und Handlungsebenen geklagt. Akzeptanz gibt es andererseits in der AG, wenn auch die Ideen der Fachleute vor Ort Unterstützung finden. Diese Erfahrungen sind jedoch eher selten, sodass die regelmäßige Teilnahme an den AG-Sitzungen den Leitungskräften verwehrt wird, um sich zu schützen vor Kontrolle, Anweisungen, indirekter Beeinflussung durch die Hierarchie, Fremdbestimmung der Themen und vor einer Abnahme an Offenheit und Kollegialität. Die Folge ist, dass es keinen Ort gibt, an dem Kontroversen direkt angesprochen werden. Es gibt keinen fachlichen Disput, wenn es den Stadtteil insgesamt betrifft, und die Personen stehen nicht in einer kontinuierlichen Arbeitsbeziehung. Über die PolitikerInnen herrscht Enttäuschung, weil sie sich in den Einrichtungen nicht sehen lassen, die Arbeit nicht würdigen und den Weg scheuen. „Schade, daß die sich nicht informieren, im Jugendzentrum beim 30-jährigen Jubiläum kam es ’raus, das die Verantwortlichen nicht etwa regelmäßig mal vorbeischau’n, sondern zum Teil noch nie dort gewesen sind, in 30 Jahren. Die müssen sich schon selbst ein Bild machen und vorbeikommen“ (V12, 4). Allerdings formulierten die PolitikerInnen an die Professionellen die gleiche Erwartung nach Würdigung ihrer Arbeit: Die Fachleute sollten den Weg zu den PolitikerInnen gehen, und sie sollten sich besser mit kommunalpolitischen Verfahren vertraut machen. 164 5.4 FREMDSICHT AUF DIE KOOPERATION DER AG KINDER- UND JUGENDARBEIT 5.4.4 Zusammenfassung des Fremdbildes Leitungskräfte möchten mit ihrem Wissen die Fachleute der AG Kinderund Jugendarbeit beraten und unterstützen. Allerdings ist das nicht ganz uneigennützig: Die Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendbereich im Stadtteil soll im Sinne der Leitung besser funktionieren. Leitungskräfte äußern sich regelmäßig zu der Arbeit im Stadtteil. Viele Äußerungen sind missverständlich, enthalten Kritik, ohne die Zusammenhänge zu sehen oder Detailkenntnisse zu berücksichtigen. Gelegentlich werden ungebetene Ratschläge erteilt, die versteckte Kritik enthalten. Es fehlen kontinuierliche Arbeitsbeziehungen, in denen direkte Kritik geäußert werden kann, in denen an konsensfähigen Themen gearbeitet und auch Anerkennung ausgesprochen wird. Die Fachleute vor Ort haben wenig Hoffnung, dass eine partnerschaftliche Kooperation mit Leitungskräften der Verwaltung entsteht. Sie befürchten eine Vereinnahmung der Diskussionsthemen, eine stärkere Kontrolle und Formalisierung der AG-Treffen durch Vorgesetzte und damit eine Veränderung zu weniger Offenheit bei fachlicher Reflexion und kollegialem Austausch. Es gibt Erwartungen an die Leitungskräfte nach mehr Unterstützung und Anerkennung, und es gibt auch vereinzelte Erfahrungen von gelungener Kooperation. Allerdings sind dies Ausnahmen, die die Fachleute im Stadtteil von vielen Leitungskräften im Jugendamt nicht mehr erwarten. Das bedeutet, dass bereits ein großer Vertrauensverlust und ein Defizit an Vernetzung zwischen den Hierarchieebenen besteht, mit Folgen für Austausch, Diskussion, Planung und Umsetzung von Kinder- und Jugendhilfe. Insgesamt sind die Erwartungen der AG an PolitikerInnen undeutlich, weil deren Aufgaben und gesetzliche Grundlagen, deren Handlungsspielräume und Selbstverständnis nur in Ansätzen bekannt sind. Die PolitikerInnen gehen davon aus, dass die Fachleute vor Ort ihnen die nötige Informationen zukommen lassen und sich auch persönlich um Kontakte bemühen. Erwartungen der Fachleute, die PolitikerInnen könnten ihrer Arbeit Aufmerksamkeit widmen, erfüllen sich nicht. Gemeinsamkeit von Leitungskräften in der Verwaltung und PolitikerInnen ist, dass sie den Fachleuten kein Mandat für Kinder und Jugendliche zubilligen. Allenfalls als fachlich versierte Berater sollen die AG-TeilnehmerInnen Statements abgeben können, was in folgendem Zitat zum Ausdruck kommt: „Wir haben nun mal die demokratische Struktur und über die niedersächsische Gemeindeordnung festgelegte Struktur, daß es einen Rat der Gemeinde gibt und daß es angesichts der Größe der Stadt Hannover Bezirksräte gibt. Und diese 165 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG Leute, die da gewählt wurden, die sollen ihre Kompetenzen mit einbringen. Die sollen auch ein bestimmtes Spektrum der Bevölkerung widerspiegeln. Und sollen dann eigentlich in der Lage sein, für ihren Stadtteil, für ihren Bereich oder auch Gesamtstadt die richtigen Entscheidungen zu treffen“ (E7, 3-4). Die JugendpolitikerInnen im Rat müssen für alle Kinder und Jugendlichen in Hannover planen und entscheiden. Hier sind Themen sehr allgemein gehalten, Details verschwimmen, und es stürzt eine Fülle von Informationen auf die Einzelnen ein. Kontakte entstehen in besonderen Situationen, wie etwa bei Podiumsdiskussionen, Protesten und Demonstrationen, medienwirksamen Aktionen und stadtweiten Projekten sowie den üblichen Jubiläen und Eröffnungen. Absprachen und Beschlüsse mit kurzer Abstimmung zwischen Verwaltungsleitung und PolitikerInnen nehmen zu und führen zu Konflikten bei der Umsetzung, weil Fachleute vor Ort nicht rechtzeitig und umfassend in Planungen einbezogen werden und sich Planungen häufig nicht auf die kleinräumigen Erfordernisse beziehen. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bleibt häufig auf Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit begrenzt. Stadtweite Planungsansätze und modellhaftes Vorgehen nimmt auf stadtteilbezogene Ansätze keine Rücksicht, insbesondere wenn dadurch auch repräsentative Funktionen miterfüllt werden sollen. Die BezirksratspolitikerInnen stimmen in weit mehr Punkten mit den Fachleuten im Stadtteil überein als die RatspolitikerInnen. Das betrifft die Analyse sozialer Probleme und die erforderlichen Maßnahmen, auch die Erfahrung, viele gute Ideen aus den Stadtteilen nicht verwirklichen zu können und in Konkurrenz zu stadtweiter Planung zu geraten. Erwartet werden von der AG Äußerungen unabhängig von offiziellen Verlautbarungen über die Lage von Kindern und Jugendlichen und Informationen über die Erfordernisse der alltäglichen Arbeit, weil vielfach die offizielle Verwaltungsmeinung eine geschönte Version des Bedarfs an Kita-Plätzen, Personalausstattung, Jugendzentren oder Öffnungszeiten von Einrichtungen wiedergibt. Allerdings sind BezirksratspolitikerInnen nicht nur für einen, sondern für alle Themen in fünf Stadtteilen zuständig, sodass der Jugend- und Sozialbereich zeitweise zurückstehen muss. Üblicherweise haben die organisierten BürgerInnen aus Parteien, Vereinen und Verbänden als potenzielle WählerInnen bessere Chancen ihre Ideen durchzusetzen. Die AG versucht deshalb stellvertretend die Interessen von Kindern und Jugendlichen aus dem Armutsstadtteil, die selten in Vereinen organisiert sind, vorzutragen. Deshalb werden die drei zentralen Erwartungen der Interviewten Teil zukünftiger Auseinandersetzung sein: 166 5.4 FREMDSICHT AUF DIE KOOPERATION DER AG KINDER- UND JUGENDARBEIT • Direkten Kontakt aufnehmen und Ansprechpartner benennen. • Kritik zulassen und Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung ausbauen. • Neue Aufgaben bewältigen durch Umschichtung und ohne zusätzliche Finanzen. Selbstorganisierte Runden werden sich in Zukunft mit einer durch stetige Haushaltskonsolidierungen und Reformprozesse gewandelten Kommunalpolitik auseinandersetzen müssen, die das Verhältnis von Verwaltung, Ratspolitik, Bezirksratspolitik und Fachleuten im Stadtteil sowie zu anderen Disziplinen verändern wird. Es wird bedeutsam werden, sich der konsensfähigen Positionen zu vergewissern und je nach Thema oder Projekt Bündnispartner zu suchen, was Folgen für das Binnengefüge der Selbstorganisation haben wird. Tabelle 22: bei Analyse, Planung und Umsetzung Konsensfähigkeit von Positionen und mögliche Bündnisse AG Kinderund Jugendarbeit Bezirksrat Ja Ja LeitungsRat der Stadt kräfte des Jugendamtes Bündnis mit Bezirksräten Kompetenz in der Stadtteilperspektive Kompetenz in der Stadtperspektive Projekte aus Berufspraxis entwickeln Ja Ja Offizielle Anerkennung gewünscht Ja Ja AG macht Beratung für Politik Ja Ja Ja Ja Nein Nein 167 5. ERGEBNISSE DER PRAXISFORSCHUNG bei Analyse, Planung und Umsetzung AG Kinderund Jugendarbeit Bezirksrat Finanzanträge der AG direkt an Politik stellen Ja Ja Nein, Hierarchien einhalten Ja, aber mit Verwaltung abstimmen Nein Nein Ja Ja Ja Teilweise Vorhandene Mittel umschichten LeitungsRat der Stadt kräfte des Jugendamtes Bündnis mit Leitung Spezifisches Fachwissen zur Jugendhilfe Ja Bündnis mit Leitung/Politik Praxiserfahrung in Planung einbeziehen Ja Ja Ja, aber mit Ja, aber mit Entscheidungs Entscheidungs vorbehalt vorbehalt Kinder und Jugendliche beteiligen Ja Ja Ja, aber mit Ja, aber mit Entscheidungs Entscheidungs vorbehalt vorbehalt Beschlüsse, neue Modelle etc. umsetzen Bedingungen und Folgen für Praxis prüfen Enthaltung Ja Ja Urheberschaft hat Bedeutung für Förderung Nein, es zählt Ergebnis und Gruppenleistung Ja Ja Ja AG ohne Bündnispartner 168 5.4 FREMDSICHT AUF DIE KOOPERATION DER AG KINDER- UND JUGENDARBEIT bei Analyse, Planung und Umsetzung AG Kinderund Jugendarbeit Bezirksrat LeitungsRat der Stadt kräfte des Jugendamtes AG hat Mandat für Kinder und Jugendliche Ja Nein Nein Nein Kinder/ Jugendl. Entscheidungen überlassen Ja Nein Nein Nein Zukünftig wird es darum gehen, Entscheidungsprozesse so zu entwickeln und komplexe Problemfelder so zu bearbeiten, dass die verschiedenen Planungs- und Handlungsebenen, nicht nur trägerbezogen, sondern mit Bezug auf das Verhältnis von Stadtteilen und Gesamtstadt berücksichtigt werden. Ebenso sind zur Sozialplanung die konkurrierenden Fachgebiete, wie Ordnungspolitik, Stadt- und Grünplanung, Verkehrsplanung, Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung einzubeziehen. Das wird eine Öffnung der AG für andere Professionen erfordern. Wichtig wird es auch sein, die Abstimmungsprozesse in den Stadtteilen stärker zu fördern und nicht einzelne Vorhaben von Schulen, Wohlfahrtsverbänden oder Jugendamt zum Nachteil einer Gesamtplanung durchzusetzen, auch wenn nicht alle mit diesen Prozessen einverstanden sind. Deshalb ist zu fragen, bei welchen Themen die Fachleute vor Ort Bündnispartner finden können. 169 6. Vergleich der Ergebnisse mit der Fachliteratur 6.1 NETZWERKEN ALS HANDLUNGSFORM SOZIALER ARBEIT In den letzen 30 Jahren haben sich Arbeitsgemeinschaften, Foren, Stadtteiloder Kooperationsrunden als besondere Form der Zusammenarbeit von Fachleuten der Sozialen Arbeit in vielen Städten und Gemeinden der Bundesrepublik etabliert. Die Handlungsform, Berufstätigkeit zusätzlich in einer Selbstorganisation mit selbstgesetzten Prioritäten zu vernetzen, steht im Spannungsverhältnis zu den offiziellen Strukturen von Kommunalverwaltung und Wohlfahrtsverbänden sowie zur funktionalen Umsetzung des offiziellen Auftrags. Dennoch erhalten die vielfachen Formen der Selbstorganisation Bedeutung für professionelles Handeln und werden inzwischen als selbstverständlicher Teil von stadtteil- und gemeinwesenorientierter Sozialer Arbeit angesehen. Soziale Bewegungen der 60er Jahre können als Vorbild dieser Handlungsform gelten. Soziale und politische Protestbewegungen in der Bundesrepublik führten, anders als die Bürgerrechts- und Friedensbewegung der 50er60er Jahre zu einer Veränderung der politischen Kultur, die über die Öffentlichkeit hinaus auch das Alltagsleben beeinflusste (vgl. Geiling 1996). Die Herrschafts- und Zivilisationskritik wirkte verändernd auf die Konzepte und das Selbstverständnis von Fachleuten in der Bildungs-, Kulturarbeit, Stadtentwicklung und in der Sozialen Arbeit (vgl. Glaser 1991, 346f.). Daraus entstanden Erwartungen der Fachleute an die gesellschaftlichen Organisationen, mehr Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung bzw. Authentizität, mehr Partizipation an Entscheidungsprozessen und soziale Gerechtigkeit zu erreichen und dafür neue Lebensweisen in der Politik, im Beruf und Privatleben zu erproben. Die Zusammenschlüsse von Fachleuten Sozialer Arbeit lassen sich in dieser Tradition betrachten und ihre Kontinuität scheint einen fachlichen Bedarf aufzuzeigen, der in den Organisationen Sozialer Arbeit nicht erfüllt wird. Auf den ersten Blick ist es nachvollziehbar, dass ein trägerübergreifender fachlicher Austausch, gegenseitige Information über Arbeitsinhalte und Angebote sowie abgestimmte Projektentwicklung es möglich machen, Ressourcen in einem gemeinsamen Arbeitfeld sinnvoller einzusetzen. Ungeklärt bleibt, dass viele notwendigen Aufgaben Sozialer Arbeit außerhalb von Organisationen und parallel zu offiziellen Aufträgen oder Arbeitszei170 6.1 NETZWERKEN ALS HANDLUNGSFORM SOZIALER ARBEIT ten stattfinden müssen. Damit bleibt ein latentes Spannungsverhältnis zwischen Selbstorganisation und offizieller Organisation bestehen, das auf Prozesse und Ergebnisse beruflicher Tätigkeit einwirkt. Inzwischen hat sich auch in Wohlfahrtsverbänden und Stadtverwaltungen der fachliche Standard durchgesetzt, dass Formen der Vernetzung die Qualität Sozialer Arbeit erhöhen können, insofern erhalten selbstorganisierte Runden Ergänzung und Konkurrenz durch organisationsbezogene Vernetzung (vgl. Bassarak 1997). Forderungen nach mehr Vernetzung der Fachleute werden über Bundesprogramme z.B. zur Sozialen Stadt (vgl. www.sozialestadt.de), durch gesetzliche Vorgaben z.B. im Kinder- und Jugendhilfegesetz (vgl. Münder 1998) festgelegt oder durch kommunalpolitische Beschlüsse bei der Finanzvergabe vorgegeben. Messner führt die Zunahme von Netzwerken zur Bearbeitung von Problemlagen zurück auf die Steuerungsprobleme zwischen Staat und Markt aufgrund der Komplexität und Eigendynamik der Vielzahl von staatlichen, privaten und intermediären Trägerschaften (vgl. ebd., 2000). Zu den neuen Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe gehört u.a. die Entwicklung von Beteiligungsformen für Kinder und Jugendliche, um deren Wünsche und Bedürfnisse in die kommunale Jugendhilfeplanung einzubeziehen. Andere Forderungen von PädagogInnen, SozialarbeiterInnen und PlanerInnen gehen darüber hinaus und weisen auf eine Beteiligung an Stadtentwicklungsplanung hin (vgl. Stange 1997; Bürgerbüro Stadtentwicklung 1997). Um diesen Anforderungen zu entsprechen, wird einerseits eine Kooperation von Fachleuten verschiedener Organisationen verbindlich geregelt, z.B. mit Arbeitsämtern, Schulen, Handwerkskammern, Polizei und Justiz. Andererseits entwickeln Fachleute durch Eigeninitiative vergleichbare Kooperationen. Bei den Forderungen nach mehr Vernetzung ist nicht immer deutlich zu erkennen, welche Form gemeint ist und welche Ziele damit verfolgt werden. In dieser Praxisforschung äußerten Leitungskräfte der Stadtverwaltung und VertreterInnen anderer Organisationen, z.B. der Schulen oder der Polizei, eine bessere Vernetzung sei im Stadtteil erforderlich. Diese Annahme einer nicht ausreichenden Vernetzung konnte die Untersuchung für die Sozialen Fachkräfte im Stadtteil nicht bestätigen, denn diese waren gut miteinander verbunden, wohl aber fehlten kontinuierliche Verbindungen zu anderen Fachleuten und den Entscheidungsträgern. Diese Einseitigkeit in Kooperationen hat auch schon Kähler in einer Untersuchung festgestellt. Der Umgang mit BerufskollegInnen gestaltet sich schwieriger, wenn die Zuord171 6. VERGLEICH DER ERGEBNISSE MIT DER FACHLITERATUR nung der Aufgaben uneindeutig ist oder externe Kräfte angesprochen werden müssen. Auch mit fachfremden, statusniedriger oder statushöher gestellten Fachleuten arbeiten soziale Fachkräfte deutlich verunsichert oder erschwert zusammen. Beziehungen im Hilfesystem Sozialer Arbeit sind nicht nur personenabhängig, sondern funktionsabhängig in der jeweiligen Institution oder Organisationen zu sehen, wobei die Differenz zwischen eigener und fremder Funktion und den zugeordneten Aufgaben die Kooperation behindert (vgl. ebd., 1999). Die unterschiedlichen Ansprüche an Vernetzung und die damit verbundenen Strukturen und Interessen fanden einen sprachlichen Ausdruck. Mit den gewählten Begriffen für Kooperation wurden jeweils andere Inhalte verbunden. während die Fachleute im Stadtteil von „Zusammenarbeit“ sprachen, benutzten PolitikerInnen und Verwaltungsleitung die Bezeichnung „Vernetzung“. Die TeilnehmerInnen der AG beziehen Zusammenarbeit auf konkrete Maßnahmen, wie das Organisieren von Projekten, Ferienfahrten oder Freizeitaktivitäten. Leitungskräfte verstanden den Bedarf an Vernetzung vorwiegend in der Zusammenarbeit zwischen MitarbeiterInnen und der Planungs- bzw. Entscheidungsebene. PolitikerInnen sahen die Notwendigkeit des Zusammenwirkens verschiedener Verwaltungsebenen, um Beschlüsse kurzfristig und effektiv umzusetzen. Vielfach überdeckte der Begriff Vernetzung wichtige Fragen nach Handlungsformen, Themen, Zielen und den Graden der Beteiligung an Entscheidungsprozessen. Insbesondere die Fachleute im Stadtteil legten Wert auf eine Differenzierung, um ihre Selbstorganisation vor einer Vereinnahmung durch andere Interessen zu schützen. In der Untersuchung waren mehrfach Versuche der Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung festzustellen, die selbstorganisierten Netzwerke für eigene Interessen nutzbar zu machen. Damit war nicht nur der Wunsch verbunden Steuerungsfähigkeit zurückzugewinnen, sondern auch Einblick in den Lebensalltag der Bevölkerung zu erhalten. Die Einflussnahme erfolgte über Kontrolle von Arbeitszeiten und Finanzen, Dienstanweisungen und Aufträge, Einmischung in interne Debatten und Absprachen, negative Statements gegenüber anderen Entscheidungsträgern, Kooperationsangebote an Einzelne. Ein Vergleich mit der Fachliteratur zeigt, dass die Begriffswahl keine unnötige Spitzfindigkeit ist, denn damit kommen theoretische und konzeptionelle Differenzen zum Ausdruck, wie folgendes Zitat wiedergibt: „Das Unbehagen der Beschäftigten im Sozialsektor mit dem aktuellen Vernetzungsdiskurs rührt daher, daß alle spüren, daß die ökonomisch motivierte Ver- 172 6.1 NETZWERKEN ALS HANDLUNGSFORM SOZIALER ARBEIT netzung ein Instrument ‚systemischer Rationalisierung‘ ist, ... Vernetzte Systeme mit Effizienzfokus lassen nicht mehr jede Kommunikation zu, ... denn durch die Etablierung ‚wettbewerblicher Anreiz- und Sanktionsmechanismen‘ werden fachspezifische Inhalte und Motive schnell ‚irrational und zu Störfaktoren‘“ (Dahme 2000, 66-67). Folgt man der Definition von Merchel bedeutet Vernetzen, den Austausch unterschiedlicher Konzepte und das gemeinsame Bemühen um Herstellung einer trägerübergreifenden Arbeitsbasis, wobei Konflikte in kooperativer Weise geregelt werden (vgl. ebd. 1989, 18). Dieses weite Verständnis von Vernetzung findet bei vielen Beteiligten Zustimmung und wirkt gelegentlich konsensbildend, weil so Zustimmung zur „Verbesserung der Vernetzung“ signalisiert werden kann. Die Realität bleibt hinter dem Symbolgehalt solcher Äußerungen jedoch zurück, Interessenskonflikte bleiben bestehen und werden nicht offengelegt und Spannungsverhältnisse lassen sich nicht genügend konturieren. Zur Analyse der Forschungsergebnisse bietet die Definition der Netzwerke von Kardorff mehr Raum für Differenzierungen, wenn das „Gewebe sozialer Verbindungslinien zwischen Personen als soziales Netzwerk“ bezeichnet wird und die Merkmale dieser Beziehungen als Grundlage zur Interpretation des Sozialverhaltens herangezogen werden. Dabei sind weniger die formellen, sondern die informellen Beziehungen gemeint, um ihre Strukturen, Abläufe und Wirkungen sichtbar zu machen (vgl. ebd., 1995). Zur analytischen Betrachtung von Zusammenarbeit bzw. Vernetzung scheint darüber hinaus die Einführung der Begriffe „Netzwerk“ und „Bündnis“ (vgl. Holland-Cunz, 1998.) hilfreich, um kontinuierliche und thematisch umfassende von zeitlich und thematisch gegrenzten Kooperationen abzugrenzen. Dadurch werden die Funktionen in den beiden Arbeitsformen deutlicher getrennt und Hinweise auf widersprüchliche Anforderungen gegeben, die das Binnenverhältnis von selbstorganisierten Runden spannungsreich belasten können, wenn sich beides überschneidet. Die im Forschungsprojekt herausgearbeiteten vier Typen von Netzwerken in spiegeln die Unterschiede der Strukturen wider und weisen damit auf die Folgen bei der Aufgaben- und Funktionswahrnehmung sowie den Rollen der TeilnehmerInnen hin. Die Netzwerke können trägerintern oder trägerübergreifend gestaltet sein: (1) organisationsinternes Netzwerk für Austausch (2) organisationsübergreifendes Netzwerk für Austausch und Aktionen (3) selbstorganisiertes Netzwerk für Austausch 173 6. VERGLEICH DER ERGEBNISSE MIT DER FACHLITERATUR (4) selbstorganisiertes Netzwerk für Austausch und Aktionen Die Strukturen und Regeln in organisationsbezogenen Netzwerken (1. und 2.) werden von der Eigengesetzlichkeit der Organisationen (Auftrag, Geschichte, Tradition, Hierarchie, Legitimation usw.) und deren Entscheidungsträgern maßgeblich bestimmt. Soziale Arbeit ist weitgehend in öffentlicher Verwaltung eingebunden oder auf Wohlfahrtsverbände bzw. vergleichbare Organisationen delegiert und unterliegt dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit (vgl. Art. 20 Abs. 3 GG). Die Fachleute der Sozialen Arbeit vor Ort haben darauf, wenn überhaupt, nur einen geringen Einfluss. Ihnen wird die Funktion zugewiesen, Aufgaben mit bestimmten Handlungsformen zu erfüllen. Stärke dieser Struktur ist eine Zusammenarbeit, die in Abwägung zwischen öffentlichen und individuellen Interessen Gesetze, Verordnungen und politische Beschlüsse nach Maßgabe von Satzungen und Richtlinien umsetzt. Dabei wird eine gleichmäßige Verteilung von Ressourcen berücksichtigt, deren pflichtgemäße Abwicklung die Berücksichtigung von einheitlichen Verwaltungsverfahren und die Dokumentation von Verwaltungsakten garantiert (vgl. Böttcher, 1980). Zur Handlungslogik von Organisationen gehört nicht die Selbstorganisation als Handlungsform (3. und 4.). Das bietet Anlass für permanente Spannungen. Selbstorganisierte Netzwerke der Sozialen Arbeit bieten einzelnen Mitgliedern die Möglichkeit der Rollenerweiterung parallel zur Organisation. Die Regeln der Zusammenarbeit werden auf die Personen und die Aufgaben hin orientiert. Leitmotiv der Zusammenarbeit ist die gegenseitige Sympathie und ein vergleichbares Berufsverständnis, dadurch werden nicht alle gleichermaßen angesprochen und in Aktivitäten einbezogen. Doch es können Spontanität, Kreativität, Einfallsreichtum und Engagement angeregt und in die Arbeitsvollzüge integriert werden. Die Bereitschaft Risiken einzugehen und Verantwortung zu übernehmen, sogar unbezahlte Mehrarbeit zu leisten, um neue Ideen zu erproben ist nachweislich höher, als innerhalb der Organisationen. Zusammenfassend weisen die Ergebnisse auf einen gravierenden Unterschied hin, der in der Fachliteratur nicht weiter differenziert wird, da Netzwerkanalysen bislang überwiegend informelle Beziehungen untersuchten: Selbstorganisierte und organisationsgebundene Strukturen von Vernetzung in der Sozialen Arbeit unterscheiden sich wesentlich durch Verteilung von Entscheidungskompetenzen, die Zusammensetzung der TeilnehmerInnen sowie durch ihre Ziele, Funktionen, Regeln, und Arbeitsweisen, die jeweils andere Handlungslogiken hervorbringen. Dieser Unterschied wird in der 174 6.1 NETZWERKEN ALS HANDLUNGSFORM SOZIALER ARBEIT Fachliteratur nicht weiter differenziert, da Netzwerkanalysen überwiegend informelle Beziehungen untersuchen und weniger formelle Beziehungen als Vergleich heranziehen (vgl. Kardorff 1995). Die Selbstorganisation von Fachkräften der Sozialen Arbeit kann Verstöße gegen Regeln der Organisation in folgenden Fällen bewirken: (1) Fachkräfte nehmen an selbstorganisierten Treffen zu dienstlichen Themen teil, häufig ohne Einverständnis oder Absprachen mit der Organisation; (2) sie formulieren Kritik an Verfahren oder Entscheidungen der sozialen Organisationen und wenden sich damit direkt an die Politik und Öffentlichkeit; (3) sie beanspruchen ein politisches Mandat für bestimmte Bevölkerungsgruppen und führen direkt Gespräche und Verhandlungen mit PolitikerInnen. Damit widersetzen sich die Fachkräfte der Sozialen Arbeit der Logik von Verwaltungshandeln, das Lebensbereiche der Menschen aufteilt und sämtliche Tätigkeiten nach Richtlinien oder Weisungen geordnet und gestaltet werden. Sie stellen dem Verwaltungshandeln eine Logik der sozialpädagogischen und sozialarbeiterischen Intervention entgegen, die Lebensbereiche aufgrund eines anderen Menschenbildes als Gesamtheit belässt sowie Kommunikation und Interaktion anderen Regeln zuordnet und damit einen anderen Stellenwert beimisst. Einerseits wird dieses Vorgehen von Entscheidungskräften geduldet und Erfolge in der Sozialen Arbeit stillschweigend akzeptiert, andererseits werden Dienstanweisungen ausgesprochen und Abmahnungen erteilt. Eine Ambivalenz der Handlungslogiken bleibt bestehen, wenn Fachleute in Organisationen, insbesondere Kommunalverwaltungen eingebunden sind, Verwaltungshandeln unterliegen, aber gleichzeitig als soziale Fachkräfte professionell handeln und dabei fachliche Standards berücksichtigen wollen. Eine Vernetzung dieser beiden Strukturen bereitet erhebliche Probleme und ruft Irritationen, Ängste und Widerstände bei den Beteiligten hervor und stellt die Handlungs-, Interventions- und Steuerungsfähigkeit von Organisationen bezogen auf den Lebensalltag der Menschen in Frage. Einen weiteren Aspekt, nämlich eine Tendenz zur Gesprächs- statt Handlungsorientierung gibt Hinte zu Bedenken. Er hinterfragt das Selbstverständnis und die Arbeitshaltung von Fachkräften der Sozialen Arbeit in Organisationen und meint: „Durch falsch verstandene Vernetzung wird die Kluft zwischen Bürokratie und Lebenswelt weiter vergrößert“ (ebd. 1997, 175 6. VERGLEICH DER ERGEBNISSE MIT DER FACHLITERATUR 12). Er sieht ein Problem darin, dass unter Vernetzung in der Verwaltungslogik lediglich die Teilnahme an Sitzungen und Gremien, das Weiterreichen von Fällen an den Allgemeinen Sozialdienst oder die gesellige Kommunikation unter KollegInnen verstanden wird. Seine Forderung richtet sich an alle Ebenen des Handelns und Entscheidens: „Verwaltung und Politik müssen – unter Rückgriff auf eine funktionierende Binnenorganisation – an ihren Rändern derart funktionieren, daß sie sich auch auf nicht vorhersehbare und klassischen Standards eher fernliegende Bedarfe einstellen und sich somit auch – für bürgerliche Maßstäbe eher komplizierten – Lebenswelten annähern können“ (ebd. 1997, 14). Diese Kritik scheint einerseits berechtigt, da die Vernetzungsstrukturen in der Sozialen Arbeit zunehmend unübersichtlicher werden. Kriterien könnten Formen der Vernetzung differenzieren und eine Einschätzung ihrer Handlungsspielräume erleichtern, andererseits bleibt die Ambivalenz der Handlungslogiken bestehen, denen Soziale Arbeit ausgesetzt ist. Eine fehlende Handlungsorientierung von Netzwerken der beruflichen Praxis, wie Hinte sie sieht, ist in der Untersuchung nicht bestätigt worden. Anschaulich wird dies durch die Darstellung des Netzwerks als Soziogramm mit Abbildungen von gewählten Kooperationen. Daraus lassen sich die Binnendifferenzierung der Selbstorganisation aufzeigen und drei Typen von Gruppierungen ableiten, die sich durch abgestufte Formen der Mitarbeit unterscheiden: (1) Neue-Netzwerk-Passive, (2) Berufserfahrene-Netzwerk-Teilaktive, (3) Berufserfahrene-Netzwerk-Aktive. Die Schwerpunkte der TeilnehmerInnen beziehen sich überwiegend auf Gesprächsorientierung (1.), Aktionsorientierung (2., 3.) oder Funktionsübernahme (3.). Die Arbeitsformen Netzwerk und Bündnis überschneiden sich hierbei. Als Vorteil hat sich die Bandbreite von Gesprächs- bis Aktionsorientierung herausgestellt und die Möglichkeit sich je nach Themenstellung neu zuzuordnen. Allerdings geraten Verantwortliche unter Druck, wenn für Aktivitäten das Personal und für politische Strategien die Unterstützung mangelt. Hier wird die fehlende Verankerung der Netzwerkarbeit im Arbeitsauftrag der Organisationen mit reservierten Zeitbudgets sichtbar. Eine deutlichere Trennung zwischen Netzwerk und Bündnis wäre zudem erforderlich, um BündnispartnerInnen außerhalb der eingespielten Runden und Arbeitskreise zu suchen. 176 6.1 NETZWERKEN ALS HANDLUNGSFORM SOZIALER ARBEIT Die Zusammenarbeit in der AG muss über die Dynamiken von Netzwerken und Bündnissen hinaus typische Großgruppenprozesse berücksichtigen, um die kontinuierliche Arbeit zu sichern (vgl. König 1996; Sader 1998). Aus der Vielzahl von Vernetzung- und Koordinationsrunden konnten Bohn u.a. Phasen der Zusammenarbeit herausarbeiten. Diese entwickeln sich von Vorbereitung, Vertrauensbildung, fachliche Kommunikation, Aufgabendefinition, Selbstverständnisklärung bis zur Vernetzung und zu weiterer inhaltlicher Ausdifferenzierung (vgl. ebd., 161). Die hier benannten Phasen waren auch in der AG Kinder- und Jugendarbeit vorzufinden. Allerdings konnte die Entwicklung nicht wie bei einem Stufenmodell mit den letzten beiden Phasen als abgeschlossen gelten. Es gab zeitweise Rückgriffe, etwa auf die Phase Vertrauensbildung, wenn neue Mitglieder hinzukamen oder es mussten Aufgaben überprüft und neu definiert werden. Gleichzeitig bestanden parallel dazu die Phasen der Vernetzung und Ausdifferenzierung fort. Für andere Runden und Arbeitsgemeinschaften bedeutet dies, dass auch langjährige Kooperationen sich so verändern, dass Rückschritte mit Wiederholung von Anfangsphasen erforderlich werden, um die fachliche Qualität der Zusammenarbeit erneut herzustellen. Daraus resultieren permanente Wechsel zwischen Erneuerung und Beständigkeit. Diese Prozesse sind für die Qualitätsentwicklung der Industrie hinreichend beschrieben (vgl. Howaldt 1993; Womack u.a. 1994) und finden in veränderter Form auch in Non-Profit-Organisationen als „double-loop-learning“ Eingang (vgl. Graeff 1996; Argyris 1997). Das „Zweischleifenlernen“ setzt voraus, ein Sachthema zu bearbeiten, die Reflexion des Prozesses mit zu bedenken und auf beiden Ebenen lern- und veränderungsbereit zu sein. In dieser Hinsicht waren viele Prozesse für die AG Kinder- und Jugendarbeit neu, und einige TeilnehmerInnen hatten den Eindruck, sich durch Reflexion von der „eigentlichen Arbeit, dem eigentlichen Tun“ zu entfernen. Dementsprechend wurde der Reflexionsprozess überwiegend nicht als Arbeit betrachtet und nur mit geringen Zeitanteilen bedacht, obwohl Reflexion von Sach- und Prozessebene zur Weiterentwicklung der Arbeit gefordert werden (vgl. Schütze 1992; Nagel 1997; Heiner 1998). Die kritische Anfrage, welche Arbeitsanteile bei einer Ausweitung von Reflexionsprozessen die Betroffenen erreichen, hat Hinte bereits problematisiert (vgl. ebd. 1997). Die AG verfügte über besondere Handlungskompetenzen bei der Projektentwicklung und -durchführung, die in anderen Organisationen erst durch Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung eingeführt wurden (vgl. Zamora u.a. 2000). Allerdings waren sich die AG-Teilnehme177 6. VERGLEICH DER ERGEBNISSE MIT DER FACHLITERATUR rInnen ihre Arbeitsschritte und vorhandene Qualitäten nicht bewusst, konnten sie daher auch kaum steuern und nicht als Fachkompetenz öffentlich vertreten. 6.2 BERUFLICHE IDENTITÄT IN NETZWERKEN UND BÜNDNISSEN Not-for-Profit-Organisationen werden von der Politik aufgefordert, durch verbindliche Verfahren die Qualität ihrer Arbeit nachzuweisen. Personaleinsatz ist insbesondere in der Sozialen Arbeit, eine wichtige Ressource. Verstärkt wird nach den erforderlichen Kompetenzen von SozialarbeiterInnen gefragt und wie sie zu vermitteln, zu aktualisieren und zu erweitern sind. Dadurch bekommt das Thema Professionalität in der aktuellen Fachdiskussion einen zentralen Stellenwert. Vernetzung stellt ein Element professioneller Sozialer Arbeit dar. Insofern sind die Ergebnisse der Untersuchung irritierend, weil sie auf ein Spannungsverhältnis hinweisen, das Handlungsspielräume einschränkt und Blockaden verursacht. Scheinbar gegensätzliche Konzepte einer Profession (symbolisiert durch die Form Selbstorganisation versus Organisation) lassen sich nicht vereinbaren. Selbstorganisierte, handlungsaktive Netzwerke dienen der Professionalität von Sozialer Arbeit, wie die Untersuchung zeigt, indem sie folgende Funktionen erfüllen: • Informationsaustausch gewährleisten • Arbeitsabsprachen koordinieren • Planung und Umsetzung von Projekten managen • Überblick behalten und rechtzeitig reagieren • Reflexion beruflicher Erfahrungen durchführen • Ansprechpartner für Betroffene, Politik und Verwaltung sein • Lobbyarbeit für Kinder und Jugendlichen eines Stadtteils übernehmen. Allerdings werden die gewählte Handlungsform und die Ergebnisse von den Organisationen, insbesondere von der Stadtverwaltung, vernachlässigt bzw. ignoriert. Eine Wertschätzung wird weder von RatspolitikerInnen noch von Leitungskräften der Verwaltung ausgesprochen. Dementsprechend ist zwar das Selbstbild von einer engagierten, fachlich versierten Arbeitsgemeinschaft vorhanden, erfährt jedoch von Externen als Fremdbild keine Bestäti178 6.2 BERUFLICHE IDENTITÄT IN NETZWERKEN UND BÜNDNISSEN gung. Was bringt nun Fachleute der Sozialen Arbeit dazu, dennoch freiwillig an monatlichen Runden teilzunehmen, sich Aufgaben zu stellen und darüber hinaus Zeit in berufliche Aktivitäten zu investieren, deren Wert von den Entscheidungskräften in Politik und Verwaltung gering geschätzt wird? Was bewirkt den Zusammenhalt und die kontinuierliche Mitarbeit? Berufliche Identität wird als Konzept beschrieben, das ein Verständnis von Selbstbildern liefern kann, die Beziehungen und Bezüge zu sich und anderen Personen also auch die Fremdbilder zu einer einheitlichen Gesamtheit zusammenbringt (vgl. Mead 1973). Veränderungen der Lebenswelten weisen auf die Notwendigkeit hin, mit zusammengesetzten Selbstbildern differenzierte und widersprüchliche Lebenserfahrungen in „Identitätskonstruktionen“ zu integrieren (vgl. Keupp; Bilden 1989). Widersprüchliche Erfahrungen müssen die TeilnehmerInnen von selbstorganisierten Netzwerken machen, wenn sie „Lobbyarbeit für Kinder und Jugendliche des Stadtteils“ umsetzen und „Ansprechpartner für Betroffene, Politik und Verwaltung“ sein wollen. Denn ein politisches Mandat wird selbstorganisierten Netzwerken offiziell weder von der Politik, noch von der Verwaltungsleitung zugesprochen, allerdings gibt es gelegentlich stillschweigende Zustimmung, wenn die Sachargumente überzeugen. Mit diesen widersprüchlichen Handlungsformen setzen sich Fachleute der Sozialen Arbeit einer permanenten Kritik aus, die Bönisch und Lösch als „doppeltes Mandat“ bezeichnen (vgl. Kreft; Mielenz 1996, 510). Derartige Interventionen können zwar durchaus erfolgreich sein, doch von Entscheidungsträgern bleibt die offizielle Zustimmung und Anerkennung der Netzwerkarbeit verwehrt und führt darüber hinaus zu Ressentiments. Das Dilemma wird verstärkt, durch die Fragen nach der Loyalität gegenüber der Organisationen als Anstellungsträger (einem Amt oder Wohlfahrtsverband) und der Legitimation von Selbstorganisation. Aufgrund dieser Bedingungen ist erklärbar, warum sich Kooperationen zwischen selbstorganisierten Netzwerken und Organisationen äußerst schwierig gestalten. Der Grad an Zugehörigkeit und Verbundenheit mit der Organisation ist mit Einstellungen verbundenen, die Teil der Identität geworden sind. Sie bieten Orientierungshilfe, Gruppenzugehörigkeit, Statuserwerb und verlangen ein an die Organisation angepasstes Verhalten (vgl. Griese 1979, 200). Die Wahl der zusätzlichen Arbeitsform „selbstorganisiertes Netzwerk“ bietet die Möglichkeit einer Distanzierung und den Spielraum für organisationskritisches Verhalten. Bei Kooperationen zwischen Organisation und Selbstorganisation müssten die Betreffenden zwischen eher verwaltungskon179 6. VERGLEICH DER ERGEBNISSE MIT DER FACHLITERATUR formen und sozialarbeitsbezogenem ggf. sozialpolitischem Verhalten wählen, das Regelverletzung und Einmischung in Politik einschließen kann (vgl. Kreft; Mielenz 1996, 232f.). In der Untersuchung wurde die Diskrepanz der fachlichen Positionen in selbstorganisierten Netzwerken und Organisationen deutlich. Eine weitgehende Vernetzung zwischen Fachleuten vor Ort und Entscheidungsträgern hätte Auseinandersetzung zur Folge, die fachliche Positionen und Interessen konflikthaft und unversöhnlich offenlegen würden. Dies könnte Einstellungen auf beiden Seiten, in stärkerem Maße als bisher, irritieren und in Frage stellen. Die Polarität der Positionen mit geringen direkten Kontakten entlastet von Identitätskonflikten, weil Selbst- und Fremdbilder (nach Mead „I and me“) nicht übereinstimmen. Hier bieten Missverständnisse die Chance der Abgrenzung zwischen Entscheidungs- und Ausführungsebene und Vorurteile helfen, das differenzierte Binnengefüge und dessen Komplexität dennoch überschaubar zu machen. Lassen sich Abgrenzungen zu PolitikerInnen noch über die Zugehörigkeit zu anderen Professionen oder durch ausgewiesene Funktionen begründen, werden Differenzierungen der SozialarbeiterInnen durch deren Einbindung in Leitungsaufgaben oder Praxisbezüge vorgenommen. Durch Schlüsselbegriffe wird deutlich, welche Bedeutung die Fachleute den Kooperationen zumessen. Leitungskräften sind „Urheberschaften der Ideen“ wichtig und TeilnehmerInnen in selbstorganisierten Netzwerken, legen Wert auf „aktive Mitarbeit an Aktionen“. Beides sind gleichsam Prüfsteine der Kooperationen, daran wird jeweils der Grad an Übereinstimmung von Positionen gemessen. Dadurch polarisieren sich soziale Fachkräfte in „zwei Welten“, einer Welt der Ideen, der Planung und Entscheidung und einer Welt des unmittelbaren Handelns, der Umsetzbarkeit in vorgegebenen Kontexten mit komplexen Interaktionen im Lebensalltag der Betroffenen. Diese „konstruierten Welten“ scheinen schwer vereinbar zu sein, wodurch die Bündnisfähigkeit selbstorganisierter Runden beeinträchtigt wird. Als Zwischenfazit bleibt jedoch die Problematik, dass auch selbstorganisierte Netzwerke das Dilemma einer „halben Profession“ abbilden, Analyse, Planung und Entscheidung von Politik und Verwaltung bleiben häufig getrennt von den beruflichen Erfahrungen der PraktikerInnen und führen zu einer Polarisierung, die in vielen Arbeitszusammenhängen bestätigt wird und thematische Bündnisse quer durch Organisationen und Selbstorganisationen erschwert. Biographische Erfahrungen und deren Einbeziehung im Berufsalltag haben für viele Fachleute der Sozialen Arbeit eine besondere Bedeutung (vgl. Tho180 6.2 BERUFLICHE IDENTITÄT IN NETZWERKEN UND BÜNDNISSEN le, Küster-Schapfl 1997, Heinemeier 1994). Motive der Berufswahl sind eng mit der Persönlichkeit verbunden, so sind vielfach Ansätze der Berufsidentität bereits vor dem Studium angelegt, die sich durch Berufswechsel, Wünsche nach Selbstverwirklichung, sozialem Aufstieg und Qualifikation in einem akademischen Beruf ausdrücken (Ackermann; Seeck 1999). SozialarbeiterInnen gemeinsam ist ein hohes Maß an Selbstbestimmung, um den Umgang, die Vorstellungen und die Optionen bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben jenseits von Geschlechtsrollen zu gewährleisten, wie Jünemann feststellte. Frauen schätzen die ökonomische Unabhängigkeit und die soziale und intellektuelle Herausforderung, während Männer zusätzlich die Selbstdarstellung, mit einer nach außen sichtbaren Erfüllung der Berufsrolle anstreben (vgl. ebd., 2000). Das Ergebnis dieser Praxisforschung bestätigt, dass dadurch Männer ansprechbarer für Funktionen innerhalb von Organisationen sind und sich eher für gesprächsorientierte, selbstorganisierte Netzwerke interessieren, die auch andere Professionen einbeziehen. Es ist anzunehmen, dass sie in organisationsbezogenen Netzwerken eher bereit sind aktivere Rollen einzunehmen. Sie suchen statusaufwertende Funktionen und in stärkerem Maße Übereinstimmung mit von außen gesetzten Erwartungen. Es ist zu vermuten, dass sie damit versuchen, den niedrigen Status der Profession auszugleichen und ihre soziale Identität zu stabilisieren. Für Frauen bieten sich identitätsstabilisierende Aspekte in einer selbstorganisierten, aktionsorientierten Arbeitsweise und in der Berücksichtigung der Geschlechterperspektive an, die von Organisationen im Berufsalltag vernachlässigt wird. So kann die personale und soziale Identität gewahrt werden, ohne sich übermäßig an Organisationen orientieren zu müssen. Für Soziale Fachkräfte insgesamt gelten Distanzierungen und flexibler Umgang mit Verwaltungsvorschriften und Bürokratie. Dagegen besitzen fall-, zielgruppen- oder stadtteilbezogene Reflexionen der beruflichen Praxis einen hohen Stellenwert, weil sie die Selbstbestimmung im fachlichen Handeln sichern. Die Bearbeitung sozialer Probleme ist auf multiperspektivische Betrachtung angewiesen, umso notwendiger ist die Analyse von Kontextbedingungen, aus denen sich Einflussfaktoren auf Wahrnehmung und Verhalten herausarbeiten lassen. Nur durch Reflexion der Perspektiven unter Einbezug der Selbstreflexion von Professionellen lassen sich „reflexive Rollendistanz“ und damit Handlungsoptionen sichern (vgl. Nagel 1997). Lebensgeschichtlich bedingte Lernprozesse an den „Schaltstellen der Sozialisation“ (vgl. Griese 1979, 189) beeinflussen Persönlichkeit und Identität von SozialarbeiterInnen in besonderer Weise. Es lässt sich von einer „bio181 6. VERGLEICH DER ERGEBNISSE MIT DER FACHLITERATUR graphischen Einbettung“ der Berufswahl sprechen (vgl. Heinemeier 1994), auch wenn Jünemann feststellt, dass eher die aktuellen Lebenlagen und Lebensphasen das Privatleben und die Berufsausübung beeinflussen (vgl. ebd. 2000). Die Bewältigung eigener Lebenskrisen mit Mitteln von Kommunikation und Interaktion und Versuche der Überwindung gesellschaftlicher Segregation und Stigmatisierung macht soziale Fachkräfte empfänglich für die Wahrnehmung gesellschaftlicher Benachteiligung (vgl. Krahulec 1999). Die in der Auseinandersetzung mit den bedeutsamen Lebensereignissen erworbenen Bewältigungsstrategien, können verbunden sein mit Formen des Widerstands und Protests. Die Bedeutung lebensgeschichtlicher Ereignisse für die berufliche Identität der Sozialen Fachkräfte erleichtert das Verständnis für soziale Probleme, erschwert aber zugleich eine rein funktionale Wahrnehmung beruflicher Aufgaben. Das Betriebsverfassungsgesetz und das Personalvertretungsgesetz (vgl. Richardi 1996) sehen öffentliche Meinungsäußerungen einzelner MitarbeiterInnen zu Abläufen ihrer Ämter und Betriebe nicht vor, obwohl nach Art. 5 Abs. 1 GG das Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit besteht. In den USA sich als „Whistleblowing“ ein Weg eröffnet, Meinungsäußerungen über Betriebsabläufe abzugeben, „... wenn Beschäftigte sich aus gemeinnützigen Motiven gegen ungesetzliche, unlautere oder ethisch zweifelhafte Praktiken wenden, die ihnen innerhalb ‚ihres‘ Betriebes oder ‚ihrer‘ Dienststelle bekannt geworden sind“ (vgl. Deiseroth 2000, 9). Ein solches Vorgehen wäre auch in der Sozialen Arbeit bei folgenden Konfliktlagen denkbar, in denen Beschäftigte „ethisch desertieren“: Konflikte um die Einhaltung beruflicher Standards, Bagatellisierung von Schadensfällen, Unterdrückung und Vernichtung von Dokumenten, Kritik an betriebsinternen Missständen, Aufdeckung von Gesetzesverstößen und Straftaten, Verstöße gegen internationale Abkommen (vgl. ebd., 9). Die Sensibilität für soziale Ungerechtigkeit kann emotionale Reaktionen bewirken, z.B. Ärger, Wut oder Empörung, die spontanen Ausdruck finden. Verbunden mit kognitiver Analyse führen sie zu Erkenntnissen über Gesellschaft, weil die Vergesellschaftung in seiner Komplexität, im Subjekt von innen (emotional) nach außen (rational) “begriffen” wird (vgl. Tillmann 1994). Erkenntnisse können, von anderen geteilt und mittels Institutionen oder Organisationen in einen Sinn- und Handlungszusammenhang gebracht, auch politisch wirksam werden (vgl. Krahulec 1999). Wenn sich Eigensinn und Eigendynamik von SozialarbeiterInnen der geforderten 182 6.2 BERUFLICHE IDENTITÄT IN NETZWERKEN UND BÜNDNISSEN Funktionalität widersetzen und öffentlich werden, dann hat die Verwaltungshierarchie mit solchen Reaktionen Probleme, da potenziell typische Verwaltungsabläufe und die Pläne von Leitungskräften gestört werden. Es gibt fachliche Positionen, die eine Selbstorganisation in Arbeitsvollzügen als fachliche Strategie grundsätzlich ablehnen und Sozialer Arbeit kein politisches Mandat zusprechen (vgl. Merten 2000 und 2001). Durchsetzungschancen für sozialarbeiterische Positionen werden nur gesehen, wenn Funktionen und Aufgaben im Sozialsystem fachlich versiert wahrgenommen würden (vgl. Wendt 1995). Nur über offizielle Funktionen und Zuständigkeiten nehme die gesellschaftliche Akzeptanz der Sozialen Arbeit zu. Zwar gilt inzwischen die Profession in vielen Bereichen der Alten-, Gesundheits-, Jugend- und Sozialhilfe gesellschaftlich als anerkannt. Allerdings wird dies zunächst weniger an der Organisation, sondern an einzelnen Fachkräften, an den Personen festgemacht. Die Bevölkerung verbindet Soziale Arbeit nicht direkt mit einer Sicherung materieller Hilfen, “sondern in der Vermittlung persönlicher Hilfen, der Förderung von Selbsthilfe und der Bewahrung sozialer Gerechtigkeit zur Vermeidung gesellschaftlicher Konflikte“ und bleibt gegenüber den Trägern von Sozialer Arbeit skeptisch eingestellt (vgl. Nodes 2000, 55). Insofern erhalten konfliktorientierte Strategien von der Bevölkerung durchaus Unterstützung, wenn sie sich gegen ungerechte oder bürokratische Regelungen der Organisationen richten. Darüber hinaus bleibt die Frage, ob es andere Formen gibt, politische Positionen der Sozialen Arbeit durchzusetzen. Der Ausbau sozialer Dienste weitet sich auf die Bereiche Schule, berufliche Bildung, Arbeit, Wohnen, Stadtsanierung aus, sodass schon von einer (Sozial-) Pädagogisierung von Teilen der Gesellschaft gesprochen werden kann (vgl. Griese 1994; vgl. Völker 1998). Es bleibt die Frage, ob Sozialpädagogik und Sozialarbeit mit ihren Handlungsvollzügen Politikdefizite überdecken soll und ob gerade deshalb der Anspruch auf ein politisches Mandat auf wenig Zustimmung in Verwaltung und Politik trifft. Denn Soziale Arbeit ist stets Indikator für Problemlagen, für die andere Lösungen nicht möglich oder politisch durchsetzbar sind. Doch die grundsätzliche Kritik an Defiziten des Sozialstaats und dem Zusammenhang zur Ökonomie des Marktes bleibt vielfach aus (vgl. Scherr 2000). Rieger fordert für die Profession eine Sozialarbeitspolitik als eigenständigen Handlungsbereich, um Formen der Anwaltschaft, Aufklärung, Politikberatung, Evaluation von Wirkungen und Nebenfolgen, Aktivierung durch Handlungsformen und -konzepte zu lehren und zu praktizieren. Damit berufliches Han183 6. VERGLEICH DER ERGEBNISSE MIT DER FACHLITERATUR deln auf Betroffenenorganisationen, Berufsverbände, Gewerkschaften, Parteien und andere gesellschaftliche Bereiche ausgeweitet werden kann (vgl. ebd. 2002). Damit wird ein, für Soziale Arbeit in Lehre und Praxis, noch zu entwickelnder Kompetenzbereich der gesellschaftlichen Mesoebene aufgezeigt. 6.3 KOMPETENZEN IN NETZWERKEN BEI ANALYSE UND PLANUNG Die Analyse von Lebenslagen der Bevölkerung wird in bundes- oder landesweiten Armuts- und Reichtumsberichten (vgl. BMfAS 2001; Hanesch 1994) und durch Lebenslagen- und Sozialstrukturanalysen (vgl. Hradil 1987, 1999) erhoben. In Berichten über ausgewählte Bevölkerungsgruppen z.B. Kinder, Jugendliche, Frauen, alte Menschen werden Lebensbedingungen untersucht und dargestellt (vgl. BMFSFJ 1998a-c, 1999a-d). Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung beziehen ihre Planungen und Entscheidungen auf diese Grundlagen, auf eigene statistische Materialien und die kommunale Sozialberichterstattung (vgl. Basserak 1997; VSOP 1996). Um die daraus abgeleiteten Programme und Projekte wirksam auf die Mikroebene eines Stadtteils oder einer Gemeinde zu übertragen sind zusätzlich kleinräumige Analysen erforderlich, z.B. Stadtteil-, Milieu- oder Sozialraumanalysen (vgl. Hinte, Karas 1998; Vester u.a. 1993; Freyberg, Schneider 1999). Dadurch sollen Planungen an die Kontextbedingungen der räumlichen, sozialen kulturellen und ökonomischen Gegebenheiten des Gemeinwesens, an die Handlungsspielräume der zuständigen Fachleute bzw. der Institutionen und an die Akzeptanz und Handlungsbereitschaft der Bevölkerung anknüpfen. In der Vergangenheit wurden diese praxisbezogene Untersuchungen selten an SozialarbeiterInnen, sondern fast ausschließlich an GeographInnen, SoziologInnen, Politik- und SozialwissenschaftlerInnen vergeben. Fachleute der Sozialen Arbeit waren eher Zuträger von Praxiserfahrungen und Kontextwissen und vermittelten Kontakte zu Gruppierungen, Cliquen und Kleinmilieus der Bevölkerung (vgl F1-21). Erkenntnisse aus der Reflexion beruflicher Praxis Sozialer Arbeit flossen selten in Forschungsprojekte mit ein. Bei statistischen Erhebungen blieb der personelle Einsatz Sozialer Arbeit weitgehend unberücksichtigt bzw. auf die Fallzahlen oder den Kostenfaktor reduziert. Diese Erfahrungen scheinen Vorbehalte gegenüber universitärer Forschung und statistischen Verfahren zu verstärken. Nur wenige Fachleute der Sozialen Arbeit nutzen statistische Daten, um darauf ihre Argumentationen aufzubauen. 184 6.3 KOMPETENZEN IN NETZWERKEN BEI ANALYSE UND PLANUNG In der Fachliteratur findet der kritische Umgang der Fachleute mit Statistik Bestätigung. Sozialdaten müssen bestimmte Kriterien erfüllen, um als Planungsgrundlage für Soziale Arbeit zu genügen. Für den Zusammenhang von Lebenslagen und Fremdunterbringung bzw. Erziehungshilfemaßnahmen sind z.B. nicht nur Wohnungsgrößen, Arbeitslosigkeit, Sozialhilfebezug in einem Wohnbebiet einzubeziehen. Es bedarf zusätzlicher Klärung hinsichtlich der Haushalts- bzw. Familienstrukturen, die häufig statistisch nicht erfasst werden, z.B. über Handlungsspielräume in der Wohnung bzw. im Haus, gemeinsame Familienaktivitäten, vorhandene oder fehlende elterliche Sorge, Betreuungen durch Fachleute oder Institutionen, Belastungen in der Wohnumgebung, benachbarter Wohnungsneubau, Bedrohung des Lebensstandards, fehlende soziale Verankerung der Familien, Probleme beim Berufseinstieg von Jugendlichen usw. (vgl. Santen u.a. 2000, 218f.). Untersuchungen über die Gültigkeit von Sozialindikatoren weisen auf die Notwendigkeit von Aushandlungsprozessen hin, in denen die Ergebnisse auf überschaubare Lebensfelder bezogen, diskutiert und daraus Bedarfe herausgearbeitet werden können. Soziale Fachkräfte scheinen Unsicherheiten im Umgang und der Bewertung von statistischen Daten und Lebenslagenanalysen zu haben. Unklar ist, wie die Erkenntnisse der Forschung auf kleine regionale Einheiten zu übertragen sind und in welchem Verhältnis die beruflichen Erfahrungen dazu stehen. Berechtigterweise gibt es dort Kritik, wo Makroanalysen die Innenperspektiven vernachlässigen, gerade weil sie für den beruflichen Alltag von Sozialer Arbeit von großer Bedeutung sind. Auf die Lebenslagen von Jugendlichen kann zwar allgemein mit Programmen und Maßnahmen reagiert werden. Doch ohne die Einbeziehung differenzierter Kontextbedingungen z.B. durch Lebensweltanalysen (vgl. Hitzler; Honer 1995) mit Berücksichtigung des Lebensfeldes, des Lebensalltags, der Lebensweisen mit den subjektiven Verarbeitungs- und Bewältigungsstrategien verlieren Hilfsangebote an Wirkung (vgl. Kardorff 1998). Beratung, Bildung, Begleitung, und Förderung als sozialarbeiterische Handlungsformen (vgl. Klüsche 1999) sind geradezu auf die Kenntnisse der „Innenwelten“ von jeweiligen Zielgruppen angewiesen. Bei einem Vorgehen, in dem technisches Planungsverständnis oder Verwaltungslogik dominieren und Handlungsansätze Sozialer Arbeit mit ihren differenzierten Abstimmungs- und Rückkopplungsprozessen vernachlässigt werden, wird sozialen Programmen und Projekten die erforderliche Fachlichkeit genommen. Selbstorganisierte Netzwerke bieten einen Rahmen, um den Blick auf das Lebensfeld der BewohnerInnen zu lenken und, anders als das Zusammen185 6. VERGLEICH DER ERGEBNISSE MIT DER FACHLITERATUR wirken großer Organisationen, die Konkurrenz der Träger partiell zu verringern. Das ermöglicht einen Rahmen und eine Gesprächsform, in der relativ offen Berufserfahrungen ausgewertet, Schlussfolgerungen gezogen und Planungsgrundlagen für berufliches Handeln abgeleitet werden können. Moser beschreibt dies in Bezug auf Kurt Lewins „action research“ als ein zyklisches Vorgehen, bei dem sich Aktion, Auswertung, Erkenntnisbildung, erneute Planung und Aktion stetig wiederholen und sich so praxisbezogenes Wissen optimiert und an die sich verändernden Kontextbedingungen anpasst (vgl. Moser 1995, 106f.). Durch das Zusammentragen von Betroffenenberichten, teilnehmenden Beobachtungen, beruflichen Erfahrungen im Lebensfeld können TeilnehmerInnen selbstorganisierter Netzwerke geeignete Planungs- und Handlungsgrundlagen für die berufliche Praxis erarbeiten. Diese müssten allerdings mit großräumigen Planungen abgestimmt und verbunden sein. In einem Modellprojekt des Landes Nordrhein-Westfalen zur „ortsnahen Koordinierung der gesundheitlichen und sozialen Versorgung“ in 28 Kommunen wurde als Teilziel eine „Planungs- und Entscheidungskultur“ verankert, die einem kybernetischen Regelkreis entspricht, ganz im Sinn eines Lernenden Systems (vgl. Zamora u.a. 2000). Über einen Runden Tisch wurden erarbeitet: Situations-, Problem- und themenspezifische Problemanalyse, Lösungsansätze, Alternativauswahl, Handlungsempfehlung, Umsetzung und Bericht über Ergebnisse und erneute Situations- und Problemanalyse. Interessant ist, dass die TeilnehmerInnen der AG ebenfalls, nach einem solchen Regelkreis gearbeitet haben, ohne dass dies ihnen bewusst war. Damit wird allerdings ein Defizit des professionellen Handelns aufgedeckt, dass weder die Aktivitäten dokumentiert, noch methodisch nachvollziehbar erläutert und deshalb nur eingeschränkt öffentlich vertreten werden können, wenn auf die schriftliche Form und eine wissenschaftliche Systematik verzichtet wird. Eine andere Form eines Netzwerkes stellt das organisationsbezogene „Kontraktmanagement“ dar. Damit wollen die Städte und Gemeinden die Kosten für gesetzliche Aufgaben begrenzen. Dazu sollen die öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe besser zusammenarbeiten, „Leistungs- und Finanzziele“ entwickeln und vereinbaren, durch „abgestimmte und operationalisierte Ziele und Standards“ die Arbeit verbessern und mittels „Sozialraumbudgets“ über Einzelfälle hinaus Leistungen der sozialen Arbeit finanzieren und auf bestimmte Gebiete übertragen (vgl. Hinte 1998). Damit wird der Versuch unternommen, die Vorteile selbstorganisierter Netzwerke in die 186 6.3 KOMPETENZEN IN NETZWERKEN BEI ANALYSE UND PLANUNG Strukturen der Organisationen zu integrieren. Selbstorganisationen können sich stärker den lebensweltlichen Perspektiven der BewohnerInnen nähern und deren räumliche und soziale Zuordnung und Abgrenzung in ihrer Arbeit berücksichtigen. Organisationen geben eher Raster vor, die mit politischen oder verwaltungstechnischen Kriterien übereinstimmen, sich an Grenzen von Stadtbezirken, Mindestfallzahlen pro MitarbeiterIn oder Einwohnerzahl pro Bezirk orientieren. Sozialräume aus BewohnerInnensicht unterliegen aber der zeitlichen und biographischen Veränderung und sind nicht nur auf die unmittelbare Wohnumgebung beschränkt. Betreuungsangebote und Treffpunkte gehören dazu, werden aber nach Angebot und nicht nach Wohnortnähe ausgewählt (vgl. Santen u.a. 2000, 125f.). Deshalb stößt der Versuch einer lebensweltorientierten Arbeitsweise auf Grenzen, wenn Sozialräume ausschließlich verwaltungsmäßig bestimmt werden. Einen Ausweg weisen diskursive Ansätze, wenn auf eine Verständigung über die Bedeutung der Daten Wert gelegt. „Es kann sich im Zuge eines Planungsprozesses als sinnvoll erweisen, die Erhebung, Sammlung und Verwendung des Datenmaterials mit einem Aushandlungsprozeß zu begleiten, der Klarheit darüber verschafft, welche Erwartungen man in der Kommune an die sozialstrukturellen Daten heranträgt, was sie aussagen, was sie tatsächlich leisten können und wofür sie verwendet werden sollen“ (ebd., 123). Die Kinder- und Jugendhilfeplanung in der Stadt Hildesheim geht einen vergleichbaren Weg. Dort werden verschiedene Perspektiven in den Planungsprozess einbezogen. Der Blickwinkel von Mädchen und Jungen, die Arbeitsfelder der Jugendhilfe, die Sichtweisen der Stadtteilbewohner sollen in den Prozess einfließen. Über Umfragen in Kindertagesstätten, Versammlungen von Kindern und Jugendlichen, über Interviews und Stadtteilspaziergänge werden verschiedene Formen von Netzwerken und Personengruppen erschlossen, um eine von vielen akzeptierte Jugendhilfeplanung zu erstellen (vgl. Jugendamt der Stadt Hildesheim 1995). Als grundsätzliche Anforderungen an stadtteilbezogene Planung und Arbeit können die Ergebnisse eines Forschungsprojektes zur „Gewaltprävention und Gewaltbekämpfung im kommunalen Sozialraum“ von 1994 bis Ende 1996 in neun Städten gelten. Als sinnvoll und notwendig wurden Praxisberatungs- und Praxisentwicklungsprozesse angesehen, die die Arbeit dokumentieren und auswerten und mit einer Sozialstrukturanalyse die regionalen Lebensverhältnisse darstellen. Zusätzlich sollen „Bedürfnisermittlungen ... Auskunft über die subjektive Wahrnehmung des sozialen Klimas“ geben. 187 6. VERGLEICH DER ERGEBNISSE MIT DER FACHLITERATUR Notwendig sind Übersichten des Bestands an Einrichtungen, Diensten und Angeboten. Erfahrungen der Modellregionen zeigten, dass Maßnahmen besonders dann erfolgreich sind, wenn sie „sich an den Interessen der BewohnerInnen orientieren, ihre Beteiligung ermöglichen und sie zur Umsetzung gewaltpräventiver Aktivitäten motivieren“ (Bohn u.a. 1997, 25). 6.4 ZUSAMMENFASSUNG Die Forschungsergebnisse bestätigen einen Wandel in der Sozialen Arbeit zu mehr Vernetzung in selbstorganisierter, aber auch in organisationsgebundener Form als gesprächs- oder aktionsorientierte Netzwerke und Bündnisse. Zwischen den kleinen selbstorganisierten Runden und den großen sozialen Organisationen entsteht eine Konkurrenz um die Wandlungsund Problemlösungsfähigkeit der Handlungsformen vor dem Hintergrund knapper kommunalpolitischer Finanzen. Feststellbar ist eine Umkehr der Einmischungsstrategie, waren es früher Selbstorganisationen, die sich in Kommunalpolitik einmischten, sind es zunehmend die Organisationen (Polizei, Arbeitsamt, Justiz, Ordnungsamt ...), die sich in professionelle Handlungs- und Arbeitsformen auch der Selbstorganisation sozialer Fachkräfte einmischen, um deren Wissen und Können für ihre Organisation nutzbar zu machen. Gemeinsam ist allen Handlungsformen, dass unter dem zunehmenden Einfluss und Druck der Ökonomie, Ambivalenz von Kooperation und Konkurrenz die Vernetzung in der Sozialen Arbeit mitbestimmt. Als unauflösbarer Gegensatz scheinen die widersprechenden Handlungslogiken zu wirken, wodurch personelle Ressourcen und Kompetenzen blockiert werden. Gleichzeitig weisen selbstorganisierte Netzwerke auf Defizite und Mängel hin, die von den Organisationen nicht bewältigt werden und sie bieten einen Ausgleich für die nicht zugestandene Mitwirkung an Bedarfserhebung und Planung, an Konzept- und Projektentwicklung sowie an Öffentlichkeitsarbeit. Interessanterweise weisen Fachliteratur und Ausbildungskonzepte darauf hin, dass Fachleute der Sozialen Arbeit zunehmend in diesen Bereichen Kompetenzen erwerben, die in den Organisationen nicht anwendbar erscheinen. Das wirft Fragen nach der beruflichen Identität auf, wenn nur Teilkompetenzen von den Fachleuten der Sozialen Arbeit gefragt sind. Festzustellen ist, dass in selbstorganisierten Netzwerken zwar Gespräche, Beobachtungen, Diskussionen und Aktionen mit Betroffenen gesammelt 188 6.4 ZUSAMMENFASSUNG und in Fachgesprächen verarbeitet und validiert werden, die Ergebnisse bleiben jedoch in der mündlichen Form und sind stark an Handlungsoptimierung orientiert. Die Erhebungen über Lebensfeld, Lebensweise und Lebenswelt werden nicht systematisch dokumentiert und sind für Externe inhaltlich und methodisch nicht nachvollziehbar. Damit fehlt Sozial- und JugendpolitikerInnen die professionelle Fundierung, wenn sie mit anderen Politikbereichen um Finanzen konkurrieren. Die Ablehnung einer Nutzung statistischer Daten zu Planungszwecken und der Bezug auf Berufserfahrung allein sind nicht ausreichend, um Fachlichkeit zu begründen. Stellt die deskriptive Statistik doch einen Teil der Lebenslagenkonzepte dar, mit denen Lebensweltkonzepte korrespondieren. Eine zukünftige Aufgabe für Lehre und Praxis scheint darin zu liegen, Forschungsansätze deutlicher zu differenzieren, deren Einsatz und Nutzen herauszuarbeiten sowie Methoden der Sozialen Arbeit als Erhebungsmethoden dafür nutzbar zu machen und sie so in den Rahmen einer Forschung zu stellen, den auch PraktikerInnen akzeptieren und nutzen. Dazu gibt es ermutigende Ansätze für die Disziplin Soziale Arbeit (vgl. Filsinger, Hinte 1988; Moser 1995; Kreft 1997; Schmidt-Grunert 1999; Steinert, Thiele 2000; Sahle 2001). Zu klären wird sein, bei welchen Fragestellungen, welche Forschungsperspektiven mit welchen Erkenntniswegen geeignet sind um Ergebnisse zu erzielen. Der induktive Erkenntnisweg einer „action research“ im Sinne Kurt Lewins, ausgehend von der Reflexion beruflicher Erfahrungen gültige Informationen für Planung zu gewinnen, kann sich für PraktikerInnen anbieten (vgl. Altrichter u.a. 1997). Gewonnen wäre in jedem Fall eine Zunahme an Professionalität in der Sozialen Arbeit, wenn die erhobenen empirischen Daten sich auf wissenschaftliche Grundlagen beziehen, und damit um die Durchsetzung der Interessen mittels einer neu formulierten und vermittelnden Sozialarbeitspolitik (vgl. Rieger 2002) gerungen wird. Dabei wären Prinzipien einer Bündnisarbeit zu berücksichtigen, die anders als selbstorganisierte Netzwerke nicht ein gleiches Berufsverständnis (ggf. gleiches Politikverständnis) und gegenseitige Sympathie voraussetzen, sondern zur Durchsetzung von gemeinsamen Interessen zeitlich und thematisch befristet kooperieren. 189 7. Annäherung an Soziale Arbeit durch praxisbezogene Forschung 7.1. ZUR DISKUSSION UM SOZIALPÄDAGOGISCHE FORSCHUNG UND SOZIALARBEITSFORSCHUNG Unterschiedliche Interessen sind mit Forschung zur Sozialen Arbeit bzw. zur Sozialpädagogik verknüpft. Hochschulpolitische Dimensionen besitzt der Streit um die Bezeichnung der Forschung als „sozialpädagogische Forschung“ (von Universitäten) bzw. „Sozialarbeitsforschung“ (von Fachhochschulen). Damit verbunden ist die Frage, ob Universitäten und Fachhochschulen „wissenschaftliche, grundlagenbezogene Disziplinforschung“ betreiben können (vgl. Otto 1998). Fachhochschulen wird eher die „handlungsorientierte Praxisforschung“ und eine „professionsorientierte, reflexive Forschung“ zugeordnet. Diese generelle Einschränkung akzeptieren die Fachhochschulen nicht. Theoriebildung lasse sich sinnvoller Weise nicht trennen von Handlungs- und Gefühlsebenen der Praxis und der „synthetisierenden Nähe zur Lebenswelt“ (vgl. Tillmann 1994, 17f.). Ansprüche der Fachhochschulen auf eine „Sozialarbeitswissenschaft“ (vgl. Engelke 1992) und Distanz zu den Bezugswissenschaften beleben die akademische Diskussion. Steinert und Thiele sehen die Sozialarbeitsforschung praxisorientiert, „aus Gründen der Abgrenzung gegenüber anderen Disziplinen, die stärker grundlagenorientiert forschen“ (vgl. ebd. 2000, 21). Gleichzeitig grenzen sie sich von reiner Anwendungs- oder Praxisforschung ab, weil sie auch der Sozialarbeitswissenschaft als Handlungswissenschaft Grundlagenforschung zuordnen. Thole nennt sieben Erwartungen die sich mit „sozialpädagogischer Forschung“ (an Universitäten und Fachhochschulen) verbinden lassen: • eine Effektivierung der Praxis; • eine Verschränkung von Wissenschaft und Praxis der Sozialen Arbeit; • ein kontinuierlicher Wissenschaft-Praxis-Diskurs; • ein Medium zur Praxisreflexion; • Dokumentation von Handlungs- und Erfahrungswissen; • Entwicklung qualitativer Methoden und • Theoriebildung (vgl. ebd. 1999, 233). 190 7.1. ZUR DISKUSSION Diese Anforderungen lassen die Forschung zwischen „Optimierung der Praxis“ und „Theoriegenerierung“ zirkulieren. Die Dimensionen des gewonnenen Wissens reichen dementsprechend von „Handlungswissen“ bis zu „wissenschaftlichem Wissen“ (vgl. ebd. 234). In einer gemeinsamen Umfrage von Fachhochschule und Universität Bielefeld wurden an den Fachhochschulen für Sozialarbeit/Sozialpädagogik in Nordrhein-Westfalen zwischen 1971 und 1988 101 ForscherInnen und 236 Projekte erfasst und ausgewertet. Dabei kamen „beträchtliche Forschungslücken“ ans Licht. Es gab nur geringe Forschungsaktivitäten in den Arbeitsfeldern Beratung in Beruf und Arbeitsleben (3%), Gemeinwesen- und Stadtteilarbeit (2,1%), Sozialplanung und Sozialverwaltung (3,3%) sowie Sozialpolitik (3,6%). Schwerpunkte der Forschung lagen in den Bereichen Erziehung und Bildung (22,2%), Sozialarbeit als Beruf und Disziplin (20%), Beratung und Behandlung (12,1%) sowie Gesundheit, Rehabilitation (12,3%) und Resozialisierung (8,1%). 89,5% der ForscherInnen nutzten Ergebnisse für die Lehre, und 82% stellten Ergebnisse direkt den Studierenden vor. Ein wichtiger Ansatz ist das forschende Lernen als didaktisches Prinzip, z.B. bei Lehrforschung, Projektstudium, Handlungs- und Feldforschung. Die Studie kommt zu dem Fazit, für Fachhochschulen sei „die Befruchtung der Lehre und Ausbildung durch die Forschung ein wichtiges Moment fast aller untersuchten Projekte“ (Salustowicz 1995, 129). „Man kann von einer mehr oder weniger abgeschlossenen Konsolidierung der Fachbereiche ‚Sozialwesen‘ sprechen“ (ebd., 108) und zwar in rechtlicher Hinsicht, in Bezug auf Prüfungs- und Studienordnungen, Studienprogramme, Lehrangebote sowie beginnende Forschung und Entwicklung (z.B. Gründung von Instituten, wissenschaftlichen Mitarbeitern/Mittelbau). Folglich wird an Fachhochschulen für Sozialarbeit/Sozialpädagogik zukünftig der Ausbau der Forschung und Entwicklung, neue Lehrthemen, neues Wissen, Persönlichkeitsentwicklung als Lehrthema, Grundlagen für Evaluation und Reflexion der LehrLernprozesse an Bedeutung gewinnen (vgl. ebd., 113). Mühlum sieht die Besonderheiten einer Erforschung der Sozialen Arbeit in einem besonderen interdisziplinären Erkenntnisinteresse, einem professionellen Verhältnis von Nähe und Distanz, einer Beteiligung der Praxis (auch bei Methoden und Designs), der Verstehbarkeit des Vorgehens und der Ergebnisse sowie einer Entwicklungsarbeit und Evaluation der Praxis als Ziel der Forschung. Diese „Forschung trägt dazu bei, daß komplexe und vielschichtige Alltagsprobleme durchdrungen und besser verstanden werden“ (vgl. ebd. 1996, 114). 191 7. ANNÄHERUNG AN SOZIALE ARBEIT DURCH PRAXISBEZOGENE FORSCHUNG 7.1.2 Zur Praxisforschung der Sozialen Arbeit Schon vor der aktuellen Debatte um „Sozialarbeitswissenschaft und Professionalisierung“ gab es über zehn Jahren lang ein neues Verständnis der Forschung in der Sozialen Arbeit. Nicht mehr allein die Beantwortung von Fragen nach Input und Output sind das Ziel von Untersuchungen; von Interesse ist vielmehr, wie bestimmte Ergebnisse zustande kommen. Mit dem Begriff „Praxisforschung“ haben Heiner, Müller, Kardorff und andere versucht, das Forschungsfeld der Sozialen Arbeit einzugrenzen, Ziele und Aufgaben zu benennen und methodische Orientierung zu geben (vgl. Heiner 1988a). Dadurch lieferten sie einen Beitrag zur Einführung und Entwicklung einer Forschungsrichtung für die Soziale Arbeit im weiten Sinn. Das Besondere daran ist der hochschulübergreifende Diskurs. Praxisforschung als Begriff ist nicht eindeutig festgelegt. Heiner versteht darunter „die Untersuchung der Praxis des beruflichen Handelns in der sozialen Arbeit“ (ebd., 7). Als wesentliche Kennzeichen benennt sie die enge Kooperation mit den Fachkräften und einen Beitrag zur Veränderung in der Praxis durch eine Anwendungsorientierung (vgl. ebd., 7f.). Drei typische Modelle mit unterschiedlicher Ausprägung der genannten Merkmale stellt Heiner vor. Die „bestimmende Funktion“ der WissenschaftlerInnen nimmt von (1) bis (3) jeweils ab, die „Intensität und Dauer der Kooperation“ mit der Praxis nimmt dagegen zu. (1) Die ForscherInnen führen Untersuchungen durch und kooperieren dabei mit Leitungskräften der betreffenden Organisationen. (2) Die ForscherInnen und Mitarbeiter bzw. Leitungskräfte sind ebenfalls daran beteiligt, Daten zu erheben. (3) Praktiker und ForscherInnen sind gleichermaßen aktiv an der Forschung beteiligt. „Der Forschungsgegenstand wird einerseits komplexer, weil die Untersuchung des Bedingungsgefüges, in dem die untersuchten Ergebnisse zu sehen sind, ausgeweitet wird“ (ebd., 9). Die Aufgabenbereiche für die Praxisforschung lassen sich wie folgt benennen: Bedarfsanalysen, Programm- und Produktentwicklung, Anwendungsanalyse und -unterstützung, Organisationsanalysen, Evaluation (vgl. Kardorff 1988, 73-74). Praxisforschung sollte als Bezugspunkte die Kontexte, also die Lebensund Arbeitsbedingungen untersuchen. Kardorff schlägt vor, das soziale Feld durch die Unterscheidung in Lebensfeld und Lebenswelt besser zu strukturieren. In der Praxis der Sozialen Arbeit wird disziplinspezifisches Wissen nicht einfach nur aus wissenschaftlichem Wissen abgeleitet, es wird verarbeitet, 192 7.1. ZUR DISKUSSION angepasst, geändert, in die Strukturen alltäglicher Routinen eingebaut und mit anderen Wissensbeständen gemischt, z.B. mit systematisierter Alltagserfahrung, Prinzipien und Regeln. Die Praxis ist in einen permanenten Herstellungsprozess eingebunden, in dem Erfahrungswissen als angenommene Intuition mit anderen Wissensbeständen zum praktischen Handeln und zur Legitimation verknüpft wird. Zum Verstehen institutioneller Handlungsmuster bedarf es eines Kontextwissens über lokal-historische Traditionen, geschlechtsspezifische Differenzierungen, sozialräumliche Bedingungen, schichtenspezifische Lebensformen und Konfliktfelder unterschiedlicher nationaler Identitäten (vgl. Kardorff 1988, 77-78). Müller stellt eine erweiterte Definition von Praxisforschung vor. Er sieht sie als „empirische Untersuchungen der Voraussetzungen, der Praxis und der Folgen beruflichen Handelns in der sozialen Arbeit“ (ebd. 1988, 17). In seinen Ausführungen geht er zurück auf soziographische Untersuchungen der Armenpflege des 19. Jahrhunderts und zeigt auf, dass es eine unmittelbare Verbindung, eine „Gleichzeitigkeit von Sozialforschung und Sozialarbeit“ gab. Die Arbeit der Frauen im „Hull House“, einem Nachbarschaftsheim bestand aus Untersuchungen über die Wohn- und Lebensverhältnisse und die vorhandene bzw. fehlende Infrastruktur. Sie nutzten die Ergebnisse der Erhebung zu verändertem Handeln und zur Strukturierung von Hilfsmaßnahmen sowie vergleichbare Untersuchungen sind die 1915 ausgewerteten Fürsorgeakten aus fünf nordamerikanischen Städten durch Mary Richmond (vgl. Müller 1988, 20). und 1929 die Untersuchung über die Arbeitslosen von Marienthal, mit der versucht wurde sämtliche Erhebungen qualitativ und quantitativ abzusichern (vgl. Jahoda u.a.1997). Praxisforschung unterscheidet Müller von summativer Evaluation (vgl. ebd. 1988, 29f.), die im Wesentlichen darauf gerichtet ist, den Wirkungsgrad (output) der Arbeit von Institutionen zu erfassen und dabei die Zielvorgaben übernimmt, die etwa der Auftraggeber der Forschung oder der Träger der Institution festgesetzt hat. Praxisforschung, wie sie Müller versteht, geht davon aus, dass MitarbeiterInnen mit den spezifischen Erfahrungen innerhalb der Institutionen keine Messwerte einer Zielvorgabe übergestülpt werden dürfen, die deren Selbstverständnis und Handlungsintentionen nicht entsprechen. Andererseits würde es nicht genügen, wenn die Forschung die Zielsetzungen der Praxis unkritisch übernähme und lediglich deren Erreichen überprüft. 193 7. ANNÄHERUNG AN SOZIALE ARBEIT DURCH PRAXISBEZOGENE FORSCHUNG 7.1.3 Bezug auf die Aktionsforschung Eine Verbindung zwischen Praxis- und Aktionsforschung stellen Filsinger und Hinte her. Sie gehen davon aus, dass die Aktionsforschung weiterentwickelt wurde und die Kritik an der Sozialforschung berechtigt war, um das Interesse an Veränderungen im untersuchten Feld und eine hohe Beteiligung der untersuchten Akteure zu erreichen (vgl. ebd. 1988, 34). Ihre Anforderungen an Praxisforschung sind Nützlichkeit für die Praxis, Problemlösungskompetenz und dennoch politische Enthaltsamkeit und Loyalität gegenüber den Beteiligten trotz kontroverser Interessen. „Insofern ist Praxisforschung auf Anwendung hin orientiert; sie ist eine Art Begleitforschung bzw. praxisbegleitender Forschung und damit auch eine Form der Intervention in Praxis. Dieser Anspruch von Praxisforschung legt einen methodischen Zugang nahe, der – unter Nutzung eines breiten Methodenspektrums – sich eng anlehnt an das Konzept qualitativer Sozialforschung“ (Filsinger; Hinte 1988, 43). Eine Besonderheit der Praxisforschung ist eine kontinuierliche Arbeit im Feld. Von daher ist sie längerfristig angelegt. Die Forschung hat Interesse an der Anwendung der Ergebnisse, deshalb müssen Vorlagen und Zwischenberichte rechtzeitig in verständlicher Form an die Praxis gegeben werden. Die Verarbeitung der Ergebnisse in der Praxis muss berücksichtigt werden. „Forschung ist somit ein umfassender, durch prägnante Menschen (Forscher) initiierter und durch wissenschaftliche Methoden begleiteter kommunikativer Prozeß, in dessen Verlauf Professionelle im Bereich sozialer Arbeit, aber auch Verwaltungsfachleute und Politiker, auf der Grundlage von gemeinsam mit den Forschern entwickelten Kriterien lernen, ihre Arbeitsvollzüge zu reflektieren, deren Wirkung auf die eigene Person, die Institution und die ihnen anvertrauten Menschen wahrzunehmen, zu analysieren und, falls sie es für nötig halten zu verändern“ (ebd., 45). Bei diesem Verständnis von Praxisforschung werden Ergebnisse über eine Beratungsarbeit umgesetzt, wobei Beratung dann heißt, die Begleitung neuer Modelle durch Dokumentation, Überprüfung und Reflexion zu ermöglichen. Das geschieht durch Konkretisierung von Zielen und Interessen, Analyse der Situation und der sie prägenden Kontexte. „Forschen und Umsetzen/Entwickeln sind dabei ineinandergreifende Prozesse, die sich wechselseitig beeinflussen und bedingen, auch wenn Forschen und Handeln zeitweise auseinanderfallen können“ (ebd., 61). 194 7.1. ZUR DISKUSSION Wenn Praxisforschung auf Kontextbedingungen und Veränderungsprozesse zielt, dann folgt daraus ein anderes Forschungsverständnis, ein anderes Forschungsdesign mit dafür geeigneten Methoden. „Favorisiert man ein Handlungs- und Kompetenzmodell, das auf Prozesse zielt, deren Ablauf und Ausgang sich in möglichst vielen kontaktreichen Aushandlungsprozessen der Beteiligten entwickeln, so steht dieses in einem Gegensatz zu Modellen, die einen möglichst genau umschreibbaren Soll-Zustand einer Person oder eines Systems definieren, der durch zielgerichtetes Handeln intentional herbeiführbar ist“ (Filsinger; Hinte 1988, 45). In der Sozialforschung wird die gleichzeitige Wahrnehmung von forschenden und pädagogischen Funktionen kritisch gesehen. Ein solches Vorgehen verletzt das Abstinenzgebot der beteiligten Forscher. Der Eingriff ins Feld soll, anders als bei der Aktionsforschung, so gering wie möglich gehalten werden. Selbst wenn die Rollen der Forschenden erst im Anschluss an Erhebungsphasen zum Berater oder Moderator wechseln, können methodologische Probleme für die Praxisforschung entstehen. Andererseits erwartet die Praxis von der Forschung nicht nur die Erhebung der erstarrten Routinen von Sozialer Arbeit, sondern auch eine Unterstützung bei Dokumentation und Evaluation der Arbeit, Anregung zur Selbstreflexion, Empfehlungen oder Durchführung von Organisationsentwicklung, Supervision und Fortbildung. Bei einer Verbindung von Forschung und Beratung bleibt ungenau, welche Eingriffe ins Feld erfolgen, zu welchem Zeitpunkt die ForscherInnen in die Rolle der Berater wechseln und ob dabei nicht die eigenen Forschungsergebnisse zum Untersuchungsgegenstand werden? Dann würde die eigene Tätigkeit untersucht, deren Erfolge oder Misserfolge unter Legitimationszwänge geraten könnten. Um hier eine größere Klarheit zu bekommen, sollen die Diskussionen und Beiträge zur Aktionsforschung ausgewertet werden. Aktionsforschung stand in den 1970er Jahren für eine neue Methodologie, die sich einerseits auf Erfordernisse pädagogischer, sozialer und politischer Praxis bezog und zugleich die Kritik an dem Postulat der Wertfreiheit von Wissenschaft (vgl. Adorno u.a. 1969), dem Wissenschaftssystem (vgl. Feyerabend 1978) und den vorherrschenden quantitativen Forschungsansätzen zum Ausdruck brachte. Aktionsforschung strebte den herrschaftsfreien Diskurs (vgl. Habermas 1971) an, problematisierte das Subjekt-Objekt-Problem in der Forschung und verband Forschung und Aktivität im sozialen Feld. Aktionsforschung suchte Bezugspunkte in den USA und den dortigen wissenschaftlichen Strömungen, dem Pragmatismus (Peirce), dem Symbolischen Interaktionismus (Mead, Blumer u.a.) und dem action research (Lewin). 195 7. ANNÄHERUNG AN SOZIALE ARBEIT DURCH PRAXISBEZOGENE FORSCHUNG Schon aus dem action research nach Lewin entwickelten sich drei erkennbare Forschungsansätze der Beratung, Begleitung und Personalentwicklung: (1) Prozessberatung, um Kommunikationsprozesse, Funktionen und Rollen von Gruppenmitgliedern, Problemlösungs- und Entscheidungsverfahren herauszuarbeiten. (2) Beobachtende begleitende Entwicklung, um Führungs- und Gruppenverhalten, Organisationsklima und innere Struktur einer Organisation zu erfassen. (3) Kontingenzansatz, der die Koordination der personalen Bedürfnisse mit Aufgaben der Umwelt bearbeitet. Motivation, Wahrnehmung und Erfahrung der Einzelnen werden bezogen auf Mitgliederwerbung und -auswahl (vgl. Hameyer; Haft 1977, 185). Das methodische Vorgehen in der Aktionsforschung enthält als zentrales Design Erhebungs- und Diskussionsphasen und sucht eine große Nähe zum Feld (vgl. Moser 1977a, 65). Moser spricht vom „zyklischen Modell“ (ebd. 1977b, 12), das Informationssammlung, Erarbeitung von Handlungsorientierungen und Handeln im sozialen Feld umfasst. „Ziel ist die Erarbeitung von Handlungsorientierungen, welche das Handeln im sozialen Feld anleiten“ (ebd., 12). Die kritische Argumentation sollte vor der „Befolgung bestimmter methodologischer Prinzipien und Verfahrensweisen“ stehen. Die Nähe zum Alltagshandeln und der Anspruch, Veränderungen im Feld anzustreben, wurden der Aktionsforschung vorgehalten. Die Distanz der Forschenden schien dadurch nicht gewahrt. Ethische Anforderungen erscheinen in der Aktionsforschung nicht abstrakt, sondern sind Bestandteil der Kommunikation und Umgang im Feld. Der Zugang zu diesem hängt wesentlich von der Kooperationsfähigkeit, Transparenz, Verständlichkeit der ForscherInnen ab (vgl. Moser 1977a, 56). Dazu übernehmen die AktionsforscherInnen Erhebungsmethoden aus der Sozialforschung und entwickelten vielfältige Methoden, sich dem Alltagshandeln anzunähern, z.B. Experimente, Rollen- und Planspiele, Krisenexperimente, informelle Tests, Beobachtungen, Interviews, Expertenbefragungen, Protokolle der Prozessreflexion, Soziometrie, Erhebung sozioökonomischer Daten, Literatur- und Quellenanalysen, Dokumentenanalyse (vgl. Moser 1977b, 61f.). Unter dem Begriff „Feldentwicklungsarbeit“ (vgl. Schweitzer u.a. 1976, 209) wurden eine gemeinsame Praxis und gemeinsame Erfahrungen einge196 7.1. ZUR DISKUSSION fordert, um praktisch-umgangssprachliche Kompetenzen anzugleichen und darüber in einen Diskurs zu treten. Die ForscherInnen erhalten ansonsten eine Sonderrolle, ohne dass ein gleichberechtigter Tätigkeitszusammenhang eingelöst wird. Das Problem einer gemeinsamen Diskursfähigkeit sieht auch Moser: „Vielmehr erfordert auch jedes Problematisieren von Lebenssituationen der Praxis Diskursfähigkeit. Daß diese bei Wissenschaftlern ausgeprägter vorhanden sei, ist nur dann gegeben, wenn Lebensprobleme in dem analytischen Stil des Wissenschaftlers angegangen werden. Oft fehlt es aber dem Wissenschaftler an der Fähigkeit, nicht abstrahierend zu verfahren, sondern sich auf eine Situation als solche einzulassen“ (ebd. 1977a, 99). Schweitzer berichtet über ein Aktionsforschungsprojekt mit einer sechsmonatigen Teilnahme im sozialen Feld der Heimerziehung. Zu kurze Zeiträume reichten nicht aus, um Einblick in die Strukturzusammenhänge eines sozialen Feldes zu gewinnen, und für Kinder und Mitarbeiter wäre es eher eine Störung der gewohnten Abläufe, „daß wir eine Reihe wichtiger Erkenntnisse nur deshalb machen konnten, weil es uns gelang, an der Basis als Kollege oder Mitarbeiter in einer Gruppe von Erziehern eine gemeinsame erzieherische Aufgabe und Verantwortung mitzutragen“ (Schweitzer u.a. 1977, 202). Eine Veränderbarkeit des Feldes von außen wurde kaum für möglich gehalten. „Nur auf der Grundlage gemeinsamer Erfahrungen im Gruppenalltag konnten wir mit den Erziehern die Notwendigkeit von Veränderungen feststellen“ (ebd., 203). Durch Teilnahme an Aktionen im Feld wird über Rückmeldung und Diskurs hinaus in dieses eingegriffen. Moser sieht darin eine Sonderrolle, die ForscherInnen durchaus ausüben können. „Obwohl die praktische Tätigkeit des Aktionsforschers durchaus eine Möglichkeit der Kooperation darstellt, kann sie nicht zur allgemeingültigen erhoben werden. Eine gemeinsame Erfahrungs- und Vertrauensgrundlage kann auch über Formen der Kooperation aufgebaut werden, welche die Arbeitsteiligkeit – die durch das gesellschaftliche System gegeben ist – akzeptiert“ (ebd. 1977a, 99). In der Beratung und Entscheidungshilfe sieht Moser die zentralen Aufgaben für die AktionsforscherInnen. „Das didaktische Vorgehen des Forschers bedeutet, daß er Anstöße gibt, Probleme formuliert und präzisiert, auf Probleme aufmerksam macht, Entscheidungsalternativen verdeutlicht usw. Die darauf bezogenen Entscheidungen sollten von allen Beteiligten, also unter gleichberechtigtem Einschluß der Betroffenen, vorgenommen werden“ (Moser 1977a, 25). 197 7. ANNÄHERUNG AN SOZIALE ARBEIT DURCH PRAXISBEZOGENE FORSCHUNG Der Forschungsansatz erweiterte sich dadurch, dass eine Verständigung über Forschungsthema, Design, Methoden, über die Teilnahme an Aktionen und der Verwertung der Ergebnisse stattfand. Das Untersuchungsfeld wurde unter Einbeziehung vieler Variablen betrachtet, Erkenntnisziele wurden diskursiv erhoben. Kritisiert wird die traditionell hierarchische Beziehungsstruktur zwischen „Forschenden und Erforschten“. Durch eine gemeinsame Problemdefinition und Lösungssuche wird ein „Subjekt/Subjektverhältnis“ angestrebt (vgl. Hameyer 1977, 172-175). Besonders strittig war der erwogene Rollenwechsel der ForscherInnen durch Ratgeben oder Mitarbeit im Feld. „Die Forscherrolle verändert sich dahingehend, daß er im Sinne der vorher gemeinsam festgelegten Absichten aktiv in das Handlungsfeld eingreift“ (ebd., 174). Nicht nur Ist-Situationen, sondern auch Veränderungsprozesse wurden untersucht. Die Absicht, einen verknüpften Forschungs- und Veränderungsprozess anzuregen, führte dazu, dass sich alle „Forschende und Erforschten“ an „Zielentscheidungen, an der Planung und Durchführung des Prozesses“ beteiligten (vgl. ebd., 174). Leithäuser und andere haben einen Beitrag zur „kritischen Sozialforschung“ geleistet, in dem sie über die erprobten Methoden hinaus qualitative Verfahren weiterentwickelten, die sich dem Gegenstand angemessener näherten. „Das Alltagsbewußtsein bildet von sich und den sozialen Situationen, auf die es sich bezieht, Vorstellungsbilder ... (diese) ... besorgen die Orientierung in den sozialen Situationen, gliedern die in ihnen nötigen Selbst- und Fremddefinitionen und Selbst- und Fremdwahrnehmungen. Sie helfen die Identität zu garantieren und sind in einem ganz allgemeinen Sinne verhaltensrelevant“ (Leithäuser u.a. 1977, 66). In Aktionsforschungsprojekten erhalten die Methoden einen anderen Stellenwert, sie dienen „als Medien innerhalb des Kommunikationsprozesses über die hergestellten Arbeits- und Lernverhältnisse“. Darüber hinaus sind sie „hilfreiche Selbstreflexions- bzw. Bewußtwerdungs- und Verständigungsmittel, Planungs- und Entscheidungshilfen“, dadurch entsteht ein großer „Spielraum für die Entfaltung sozialwissenschaftlicher Phantasie in Richtung auf die Erfindung systematischer Kommunikationsmittel“ (Haag u.a. 1977, 53). „Action research im Sinne kritischer Theorie hat demnach das Ziel, die Betroffenen dadurch von konkreten sozialen Zwängen zu befreien, daß man ihnen Einsicht in soziale Zusammenhänge vermittelt. Sie werden so in die Lage versetzt, selbst zu den bisher verfolgten Strategien auch Alternativen zur Lösung 198 7.1. ZUR DISKUSSION ihrer Probleme zu entwickeln und zur Veränderung ihrer sozialen Situation beizutragen“ (Leithäuser 1977, 89-90). Die Kritik am kritischen Rationalismus lautete, Subjekte sollen nicht als bloße Datenlieferanten herhalten und dadurch zu Objekten gemacht werden, auch nicht zur Gewinnung sinnvoller Forschungsergebnisse. „Damit ergibt sich methodologisch die Notwendigkeit, Subjekte sowohl als Gegenstand der Erkenntnis wie auch als Träger von Erkenntnis aufzufassen; dies bedeutet, daß der Sozialwissenschaftler seine Informationen stets durch einen Verständigungsprozeß mit den Betroffenen erhalten muß“ (ebd., 90). 7.1.4 Zusammenfassung Für eine praxisbezogene Forschung in der Sozialen Arbeit lassen sich folgende Elemente aufgreifen und weiterführen: Wesentlich für eine Forschung ist der Zugang, der u.a. durch die Auswahl der Untersuchungsmethoden bestimmt wird; dazu sind die Methoden an die Fragestellung und die Situation im Feld anzupassen. Empfehlenswert ist ein Mehrmethodenansatz. Dabei wird sowohl mit qualitativen als auch mit quantitativen Methoden gearbeitet. „Das eigenständige Profil der Praxisforschung wäre demnach einerseits in der Abgrenzung zur weniger anwendungs- und umsetzungsorientierten Grundlagenforschung zu sehen, es ist aber auch abzuheben von einer Handlungs- und Aktionsforschung, die sich einseitig auf qualitative Verfahren und Pläne festgelegt hat“ (Heiner 1988a, 9-10). Die Zwischenergebnisse werden zur Diskussion ins Feld gegeben. Diese sollen inhaltlich, sprachlich und zeitlich der Praxis angepasst werden und eine Auseinandersetzung ermöglichen. Erhebungsphasen und Diskurse wechseln sich ab. Dadurch können die Handelnden im Feld zu MitforscherInnen werden, Vorschläge zum Vorgehen und für Fragestellungen machen. Die Kooperation zwischen ForscherInnen und Praxis wird ausgehandelt (vgl. Moser 1977a). Methodologisch ist noch unklar, wie Erhebungsphasen und Rückkopplung sich unterscheiden. In der Aktionsforschung wurden diese Phasen methodologisch nicht getrennt, die Erhebungsmethoden nicht sorgfältig reflektiert und in der Anwendung unterschieden. Ein gravierender Unterschied zwischen Praxis- und Aktionsforschung ist deshalb auch die Rolle des Forschenden, der nicht an Handlungsvollzügen der Praxis teilnimmt, sich dem Forschungsfeld zunächst nicht generell durch theoriebezogene Fragestellungen annähert, und auch nicht besser weiß, was zu tun wäre. 199 7. ANNÄHERUNG AN SOZIALE ARBEIT DURCH PRAXISBEZOGENE FORSCHUNG 7.2 ZU DEN ERHEBUNGSMETHODEN Für die Erhebung der Kontexte kommen vorzugsweise Varianten von Interviews zum Einsatz. Im Prozess, dem Verfolgen von zeitlichen und inhaltlichen Entwicklungen und Abläufen werden Beobachtungen, ggf. in Kombination mit diskursiven Methoden, eingesetzt. Es gibt zentrale Erhebungsmethoden, die sich den jeweiligen Forschungsebenen wie Kontext und Prozess zuordnen lassen und es gibt ergänzende Methoden, die das Forschungsdesign, den Prozess steuern oder für spezielle Fragen zur Erhebung eingesetzt werden. Insofern ist der Begriff „Methodenmix“ zu differenzieren und hat lediglich für das Gesamtprojekt Gültigkeit. In einzelnen Erhebungsphasen wurde vorrangig mit einer zentralen Methode gearbeitet. 7.2.1 Leitfaden-Interview Interviewformen werden in der qualitativen Sozialforschung unter verschiedenen Begriffen angewandt. Mayring nennt als Beispiele: problemorientiertes Interview, unstrukturiertes Interview, fokussiertes Interview, Tiefeninterview, Intensivinterview, offenes oder qualitatives Interview (vgl. Mayring 1996, 48f.). Charakteristische Gemeinsamkeit all dieser Interviewformen ist die Offenheit der Frageformulierung. Es wird weniger nach Fakten gefragt (wer, wo, wann, wie viel?), sondern häufiger Beschreibungen von Ereignissen, Entwicklungen oder Prozessen verlangt (was, welche?). Die Art und Weise (wie?) sowie Begründungen und Deutungen werden angesprochen (weshalb, warum?). Der Forschungsgegenstand (ausgewählte Themen und Fragen) soll überwiegend durch die subjektiven Bedeutungsgehalte der Befragten erschlossen werden. „Problemzentriertes Interview“ nennt Witzel ein Interview mit drei wesentlichen Prinzipien: Die ForscherInnen müssen sich zuvor mit den wesentlichen Aspekten der gesellschaftlichen Problemstellung vertraut gemacht haben. Das Verfahren zur Erhebung muss sich auf den „Gegenstand“, auf die Personen, das Thema, die Situation beziehen. Es muss berücksichtigt werden, dass die Forschung sich in Bezug auf die angewandte Methode flexibel und schrittweise auf den Prozess der Erhebung und Reflexion der gewonnenen Daten bezieht (vgl. ebd. 1982). In nahezu allen Formen des Interviews wird dazu ein Leitfaden mit Fragen erstellt. Zuvor bedarf es einer gründlichen Einarbeitung in das Thema, um die wesentlichen Aspekte bei der Frageformulierung zu berücksichtigen. 200 7.2 ZU DEN ERHEBUNGSMETHODEN Ein „Leitfaden-Interview“ (vgl. Friebertshäuser 1997) sollte keine Antwortvorgaben enthalten. Auswahl und Reihenfolge der Fragen sind mit entscheidend für den Gesprächsfluss. Es ist geradezu erwünscht, wenn sich narrative Phasen ergeben, in denen die Interviewten die Verarbeitung ihrer Erfahrungen, Handlungszusammenhänge und Bedeutungen zur Sprache bringen. Anders als ein „narratives Interview“ (vgl. Schütze 1983) sind die angesprochenen Aspekte durch den Leitfaden vorstrukturiert. Der Grad der Strukturierung ist thematisch bedingt und ermöglicht eine Vergleichbarkeit mit anderen Interviews. Die Interviewten sollen frei antworten. Dadurch lässt sich prüfen, ob sie den Interviewer überhaupt verstanden haben. Wesentlich ist, dass die Befragten ihre subjektiven Deutungen offen legen. Freie narrative Phasen erlauben die Darstellung emotionaler und kognitiver Zusammenhänge. Die Bereitschaft zur offenen Antwort hängt von einer Vertrauensbeziehung ab, die sich in den ersten Geprächsmomenten entwickelt. Abkürzende, bewertende, kommentierende Äußerungen sind geeignet, die Interviewten zu irritieren und Vertrauen zu verlieren (vgl. Atteslander 1995, 166-167). Leitfaden-Interviews können mit Einzelnen, Paaren oder Kleingruppen durchgeführt werden. Der Fokus bleibt auf die Einzelmeinungen der Interviewten gerichtet. Am Leitfaden orientiert erhalten die TeilnehmerInnen abwechselnd Gelegenheit zu antworten. Durch die Wiederholung von Fragestellungen werden verschiedene Standpunkte deutlich. Die TeilnehmerInnen erhalten ähnlich wie in der Gruppendiskussion eine Stimulierung. Es kann auch zu ungewollter Anpassung von Meinungen kommen. Dominante Interviewpartner können sich eher durchsetzen. Diskussionen untereinander müssen begrenzt werden, da zunächst nicht die Diskussionsergebnisse der Gruppe interessieren. Eine Besonderheit stellen Interviews mit ExpertInnen dar. Meuser und Nagel entwarfen dafür den Begriff „ExpertInneninterviews“ (vgl. ebd., 1994). Deren Wissen unterscheidet sich vom Alltagwissen der Allgemeinheit und erfordert ein anderes Vorgehen seitens des Interviewers. Doch über welches Wissen verfügen ExpertInnen? Ist es auch Alltagswissen, das von vielen geteilt wird? Ist es Gebrauchswissen über Fertigkeiten zum Umgang mit Objekten? Oder ist es besonderes Wissen, über das nur ExpertInnen verfügen, das eben nicht allen zur Verfügung steht? Wodurch zeichnet sich das Wissen aus? Kennzeichnend ist die Benutzung einer Fachsprache, die für Außenstehende sprachlich meist unverständlich und mit Fachbegriffen durchsetzt ist. ExpertInnen gelten als kompetent und legitimiert. Sie statten sich mit Em201 7. ANNÄHERUNG AN SOZIALE ARBEIT DURCH PRAXISBEZOGENE FORSCHUNG blemen und Symbolen aus, vollziehen bestimmte Rituale, erklären sich zuständig für ein Wissensgebiet und weisen andere Ansprüche auf dieses Gebiet erfolgreich zurück. „Expert(inn)enwissen wäre demnach vor allem das Wissen, wie man sich als Experte, und mithin als ‚unterweisungsbefugt‘ für ein Wissensgebiet, darstellt – und wie man Weisungsansprüche anderer auf diesem Gebiet erfolgreich zurückweist“ (Hitzler 1994, 27). Meuser und Nagel unterscheiden Leitfaden-Interviews und ExpertertInneninterviews, um auf das Sonderwissen durch die Wahrnehmung von bestimmten Funktionen hinzuweisen. Für sie ist der Expertenbegriff „nicht an Bedingungen formaler Qualifikation oder an eine offizielle Position“ gebunden. Es geht um Insiderwissen, über das z.B. auch Jugendliche der Punkszene oder wohnungslose Menschen für ihren Lebensbereich verfügen. Allgemein anerkannt sind jedoch ExpertInnen erst, wenn sie „akademisch gebildete Angehörige von Funktionseliten“ sind, also maßgeblich Prozesse des sozialen Wandels steuern (vgl. ebd. 1994, 180f.). Über die Strategien und Relevanzen, die zum Tragen kommen, sind sich die ExpertInnen häufig selbst nicht im Klaren. Sie können darüber wenig Auskunft geben. Es handelt sich nicht um kollektiv verfügbare Muster (Rezeptwissen), sondern um „impliziertes Wissen“, das als ungeschriebenes Gesetz fungiert. Allerdings müssen diese „überindividuellen, handlungs- bzw. funktionsbereichsspezifischen Muster des Expertenwissens“ entdeckt werden. Meuser und Nagel plädieren für ein offenes Leitfaden-Interview, um das ExpertInnenwissen herauszuarbeiten. Dazu muss der Interviewer selbst zum Experten werden, um herauszubekommen, „wie man es anstellt, Einfluss auf Entscheidungen zu nehmen, von denen der Zustand eines sozialen Systems (mit-) abhängt“ (ebd., 184). Bedingt durch die Konkurrenzsituation zwischen den Anbietern von Sozialer Arbeit werden MitarbeiterInnen stärker auf ihre Repräsentationsfunktion geprüft. Daraus folgt, dass Selbstinszenierung in großem Maße zu den Äußerungen von ExpertInnen dazugehört. Ein weiterer Aspekt ist die Anpassung an offizielle politische Programmatik. Hier werden sich exponierte Fachleute in der Politik oder in Leitungsfunktionen stärker an thematischen Trends orientieren und eigene Positionen eher zu verdecken suchen. 7.2.2 Teilnehmende Beobachtung Die teilnehmende Beobachtung als Erhebungsmethode ist eine „Standardmethode der Feldforschung“ (vgl. Mayring, 1996) Die Beobachtung erfolgt 202 7.2 ZU DEN ERHEBUNGSMETHODEN nicht passiv und außerhalb der sozialen Situation, sondern durch Teilnahme an den Interaktionen. Bei der sozialwissenschaftlichen Beobachtung unterscheidet Girtler hinsichtlich einer Teilnahme oder Nichtteilnahme an Gruppenprozessen (vgl. ebd. 1984, 45). Eine bewusste Beeinflussung der Untersuchungsgruppe soll (anders als beim Experiment) trotz Teilnahme nicht stattfinden. Allerdings verändert schon die Tatsache der Teilnahme eines Beobachters das Verhalten der zu Untersuchenden, genannt Hawthorne-Effekt (vgl. Lamnek, 1988, 260) Am Anfang erleichtert der Kontakt zu einer oder mehreren Schlüsselpersonen den Zugang zum Feld (vgl. Girtler 1984, 69). Viele ForscherInnen berichten über misslungene Versuche, am Alltag von Gruppen oder Organisationen teilzunehmen, deren Gespräche zu verfolgen oder Einblick in interne Strukturen zu erhalten. Die ForscherInnen müssen sich mit einer offenen Haltung (wenig strukturiert) um den Zugang bemühen und sich zurechtfinden. Sie orientieren sich an der Sprache, dem Umgang, den wichtigsten Regeln, verschaffen sich Klarheit über ihre Rolle und stecken ihren Handlungsraum ab. Beobachten ist beides, eine soziale Handlungsform und ein wissenschaftliches Verfahren. „So geht mit jeder Beobachtung ein Mindestmaß an sozialer Teilnahme einher. Bei der teilnehmenden Beobachtung ist die soziale Interaktion der Forscher im Feld sogar ausdrücklich Bestandteil des methodischen Vorgehens“ (Atteslander 2000, 99). ForscherInnen müssen diese Interaktion reflektieren: Welches Interesse besteht an dem Thema, an den Menschen? Wie kann ein vertrauensvoller Umgang (auch mit den Ergebnissen) gewahrt bleiben? Wie häufig nehmen sie an Treffen teil? Übernehmen sie auch Aufgaben? Wie oft ziehen sie sich zur Reflexion zurück? Wie stark identifizieren sie sich mit der Gruppe, werden sie Mitglied? Die Teilnahme am Leben einer Gruppe ermöglicht eine Innenschau, eine innere Perspektive. Die Strukturen, Symbole, Rituale der Gruppe sollen so verstehbarer, Sinn und Bedeutung der sozialen Phänomene in Zusammenhängen gesehen und erklärt werden. Die Rollenwahl des Quasi-Gruppenmitglieds wird nicht vollständig gelingen, weil die verantwortliche aktive Teilnahme ausgespart bleibt. So werden die ForscherInnen pendeln zwischen Teilnahme und Distanz (vgl. Legewie 1991, 191). Eine partielle Integration des Beobachters in die Gruppe oder Organisation und seine Teilnahme an Aktivitäten lässt ihn die innere Dynamik besser verstehen. Das geht soweit, dass ein enger Kontakt zustande kommen kann, durch den sich emotionale Stimmungen mitfühlen lassen. Im Allgemeinen 203 7. ANNÄHERUNG AN SOZIALE ARBEIT DURCH PRAXISBEZOGENE FORSCHUNG entstehen die Akzeptanz und der Zugang zum Forschungsfeld nicht nur aufgrund einsichtiger Forschungsziele, eines guten Forschungsdesigns, sinnvoller Methoden usw. Es stellen sich vielmehr die Fragen: „Sind es nette, verständige Personen?“ und „Werden sie uns unterstützen und nicht schaden?“ Die Akzeptanz der ForscherInnen als Personen hängt von ihrer Haltung ab. Daraus bestimmt sich die Qualität der Interaktion mit „Befragten bzw. Beobachteten“. Die Rolle der Forschenden als Lernende scheint geeignet zu sein, Nähe herzustellen, um komplexe Sachverhalte nachzuvollziehen und zu verstehen. Für die Aufzeichnungen sind folgende Fragen hilfreich, um den auf eine Gruppe bezogenen Forschungsprozess zu kontrollieren und zu korrigieren: Wo haben die Fachleute starke Stimmungen und Gefühle zu verdrängen oder zu übergehen gesucht? Wo wurde etwas behauptet, anders gehandelt und viele Erklärungen dafür geliefert? Wo kommt ein Thema immer wieder auf den Tisch? Wo gibt es Wiederholungen? Wo kommen gegensätzliche Meinungen oder Handlungen, widerstrebendes Handeln zum Vorschein? (vgl. Girtler 1984, 132f.) Die Antworten sind aus den Beobachtungen oder über die zusätzliche Dimension des Mitfühlens bzw. der engagierten Nähe zu erschließen. Dadurch kann sich das Vorverständnis der ForscherInnen gravierend verändern und neue Erkenntnisse fördern. Durch den Wechsel von Nähe und Distanz der ForscherInnen zum Forschungsfeld lässt sich das soziale Feld in größeren Zusammenhängen verstehen. 7.2.3 Gruppendiskussionsverfahren „Gruppendiskussion“ als Erhebungsmethode bezeichnet zunächst kein besonderes Verfahren. Es wird allgemein als eine Befragung mehrerer Personen gesehen. Die Auswertung von 115 Forschungsarbeiten aus den Jahren 1978 bis 1988 zeigt auf, dass in drei Viertel aller Fälle dieses Erhebungsverfahren Anwendung findet, wenn eine besondere Gruppe Gegenstand der Forschung ist (vgl. Dreher; Dreher 1991, 186f.). Befürworter dieser Methode schätzen die wechselseitige Stimulation, eine höhere Realitätsnähe und -prüfung der Beiträge durch die Anwesenden sowie die größere Spontanität der Äußerungen. Atteslander unterscheidet weiter nach dem Grad der Strukturierung in „Gruppendiskussion“ (wenig strukturiert) „Gruppenbefragung“ (teilstrukturiert) und „Gruppeninterview“ (stark strukturiert) (vgl. ebd. 2000, 152). Die Unterscheidung in unstrukturiert/strukturiert kritisiert er als zu unspezifisch, da jedes Gespräch bzw. jedes Interview bereits eine Struktur beinhalte (Atteslander 1995, 159). 204 7.2 ZU DEN ERHEBUNGSMETHODEN Eine zentrale Frage für die Anwendung der Methode ist, inwieweit geäußerte Meinungen in der Gruppe auch die Einzelmeinungen widerspiegeln. Häufig ist es deshalb notwendig, zusätzlich Einzelmeinungen zu erheben. Dennoch bleibt die Diskrepanz, dass nicht in jedem Fall die Summe der Einzelmeinungen mit denen der Gruppe übereinstimmte. Bestimmte Meinungen setzen sich in der Diskussion durch. In Gruppendiskussionen können die ForscherInnen erfassen, wie „alltägliche Sinnstrukturen, die in sozialen Situationen entstehen, sich verändern und das Denken, Fühlen und Handeln beeinflussen“ (Mayring 1996, 60). Die Auswahl der TeilnehmerInnen korrespondiert mit den Forschungsfragen und dem Diskussionsthema. Nach der Gruppenbildung wird das Thema präsentiert, es soll einen „Grundreiz“ beinhalten. Danach folgt eine freie Diskussion, die später durch weitere „Reizargumente“ erweitert wird. Abschließend reflektiert die Gruppe den Diskussionsprozess. Gruppendiskussionen sollten auf Tonband aufgenommen werden, ggf. sollten ergänzend Gruppendynamik, Mimik und Gestik beobachtet werden (vgl. ebd., 59). Der Wert der Methode Gruppendiskussionsverfahren hängt ab von der Gruppenzusammensetzung, der Kompetenz des Diskussionsleiters und der Frage, ob die Beteiligten der Diskussion einen Sinn und eine Bedeutung zumessen. Bei einem hohen Grad an vergleichbarem Erfahrungshintergrund und Betroffenheit der TeilnehmerInnen bieten die Ergebnisse Aussagen im Hinblick auf die Konstitution von gesellschaftlicher Wirklichkeit und ihrer Veränderung innerhalb einer Gruppe. „In dieser Verwendungsweise wird Gruppendiskussion zweifach sinnvoll und gewinnbringend: einmal als Informationsquelle für den Forscher, zum anderen als Lernprozess für die an der Forschung Beteiligten“ (Dreher; Dreher 1991, 188). 7.2.4 Soziogramm Soziometrische Techniken sind Verfahren der empirischen Sozialforschung, um zwischenmenschliche Beziehungen und Strukturen in sozialen Gruppen zu erfassen und graphisch darzustellen. Die Bezeichnung „Soziogramm“ geht auf Lochner (1927) zurück, der diesen Begriff für umfangreiche Beobachtungen und Befragungen von Schulklassen benutzte. Die klassische Form geht zurück auf Moreno (vgl. ebd. 1989), der den Anstoß gab, Beziehungsgeflechte von Sympathie und Antipathie zu veranschaulichen. „Der soziometrische Test ist ein Instrument, das soziale Strukturen überprüft, indem die Anziehungen und Abstoßungen gemessen werden, die unter den Personen in einer Gruppe stattfinden“ (ebd., 157). 205 7. ANNÄHERUNG AN SOZIALE ARBEIT DURCH PRAXISBEZOGENE FORSCHUNG Bei der Soziometrie geht es um eine Wahlhandlung (Auswahl und Ablehnung) in einer überschaubaren Gruppe, die durch Fragebogen, Aktion oder Beobachtung ermittelt wird. Mit einfachsten Mitteln lässt sich z.B. mit einem Fragebogen ein Überblick über eine Gruppenkonstellation gewinnen. Kreise stehen für die Personen, durchgehende oder gestrichelte Verbindungslinien für die Auswahl bzw. Ablehnung. Durch diese Form der Abbildung von Wahlhandlungen erscheinen Paarbildungen, Dreiecke, Ketten oder Sterne, die das Gruppengefüge sichtbar machen. Daraus lassen sich Aussagen über zentrale, mittlere oder randständige Positionen der Gruppenmitglieder ableiten. Die Anzahl der Verbindungen pro TeilnehmerIn und das Verhältnis der Verbindungen zueinander sind wichtige Fakten. Unterschieden wird zwischen Statusstabilität (wie viele Wahlen erhält jemand?) und Strukturstabilität (wer wählt wen?). Eine Gegenseitigkeit der Wahl stellt eine besondere Verbindung dar, die graphisch hervorgehoben wird. Durch die Darstellung der Anzahl und Art der Verbindungen wird die Position des Einzelnen in der Gruppe deutlich. Die Teilnehmerschaft allein reicht nicht aus, um den Beitrag und die Stellung des Einzelnen zu verstehen. „Auf diese Weise gewinnen wir eine Einsicht darüber, wie sich Gruppen aus sich selbst heraus strukturieren, im Vergleich zu Gruppen, denen ihre Strukturen von außen auferlegt werden“ (Moreno 1954, 163). In zwei Punkten unterscheidet sich das Soziogramm dieser Untersuchung von Darstellungen in der Fachliteratur. • Es wurden nur Fragen nach der regelmäßigen Zusammenarbeit gestellt, also nach den vorhandenen und nicht den gewünschten Kontakten. Damit bildet das Ergebnis eher die funktionale und weniger die affektive Seite der Arbeitskontakte ab. Dennoch sind die Kontakte maßgeblich vom Arbeitsauftrag der Institution abhängig, aber sie enthalten auch Vorlieben und Interessen der einzelnen Person und bilden eine Mischung von Wahl und Pflicht ab, die sich je nach Institution aus verschiedenen Anteilen zusammensetzt. • Es wurde nicht gefragt nach Ablehnung, also mit welcher Einrichtung keine Zusammenarbeit stattfindet. Die Schwierigkeit besteht darin, dass dieser Fall insofern nicht beantwortbar ist, weil alle Einrichtungen sich zur Zusammenarbeit in der AG zusammengefunden haben. In einem Erstinterview würde niemand offen diese Frage beantworten. Die Distanzierungen lassen sich erst aus der Teilnahme bzw. Ablehnung bei gemeinsamen Projekten ableiten. 206 7.2 ZU DEN ERHEBUNGSMETHODEN Bei den Antworten gilt es zu berücksichtigen, dass die Befragten zwar für sich als Vertreter der Institution antworten, aber dennoch nur die Zusammenarbeit im Rahmen der AG Kinder- und Jugendarbeit dargestellt wird. Die jeweiligen Teams entsenden in andere Zusammenhänge z.B. zum Thema Arbeitslosigkeit oder Sanierung andere Vertreter, die ebenfalls ihre Institution repräsentieren und auf andere Weise zusammenarbeiten. Die Frage bleibt offen, inwieweit Gruppenprozesse durch wenige Fragen zur Kooperation abgebildet werden können. Erfassungsmodalitäten, Dimension und Kriterienwahl sind dabei entscheidend (vgl. Sader 1998, 53). Es handelt sich um einen zeitlichen Ausschnitt, der durch Auswertung weiterer Fragen der Interviews bestätigt werden kann. Durch die bildhafte Darstellung von Netzen als Beziehungen wirken sie übersichtlich und anschaulich. Letztlich wird Komplexität vereinfacht. Da soziale Wirklichkeit dem Wandel und der Veränderung unterliegt, stellt diese Darstellung gleichzeitig eine Vereinfachung und Konstruktion von Wirklichkeit dar. 7.2.5 Schriftliche und telefonische Befragung Schriftliche Befragung Der Fragebogen wird in der qualitativen Sozialforschung eher als Ergänzung zu den bevorzugten Erhebungsmethoden des Interviews und der Teilnehmenden Beobachtung gesehen. Ein „Kurzfragebogen“ (vgl. Witzel, 1982, 89) wird häufiger bei Interviews eingesetzt, um wichtige persönliche Daten, wie z.B. Alter, Berufszugehörigkeit, Wohndauer usw. zu erheben. Diese Fragen sollten zu Beginn erhoben werden, wenn die Informationen Teile des Interviews bestimmen. Ein Fragebogen, im Anschluss an das Interview verteilt, stört dagegen weniger den Interviewablauf. In einer praxisbezogenen Forschung gehört Faktenwissen zur Einschätzung der überwiegend subjektiven Sichtweisen hinzu. Es ist sorgfältig abzuwägen, zu welchem Zeitpunkt nach Fakten gefragt wird. Bestimmte Fragen bergen Brisanz und können die für Interviews notwendige Offenheit gefährden. Dazu gehören z.B. Fragen an soziale Fachkräfte nach Besucherzahlen, messbaren Wirkungen ihrer Arbeit, Umfang des Personaleinsatzes, Finanzierung (Einnahmen/Ausgaben/Zuschüsse). Hier wird neben den Fakten auch deren Bedeutung innerhalb der Organisation und im Verbund mit anderen, etwa der Kontrolle von Arbeitsleistung, angesprochen. Diese Informationen unterliegen einem besonderen Schutz, um z.B. zusätzlicher Konkurrenz und Kürzungen der Personal- und Sachmittel vorzubeugen. 207 7. ANNÄHERUNG AN SOZIALE ARBEIT DURCH PRAXISBEZOGENE FORSCHUNG Neben allgemeinen Sozialdaten, die über Statistikstellen zugänglich sind, benötigt eine praxisbezogene Forschung ein Mindestmaß an selbst erhobenen Sozialdaten. Dazu werden Fragebögen ausgearbeitet und vorher getestet. Suggestive Fragen sollen vermieden werden. Je geschlossener die Frage, um so stärker orientiert sie sich an Fakten. Geschlossene Fragen erleichtern die Vergleichbarkeit. Offene Fragen helfen Unwissenheit, Missverständnisse oder unerwartete Bezugssysteme aufzudecken und können den Gesprächskontakt fördern. Bei Meinungsfragen besteht jedoch die Gefahr, dass bei neuen Themen in so kurzer Zeit keine umfassende Meinung gebildet werden kann (vgl. Atteslander, 1995 177f.). Die Befragten äußern sich in vorgegebenen Begriffen oder selbst formulierten Beiträgen, die schriftlich festgehalten werden. Auf diese Art lässt sich über einzelne Fragen des Forschungsprozess eine kurze Rückmeldung erhalten oder ein Stimmungsbild von der Gruppe erheben. Fragen sollen einfache Wörter enthalten, konkret sein, keine bestimmten Antworten provozieren, neutral formuliert sein und positive wie negative Antwortmöglichkeiten enthalten. „Befragung ist ein sozialer Prozeß. Fragen sind also in einem komplizierten Zusammenhang unter nie gänzlich vorhersehbaren und kontrollierbaren gegenseitigen Einwirkungen zu betrachten“ (ebd., 192). Schriftliche Befragungen haben innerhalb einer praxisbezogenen Forschung verschiedene Funktionen. Erfragt werden können Sozialdaten zum Forschungsthema, Rückmeldungen über den Forschungsprozess sowie Meinungen und Einstellungen zu Forschungsfragen. • Sozialdaten, also Fakten, sollen erhoben werden, um qualitatives Material einordnen und vergleichen zu können. Dazu würde ein Kurzfragebogen im Rahmen eines Interviews z.B. Angaben zur Person oder zur Berufstätigkeit, Angaben über Entstehung und Geschichte von sozialen Einrichtungen und zu ihrer Ausstattung erheben. • Der Verlauf einer begleitenden Forschung soll sich nicht zu weit von der Praxis entfernen. Vergleichbar den Lernprozessen in der Bildungsarbeit bedarf es deshalb regelmäßiger Rückkopplungen, um die Mitarbeit der PraktikerInnen und Teilhabe am Erkenntnisprozess zu gewährleisten (vgl. Schmidt 1994, 88-89). Dazu können neben Gruppendiskussionen schriftliche Befragungen dienen, meist in kurzer Form. Die Ergebnisse fließen ein in Gespräche über den Forschungsprozess, um Reaktionen auf Forschungsimpulse und auf Zwischenergebnisse sowie die Festlegung neuer Erhebungsphasen abzustimmen. Dadurch werden „Objekte 208 7.2 ZU DEN ERHEBUNGSMETHODEN der Forschung“ tendenziell zu „Subjekten der Forschung“ im Verstehen, Fragenstellen, Abwägen und Mitentscheiden. • Eine weitere Funktion ist die Selbstvergewisserung der Praxis durch Nachfragen zum Vorwissen (als Einzelne bzw. Gruppe), um Gruppendiskussionen vorzubereiten. Telefonische Befragung Diese Erhebungsmethode wird mittlerweile nicht nur in der Meinungs- und Marktforschung eingesetzt. Sie findet sich auch in sozialwissenschaftlichen Studien z.B. zu regionalen Lebenssituationen wieder (vgl. Schubert 1990). Diese Methode stützt sich auf eine hohe Telefondichte, die bereits 1988 für die Bundesrepublik mit 92% angegeben war (vgl. Frey u.a. 1990, 35). Erfahrungen mit dieser Methode und Untersuchungen dazu wurden zuerst in den USA gemacht. Dort liegt die Telefondichte bereits bei über 96%. In Standardwerken zur Sozialforschung wird diese Methode mittlerweile dargestellt (vgl. Atteslander 2000, 148f.). Es gibt jedoch Bedenken hinsichtlich geringerer Motivation der Befragten, fehlender Kontrolle der Befragungssituation, Verzicht auf schriftliche Erinnerungsstützen oder Vorlagen (vgl. ebd.). Institute wie ZUMA/Mannheim, Infratest/München und FORSA/Dortmund weisen allerdings auf positive Erfahrungen hin (vgl. Frey u.a. 1990, 24). Für die Telefonbefragungen sprechen die geringeren Kosten. Die Anforderung an das Personal sind durch Verzicht auf persönlichen Kontakt zu den Befragten niedriger und der Zeitraum der Befragung verkürzt sich erheblich. Die Schulung und Begleitung der Hilfskräfte (Interviewer) kann zentral von wenigen ForscherInnen durchgeführt werden. Bei der Wahl dieser Methode ist zu bedenken, dass es zwar eine hohe Ausschöpfungsquote von bis zu 70% gibt, allerdings sind bestimmte Personengruppen ohne Telefonanschluss, z.B. Minderjährige oder Wohnungslose, so überhaupt nicht zu erreichen. Die Personen müssen im Umgang mit dem Telefon geübt sein, und es muss ein Themenkreis angesprochen werden, bei dem die Präsenz der ForscherInnen und die dadurch erfolgte Motivation nicht erforderlich ist. Als wenig sensitiv gelten Fragen zum Freizeitverhalten, zum Medienverhalten, zu den Konsumgütern, zur Häufigkeit des Kirchgangs, zu den Rauch- und Trinkgewohnheiten. Dagegen gelten Fragen nach der politischen Einstellung, nach dem Einkommen und Vermögen sowie dem Sexualverhalten als problematisch (vgl. Reuband; Blasius 1996, 311). 209 7. ANNÄHERUNG AN SOZIALE ARBEIT DURCH PRAXISBEZOGENE FORSCHUNG Bei dieser Befragungsmethode sind bildhafte Darstellungen, Antwortkarten, nummerierte Antworten oder das anonymisierte Rückmeldeverfahren per Brief nicht möglich. Die Zeitspanne eines Telefonats sollte zehn bis 15 Minuten nicht überschreiten (vgl. Habermehl 1992, 163). Frey u.a. geben Befragungszeiten von bis zu 50 Minuten an (vgl. ebd. 1990, 49f.). Zugangsprobleme können entstehen, wenn ForscherInnen ohne Ankündigung in die Privatsphäre eindringen. Auch wenn die Teilnahme freiwillig bleiben soll, ist der Wunsch zu hoher Teilnahme handlungsleitend und beeinflusst das Verfahren, wie folgendes Beispiel belegt: „Guten Tag! Mein Name ist NAME. Von INSTITUT. Wir machen eine Umfrage. Es geht um THEMA. Und zwar möchte ich Sie fragen: ERSTE FRAGE. Der Befragte soll den Eindruck gewinnen, (1) daß es selbstverständlich ist, daß er alle Fragen beantwortet, und (2) daß die Befragung schnell geht“ (Habermehl 1992, 172). Als alleinige Untersuchungstechnik wirft die Telefonbefragung weitere Probleme auf. Verzerrungen entstehen durch privat und gewerblich kombinierte Telefoneinträge, Mehrfachanschlüsse und nicht registrierte Telefonnummern. Die daraus resultierenden Abweichungen sind für Meinungsumfragen z.B. nach der Zufriedenheit mit den Länderspielen der Nationalmannschaft oder bestimmten Konsumartikeln wenig relevant. 7.2.6 Dokumentenanalyse In der Sozialforschung wird die Dokumentenanalyse bzw. Inhaltsanalyse zwar als zentrale Erhebungsmethode dargestellt (vgl. Atteslander 1995, 224). Als solche gebräuchlich ist sie jedoch nur in wenigen Einzeldisziplinen wie Geschichte, Theologie, Rechts- und Kommunikationswissenschaften. Dokumentenanalyse kann weit definiert werden, dann bezieht sie sich auf Zeugnisse menschlichen Verhaltens wie Texte, Filme, Tonaufnahmen, aber auch auf Werkzeuge, Bauten oder Kunstobjekte. Damit bietet sich eine große Bandbreite an Material, um menschliches Denken, Fühlen und Handeln zu interpretieren (vgl. Mayring 1996, 33). Ein zentraler Vorteil der Dokumentenanalyse ist die Verwendung von vorhandenem Material. Vorliegende Einladungen, Protokolle, Konzepte oder Gutachten können rückblickend betrachtet und ausgewertet werden und blieben zum Zeitpunkt der Entstehung ohne Einwirkungen der ForscherInnen. Bei einer Prozessbegleitung können auch Materialien Verwendung finden, die parallel zum Forschungsprozess entstehen, dann wäre allerdings der Einfluss der Subjektivität der ForscherInnen und seiner Fragestellung zu berücksichtigen. 210 7.2 ZU DEN ERHEBUNGSMETHODEN Insbesondere für zurückliegende Ereignisse oder für den Fall, dass die Forschenden bestimmte Protokolle und Berichte zusätzlich zu eigenen Erhebungen verwenden wollen, eignet sich die Dokumentenanalyse. Für eine Praxisforschung, die die Arbeitsweise einer Arbeitsgemeinschaft untersucht, werden deren Pressemitteilungen, Leserbriefe, Einladungen, Broschüren und Faltblätter, Sitzungsprotokolle, Anträge und Beschlüsse und Berichte über Arbeitsergebnisse von Bedeutung sein (vgl. Moser 1995, 169). Die in diese Forschung einbezogenen Dokumente sind in Kapitel C2 dargestellt. Entscheidend sind letztlich die Auswahl aus der Fülle der Dokumente sowie die Art und Intensität der Bearbeitung. Dafür müssen Art, Zustand, Inhalt bzw. Aussagekraft, Absicht und Adressat des Dokuments sowie damit verbundene Fehlerquellen für die Forschung geprüft werden. Wichtig ist auch die Überprüfung der sozialen und zeitlichen Nähe sowie Herkunft oder Überlieferung (vgl. Mayring 1996, 34). „Dokumentenanalysen empfehlen sich immer dann, wenn ein direkter Zugang durch Beobachten, Befragen oder Messen nicht möglich ist, trotzdem aber Material vorliegt” (ebd., 35). Für die Praxisforschung wird die Dokumentenanalyse eher eine ergänzende Methode sein, die den Vorteil hat, an Formen der Selbstevaluation anzuknüpfen bzw. diese durch Forschung anzuregen (vgl. Spiegel 1996, 265f.). 7.2.7 Forschungstagebuch Wesentliche Bestandteile eines Tagebuchs in der Forschung sind Aufzeichnungen über unstrukturierte Beobachtungen, informelle Gespräche, Eindrücke, Empfindungen und Gedanken. Diese werden schriftlich festgehalten, auf den Begriff gebracht, können gegliedert, sortiert und strukturiert werden. Damit werden sie „der Erinnerung und reflektierenden Bearbeitung zugänglich gemacht“ (Fischer 1997, 693). Grundsätzlich ist es möglich, noch offenere und persönlichere Formen zu wählen, z.B. in Form eines fiktiven Briefes an eine befreundete Person. Häufiger eingesetzt wurde das Schreiben von Tagebüchern in Aktionsforschungsprojekten, besonders zur Untersuchung der Tätigkeit von Lehrenden (vgl. Altrichter u.a. 1997). In sozialen und pädagogischen Praxisfeldern gewinnen Evaluationsverfahren an Bedeutung. Zentrales Element der Evaluation ist die Dokumentation. Dies gilt auch für praxisbezogene Forschung, die phasenweise eine große Nähe zum Forschungsfeld eingeht. Zunächst kann eine Dokumentation eine unstrukturierte Sammlung von Feldnotizen sein, die nur chronologisch geordnet sind. Die ForscherInnen sammeln stichpunktartig, zunächst spon211 7. ANNÄHERUNG AN SOZIALE ARBEIT DURCH PRAXISBEZOGENE FORSCHUNG tan und unsystematisch möglichst viele „Beobachtungen, Gefühle, Reaktionen, Interpretationen, Reflexionen, Ahnungen, Befürchtungen, Hypothesen und Erklärungen“ (Moser 1995, 164). Aber auch wenig zielgerichtete Äußerungen wie Unsicherheiten, Phantasien und Wünsche, die im Zusammenhang mit der Arbeit entstehen, können hilfreich sein. Das wird umfangreich, und es ist sinnvoll, den Notizen mit der Zeit eine Struktur zu geben. Allerdings kann eine funktionalistisch am Fortgang des Projekts orientierte Dokumentation bestimmte Wahrnehmungen ausgrenzen. Hierdurch können im Forschungsprozess wichtige Hinweise, etwa auf verdeckte Konflikte, fehlende Recherchen, methodische Probleme verloren gehen. Für die Selbstevaluation in sozialen Einrichtungen wird ein Journal vorgeschlagen, um „anwesende Personen, Ereignisse, eigene Gefühle, Gedanken dazu, neue Informationen etwa über Kinder/Jugendliche, vom Amt, aus dem Stadtteil, Merkpunkte zum weiteren Vorgehen, Vorsätze, Ideen, Vorschläge, Anregungen“ (Spiegel 1996, 270) zu notieren. Das Journal kann mit mehreren gemeinsam, als Team oder von Einzelnen geführt werden. Es kann vorstrukturierte Spalten haben oder nachträglich sortiert werden. Moser nennt für die Praxisforschung Aufzeichnungen in Form eines Projektjournals oder eines Projekttagebuchs. Das Journal kann sowohl von den ForscherInnen als auch von Forschungspartnern erstellt werden. Es dient zur Verlaufsdokumentation mit der Möglichkeit, ergänzend Materialien zu sammeln und Kommentare zu notieren. Außerdem lassen sich mit einem Tagebuch eigene Erfahrungen im Lern- und Veränderungsprozess verfolgen. Vorab sollte in jedem Fall eine Vereinbarung getroffen werden, welche Fragen dafür von Bedeutung sind und wie zum Abschluss mit den Informationen umgegangen wird (vgl. Moser 1995, 162). Für das Forschungstagebuch wird eine der Selbstevaluation ähnliche Form vorgeschlagen, die „zwischen dem ‚freien Assoziieren‘ und einer zunehmenden Disziplinierung zu einer vollständigeren und präziseren Wahrnehmung sozialer Situationen“ (Kardorff vgl. 1988, 86) liegt. Der Vorteil ist die Schulung der latenten Aufmerksamkeit und eine Sensibilisierung für komplexe Konfigurationen. Grenzen der Tagebuchnotizen liegen darin, dass es oftmals schwierig ist, Verbindungen zwischen Aufzeichnungen und Forschung herzustellen. Die Notizen können autobiographischen Charakter bekommen und für Außenstehende nicht nachvollziehbar sein. Der Anspruch an (praxisbezogene) Forschung, „Emotionen am menschlichen Erkenntnisprozeß teilnehmen zu lassen“ (vgl. Meier-Seethaler 1997, 20) hat seine Berechtigung, muss allerdings für den Forschungsprozess handhabbar werden. PraxisforscherInnen 212 7.3 REFLEXION DES FORSCHUNGSPROZESS können Stimmungen aus dem Forschungsfeld aufnehmen, ohne dass im gleichen Moment die zugehörigen Fakten erhoben werden können oder verständlich sind. Dennoch wirken Emotionen in den Personen der ForscherInnen. Sie übernehmen Funktionen ähnlich einem Katalysator und erleben z.B. Spannungen im Forschungsfeld (als Hinweis auf mögliche Widersprüche) oder Ärger/Wut (als mögliche Rollen- oder Interessenkonflikte). Nadig hat für die ethnologische Feldforschung das Tagebuch als Verschriftlichung von Assoziationen eingesetzt und sieht darin Möglichkeiten auch „unbewußten Funktionsweisen“ auf die Spur zu kommen. Zeitliche Distanz und eine Zusammenarbeit mit KollegInnen oder in Supervision erfahrenen Personen helfen bei der Deutung solcher Notizen (vgl. ebd. 1986, 40/41). In ein Tagebuch gehören nach Girtler neben Adressen etc. auch „emotionale Betroffenheit, wie Ärger mit Personen, u.a.“ (ebd. 1984, 131). Zur Überprüfung lassen sich aus den Aufzeichnungen Themen herausarbeiten und Zusammenhänge als Hypothesen aufstellen, die, als Fragen an das Forschungsfeld formuliert, zurückgespiegelt werden können. Sie regen den Forschungsprozess an, werden diskutiert, provozieren eine weitere Auseinandersetzung und ggf. ein vertieftes Verständnis des Forschungsfeldes. 7.3 REFLEXION DES FORSCHUNGSPROZESS 7.3.1 Das Forschungsdesign Dieses Forschungsprojekt zeichnet sich aus durch die Verwendung von fünf Elementen, mit denen der Forschungsprozess geplant und strukturiert wurde und der es ermöglicht, im Verlauf Veränderungen vorzunehmen. Jedes Element enthält Interaktion und Kommunikation zwischen Praxisforscher und Untersuchten. Das ist beabsichtigt, weil sich dadurch zusätzlich zu den gezielten Erhebungen Einblicke in den Berufsalltag erschließen lassen. (1) Vertragsgestaltung (2) Zweiteilung der Forschung in Kontext und Prozess (3) Zentrale und ergänzende Erhebungsmethoden (4) Reihe von Untersuchungseinheiten (5) Rückkopplung und Diskussion 213 7. ANNÄHERUNG AN SOZIALE ARBEIT DURCH PRAXISBEZOGENE FORSCHUNG Über wiederholte Zwischenberichte und Diskussionen gelangen eine Auswahl und Fokussierung der Datensammlung und eine zyklische Form der Erkenntnisgewinnung (vgl. Moser 1995, 106f.). Damit nähert sich das Forschungsdesign in seiner Struktur den Handlungsvollzügen in der Sozialen Arbeit an. Die Verbindung von Kontext- und Prozessforschung ergänzt sich gut und hat sich bewährt, allerdings erfordert sie einen erheblichen Zeitaufwand und bringt eine Fülle von Datenmaterial, das zu bearbeiten ist. (1) Die Vertragsgestaltung bietet die Möglichkeit, Fachleute ins Untersuchungsfeld einzubeziehen und sie an der Entwicklung von Fragestellungen zu beteiligen. Das erhöht die Motivation zur Mitarbeit und schafft Vertrauen in der Anfangsphase der Forschung. Bereits die Zustimmung oder Ablehnung zu Untersuchungsthemen weist auf interessante Dynamiken hin, und die Konsenssuche gibt bereits Anhaltspunkte zur Struktur und Arbeitsweise der Gruppe oder Organisation. Das Recht auf Gegendarstellung im Abschlussbericht erhöht zusätzlich die Bereitschaft Auskünfte und Einblicke zu geben. (2) Die Zweiteilung der Forschung in Kontext- und Prozessforschung bietet die Chance verschiedene Wissensebenen (Fakten-, Regel- oder Ereigniswissen) zu erheben und miteinander zu verschränken (vgl. Moser 1995, 128). Damit können Hinweise aus einer Wissensebene Fragestellungen in einer anderen anregen und fördern. Aussagen in Interviews können im Prozess durch Beobachtung überprüft werden, und Beobachtungen können durch Interviews Erläuterung und Begründung erhalten. (3) Das Forschungsprojekt arbeitete mit zentralen Erhebungsmethoden des Leitfaden-Interviews und der teilnehmenden Beobachtung. Die Erhebungsmethoden sind der Untersuchung von Kontext und Prozess zugeordnet. Dadurch konnten Fragen von der jeweiligen Untersuchungsebene aus in den Blickpunkt genommen werden. Die Ergebnisse erweitern das Verständnis, weil sie einen zeitlichen Ausschnitt und den Verlauf einbeziehen. Streng genommen ist das kein Methodenmix. Allerdings gab es ergänzende Methoden, die Variationen der Erhebungen zuließen (Befragung, Dokumentenanalyse, Soziogramm, Gruppeninterview und Gruppendiskussion). Andere Methoden dienten der Steuerung von Rückkopplungsprozessen (Befragung) und der Reflexion des Forschungsprozesses (Tagebuch). (4) Die Reihe von Untersuchungseinheiten zu Sozialdaten, Selbstsicht, Fremdsicht, Sitzungen und Projekten ermöglichte die Konfrontation verschiedener Perspektiven. Durch die Gegenüberstellung konnten Komplexi214 7.3 REFLEXION DES FORSCHUNGSPROZESS tät und Vielfalt der sozialen Wirklichkeit abgebildet werden. Nicht alle Untersuchungseinheiten waren zu Beginn vereinbart, im Verlauf kamen neue Themen hinzu, für die Untersuchungen nachträglich konzipiert wurden. Dadurch bestand die Möglichkeit sich auf Veränderungen im Forschungsfeld einzustellen und neue Entwicklungen zu berücksichtigen. 7.3.2 Veränderungen im Forschungsprozess Die weitreichende Einbeziehung der Praxis in den Forschungsprozess und der mit Fachleuten im Stadtteil abgeschlossenen Vertrag sind eher selten anzutreffen. Üblicherweise vereinbaren in Kommunen die PolitikerInnen und die DezernentInnen mit Amtsleitungen, bei Verbänden die GeschäftsführerInnen in Zusammenarbeit mit Personalvertretungen den Einsatz von Forschungsprojekten. Sie wären bei frei finanzierten Projekten die Verhandlungspartner. Dieses Projekt stellt durch die Promotionsförderung eine Besonderheit dar, es konnte direkt mit Fachleuten an der Basis ein Forschungsvertrag geschlossen und daher in einer besonderen Weise auf die Perspektiven der Fachleute vor Ort eingegangen werden. Die Entscheidungskräfte aus Politik und Verwaltung wirkten nicht an der Entstehung des Forschungsprojekts mit, ihre Fragen flossen punktuell über Interviews nicht über den Gesamtprozess mit ein. Das wird vermutlich das Interesse an den Ergebnissen schmälern und weniger Auswirkungen auf ihre Arbeitsweisen haben. Die AG-TeilnehmerInnen hatten durch die Rückkopplung der Zwischenberichte mit anschließenden Diskussionen die Gelegenheit zur Reflexion und zur Veränderung. Eine Anwendung des neu erworbenen Wissens schon während der Erhebungen war möglich. Dadurch entstand ein methodologisches Problem. Der beabsichtigte Erkenntnisgewinn der Praxis veränderte Handlungsansätze und damit die Ausgangslage, sodass nicht mehr typische Zusammenarbeit im Berufsfeld erhoben werden konnte, sondern das Handeln unter der besonderen Bedingung nach einer durch Forschung angeregten Reflexion. Um die Veränderungen zwischen den Forschungsteilen zu erheben, wurden Beobachtungsprotokolle und Tagebuchaufzeichnungen ausgewertet, wie es auch für Organisationsentwicklung und Supervision empfohlen wird (vgl. Fatzer 1996). 215 7. ANNÄHERUNG AN SOZIALE ARBEIT DURCH PRAXISBEZOGENE FORSCHUNG 7.3.3 Lernprozesse durch Zwischenberichte und Diskussion Die Rückkopplung, das Zuschicken und Diskutieren der Zwischenberichte führte dazu, dass über die Einbeziehung von neuen AG-TeilnehmerInnen nachgedacht wurde. Die Vorstellungsrunde erhielt einen selbstverständlichen Platz zu Beginn jeder Sitzung, weil die Neuen dies für vorteilhaft hielten und sich mehr Einführung wünschten. Die Geschichte der AG wurde rekapituliert und die Grundregeln aufgeschrieben. Die Gegensätze zwischen offener Kinder- und Jugendarbeit und Erziehungshilfe und anderen betreuenden Arbeitsformen wurden deutlicher wahrgenommen. Dadurch entstand mehr Verständnis für die Verschiedenheiten der Arbeitsbereiche und Arbeitsschwerpunkte. Insgesamt wurden für viele Zusammensetzung, Ziele, Inhalte und Arbeitsweise der AG verständlicher. Dies fehlte bis zu diesem Zeitpunkt, weil es vorher keinen schriftlichen Überblick über Arbeitsform und Ergebnisse gegeben hatte. Der Anspruch zur Teilnahme an gemeinsamen Projekten und zur Entwicklung einer stadtteilorientierten Praxis wurde in Teilen zurückgenommen, weil nicht alle über gleich hohe Zeitbudgets für Projektarbeit verfügten. Die Interessenskonflikte wurden benannt und begründet, was die unterschiedlichen Positionen verständlicher machte. Neue Leute konnten sich positionieren, die Anzahl ihrer Redebeiträge nahm zu. Und es entstand eine gemeinsame Fragestellung, die für die zukünftige Arbeit der AG als bedeutsam angesehen wurde, nämlich die Einschätzung und Bewertung der Arbeit durch externe Fachleute mit Entscheidungsfunktionen in Administration und Politik. Nach der Diskussion des Fremdbildes von Entscheidungsträgern über die AG wurden einige Kritikpunkte der Entscheidungskräfte aufgegriffen und in Arbeitsabläufe integriert. Einige informierten sich durch die Niedersächsische Gemeindeordnung über die Rechte und Pflichten von KommunalpolitikerInnen. Ein Treffen mit BezirksratspolitikerInnen wurde vereinbart, die offenen Angebote der Einrichtungen gesammelt und aufgelistet. Bei den zwei Projekten Abendsport und Zukunftswerkstätten und dem Austausch und der Bearbeitung aktueller Themen und Probleme lief alles weiter wie zuvor. Beobachtete Wirkungen von Zwischenberichten, Reflexion und Diskussion können wie folgt zusammengefasst werden: Veränderungen durch Intervention oder Nutzung der Ergebnisse waren feststellbar; sie dienten als: • Bestandsaufnahme der bisherigen Arbeit, • Orientierung für neue TeilnehmerInnen, 216 7.3 REFLEXION DES FORSCHUNGSPROZESS • Dokumentation und Argumentationshilfe, • Arbeitshilfe zur Projektentwicklung, • Klärung von Traditionen und Regeln, • Anhaltspunkte zur Reflexion der Arbeitsweise, • Korrektur von Ansprüchen und Erwartungen, • Hilfe zur Wahrnehmung von Differenzen und Konflikten. Die Rückkopplung der Ergebnisse war geeignet, das Wissen über Vernetzung zu erhöhen und Transparenz herzustellen. Aufgegriffen wurden Erkenntnisse dann, wenn sie die Routine und Abläufe der AG nicht wesentlich störten. Die meisten Veränderungen bezogen sich auf den inneren Bereich der AG als Großgruppe. Das Verhältnis zu Entscheidungskräften in der Kommune blieb weitgehend ausgeklammert, weil dazu die Mitarbeit der externen Fachleute erforderlich gewesen wäre. Die Veränderungsprozesse wären komplexer geworden und hätten erhebliche Rückwirkungen auf die Binnenstruktur der AG zur Folge gehabt. Die Erkenntnisse des Forschungsprojekts blieben ungenutzt bei der Bearbeitung von Konflikten zwischen AG-TeilnehmerInnen oder mit den Entscheidungskräften. Das Konfliktverhalten der AG blieb auf einer strategisch-politischen Ebene und äußerte sich überwiegend durch öffentliche Stellungnahmen, fachliche Forderungen und Anträge, interne Diskussionen, eigene Schwerpunktsetzung und Abgrenzung von anderen Fachrunden. Dieses Vorgehen ließ Beziehungsaspekte vielfach unberücksichtigt. Wichtige Fragen des Selbstverständnisses der AG und der Perspektiven für Soziale Arbeit in der Kommune lassen sich nicht allein aus der internen Dynamik der AG heraus erklären und verändern. Darüber müsste mit den Entscheidungskräften diskutiert und verhandelt werden. Für die Prozessforschung waren die Projekte Abendsport und Zukunftswerkstätten ausgewählt worden, weil dabei insbesondere das Zusammenwirken von Fachleuten im Stadtteil und Entscheidungsträgern verfolgt und herausgearbeitet werden konnte. Dieser Themenbereich blieb durch die Rückkopplung und Diskussion der Zwischenberichte weitgehend unverändert. Die Entscheidungsträger waren nicht am Rückkopplungsverfahren beteiligt und die Konfliktkonstellationen blieben erhalten. 217 7. ANNÄHERUNG AN SOZIALE ARBEIT DURCH PRAXISBEZOGENE FORSCHUNG 7.4 ZUR ROLLE DES PRAXISFORSCHERS Bei der Praxisforschung kann sich der jeweilige Fokus verändern, weil den Partnern im Forschungsverlauf Einfluss auf die Fragestellungen zugestanden wird. Beim Kontext können ergänzende Erhebungen erforderlich werden, z.B. um die Stadtteilgeschichte zu erkunden oder um die Entstehung eines zentralen Konflikts zu verstehen. Zur Steuerung des Forschungsprozesses und zur Intensivierung von Rückkopplungen und Diskussionen sind Hilfsmethoden erforderlich, z.B. um an bestehendes Wissen anzuknüpfen oder um alle TeilnehmerInnen auf den selben Informationsstand zu bringen. Mit Befragung, Gruppendiskussion und Forschungstagebuch lassen sich gleichzeitig der Prozess steuern und Daten erheben. Besonderheit dieser Praxisforschung ist ein längerer Zeitraum der „beobachtende Teilnahme“ an Gruppenprozessen (vgl. Honer 1989). Durch strukturierte und unstrukturierte Beobachtungen (vgl. Girtler 1984) erhält er zusätzliche Ergebnisse, weil er partiell eingebunden ist in Informationsaustausch, Ereignisse und Interaktionen und sich darüber nicht nur Fakten, sondern auch emotionalen Gehalt und Bedeutungen sozialer Wirklichkeit erschließen. Die große Nähe zur den Fachleuten vor Ort und deren Alltag stellt besondere Anforderungen an den Praxisforscher: Äußerungen zur eigenen Person zuzulassen, sich in Selbst- und Fremdwahrnehmung zu üben und Wahrnehmungen von emotionaler Dynamik in den Forschungsprozess zurückfließen zu lassen. Dazu bedarf es einer größeren Vielfalt von Forschungsmethoden. Die Bereitschaft zur Offenheit in der Wahrnehmung und zu eigenen Lernprozessen kann dabei hilfreich sein. Darin sollten Praxisforscher bereits eine ausreichende Übung haben. Die Praxis wird sich nicht nur über Methoden oder Verfahren der Forschung auseinandersetzen, sondern auch aufgrund der Nähe versuchen, die Person des Forschers in inhaltliche Auseinandersetzungen einzubeziehen. Die gewünschte Reflexion der Praxis erhöht auch die Bereitschaft, den Forscher und die von ihm ausgewählten Methoden, Verfahren und erzielten Ergebnisse der Forschung zu kritisieren. Es kommt häufiger zur Gegenüberstellung von Forscher- und Praxissicht. Diese Auseinandersetzung ist gewollt, denn solche Diskussionen ergeben, über die ersten Ergebnisse hinaus, vertiefte Einsichten in Zusammenhänge. Dafür ist eine Beweglichkeit im Umgang mit Erhebungsmethoden Voraussetzung, auch um Widerstände im Forschungsprozess zu berücksichtigen und berechtigte Kritik darin 218 7.4 ZUR ROLLE DES PRAXISFORSCHERS einzubeziehen. Das reflektierte Erleben des Praxisforschers kann nicht nur zusätzlich als Medium der Erkenntnis eingesetzt werden, sondern ist auch nötig, um den Forschungsverlauf zu korrigieren und in Zeitabständen wieder Distanz zu den Prozessen in der Praxis herzustellen. Dafür wurden neben den gezielt eingesetzten Erhebungsmethoden wie Leitfaden-Interview, Gruppendiskussion oder teilnehmende Beobachtung ein Forschungstagebuch geführt, in das regelmäßig unstrukturierte Wahrnehmungen von Ereignissen, Gruppenprozessen und die Reaktionen des Praxisforschers notiert wurden. Daraus ließen sich jeweils neue Fragestellungen entwickeln. Das Tagebuch ist eine wenig gebräuchliche Forschungsmethode. Sie ist in der Praxis- und Feldforschung nötig, um Schwierigkeiten und Annäherungen im Forschungsprozess zu beschreiben und eigene, zunächst vage Wahrnehmungen bearbeitbar zu machen. Die Rolle als Praxis- und Feldforscher beinhaltet emotionale Nähe und partielle Identifikation. Mit Hilfe selbstreflektiver Methoden kann es gelingen, diese zu kontrollieren und darüber weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Daneben werden die Forschungsschritte dokumentiert. Es ist eine Hilfe, um Unvorhergesehenes, Blockaden und Widerstände, Konflikte im Forschungsprozess, aber auch im Forschungsfeld (Inhalt, Form und Beziehung) zu sortieren. Bei Konflikten im Feld kann der Forscher als Zuhörer und Beobachter vergleichbar mit einem Organisationsentwickler die Funktion eines Katalysators einnehmen (vgl. French; Bell 1999, 31). Er fühlt mit und kann verstehen, welche Dynamik sich hinter den Äußerungen verbirgt. Anders als in einer Supervision oder Organisationsentwicklung gilt es, nicht direkt Probleme anzusprechen und zu intervenieren. Erhebungen und Rückkopplungen sind so zu entwickeln, dass sie sich im Rahmen des Forschungsdesigns dokumentieren und methodisch kontrollieren lassen. Die Notizen sind in dem hier geführten Forschungstagebuch in drei Rubriken unterteilt: (a) Beobachtungen im Stadtteil, (b) Gesprächskontakte mit Fachleuten im Feld, (c) Erleben und Rolle als Praxisforscher (vgl. P5-7). (1) Beobachtungen im Stadtteil ergaben sich beim Weg zu den monatlichen Sitzungen der AG, zu den Interviews in den Einrichtungen, bei der Begleitung von Aktionen, beim Verweilen auf der Parkbank oder im Café. Es sind Momentaufnahmen, die in der Art eines Blitzlichts nur kleine Ausschnitte 219 7. ANNÄHERUNG AN SOZIALE ARBEIT DURCH PRAXISBEZOGENE FORSCHUNG von Begebenheiten, Gesprächen der Menschen auf Plätzen, Straßen und bei Treffpunkten wiedergeben. Vereinzelt haben sich Gespräche zwischen Praxisforscher und den BewohnerInnen entwickelt über den Alltag, das Leben im Stadtteil, eher beiläufig. (2) Gesprächskontakte ergaben sich überwiegend zu den TeilnehmerInnen der AG, vor oder nach den monatlichen Sitzungen oder anderen Terminen sowie bei telefonischen Verabredungen oder gezielten Nachfragen. Hier waren die Kurznotizen zur eigenen Orientierung nützlich (wen habe ich wann angerufen, wen noch nicht?) aber auch um den Forschungsverlauf zu dokumentieren (was passierte, in welcher Reihenfolge zusätzlich zu den Erhebungen?). (3) Durch Dokumentation des Forschungsablaufs und subjektiven Einschätzungen über Ereignisse, Beteiligte und sich selbst bietet sich damit auch eine Möglichkeit, den Forschungsprozess zu reflektieren. In Forschungsprojekten drehen sich Empfindungen und Gedanken des Forschers oftmals im Kreis. Bestimmte Themen können rätselhaft sein, manche werfen Fragen auf, andere sind verschwommen und nicht recht greifbar. Besonders schwierig zu bearbeiten sind die Stimmungen, die den Praxisforscher mitfühlen lassen (ihn ärgern, empören, enttäuschen), die ihn in Schwingung versetzen, weil er zunächst Worte, Gesten, Aktionen im Forschungsprozess aufnimmt und sich die Äußerungen zunächst nicht erklären kann. Gleichzeitig ist Zurückhaltung gefordert, weil unmittelbare Reaktionen die Ereignisse im Feld unzulässig verändern würden. Die rezeptive Haltung verbunden mit einer persönlichen Nähe stellt besondere Anforderungen an diesen Forschungstyp, denn die praxisbezogene Forschung ist überwiegend eine kognitive Verarbeitung von sozialer Wirklichkeit. Gefühle werden nicht szenisch im Rollenspiel dargestellt. Es wird nicht getanzt oder gesungen, auch nicht bildhaft ausgedrückt. Die Erlebnisse, auch die Introspektive wird beschrieben, geordnet. Es wird analysiert und verglichen, es werden Verbindungen gezogen und Ergebnisse in einen allgemeinen theoretischen Rahmen gestellt. Nachteilig sind deshalb Forschungsvorhaben, die nicht im Team bearbeitet und reflektiert werden können. Nach etwa einem Jahr der Forschung wurden die AG-TeilnehmerInnen im Dezember 1998 in einer schriftlichen Kurzbefragung gebeten, sich an den Beginn der wissenschaftlichen Begleitung zu erinnern und die Rolle des Praxisforschers einzuschätzen. Der Forscher wurde zu Beginn als Wissenschaftler/Beobachter (6x) und von einigen als Fremder/Besucher (3x) gese220 7.4 ZUR ROLLE DES PRAXISFORSCHERS hen. Andere sahen ihn als Sozialarbeiter/Kollegen (5x). Diese Sicht veränderte sich. Dabei sind zwei Gruppen mit verschiedener Tendenz festzustellen. Die AG-TeilnehmerInnen, die sich bei den Zukunftswerkstätten engagierten, sahen durch zusätzliche Kontakte und Gespräche im Begleitprozess (in Phase 5) eher den Kollegen (7x) und weniger den Wissenschaftler (2x). Während bei den anderen in der AG eher das Bild des Beobachters und Wissenschaftlers (5x) Konturen annahm und weniger der Kollege (1x) genannt wurde. Daraus lässt sich ableiten, dass die aktive Mitarbeit der AGTeilnehmerInnen an begleiteten Projekten ihre Perspektive zur Forschung verändert und sich der anfängliche Vertrauensvorschuss durch Erfahrungen mit konkreten Forschungsphasen einlöst. Es ist zu vermuten, dass damit auch Lernprozesse in den Vorhaben einhergehen. Als Haltungen gegenüber dem Forschungsprojekt bzw. dem Forschungsmitarbeiter wurden überwiegend „Offenheit und Interesse“ (11x) genannt, seltener „Unsicherheit und Skepsis“ (2x). Weitere Äußerungen lauteten: „gut war das Interview über die eigene Tätigkeit, um sich über Rolle und Aufgaben bewußt zu werden“ und „gut, daß jetzt alle wissen, wie die AG richtig heißt.“ Geschätzt wird „die Objektivität der Beobachtungen als Außenstehender“. Für die AG-TeilnehmerInnen ist es „spannend die Ergebnisse zu erfahren“ und dadurch entsteht „ein gutes Gefühl, daß unsere Arbeit wertgeschätzt wird“ (vgl. V10b). Die Folge für den Forschungsprozess war ein häufiger Einsatz von ergänzenden Methoden, um mehr AG-TeilnehmerInnen anzusprechen. Jede Forschungsphase sollte für möglichst viele nachvollziehbar sein. Dazu wurden Rückfragen gestellt, Zusammenfassungen von Zwischenberichten angeboten, nach Schwerpunkten für weitere Erhebungen gefragt. Das war insofern wichtig, als TeilnehmerInnen der AG wechselten, die AG sich erweiterte, einige unregelmäßig teilnahmen. Der Forschungsprozess war zusätzlich erschwert durch die große Anzahl von 21 beteiligten Einrichtungen. In dieser relativ großen Runde wurden Möglichkeiten zur Reflexion und zum Lernen ungleich wahrgenommen, zumal nur die Hälfte der Beteiligten in die Projekte der AG direkt involviert war. Andererseits wirft die bisher verbreitete Zurückhaltung bei Interventionen im Forschungsfeld die Frage auf, ob es ein Setting geben kann, das sowohl die kognitive als auch die körperlich-emotionale Ebene für praxisbezogene Forschung neuen Typs zulässt. Organisationsberatung und -entwicklung nutzen mittlerweile „Spielsequenz, körpersprachliche Positionierung, szenische Arbeit, themenzentriertes Theater, Vortragstheater“ (Hirschfeld u.a. 221 7. ANNÄHERUNG AN SOZIALE ARBEIT DURCH PRAXISBEZOGENE FORSCHUNG 2000, 30f.), um durch partizipatorische Elemente erlebbare und vielschichtige Abbilder von Organisationen entstehen zu lassen. In Supervisionsprozessen und im Psychodrama wird Rollenspiel als Methode der Reflexion von Team-, Personalentwicklung und Organisationsentwicklung angewendet (vgl. Moreno Institut 2000). 7.4 PERSPEKTIVEN FÜR DIE PRAXISFORSCHUNG 7.4.1 Methodologische Probleme einer Praxisforschung Diese Form der Praxisforschung hat zu Beginn Kontextbedingungen erhoben, was für Außenstehende eher als Dokumentation erscheint. Es handelte sich aber um eine mühsame Arbeit des Erfragens, Dokumentierens und Strukturierens. Themen wurden herausgearbeitet, die den TeilnehmerInnen nicht als schriftliche Konzeption vorlagen und auch in Diskussionen als Wissen nicht verfügbar waren. Durch das Herausarbeiten können unterschiedliche Positionen zur Sprache gebracht werden, und erst darüber lassen sich gemeinsame und kontroverse Positionen verdeutlichen. „Die wichtigsten Entdeckungsmethoden sind Variation bei Beobachtung und Experiment und die Feststellung von Ähnlichkeit bzw. Analogie (Mach, 1905) – beides sind auch Alltagsmethoden. Entdeckungen sind Prozesse, durch die sich das Vorverständnis von den Gegebenheiten den (neuen) Tatsachen anpaßt. Dadurch werden die bisherigen Ansichten überwunden, man kann auch sagen kritisiert. Entdeckende Forschung ist also kritisch: nicht kritisierend von einem wie auch immer begründeten Standpunkt aus, sondern kritisch durch den Fortgang des Entdeckungsprozesses selbst“ (Kleining 1995, 15). Bereits in der ersten Erhebungseinheit ist ungewollt Beeinflussung enthalten. Die Art und Weise der Fragen kann bereits auf Probleme aufmerksam machen, zum Nachdenken anregen und zu Veränderungen führen. Allein die Teilnahme an Interviews fördert Prozesse der Selbstreflexion und Anregungen zum Lernen. Dadurch stellt sich die Frage nach dem Eingriff in Handlungszusammenhänge. Forschung kann nicht so tun, als könnte sie ohne Veränderung einen Tatbestand untersuchen (vgl. Cicourel 1974). Allerdings gilt die Prämisse, dass der eigene Anteil (Ziele, Vorwissen, Rolle, Urheberschaft) aufgedeckt und reflektiert wird. Die Eingriffe sollen anders als bei der Aktionsforschung beschränkt werden auf forschende Aktivitäten, ohne selbst im Feld tätig zu werden (vgl. Haag u.a. 1972; Hameyer 222 7.4 ZUR ROLLE DES PRAXISFORSCHERS 1977). Für die Praxisforschung hat sich bewährt, Zwischenergebnisse zu diskutieren und Untersuchungseinheiten mit Diskussion zyklisch aufeinander aufzubauen. Zur Untersuchung und Gestaltung dieser Forschungsprozesse ist eine Vielfalt von Erhebungsmethoden sinnvoll, mit der auf Veränderungen im Forschungsfeld reagiert werden kann. Dadurch erhält Praxisforschung gegenüber traditioneller Sozialforschung mehr Flexibilität. Vorgehen und Methoden können verändert werden, wenn sich die Aktivitäten der Praxis vom Forschungsplan entfernen. 7.4.2 Rückmeldung der AG-TeilnehmerInnen Alle an der Rückmeldung zur Forschung beteiligten AG-TeilnehmerInnen sehen einen Nutzen für ihre Arbeit. Diese gemeinsame Einschätzung besteht trotz Unterschieden beim Eintritt in die AG und bei der aktiven Mitarbeit in Projekten. Auch die Bereiche Kinder- und Jugendarbeit und Erziehungshilfe teilen diese Meinung in gleicher Weise: „Ein positiver Effekt ist darin zu sehen, die AG-Treffen zu reflektieren und den Sinn dieser Treffen deutlich zu machen, das motiviert ... Bessere Einschätzung der Arbeit im Stadtteil und Klärung des Selbstverständnisses wurden erreicht ... Sichtweisen anderer Personen und Einrichtungen wurden deutlicher und nachvollziehbarer“ (V18). In der Forschung wurden Offenheit und Transparenz des Verfahrens und die regelmäßigen Zwischenberichte geschätzt. Die Erstinterviews in den Einrichtungen wurden als gelungener Einstieg und als zeitliches und persönliches Entgegenkommen bewertet: „Die Person, der Forscher wurde als ‚echt‘ erlebt, als Begleiter mit Fragen und kritischem Blick. Forschung ist ganz nah an der Arbeit dran. Sie war nicht abgehoben und auf Zahlen ausgerichtet, sondern gibt ‚Erlebtes‘, Arbeitserfahrungen wieder. Mir hat das Forschungsprojekt sehr gut gefallen und ich würde vielen AGs, Stadtteilen so eine Forschung wünschen – es war keine Beforschung sondern eine kritische Begleitung, die Nutzen für die Arbeit gebracht hat“ (V18). Allerdings gibt es deutliche Wünsche, zukünftige Forschungsprojekte zeitlich zu straffen und die Zwischenberichte erheblich zu kürzen. Die Mehrheit war bereit, Berichte mit 7 bis 15 Seiten aufzunehmen. Lediglich zwei Personen, die in der AG Funktionen innehaben, wären bereit, 20 bis 30 Seiten zu lesen und zu verarbeiten. Mehrheitlich wurden an die Forschung Erwartungen nach Beratung und Empfehlungen für die Arbeit herangetragen. Zukünftig sollte der Praxisforscher: 223 7. ANNÄHERUNG AN SOZIALE ARBEIT DURCH PRAXISBEZOGENE FORSCHUNG „Anregungen geben und kritische Anmerkungen machen ... Nicht nur Beobachtungen und Feststellungen neutral darstellen, sondern (mündlich) darstellen, was Dir kritisch aufgefallen ist, welche Anregungen Du der AG geben würdest, welche Entwicklungsmöglichkeiten Du siehst. Laß’ uns von Deinen Einblicken profitieren, bezieh’ Stellung!“ (V18). Es ist möglich, zu Beginn den Ist-Stand durch kürzere Methoden zu erheben, z.B. ein Gruppendiskussionsverfahren und einzelne strukturierte teilnehmende Beobachtungen mit einem eng begrenzten Auftrag einzusetzen. Voraussetzung wäre, dass die Akzeptanz gegenüber der Forschung groß genug ist oder ein Veränderungsanlass bzw. -druck besteht und dass die Fragestellung deutlicher herausgearbeitet wäre. Es ließen sich auch etwa Partnerinterviews durch die AG-TeilnehmerInnen selbst durchführen, um Kosten und Zeit zu reduzieren. Nachdem eine Einigung über die zu erfragenden Sachverhalte bestünde, könnten mit einem anderen Forschungsdesign Erfahrungen und Meinungen erhoben werden. Auf umfangreiche Untersuchungseinheiten und deren Kombination müsste dann allerdings verzichtet werden. 7.4.3 Praxisforschung oder Organisationsberatung? In den Einrichtungen sozialer Arbeit sind in vielen Bereichen wissenschaftliche Untersuchungen durch Supervision und Organisationsentwicklung abgelöst worden (vgl. Puhl 1999). Problem- und lösungsorientierte Fort- und Weiterbildung werden häufig betriebsintern, aber auch unter Hinzuziehung von externen Fachleuten durchgeführt (vgl. Fiedler 1996). In den Vereinen, Verbänden und Kommunalverwaltungen sind Neu- und Umorganisationen aufgrund von Einsparungen und höherer Wirtschaftlichkeit gefragt (vgl. Reichard; Wollmann 1996). Unterschieden wird zwischen Supervision und Organisationsentwicklung. Supervision kennzeichnet eine „Beratungsmethode, die zur Sicherung und Verbesserung der Qualität beruflicher Arbeit eingesetzt wird“ und „bezieht sich dabei auf psychische, soziale und institutionelle Faktoren“ (vgl. DGSv 1996, 11). Darin geht es um Entwicklung von Konzepten, Strukturveränderungen und Berufsrollen. Organisationsentwicklung bezeichnen French und Bell als „eine langfristige Bemühung, die Problemlösungs- und Erneuerungsprozesse in der Organisation zu verbessern, vor allem durch eine wirksamere und auf Zusammenarbeit gegründete Steuerung der Organisationskultur“ (ebd. 1995, 31). Dabei fließen betriebswirtschaftliche Konzepte in Non-Profit-Organisationen ein. Es wird danach 224 7.4 ZUR ROLLE DES PRAXISFORSCHERS gefragt, wofür Ergebnisse von Forschung geeignet sind und in welcher Zeit überhaupt Ergebnisse erzielt werden. Das stellt besondere Anforderungen an praxisbezogene Forschung. Einerseits sind effektive Designs und Erhebungsmethoden für Studien zu entwickeln, andererseits sind Verbindungen zu Supervision und Organisationsentwicklung herzustellen, um zu klären, wie Forschung, Beratung und Entwicklung kombiniert werden können. Kommunikative Formen der Organisationsuntersuchung und -entwicklung werden angestrebt, um Prozesse einzubeziehen (vgl. Giesecke; Rappe-Giesecke 1997). Eine Verbindung von Forschung und Beratung ist auch in der praxisbezogenen Forschung häufiger anzutreffen. Dabei wird bisher darauf geachtet, dass in der ersten Phase geforscht und in der zweiten Phase eine Beratung angeboten wird. Die Phasen bleiben streng getrennt (vgl. Bohn 1997; ISSAB 1995). Hier wird entscheidend sein, wie Forschungspläne und Methodenkontrolle entwickelt werden und ob Forschungsteams beide Funktionen kompetent ausfüllen können. Neben grundsätzlicher Verständigungsprobleme zwischen Wissenschaft und Praxis können Schwierigkeiten entstehen, wenn viele Hierarchiestufen in einen Forschungsprozess einbezogen sind. Die Dienst- und Fachaufsicht der Leitungskräfte könnten die Entwicklung vertrauensvoller Kontakte stören und dadurch Zugänge zum Forschungsfeld versperren. Hier wäre eine personelle und funktionale Trennung von Forschung und Beratung hilfreich, Ergebnisse aus dem Forschungsprozess würden allgemein zugänglich und verwendbar. Dagegen könnte der Beratungsprozess einen besonderen Vertrauensschutz für interne Informationen bieten. 7.4.4 Verbindung von Forschung und Beratung Praxisbezogene Forschung widmet sich den Themen, die vielfach von Organisationsentwicklung oder Supervision aufgegriffen werden. In der Arbeit wird weitgehend auf empirische Voruntersuchung im Feld, auf Dokumentation der Prozesse und Veröffentlichung verzichtet, wenn Organisationsentwicklung stattfindet. Forschung setzt mit ihren Methoden stärker auf die Verschriftlichung und Veröffentlichung von Analysen, Konzepten und Maßnahmen. Wichtig bei einer Kombination wäre, die Untersuchungseinheiten von Forschungsprojekten zu beachten. Jede Phase bzw. Untersuchungseinheit stellt andere Anforderungen an die ForscherInnen und benötigt andere Erhebungsmethoden. Die zentralen Teile für zukünftige Forschungs- und Bera225 7. ANNÄHERUNG AN SOZIALE ARBEIT DURCH PRAXISBEZOGENE FORSCHUNG tungsprozesse könnten sein: Kontextforschung, Prozessforschung und Beratung. In diesem Projekt haben sich die Grunderhebungen mit Leitfaden-Interviews zur Innensicht und Außensicht der Arbeitsgemeinschaft bewährt, weil viele Aspekte und Perspektiven einfließen und ausgewertet werden konnten. Eine Zusammenfassung diente zur Selbstvergewisserung und Überprüfung der Arbeit. Die Fachleute konnten ihre Positionen intern mit BerufskollegInnen und extern mit fachfremden Professionen vergleichen. Darauf aufbauend konnten Fragen und Probleme präzisiert werden. Die Bearbeitung weiterer Fragen auf der Basis der erhobenen Selbst- und Fremdsicht wäre auch durch Beratung denkbar und weitere Schritte (ob Forschung oder Beratung) könnten unter finanziellen, zeitlichen und inhaltlichen Aspekten abgewogen und entschieden werden. Um den gesamten Ablauf zu verkürzen, könnte Beratung die Prozessforschung ersetzen. Da Beratungsprozesse selten dokumentiert und veröffentlicht werden, wäre der Gewinn für die Fachöffentlichkeit geringer. Die Praxis würde dann lediglich zum Kontext untersucht. Die erkenntnisleitende Frage zum Prozess könnte nicht mehr systematisch verfolgt werden, und damit müssten Anhaltspunkte aus der Kontextuntersuchung (als Grunderhebung) genügen, um Beratungsprozesse durchzuführen. Das würde den Verzicht der thematischen Vertiefungen und die Begleitung über einen längeren Zeitraum bedeuten. Es wäre auch möglich, nur den ersten Teil der Kontextuntersuchung (Interviews mit TeilnehmerInnen der AG) durchzuführen, um lediglich das Selbst- und nicht das Fremdbild zu erheben. Ein darauf folgender Einstieg in den Beratungsprozess hätte zur Folge, dass ohne empirische Erhebung des Fremdbildes (Außensicht durch Verwaltung und Politik) beraten würde. Die BeraterInnen müssten diese Perspektiven mitbedenken und ergänzen. Dafür müsste eine Konzeption mit der Kombination beider Elemente für die Forschung entwickelt werden. Anleihen sind sicher bei Supervision und Organisationsentwicklung zu nehmen. Organisationsentwicklung arbeitet häufig mit der Aktionsforschung von Kurt Lewin und geht davon aus, dass „diese Untersuchung keine neutrale Betrachtung ist, sondern vielmehr bereits einen Eingriff in das System darstellt und die beobachtbaren Prozesse selbst beeinflußt“ (vgl. Graeff 1996, 196). Mit dem Angebot kurzfristiger Analysen mit unmittelbarer Veränderung haben Organisationsentwickler unterschiedlicher Ansätze und Schulen der organisationssoziologischen Forschung vom Markt verdrängt. Sie schaff226 7.4 ZUR ROLLE DES PRAXISFORSCHERS ten es, sich auf verschiedene Formen von Organisationen einzustellen und haben dafür ein breites Methodenrepertoire zur Verfügung (vgl. ebd. 201f.). Die angloamerikanische Forschung verbindet beide Strömungen (vgl. Argyris 1997). Insbesonders das Massachusetts Institute of Technology (MIT) hat sich mit Organisationen und Management beschäftigt und den Begriff der „lernenden Organisation“ entwickelt (vgl. ebd.1998). Die in Unternehmen entwickelten Verfahren finden auch in Non-Profit-Organisationen Verwendung. Erhebungsmethoden werden eher als Hilfsmittel betrachtet und so eingesetzt, dass auf spezielle Anforderungen wirksam reagiert werden kann. Methodenkritik und -kontrolle haben einen geringeren Stellenwert als in der Organisationssoziologie, die mehr Reflexion und Diskussion der Methoden fordert (vgl. Grunow; Wohlfahrt 1984, 257). Das kann dazu führen, dass betriebswirtschaftliche Elemente gegenüber gesellschaftstheoretischen Anteilen dominieren. Praxis und Funktion erhalten ein Übergewicht gegenüber der kritisch-theoretischen Ebene. Auch praxisbezogene Forschung wird Designs entwickeln müssen, die in kurzer Zeit Ergebnisse erarbeiten kann und die für die Praxis einen erkennbaren Nutzen bieten. Der Verkauf von Teilleistungen aus dem Forschungskontext wird gefragt sein, und die Kombination mit Organisationsberatung und –entwicklung kann neue Forschungsdesigns fördern. Die Angebote müssen für die Praxis durchschaubar sein. Sie können aus Elementen der wissenschaftlichen Arbeit, wie z.B. Dokumentation und Veröffentlichung, Analysen und Vergleich von Modellen oder Konzeptionen, Wissensaustausch und Beratung bzw. Moderation bestehen. Grundsätzlich scheinen in der Kombination von Forschung und Beratung noch Möglichkeiten zu liegen, die entwickelt werden können. Das Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Frankfurt/M. hat diesen Schritt bereits unternommen und versteht sich: „immer stärker unternehmensberatungsähnlich ... als modernes Praxisberatungs- und Praxisforschungsinstitut“. Damit wird angestrebt „fachliche Standards ... fortzuentwickeln und zu sichern“ sowie „das fachlich gebotene stets mit Ressourcenüberlegungen zu verbinden“ (Kreft 1997, 19). Die Praxistauglichkeit wird dadurch belegt, dass Leistungen nachgefragt werden, über die Gründung einer ISSConsult GmbH wird nachgedacht. Das Beratungs- und Forschungsfeld ist auch ein umkämpfter Markt mit starker Konkurrenz. Derzeit haben Supervision und Organisationsentwickung in der Sozialen Arbeit einen hohen Stellenwert, wenn man die Zahl der Veröffentlichungen mit denen zur Praxisforschung vergleicht. Allerdings scheint an den Fachhochschulen empi227 7. ANNÄHERUNG AN SOZIALE ARBEIT DURCH PRAXISBEZOGENE FORSCHUNG rische Forschung bei der Untersuchung kleinerer Praxisprojekte sowie für die Ausbildung notwendiger zu werden und erhält zusätzliche Legitimation durch den Ausbau von Materstudiengängen (vgl. Heine 1999; Keedy 1999). 7.4.5 Praxisforschung oder Sozialarbeitsforschung? Die Diskussion um Sozialarbeitswissenschaft (vgl. Wendt 1994; Puhl 1996, Pfaffenberger u.a. 2000) entstammt dem wissenschaftstheoretischen Diskurs um eine „eigene Grundlegung als Sozialwissenschaft“ (vgl. Haupert 1995, Engelke 1992), verbunden mit einer hochschulpolitischen Professionalisierungsdebatte und bezieht sich selten auf empirische Studien oder Veröffentlichungen zur Praxisforschung (vgl. Heiner 1988a; Kardorff 1988; Müller 1988; Moser 1995). Die begrenzte Förderung von Forschung an den Fachbereichen Sozialpädagogik/Sozialarbeit bzw. Sozialwesen und damit auch das dafür fehlende wissenschaftliche Personal verstärken eher die theoretisch-wissenschaftlichen Debatten, weil fundierte Forschungsvorhaben mit empirischen Ergebnissen und Beiträgen zur Methodologie einer Forschung der Sozialen Arbeit fehlen (vgl. Salustowicz 1995; Böttger, Lobermeier 1996). Vielfach sind VertreterInnen der Bezugswissenschaften mit ihren forschungstheoretischen Positionen dominierend. SozialarbeiterInnen sind eher als Lehrkräfte für besondere Aufgaben, insbesondere in praxisbezogenen Seminaren und Projekten tätig. Deren praxisbezogenes Wissen resultiert zwar aus einer Vielzahl von Beratungs- und Supervisionsprozessen, bleibt jedoch häufig nicht wissenschaftlich ausgewertet und unveröffentlicht. Dennoch beziehen sich mittlerweile, angeregt durch Institutsgründungen und Promotionsförderungen, etliche Forschungsprojekte auf Soziale Arbeit (vgl. Meier 1999). Der Stellenwert von Praxisforschung der Sozialen Arbeit oder Sozialarbeitsforschung an Fachhochschulen ist u.a. abhängig von den jeweiligen Forschungstraditionen und ihrer Institutionalisierung, vom Einfluss der Bezugswissenschaften, von den Verknüpfungen mit Fortbildung, Beratung und Supervision sowie vom Stellenwert beruflicher Praxis an der Hochschule (zum Praxisbegriff vgl. Kietzell 1994b). Eine wesentliche Differenzierung ergibt sich, wenn Sozialarbeitswissenschaft als Handlungswissenschaft gesehen wird, die das Erforschen von gesellschaftlichen Bedingungen und Lebenslagen, Institutionen und Organisationen, Lebensweisen und Lebenswelten stets mit der Analyse professionellen Handelns (dessen An228 7.4 ZUR ROLLE DES PRAXISFORSCHERS sätze, Methoden, Kompetenz, Legitimation) verbindet (vgl. ebd.). Allerdings lassen sich auch andere Positionen vertreten, die Sozialarbeitsforschung nach Kategorien aus der empirischen Sozialforschung ordnet (z.B. qualitativ-quantitativ, methoden-, themen- oder zielgruppenbezogen usw.). Dabei werden sämtliche Untersuchungsebenen nebeneinander gestellt und lassen sich durch andere Forschungsschwerpunkte beliebig ergänzen (vgl. Steinert, Thiele 2000). Es bleibt die Frage, ob es in der Sozialarbeitsforschung eine eigenständige Methodologie mit notwendigen Prioritäten und Zuordnungen gibt, in der die Auswahl und der Nutzwert induktiver und deduktiver Erkenntniswege abhängig von der Fragestellung und dem Bezug zur Praxis bzw. Theorie erklärt werden? Lassen sich, wie in der Praxisforschung, Methoden der beruflichen Praxis als Erhebungsmethoden einsetzen, sodass PraktikerInnen zu ForscherInnen werden können? Wird der Komplexität beruflicher Praxis durch Kontext- und Prozessforschung Rechnung getragen? Auf diese und weitere Fragen werden VertreterInnen einer Sozialarbeitsforschung antworten müssen, wenn sie die disziplinären Besonderheiten und damit die Eigenständigkeit innerhalb der empirischen Sozialforschung betonen wollen, wie das in Ansätzen schon beim Diskurs zur Sozialarbeitswissenschaft erkennbar wird. Eine Untersuchung von 88 Projektberichten der Sozialforschung in den 80er Jahren in diversen Fachzeitschriften ergab, dass wesentliche Informationen zu Methoden, Durchführung der Datenerhebung, Modelle der Datenanalyse fehlten und die Verallgemeinerung der Ergebnisse oftmals unterblieb (vgl. Meinefeld 1985). Es ist zu vermuten, dass sich dieser Sachverhalt bis heute wenig geändert hat. Tendenziell unterliegt auch Praxisforschung bzw. Sozialarbeitsforschung der Gefahr, die Forschungsverfahren methodologisch nicht zu differenzieren, die Methoden nicht sorgfältig genug auszuwählen bzw. zu reflektieren und die Interessen von Auftraggeber und Forscher nicht offen zu legen. Bei kleinen Forschungsprojekten werden häufig methodische Vereinfachungen vorgenommen, die forschende Rolle nicht klar eingehalten und Ergebnisse nur teilweise ohne Methodenreflexion veröffentlicht. Ausbildung in Praxisforschung müsste Anforderungen formulieren und kollegiale Kritik bei Grenzfällen der Forschung üben, damit eine Entwicklung zu fachlichen Standards führt, vergleichbar dem Diskurs im „Handbuch der qualitativen Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft“ (vgl. Friebertshäuser, Prengel 1997). Kooperation zwischen Fachhochschulen und Universitäten gestalten sich traditionell und aktuell hochschulpolitisch bedingt schwierig, obwohl sich in Abständen thematische Bündnisse ergeben (z.B. bei Frieden, Migration, 229 7. ANNÄHERUNG AN SOZIALE ARBEIT DURCH PRAXISBEZOGENE FORSCHUNG Gender, Sozialpolitik, Demokratie und Bürgerrechte) und ForscherInnen beider Systeme sich an der Entwicklung von Standards zur empirischen Sozialforschung beteiligen (Heiner 1988a; Flick u.a. 1995; Flick u.a. 2000). Die Konkurrenz zwischen den Hochschulen und die Besonderheiten von Fachhochschulen erfordern jedoch Begründungen für unterschiedliche forschungstheoretische Ansätze und disziplinär bedingte Abgrenzungen. Die Fachhochschulen könnten ihrem Auftrag zu FundE-Schwerpunkten ein deutlicheres Gewicht beimessen (vgl. Wissenschaftsrat 2002, 58f.). Eine stärkere Beteiligung an sozialpolitischen Diskursen und die kontinuierliche Pflege von Praxiskontakten, nicht nur zur Akquisition von Aufträgen, könnte das eigene Forschungsprofil schärfen. Zur weiteren Entwicklung und zum Ausbau von Sozialarbeitsforschung wären grundsätzlich erforderlich: • Initiierung und Ausbau von Forschungsteams, -gruppen und –instituten, die sich als Dienstleister für Externe verstehen und auf aktuelle Fragestellungen oder Anfragen mit flexiblen Forschungsdesigns offensiv reagieren, um das Feld nicht den Marketing- und Consultingbüros und VertreterInnen anderer Disziplinen zu überlassen (vgl. Howaldt 2001); • Aufbau geeigneter fachhochschulinterner und -externer Informationsnetzwerke zum Austausch von Forschungsergebnissen (vgl. Meier 1999); • Klärung methodologischer Fragen, insbesondere des Stellenwerts von Praxis und PraktikerInnen, wenn kontinuierlich Sozial- und Jugendhilfeplanung, Armutsberichte, Institutionsanalysen, Bedarfsanalysen, Evaluationen entstehen sollen (vgl. Kardorff 1988, 73-74). • Entwicklung geeigneter Lehrkonzepte (vgl. Wolf 1995, 323f.; Flick u.a. 2000) sowie Forschungsdesigns zur Analyse von gesellschafts- und sozialpolitischen Diskursen, Lebenslagen, Organisationen, Lebenswelten, Handlungsfeldern und beruflicher Praxis (vgl. Kietzell 1994b); Die Frage, welche der Bezeichnungen, Praxisforschung oder Sozialarbeitsforschung, für die Forschung in der Sozialen Arbeit zutreffend ist, führt zu strukturellen und methodologischen Details, die in Verbindung mit der Entwicklung zur Sozialarbeitswissenschaft geklärt werden müssen. Letztlich wird sich vermutlich Sozialarbeitsforschung als Komplementärbegriff durchsetzen, wobei ein Verzicht auf die genannten Bezugspunkte der Praxisforschung jedoch ein Verlust an einer bereits entwickelten Fachlichkeit darstellen würde. 230 Literatur und Quellen Ackermann, Friedhelm; Seeck, Dietmar 1999: Der steinige Weg zur Fachlichkeit. Hildesheim Adorno, Theodor W. u.a. 1969: Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie. Neuwied und Berlin AG Kinder- und Jugendarbeit Vahrenheide 2001: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei der Verbesserung des Wohnumfeldes im Stadtteil Vahrenheide/ Hannover. Hannover Alinsky, Saul D. 1999: Anleitung zum Mächtigsein. Ausgewählte Schriften. Göttingen Alisch, Monika (Hrsg.) 1998: Stadtteilmanagement. Voraussetzungen und Chancen für eine soziale Stadt. Opladen/Wiesbaden Altrichter, Herbert; Lebenwein, Waltraud; Welte, Heike 1997: PraktikerInnen als ForscherInnen. Forschung und Entwicklung durch Aktionsforschung. In: Friebertshäuser, Barbara; Prengel, Annedore: Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Weinheim/München, 640-660 Altvater, Elmar (Hrsg.) 2000²: Vernetzt und Verstrickt: Nicht-Regierungs-Organisationen als gesellschaftliche Produktivkraft. Münster Argyris, Chris 1997: Wissen in Aktion. Eine Fallstudie zur lernenden Organisation. Stuttgart Atteslander, Peter 1995: Methoden der empirischen Sozialforschung. Berlin/New York Atteslander, Peter 2000: Methoden der empirischen Sozialforschung. Berlin/New York Baacke, Dieter 1980: Der sozialökologische Ansatz zur Beschreibung und Erklärung des Verhaltens Jugendlicher. In: Deutsche Jugend. Jg. 28, Heft 11. Weinheim, 493-505 Baacke, Dieter 1999a: Jugend und Jugendkulturen. Darstellung und Deutung. Weinheim Badelt, Christoph 1997: Handbuch der Nonprofit-Organisation. Stuttgart Bartscher, Matthias 1998: Partizipation von Kindern in der Kommunalpolitik. Freiburg Bassarak, Herbert (Hrsg.) 1997: Modernisierung Kommunaler Sozialverwaltungen und der Sozialen Dienste. Düsseldorf Beck, Ulrich 1986: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt/M. Beck, Ulrich und Wolfgang Bonß 1989: Verwissenschaftlichung ohne Aufklärung? Zum Strukturwandel von Sozialwissenschaft und Praxis. In: Beck, Ulrich und Wolfgang Bonß (Hrsg.): Weder Sozialtechnologie noch Aufklärung. Frankfurt/ M., 7-45 231 LITERATUR UND QUELLEN Beck, Ulrich; Beck-Gernsheim, Elisabeth (Hrsg.) 1994: Riskante Freiheiten. Frankfurt/M. Beck, Ulrich; Bonß, Wolfgang 1989: Weder Sozialtechnologie noch Aufklärung? Analysen zur Verwendung sozialwissenschaftlichen Wissens. Frankfurt a. M. Becker, Howard S.; Geer, Blanche 1993: Teilnehmende Beobachtung: Die Analyse qualitativer Forschungsergebnisse. In: Hopf, Christel; Weingarten, Elmar (Hrsg.) 1993³: Qualitative Sozialforschung. Stuttgart Becker-Schmidt, Regina; Knapp, Gudrun-Axeli (Hrsg.) 1995: Das Geschlechterverhältnis als Gegenstand der Sozialwissenschaften. Frankfurt/M. Berger, Peter A.; Vester, Michael (Hrsg.) 1998: Alte Ungleichheiten – Neue Spaltungen. Opladen/Wiesbaden Berger, Peter; Luckmann, Thomas 1970: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt/M. Bertels, Lothar; Herlyn, Ulfert (Hrsg.) 1990: Lebenslauf und Raumerfahrung. Opladen BMfAS (Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung) 2001: Lebenslagen in Deutschland. Der erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Bonn BMFSFJ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) 1998a: Zehnter Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation von Kindern und die Leistungen der Kinderhilfen in Deutschland. Bonn BMFSFJ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) 1998b: QS Materialien zur Qualitätssicherung in der Kinder- und Jugendhilfe. Band 19: Liebald, Christiane: Leitfaden für Selbstevaluation und Qualitätssicherung. Bonn BMFSFJ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) 1998c: Familien- und Kinderfreundlichkeits-Prüfung in den Kommunen: Erfahrungen und Konzepte. Bonn BMFSFJ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) 1999a: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Kommune. Ergebnisse einer bundesweiten Erhebung. München BMFSFJ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) 1999_b: Kinder- und Jugendhilfegesetz. Berlin BMJFFG (Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit) 1990: Achter Jugendbericht. Bericht über Bestrebungen und Leistungen der Jugendhilfe. Bonn Bohn, Irina; Kreft, Dieter; Segel, Gerhard (Hrsg.) 1997: Das Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt AgAG. Band 5. Kommunale Gewaltprävention. Eine Handreichung für die Praxis. Münster Bolay, Eberhard; Herrmann, Franz (Hrsg.) 1995: Jugendhilfeplanung als politischer Prozeß. Beiträge zu einer Theorie sozialer Planung im kommunalen Raum. Neuwied Boomgaarden, Theo 2001: Flexible Erziehungshilfen im Sozialraum. Theoretische Grundlagen und praktische Erfahrungen. Münster 232 LITERATUR UND QUELLEN Böttger, Hans-Walter 1980: Verwaltung. In: Deutscher Verein (Hrsg.): Fachlexikon der sozialen Arbeit. Frankfurt/M., 798-799 Böttger, Andreas, Lobermeier, Olaf 1996: Sozial(arbeits)wissenschaftliche Forschung an Fachhochschulen. Theoretische Hintergründe und Ergebnisse einer empirischen Untersuchung an den Fachbereichen Sozialwesen in Norddeutschland. Braunschweig Bourdieu, Pierre 1991²: Sozialer Raum und „Klassen“. Frankfurt/M. Bremer, Peter 2000: Ausgrenzungsprozesse und die Spaltung der Städte. Zur Lebenssituation von Migranten. Opladen Brumlik, Michael 1984: Fremdheit und Konflikt. Zur Kritik der verstehenden Vernunft in der Sozialpädagogik. In: Griese, Hartmut M. 1984: Der gläserne Fremde. Bilanz und Kritik der Gastarbeiterforschung und Ausländerpädagogik. Opladen Brunnengräber, Achim; Walk, Heike 2000²: Die Erweiterung der Netzwerktheorien: Nicht-Regierungs-Organisationen verquickt mit Markt und Staat. In: Altvater, Elmar u.a. (Hrsg.): Vernetzt und verstrickt. Nicht-Regierungs-Organisationen als gesellschaftliche Produktivkraft. Münster, 66-85 Brunsemann, Claudia; Stange, Waldemar; Tiemann, Dieter 1997: mitreden – mitplanen – mitmachen. Kinder und Jugendliche in der Kommune. Berlin/Kiel Bullinger, Hermann; Nowak, Jürgen 1998: Soziale Netzwerkarbeit. Eine Einführung. Freiburg Bultmann, Ingo; Neumann, Thomas; Schiecke, Jutta (Hrsg.) 1989: Hannover zu Fuß. 18 Stadtteilrundgänge durch Geschichte und Gegenwart. Hamburg Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 1990: Städtebauliche Lösungen für die Nachbesserung von Großsiedlungen der 50er bis 70er Jahre. Teil A. Städtebauliche und bauliche Probleme und Maßnahmen. Teil B. Wohnungswirtschaftliche Probleme und Maßnahmen. Hamburg. Burdewick, Ingrid 1999: Jugendparlamente gegen „Politikverdrossenheit“? – ein Beteiligungsmodell unter der Lupe. In: Theorie und Praxis sozialer Arbeit. Jg. 50, Nr. 11. Bonn, 415-420 Bürgerbüro Stadtentwicklung 1997: Schritte zur kinderfreundlichen Stadt. Materialien zur Vorbereitung des Fachforums „Kinderfreundliche Stadt Hannover“. Hannover Bürgerbüro Stadtentwicklung Hannover 1998: Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bei der Erneuerung benachteiligter Stadtquartiere – in Vahrenheide und anderswo. Texte und Stichworte zum Werkstattgespräch am 23. April 1998. Hannover Carrigan, Tim; Connell, Robert W; Lee, John 1996: Ansätze zu einer neuen Soziologie der Männlichkeit. In: BauSteineMänner (Hrsg.): Kritische Männerforschung. Neue Ansätze in der Geschlechtertheorie. Hamburg Cicourel, Aaron Victor 1974: Methoden und Messung in der Soziologie. Frankfurt/ M. Crozier, Michel; Friedberg, Erhard 1979: Macht und Organisation. Die Zwänge kollektiven Handelns. Berlin 233 LITERATUR UND QUELLEN Dahme, Heinz-Jürgen; Wohlfahrt, Norbert (Hrsg.) 2000: Netzwerkökonomie im Wohlfahrtsstaat. Wettbewerb und Kooperation im Sozial- und Gesundheitssektor. Berlin Dangschat, Jens S. 1998: Sozialräumliche Aspekte der Armut im Jugendalter. In: Klocke, Andreas; Hurrelmann, Klaus (Hrsg.): Kinder und Jugendliche in Armut. Opladen/Wiesbaden, 112-135 Deinet, Ulrich 1999: Sozialräumliche Jugendarbeit. Eine praxisbezogene Anleitung zur Konzeptentwicklung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Opladen Deinet, Ulrich; Sturzenhecker, Benedikt (Hrsg.) 1996: Konzepte entwickeln. Anregungen und Arbeitshilfen zur Klärung und Legitimation. Weinheim/München Deiseroth, Dieter 2000: Zivilcourage am Arbeitsplatz. Reform der Betriebsverfassung. In: Frankfurter Rundschau. Dokumentation, 31. August 2000. Frankfurt/ M., 9 Deutsche Shell-AG Jugendwerk (Hrsg.) 2000: Jugend 2000. 13. Shell Jugendstudie. Opladen Deutscher Städtetag (Hrsg.) 1979: Hinweise zur Arbeit in Sozialen Brennpunkten. Reihe D, DST-Beiträge zur Sozialpolitik, Heft 10. Köln Deutscher Städtetag (Hrsg.) 1987: Sicherung der Wohnungsversorgung in Wohnungsnotfällen und Verbesserung der Lebensbedingungen in Sozialen Brennpunkten. Köln Dewe, Bernd; Ferchhoff, Wilfried; Scherr, Albert; Stüwe, Gerd 1995: Professionelles soziales Handeln. Soziale Arbeit im Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis. Weinheim und München Dewe, Bernd; Ferchhoff, Wilfried; Scherr, Albert; Stüwe, Gerd 1996 Sozialpädagogik, Sozialarbeitswissenschaft, Soziale Arbeit?. Die Frage nach der disziplinären und professionellen Identität. In: Puhl, Ria (Hrsg.): Sozialarbeitswissenschaft. Neue Chancen für theoriegeleitete Soziale Arbeit. Weinheim und München DGSv (Deutsche Gesellschaft für Supervision) (Hrsg.) 1996: Supervision – professionelle Beratung zur Qualitätssicherung am Arbeitsplatz. Köln Dietzen, Agnes 1993: Soziales Geschlecht. Dimensionen des Gender-Konzepts. Opladen Döscher, Susanne; Urban, Elke 1982: Der Stadtteil Vahrenheide – ein soziales Spannungsfeld. Möglichkeit und Grenzen einer Stadtteilidentität in einem nicht gewachsenen Stadtteil durch Aktionen von Bürgern. Magisterarbeit an der Uni Hannover. Hannover Dreher, Michael; Dreher, Eva 1995: Gruppendiskussionsverfahren. In: Flick, Uwe; Kardoff, Ernst von; Keupp, Heiner u.a.: Handbuch qualitative Sozialforschung. München, 186-188 Ebbe, Kirsten; Friese, Peter 1989: Milieuarbeit. Grundlagen präventiver Sozialarbeit im lokalen Gemeinwesen. Stuttgart Elsen, Susanne 1998: Gemeinwesenökonomie – eine Antwort auf Arbeitslosigkeit, Armut und soziale Ausgrenzung? Neuwied Engel, Petra 2001: Sozialräumliche Altenarbeit und Gerontologie. Am Beispiel älterer Frauen auf dem Land. Opladen 234 LITERATUR UND QUELLEN Engelke, Ernst 1992: Soziale Arbeit als Wissenschaft. Eine Orientierung. Freiburg Engler, Steffani 1997: Zur Kombination von qualitativen und quantitativen Methoden. In: Friebertshäuser, Barbara; Prengel, Annedore: Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Weinheim/München, 118-130 Esser, Johannes 1994: Alltags-Partizipation und Demokratiepraxis. Basisüberlegungen für Politikkonzepte. In: Dietrich, Barbara u.a. (Hrsg.): Den Frieden neu denken. Jahrbuch 1994 des Arbeitskreises Frieden in Forschung und Lehre an Fachhochschulen. Münster, 88-111 Esser, Johannes; Kietzell, Dieter von; Ketelhut, Barbara; Romppel, Joachim 1996: Frieden vor Ort. Alltagsfriedensforschung – Subjektentwicklung – Partizipationspraxis. Münster Fatzer, Gerhard (Hrsg.) 1996: Erfolgsforschung bei Veränderungsprozessen: OE und Supervision. In: Fatzer, Gerhard: Organisationsentwicklung und Supervision: Erfolgsfaktoren bei Veränderungsprozessen. Köln, 77-91 Feyerabend, Paul K. 1978: Der wissenschaftstheoretische Realismus und die Autorität der Wissenschaften. Braunschweig/Wiesbaden Fiedler, Jobst 1996: Verwaltungsreformprozeß in einer deutschen Großstadt. Versuch einer kritischen Evaluation des Reformprozesses in Hannover. In: Reichard, Christoph; Wollmann, Hellmut (Hrsg.): Kommunalverwaltung im Modernisierungsschub? Basel, 113-134 Filsinger, Dieter; Hinte, Wolfgang 1988: Praxisforschung: Grundlagen, Rahmenbedingungen und Anwendungsbereiche eines Forschungsansatzes. In: Heiner, Maja (Hrsg.): Praxisforschung in der sozialen Arbeit. Freiburg, 34-72 Fischer, Dietlind 1997: Das Tagebuch als Lern- und Forschungsinstrument. In: Friebertshäuser, Barbara; Prengel, Annedore: Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Weinheim/München, 693-703 Flade, Antje 1993: Kann der Rückzug der Mädchen aus dem öffentlichen Raum verhindert werden? Empirische Ergebnisse und Schlußfolgerungen. In: Flade, Antje; Kustor-Hüttle, Beatrice 1993: Mädchen in der Stadtplanung. Bolzplätze – und was sonst? Weinheim, 23-40 Flick, Uwe 1991a: Stationen des qualitativen Forschungsprozesses. In: Ders. u.a. (Hrsg.): Handbuch qualitative Sozialforschung. München, 148-173 Flick, Uwe 1991b: Triangulation. In: Ders. u.a. (Hrsg.): Handbuch qualitative Sozialforschung. München, 432-434 Flick, Uwe; Kardorff, Ernst von u.a. (Hrsg.) 1995²: Handbuch qualitative Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen. Weinheim Flick, Uwe; Kardorff, Ernst; Steinke, Ines (Hrsg.) 2000: Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Reinbeck bei Hamburg French, Wendell L.; Bell, Cecil H. 1994: Organisationsentwicklung. Sozialwissenschaftliche Strategien zur Organisationsveränderung. Bern Frey, James H; Kunz, Gerhard; Lüschen, Günther 1990: Telefonumfragen in der Sozialforschung. Methoden, Techniken, Befragungspraxis. Opladen Freyburg, Thomas von; Schneider, Johann (Hrsg.) 1999: Sozialraumanalyse als Lernprozeß. Beiträge zur qualitativen Segregationsanalyse. Frankfurt/M. 235 LITERATUR UND QUELLEN Friebertshäuser, Barbara 1997: Interviewtechniken – ein Überblick. In: Friebertshäuser, Barbara; Prengel, Annedore: Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Weinheim/München, 371-395 Friebertshäuser, Barbara; Prengel, Annedore (Hrsg.) 1997: Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Weinheim/München Friedberg, Erhard 1995 Ordnung und Macht. Dynamiken organisierten Handelns. Frankfurt/M. Froessler, Rolf 1994: Integrierende Politik: Aufgaben, Inhalte und Formen staatlicher Programme zur Erneuerung benachteiligter Quartiere. In: Froessler, Rolf; Markus Lang u.a. (Hrsg.): Lokale Partnerschaften. Die Erneuerung benachteiligter Quartiere in europäischen Städten. Basel, 8-35 Fuchs-Heinritz, Werner; Lautmann, Rüdiger; Tammstedt, Otthein; Wienhold, Hanns 1994³: Lexikon zur Soziologie. Opladen Garz, Detlef: Entwicklungslinien qualitativ-empirischer Sozialforschung. In: König, Eckard; Zedler, Peter (Hrsg.) 1995: Bilanz qualitativer Forschung. Band I: Grundlagen qualitativer Forschung. Weinheim, 11-32 Geiling, Heiko 1996: Das andere Hannover. Jugendkultur zwischen Integration und Rebellion in der Großstadt. Hannover Geiling, Heiko; Schwarzer, Thomas 1999: Abgrenzung und Zusammenhalt. Zur Analyse sozialer Milieus in Stadtteilen Hannovers. Hannover Geiling, Heiko; Schwarzer, Thomas; Heinzelmann, Claudia; Bartnick, Esther 2001: Stadtteilanalyse Hannover-Vahrenheide. Sozialräumliche Strukturen, Lebenswelten und Milieus. Hannover Gerhardter, Gabriele 1998: Netzwerkorientierung in der Sozialarbeit. In: Pantucek, Peter; Vyslouzil, Monika (Hrsg.) Theorie und Praxis lebenswelt-orientierter Sozialarbeit. St. Pölten, 49-71 Giddens, Anthony 1992: Kritische Theorie der Spätmoderne. Wien Giesecke, Michael; Rappe-Giesecke, Kornelia 1997: Supervision als Medium kommunikativer Sozialforschung. Die Integration von Selbsterfahrung und distanzierter Betrachtung in Beratung und Wissenschaft. Frankfurt/M. Girtler, Roland 1980: Vagabunden in der Großstadt. Teilnehmende Beobachtungen in der Lebenswelt der „Sandler“ Wiens. Stuttgart Girtler, Roland 1992: Methoden der qualitativen Sozialforschung. Anleitung zur Feldarbeit. Wien Glaser, Barney G.; Strauss, Anselm L. 1998: Grounded theory. Strategien qualitativer Forschung. Bern Glaser, Hermann 1991: Kleine Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 1945-1989. Bonn Glinka, Hans-Jürgen; Neuberger, Christa 1999: Interaktionsformen des Jugendamtes mit Kindern und Jugendlichen. Umbruch und Irritationen im Sinn- und Orientierungsmilieu von sozial-helfenden Instanzen. Eine milieuanalytische Studie. In: Glinka, Hans-Jürgen; Neuberger, Christa u.a.: Kulturelle und politische Partizipation von Kindern. Interessenvertretung und Kulturarbeit für und durch Kinder. Opladen, 9-137 236 LITERATUR UND QUELLEN Graeff, Peter 1996: Organisationsentwicklung. In: Boskamp, Peter; Knapp, Rudolf (Hrsg.): Führung und Leitung in sozialen Organisationen. Handlungsorientierte Ansätze für neue Managementkompetenz. Neuwied, 193-227 Graf, Erich Otto 1990: Forschung in der Sozialpädagogik: Ihre Objekte sind Subjekte. Luzern Griese, Hartmut M. 1979: Erwachsenensozialisationsforschung. In: Siebert, Horst (Hrsg.): Taschenbuch der Weiterbildungsforschung. Baltmannsweiler, 172-210 Griese, Hartmut M. 1987³: Sozialwissenschaftliche Jugendtheorien. Eine Einführung. Weinheim und Basel Griese, Hartmut M. 1994: Wider die Re-Pädagogisierung in der Jugendarbeit. Eine soziologisch-provokative Außenperspektive und Kritik. In: Deutsche Jugend 42. Jg., Heft 7-8. Weinheim, 310-317 Griese, Hartmut M; Nikles, Bruno W.; Rülcker, Christoph (Hrsg.) 1977: Soziale Rolle. Zur Vermittlung von Individuum und Gesellschaft. Opladen Haag, Fritz; Krüger; Helga u.a. 1972: Aktionsforschung. Forschungsstrategien, Forschungsfelder und Forschungspläne. München Habermas, Jürgen 1971: Erkenntnis und Interesse. Frankfurt/M. Habermas, Jürgen 1981: Theorie des kommunikativen Handelns. Band II. Frankfurt/M. Habermehl, Werner 1992: Angewandte Sozialforschung. München Hafeneger, Benno 1992: Jugendarbeit als Beruf. Geschichte einer Profession in Deutschland. Opladen. Hameyer, Uwe; Haft, Henning 1977: Handlungsorientierte Schulforschungsprojekte. Praxisberichte, Analysen, Kritik. Weinheim und Basel Hanesch, Walter u.a. 1994: Armut in Deutschland. Der Armutsbericht des DGB und des paritätischen Wohlfahrtsverbands. Reinbeck bei Hamburg Hannoversche Allgemeine Zeitung 1958-73: Gründung des Stadtteils Vahrenheide in Presseartikeln. Sammlung der Gemeinwesenarbeit Vahrenheide. Hannover Hauer, Doris 1990: Berufliche Identität im Arbeitsalltag. Entwicklung eines Konzeptes für die Weiterbildung von Sozialarbeitern/Sozialpädagogen. Wiesbaden Haupert, Bernhard 1995: Konturen einer Sozialarbeitswissenschaft. In: Sozialarbeit. Fachblatt des Schweizerischen Berufsverbandes der Dipl. SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen. Jg. 27, Nr. 5/95. Bern, 12-21 Hauser, Richard 1998: Einkommen und Vermögen. In: Schäfers, Bernhard; Zapf, Wolfgang (Hrsg.): Handwörterbuch zur Gesellschaft Deutschlands. Opladen Häußermann, Hartmut; Siebel, Walter 1987: Neue Urbanität. Frankfurt/M. Heine, Christoph 1999: Gestufte Studiengänge und -abschlüsse im deutschen Studiensystem. Was erwarten Studierende von Bachelor, Master und Credit-System? Ausgewählte Ergebnisse aus Längsschnittbefragungen der Studienberechtigten ’94. Hannover Heinelt, Hubert; Lohmann, Anne 1992: Immigranten im Wohlfahrtstaat. Rechtspositionen und Lebensverhältnisse. Opladen Heinemeier, Siegfried 1994: Sozialarbeit: Notnagel oder Sinnquelle? Zwischenergebnisse einer biographischen Studie zur Bedeutung von Studium und Berufs- 237 LITERATUR UND QUELLEN perspektive. In: Schatteburg, Uta (Hrsg.): Aushandeln, Entscheiden, Gestalten – Soziale Arbeit, die Wissen schafft. Hannover, 173-216 Heiner, Maja (Hrsg.) 1988a: Praxisforschung in der sozialen Arbeit. Freiburg Heiner, Maja (Hrsg.) 1988b: Selbstevaluation in der sozialen Arbeit. Fallbeispiele zur Dokumentation und Reflexion beruflichen Handelns. Freiburg Heiner, Maja (Hrsg.) 1998: Experimentierende Evaluation. Ansätze zur Entwicklung lernender Organisationen. Weinheim und München Heiner, Maja 1994: Aufbau und Pflege politischer Netzwerke in der Gemeinwesenarbeit. In: Bitzan, Maria; Klöck, Thilo: Jahrbuch Gemeinwesenarbeit 5. Politikstrategien – Wendungen und Perspektiven. München, 90-116 Heiner, Maja 1995a: Nutzen und Grenzen systemtheoretischer Modelle für eine Theorie professionellen Handelns (Teil I). In: Neue Praxis. Jg. 25, Heft 5. Neuwied, 427-441 Heiner, Maja 1995b: Nutzen und Grenzen systemtheoretischer Modelle für eine Theorie professionellen Handelns (Teil II). In: Neue Praxis. Jg. 25, Heft 6. Neuwied, 525-546 Heiner, Maja; Meinhold, Marianne u.a. 1996³: Methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit. Freiburg Heinze, Thomas 1992: Qualitative Sozialforschung. Erfahrungen, Probleme und Perspektiven. Obladen Herlyn, Ulfert 1990: Leben in der Stadt. Lebens- und Familienphasen in städtischen Räumen. Opladen. Herlyn, Ulfert, Naroska, Hans-Jürgen, Tessin, Wulf 1986: Hannover VahrenheideSüdost. Sozialwissenschaftliche Expertise. Hannover Herlyn, Ulfert; Lakemann, Ulrich u.a. 1991: Armut und Milieu. Benachteiligte Bewohner in großstädtischen Quartieren. Basel Herlyn, Ulfert; Selle, Klaus u.a. 1994: Soziale Brennpunkte. Handlungsbedarf und gebietsbezogene Politik. Hannover Hermann, Thomas 1992: Die sozialen und politischen Strukturen Hannovers in kleinräumlicher Gliederung 1987/1990. Band 1 und 2. Hannover Hermann, Thomas 1998: Das kleinräumige Wahlverhalten nach sozialstrukturellen Schwerpunkten. Hannover Hilpert, Jochen 1996: Partizipative Jugendarbeit und Bürgerengagement. Über die Praxis einer Theorie. Konstanz Hinte, Wolfgang 1993: Die mit den Wölfen tanzen. Intermediäre Instanzen in der Gemeinwesenarbeit. In: Sozial Extra. Jg. 17, Nr. 7/8. Wiesbaden, 9-12 Hinte, Wolfgang 1997: Beteiligung und Vernetzung – ein kritischer Blick auf aktuelle Mode-Begriffe. In: Theorie und Praxis der sozialen Arbeit. Jg. 48., Nr. 12. Bonn, 8-15 Hinte, Wolfgang 1998: KGST-Bericht: Nr. 12/1998: Kontraktmanagement zwischen öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe. Köln Hinte, Wolfgang; Karas, Fritz 1998²: Studienbuch Gruppen- und Gemeinwesenarbeit. Eine Einführung für Ausbildung und Praxis. Neuwied 238 LITERATUR UND QUELLEN Hirschfeld, Karin; Preissler, Harald u.a. 2000: Was soll das Theater? Erfahrungen mit Spiel und Theater in der Organisationsentwicklung. In: Organisationsentwicklung. 19. Jg., Nr. 3. Basel, 30-39 Hitzler, Ronald 1994: Wissen und Wesen des Experten. In: Hitzler, Ronald; Honer, Anne und Christoph Maeder (Hrsg.): Expertenwissen. Die institutionalisierte Kompetenz zur Konstruktion von Wirklichkeit. Opladen, 13-30 Hitzler, Ronald; Honer, Anne 1995: Qualitative Verfahren zur Lebensweltanalyse. In: Flick, Uwe; Kardorff, Ernst von u.a.: Handbuch qualitative Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen. Weinheim, 382-385 Holland-Cunz, Barbara 1998: Demokratietheorie und feministische Bündnispolitik. In: Wrangel, Ute von u.a. (Hrsg.): Frauenbeauftragte. Zu Mythos, Theorie und Praxis eines jungen Berufes. Königstein, 57-77 Honer, Anne 1989: Einige Probleme lebensweltlicher Ethnographie. Zur Methodologie und Methodik einer interpretativen Sozialforschung. Zeitschrift für Soziologie, Jg. 18, Heft 4, August 1989. Stuttgart, 297-312 Honer, Anne 1995: Das Perspektivenproblem in der Sozialforschung. Bemerkungen zur lebensweltlichen Ethnographie. In: Jung, Thomas; Müller-Doohm, Stefan (Hrsg.): „Wirklichkeit“ im Deutungsprozeß. Verstehen und Methoden in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Frankfurt/M., 241-257 Honig, Michael-Sebastian 1999: Forschung „vom Kinde aus“? Perspektivität in der Kindheitsforschung. In: Honig, Michael-Sebastian; Lange, Andrea; Leu, Hans Rudolf (Hrsg.): Aus der Perspektive von Kindern? Zur Methodologie der Kindheitsforschung. Weinheim/München, 33-50 Hopf, Christel 1993: Soziologie und qualitative Sozialforschung. In: Hopf, Christel und Elmar Weingarten (Hrsg.): Qualitative Sozialforschung. Stuttgart Howaldt, Jürgen 1993: Vom Objekt zum Subjekt der Rationalisierung? – Der kontinuierliche Verbesserungsprozeß als beteiligungsorientierter Rationalisierungsansatz. In: Howaldt, Jürgen; Minssen, Heiner (Hrsg.) Lean, leaner ...? Die Veränderung des Arbeitsmanagements zwischen Humanisierung und Rationalisierung. Dortmund Howaldt, Jürgen 2001: Wissensproduktion im Netzwerk – auf dem Weg zu einer neuen Produktionsweise der Sozialwissenschaft? In: Heinz, Walter R. u.a. (Hrsg.): Beratung ohne Forschung – Forschung ohne Beratung. Dortmund, 18-33 Höyng, Stephan; Puchert, Ralf 1998: Die Verhinderung der beruflichen Gleichstellung. Männliche Verhaltensweisen und männerbündische Kultur. Bielefeld Hradil, Stefan 1987: Sozialstrukturanalyse in einer fortgeschrittenen Gesellschaft. Opladen Hradil, Stefan 1999: Soziale Ungleichheit in Deutschland. Opladen Huber-Sheik, Kathrin 1996: Sozialer Brennpunkt. Sozialstruktur und Sanierung in einem Freiburger Stadtteil. Konstanz Institut der deutschen Wirtschaft 2001: Deutschland in Zahlen. Köln ISSAB (Institut für stadtteilbezogene Arbeit und Beratung der Universität GHS Essen) 1995: Integration und soziale Gerechtigkeit durch soziale Kommunalpolitik: Wirkungsweise, Chancen und Grenzen kommunaler sozialer Arbeit in den 239 LITERATUR UND QUELLEN neuen Bundesländern am Beispiel Dresden und Frankfurt (Oder). Abschlußbericht. Essen Jahoda, Marie; Lazarsfeld, Paul F. u.a. 1997¹³: Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein soziographischer Versuch. Frankfurt/M. Jarass, Hans D.; Pieroth, Bodo 1992: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Kommentar. München Joschonek, Thomas; Romppel, Joachim; Wellhausen, Birgit 2002: Strukturen und Aktivitäten der sozialräumlich orientierten Kinder- und Jugendhilfe in Niedersachsen. 2. Expertise im Auftrag des SPI als Regiestelle des BMFSFJ. Hannover Jugendamt der Stadt Hildesheim 1995: Jugendhilfe in Bewegung. Bericht zur Jugendhilfeplanung der Stadt Hildesheim. Hildesheim Jünemann, Rita 2000: Geschlechtstypische Identitätsbildungsprozesse in der professionellen Sozialen Arbeit. Eine geschlechtsvergleichende Untersuchung. Opladen Jungk, Robert; Müllert Norbert R. 1989: Zukunftswerkstätten. Mit Phantasie gegen Routine und Resignation. München Kähler, Harro Dietrich 1999: Beziehungen im Hilfesystem Sozialer Arbeit. Zum Umgang mit BerufskollegInnen und Angehörigen anderer Berufe. Freiburg Kardorff, Ernst von 1988: Praxisforschung als Forschung der Praxis. In: Heiner, Maja (Hrsg.): Praxisforschung in der Sozialen Arbeit. Freiburg, 73-100 Kardorff, Ernst von 1995: Soziale Netzwerke. In: Flick, Uwe; Kardorff, Ernst von u.a.: Handbuch qualitative Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen. Weinheim, 402-405 Kardorff, Ernst von; Stark, Wolfgang u.a. (Hrsg.) 1989: Zwischen Netzwerk und Lebenswelt – Soziale Unterstützung im Wandel. Wissenschaftliche Analysen und praktische Strategien. München Keedy, J. Leslie 1999: In Stufen zum Ziel: Zur Einführung von Bachelor- und Master-Graden an deutschen Universitäten. Stuttgart Kelle, Udo 1996: Die Bedeutung theoretischen Vorwissens in der Methodologie der Grounded Theory. In: Strobl, Rainer; Böttger, Andreas (Hrsg.) 1996: Wahre Geschichten? Zur Theorie und Praxis qualitativer Interviews. Baden-Baden, 23-47 Kelle, Udo 1997: Empirisch begründete Theoriebildung. Zur Logik und Methodologie interpretativer Sozialforschung. Weinheim Keupp, Heiner; Bilden, Helga 1989: Verunsicherungen. Das Subjekt im gesellschaftlichen Wandel. Göttingen Keupp, Heiner; Röhrle, Bernd (Hrsg.) 1987: Soziale Netzwerke. Frankfurt/M. Kiefl, Walter; Holzmüller, Helmut 2000: Strukturierte Tagebücher als prozessbegleitende Verfahren. In: Soziale Arbeit. Jg. 49, Nr. 8. Berlin, 300-306 Kietzell, Dieter von 1994a: Vernetzung – Schlagwort oder Strategie. Vortrag auf dem Symposium des Lindener Institut für Öffentlichkeits- und Gemeinwesenarbeit. Hannover Kietzell, Dieter von 1994b: Die Praxis der sozialen Arbeit in Lehre und Forschung an Fachhochschulen. In: Schatteburg, Uta (Hrsg.): Aushandeln, Entscheiden, Gestalten – Soziale Arbeit, die Wissen schafft. Hannover, 115-150 240 LITERATUR UND QUELLEN Kiwitz, Peter 1986: Lebenswelt und Lebenskunst. München Kleining, Gerhard 1995: Methodologie und Geschichte qualitativer Sozialforschung. In: Flick, Uwe u.a.: Handbuch qualitative Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen. Weinheim, 11-22 Klocke, Andreas; Hurrelmann, Klaus 1998: Kinder und Jugendliche in Armut. Umfang, Auswirkungen und Konsequenzen. Opladen/Wiesbaden Klüsche, Wilhelm (Hrsg.) 1999: Ein Stück weitergedacht ... Beiträge zur Theorie und Wissenschaftsentwicklung der Sozialen Arbeit. Freiburg Kommunalverband Großraum Hannover; Landeshauptstadt Hannover; Landkreis Hannover 1993: Einwohnerentwicklung 1992 bis 2010. Prognosen für den Großraum, die Landeshauptstadt und den Landkreis Hannover. Schriften zur Stadtentwicklung, Heft 64. Hannover König, Eckard; Zedler, Peter (Hrsg.) 1995: Bilanz qualitativer Forschung. Band I: Grundlagen qualitativer Forschung. Weinheim, 75-96 Konrad, Klaus 1999: Mündliche und schriftliche Befragung. Forschung, Statistik und Methoden Band 4. Landau Krahulec, Peter 1999: „Was geht mich das an?“ Sozialpsychologische Konzepte des Hilfeverhaltens im Licht eines sozialpädagogischen Interesses an Einmischung und Zivilcourage. In: Sozial Extra 23. Jg., Heft 7/8 1999. Wiesbaden, 11-12 Kreft, Dieter 1997: Praxisberatung und Praxisforschung im Wandel – am Beispiel des Instituts für Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Frankfurt a. M. (ISS). In: Theorie und Praxis Sozialer Arbeit. Jg. 48, Nr. 12. Bonn, 15-19 Kreft, Dieter; Mielenz, Ingrid 1996: Wörterbuch Soziale Arbeit. Aufgaben, Praxisfelder, Begriffe und Methoden der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Weinheim/Basel Krings- Heckemeier, Marie-Therese 1998: Neue Herausforderungen für die Wohnungswirtschaft. In: LAG Hessen (Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte Hessen): Soziale Stadterneuerung. Frankfurt/M., 35-57 Kromrey, Helmut 1994: Empirische Sozialforschung. Modelle und Methoden der Datenerhebung und Datenauswertung. Opladen LAG Nds. (Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte Niedersachsen) e.V. 1994: Soziale Brennpunkte. Handlungsbedarf und gebietsbezogene Politik. Hannover Lamnek, Siegfried 1998: Gruppendiskussion. Theorie und Praxis. Weinheim Lamnek, Siegried 1988: Qualitative Sozialforschung. Band 1: Methodologie. München/Weinheim Lamnek, Siegried 1989: Qualitative Sozialforschung. Band 2: Methoden und Techniken. München Landeshauptstadt Hannover 1993: Sozialbericht 1993. Zur Lage der Kinder, Jugendlichen und Familien in Hannover. Schriftenreihe zur kommunalen Sozial-, Jugend- und Gesundheitspolitik, Band 13. Hannover Landeshauptstadt Hannover 1997a: Stadtteilbeschreibung des Kommunalen Sozialdienst für Vahrenheide und Sahlkamp. Unveröffentliches Arbeitspapier. Hannover 241 LITERATUR UND QUELLEN Landeshauptstadt Hannover 1997b: Beschlußdrucksache Nr. 2236/97. Vahrenheide-Ost. Beschluß über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiet mit Anlagen (Satzung und Aktionsprogramm). Hannover Landeshauptstadt Hannover 1998a: Wohnberechtigte Bevölkerung am 01.01.1998 nach statistischen Bezirken und Stadtteilen. Hannover Landeshauptstadt Hannover 1998b: Sozialbericht 1998. Bericht zur sozialen Situation in Hannover (Gesundheit-, Jugend- und Sozialdezernat). Hannover Landeshauptstadt Hannover 1998c: Landtagswahl am 1.3.1998 nach statistischen Bezirken und Stadtteilen. Hannover Landeshauptstadt Hannover 1998d: Bundestagswahl am 27.9.1998 nach statistischen Bezirken und Stadtteilen. Hannover Landeshauptstadt Hannover 1999: Wohnberechtigte Bevölkerung am 01.01.1999 nach statistischen Bezirken und Stadtteilen. Hannover Landeshauptstadt Hannover 2001a: Wahlergebnisse der Kommunalwahl. Wahl des Rates der Stadt Hannover und Wahlergebnisse nach Stadtteilen. Hannover Landeshauptstadt Hannover 2001b: Strukturdaten der Stadtteile. Hannover Landeshauptstadt Hannover/Gesellschaft für Bauen und Wohnen (GBH) 1998: Aktionsprogramm Integrierte Sanierung Vahrenheide-Ost. Ansätze für eine soziale Stadterneuerungspolitik. Hannover Landeshauptstadt Hannover; Landkreis Hannover; Kommunalverband Großraum Hannover 1998: Statistischer Vierteljahresbericht Oktober bis Dezember 1998. Hannover Legewie, Heiner 1991: Feldforschung und teilnehmende Beobachtung. In: Flick, Uwe u.a.: Handbuch qualitative Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen. München, 189-193 Lewin, Kurt 1953: Die Lösung sozialer Konflikte. Ausgewählte Abhandlungen über Gruppendynamik. Bad Nauheim Lewin, Kurt 1963: Feldtheorie in den Sozialwissenschaften. Bern und Stuttgart LHH siehe unter Landeshauptstadt Hannover Lüders, Christian 1989: Der wissenschaftlich ausgebildete Praktiker. Entstehung und Auswirkung des Theorie-Praxis-Konzeptes des Diplomstudienganges Sozialpädagogik. Weinheim Luhmann, Niklas 1985²: Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt/M. Luhmann, Niklas 1988: Erkenntnis als Konstruktion. Bern Lüttringhaus, Maria 2000: Stadtentwicklung und Partizipation. Fallstudien aus Essen Katernberg und der Dresdener Äußeren Neustadt. Bonn Maier, Konrad (Hrsg.) 1995: Der Beitrag der Sozialarbeit zum Aufbau neuer Stadtteile. Freiburg Maier, Konrad (Hrsg.) 1999: Forschung an Fachhochschulen für Soziale Arbeit. Bestandsaufnahmen und Perspektiven. Freiburg Marquard, Peter 1994: Übereinkommen über die Rechte des Kindes. Beiträge zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention (KRK). In: Forum Jugendhilfe. AGJ-Mitteilungen, Heft 4/94. Bonn, 41-44 242 LITERATUR UND QUELLEN Martin, Ernst; Wawrinowski, Uwe 1993: Beobachtungslehre. Theorie und Praxis reflektierter Beobachtung und Beurteilung. Weinheim/München März, Gerd 1999: Niedersächsische Gemeindeordnung. In: Ders.: Niedersächsische Gesetze. Textsammlung sowie Fundstellen und Änderungsnachweise des geltenden Landesrechts. München Maturana; Humberto R.; Varela, Francisco J. 1990: Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln des menschlichen Erkennens. München Mayring Philipp 1996³: Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken. München Mead, Georg Herbert 1973: Geist, Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviorismus. Frankfurt/M. Mead, George Herbert 1980: Gesammelte Aufsätze. Band 1. Frankfurt/M. Mead, George Herbert 1983: Gesammelte Aufsätze. Band 2. Frankfurt/M. Meier-Seethaler, Carola 1997: Gefühl und Urteilskraft. Ein Plädoyer für die emotionale Vernunft. München Meinefeld, Werner 1995: Realität und Konstruktion. Erkenntnistheoretische Grundlagen einer Methodologie der Empirischen Sozialforschung. Opladen Meinhold, Marianne1998³: Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in der Sozialen Arbeit. Einführung und Arbeitshilfen. Freiburg Merten, Roland (Hrsg.) 2001: Hat Soziale Arbeit ein politisches Mandat. Positionen zu einem umstrittenen Thema. Opladen Merten, Roland 2000: Soziale Arbeit hat kein politisches Mandat, aber einen professionellen Auftrag. In: Sozial Extra, Jg. 24, Heft Mai/Juni 2000, Wiesbaden, 17-20 Messner, Dirk 2000: Netzwerktheorien: Die Suche nach Ursachen und Auswege aus der Krise staatlicher Steuerungsfähigkeit. In: Altvater, Elmar u.a. (Hrsg.): Vernetzt und verstrickt. Nicht-Regierungs-Organisationen als gesellschaftliche Produktivkraft. Münster, 28-65 Meuser, Michael; Nagel, Ulrike 1994: Expertenwissen und Experteninterview. In: Hitzler, Ronald; Honer, Anne und Christoph Maeder (Hrsg.): Expertenwissen. Die institutionalisierte Kompetenz zur Konstruktion von Wirklichkeit. Opladen, 180-192 Mohrlok, Marion u.a. 1993: Let’s organize! Gemeinwesenarbeit und Community Organization im Vergleich. München Moreno Institut Stuttgart 2000: Sonderprogramm Organisationsentwicklung 2001. Stuttgart Moreno, Jakob L. 1954: Die Grundlagen der Soziometrie. Köln und Opladen Moreno, Jakob L. 1989: Psychodrama und Soziometrie. Essentielle Schriften. Köln Morgan, Gareth 1997: Bilder der Organisation. Stuttgart Moser, Heinz 1977a: Methoden der Aktionsforschung. Eine Einführung. München Moser, Heinz 1977b: Praxis der Aktionsforschung. Ein Arbeitsbuch. München Moser, Heinz 1995: Grundlagen der Praxisforschung. Freiburg Moser, Heinz 1997: Instrumentenkoffer für den Praxisforscher. Freiburg 243 LITERATUR UND QUELLEN Mühlum, Albert 1995: Soziale Arbeit weiter denken. Ein Diskussionsbericht. In: Wendt, Wolf Rainer (Hrsg.): Soziale Arbeit im Wandel ihres Selbstverständnisses. Beruf und Identität. Freiburg, 115-133 Mühlum, Albert 1996: Sozialpädagogik und Sozialarbeit. Ein Vergleich. Frankfurt/ M. Müller, Carl Wolfgang 1988: Wie helfen zum Beruf wurde. Band 2. Eine Methodengeschichte der Sozialarbeit 1945-1985. Weinheim und Basel Müller, Wolfgang C. 1988: Achtbare Versuche. Zur Geschichte von Praxisforschung in der Sozialen Arbeit. In: Heiner, Maja (Hrsg.): Praxisforschung in der sozialen Arbeit. Freiburg, 17-33 Münder, Johannes 1998: Frankfurter Lehr- und Praxis-Kommentar zum KJHG/ SGB VIII. Münster Mutschler, Roland 1998: Kooperation ist eine Aufgabe Sozialer Arbeit. In: Blätter der Wohlfahrtspflege. Jg. 145, Heft 3/4 1998. Stuttgart, 49-52 Nadig, Maya; Erdheim, Mario 1984: Die Zerstörung der wissenschaftlichen Erfahrung durch das akademische Milieu. Ethnopsychoanalytische Überlegungen zur Aggressivität in der Wissenschaft. Psychosozial. Jg. 7., Nr. 23. Hamburg, 11-27 Nagel, Ulrike 1997: Engagierte Rollendistanz. Professionalität in biographischer Perspektive. Opladen Nikles, Bruno W. u.a. 1994: Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in die Jugendhilfeplanung. Bericht über einen Modellversuch. Essen Nohlen, Anja 1997: Lebenslage und Subjektorientierung. In: Mangold, Jürgen (Hrsg.): Lebenswelt- und Subjektorientierung. Kritische Praxis Sozialer Arbeit. Berlin, 79-151 Oelschlägel, Dieter 1985: Partizipation: Scheindemokratie – Subversion - Integration. In: Meyer, Bernhard; Schröder, Eberhard (Hrsg.): Die junge Generation bestimmt mit. Praktische Modelle in Gemeinde und Gesellschaft. München, 24-35 Oelschlägel, Dieter 1995: Zum aktuellen Stand fachwissenschaftlicher Diskussion in der sozial-kulturellen und in der Gemeinwesenarbeit. In: Baumgärtner, Andreas u.a. (Hrsg.): Dokumentation. Köln, 3-16 Otto, Hans-Uwe 1998: Die Zukunftsfähigkeit der sozialpädagogischen Forschung. In: Rauschenbach, Thomas; Thole, Werner (Hrsg.): Sozialpädagogische Forschung. Gegenstand und Funktionen, Bereiche und Methoden. Weinheim/München, 133-139 Peirce, Charles Sanders 1967: Schriften I. Zur Entstehung des Pragmatismus. Frankfurt/M. Pfaffenberger, Hans; Scherr, Albert; Sorg, Richard (Hrsg.) 2000: Von der Wissenschaft des Sozialwesens – Standort und Entwicklungschancen der Sozialpädagogik/Sozialarbeitswissenschaft. Rostock Pfeiffer, Toni Sachs 1995²: Qualitative Stadt- und Gemeindeforschung. In: Flick u.a. (Hrsg.): Pühl, Harald 1999: Organisationsentwicklung und Supervision: Konkurrenten oder zwei Seiten einer Medaille? In: Pühl, Harald (Hrsg.): Supervision und Organisationsentwicklung. Handbuch 3. Opladen, 13-19 244 LITERATUR UND QUELLEN Puhl, Ria (Hrsg.) 1996: Sozialarbeitswissenschaft. Neue Chancen für theoriegeleitete Soziale Arbeit. Weinheim und München Rausch, Günter 1998: Gemeinschaftliche Bewältigung von Alltagsproblemen – Gemeinwesenarbeit in einer Hochhaussiedlung. Münster Reichard, Christoph; Wollmann, Hellmut (Hrsg.) 1996: Kommunalverwaltung im Modernisierungsschub? Basel Reuband, Karl-Heinz; Blasius, Jörg 1996: Face-to-face, telefonische und postalische Befragungen. Ausschöpfungsquoten und Antwortmuster in einer Großstadt-Studie. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. 48. Jg. Köln, 296-318 Rieger, Günter 2002: Von der Sozialpolitik zur Sozialarbeitspolitik. In: Sozialmagazin, 27. Jg. Heft 5, Weinheim, 36-51 Röhrle, Bernd 1994: Soziale Netzwerke und Soziale Unterstützung. Weinheim Rommelspacher, Birgit 1998²: Dominanzkultur. Texte zu Fremdheit und Macht. Berlin Romppel, Joachim 1996: Ein Leben zwischen den Chaostagen. Eine diskursive Stadtteilanalyse. In: Verband für Sozial-kulturelle Arbeit: Rundbrief 2/96. Köln, 18-23 Romppel, Joachim; Vahedi, Massoud 1998: Zur Interkulturellen Bildungsarbeit in Hannover. Eine empirische Studie anhand von ExpertInnen-Interviews. Hannover Roth, Günter 1999: Die Institution der kommunalen Sozialverwaltung. Die Entwicklung von Aufgaben, Organisation, Leitgedanken und Mythen von der Weimarer Republik bis Mitte der neunziger Jahre. Berlin Sader, Manfred 1998: Psychologie der Gruppe. Weinheim und München Sahle, Rita 2001: Perspektiven qualitativer Forschung in der Sozialen Arbeit. In: Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit. Heft 1/2001, 32. Jg. Frankfurt/M., 5-46 Salustowicz, Piotr 1995: Soziale Arbeit zwischen Disziplin und Profession. Weinheim Sanierungsbüro Vahrenheide-Ost 2000: Integrierte Sanierung Vahrenheide-Ost. Sachstandsbericht Mai 2000. Hannover Sanierungskommission 1999: Interfraktioneller Antrag von SPD-Gruppe, CDUGruppe, Bündnis 90/Die Grünen-Gruppe in der Sanierungskommission Vahrenheide-Ost vom 6.3.1999. Hannover Santen, Eric van, u.a. 2000: Sozialindikatoren, Fremdunterbringung und Sozialraumbudgetierung – ein Bermudadreieck für Fachlichkeit? In: Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit. Heft 2/2000, 31. Jg., Frankfurt/M., 101-131 Scherr, Albert 2000: Soziale Arbeit auf Suche nach Anerkennung. In: Sozial Extra, 24. Jg., Heft Mai/Juni 2000, Wiesbaden, 10-12 Schmidt, Monika 1994: Methoden als helfende Verfahren in der praktischen Bildungsarbeit. In: Siebert, Horst; Schmidt, Monika: Gestaltung von Erwachsenenbildung. Anregungen für Studium und Bildungsarbeit. Frankfurt/M., 73-119 245 LITERATUR UND QUELLEN Schmidt-Grunert, Marianne 1999: Sozialarbeitsforschung konkret: problemzentrierte Interviews als qualitative Erhebungsmethode. Freiburg Schröder, Richard 1996: Freiräume für Kinder(t)räume! Kinderbeteiligung in der Stadtplanung. Weinheim und Basel Schubert, Herbert J. 1990: Private Hilfenetze. Solidaritätspotentiale von Verwandtschaft, Nachbarschaft und Freundschaft. Ergebnisse einer egozentrierten Netzwerksanalyse. Hannover Schütz, Alfred; Luckmann, Thomas 1979: Strukturen der Lebenswelt. Band 1. Frankfurt/M. Schütz, Alfred; Luckmann, Thomas 1984: Strukturen der Lebenswelt. Band 2. Frankfurt/M. Schütze, Fritz 1983: Biographieforschung und narratives Interview. In: Neue Praxis, Jg. 13, Nr. 3, Neuwied, 283-293 Schütze, Fritz 1992: Sozialarbeit als „bescheidene“ Profession. In: Dewe, Bernd u.a. (Hrsg.): Erziehen als Profession. Zur Logik professionellen Handelns in pädagogischen Feldern. Opladen, 132-170 Schütze, Fritz 1994: Ethnographie und sozialwissenschaftliche Methode der Feldforschung. Eine mögliche methodische Orientierung in der Ausbildung und Praxis der sozialen Arbeit. In: Groddeck, Norbert; Schumann, Michael (Hrsg.): Modernisierung sozialer Arbeit durch Methodenentwicklung und -reflexion. Freiburg, 189-297 Schweitzer, Helmuth; Mühlenbrink, Herbert u.a. 1976: Über die Schwierigkeit, soziale Institutionen zu verändern. Frankfurt/M. und New York Schweitzer, Helmuth; Mühlenbrink, Herbert u.a. 1977: Projektstudium in der Heimerziehung. Entwicklungsarbeit im sozialpädagogischen Feld. Frankfurt/M. und New York Seel, Hans-Jürgen 1994: Ökologische Stadterneuerung und das „Erste Nürnberger Ökozentrum“: Intemediäre soziale Arbeit zwischen Verwaltung, Wirtschaft und Gemeinwesen. In: Sozialmagazin. Jg.19, Nr. 10. Weinheim, 26-30 Selle, Klaus 1996: Klärungsbedarf. Sechs Fragen zur Kommunikation in Planungsprozessen – insbesondere zur Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. In: Ders. (Hrsg.): Planung und Kommunikation. Gestaltung von Planungsprozessen in Quartier, Stadt und Landschaft. Grundlagen, Methoden, Praxiserfahrungen. Wiesbaden und Berlin, 161-180 Singer, Kurt 1997: Zivilcourage wagen. Wie man lernt, sich einzumischen. Zürich Spiegel, Hiltrud von 1996: Arbeitshilfen für das methodische Handeln. In: Heiner u.a.: Methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit. Freiburg, 218-287 Spiegel, Hiltrud von 1997: Offene Arbeit mit Kindern (k)ein Kinderspiel. Erklärungswissen und Hilfen zum methodischen Arbeiten. Münster Spierts, Marcel 1998: Balancieren und Stimulieren. Methodisches Handeln in der soziokulturellen Arbeit. Luzern Stange, Waldemar 1997: Planen mit Phantasie. Zukunftswerkstatt und Planungszirkel für Kinder und Jugendliche. Berlin/Kiel 246 LITERATUR UND QUELLEN Statistisches Bundesamt (Hrsg.) 2000: Datenreport 1999. Zahlen und Fakten über die Bundesrepublik Deutschland. Bonn Staub-Bernasconi, Silvia 1993: Ist Soziale Arbeit zu einfach oder zu komplex, um theorie- und wissenschaftswürdig zu sein. In: Pfaffenberger, Hans; Schenk, Hans (Hrsg.) Sozialarbeit zwischen Berufung und Beruf. Münster/Hamburg, 131-171 Staub-Bernasconi, Silvia 1995: Das fachliche Selbstverständnis Sozialer Arbeit – Wege aus der Bescheidenheit. Soziale Arbeit als „Human Rights Profession“. In: Wendt, Wolf Rainer (Hrsg.): Soziale Arbeit im Wandel ihres Selbstverständnisses. Beruf und Identität. Freiburg, 57-104 Staub-Bernasconi, Silvia 1996: Soziale Probleme – Soziale Berufe – Soziale Praxis. In: Heiner, Maja; Meinhold, Marianne; Spiegel, Hiltrud von; Staub-Bernasconi, Silvia: Methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit. Freiburg Steinert, Erika; Thiele, Gisela 2000: Sozialarbeitsforschung für Studium und Praxis. Einführung in die qualitativen und quantitativen Methoden. Köln Strauss, Anselm L. 1994: Grundlagen qualitativer Sozialforschung. Datenanalyse und Theoriebildung in der empirischen soziologischen Forschung. München Strauss, Anselm; Corbin, Juliet 1996: Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. Weinheim Strobl, Rainer und Andreas Böttger (Hrsg.) 1995: Wahre Geschichten? Zu Theorie und Praxis qualitativer Interviews. Baden-Baden Terhart, Ewald 1997: Entwicklung und Situation des qualitativen Forschungsansatzes in der Erziehungswissenschaft. In: Friebertshäuser, Barbara; Prengel, Annedore (Hrsg.): Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Weinheim/München Theis, Anna Maria 1994: Organisationskommunikation. Theoretische Grundlagen und empirische Forschungen. Opladen Thiele, Robert 1997: Niedersächsische Gemeindeordnung: Kommentar. Hannover Thiersch, Hans 1992: Lebenswelt-orientierte Soziale Arbeit. Aufgaben der Praxis im sozialen Wandel. Weinheim Thole, Werner 1999: Die Sozialpädagogik und ihre Forschung. Sinn und Kontur einer empirisch informierten Theorie der Sozialpädagogik. In: Neue Praxis 29. Jg., Heft 3/99. Bielefeld, 224-244 Thole, Werner; Küster-Schapfl, Ernst-Uwe 1997: Sozialpädagogische Profis. Opladen Tillmann, Jan 1994: Sozialarbeitswissenschaft im Werden. Gegenstand: Der Mensch im Mißbrauch. Grundvoraussetzung: der Mensch als Denk-GefühlsEinheit. In: Schatteburg, Uta (Hrsg.): Aushandeln, Entscheiden, Gestalten - Soziale Arbeit, die Wissen schafft. Hannover, 17-50 Van de Vall, Marc 1993: Angewandte Sozialforschung. Begleitung, Evaluierung und Verbesserung sozialpolitischer Maßnahmen. Weinheim Vester, Frederic 1993: Unsere Welt – ein vernetztes System. München Vester, Michael; Oertzen, Peter von u.a. 1993: Soziale Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel. Zwischen Integration und Ausgrenzung. Köln 247 LITERATUR UND QUELLEN VSOP (Verein für Sozialplanung e.V.) 1996: Leistungsbilanz der Sozialplanung. Fachtagung des VSOP und der Stadt Speyer. Speyer Wissenschaftsrat 2002: Empfehlungen zur Entwicklung der Fachhochschulen. Köln Weishaupt, Horst 1995: Qualitative Forschung als Forschungstradition. Eine Analyse von Projektbeschreibungen der Forschungsdokumentation Sozialwissenschaften (FORIS). In: König, Eckard; Zedler, Peter (Hrsg.): Bilanz qualitativer Forschung. Band I: Grundlagen qualitativer Forschung. Weinheim, 75-96 Weisser, Gerhard 1971: Grundsätze der Verteilungspolitik. In: Külp, Bernhard; Schreiber Wilfrid (Hrsg.): Soziale Sicherheit. Köln, 110-135 Welz, Frank 1996: Kritik der Lebenswelt. Eine soziologische Auseinandersetzung mit Edmund Husserl und Alfred Schütz. Opladen Wendt, Wolf Rainer (Hrsg.) 1994: Sozial und wissenschaftlich arbeiten. Status und Positionen der Sozialarbeitswissenschaft. Freiburg Wendt, Wolf Rainer 1995: Berufliche Identität und die Verständigung über sie. In: Ders. (Hrsg.): Soziale Arbeit im Wandel ihres Selbstverständnisses. Beruf und Identität. Freiburg, 11-29 Wendt, Wolf Rainer 1997: Case Management im Sozial- und Gesundheitswesen. Eine Einführung. Freiburg. Wilson, Thomas P. 1982: Qualitative „oder“ quantitative Methoden in der Sozialforschung. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Köln, 487508 Witzel, Andreas 1982: Verfahren der qualitativen Sozialforschung. Überblick und Alternativen. Frankfurt/M. Wolf, Willi 1995: Qualitative versus quantitative Forschung. In: König, Eckard; Zedler, Peter (Hrsg.) Bilanz qualitativer Forschung. Band I: Grundlagen qualitativer Forschung. Weinheim, 309-329 Wollmann, Hellmut 1996: Verwaltungsmodernisierung: Ausgangsbedingungen, Reformanläufe und aktuelle Modernisierungsdiskurse. In: Reichard, Christoph; Wollmann, Hellmut (Hrsg.): Kommunalverwaltung im Modernisierungsschub. Basel, 1-49 Womack, James P.; Jones, Daniel T.; Roos, Daniel 1994: Die zweite Revolution in der Autoindustrie. Konsequenzen aus der weltweiten Studie des Massachusetts Institute of Technology. Frankfurt/M. Zapf, Wolfgang; Habich, Roland 1999: Wohlfahrtsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland 1949 bis 1999. In: Kaase, Max; Schmid, Günther (Hrsg.): Eine lernende Demokratie. 50 Jahre Bundesrepublik Deutschland. WZB-Jahrbuch. Berlin, 285-314 Zeiher, Helga 1999: Die Räume der Kinder. Kindheit als institutionalisierte Lebensform. In: Theorie und Praxis der Sozialpädagogik. 107. Jg., Heft 2/1999. Seelze, 51-55 Zimmermann, Gunter E. 1998: Formen von Armut und Unterversorgung im Kindes- und Jugendalter. In: Klocke, Andreas; Hurrelmann, Klaus 1998: Kinder und Jugendliche in Armut: Umfang, Auswirkungen und Konsequenzen. Opladen, 51-71 248 LITERATUR UND QUELLEN Zinnecker, Jürgen 1990: Vom Straßenkind zum verhäuslichten Kind. In: Behnken, Imbke (Hrsg.): Stadtgesellschaft und Kindheit im Prozess der Zivilisation. Opladen, 142-162 http://www.eundc.de/seiten/info/cont_download.html. Version: August 2000. Datum: 10.12.2000. Seite 1-16 http://www.nananet.de/vahrenheide/start.html. Version: Datum 14.3.2002 http://www.niedersachsen.de/ms_soziale_stadt.htm. Version: Dezember 2000. Datum: 22.11.2000. Seite 1-2 http://www.sozialestadt.de/programm/grundlagen/polarisierung.shtml. Version: 2.10.2000. Datum 15.1.2001. Seite 1-2 http://www.stadtteilarbeit.de/index.html. Version: Januar 2001. Datum: 14.3.2002 http://www.stadtteilarbeit.de/seiten/Projekte/Vernetzte_Dienste/ Vernetzte_Dienste/htm. Datum: 14.3.2002 249 Der Autor Joachim Romppel, 1954 in Duderstadt/Niedersachsen geboren. Studium der Architektur, Sozialarbeit/Sozialpädagogik und Erziehungswissenschaften. Berufliche Tätigkeiten seit 1980 als Sozialarbeiter in der Erziehungshilfe eines Jugendamtes und in der kommunalen Gemeinwesenarbeit. Seit 1993 tätig in verschiedenen Forschungsprojekten der Praxisforschung u.a. zur interkulturellen Arbeit und Kindertagesstättenarbeit im Stadtteil, zur Gemeinwesenarbeit und interkulturellen Bildungsarbeit sowie zur sozialräumlich-orientierten Kinder- und Jugendhilfe. Seit 2000 Dozent für Praxisforschung, Stadtteil- und Gemeinwesenarbeit an der Evangelischen Fachhochschule Hannover. 250