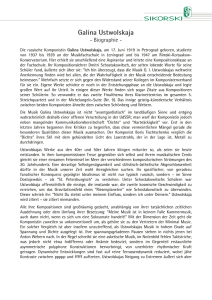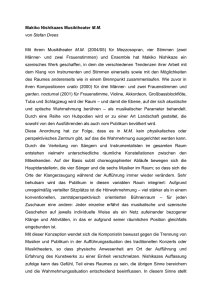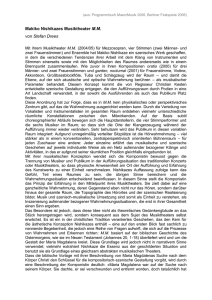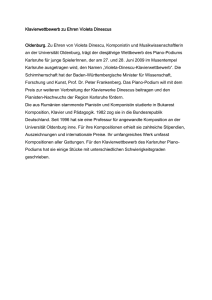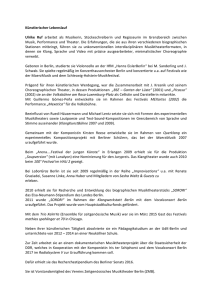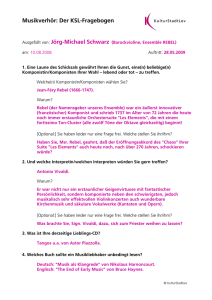Wir machen Musik
Werbung
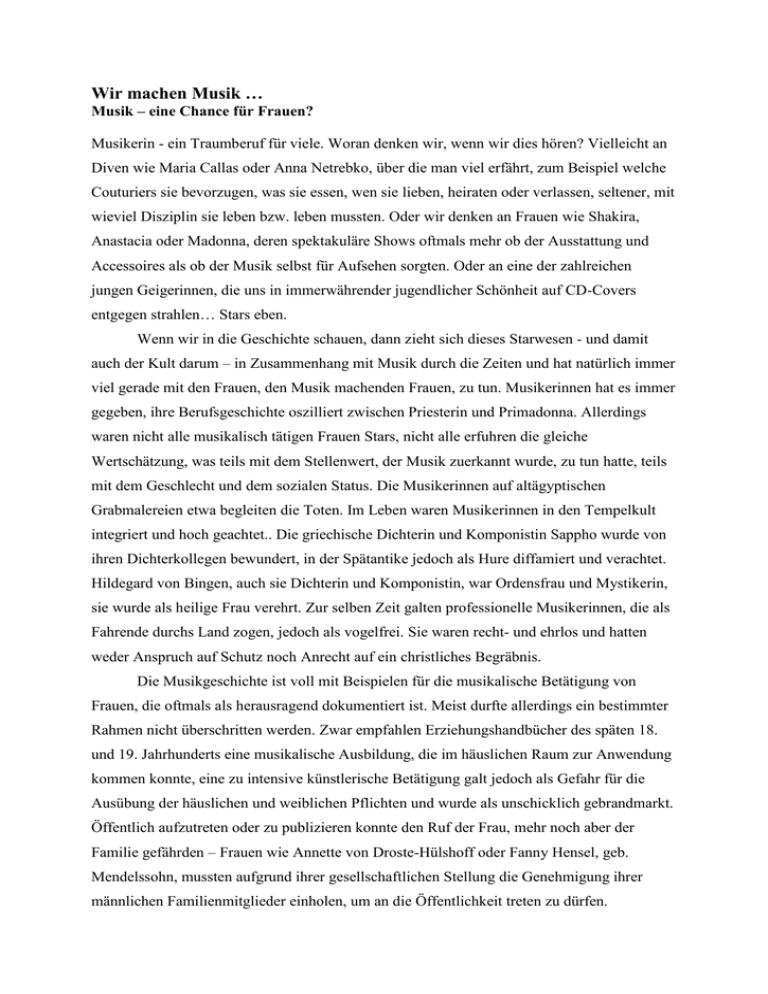
Wir machen Musik … Musik – eine Chance für Frauen? Musikerin - ein Traumberuf für viele. Woran denken wir, wenn wir dies hören? Vielleicht an Diven wie Maria Callas oder Anna Netrebko, über die man viel erfährt, zum Beispiel welche Couturiers sie bevorzugen, was sie essen, wen sie lieben, heiraten oder verlassen, seltener, mit wieviel Disziplin sie leben bzw. leben mussten. Oder wir denken an Frauen wie Shakira, Anastacia oder Madonna, deren spektakuläre Shows oftmals mehr ob der Ausstattung und Accessoires als ob der Musik selbst für Aufsehen sorgten. Oder an eine der zahlreichen jungen Geigerinnen, die uns in immerwährender jugendlicher Schönheit auf CD-Covers entgegen strahlen… Stars eben. Wenn wir in die Geschichte schauen, dann zieht sich dieses Starwesen - und damit auch der Kult darum – in Zusammenhang mit Musik durch die Zeiten und hat natürlich immer viel gerade mit den Frauen, den Musik machenden Frauen, zu tun. Musikerinnen hat es immer gegeben, ihre Berufsgeschichte oszilliert zwischen Priesterin und Primadonna. Allerdings waren nicht alle musikalisch tätigen Frauen Stars, nicht alle erfuhren die gleiche Wertschätzung, was teils mit dem Stellenwert, der Musik zuerkannt wurde, zu tun hatte, teils mit dem Geschlecht und dem sozialen Status. Die Musikerinnen auf altägyptischen Grabmalereien etwa begleiten die Toten. Im Leben waren Musikerinnen in den Tempelkult integriert und hoch geachtet.. Die griechische Dichterin und Komponistin Sappho wurde von ihren Dichterkollegen bewundert, in der Spätantike jedoch als Hure diffamiert und verachtet. Hildegard von Bingen, auch sie Dichterin und Komponistin, war Ordensfrau und Mystikerin, sie wurde als heilige Frau verehrt. Zur selben Zeit galten professionelle Musikerinnen, die als Fahrende durchs Land zogen, jedoch als vogelfrei. Sie waren recht- und ehrlos und hatten weder Anspruch auf Schutz noch Anrecht auf ein christliches Begräbnis. Die Musikgeschichte ist voll mit Beispielen für die musikalische Betätigung von Frauen, die oftmals als herausragend dokumentiert ist. Meist durfte allerdings ein bestimmter Rahmen nicht überschritten werden. Zwar empfahlen Erziehungshandbücher des späten 18. und 19. Jahrhunderts eine musikalische Ausbildung, die im häuslichen Raum zur Anwendung kommen konnte, eine zu intensive künstlerische Betätigung galt jedoch als Gefahr für die Ausübung der häuslichen und weiblichen Pflichten und wurde als unschicklich gebrandmarkt. Öffentlich aufzutreten oder zu publizieren konnte den Ruf der Frau, mehr noch aber der Familie gefährden – Frauen wie Annette von Droste-Hülshoff oder Fanny Hensel, geb. Mendelssohn, mussten aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung die Genehmigung ihrer männlichen Familienmitglieder einholen, um an die Öffentlichkeit treten zu dürfen. Als 1913 die amerikanische Pianistin und Komponistin Amy Beach im Rahmen einer Tournee in Leipzig gastierte, wo ihre Sinfonie in e-Moll (1897) und ihr Klavierkonzert cisMoll (1900) mit ihr selbst als Solistin aufgeführt wurden, fand man, wie die Rezensionen belegen, die Pianistin „kühl“ in Ausdruck und Erscheinung, die Komponistin ungewöhnlich, auch wenn man ihr ein respektables Talent attestierte. Die amerikanischen Kritiker hatten bei der Uraufführung der Sinfonie in der Bostoner Symphony Hall 1897 anerkennender reagiert. Hervorgehoben wurden die „männlichen“ Qualitäten der Musik, was sich auf die klangliche Qualität und die Durcharbeitung der großen Form Sinfonie bezog. Von ihren männlichen Kollegen erhielt die Komponistin das Kompliment, sie sei nun „one of the boys“. Wo stehen wir nun heute? Sind die Zeiten, in denen eine musikalische Leistung nur galt, wenn sie als „männlich“ bewertet wurde, in denen das Mitwirken von Mädchen in Ensembles als Gefährdung musikalischer Qualität gesehen wurde, in denen Instrumente als für Frauen geeignet oder nicht unterschieden wurden, endgültig vorbei? Die Statistik Austria belegt mit den Zahlen für das Studienjahr 2006/07, dass bei den Studierenden an allen Musikuniversitäten Österreichs Frauen- und Männeranteile etwa gleich groß sind, dass bis zur Aufnahme des Studiums keine Diskriminierung deutlich wird. Allerdings wissen wir zuwenig darüber, welche geschlechterspezifischen Begabungsmomente in die Beschäftigung mit Musik hineinspielen. Warum wollen Mädchen Flöte oder Harfe spielen und träumen weniger häufig von einem fetzigen Schlagzeug? Sind es alte, bewusstunbewusst verlaufende Erziehungsmuster, die sich hier niederschlagen? Die weitergehende, spannende Frage, was nun im Studium und danach passiert, ob männliche und weibliche Studierende ähnliche Prozesse durchlaufen, ob AbsolventInnen gleiche Karrierechancen, gleiche Laufbahnen, gleiche Gehälter erreichen, lässt sich ebenfalls kaum beantworten, fehlt doch auch hier (noch) statistisches und dokumentarisches Material als Grundlage. Universitären Karrieren analog ist, dass individuelle Förderung entscheidend ist. Frauenförderung muss gezielt ansetzen, in den Lehrveranstaltungen, bei den ersten Auftritten, bei der Frage, wer, ob Student oder Studentin, und wie für einen Wettbewerb vorbereitet wird. Ähnliches gilt für den Übergang in Stellen und Engagements. Zwar haben die Frauenbewegungen in den USA und Europa sowie die EU-Richtlinien viele Wege für die Frauenförderung geebnet, aber nach wie vor sind Frauen in bestimmten Sparten, sei es als Komponistin, in Orchestern oder am Dirigierpult, deutlich unterrepräsentiert, etwas, was der Blick auf mehr oder weniger spektakuläre Einzelkarrieren verdeckt. Spitzenpositionen, ob auf dem freien Markt oder in den künstlerischen und akademischen Institutionen, werden nach wie vor nur von wenigen Frauen eingenommen. Auch wenn Musik als Beruf nicht mehr als anstößig oder unschicklich gilt, ist es doch immer eine Aufgabe, mit optimaler Förderung Mädchen und Frauen den gleichberechtigten Weg in ihren Traumberuf zu ermöglichen.