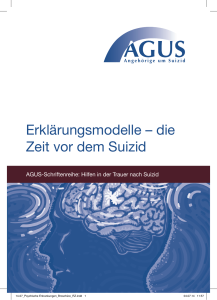Daran denken und aktiv ansprechen! - Familienmedizin
Werbung

FORTBILDUNG Fotolia FORTBILDUNG Suizidprävention in der Hausarztpraxis Daran denken und aktiv ansprechen! Hans-Michael Mühlenfeld Auch wenn der Verlust eines Patienten durch eine Selbsttötung im hausärztlichen Alltag selten vorkommt, ist es für den Kollegen ein schreckliches Erlebnis. Die Fragen „Habe ich die Schwere der Erkrankung falsch eingeschätzt?“ oder „Hätte ich es verhindern können? “ beschäftigen einen über Tage und Wochen. Wie kann man eine Suizidgefährdung frühzeitig erkennen und den Selbstmord abwenden? Der Suizid ist ein evidentes Problem unserer Gesellschaft. In Deutschland sterben doppelt so viele Menschen durch Suizid als im Straßenverkehr. Suizidprävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zum einen durch Enttabuisierung, zum anderen durch den Verzicht auf Publikation in den Massenmedien, um Nachahmungen zu vermeiden. Aber auch der Hausarzt steht hierbei wieder einmal im Mittelpunkt. Studien zeigen, dass in den Wochen vor dem Suizid viele Menschen Der Allgemeinarzt 16/2008 häufiger als sonst einen Arzt aufsuchen. Dabei wird jedoch oftmals das Ausmaß der Suizidgefährdung nicht erkannt. Obwohl uns die „erlebte Anamnese“, das Lebensumfeld und die berufliche Situation unserer Patienten bekannt sind, ist es dennoch sehr schwierig, in der vollen Sprechstunde immer auch an diesen gefährlichen – nicht immer abwendbaren – Verlauf zu denken. Wie kann der Hausarzt Suizidalität erkennen? Um an Suizidalität überhaupt denken zu können, ist es wichtig, die Risikofaktoren (vgl. Übersicht 1) zu kennen. Patienten, die ein erhöhtes Risiko haben, sollten wir gezielt diesbezüglich befragen. Ich spreche z. B. jeden depressiven Patienten in folgender Weise auf Selbsttötungsgedanken an: ● „Ich kann verstehen, dass es Ihnen schlecht geht, haben Sie auch schon einmal daran gedacht, Ihr Leben zu beenden?“ oder ● „Haben Sie sich gewünscht, nicht wieder aufzuwachen?“ oder ● „Sind Sie des Lebens müde?“ oder ● „Ich mache mir Sorgen über Sie, wie kann ich Ihnen helfen?“ Allein schon dieses Ansprechen reduziert bei den Patienten den Krankheits- und Leidensdruck, da ich damit auch Verständnis für ihre Situation signalisiere. Was sollten wir möglichst nicht tun? Ein Bagatellisieren der vom Patienten empfundenen Belastungen, wie „Na, so schlimm ist das doch nicht“ oder „Das wird schon wieder“ ist in der Regel im Rahmen von depressiven Episoden wenig hilfreich, auch wenn es inhaltlich stimmen mag. Ebenso ist eine Konfrontation mit Konflikten bei schweren Depressionen in der akuten Phase zu vermeiden. Auch wenn ich oftmals zunächst mit dem Patienten im Rahmen einer suizidalen Krise alleine bin, versuche ich ihn von der Sinnhaftigkeit einer Kooperation mit einem Nervenarzt zu überzeugen, was mir aber nicht immer gelingt. Die Mitbehandlung durch einen Nervenarzt entlastet mich (geteilte Verantwortung) und ist zudem hilfreich, wenn eine komplexere Medikation notwendig wird. 39 FORTBILDUNG Wie können wir weiter vorgehen? Meistens distanziert sich der Patient in der Sprechstunde von aktuellen Suizidgedanken (ansonsten vgl. Kasten rechts unten). Da in der Regel ein Nervenarzt nicht unmittelbar greifbar ist, haben sich bei mir kurzfristige Wiedereinbestellungen bewährt. Zum einen kann die Situation am nächsten Tag neu eingeschätzt werden, zum anderen erhält der Patient dadurch eine – wenn auch geringe – Perspektive. Als Alarmzeichen einer zunehmenden Suizidgefährdung gelten dabei: ● schriftliche oder verbale Suizidäußerungen ● konkrete Vorbereitungen zu einer suizidalen Handlung ● weiterer Rückzug aus zwischenmenschlichen Beziehungen ● abwehrend-aggressives Verhalten ● plötzliche Veränderung der Stimmung oder des Verhaltens. Suizid in Deutschland: Die Fakten ● Ca. 9 500 Suizide in Deutschland im Jahr 2006, ca. 18 000 Suizide im Jahr 1980. ● Suizidraten: 18/10 000 Männer, 7/100 000 Frauen. ● Männer wählen konsequentere Methoden (Erschießen, Erstechen, Erhängen) als Frauen (Schlafmittel). ● Mit zunehmendem Alter steigen die Suizidziffern an, insbesondere bei Frauen. ● In Deutschland existieren deutliche regionale Unterschiede mit deutlich höheren Suizidraten in Sachsen und Bayern und niedrigen Ziffern in Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. ● Es gibt eine saisonale Häufung von März bis Oktober. ● Bei Verheirateten (besonders wenn Kinder da sind) finden sich die geringsten, bei Verwitweten, Alleinstehenden und Geschiedenen die höchsten Suizidraten. ● Suizidversuche sind vermutlich zehnfach häufiger als vollendete Suizide. ● 40 bis 50 % der Menschen, die sich umbrachten, hatten im letzten Monat ihres Lebens einen Arzt aufgesucht (20 bis 25 % sogar in der letzten Woche). Science Risikofaktoren für einen Suizid Psychische Erkrankungen ● Depressionen (vorausgehend bei 65 – 95 % aller Suizide) ● Schizophrenie ● Manisch-depressive Störungen ● Angststörungen ● Persönlichkeitsstörungen ● Schlafstörungen ● Behandlung mit Antidepressiva Alkoholmissbrauch und anderer Drogenkonsum ● Alkoholabhängigkeit: Suizidrisiko et- wa um das Zehnfache erhöht ● Drogenabhängigkeit: Suizidrisiko et- wa um das 20-Fache erhöht ● Auch Kinder und Jugendliche aus suchtbelasteten Familien neigen häufiger zu suizidalem Verhalten Schwere Erkrankung Gewalttätige Umgebung Psychosoziale Belastungsfaktoren ● Berufliche Überforderung ● Finanzielle Belastungen ● Arbeitslosigkeit Frühere Suizidversuche und -gedanken Isolation, Alleinleben und Verlust von Unterstützung Übersicht 1 40 Es gilt die Regel: Je konkreter die Suizidgedanken sind, desto größer ist die Gefahr und desto mehr Handlungsbedarf besteht! Eine Vereinbarung mit einem Therapievertrag sowie die Verabredung für ein Treffen am nächsten Tag, gegebenenfalls auch die Möglichkeit einer „Notrufnummer“ (meine Handynummer oder auch das Krisentelefon der Gemeinde), deeskalieren die Situation. Hilfreich kann die Frage des Arztes sein, ob er sich darauf verlassen kann, dass der Patient sich bis zum nächsten Treffen nichts antut. Auch die gemeinsamen Überlegungen, Partner, Angehörige oder Freunde zur Stärkung des sozialen Netzes in die aktuelle Krankheitssituation mit einzubinden, können entlasten. Angehörige einbeziehen Suizidprävention sollte generell die Angehörigen mit einbeziehen, denn von jedem Suizid bzw. Suizidversuch sind auch die Angehörigen betroffen. Suizidales Verhal- ten von Angehörigen führt aufgrund von depressiven Syndromen mit Gedanken an Schuld häufig zu weiterem suizidalen Verhalten. Neben Risikofaktoren gibt es natürlich auch schützende Faktoren: ● soziale Kompetenzen ● ein gut ausgebildetes Gesundheitsbewusstsein ● Persönlichkeitsmerkmale wie Neugierde und Offenheit, Selbstvertrauen Einweisung bei akuter Suizidalität Sofern der Patient von floriden Selbstmordgedanken berichtet, biete ich meinen Patienten eine (selbst)„schützende“ Einweisung an. Im Setting einer Klinik ist eine Entlastung (psychotherapeutisch und medikamentös) besser möglich. Dieses Angebot wird meistens angenommen. Die Ausnahme, dass eine Zwangseinweisung bei akuter Suizidalität notwendig wird, habe ich nur im Rahmen von Psychosen erlebt. Kasten Der Allgemeinarzt 16/2008 FORTBILDUNG Therapeutische Grundregeln bei depressiven Patienten ● An erster Stelle steht das ärztliche Gespräch, das mit Zuhören begonnen hat. ● Akute Episoden klingen in der Praxis oft in kurzer Zeit spontan ab. ● Bei Patienten mit leichter und mittelschwerer Depression, die keine Therapie wünschen, ist ein beobachtendes Abwarten möglich. ● Je ausgeprägter die Symptomatik, desto früher sollte man den Einsatz von Antidepressiva erwägen. ● Verwendung von wenigen Medikamenten, mit denen man Erfahrung hat ● der Situation angepasste Verhaltensweisen (adäquate Copingstrategien) ● soziale Integration und die Unterstützung durch Familie und Freunde ● persönliche und berufliche Perspektiven Diese gilt es zu finden und zu stärken. Behandlungsmöglichkeiten bei bestehender Depression Die häufigste Ursache für Suizidalität in der Hausarztpraxis wird sicherlich eine Dekompensation einer depressiven Episode sein. Gerade hierbei haben wir eine gute Prognose, einerseits durch den spontanen Verlauf und andererseits durch psychotherapeutische und pharmakologische Optionen, wenn wir die suizidale Krise erkennen und behandeln. Depressive Episoden in der Sprechstunde zu erkennen ist jedoch meistens nicht Mögliche Gründe einer Überweisung zum Psychiater bei depressiven Patienten ● unklare psychiatrische Diagnose ● mittelschwere bis schwere anhaltende Symptomatik einfach, da einerseits die Patienten körperliche Symptome (wie Kopf-, Bauch- und Rückenschmerzen) präsentieren und andererseits es sich zu zwei Dritteln um leichte Formen handelt, die bei vielen hausärztlichen Patienten ohne spezifische Therapie nach sechs bis zwölf Monaten verschwinden. ● Kein abruptes Absetzen, sondern „Ausschleichen“ bevorzugen. ● Ausreichend lange Erhaltungstherapie (mindestens sechs bis neun Monate). ● Unterschiede in der antidepressiven Wirksamkeit zwischen den einzelnen chemisch definierten Antidepressiva wurden bislang nicht sicher gezeigt. ● Die Differenzialindikation der einzelnen Wirkstoffe ergibt sich aus den Neben- und Wechselwirkungsprofilen. ● Für viele Patienten in der hausärztlichen Praxis, insbesondere für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen oder höherem Alter, sind SSRI aufgrund ihres Nebenwirkungsprofils zu bevorzugen. ● Bei aktivierenden Antidepressiva und Suizidgefahr ggf. anfangs dämpfende Medikamente ergänzen, da für diesen Fall eine anfängliche Erhöhung der Suizidgefahr immer wieder diskutiert wird. Übersicht 3 Bedeutsam jedoch ist das Erkennen des abwendbar gefährlichen Verlaufes, eben der Suizidalität. Wichtig ist es sicherlich zudem, immer die Schnittstelle der Überweisung zum Spezialisten (Übersicht 2) sowie die Grundregeln der Therapie zu beachten (Übersicht 3). ▪ Internetadressen: www.suizidprophylaxe.de www.suizidpraevention-deutschland.de Weitere Literatur bei Verfasser ● psychotische Symptome ● schwere psychosoziale Probleme ● akute suizidale Gefährdung ● psychiatrische Komorbidität und Substanzabhängigkeit/-missbrauch ● fehlende Besserung nach sechs Wochen Behandlung Fotolia ● Mögliche Nebenwirkungen frühzeitig ansprechen. ● Einschleichende Dosierung (Tropfen!) unter erhöhter Kontaktfrequenz anstreben. Dr. med. Hans-Michael Mühlenfeld Arzt für Allgemeinmedizin Gemeinschaftspraxis für Familienmedizin 28197 Bremen practica-Seminare „Hausbesuchsmanagement“ und „Freude am Beruf“ Der Autor dieses Beitrags zur Suizidprävention, Dr. med. Hans-Michael Mühlenfeld – Allgemeinarzt, Lehrarzt in Göttingen und stellv. Vorsitzender des Instituts für hausärztliche Fortbildung (IhF) im Deutschen Hausärzteverband – ,ist wie bereits in den letzten beiden Jahren auch 2008 wieder auf der practica vertreten. Diesmal bietet er zwei Seminare an: 1. Hausbesuchsmanagement: Mitarbeiterqualifizierung in und für die Praxis der Zukunft im Rahmen der Qualifizierung zur Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis – VERAH®. Termin: Mittwoch, 22.10.2008, 15.00 bis 18.30 Uhr 2. Freude am Beruf – Ehrlich und gut verdienen. Termin: Donnerstag, 23.10.2008, 9.00 bis 12.30 Uhr Näheres unter www.practica.de Übersicht 2 Der Allgemeinarzt 16/2008 41