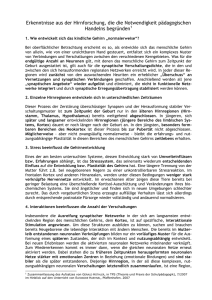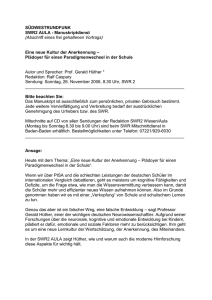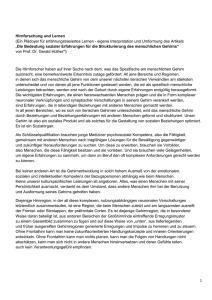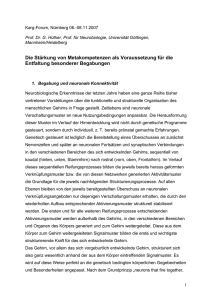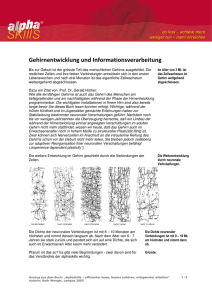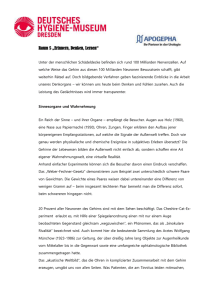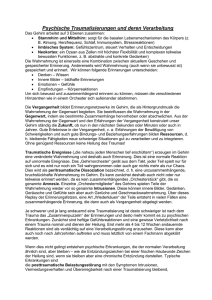Die Folgen traumatischer Kindheitserfahrungen für die weitere
Werbung

Die Folgen traumatischer Kindheitserfahrungen für die weitere Hirnentwicklung von Gerald Hüther, Psychiatrische Klinik der Universität Göttingen (Dezember 2002) • • • • • • • • • • • Einleitung Die Hirnentwicklung als ein sich selbst organisierender, durch Interaktionen mit der Außenwelt gelenkter Prozess Die nutzungsabhängige Stabilisierung synaptischer Angebote Die erfahrungsabhängige Modifikation und Reorganisation synaptischer Verschaltungsmuster Die Bedeutung psychosozialer Entwicklungsbedingungen für die Strukturierung des kindlichen Gehirns Die Hirnentwicklung als ein von Außen beeinflußbarer und daher auch störbarer Prozess Die Auswirkungen früher Traumatisierung auf die weitere Hirnentwicklung Die Bedeutung subjektiver Bewertungen Die psychobiologischen Besonderheiten frühkindlicher Traumatisierung Therapeutische Implikationen Literatur 1. Übersicht Dieser Beitrag untersucht die Auswirkungen von Kindheitstraumata auf die weitere Hirnentwicklung unter Zugrundelegung neuerer entwicklungsneurobiologischer Erkenntnisse über nutzungs- und erfahrungsabhängige Strukturierungsprozesse auf der Ebene neuronaler Verschaltungen. Psychische Traumatisierung führt zur unkontrollierbaren Aktivierung stresssensitiver kortiko-limbischer Netzwerke und neuroendokriner Regelkreise. Unter diesen Bedingungen kommt es zu einer fortschreitenden Destabilisierung bereits etablierter, komplexer Verschaltungsmuster (Regression, dendritischer Degeneration, insbesondere im Hippocampus). Anhalten und bewältigen lassen sich diese Prozesse meist nur noch durch die Aktivierung von früh angelegten, einfach strukturierten neuronalen Verschaltungen (Notfallreaktionen) und durch nachfolgende nutzungsabhängige Bahnung von selbstschützenden, protektiven und defensiven Reaktionsmustern (Dissoziation, Depersonalisation, Derealisation etc.). Die weitere nutzungs- und erfahrungsabhängige Strukturierung komplexer kognitiver und affektiver neuronaler Verschaltungen, insbesondere in den höheren assoziativen, frontokortikalen Hirnbereichen kann unter diesen Bedingungen nur noch eingeschränkt erfolgen. Die daraus resultierenden strukturellen Veränderungen des Gehirns sind inzwischen durch eine Vielzahl empirischer Befunde belegt. Langfristig wird die weitere nutzungs- und erfahrungsabhängige Strukturierung des kindlichen Gehirns jedoch weniger durch das tatsächliche erlebte Trauma gefährdet, sondern durch die dadurch beim Kind ausgelöste Zerstörung von Sicherheit-bietenden emotionalen Bindungen, Selbstwertkonzepten und inneren Leitbildern. Wichtigstes Ziel aller therapeutischen Bemühungen muß es daher sein, Bedingungen zu schaffen, die es einem traumatisierten Kind ermöglichen, diese wichtigsten Ressourcen zur Bewältigung von Angst und Stress möglichst rasch wieder zurückzugewinnen. 2. Einleitung Im Grunde ist es ganz einfach: Keine andere Spezies kommt mit einem derartig offenen, lernfähigen und durch eigene Erfahrungen in seiner weiteren Entwicklung und strukturellen Ausreifung formbaren Gehirn zur Welt wie der Mensch. Nirgendwo im Tierreich sind die Nachkommen beim Erlernen dessen, was für ihr Überleben wichtig ist so sehr und über einen derartig langen Zeitraum auf Fürsorge und Schutz, Unterstützung und Lenkung durch die Eltern angewiesen, und bei keiner anderen Art ist die Hirnentwicklung in solch hohem Ausmaß von der emotionalen, sozialen und intellektuellen Kompetenz dieser erwachsenen Bezugspersonen abhängig wie beim Menschen. Da diese Fähigkeiten bei den für die Gestaltung der Entwicklungsbedingungen eines Kindes maßgeblichen Erwachsenen unterschiedlich gut entwickelt sind, können die genetischen Potenzen zur Herausformung hochkomplexer, vielseitig vernetzter Verschaltungen im Gehirn der betreffenden Kinder nicht immer in vollem Umfang entfaltet werden. Die Auswirkungen derartiger suboptimaler Entwicklungsbedingungen werden allerdings meist erst dann sichtbar, wenn ein so aufgewachsenes Kind später, als Erwachsener, seine emotionale, soziale und intellektuelle Kompetenz bei der Gestaltung der Entwicklungsbedingungen seiner eigenen Nachkommen unter Beweis stellen muß. Sogar bei Ratten ist die transgenerationale Weitergabe von Defiziten der Erziehungskompetenz inzwischen empirisch nachgewiesen worden (Francis und Meaney 1999). Beim Versuch, diese recht eindeutigen tierexperimentellen Befunde auf den Menschen zu übertragen, stößt man gegenwärtig jedoch noch immer auf erhebliche Akzeptanzprobleme. Diese Ablehnung macht deutlich, wie sehr die tatsächliche Tragweite der sich aus derartigen Erkenntnissen ergebenden Folgerungen erahnt wird und erklärt zugleich den Umstand, dass sich in der Vergangenheit deterministische Vorstellungen einer primär durch genetische Programme gesteuerten Hirnentwicklung wesentlich erfolgreicher verbreiten und im Bewußtsein ganzer Bevölkerungsschichten verankern ließen und zwangsläufig auch zu tragenden Säulen medizinischer, biologischer, psychologischer und sogar soziologischer Theoriegebäude geworden sind (Rutter 2002). Es ist daher durchaus verständlich, dass die ersten Berichte über die dramatischen Auswirkungen frühkindlicher psychischer Traumatisierung auf die weitere emotionale, kognitive und somatische Entwicklung kaum zur Kenntnis genommen oder als Folklore abgetan wurden. Erst in den letzten Jahren ist das Ausmaß der durch psychische Taumata während der frühen Kindheit ausgelösten Entwicklungsdefizite und die Vielfalt der daraus resultierenden psychiatrischen und psychosomatischen Störungsbilder so evident geworden, dass eine Neubewertung des Einflusses der psychosozialen Entwicklungsbedingungen auf die strukturelle und funktionelle Ausreifung des kindlichen Gehirns inzwischen nicht nur möglich, sondern unausweichlich geworden ist. Die Auswirkungen frühkindlicher Traumatisierung reichen aber weit über die beobachteten Veränderungen der Hirnentwicklung und die damit einhergehenden Beeinträchtigungen kognitiver und affektiver Reifungsprozesse der betroffenen Kinder hinaus. Sie werfen auch ein helles Licht auf die Schwachstellen einer Vorstellungswelt, die durch eine allzu bereitwillige Übernahme genetisch-deterministischer und monokausal-mechanischer Modellvorstellungen entstanden ist. Sie zwingen uns nicht nur, bequeme und deshalb liebgewonnene Weltbilder zu korrigieren, sondern endlich die Verantwortung für eine optimale Gestaltung der Einwicklungsbedingungen der nachwachsenden Generation zu übernehmen und dafür zu sorgen, dass zumindest den in die Gesellschaft hineinwachsenden Kindern traumatische Erfahrungen in Zukunft erspart bleiben. 3. Die Hirnentwicklung als ein sich selbst organisierender, durch Interaktionen mit der Außenwelt gelenkter Prozess Die Entwicklung des kindlichen Gehirns folgt einem grundsätzlichen Entwicklungsprinzip aller lebenden Systeme: Neue Interaktionen (hier: neuronale Verbindungen und synaptische Verschaltungen) können nur im Rahmen und auf der Grundlage bereits etablierter Interaktionsmuster ausgebildet und stabilisiert werden. Dabei müssen sie den bereits entwickelten Interaktionsmöglichkeiten zwischen den verschiedenen Subsystemen folgen. Wie alle lebenden Systeme entwickelt sich auch das Gehirn nur dann weiter, wenn neuartige Bedingungen auftreten, die die Stabilität der bereits etablierten Interaktionen in Frage stellen. Solche Bedingungen werden mit erstaunlicher Präzision von dem sich entwickelnden System selbst verursacht (im sich entwickelnden Gehirn etwa durch Proliferation von neuralen Zellen, Auswachsen von Fortsätzen, Sekretion von wachstumshemmenden und stimulierenden Faktoren etc.). Solange das der Fall ist, verläuft die (Hirn)Entwicklung weitgehend autonom, selbstorganisiert und eigendynamisch innerhalb der jeweils herrschenden äußeren (intrauterinen) Bedingungen. Wenn Proliferation und Wachstum zu erlöschen beginnen, verliert das sich entwickelnde Gehirn eine wesentliche Triebfeder seiner Eigendynamik. In dem Maße, wie das sich entwickelnde Gehirn zunehmend Verbindungen zur Außenwelt erlangt, werden die bereits etablierten und noch zu bildenden Verschaltungen und Erregungsmuster über die entsprechenden sensorischen Eingänge zunehmend von außen beeinflußbar. Mehr noch, da nun die durch sensorische Eingänge getriggerten Erregungsmuster dazu führen, daß bestimmte neuronale Verschaltungsmuster stabilisiert werden können, hängt die Stabilität dieser Verschaltungen von den jeweiligen sie stabilisierenden Eingängen und Erregungsmustern ab. Von diesem Zeitpunkt an verläuft die Hirnentwicklung nicht mehr autonom gegenüber sensorischen Inputs, sondern sie wird durch die sensorischen Eingänge aus der Außenwelt bestimmt und bleibt von ihnen abhängig. 3.1. Die nutzungsabhängige Stabilisierung synaptischer Angebote Keine der Milliarden Nervenzellen „weiß“, wann sie aufhören muß, sich zu teilen, wohin sie anschließend zu migrieren und ihre Fortsätze auszuwachsen hat, mit welchen andern Nervenzellen sie Verbindung aufnehmen und Synapsen ausbilden soll. Ihr genetisches Programm versetzt sie lediglich in die Lage, sich zu teilen, solange die äußeren Bedingungen (das lokale Mikroenvironment) dafür günstig sind, entlang bestimmter Signalstoffgradienten zu wandern und Fortsätze auszuwachsen, dendritische (postsynaptische) Angebote zu machen und axonale Präsynapsen auszubilden. Es handelt sich also um ein Programm von Optionen, das lediglich festlegt, was unter gewissen Bedingungen möglich ist, und was zu geschehen hat, wenn sich diese Gegebenheiten ändern, entweder als zwangsläufige Folge der eigenen Wachstumsdynamik (Gradienten von Nährstoffen, Metaboliten, Signalstoffen, Adhäsionsmolekülen etc.) oder durch äußere Faktoren (sensorische Eingänge, äußere Störungen des inneren Bedingungsgefüges). Jede Veränderung der äußeren Welt, die stark genug ist, um das in der „Innenwelt“ des sich entwickelnden Gehirn herrschende Bedingungsgefüge zu verschieben, kann daher die dort ablaufenden Wachstums- und Differenzierungsprozesse in eine bestimmte (ohne diese Störung nicht oder noch nicht eingeschlagene) Richtung lenken. Weil das sich entwickelnde Gehirn nicht „weiß“, welche Nervenzellverschaltungen und synaptischen Verbindungen in welcher Weise herauszuformen und miteinander zu verknüpfen sind, wird in allen Regionen zunächst ein enormer Überschuß an Nervenzellen, Fortsätze und Synapsen produziert. Erhalten bleiben im weiteren Verlauf des Reifungsprozesses davon jedoch nur diejenigen Nervenzellen, Fortsätzen und Synapsen, die funktionell genutzt, d.h. in größere funktionelle Netzwerke integriert und auf diese Weise stabilisiert werden können (Singer 1995). Der Rest wird wieder abgebaut (nutzungsabhängige Strukturierung). Dieser Prozess verläuft in einer charakteristischen zeitlichen Abfolge, wie die Schließung des Neuralrohres, von kaudal beginnend (Rückenmark) über Stammhirn, Mittelhirn (Thalamus, Hypothalamus, limbisches System) zum Vorderhirn. In den älteren Bereichen ist diese die nutzungsabhängige Strukturierung zum Zeitpunkt der Geburt weitgehend abgeschlossen, in jüngeren Bereichen sind nur die wichtigsten Neuronenverbände und Verschaltungsmuster bereits herausgeformt. Die Nervenzellproliferation ist (bis auf eine kleines Areal im Gyrus dentatus des Hippocampus) beendet, die entsprechenden Kerngebiete bzw. Zellschichten sind angelegt. In den jüngeren Regionen werden noch lange nach der Geburt intensiv Gliazellen produziert und Myelinscheiden geformt. Vor allem im Cortex ist das Auswachsen von Dendriten und Axonen und die Synapsenbildung noch in vollem Gange. In der jüngsten Hirnregion, dem frontalen Cortex, wird das Maximum der synaptischen Dichte erst im 2. Lebensjahr erreicht. Wird der sukzessive Ablauf dieser Reifungsprozesse an irgendeiner Stelle gestört, wirkt sich diese Störung auch auf alle nachfolgenden Reifungsschritte in all jenen Regionen aus, die funktionell von dieser Störung affiziert sind. 3.2. Die erfahrungsabhängige Modifikation und Reorganisation synaptischer Verschaltungsmuster In den jüngeren Bereichen des Gehirns wird der Prozess der nutzungsabhängigen Strukturierung (Bildung und Elimination überschüssiger synaptischer Verschaltungen) zunehmend durch die individuell vorgefundenen äußeren Nutzungsbedingungen (familiäres und soziales Umfeld, Anregungen, Forderungen, Erziehung und Sozialisation) und den unter diesen Bedingungen jetzt gemachten oder von nahestehenden Bezugspersonen übernommenen Erfahrungen bestimmt. Die strukturelle Verankerung von Erfahrungen ist eng an die Aktivierung emotionaler, limbischer Hirnregionen geknüpft. Zu einer Aktivierung dieser Bereiche kommt es immer dann, wenn etwas Neues, Unerwartetes wahrgenommen wird. Diese Wahrnehmung kann entweder als Bedrohung (Angst) oder als Belohnung (Freude) empfunden werden. Die damit einhergehende Aktivierung limbischer Zentren führt zu einer vermehrten Ausschüttung einer ganzen Reihe von Signalstoffen mit trophischen, neuroplastischen Wirkungen (Transmitter, Mediatoren, Hormone) in den höheren assoziativen corticalen Regionen. Unter dem Einfluß dieser, die Bildung und Bahnung synaptischer Verschaltungen stimulierenden Signalstoffe (z.B. Catecholamine, Neuropeptide) kommt es zur Festigung und Stabilisierung insbesondere all jener Nervenzellverschaltungen, die im Verlauf der emotionalen Aktivierung besonders intensiv genutzt werden (strukturelle Verankerung positiver/negativer Erfahrungen, „emotionales Gedächtnis“ für erfolgreiche/erfolglose Bewältigungsstrategien, vgl. Hüther 1996). Offenbar gibt es einen Grad „optimaler“ Stimulation emotionaler Zentren, der die Herausbildung und Stabilisierung hochkomplexer Verschaltungsmuster im Cortex (und dort in der am stärksten vernetzten und durch eigene Erfahrungen formbarsten Region, dem präfrontalen und orbifrontalen Cortex der rechten Hemisphäre) fördert. Steigt das Ausmaß an emotionaler Aktivierung weiter an (Angst, Stress), so kommt es zu einer eskalierenden, unspezifischen Erregung in den höheren, assoziativen Bereichen (Verwirrung, Ratlosigkeit). Gebahnt und stabilisiert werden unter diesen Bedingungen die zur Bewältigung dann aktivierten, weniger komplexen, älteren, bereits „bewährten“ Verschaltungen. Wird die Aktivierung der emotionalen Zentren überstark und läßt sie sich nicht durch den Rückgriff auf eine geeignete Bewältigungsstrategie abstellen (langanhaltende, unkontrollierbare Angst- und Stressreaktion), so reagiert das Gehirn mit der Aktivierung einer archaischen, sehr früh angelegten und von tieferliegenden subcorticalen Bereichen gesteuerten „Notfallreaktion“ (Erstarrung, Hilflosigkeit). Gleichzeitig kommt es zu einer ausgeprägten, langanhaltenden Stimulation der (für die körperliche Bewältigung derartiger Notfälle zuständigen) HPA-Achse. Die damit einhergehende Überflutung des Hirns mit Cortisol begünstigt die Destabilisierung und Regression bereits entstandener und gebahnter neuronaler Verschaltungen in all jenen Bereiche des Gehirns, die eine besonders hohe Dichte an Cortisolrezeptoren aufweisen (Hippocampus, limbischer und präfrontaler Cortex) und die gleichzeitig durch massive exzitatorische Eingänge (Glutamat) überstark erregt werden (Hippocampus, Sapolski 1996). 3.3. Die Bedeutung psychosozialer Entwicklungsbedingungen für die Strukturierung des kindlichen Gehirns Zusammenfassend läßt sich also festhalten: Kinder kommen bereits mit sehr unterschiedlichen Anlagen und Prädispositionen zur Welt. Diese Unterschiede beruhen nur zum Teil auf Unterschieden der genetisch festgeschriebenen Optionen und Potenzen, da diese in Abhängigkeit von den individuell vorgefunden Bedingungen exprimiert werden. Wie groß diese von außen getriggerten Unterschiede bereits im Verlauf der pränatalen Phase der Hirnentwicklung sein können, wie unterschiedlich diese frühe Entwicklungsphase selbst bei eineiigen Zwillingen verlaufen kann und welche Folgen diese frühen Unterschiede für die weitere Entwicklung haben können, ist von René Spitz sehr eindringlich am Beispiel der Zwillingsschwestern Cathy und Rosy beschrieben worden (Spitz 2000). Alle weiteren, nach der Geburt normalerweise stattfindenden Strukturierungs- und Reifungsprozesse sind das Ergebnis der Interaktion zwischen den bis dahin bereits etablierten und stabilisierten Verschaltungen (Grundlage der bereits vorhandenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und affektiven Reaktionsmuster) sowie den noch vorhandenen Optionen (noch mögliche Entwicklungsrichtungen und – geschwindigkeiten) einerseits und den in der äußeren Welt vorgefundenen Nutzungsbedingungen (Anforderungen, Anregungen) andererseits. Diskrepanzen zwischen diesen (inneren) Voraussetzungen und den (äußeren) Erfordernissen führen zur Aktivierung emotionaler Zentren (stress-sensitive Systeme). Die dabei vermehrt ausgeschütteten neurotrophen Signalstoffe wirken als Trigger für die adaptive Modifikation und Reorganisation der bis dahin bereits etablierten Verschaltungsmuster und ermöglichen so eine Anpassung der inneren Struktur und Organisation des sich entwickelnden Gehirns an die aus Wahrnehmungen aus der Außenwelt abgeleiteten Erfordernisse (Hüther 1998). Das heißt: - Ohne Aktivierung dieser emotionalen Zentren können keine neuen Erfahrungen gemacht und hinreichend fest verankert werden. - Optimale Bedingungen für die Etablierung und Stabilisierung neuer, komplexerer assoziativer Verschaltungsmuster herrschen immer dann, wenn es zu einer moderaten Aktivierung emotionaler Zentren kommt („Neugier“, „Spiel“). - Die stärkere Aktivierung dieser Zentren führt zur präferentiellen Bahnung und Stabilisierung bereits vorhandener, „bewährter“ assoziierter Verschaltungen. - Bei überstarker und langanhaltender Aktivierung wächst die Gefahr einer fortschreitenden Destabilisierung und Regression bereits etablierter (aber zur Lösung des Problems ungeeigneter) Verschaltungen. 4. Die Hirnentwicklung als ein von Außen beeinflußbarer und daher auch störbarer Prozess Die notwendige Offenheit des sich entwickelnden Gehirns für strukturierende Einflüsse aus der äußeren Welt hat zwangsläufig zur Folge, dass es auch Einflüssen ausgesetzt werden kann, die die Integrität seiner inneren Struktur und Organisation bedrohen. Die genetischen Programme, die die Ausformung eines derartig offenen und daher enorm störbaren Hirns ermöglichen, konnten nur unter der Voraussetzung entstehen und im Genpool des Menschen verankert werden, dass derartige Störungen so gut wie nie vorkamen. Hand in Hand mit der Öffnung der anfangs noch recht starren genetischen Programmierung der Hirnentwicklung mußten im Lauf der Evolution also immer effizientere Mechanismen zum Schutz des sich entwickelnden Hirns vor äußeren Störungen entwickelt werden. Neben den bereits bei den Säugetieren „erfundenen“ Schutz der Nachkommen durch Verlagerung der störanfälligsten Entwicklungsschritte in den Mutterleib, wurden bei den Primaten und insbesondere beim Menschen Sicherheit-bietende Bindungen zur entscheidenden Voraussetzung für die Ausbildung lernfähiger, plastischer Gehirne (Hüther 2000). Nichts erzeugt soviel unspezifische Erregung im Hirn (und vor allem in den emotionalen Zentren) eines Kleinkindes, wie das plötzliche Verschwinden der Mutter. Offenbar ist der Verlust der bis dahin vorhandenen, Sicherheit-bietenden Bezugsperson die bedrohlichste und massivste Störung, die das sich entwickelnde Gehirn treffen kann (Gunnar 1998). Wie in Tierversuchen („maternal deprivation“) unnötig oft repliziert, gilt das bereits für Ratten und in noch stärkerem Ausmaß und mit noch nachhaltigeren Folgen für die weitere Hirnentwicklung von Primaten. Das Gehirn dieser bedauernswerten Versuchstiere entwickelt sich unter diesen Bedingungen nur zu einer notgereiften Kümmerversion dessen, was daraus hätte werden können (Übersicht in: Hüther 1998). Auch alle weiteren Erkenntnisse, die mit Hilfe derartiger „Tiermodelle“ bisher zutage gefördert wurden, wären allein durch bloßes Nachdenken ebenso sicher vorhersehbar gewesen: - Je früher die Trennung erfolgt, desto globaler ist die Retardierung des Gehirns auch noch im erwachsenen Zustand ausgeprägt. - Am stärksten wird diejenige Hirnregion betroffen, sie sich zum Zeitpunkt des Verlustes der Mutter in einer sog. „growth spurt“ Phase befindet, in der also besonders komplexe Wachstums- und Differenzierungsprozesse besonders rasch ablaufen. - Immer wird nachfolgend auch die Entwicklung all derjenigen Strukturen und Subsysteme beeinträchtigt, die erst später reifen und deren Komplexitätsgrad vom jeweils erreichten Komplexitätsgrad der bereits entstandenen, älteren Strukturen und Subsysteme abhängig ist (frontaler Cortex, monoaminerge Systeme). - Manches läßt sich nach einer solchen Störung später noch aufheben und kompensieren, anderes nicht. Die menschliche Entsprechung dieser „maternal deprivation“ ist die frühkindliche Traumatisierung. 5. Die Auswirkungen früher Traumatisierung auf die weitere Hirnentwicklung Auf der Grundlage der bisher dargestellten Sachverhalte und Überlegungen läßt sich ein Trauma als eine plötzlich auftretende Störung der inneren Struktur und Organisation des Gehirns beschreiben, die so massiv ist, dass es in Folge dieser Störung zu nachhaltigen Veränderungen der von einer Person bis zu diesem Zeitpunkt entwickelten neuronalen Verschaltungen und der von diesen Verschaltungen gesteuerten Leistungen des Gehirns kommt. Eine solche Traumatisierung kann durch physische oder psychische (psychosoziale) Einwirkungen ausgelöst werden. Im Fall einer psychischen Traumatisierung wird die Störung durch eine überstarke Aktivierung stress-sensitiver, kortiko-limbischer Netzwerke und hypothalamischer neuroendokriner Regelkreise ausgelöst, die durch keine der bisher entwickelten (d.h. erlernten und in Form bestimmter assoziativer Verschaltungsmuster verankerten) Bewältigungsstrategien unter Kontrolle gebracht werden kann. Unter diesen Bedingungen breitet sich die Erregung soweit aus, bis davon auch ältere, subkortikale Netzwerke erreicht und ebenfalls stimuliert werden. Durch die Aktivierung dieser archaischen Notfallreaktionen und –handlungen (Ohnmacht, Erstarren, Stereotypien etc.) kann die sich ausbreitende unspezifische Erregung in ein spezifisches Aktivierungsmuster umgewandelt und die Überstimulation der emotionalen, stress-sensitiven Schaltkreise gedämpft werden. 5.1. Die Bedeutung subjektiver Bewertungen Soweit ist alles noch einfach. Die Probleme beginnen aber bereits bei der Frage, ob eine psychische Belastung in jedem Fall zu einer so massiven Reaktion führen muss. Sicher nicht, denn das Ausmaß der Aktivierung der emotionalen Zentren hängt von der subjektiven Bewertung der betreffenden Belastung ab. Diese subjektive Bewertung wiederum wird von den bisherigen individuellen Erfahrungen, den bisher entwickelten Kompetenzen (Bewältigungsstrategien), der Verfügbarkeit und Nutzbarkeit psychosozialer Unterstützung und nicht zuletzt von den bis dahin von einer Person entwickelten, halt-bietenden inneren Leitbildern und Orientierungen bestimmt (Hüther 1997, Gebauer und Hüther 2001, 2002). Ob also ein traumatisches Ereignis von einer Person auch als eine unbewältigbare, die Integrität der innern Ordnung des Gehirns (und des Körpers) bedrohende, mit einer überschießenden Aktivierung emotionaler, stress-sensitiver Regelkreise einhergehende Erfahrung erlebt wird, ist im Einzelfall kaum vorhersehbar. Nicht anders verhält es sich bei der Abschätzung der im weiteren Verlauf nach einer primären Traumatisierung auftretenden Folgen. Wie lange dieser Zustand anhält, ob er zu persistierenden Veränderungen der inneren Organisation und Struktur des Gehirns führt , und welche Veränderungen in der Folge noch entstehen, hängt auch hier von vielen Faktoren ab. Zunächst davon, ob es durch die überschießende Aktivierung und die massive Ausschüttung von Katecholaminen, Glutamat und nachfolgend auch von Kortisol zu direkten oder indirekten Schädigungen von Nervenzellen gekommen ist. Dass solche Schädigungen auftreten können, ist aus tierexperimentellen Untersuchungen gut bekannt (McEwen 1999). Zweitens ist entscheidend, wie lange eine traumatisierte Person in diesem „Notfallzustand“ verharrt. Je länger die überschießende Reaktion stress-sensitiver Systeme andauert, desto größer wird die Gefahr derartiger Schädigungen. Und drittens hängen die Folgen einer Traumatisierung davon ab, mit welchen Strategien die betreffende Person schließlich irgendwann aus diesem Zustand herausfindet. Unter dem Einfluß der fortbestehenden emotionalen Aktivierung werden die dabei genutzten Verschaltungen (in Abhängigkeit von der Häufigkeit ihrer Benutzung und der individuellen Bewertung ihrer Effizienz) immer stärker gebahnt und gefestigt. Diese individuellen, zur Bewältigung des Traumas und der immer wieder aufflackernden traumatischen Erinnerungen (Flash-backs) gefundenen und gebahnten Lösungen (Depersonalisation, Derealistation, Dissoziation etc.) erweisen sich für die weitere Lebensgestaltung meist als äußerst problematisch und verhindern eine adäquate Verbreitung der traumatischen Erfahrungen, d.h. deren Integration in den Erfahrungsschatz der betreffenden Person. 5.2. Die psychobiologischen Besonderheiten frühkindlicher Traumatisierung Noch schwieriger wird die Abschätzung der Folgen psychischer Traumata während der Kindheit, wenn sich also immer dann, eine unkontrollierbare, überschießende Aktivierung stress-sensitiver Systeme in einem sich noch in der Entwicklung befindlichen, noch besonders offenen und daher auch störanfälligen Gehirn eines Kindes ausbreitet. Je weniger ein Kind bereits andere Ressourcen der Stressbewältigung nutzen kann (eigene Kompetenzen oder eigene innere Sicherheit-bietende Leitbilder) desto stärker ist es auf die protektive Funktion sicherer emotionaler Bindungen bei der Bewältigung bedrohlicher Situationen angewiesen (Gunnar 1998). Desto mehr wird dann aber auch der Verlust dieser Sicherheit-bietenden Bindungen zur eigentlichen und wichtigsten Ursache frühkindlicher Traumatisierungen. Das Kind erlebt sich unter solchen Bedingungen als allen äußeren Einflüssen in jeder Hinsicht schutzlos ausgeliefert. Vor der Gefahr einer direkten Schädigung durch eine überschießende Aktivierung stress-sensitiver Systeme ist das kindliche Gehirn aber besser geschützt als das von Erwachsenen: Das Kind kann eine Bewältigungsstrategie aktivieren (Schreien), die relativ rasch zu einem Zustand der Erschöpfung führt. Auf diese Weise wird das weitere Aufschaukeln der initialen Stressreaktion automatisch verhindert. Spätfolgen frühkindlicher Traumata werden also vermutlich nicht durch die akute Traumatisierung verursacht. Sehr viel wahrscheinlicher sind sie das Resultat einer, unter Bedingungen emotionaler Aktivierung gemachten und im kindlichen Hirn verankerten fatalen Erfahrung: Sicherheit-bietende Bezugspersonen bieten keine Sicherheit. Bei etwas älteren Kindern, die bereits selbst Wirksamkeitskonzepte entwickelt haben, kommt noch hinzu: Die Aneignung von Kompetenzen bietet keine Sicherheit. Damit verlieren diese Kinder ihr bis dahin entwickeltes Urvertrauen in die Bewältigbarkeit der Welt. Die Folgen dieser durch das Trauma entstandenen Haltung (meist handelt es sich um multiple, diese Einstellung immer weiter verstärkende Traumatisierungen) für die weitere Hirnentwicklung sind katastrophal. Das Kind hat außer den archaischen Notfall-Reaktionen (Schreien, stereotype Bewegungen, Erstarren etc.) alles verloren, was geeignet wäre, die durch neue Anforderungen, Wahrnehmungen oder Bedrohungen aktivierten, stress-sensitiven Systeme und die damit einhergehende Ausbreitung unspezifischer Erregungsmuster in den limbischen und kortikalen Hirnbereichen unter Kontrolle zu bringen. Es kann die Aktivierung emotionaler Zentren nicht nutzen, um neue Erfahrungen in seinem Hirn zu verankern und bleibt damit unfähig, das Trauma zu bearbeiten, d.h. die durch die Traumatisierung entstandene Haltung allmählich aufzulösen und sich weiterzuentwickeln. Vor allem im frontalen Cortes können unter diesen Bedingungen all jene hochkomplexen synaptischen Verschaltungsmuster nicht herausgeformt und stabilisiert werden, die die Grundlage für die subtilsten Leistungen des menschlichen Gehirns bilden: Die Fähigkeit zur Herausbildung eines Selbstbildes, die Fähigkeit zu Impulskontrolle und Handlungsplanung, und nicht zuletzt emotionale und psychosoziale Kompetenz. Damit fehlen die Voraussetzungen für eine zielgerichtete und bewußte Steuerung von Wahrnehmungs-, Verarbeitungs- und Entscheidungsprozessen in der Auseinandersetzung mit der äußeren (und vielfach auch inneren, körperlichen und seelischen) Welt. Die weitere Hirnentwicklung kann unter diesen Umständen nur noch entsprechend (nutzungsbedingt) desorganisiert verlaufen. Welche Verschaltungsmuster im Einzelfall nun noch stabilisiert werden, hängt von der Art des erlebten Traumas (sexueller Mißbrauch, körperliche Gewalt, Vernachlässigung etc.), von individuellen Prädispositionen (extrovertierte oder introvertierte Reaktionsmuster, Sensibilität, Handlungsbereitschaft etc.) und den diese Kinder erreichenden und von ihnen nutzbaren äußeren Orientierungsangeboten ab (Elterhaus, Schule, Peers, Medien). Viele der aus diesen Überlegungen ableitbaren Spätfolgen früherer Traumatisierung sind inzwischen bereits empirisch belegt: - verringertes Hirnvolumen, erweiterte Ventrikel (De Bellis et al. 1999), - verringerte Dicke des Corpus callosum (Teicher et al. 1993), - verringertes Volumen des Hippocampus (Stein et al. 1997, Bremner et al. 1997), - Defizite der Frontalhirnentwicklungen besonders im Bereich der rechten Hemiphäre (Schore 2001), - Defizite auf der Ebene der sensorischen Integrationsfähigkeit, z.B. Körperempfinden (Young 1992), Schmerzempfinden (van der Kolk und Ducey 1989), Bewegungskoordination (StreeckFischer et al. 2000), - vielfältige Verhaltensstörungen (Putnam 1993), - Defizite auf der Ebene von Lernen und Gedächtnis (Pollak et al. 1998), - Dissoziative Symptome (Spiegel und Cardena 1991, Putnam 1993), - Gestörte Affektregulation (van der Kolk et al. 1996, Schore 2000), - Manifestation unterschiedlicher psychiatrischer Störungsbilder: Somatisierungsstörungen, Borderline-Persönlichkeitsstörung, Drogenabhängigkeit (Sachse et al. 1994), selbstverletzendes Verhalten (van der Kolk et al. 1991), Depressionen, Zwangsstörungen, Eß-Störungen, Angst-Störungen, ADHS etc. (Swatt et al. 1990, Post et al. 1994, Cichetti and Toth 1995), 6. Therapeutische Implikationen Die hier geschilderten neurobiologischen Zusammenhänge und Folgen frühkindlicher Traumatisierung unterstreichen im Grunde nur einige, seit langem bereits angestellte Vermutungen und daraus abgeleitete Forderungen: - es muß und kann mehr getan werden, um zu verhindern, dass Kinder von ihren Eltern mißhandelt, vernachlässig oder mißbraucht werden, nicht nur um das Leid dieser Kinder zu beenden, sondern auch - und das mag heutzutage für viele Menschen noch motivierender sein – um die immensen Kosten zu vermeiden, die aufgrund der vielfältigen Störungen der Hirnentwicklung von diesen Opfern direkt (als spätere Straftäter, Drogenabhängige etc.) oder indirekt (als spätere, in dieser Funktion überforderte Eltern oder als Langzeitpatienten) verursachen. - Kindern, die solche traumatischen Erfahrungen machen, kann und muß geholfen werden. Sie brauchen so schnell wie möglich ein Sicherheit-bietendes Umfeld und Sicherheit-bietende emotionale Beziehungen. - Die psychopathologischen Anzeichen und Hinweise auf eine frühe Traumatisierung können und müssen bereits bei Kindern und Jugendlichen und nicht erst im Erwachsenenalter erkannt werden. Je früher eine Therapie eingeleitet werden kann, um so besser sind die Erfolgsaussichten der Behandlung. - Der vielleicht wichtigste Ansatzpunkt für eine gelingenden Therapie frühtraumatisierter Patienten ist die als Folge der Traumatisierung entstandenen Haltung (Verlust von Vertrauen in und Ablehnung von Sicherheit-bietenden Beziehungen, Abwertung von erworbenen Kompetenzen und von Sinn-bietenden Orientierungen). Diese Haltung läßt sich nur verändern, wenn es dem Patienten im Verlauf des therapeutischen Prozesses gelingt, neue positive Erfahrungen über die Verläßlichkeit von Beziehungen, die Nützlichkeit erworbener Kompetenzen und den Wert innerer Orientierungen zu machen. Es ist eine spannende, aber leider nur selten gestellte Frage, welchen Einfluß die jeweiligen gesellschaftlichen Bedingungen auf die nach einer frühen Traumatisierung entwickelten Spätfolgen und Störungsbilder haben. Wie sich am Beispiel der sog. „Kriegszitterer“ (während des ersten Weltkrieges traumatisierte Soldaten) eindrucksvoll zeigen läßt, hängt die jeweils ausgeprägte Symptomatik einer PTSD bei traumatisierten Erwachsenen offenbar sehr stark von den jeweiligen gesellschaftlich angebotenen, tolerierten oder akzeptierten (und medizinisch anerkannten) Symptombildern ab. Vietnamveteranen mit PTSD entwickelten bereits eine völlig andere Symptomatik als diese Kriegszitterer. Bei Kindern, die durch eine frühe Traumatisierung gezwungen sind, ihr Gehirn ohne Schutz und Anleitung, ohne Sicherheit-bietende Beziehungen zu benutzen, müßte sich der gesellschaftliche und kulturelle Kontext in dem sie aufwachsen in noch viel stärkerem Maß als strukturierende Kraft auf die weitere Nutzung und Strukturierung ihres Gehirns bemerkbar machen. In Zeiten und unter Bedingungen, wo diese strukturierenden Kräfte sehr stringent und zwingend sind, sollten die entwickelten Symptombilder homogener und eindeutiger sein, als unter den Bedingungen einer pluralistischen und fast alle Optionen offenlassenden Gesellschaft. Unter diesem Gesichtspunkt ist die „Buntheit“ der nach frühkindlicher Traumatisierung in unserer gegenwärtigen Gesellschaft sich manifestierenden Symptombilder ein außerordentlich spannendes Betätigungsfeld für zukünftige, neurobiologisch orientierte psychiatrische Forschungen. 7. Literatur: Bremner, J., Randall, P., Vermetten, E., Staib, L., Bronen, R., Mazure, C., Capelli, S., McCarthy, G., Innis, R., Charnex, D. (1997) Magnetic resonance imaging-based measurement of hippocampal volume in post-traumatic stress disorder related to childhood physical and sexual abuse -–preliminary report. Biological Psychiatry, 41, 23-32. Cicchette, D., Toth, S. (1995) Child maltreatment and attachment organization: Implications for intervention. In: Goldberg, S., Muir, R., Kerr, J. (eds). Attachment theory: Social, developmental, and clinical perspectives. The Analytical Press, London, 279-308. DeBellis, M., Braum, A., Birmaher, B., Keshavean, M., Eccard, C., Boring, A., Jenkins, F., Ryan, N. (1999) Developmental traumatology Part I: Biological stress systems. Biological Psychiatry, 45, 1259-1270. DeBellis, M., Keshavan, M., Clark, D., Casey, B., Giedd, J., Boring, A., Frustaci, K., Ryan, N. (1999) Developmental traumatology Part II. Brain development. Biological Psychiatry, 45, 1271-1284. Francis, DD., Meaney, MJ. (1999) Maternal care and the development of stress responses current opinion. Neurobiology, 9, 128-134. Gebauer, K., Hüther, G. (2001) Kinder brauchen Wurzeln. Walter Verlag Göttingen. Gebauer, K., Hüther, G. (2001) Kinder suchen Orientierung. Walter Verlag Göttingen. Glaser, D. (2000) Child Abuse and Neglect and the Brain – a Review. J Child Pschol Psychiat 41, 97-116. Gunnar, M. (1998) Quality of early care and buffering of neuroendocrine stress reactions: Potential effects on the developing human brain. Preventative Medicine, 27, 208-211. Hüther, G. (1996) The central adaptation syndrome: Psychosocial stress as a trigger for adaptive modifications of brain structure and brain function. Progress in Neurobiology, 48, 569-612. Hüther, G. (1997) Biologie der Angst. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen. Hüther, G. (1998) Stress and the adaptive self-organization of neuronal connectivity during early childhood. Int. J. Devl. Neurosci, 16, 297-306. Hüther, G. (2000) Die Evolution der Liebe. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen. McEwen, BS. (1999) Stress and hippocampal plasticity. Annual Reviews of Neuroscience, 22, 105-122. Pollak, S., Chicchetti, D., Klorman, R. (1998) Stress, memory and emotion. Developmental consideration for the study of child maltreatment. Developmental Psychopathology, 10, 811828. Post, R., Weiss, S., Leverich, G. (1994) Recurrent affective disorder: Roots in developmental neurobiology and illness progression based on changes in gene expression. Development and Psychopathology, 6, 781-813. Putnam, FW. (1993) Dissociative disorders in children: behavioral profiles and problems. Child Abuse and Neglect, 16, 39-45. Rutter, M. (2002) Nature, nurture, and development: from evangelism through science toward policy and practice. Child Development, 73, 1-21. Sapolski, RM. (1996) Stress, glucocorticoids and damage to the nervous system: the current state of confusion. Stress, 1, 1-19. Saxe, GN., Chinman, G., Berkowitz, R., et al. (1994) Somatization in patients with dissociative disorders. American Journal of Psychiatry, 151, 1329-1334. Schore, AN. (2001) The effect of a secure attachment relationship on right brain development, affect regulation, and infant mental health. Infant Mental Health Journal, 22, 7-66. Singer, W. (1995) Development and plasticity of cortical processing ardritectures. Science, 270, 758-764. Spiegel, D., Cardena, E. (1991) Disintegrated experience: the dissociative disorders revisited. Journal of Abnormal Psychology, 100, 366-378. Spitz, R. (2000) Angeboren oder erworben? Die Zwillinge Cathy und Rosy – eine Naturgeschichte der menschlichen Persönlichkeit und Entwicklung. Vortragsreihe, hrsg. v. L. Köhler. Beltz-Verlag, Weinheim/Basel.br/> Stein, MB., Koverola, C., Hanna, C., Torchia, MG., McClarty, B. (1997) Hippocampal, in women victimized by childhood sexual abuse. Psychological Medicine, 27, 951-959. Streeck-Fischer, A., Kepper, I., Lehmann, U., Schrader-Mosbach, H. (2000) Gezeichnet für das Leben? Stationäre Psychotherapie von mißhandelten und mißbrauchten Kinder, in: Streeck-Fischer, A., Sachsse, U., Oezkan I.: Körper, Seele, Trauma, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen. Streeck-Fischer, A., van der Kolk, BA. (2000) Down will come baby, cradle and all: diagnostic and therapeutic implications of chronic trauma on child development. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 34, 903-918. Swett, C., Surrey, J., Cohen, C. (1990) Sexual and physical abuse histories and psychiatric symptoms among female psychiatric outpatients. American Journal of Psychiatry, 144, 632636. Teicher, MH., Glod, CA., Surrey, J., Swett, C. (1993) Early childhood abuse and limbic system ratings in adult psychiatric outpatients. Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 5, 301-306. Van der Kolk, BA., Ducey, CP. (1989) The psychological processing of traumatic experience. Rorschach pattern in PTSD. Journal of Traumatic Stress, 2, 259-265. Van der Kolk, BA., Pelcowitz, D., Roth, S., Mandel, F., McFarlane, AC., Herman, JL (1996) Dissociation, somatization, and affect dysregulation: the complexity of adaptation to trauma. American Journal of Psychiatry, 153, 83-93. Van der Kolk, BA., Perry, JC., Herman, JL. (1991) Childhood origins of self-destructive behavior. American Journal of Psychiatry, 148, 1665-1671. Young, L. (1992) Sexual abuse and the problem of embodiment. Child Abuse and Neglect, 16, 89-100. 7. Summary And nothing will any longer be the same as before..... The impact of early traumatization on further brain development Based on the concept of use-and experience-dependent plasticity, a neurobiological concept of the consequences of child abuse and neglect on subsequent brain development is proposed. According to this concept, traumatic experiences elicit an uncontrollable activation of stresssensitive cortico-limbic networks and hypothalamic neuroendocrine centers. The resulting long-lasting activation of the HPA-System in conjunction with the persisting hyperarousal of higher limbic and cortical centers will have a destabilizing effect on already stabilized neuronal connectivity in these higher, associative centers, especially in the hippocampus (dentritic regression). Coping under such conditions is only possible by the activation of more primitive, less complex neuronal circuits (emergency responses) and by the use-dependent facilitation of self-protective defense reactions (dissociation, depersonalization, derealization etc.). Consequently the interactions of the child with the other world are interrupted, novel experiences cannot be made, and the experience-dependent modulation of higher, especinally prefrontal cortical connectivity is seriously hampered. The hitherto published findings of deficits in the structural and functional brain maturation of traumatized children are summarized. More important than the actually experienced trauma is the trauma-induced destruction of attachment and emotional security-providing internal representations and beliefs (helplessness). Therapeutic interventions must there fore aim at a most rapid restoration of secure emotional relationships, of feelings of self-efficacy and connectedness with the outside world. Gerald Hüther, Psychiatrische Klinik der Universität Göttingen, Von-Siebold-Str. 5, D-37075 Göttingen