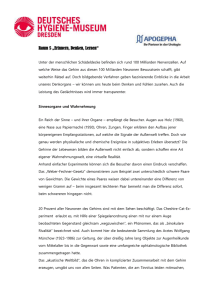Fachtagung „Aus der Rolle wachsen! Zum Einfluss von
Werbung

Fachtagung „Aus der Rolle wachsen! Zum Einfluss von Rollenbildern auf Lebenschancen“ am 02.12.2013 in Potsdam Dr. Emily Ngubia Kuria, Humboldt-Universität zu Berlin: „Wenn tote Lachse mit lebendigen Frauen verglichen werden“ Rollenklischees im Spiegel der modernen Hirnforschung und der Umgang mit der Wiederbelebung behaupteter biologischer Unterschiede Das Gehirn ist der geheimnisvollste und doch faszinierendste Teil des Körpers. Es ist ein hochkomplexes Netzwerk von Milliarden Nervenzellen, das zwischen 1200 Gramm – 1400 Gramm bei einem Erwachsenen wiegt, und das Zentrum unserer geistigen und seelischen Fähigkeiten bildet. Das Gehirn ist für die Ausprägung von Denken, Fühlen, Erinnern, für Bewusstsein und Intelligenz verantwortlich. Wissenschaftler_Innen können seine Funktion immer noch nicht vollständig beschreiben. Das Gehirn hat die faszinierende Fähigkeit, neuen Sachverstand zu erlernen und sich nach einer Verletzung zu regenerieren. Eine Frage, die Wissenschaftler_innen seit Jahrzehnten fasziniert, ist, ob Genie geboren oder geschaffen werden kann. Neurowissenschaftler_Innen sind jetzt zu dem Schluss gekommen, dass neue Verbindungen mit Training hergestellt werden und alte stärker gemacht werden. Dies bedeutet, dass einige Bereiche des Gehirns sich mit dem Gebrauch vergrößerni, wie das Beispiel von professionellen Musiker_innen im Vergleich zu Nicht-Musiker_Innen zeigt. Diese Plastizität des Gehirns ist nicht auf Musik beschränkt, sondern kann auch auf andere Fähigkeiten erweitert werden. Viele Leute einschließlich Wissenschaftler_Innen gehen davon aus, dass männliche und weibliche Gehirne unterschiedlich sind. Der Psychologe Simon Baron-Cohenii von der Universität Cambridge [1] erklärt zum Beispiel, dass weibliche und männliche Gehirne von Natur aus unterschiedlich programmiert seien. Seiner These zufolge können Männer von Geburt an überdurchschnittlich gut systematisch denken und tragen ein "S-Gehirn", während Frauen die angeborene Gabe der Einfühlsamkeit oder Empathie haben - das typisch weibliche Denkorgan nennt er deshalb "E-Gehirn". Bis jetzt ist diese Idee immer noch die populärste Theorie, und viele Bücher haben diesen Mythos verkauft, vor allem, weil es eingängige, simple Herleitung bietet und beispielsweise erklärt, warum die meisten Männer aggressiv und triebhafter seien, warum die meisten Frauen empfindlich und emotional seien, warum die meisten Frauen vom Beruf Lehrerin und die meisten Männer Ingenieure seien, warum Männer vom Mars seien und Frauen von der Venus ... Doch lassen sich diese Behauptungen wissenschaftlich nicht belegen. Die Wissenschaft beweist, dass Männer und Frauen eher ähnlich als unterschiedlich sind. Am Ende des 19. Jahrhunderts entdeckten Wissenschaftler_Innen, dass es tatsächlich einige anatomische Unterschiedeiii zwischen dem männlichen und dem weiblichen Gehirn gibt. Sie entdeckten, dass das männliche Gehirn beispielsweise etwa 9% größer ist als das der Frauen. Einigen Wissenschaftler_innen dienten die Erklärungen dazu, ihre eigenen Thesen zu stützen, nämlich dass Männer intelligenter seien als Frauen, wie in dem Fall von Larry Summers, Harvard-Präsident, der im Jahr 2006 argumentiert hat, dass Frauen aufgrund mangelnder angeborener Fähigkeiten nicht in der Wissenschaft vorankommen. Diese Idee kam durch Forschungsergebnisseiv in den späten 80er Jahren auf, die propagierten, dass der Gender-Gap in der mathematischen Leistung teilweise durch angeblich geringe räumliche Fähigkeitenv erklärt werden könne. Wissenschaftler_Innen behaupteten, dass für technische Berufe und Studienfächer wie Mathematik, Chemie, [2] Informatik und Engineering räumliche Fähigkeiten erforderlich wären. Als Ergebnis wurde das mentale Rotation Experiment zum unhinterfragten und unbestrittenen Instrument zur Messung des geistigen Unterschieds zwischen den Geschlechtern in der neurowissenschaftliche Praxis herangezogen. Mentale Rotation ist eine Komponente der Raumkognitionvi. Typische Tests bestehen aus einer Referenzfigur und einer entweder gleichen oder ungleichen Vergleichsfigur, die unterschiedlich weit in den Raumebenen verdreht sein kann. Die Aufgabe der Testrobanden_Innen besteht dann in der Regel darin, die Vergleichsfigur durch mentales Drehen in die Referenzfigur zu überführen, um eine Entscheidung bezüglich der Gleichheit zu fällen. Ergebnisse zeigten, dass Männer um etwa 0,1 Sekunde schneller als Frauen waren. Dieses für eine lange Zeit reproduzierbare Ergebnis überzeugte die Wissenschaft, dass Männer besser für das Räumliche ausgestattet seien. ..bis Claude Steelevii in den USA im Jahr 1995 zeigte, dass Stereotypen die kognitive Leistungsfähigkeit belasten können. ‚Stereotype Threat‘ ist ein Phänomen, das aktiviert wird, wenn eine Gruppe von Menschen an einem Stereotyp, das zu ihrer Gruppe zugeordnet wird, erinnert wird. Werden Frauen zum Beispiel mit der These konfrontiert, "Frauen sind genetisch nicht für Mathe geeignet", so werden ihre Leistungen schlechter als die der Männer. ‚Stereotype Threat‘ wurde bezogen auf räumliche Fähigkeiten im Jahr 2006 getestet. Das Ergebnis war eine Bestätigung dieses Phänomens. Andererseits sind in Betrachtung der Selbstbestätigungviii keine Unterschiede in der Leistung zu sehen gewesen. Wie vorher erwähnt, ist das Gehirn plastisch. Das heißt, je mehr Sie Ihr Gehirn trainieren, desto mehr Fähigkeiten können entwickelt werden. Im Jahr 2007ix weisen Neurowissenschaftler_innen nach, [3] dass Computerspielen die räumlichen Fähigkeiten der Frauen begünstigt. Nichtdestotrotz besitzen Studierende der x Naturwissenschaften , unabhängig ihres Geschlechts, eine höhere Kompetenz in der räumlichen Manipulation als die der Sozialwissenschaften. Es ist wichtig zu erkennen, dass räumliche Fähigkeiten sich nach der Beschäftigung in wissenschaftsbezogene Disziplinen entwickeln. Diese wichtigen äußeren Einflüsse von Umwelt und Sozialem stehen in Opposition zur Materialität eines Sex-basierten Geschlechtsunterschieds der räumlichen Fähigkeiten. Ist es möglich, dass Wissenschaftler_innen anstelle der Messung angeborener Geschlechtsunterschiede eigentlich nur die Erschließungen der Kultur, Vielfalt, Erfahrung und Ausbildung auf das soziale Gehirn abschätzen? Interessant zu bemerken ist die Aktivierung verschiedene Teile des Gehirns der männlichen und der weiblichen Teilnehmer_innen nach gleicher Aufgabe. Es gibt einige Hinweise, warum das so ist, dass die Hirnaktivierung vielleicht verschiedene Strategienxi verfolgt, die von den Teilnehmer_innen genutzt werden. Hirnaktivitäten werden in populärwissenschaftlichen Artikeln immer wieder thematisiert. Beliebtes Mittel dafür ist die funktionelle Magnetresonanztomographie, die Aktivitäten im Gehirn messen und darstellen kann. Wir müssen jedoch vorsichtig sein, wenn es um Hirnaktivitäten geht, denn das Gehirn ist immer aktiv, wie im Fall des toten Lachses. Hier sehen wir einen Dendriten1. Wenn Dendriten bis zu 15 Minuten Stress ausgesetzt werden, so ändern sie ihr Aussehen. Dendriten vom “männlichen“ Körper reagieren anders als die vom „weiblichen“ Körperxii. Ich verwende die Begriffe männlich und weiblich hier nur zu 1 Dendriten sind baumartigen Erweiterungen zu Beginn eines Neurons, die dessen Oberfläche vergrößern helfen. Dendriten erhalten Informationen durch elektrische Stimulation von anderen Neuronen, übertragen sie an diese und an den Kern. Dendriten sind mit Synapsen bedeckt. **Ich habe hier die Synapsen betont um den Punkt deutlicher zu machen. [4] Demonstrationszwecken. Wenn wir jetzt die Bedingungen für denselben Dendriten verändern, so würde sich folgendes zeigen: Das, was vorher als eine „männliche“ Form gekennzeichnet war, weist nun Merkmale der „weiblichen“ Form auf. Diese umgekehrte Reaktion zeigt, dass das Gehirn gleichzeitig verschiedene Handlungsweisen verkörpert, welche wir manchmal als weiblich oder männlich bezeichnenxiii. Diese Studie zeigt, dass bezogen auf die Funktion des Gehirns die Begriffe "männlich" oder "weiblich" vielleicht nicht so hilfreich sind, denn was als "männlich" oder was "weiblich" gelesen wird, hängt von den Umweltbedingungen ab. Abhängig von der Umgebung verändern einige Funktionen der Bestandteile des Gehirns. Kognitive Unterschiede sind demnach nicht stabil, sondern im Kontext flexibel und veränderbar. Sie sind nicht auf ein Geschlecht festgeschrieben. „Zwischen weiblichen und männlichen Merkmalen (Persönlichkeitsmerkmale, Einstellungen, Interessen und Verhaltensweisen, die einen Geschlechtsunterschied zeigen) und dem Geschlecht bestehen nur geringe Korrelationen […] das Gehirn ist ein einzigartiges Mosaik von sowohl männlichen als auch weiblichen Eigenschaften. Bezogen auf die Funktion des Gehirns wäre Intersex ein stimmiger Begriff“ xiv. Das Gehirn wird sich auch weiterhin in unserem Leben verändern auf der Grundlage unserer einzigartigen Erfahrungen. i . The musician's brain as a model of neuroplasticity (2002). Thomas F. Münte, Eckart Altenmüller and Lutz Jäncke. Nature, VOLUME 3 | JUNE 2002 |pp 473 ii Sex differences in the brain: Implications for explaining autism (2005). Baron-Cohen S, Knickmeyer RC and Belmonte MK, Science, 310: 819–823 iii Das Normgewicht des Gehirns beim Erwachsenen in Abhängigkeit von Alter, Geschlecht, Körpergröße und Gewicht (1994). P. Hartmann, A. Ramseier, F. Gudat et al. Der Pathologe, 1994, Volume 15, Number 3, pp 165 iv Human spatial abilities: psychometric studies and environmental, genetic, hormonal, and neurological influences (1979). McGee, M.G. Psychological Bulleting September 86(5): 889–918 v MENTAL ROTATIONS, A GROUP TEST OF THREE-DIMENSIONAL SPATIAL VISUALIZATION. Perceptual and Motor Skills (1978). STEVEN G. VANDENBERG and ALLAN R. KUSE, Volume 47, Issue , pp. 599-604 vi Rethinking Gender Politics in Laboratories and Neuroscience Research: The Case of Spatial Abilities in Math Performance (2011). Kuria, E.N. & Hess,V., Medicine Studies, 3(2): 117–123 vii A Threat in the Air: How Stereotypes Shape Intellectual Identity and Performance, (1997). Steele, C. M. American Psychologist, 52(6) pp 613–29: Stereotype Threat and the Intellectual Test Performance of African Americans, (1995). Steele, C. M. and Aronson, J. Journal of Personality and Social Psychology, 69(5) pp 797–811 [5] viii Combating Stereotype Threat: The Effect of Self-affirmation on Women’s intellectual Performance, (2006). Martens, A. et al. Journal of Experimental Social Psychology, 42(2) pp 236–43 ix Playing an Action Video Game Reduces Gender Differences in Spatial Cognition, (2007). Feng, J., Spence, I., and Pratt, J. Psychological Science, 18(10) pp 850–55 x Mental rotation test performance in four cross-cultural samples (n = 3367): overall sex differences and the role of academic program in performance (2006). Peters, M., et al. Cortex; a Journal Devoted to the Study of the Nervous System and Behavior 42(7) pp 1005–1014 xi A Lateralization of Function Approach to Sex Differences in Spatial Ability: A Reexamination, (2008). Rilea, S. L Brain and Cognition, 67(2) pp 168–82. xii Sex differences and opposite effects of stress on dendritic spine density in the male versus female hippocampus, (2001). Shors TJ, Chua C, Falduto J, Journal of Neuroscience pp 6292–6297 xiii Genetic-gonadal-genitals sex (3G-sex) and the misconception of brain and gender, or, why 3G-males and 3G-females have intersex brain and intersex gender, (2012). Daphna Joel, Biology of Sex Differences 3, pp 27 xiv Ref. xiii [6]