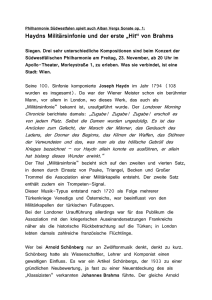Angst und »absolute« Musik
Werbung

77 Hanns-Werner Heister Angst und »absolute« Musik Schönberg, Brahms und andere »Musik spricht in ihrer Sprache anscheinend bloß von musikalischen Angelegenheiten, oder aber, wie die meisten Ästhetiker annehmen, von Angelegenheiten der Gefühle und der Phantasie.« In Wahrheit jedoch, so Schönberg weiter in Nr. 15 seiner Menschenrechte (1947), ist Musik »die Sprache, in der ein Musiker, ohne es zu wissen, sich preisgibt, indem er Gedanken formuliert, über die er selbst erschrecken würde — wüßte er nicht, daß ja doch niemand herausfinden wird, was er verbirgt, indem er es sagt.« (Schriften 1976, 144) Trotz solcher Selbstberuhigung bohrt eine geheime Angst weiter: »Aber eines Tages werden die Kindeskinder unserer Psychologen und Psychoanalytiker die Sprache der Musik dechiffriert haben. Wehe dann dem Unvorsichtigen, der sein Innerstes, sein Geheimstes sorg­ fältig verborgen dachte und nun zulassen muß, daß Unreine ihre eigene Niedrigkeit hineinschmieren. Wehe dann Beethoven, Brahms, Schu­ mann und alle anderen bisher »Unknown«, wenn ihr in solche Hände fallt; ihr, die ihr von dem Menschenrecht freier Meinungsäußerung nur Gebrauch machtet, um eure Meinung zu verschweigen.« Anders als beim Komponieren ist Schönberg hier — es erscheint ihm dringlich — gegen blanke Wiederholungen nicht empfindlich. So merkt er apropos »Unknown« an: »Vgl. The Unknown Brahms. Unter diesem Titel versucht ein Autor, das Bild des Komponisten zu behan­ deln. Ist das Recht zu verschweigen nicht auch schutzwürdig?« Unermüdlich bemüht sich Schönberg um theoretische Reflexion seines Schaffens. Diese hat den Charakter einer Rechtfertigung — zunächst des jeweiligen Werks, der Wendungen und Phasen, der Stile und Gedanken. Oft aber scheint es, als bedürfe Schönberg grundsätz­ licher, fast zwanghaft, einer Rechtfertigung seiner Person und Existenz, deren Bedeutung ja auch oft genug angefochten oder negiert wurde (und wird). Paradox genug, wie er dabei immer wieder Verhüllung und Entblößung miteinander verschränkt, von (anscheinend finsteren) Geheimnissen raunt, geheimnisvolle Andeutungen macht, diese dann aber zugleich zurücknimmt, darüber hinwegredet. Brahms kennt diesen Drang zur theoretischen Legitimierung nicht, gibt ihm jeden­ falls nicht nach. Immerhin führt auch er in Briefen eine analoge Selbst­ darstellung ein: »Übrigens schreibe ich immer nur halbe Sätze, und es 78 Hanns-Werner Heister ist nötig, daß der Leser die andere Hälfte dazu denkt.« Oder Ver­ schwiegenes andeutend: »Es läuft bei mir alles in Gedankenstrichen aus —« Für Schönberg wie für Brahms schien dabei die »absolute« Musik die feste Burg einer machtgeschützten und ohnmächtigen Innerlich­ keit, ein Rückzugsort vor zudringlicher und bedrängender Öffentlich­ keit. »Denn Musik ist darin wunderbar, daß man alles sagen kann, so daß der Wissende alles versteht, und trotzdem hat man seine Geheim­ nisse, die, die man sich selbst nicht gesteht, nicht ausgeplaudert.« (Schönberg 1912, 13) Dabei definiert Schönberg »absolute Musik« ungewöhnlich und faßt sie viel weiter als die übliche Bestimmung, die, im Anschluß an E.T.A. Hoffmann, alles außer der »reinen« Instrumentalmusik ausschließt. Schönberg akzentuiert die möglichst unvermittelte Beziehung zwischen Unbewußtem und Musik — die er dezidiert als »Ausdruck« faßt, insofern also einen gewissen Hang zur bürgerlicherseits verpönten »Heteronomieästhetik« erkennen läßt: »Die natürliche Reaktion auf Wagner, den Theatermusiker, hatte ein Aufblühen der sogenannten absoluten Musik hervorgebracht. Zunächst in der Form des Liedes und der Programm-Musik. Dann aber immer mehr als rein symphoni­ sche Musik, die nicht mehr Dienerin der Poesie sein wollte; die den Umweg vermied, die unbewußten Empfindungen erst duch die Sprache des Bewußtseins auszudrücken und diese Übersetzung zurückzuüber­ setzen in die Sprache des Unbewußten.« (Schönberg 1909, 161) Auf dem Prinzip des Ausdrucks, ob des Textes oder des Selbsts, besteht Schönberg auch lang nach der expressionistischen Epoche: »Übrigens, wie vergewissert man sich, daß die Musik nichts ausdrückt — oder vielmehr, daß sie nichts ausdrückt, was durch den Text hervor­ gerufen ist? Man kann seine Fingerabdrücke nicht daran hindern, einen selbst auszudrücken. Allein die Handschrift enthüllt dem Gra­ phologen sehr viel.« (Schönberg 1949,152) Ein Geständnis wie das eingangs zitierte, das freilich doch wieder abstrakt-methodologisch bleibt, hat den Charakter einer unwillkürli­ chen Fehlleistung. Ganz bewußt, geradezu penetrant versichert und proklamiert Schönberg auf der anderen Seite immer wieder, das Werk sei Selbstausdruck seines Schöpfers. Damit ineins soll das innerste Ich zugleich Repräsentant der Welt, Aller sein: »Kunst ist der Notschrei jener, die an sich das Schicksal der Menschheit erleben. Die nicht mit ihm sich abfinden, sondern sich mit ihm auseinandersetzen. Die nicht stumpf den Motor ‘dunkle Mächte’ bedienen, sondern sich ins laufende Rad stürzen. Die nicht die Augen abwenden, um sich vor Emotionen Angst und absolute Musik 79 zu behüten, sondern sie aufreißen, um anzugehen, was angegangen werden muß.« (Reich 1968, 80) Hier wie auch sonst in theoretischen wie kompositorischen Äußerun­ gen besteht also Schönberg darauf, daß er aktiv sein Leben in die Hand nehme. Und diese seine Widerstandshaltung gehört mit zu seiner Größe. Auf der anderen Seite betont er immer wieder das Zwanghafte, Schicksalhafte, ja Triebhafte seines Komponierens und seiner Ent­ wicklung. Er beruft sich auf eine höhere Notwendigkeit und einen hohem Auftrag — Schicksal, Gott, Vorsehung usw. So überliefert Hanns Eisler eine Anekdote aus Schönbergs Militärdienstzeit während des Ersten Weltkrieges. Gefragt, ob er der Schönberg sei, welcher, antwortete er, keiner habe es sein wollen, aber einer, er nämlich, habe es sein müssen. Was genau jeweils gemußt wird und ausgedrückt werden soll, bleibt in vielen Fällen ebenso unkonkret und unbestimmt wie das, was ver­ hüllt und chiffriert werden muß. Prinzipiell jedenfalls sind es Bezüge zur Realität, zum empirischen Dasein, auch und gerade die zu Person und Leben des Komponisten. Gelegentlich allerdings legt Schönberg, hin- und hergerissen zwi­ schen dem Drang nach Mitteilung, Bekenntnis, ja Geständnis und dem Bedürfnis nach Verschweigen, Verleugnen, Verschlüsseln, doch Spuren — nur um sie in der Regel sogleich wieder zu verwischen. So schreibt er in seinen Bemerkungen zu den vier Streichquartetten (wohl 1949) anläßlich des 3. Streichquartetts: »Als kleiner Junge wurde ich von einem Bild einer Szene aus dem Märchen Das G espensterschiff verfolgt, dessen Kapitän von der meuternden Mannschaft mit dem Kopf an den Topmast genagelt worden war. (...) Unterbewußt mag es eine sehr grausige Vorahnung gewesen sein, die mich dieses Werk zu schreiben veranlaßte, denn so oft ich über diesen Satz nachdachte, kam mir jenes Bild in den Sinn«. Die »Vorahnung« bei dem 1927 geschriebenen Werk dürfte sich auf den Nazismus beziehen, gegen den Schönberg ja politisch wie komposito­ risch oft dezidiert Stellung bezog. Im Hinblick auf Bild und Sujet schwächt er vorbeugend ab: »Ich bin mir sicher, daß dies nicht das »Programm« des ersten Satzes (...) war.« Und er lenkt ab, indem er bestreitet, daß das Sujet den Schlüssel für die »Struktur« liefere — was an sich niemand annähme: »Vermutlich würde ein Psychologe diese Geschichte als Sprungbrett für verfrühte Schlüsse benutzen. Da sie aber nur den Gefühlshintergrund dieses Satzes erläutert, gibt sie keinen Aufschluß über die Struktur.« (Schön­ berg 1949b, 424) Immerhin also aber doch über Teilmomente von 80 Hanns-Werner Heister Motivierung wie Gehalt. Überdies macht Schönberg selbst auf eine obsessive, in sich mit Tonrepetitionen arbeitende Figur in StaccatoAchteln aufmerksam, »die fast immerzu in diesem ersten Satz erscheint und die ein einendes Bindeglied für all die entfernt ver­ wandten Charaktere und Stimmungen abgeben könnte«. Auch Brahms, zumal in schriftlichen Äußerungen zurückhaltender und diskreter, gibt einige Male mindestens in Andeutungen solche Beziehungen doch preis. So schreibt er am 12.9.1854 aus Düsseldorf an seinen Freund Joseph Joachim: »Morgen, den 13ten ist ihr Geburtstag; ich habe ihr einen langjährigen Wunsch erfüllt, und das Quintett (Klavierquintett Es-Dur op.44) von Schumann zu vier Händen arrangiert (...) Ich habe mich immer tiefer hinein versenkt, w ie in ein Paar dunkelblauer Augen (so kömmt’s mir nämlich vor).« Erst die Vermittlung durch die Reflexion im Werk des Freund-Rivalen setzt dann, so scheint es, Brahms’ eigene kompositorische Objektivie­ rung seiner Liebesbeziehung frei. Er fährt fort: »Zu meinen Varia­ tionen (op.9) sind noch zwei neue gekommen, in der einen spricht Klaral« (Hansen 1983, 37) Nicht zuletzt mit Tonbuchstaben-Chiffren unter anderm nach Schu­ manns Vorbild (ABEGG, ASCH) dürfte Brahms häufiger mehr oder minder versteckte Liebeserklärungen im Werk ausgesprochen haben; das C-ASCH bietet dafür ebenso wie sein eigener Name hinreichend musikalisches Motiv-Material. Offenkundiger (wiewohl in der Regel nicht offener preisgegeben) sind biographische Bezüge in der Textwahl: sie macht mit Gedanken, Schlüssel- und Stichwörtem das Werk im Hinblick aufs Leben als Hin­ tergrund und Grundlage transparent. Bei den Keller-Vertonungen Brahms’ hat A. Dümling viele und mehrdimensionale Zusammen­ hänge nachgewiesen. Im Zentrum steht die unerfüllte Liebessehnucht. Nachdem finanzielle Gründe (oder besser Vorwände bzw. Rationali­ sierungen) als Hindernis für Ehe und Familiengründung wegfallen, treten die psychischen um so deutlicher hervor: »Zu Frauen«, so A. Dümling, »fühlten sie sich einerseits hingezogen, andererseits versetz­ te deren Nähe sie in Angstzustände. Schuld daran war nicht alleine ihr zwergenhafter Wuchs, sondern auch eine von übermächtigen Müttern dominierte Kindheit. (...) Frauen gegenüber verfielen später sowohl Keller als auch Brahms entweder in eine schüchterne Kinderrolle oder aber in eine Grobheit, die derb-zudringlich oder kühl-abweisend war. Eine Ausgeglichenheit zwischen beiden Polen, eine Gleichberechti­ gung zwischen den Geschlechtern gab es für sie nicht; stets erwarteten sie sich von Frauen die führende Rolle. (...) Zwischen körperlicher Angst und absolute Musik 81 und geistiger Liebe gab es für beide einen unüberbrückbaren Gegen­ satz.« (Dümling 1986, 11) Verdeckter, zurückgenommen in Skizzen und ins »Rein-Musikalische«, erscheint ein wesentliches Stück von Brahms’ Liebes-Problematik dann in den »Vier ernsten Gesängen« op. 121. Brahms schickt die im Druck erschienenen Noten im Juli 1896 nach dem Tod C. Schu­ manns an deren Töchter Marie und Eugenie: »Ich schrieb sie in der ersten Maiwoche: ähnliche Worte beschäftigen mich oft, schlimmere Nachrichten von Ihrer Mutter meinte ich nicht erwarten zu müssen — aber tief innen im Menschen spricht und treibt oft etwas, uns fast unbewußt, und das mag wohl bisweilen als Gedicht oder Musik ertönen. Durchspielen können Sie die Gesänge nicht, weil die Worte Ihnen jetzt zu ergreifend wären. Aber ich bitte, sie als ganz eigentliches Totenopfer für Ihre geliebte Mutter anzusehen und hinzu­ legen.« (Litzmann 1902, 309) Darüber hinaus aber ist das Werk das Totenopfer für eine weitere geliebte Frau, die 1892 gestorbene Elisabet von Herzogenberg (ihr Mann war auch Komponist). Der vierte der »Gesänge« war ursprüng­ lich als Teil einer auf sie bezogenen Symphonie-Kantate geplant. Text­ grundlage ist der 1. Korintherbrief (V.13) mit seiner Verherrlichung der Liebe. In den Skizzen findet sich ein Übergang von Es-Dur nach H-Dur und die Eintragung von Keller-Versen, u.a. »Nun in dieser Frühlingszeit / Ist mein Herz ein klarer See.« (Eben diesen Tonart­ wechsel hatte Brahms bereits in dem Lied »Versunken« für den Über­ gang von Feme in Nähe, für die Versöhnung von Sinnlichem und Geistigem, verwendet.) Das mit dem Text verknüpfte Melodiezitat, so Max Kalbeck, hatte für Brahms »magische Kraft«. »Und diese Kraft ging von dem Frauenbild aus, das im Quellgrund seiner Seele badete. So unwiderstehlich war der Reiz des tiefverborgenen Zaubers, daß er sich nicht enthalten konnte, die Worte Kellers dem musikalischen Zitat beizufügen, obwohl er sie gar nicht brauchte. (...) Was er der Lebenden niemals zugestand, bekannte er der Toten.« (Dümling 1986, 17) Dieses Zitat samt dem Wechsel von Es- nach H-Dur erscheint im vierten der »Ernsten Gesänge« zu dem Bibeltext »wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Worte (...)« —• eine grandiose Ver­ schränkung von Verbergen und Enthüllen. (Dümling 1986, 17) So gesehen wirken Bemerkungen von Brahms zu Gustav Ophüls, der ihm Pfingsten 1896 nach Clara Schumanns Beerdigung begegnete, weniger unverständlich: »Ich habe mir zu meinem Geburtstag ein paar Lieder komponiert, es sind ganz gottlose Lieder, aber ihre Texte stehen Gott sei Dank in der Bibel!« (Ophüls 1921, 19) Verständlicher auch Brahms’ wohl doch emstgemeinte »Frage, ob etwa der öffentliche Vortrag der bereits bei Simrock im Druck befindlichen Gesänge aus 82 Harns-Werner Heister religiösen Gründen untersagt werden könne«. (Ophüls 1921, 27) Cha­ rakteristisch schließlich wie der »derbe Schlag auf das Bein«, den der nach seinem eigenen Vortrag der Gesänge zu Tränen gerührte alte Brahms dem jungen Ophüls versetzt, die Ablenkung auf die Diskus­ sion und Erläuterung technischer Fragen: »Sie glauben gar nicht, wie schwer es ist, diese nicht rhythmischen Bibeltexte zu komponieren!« (Ophüls 1921, 28) Trotz der Verschiebung ins Technische ist freilich deutlich, daß Brahms das Komponieren hier wohl vor allem aus Gründen der Thematik und biographischen Motivierung »schwer« gefallen ist. Ansonsten scheint er, jedenfalls an der klanglich-sinnlichen Außen­ seite des Werks, oft einem fast stoizistischen Ideal der Unerschütterlichkeit zu folgen (objektiv gemischt und vermittelt mit schmerzlicher Entsagung), das er Clara Schumann im Jahr nach dem Tod Robert Schumanns predigt: »Leidenschaften gehören nicht zum Menschen als etwas Natürliches. Sie sind immer Ausnahme oder Auswüchse. Bei wem sie das Maß überschreiten, der muß sich als Kranken betrachten (...). Ruhig in der Freude und ruhig im Schmerz und Kummer ist der schöne, wahrhafte Mensch. Leidenschaften müssen bald ver­ gehen, oder man muß sie vertreiben.« (Hansen 1983, 81) Auch und gerade die gebändigte Leidenschaft macht sich freilich musikalisch bemerkbar — nicht zuletzt als politische, peinlich im »Triumphlied« »auf den Sieg der deutschen Waffen« im 70er-Krieg; mit bedeutenden Werken in antifaschistischer Grundhaltung dagegen bei Schönberg. Ein entscheidendes Mittel wie Ausdruck der musikalischen Trieb­ regulierung ist bei Brahms wie Schönberg und anderen das TechnischHandwerkliche, zumal die Verfahren der thematisch-motivischen Arbeit samt Kontrapunkt und, so Schönbergs Terminus, »entwickeln­ der Variation«. Die hohe affektive Besetzung des Technischen beson­ ders bei Schönberg läßt vermuten, daß hier mehr gemeint ist als eine bloß musikimmanente Gestaltung. Es geht nicht nur um eine inner­ musikalische Absicherung des Komponierens und des Komponierten, sondern auch um eine nach außen. Zum einen beweisen handwerk­ liches Können und Solidität die Meisterschaft gegenüber der Zunft; der »Akademiker« Brahms mit seinen historistischen Zügen und der als Lehrer wie Theoretiker vorwiegend konservative Schönberg über­ decken so ihre Herkunft aus kleinen Verhältnissen —- Schönberg war überdies in einem hohen Ausmaß Autodidakt. Zum anderen überdeckt oder tilgt die »Arbeit im geistfahigen Material« (so ein Begriff Eduard Hanslicks) die Spuren der Entstehung, die Wundmale des realen Lebens, das Stoffliche in der Musik. Freilich distanziert sich Brahms Angst und absolute Musik 83 von Hanslick, dem Dogmatiker der »absoluten« Musik und späteren Propagator seiner Musik, wenn er am 15.1.1856 an Clara Schumann schreibt: »Hanslick ist auch mus. Schriftsteller. Sein Buch Vom musi­ kalisch Schönen (...) wollte ich lesen, fand aber gleich beim Durch­ sehen so viel Dummes, daß ich’s ließ.« (Hansen 1983, 70) Gedeckt durch Konstruktion, teilweise sogar vermittelt durch deren Radikalisierung, kommt dann der Ausdruck doch zu seinem Recht. Das Unbewußte, als chaotisch erlebte Triebhafte, wird bedingt freige­ lassen, wobei dann das Technisch-Materiale selber, wie Schönbergs Formel vom »Triebleben der Klänge« zeigt, geradezu erotisch aufge­ laden werden kann. In seinem programmatischen Vortrag Brahms, der Fortschrittliche analysiert Schönberg u.a. den dritten der »Ernsten Gesänge«. Dabei hebt er, wie Brahms selber, Technisches hervor, vor allem die »außer­ ordentliche motivische Logik«, und entdeckt für die Schlüsselworte »O Tod, wie bitter« als »Geheimnis« die Verkettung von Terzen. Zugleich aber weist Schönberg, der sich dem Dogma der »absoluten« Musik allenfalls in Teilbereichen seiner Ideologie unterwirft, darauf hin, daß Brahms hier »bis zu den äußersten Grenzen des noch Ausdrückbaren vordringt«. Und, da bei ihm die Verdrängungen nur par­ tiell wirksam sind, bemerkt er an Brahms den »schützenden Wall von Trockenheit«. Bei Brahms setzen Tod und/oder Liebe, Nähe des Sterbens und Ent­ fernung des Lebens besonders nachdrücklich Hemmungen außer Kraft und Energien frei, die das Werk auf die eigene Lebenswirklichkeit hin durchlässiger machen. Während er, anders als Keller, sich mit »Ehre statt Ehe« nur notgedrungen beschied (so A. Dümling), war Schönberg zweimal verheiratet. Einer seiner entscheidenden kompositorischen Durchbrüche, der zur »freien Atonalität«, ist eben mit einer tiefen Lebenskrise im Zusammenhang mit dem Scheitern seiner ersten Ehe verknüpft. Seit Sommer 1907 verkehrte der Maler Richard Gerstl, der einzige Wiener Fauvist, im Hause Schönberg, und Schönberg selbst erhielt für seine Malweise einige Anregungen. Zwischen Gerstl und Mathilde Schönberg entwickelte sich eine Liebesbeziehung; während eines Urlaubs zu dritt in Gmunden im Sommer 1908 floh sie dann mit Gerstl und ließ Schönberg samt den Kindern zurück. Erst gemeinsame Freunde, vor allem Webern, bewogen sie zur Rückkehr. Schönberg trug sich in dieser Zeit wohl mit Suizidgedanken. Wäh­ rend er aber die Krise im Komponieren bewältigte, brachte sich Gerstl, am 4. November, wirklich um — was wahrscheinlich bei Schönberg 84 Hanns-Wenter Heister unter anderem auch Schuldgefühle erzeugte. In dieser Zeit arbeitete er weiter am 2. Streichquartett wie an den 15 Liedern aus Stefan Georges Buch der hängenden Gärten. In diesem Lieder-Zykius riskiert Schön­ berg den Durchbruch zur Atonalität, zur »Emanzipation der Disso­ nanz« und zum Verzicht auf Tonartbindung der Stücke. In einer pro­ grammatischen Erklärung anläßlich der Uraufführung 1910 schreibt er dazu: »Mit den Liedern nach George ist es mir zum ersten Mal gelungen, einem Ausdrucks- und Formideal nahezukommen, das mir seit Jahren vorschwebt. Es zu verwirklichen, gebrach es mir bis dahin an Kraft und Sicherheit. Nun ich aber diese Bahn endgültig betreten habe, bin ich mir bewußt, alle Schranken einer vergangenen Ästhetik durchbrochen zu haben.« In seiner ausführlichen Darlegung der komplexen biographischen wie kultur- und kompositionsgeschichtlichen Zusammenhänge weist A. Dümling (Dümling 1981,194) daraufhin, »daß sich die Lieder 11-15, die bei George nach der Peripetie liegen, auch musikalisch von den Liedern des Frühjahrs, die noch vor der Peripetie lagen, unter­ scheiden, nämlich durch völlige Preisgabe tonaler Bezüge. Die Peri­ petie des Gedichtzyklus galt auch für Schönberg und sein Verhältnis zur Tonalität. Parallel zum Zerbrechen der Liebe in den Liedern, zum Hereinbrechen des Herbstes, vollzog sich gleichzeitig die Emanzipa­ tion der Dissonanz.« Sie vollzieht sich auch innerhalb des 2. Streich­ quartetts in fis-moll, dessen letzter (4.) Satz »Entrückung« auf Tonartvorzeichnung verzichtet. Er wurde im Verlauf des August 1908 vollendet; am 11. Juli der 3. Satz, die »Litanei«, mit der bewegenden Schlußstrophe »töte das sehnen, / schließe die wunde! / Nimm mir die liebe, / gib mir dein glück!« Am 27. Juli vollendete Schönberg den 2. Satz, das Scherzo: hier zitiert er beziehungsreich das Wienerlied »O du lieber Augustin / alles ist hin« im Trio. Das »intervallische Autogrammsigel A-Es gleich im ersten Takt als Zeichen der Identifikation«, so Frank Schneider, »gründlich versteckt« schon im 1. Satz (Schneider 1985, 90), erscheint auch nebst anderen Buchstaben-Anspielungen am Beginn des Trios. In seiner bereits erwähnten Analyse der vier Streichquartette spricht Schönberg apropos der Notenbeispiele mit den Textzeilen »Tief ist die Trauer die mich umdüstert« und »Leih deine kühle, lösche die brände« von »Begleitstimmen deren Zweck ganz und gar nicht harmonischer Natur ist«, und S hrt, fast verräterisch, fort: »Ihre Funktion und Ab­ leitung wird vielleicht in der nahen Zukunft entdeckt werden, da ihr Autor sie psychologisch tröstlich fand, als er sie schrieb.« Die Angst und absolute Musik 85 Verallgemeinerung des Individuellen, der Übergang ins Methodische, wirkt verdeckend und ablenkend. Zumal im Schlußsatz rettet sich Schönberg aus der realen Misere in eine überschwängliche, wobei er das Georgesche »Ich fühle luft von anderem planeten« ganz buchstäblich-naturalistisch deutet: »Der vierte Satz, ‘Entrückung’, beginnt mit einer Einleitung, die die Abreise von der Erde zu einem anderen Planeten ausmalt. Der visionäre Dichter hat hier Empfindungen vorausgesagt, die vielleicht bald bestätigt werden. Die Loslösung von der Erdanziehung — das Emporschweben durch Wolken in immer dünnere Luft, das Vergessen aller Mühsal des Erdenlebens — all das wird in dieser Ein­ leitung zu schildern versucht.« (Schönberg 1949b, 421) Eine freie, unbestimmte, »schwebende« Musik hatte Busoni in seinem 1907 veröffentlichten »Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst« als Utopie anvisiert: »So jung es ist, dieses Kind, eine strahlende Eigenschaft ist an ihm schon erkennbar, die es vor allen seinen älteren Geschwistern auszeichnet. Und diese wundersame Eigenschaft wollen die Gesetzgeber nicht sehen, weil ihre Gesetze sonst über den Haufen geworfen würden. Das Kind — es schwebt! Es berührt nicht die Erde mit seinen Füßen. Es ist nicht der Schwere unterworfen. Es ist fast un­ körperlich. Seine Materie ist durchsichtig. Es ist tönende Luft. Es ist fast die Natur selbst. Es ist frei.« (Busoni 1907, 89) Schönberg kommentierte in der zweiten, etwas veränderten Fassung des »Entwurfs« von 1916: »Und nun sehe Busoni einmal dieses Flöten­ solo aus meinen Pierrot-lunaire-Melodramen an (...) ob diese Melodie (...) nicht der göttlichen Freiheit des schwebenden Kindes mehr ent­ spricht als was dem Gefängnis seiner Tonreihen entspränge!« (Busoni 1974, 73) Vor allem aber sah Schönberg Busonis Wunschträume in seiner schwebenden Tonalität verwirklicht. Der Durchbrach dazu ist Voll­ streckung von »Tendenzen des Materials«, als solcher aber biogra­ phisch mit motiviert und vermittelt. Zurecht bezieht A. Dümling das »Alles ist hin« zugleich auf die Tonalität wie auf Schönbergs Ehe. Dieser selber nahm in der Harmonielehre (1911) eine analoge Verknüp­ fung vor, die ohne die biographischen Bezüge merkwürdig bis wider­ sinnig wirkt: Dem »Formgefühl der Gegenwart (...) bleibt ein Stück auch faßlich, ohne daß die Beziehung auf den Grandton fundamental behandelt (wird), es kann auch folgen, wenn die Tonalität sozusagen schwebend erhalten wird. (...) — der Vergleich mit der Unendlichkeit könnte kaum nähergerückt werden, als durch eine schwebende, sozusagen unendliche Harmonie, durch eine, die nicht Heimatschein und Reisepaß beständig mit sich führt, Ausgangsland und Reiseziel sorgfältig nachweisend. Es ist ja recht nett von den Bürgern, daß sie gerne wissen möchten, wo die Unendlichkeit anfängt und w ie sie aufhören wird. Und man kann es ihnen verzeihen, daß sie einer Unendlichkeit, die sie nicht nachgemessen haben, 86 Hanns-Wemer Heister wenig Vertrauen entgegenbringen. A ber die Kunst, soll sie irgend etwas m it dem Ewigen gemein haben, hat das Vakuum nicht zu scheuen. Das Formgefühl der Alten verlangte das anders. Für sie schloß das Lustspiel mit der Ehe, das Trauerspiel m it der Sühne oder der Vergeltung und das M usikstück im gleichen Ton. Darum entsprang für sie aus der Wahl der Tonleiter die Verpflich­ tung, deren ersten Ton als Grundton zu behandeln, ihn als Alpha und Omega aller Ereignisse darzustellen, als patriarchalischen Beherrscher des durch seine Macht und seinen Willen abgegrenzten Gebiets: an den sichtbarsten Stellen stand sein Wappen, insbesondere am Anfang und Ende.« (Harmonielehre 1966, 151. Hervor­ hebung v. H.-W.H.) Und auch an anderer Stelle kommt er, im Text-Kontext der »Harmonie­ lehre« völlig unvermittelt und unmotiviert, eine »Verwerfung« (um einen Begriff Harry Goldschmidts variativ anzuwenden), durchaus sinnvoll aber im Kontext der Biographie, auf die Schuldfrage wie obsessiv zurück: »Man versteht es heute besser denn je, sich das Leben angenehm zu machen. Man löst Probleme, um eine Unannehmlichkeit aus dem Wege zu räumen. Aber, wie löst m an sie? Und daß man überhaupt meint, sie gelöst zu haben! Darin zeigt sich am deutlichsten, was die Voraussetzung der Bequemlichkeit ist: die Oberflächlich­ keit. So ist es leicht, eine ‘Weltanschauung’ zu haben, wenn man nur das anschaut, was angenehm ist, und das Übrige keines Blickes würdigt. Das Übrige, die Haupt­ sache nämlich. Das, woraus hervorgeht, daß diese Weltanschauungen ihren Trägern zwar wie angemessen sitzen, aber daß die Motive, aus denen sie bestehen, vor allem entspringen dem Bedürfnis, sich zu exkulpieren. D enn komischerweise: die Menschen unserer Zeit, die neue Moralgesetze aufstellen (oder noch lieber alte umstoßen), können m it der Schuld nicht leben! Aber der Komfort denkt nicht an Selbstzucht, und so wird die Schuld abgewiesen oder zur Tugend erhoben. Worin sich für den, der genau hinsieht, die Anerkennung der Schuld als Schuld aus­ drückt. D er Denker, der sucht jedoch, tut das Gegenteil. Er zeigt, daß es Probleme gibt, und daß sie ungelöst sind. Wie Strindberg, daß ‘das Leben alles häßlich macht’. Oder wie Maeterlinck, daß ‘drei Viertel unserer Brüder zum Elend ver­ dammt’ sind. Oder wie Weininger und alle anderen, die ernsthaft gedacht haben.« (Harmonielehre 1966, 6. Hervorhebung H.-W.H.) So finden sich Spuren des realen Lebens nicht nur im Werk, sondern sogar in der Theorie. Die Lebenskrise, die ihrerseits sich auf dem Hin­ tergrund einer gesellschaftlichen Krise im Jahrzehnt vor dem Beginn des Ersten Weltkrieges entwickelte, setzte mit ihren Affektstaus und -ausbrüchen in Schönberg die Energie und den »Mut« frei, das zu rea­ lisieren, was objektiv in der Luft lag, oder, in seiner Terminologie, das zu »können«, was er »mußte«. Das auslösende »Geheimnis« deutet er musikalisch-textlich an und verbirgt es. Und nach dem Krisen-Jahrzehnt mit der freien Atonalität, in der viele der geglücktesten Werke Schönbergs entstanden, folgt die rigorose Ordnung der »Komposition mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen«. Aber auch sie hindert dann Schönberg nicht daran, sich mit der Realität weiter auseinander­ zusetzen. Angst und absolute Musik 87 Marginalien »Werte Freunde! Es ist nur, daß endlich einmal ein Blatt Papier hinkommt! Rosenfarb vor Scham und freundlich wie ein Engel müßte es aussehen! Aber leider, mein Briefpapier so wenig wie mein Gesicht können so lieb und freundlich aussehen wie beides bei Frau Elisabet. (...) Es war so schön bei Ihnen; ich empfinde es heute noch wie eine angenehme Wärme und möchte zuschließen und zuknöpfen, daß sie lange bleibt. Aber so Gutes macht und sagt sich besser auf Notenpapier; so möchte ich diesen Zettel nur (wie meinen Arm beim Souper) aus schuldiger Rücksicht meiner gütigen Wirtin gereicht haben. Dann suche ich die schönste Tonart und das schönste Gedicht, um behaglich weiter zu schreiben.« Johannes Brahms am 31.1.1877 an Heinrich und Elisabet von Herzogenberg »Ein richtiges Gefühl darf sich nicht abhalten lassen, immer wieder von neuem ins dunkle Reich des Unbewußten hinabzusteigen, um Inhalt und Form als Einheit her­ aufzubringen.« Schönberg, Franz Liszts Werk und Wesen (1911) »Ich bin sicher, daß sich zukünftige Musiktheoretiker auf neue Wege der For­ schung werden einstellen müssen. Musik ist die Emanation der Seele, und ihre beherrschenden Kräfte sind die gleichen, die alle Manifestationen der Seele beherrschen. Daher könnte es der Psychologie gelingen zu analysieren: warum etwas auf etwas anderes folgt; warum etwas solche Folgen hat; warum dieses lang und jenes kurz ist etc.« Schönberg, Bemerkungen zu den vier Streichquartetten (1949)