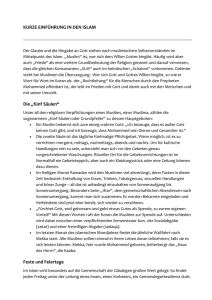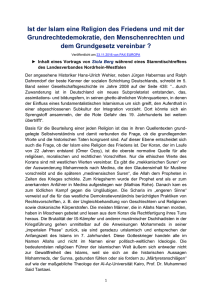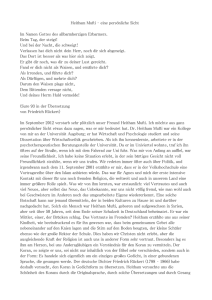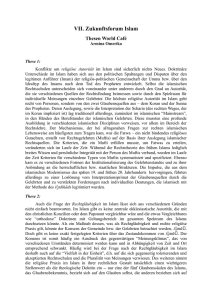Islam und Integration
Werbung

Fuad Kandil Kann religiöse Erziehung zur besseren Integration beitragen? Zur Frage des Islamischen Religionsunterrichts - Inhaltliche Überlegungen Dein Islam – mein Islam Die Lesarten des Islams unterscheiden sich – sie haben sich in der Geschichte islamischer Kulturräume immer unterschieden. Was zunächst natürlich als Chance begriffen werden kann, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen auch als ein grundsätzliches Problem. Die Anforderungen an inner-muslimische Pluralität und Toleranz dürfen dabei nämlich nicht unterschätzt werden. Was nun folgend dargestellt wird, soll auf Potenziale von religiöser und kultureller Differenz aufmerksam machen. Hier wird keine tradierte Lesart des Islams bestimmt oder bewusst eine bestimmte theologische Schule bevorzugt, sondern der Blick ruht auf den heutigen Situationen von Musliminnen und Muslimen in Deutschland. Dabei geht es aber nicht nur um Deutschland. Was hier zur Sprache kommt, gilt in gewisser Weise auch für die kulturellen, nationalen, sprachlichen und ethnischen Herkunftsräume von Musliminnen und Muslimen in Deutschland. Auch in so genannten islamischen Ländern lassen sich Prozesse gesellschaftlicher Polarisierung und kultureller Entfremdung beobachten, und auch dort stehen die Gesellschaften vor der Integration als einer gemeinsamen und unterwarteten Bewältigungsaufgabe. Integration ist also kein befristeter deutscher Sonderfall, sondern ein unbefristetes grenzüberschreitendes Erfordernis. Jeder Kanon tradierter Identität, religiös oder nicht, gerät angesichts des Zusammenwachsens der Welt auf dem Prüfstand (vgl. hierzu Meyer, Thomas: Identitäts-Wahn. In: F. Rapp (Hg.): Globalisierung und kulturelle Identität. Bochum 1998. Seiten 57-83. Ders.: Identitätswahn. Die Politisierung des kulturellen Unterschieds. Berlin 1997). Der Islam ist alles andere als abstrakt. Muslim zu sein hat viel mit sichtbarem Handeln in konkreten Situationen zu tun. Insofern wäre in manchem Fall lieber von Muslimen zu sprechen, wenn vom Islam die Rede ist. Die praxeologischen Aspekte von Religion können sich indes unter dem Eindruck von Migration erheblich verstärken, nicht selten auf Kosten des reichen kulturellen und ideengeschichtlichen Erbes einer Religion. Ihr droht Verlust in der Dimension spirituellen Erlebens. Ähnliches lässt sich nicht nur für türkische Muslime in Köln beschreiben, sondern auch für polnische Katholiken in London oder für russische Juden in New York. Gerade die gemeinsame Erfahrung von Migration kann die Polarisierung zwischen Konservativen und Liberalen und auch die damit verbundenen Prozesse theologischer Reform in Gang setzen. Dabei gilt, dass liberales Denken nicht gleichzusetzen ist mit der Abkehr von der Religion. Andersherum stellt das Beharren auf Tradition und Kult nicht unbedingt die theologische Mitte des Islams dar. Zum Problem wird aber, wenn es in den Generationen im Anschluss an Migration zu Formen der Retribalisierung von Religion kommt: Muhammad als der Gesandte des gandenreichen Gottes an alle Menschen verblasst, während Muhammad als der unduldsame türkische oder arabische Clansmann an Kontur gewinnt. Junge Musliminnen und Muslime, die ihren Islam zunehmend pluralistisch und individualistisch verstehen wollen, sind aber eher auf der Suche nach religiöser und weniger nach ethnischer oder nationaler Gemeinschaft. Sie geraten hier also schnell in die Zwickmühle: Rigoros werden ihnen von denen die Grenzen in der Gestaltung ihres Lebens gesteckt, die sie eigentlich dabei unterstützen müssten, zu jungen Menschen mit einer zwar gefestigten, aber nicht versteiften muslimischen Identität heranzuwachsen. Festigen hieße dazu befähigen, zu einer persönlich vertretbaren Lesart des Islams zu finden, der man gern ihren Sitz im eigenen Leben einräumt, weil sie dazu verhilft, ein glücklicher Mensch zu werden. Was der Islam ist und wie Muslim zu sein verstanden werden kann, lässt sich in vielen Modi beschreiben. Dazu hat es inzwischen einige Versuche der Typisierung gegeben, denen kultur-, religionswissenschaftliche oder soziologische Kriterien zu Grunde liegen. Simplifizierende Unterscheidungen wie die in orthodox und liberal gehen dabei vermutlich an der sozialen 1 Wirklichkeit von Musliminnen und Muslimen vorbei, die ja nicht in erster Linie nur Musliminnen und Muslime sind: Ihre religiösen Alltagskulturen können verschieden ausgeprägt sein, je nach sozialer Rolle und Kontext in Art, Intensität und Sichtbarkeit nach außen. Nicht ganz von der Hand zu weisen sind allerdings die drei Deutungsmodi des Islams als liberaloffen, kulturell-traditionalistisch und religiös-fundamentalistisch, wenn man in die einschlägige wissenschaftliche Literatur blickt. Dabei richtet sich der Blick vor allem auf die Frage, unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen sich ein bevorzugter Deutungsmodus an einem konkreten Ort zu einer bestimmten Zeit durchsetzt. Dass dabei die verschiedenen Auffassungen (Modi) von unterschiedlichen Gruppen und einzelnen Personen vertreten werden, teilweise auch von ein und derselben Person in verschiedenen Kontexten, und auch im Sinne der viel zitierten, von Ernst Bloch 1935 ins Spiel gebrachten „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“, darf nicht verwundern: Rationalisten und bekennende Antirationalisten treffen auch im Islam aufeinander. Als mit den Zielen einer positiven Integration am wenigsten vereinbar gilt dabei dasjenige Verständnis von Islam, welches auf die Betonung der Differenz ausgerichtet ist (vgl. dazu die Einleitung der von den Theologen J. Broer und R. Schlüter herausgegebenen Beitragssammlung Christentum und Toleranz, Darmstadt 1996). Dabei muss es sich nicht einmal um ein durch eindeutige Signale artikuliertes Selbstverständnis von Musliminnen und Muslimen handeln: Die Zuschreibung, im negativen Sinne fundamentalistisch zu sein, überlagert die positive Orientierung am Fundamentalen. Das reicht aus, um nicht nur die Kommunikation zwischen Muslimen und NichtMuslimen, sondern auch die zwischen religiös und weniger religiös Orientierten zu stören. Islamunterricht mit Gewähr Erziehung und Unterricht in Sachen Islam, formal oder non-formal, schulisch oder häuslich – und irgendwo dazwischen die Moscheen – führen keineswegs immer automatisch zur Unterstützung einer gefestigten muslimischen Identität oder einer positiven Integration. Es kommt wohl auf den Geist an, auf die Motive und die Zielsetzungen, die einem islamisch zu nennenden Bildungsbemühen zu Grunde gelegt werden. An ihnen lässt sich der jeweilige Deutungsmodus des Islams beschreiben, vorausgesetzt hinter dem, was die Musliminnen und Muslime dazu an Signalen senden, verbirgt sich keine zweite Agenda. Das Bekenntnis zu Freiheitlichkeit, das Eintreten für Rechtsstaatlichkeit und die Lust auf Progressivität werden ihnen oft als Doppelzüngigkeit ausgelegt. Es wird also zu fragen sein, wer als Träger für einen Islamischen Religionsunterricht verantwortlich zeichnet. Dass bestimmte Migrantenorganisationen mit ihrem Namen ihr bevorzugtes religiöses Selbstverständnis des Islams verbunden sehen wollen, autorisiert sie noch nicht zu theologischer Lehrzucht und qualifiziert sie noch nicht als Sprachrohr muslimischer Schüler- und Elternschaften. Dass letztere sich erfolgreich zu Trägervereinen für Islamischen Religionsunterricht an Schulen ihrer Wahl zusammenfinden, macht sie im Gegenzug aber auch noch nicht zu den Religionsgemeinschaften, die sie im Sinne des Grundgesetzartikels 7 sein möchten. Dass eine angehende Lehrkraft für den Islamischen Religionsunterricht an der öffentlichen Schule erfolgreich ihre Prüfungen abgelegt hat, gibt nur wenig Auskunft über ihre persönliche Lesart des Islams, für die sie im Unterricht einstehen wird. Hier sind immer wieder auch muslimische Stimmen zu hören, die angesichts solcher Unwägbarkeiten lieber ganz auf einen Islamischen Religionsunterricht verzichten würden als das Risiko einzugehen, er könne in die Hände von Menschen fallen, die den Islam als eine Ideologie betreiben. Derlei Skrupel sind nicht etwa nur als die deutsche Speerspitze des türkischen Kemalismus gegen die religiös Orientierten zu interpretieren. Hier geht es vielmehr auch um konservative religiöse Motive: Die Sorge um die seelische und geistige Unversehrtheit der muslimischen Kinder, gepaart mit einem gesunden Misstrauen gegenüber jeder Form von Islam im staatlichen Gewand. Andererseits ist die Sorge vieler muslimischer Eltern der religiösen Indoktrinierung der eigenen Kinder groß genug, um gerade im Islamischen Religionsunterricht an der öffentlichen Schule den Garant für 2 ein ideologiefreies Islamverständnis zu sehen. Das gilt nicht nur, wie man annehmen darf, für Elternhäuser in Distanz zur Moschee, sondern interessanterweise auch für moscheeaffine Kreise: In den laufenden Schulversuchen zum Islamischen Religionsunterricht hat sich gezeigt, dass die Eltern unabhängig von ihrer eigenen religiösen Einstellung von dem schulischen Angebot ein ergänzendes Spektrum erwarten. Darin sind sich die Mütter mit und ohne Kopftuch einig, und sie unterscheiden dabei klug zwischen den drei maßgeblichen religionsbezogenen Erfahrungsräumen Elternhaus, Moschee und Schule sowie zwischen den Kompetenzen, die sie jeweils grundlegen und einüben können. Muslimische Eltern haben oft ihre eigenen negativen Erfahrungen mit dogmatischer und verlustängstlicher Fixierung in Sachen Islam hinter sich, die in der umgebenden Gesellschaft eine Bedrohung für den eigenen Nachwuchs sieht und weniger eine Chance, geschweige denn eine gemeinsame Solidargemeinschaft. Die Antwort darauf ist oft eine spezifische Art von religiös-kultureller Erstarrung, in der sich häusliche Erziehungsfehler multiplizieren. Besonders krasse Fälle ergeben sich dort, wo sich ein protektionistisch angelegtes Religionsverständnis und eine dispositive Bereitschaft bzw. eine hierfür anfällige Persönlichkeitsstruktur gegenseitig verstärken. Diese Wechselwirkung zwischen familialer Sozialisation und Auffassung von Religion und Religiosität findet sich häufiger bei der Gruppe muslimischer Zuwanderer, die einem einfachen ländlichen Milieu mit entsprechend strukturiertem Weltbild entstammen und dessen tradierte Lebensformen mit dem Islam und einer wie auch immer gearteten „islamischen Lebensführung“ gleichgesetzt werden. Doch ist dies keineswegs auf Angehörige dieser sozialen Gruppe beschränkt, sondern erfreut sich auch unter Intellektuellen zunehmender Beliebtheit, wenn sie ihre zweite, innere Konversion erfahren und für sich im Islam ein neues Überlegenheitsparadigma entdecken. Besonders hier wirkt sich die Erfahrung von Stigmatisierung und Zurückweisung durch eine Umgebung negativ verstärkend aus, wenn das Wechselverhältnis jeweils als Prestigegefällewahrgenommen wird. Der Versuchung nachzugeben, den Islam als ein durch und durch rationales und modernes System darzustellen, bei dem man, einem Apparat gleich, nur auf den rechten Knopf drücken muss, damit am hinteren Ende das Heil rauskommt, führt die theologische und kulturelle Grammatik des Islams ad absurdum. Andererseits bedeuten hohe Hürden zur gleichberechtigten gesellschaftlichen Partizipation, dass sich Muslime zwangsläufig auf die oft mehr zugeschriebenen als angestammten Identitätsmerkmale zurückverwiesen sehen, die es nun gewissermaßen mit neuer Akribie zu pflegen gilt: Türken in der Türkei oder Marokkaner in Marokko wundern sich dann gleichermaßen über die seltsam reaktionären Anwandlungen ihrer Clansleute in der Diaspora. Das betrifft, und das überrascht viele, mehr noch die dritte als die zweite Generation der Postmigration. Die Rede ist hier von einem Trend der sich verstärkt. Deshalb wird dem Islamischen Religionsunterricht hier ein besonderer emanzipatorischer und therapeutischer Auftrag erteilt. Das ist sowohl im Interesse der eigenen Gruppe als auch der Gesellschaft insgesamt – ein Interesse, wie es von muslimischen Eltern immer wieder artikuliert wird, gepaart mit der Sorge davor, gerade in dieser Frage bei der häuslichen Erziehung zu scheitern: Wir wollen religiös mündige Kinder, aber uns fehlt dazu das religiöse Wissen. Das Wissen hätten die Moscheen, aber ihnen fehlt der Sinn zu religiöser Mündigkeit. Kann der Islamische Religionsunterricht hier den Kontakt herstellen, ohne einen Kurzschluss zu verursachen? Zusammenfassend wäre zu sagen, dass ein auf Integration angelegter Islamischer Religionsunterricht bei muslimischen Schülerinnen und Schülern zu einer religiösen Orientierung führen soll, die weder fundamentalistisch noch dogmatisch fixiert ist. Der türkische Religionswissenschaftler und Islamgelehrte Bülent Şenay spricht hier vom Recht des 3 Heranwachsenden auf seine religiöse oder kulturelle „Unentschlossenheit“ und von der Gefahr, „hybride Identitäten“ zu dämonisieren. Was das religionspädagogische Profil betrifft, geht es also nicht um die Erziehung, sondern um die Befähigung zum Glauben. Hier liegt die religionspädagogische Essenz des Islams. Funktionale und normative Aspekte Unter Musliminnen und Muslimen kursieren einige anerkannte Prinzipien, die sich auf Aussagen der islamischen Schriftgrundlagen, besonders auf den Koran zurückführen lassen. Sie können sich auf das fachliche Profil islamischer Bildungsangebote auswirken. Dabei geht es um Fragen der pädagogischen Funktionalität und der theologischen Normativität – zwei Aspekte, die in der pädagogischen Theorie schließlich nicht spannungsfrei nebeneinander stehen. Ausschlaggebend für das muslimische Selbstverständnis ist dabei das tradierte Wissen um eine spezifisch-islamische Weltkultur der Toleranz, die sich im Vergleich zu den Schlagzeilen mit „Scharia“ und „Dschihad“ eher unauffällig artikuliert. Dabei sind zwei Gedanken für die im ersten Teil dieses Beitrags [vgl. ZRLI Heft 2/2007, Seite 29 ff.; d. Red.] erwähnte Zivilisierung des Umgangs mit Differenz in der modernen Gesellschaft wichtig: die Relativität des Eigenen und der Respekt vor dem Anderen im Sinne religiöser Pluralität (auch zwischen religiös und nicht-religiös). Gemeint ist nicht die Domestizierung oder Abschaffung des religiösen Lehrsatzes, sondern seine Inpflichtnahme für das soziale Ganze. Beide Gedanken beruhen darauf, dass der Islam übergeordnete Prinzipien zulässt, wenn sie kulturell anerkannt (cāda) und sittlich gut (macrūf) sind. Dahinter verbirgt sich nichts Neues, nicht etwa bemühte Progressivität im theologischen Denken, sondern ein altbewährtes Prinzip, das in Vergessenheit zu geraten droht. Der Islam hat, wenn es um das theologische Urteil ging, schon in seiner Frühzeit prägnant zwischen den beiden Bezugshorizonten der Religion und der Vernunft unterschieden, zwischen Wahrheitssatz und konstitutivem Wirklichkeitssatz (vgl. Behr, Harry Harun: „Gott Weiß was ihr im Innern hegt.“ In: Rommel, Herbert und Edgar Thaidigsmann (Hg): Religion und Werteerziehung. Beiträge zu einer kontroversen Debatte. Waltrop 2007. Seiten 141 ff.). Daraus resultierte die Fähigkeit und Bereitschaft islamischer Theologie zu säkularem Denken – eine der Voraussetzungen für die kulturelle und wirtschaftliche Blüte des Islams. Die Relativität des Eigenen Wie aber sieht es mit dem Islam heute aus? Lassen sich in seinem normativen Deutungssystem des Islams Hinweise auf so etwas wie einen eingebauten Schutz vor seinem Missbrauch finden? Können und wollen sich die Muslime auf übergeordnete Moralbezüge einlassen, um die historisch, kulturräumlich und situativ bedingte Rigidität der einen oder anderen tradierten Auslegungs- oder Anwendungsregel einfangen zu können – und zwar so, dass sich die Mittel der Vernunft und die des immanenten Schriftbezugs als gleichermaßen anerkannte exegetische Regel ergänzen? Gibt es eine theologisch begründbare Anti-Formalismus-Formel für das religionspädagogische Fachprofil des Islamischen Religionsunterrichts, welche die private Deutungshoheit der Religionslehrkräfte so deutlich überragt, dass ihnen die Schülerinnen und Schüler in dieser wichtigen Grundsatzfrage nicht der religiösen Tageslaune ausgeliefert sind? Auch wenn hier nur angedacht werden kann, in welche Richtung die Reise gehen könnte, soll es doch nicht zu schwach formuliert sein: Im Vorrang des Gewissens, der situativen Angemessenheit und der Verbesserung der Lage der Menschen empfiehlt sich der gemäßigte Fundamentalismus. Der Vorrang des Gewissens Von Muhammad wird überliefert, er habe dreimal gesagt: „Befrage dein Herz!“ – dreimal immer dann, wenn es darum ging, die Bedeutung einer Weisung als unverhandelbaren Grundsatz zu unterstreichen. Diese und ähnliche Formeln sind in den Texten des kanonisierten Prophetenworts (hadīth) stärker vertreten als im Koran selbst, weil sie in konkrete Lebenslagen hineingesprochen 4 sind. Solche Sprüche gelten als Ausweis einer religiös begründeten Humanitätsidee im Islam und sind im Sinne eines kulturraumübergreifenden Ethos unter Musliminnen und Muslimen gemeinsam erinnert und darum gesichert tradiert. Religiös motivierte Gewalt stellt demgegenüber nicht etwa eine andere und gleichermaßen gesichert tradierte Schiene des Islams dar, sondern ist ein vergleichsweise modernes Phänomen. Das erschöpft sich aber nicht im Vordergründigen, sondern muss gelesen werden als Appell an die inneren Instanzen des Menschen, die an der Textur seines Gewissens mitweben. Die Pädagogen würden hier von Kompetenzen reden: hinsehen, hinhören, den Kopf und das Herz einschalten, kritisch prüfen. Hier wäre auch von Faktoren religiöser Intelligenz zu sprechen (vgl. dazu Behr, Harry Harun: Islamische Bildungslehre. Garching 1998). Dabei rät Muhammad zum sicheren Weg: „Lass was dich zweifeln lässt, und halte dich an das was dich nicht zweifeln lässt“ (Sammlungen Tirmidhī und Nasā’ī). Was folgt daraus? In Situationen, in denen sich der Mensch nicht auf ein bestimmtes Format religiöser, personaler und sozialer Identität festlegen lassen will, kann es zu konkurrierenden Handlungsoptionen kommen. Hier will der Islam Hilfestellung dazu geben, keine schweren Fehler zu machen. Die Kriterien für das, was als „sicher“ gelten darf, sollen deshalb im Islam geerdet sein, zum Beispiel in den fundamentalen Leitprinzipien des Korans für das soziale Handeln: Nutzen statt Schaden, Gewinn statt Verlust, Frieden statt Gewalt, Freude statt Leid. Der unreflektierte, bloß formalistische Zugriff auf eine bestimmte religiöse Norm ist jedenfalls nicht immer das Gebot der Stunde. Die damit verbundenen Lernziele des Islamischen Religionsunterrichts gründen vielmehr in der Fähigkeit, sich in die Lage anderer versetzen zu können und diejenige Form von Gelassenheit zu entwickeln, die im Selbstvertrauen und im Zutrauen in Gott ruht (arab. tawakkul). Aber auch im Stehvermögen (arab. sabr, qiyām), wenn es zum Konflikt kommt zwischen einerseits divergierenden Erwartungshorizonten beziehungsweise vorfindlichen Situationen und andererseits den eigenen moralischen und ethischen Standards. Theologisch gewendet lautet die Frage: Wofür möchte ich einstehen am Tage der Begegnung mit Gott, meinem allumfassenden Mit-Wisser? Die situative Angemessenheit Der Islam kennt das Prinzip der Passung im Sinne der Angemessenheit einer Sache mit Blick auf ihre vorfindliche Situation. Als Fachbegriff dafür findet das arabische Wort maslaha in theologischen Texten Verwendung (vgl. zum Beispiel Ünal, Halit: Al-Farūq cUmar ibn al-Khattāb. Köln 1986). Situationen werden aber von Subjekten, mithin unterschiedlich wahrgenommen und beispielsweise als „krisenhaft“ oder in anderer Weise bewertet. Eine Anrufung Gottes aus dem Koran wie „Lade uns nicht auf was wir nicht tragen können“ (lā tuhammilnā mā lā tāqata lanā bih; 2:286) verweist deshalb, trotz des grammatikalischen Plurals im Prädikat, auf die subjektiven und situativen Aspekte. Damit geizt der Koran nicht gerade, weshalb sich die Philosophen unter den Muslimen die Anmerkung gestatteten, dass es sich bei Paradies und Hölle wohl nicht um weit entfernte Orte, sondern eher um subjektive Zustände handeln müsse. Muss es soweit gehen? Das kommt darauf an. Vielleicht ja, wenn eine muslimische Schülerin im Islamischen Religionsunterricht anmerkt, sie wolle lieber nicht ins Paradies, wenn sie dort ihren Eltern wieder begegnen, sondern in die Hölle; da befinde sie sich ohnehin schon. Was immer der Islam dieser Fünfzehnjährigen zu sagen hätte, muss auf ihre Situation bezogen sein, und zwar, um genau zu sein, auf die Verbesserung ihrer Situation. Dazu kommen wir aber noch. Im semantischen Umfeld obiger Aussage des Korans findet sich ein weiterer viel zitierter Teilsatz: „Gott fordert von keinem mehr, als er schaffen kann“ (lā yukalliful-lāhu nafsan illā wuscahā; 2:286). Was das seelsorgerliche Gespräch angeht, hat dieser Satz sowohl therapeutisches als auch destruktives Potenzial – jedenfalls wenn er nur als Klausel des Bundes zwischen Gott und dem Menschen gelesen wird. Ihn als Handlungsanweisung zu lesen verleiht 5 der Sache allerdings einen anderen Drall: Hab im Blick, was dein Gegenüber leisten kann, und überfordere es nicht; hab im Blick, was du selbst leisten kannst, und überlaste dich nicht! Als maßgebliche Ursache für Schaden, Verlust, Gewalt und Unglück, und was uns sonst belastet, nennt der Koran zuerst die Hand des Menschen (vgl. 7:56, 10:14, 30:41-42, 65:8-9; und: „jeder soll selbst zusehen, was er für morgen vorausschickt“; 59:18). Es sich und anderen nicht unnötig schwer zu machen gilt im Islam auch dort als ein Prinzip, wo es ansonsten wenig Verhandlungsmasse gibt, nämlich bei gottesdienstlichen Handlungen im engeren, kultischen Sinne: die Verpflichtung zum Gebet oder zum Fasten; hier sind Verkürzung, Verschiebung, Ersatz oder sogar ersatzlose Befreiung möglich. Das sollte spätestens dann nachdenklich stimmen, wenn religiöse Regeln dort ohne Not restriktiv ausgelegt werden, wo es nicht mal um den engeren, kultischen Rahmen geht: tradierte Vorstellungen von der Rolle der Geschlechter, Alltagstheorien zur häuslichen Erziehung, Einstellungen zu Menschen anderer Religion oder zu anders denkenden Muslimen. Die Verbesserung der Lage Der Koran erinnert daran, dass Kopf und Herz, Zunge und Hand in Einklang gebracht werden wollen. Zu demjenigen Menschen zu werden, der man ist, und dabei der zu sein, der man sein will, und dabei Glauben und gutem Handeln den ihnen angemessenen Ausdruck zu verleihen, das ist das große Lernziel der Schule des Lebens (vgl. im Koran 61:2). Diese Forderung kann Angst einjagen. Abgefedert wird sie, und hier wird die Bedeutung dieser zweiten Quelle des Islams für die Koraninterpretation deutlich, durch ein berühmtes Prophetenwort: Nimm Anteil, mach den Mund auf, tu was! Herz, Mund und Hand werden hier diachronisiert – im Originaltext in umgekehrter Reihenfolge: Wenn du nichts tun kannst, dann sag was, und wenn du nichts sagen kannst, dann bleibt noch dein Herz. Der Aspekt der inneren Anteilnahme als letztgenannter wird zur Mindestforderung. Gleichgültigkeit und Kälte als Unterschreitung dieses Standards verweisen auf die Erkrankung des Herzens (vgl. im Koran z.B. 2:10) im Sinne einer ernst zu nehmende Krise. Das ist wieder ein fundamentales Leitprinzip des Islams, und zwar nicht nur für die sozialethischen Belange, sondern auch für theologische Schlüsselfragen wie beispielsweise diejenige nach Gott: Wer ist er, und was will er? Einige ideologische Strömungen des heutigen Islams berufen sich auf den koranischen Leitsatz vom tätigen Einsatz für das Gute und gegen das Schlechte (al-’amr bil-macrūf wan-nahi canil munkar; 3:110), also auf einen der handlungsleitenden Imperative des Korans, die darauf abzielen, die Lage der Menschen zu verbessern. Allerdings tragen Muslime dann zu Verschlechterung ihrer Lage bei, wenn sie sich bei der Umsetzung nicht von Vernunftargumenten leiten lassen. Schwierig wird es nämlich mit der Vernunft für denjenigen, der sich von Obedienz gegenüber seiner eigenen, in der Regel erratischen Rekonstruktion von Gott und seinem Propheten beherrschen lässt. Das Beharren auf dem wortwörtlichen Schriftverständnis und auf der prophetischen Tradition als vermeintlichem Abbild historischer Wirklichkeit birgt die Gefahr, den Islam anstelle von Gott anzubeten. Und hier ist liegt ein entscheidendes Argument: Warum tun denn die Menschen, so der Koran, mit ihren Händen Dinge, deren Folgen sie schmerzhaft zu spüren bekommen? Warum belasten sie sich selbst mit Dingen, mit denen Gott sie niemals belasten würde? Sie haben ihn und die Hoffnung an ihn aus den Augen verloren. Sie mögen an ihn glauben, aber sie glauben ihm nicht. Darin liegt die „Abkehr“ von Gott (arab. kufr ), und zwar nicht als das Stigma vermeintlicher Ungläubiger, sondern als das Signé der religiösen Verunsicherung von Musliminnen und Muslimen. Was tun? Gefordert ist die „Umkehr“ zu Gott (arab. tauba), bis er wieder so im Gesichtsfeld erscheint wie er sein will: als Zugewandter (vgl. im Koran 6:79 und 25:71). Toleranz, und um die geht es ja, ist schließlich nur möglich, wenn man sich dort auf einen verlassen kann wo alle anderen versagen, wenn es nämlich nur noch ums Aushalten geht, im Sinne der Ursprungsbedeutung von tolerare. Dem Fundamentalisten fehlt 6 diese Kraft, Unwägbarkeiten und Ungewissheiten zu ertragen, und den eigenen Zweifel erträgt er schon gar nicht. Der Respekt vor dem Anderen Hier geht es um die Öffnung hin zur Gesellschaft, um gelebten Pluralismus. Das hat nicht allein mit Pragmatismus zu tun, sondern stellt neben der Relativität des Eigenen einen zweiten theologisch normativen Aspekt des Islams dar. Dazu ein paar grundlegende Anmerkungen, die den Bezug zur speziellen Frage des religiösen Pluralismus deutlich machen sollen. Die Pluralismusproblematiken mit Blick auf die moderne Gesellschaft sind komplex. Das so genannte Unbehagen in und an der Modernität ist ein gängiges sozialwissenschaftliches Thema im Rahmen einer eher kritischen Sicht auf die Moderne (vgl. dazu Berger, Peter L., Brigitte Berger, und Hansfried Kellner: Das Unbehagen in der Modernität. Frankfurt 1975; Bell, Daniel: Die kulturellen Widersprüche im Kapitalismus. Frankfurt 1991; Kolakowski, Leszek: Die Moderne auf der Anklagebank. Zürich, Stuttgart 1991; Baumann, Zygmunt: Das Unbehagen in der Postmoderne. Hamburg 1999). Was als tolerante religiöse Orientierung firmiert, stellt für sich genommen noch kein Rezept für die Bewältigung aller Schwierigkeiten der postmodernen Gesellschaft dar, vor allem nicht für ihren zwanghaft anmutenden Umgang mit vorfindlicher Heterogenität und erforderlicher Pluralität. Man darf aber festhalten, dass die Bejahung von Pluralität durch das subjektfähige Individuum ein Grunderfordernis für den sozialen Frieden darstellt. Die Motive für eine derartige Bejahung mögen vielfältig sein, die religiösen jedenfalls gehören dazu. Ob sie notwendige oder gar die allein hinreichenden sind, darüber kann man streiten. Muslime sind nicht die besseren Christen Es gibt eine paradigmatische Lesart koranischer Prophetologie, die Heilung verheißt, letztlich aber zur religiösen Vergiftung führt: Gemeint ist die wohlmeinende Eingliederung von Abraham, Moses und Jesus in einen als pluralistische Theologie verbrämten Inklusivismus. Der findet sich schließlich auch in Lehrplanentwürfen für den Islamischen Religionsunterricht an der öffentlichen Schule in Deutschland – manchmal sehr deutlich, manchmal eher unterschwellig. Muhammad, so steht unterm Strich, habe ja keine Neuigkeiten verbreitet, sondern sei eigentlich mit der ursprünglichen und allein schon deshalb wahren Religion gekommen, der Religion aller von Gott Gesandten. Wenn der Koran auf diese Art eine theologische Prototypik der Altpropheten anstelle ihrer Genealogie in den Blick rückt, ist das eine Sache (vgl. 2:136, 3:84, 29:46, 35:31); wenn jüdische und christliche Theologien als nicht authentisch besiegelt werden, eine andere. Letzteres ist im Verlauf der islamischen Theologiegeschichte fast zum Dogma geworden, und zwar verstärkt durch den apologetischen Reflex des Christentums auf den Islam als lästiges nachgeborenes Geschwisterkind. Dieser Exklusivismus könnte nachgerade als die Ursache für den Inklusivismus gelten, was das Risiko birgt, dass jede vereinnahmende Annäherung als unbotmäßig empfunden und hart abgewehrt wird, und zwar durch Ausschluss. So wie Kinder eben sind. Die Kritik an der Sache ist also klar (vgl. auch Kandil, Fuad: Religiöser Pluralismus als Problem für die Selbstgewissheit. Zwei Ansätze zur subjektiven Verarbeitung des Problems im Koran. In: Johannes Lähnemann (Hg.): Interreligiöse Erziehung 2000. Die Zukunft der Religions- und Kulturbegegnung. Hamburg 1998. Seiten 79-90). Was bedeutet das für den Pluralisierungsdiskurs? Besondere Lernschritte in der Sache des religiösen Pluralismus, nämlich „einen theologisch verantwortbaren Weg zu gehen, der es gestattet, die Wahrheit der anderen Religion zu akzeptieren, ohne die Wahrheit der eigenen Religion und damit die eigene Identität preiszugeben“ (Zehner, Joachim: Der notwendige Dialog. Die Weltreligionen in katholischer und evangelischer Sicht. Gütersloh 1992. Seite 24). 7 Gott will mehr Ein weiteres koranisches Paradigma deutet auf den religiösen Pluralismus nicht nur als Gebot der Stunde, sondern als fundamentales Element islamischer Theologie unabhängig von sozialen oder politischen Erfordernissen: Die Vielfalt der Religionen unter den Menschen auf dieser Erde ist gottgewollt – wie auch die Vielfalt der religiösen Vorstellungen innerhalb eines sichtbaren Systems religiöser Weltdeutung. Das heißt: Gott lässt religiösen Pluralismus nicht nur zu, sondern er hat ihn so vorgesehen, und: Gott duldet nicht nur die Meinungsvielfalt unter Muslimen, sie ist nachgerade eine Notwendigkeit für den Fortschritt in der Theologie. Wo keine Meinungsverschiedenheit, da kein Diskurs. Einer der diesbezüglichen arabischen Fachbegriffe in der islamischer Theologie lautet ikhtilāf, womit weniger die Unversöhnlichkeit als vielmehr eine Notwendigkeit beschrieben ist, die Muhammad einschlägigen Überlieferungen zufolge auch als „Segen für meine Gemeinschaft“ beschrieben haben soll. Gleich mehrere Textstellen des Korans stehen hier zur Verfügung, zum Beispiel 11:118, 10:99, 16:93 oder 42:8. Koranverse wie 30:20-23 oder 49:13 deuten dabei auch auf andere Sektoren hin, in denen der Islam für Offenheit anstelle von Torschluss plädiert, nämlich die Zugehörigkeit zu einer ethnischen, sprachlichen oder kulturellen Gemeinschaft, ungeachtet der formalen Religionszugehörigkeit. Verse wie 2:272 weisen zudem darauf hin, dass die Frage von Rechtleitung und Gnade die Angelegenheit Gottes sind und nicht die des Gesandten, geschweige denn die seiner Zeitgenossen oder seiner Nachfahren. Also gilt auch für die Muslime hier und heute als Direktive: Die Vielfalt der Modi, in denen Menschen mit der Gottesfrage umgehen, auch ihr Recht auf Ablehnung oder Unentschiedenheit, sind nicht nur normal, sie sind gut, da der Koran darauf abzielt, das Gute zu bewirken. Ebenso normal ist, dass es zwischen Angehörigen unterschiedlicher Religionen oder zwischen Andersdenkenden innerhalb eines religiösen System zu Konflikten kommt. Es gehört zu den grundlegenden Kompetenzen, die der Religionsunterricht einüben muss, mit derartigen Konflikten umzugehen. Dass es in Sachen Religion aber auch zu gewaltsam ausgetragenen Eskalationen kommen kann, ist nicht normal und auch nicht vom Islam gewollt. Wenn also der Islamische Religionsunterricht auf die pädagogische Dimension der Selbstgewissheit abzielt, dann darf er das nicht tun, indem er Menschen anderer Religionszugehörigkeit abwertet. Die Stärke des Eigenen darf sich nicht konstituieren, indem die vermeintliche Schwäche des Anderen konstruiert wird; Identität auf der Grundlage von Gegenidentität bleibt schwach (vgl. dazu Bar-On, Dan: Die „Anderen“ in uns. Dialog als Modell der interkulturellen Konfliktbewältigung. Sozialpsychologische Analysen zur kollektiven israelischen Identität. Hamburg 2001). Da Lebenserfahrungen im Kontext von Migration zu einem Gutteil mit Verunsicherung zu tun haben, steht der Islamische Religionsunterricht vor einer besonderen Herausforderung: Seine Adressaten sind tendenziell verlustängstlich, was ihre Religion, Lebensweise und Kultur angeht. Zum Schluss Der Islamische Religionsunterricht soll einerseits theologisch fundiert informieren. Das geht nicht ohne den Einbezug grundlegender koranischer Paradigmen. Andererseits soll er die soziale Situation muslimischer Schülerinnen und Schüler aufgreifen und sinnvoll an Fragen der religiösen Orientierung entlangführen – durchaus mit emanzipatorischem und aufklärerischem Ethos, aber frei von jedwedem zwanghaften Versuch der Entfremdung. Es geht hier vielmehr um Kompetenzen im Umgang mit Differenz und die Bejahung von Pluralität in den Lebensentwürfen, auch denjenigen religiöser Natur. Hierin kann der Islamische Religionsunterricht Vorreiter sein, was die Belange der Integration angeht. Die gelingt nur, indem aufgezeigt und eingeübt wird, was besser hilft den Alltag zu bewältigen und das Leben zu bereichern. Die Schülerinnen und Schüler sollen also dazu befähigt werden, theologisch begründete und an der Vernunft gemessene Standards des Islams in ihren Fundus an selbst8 verständlichen Überzeugungen zu integrieren. Das ist keine Hausaufgabe für die Muslime allein, sondern es geht um multilaterale Prozesse; alle müssen ein bisschen nachsitzen. Auf allen Seiten müssen irrtümliche Überzeugungen und Gewohnheiten widerlegt und überwunden werden, denn „es gibt keine umfassende und konsistente Alltagstheorie, die den gesamten Prozess der Wanderung begleitet“ (Hoffmann, Lutz: „Wir machen alles falsch.“ Wie türkische Jugendliche mit ihrer Lage in der Bundesrepublik auseinandersetzen. Bielefeld 1981. Seite 30). Die Schaffung eines übergeordneten Normensystems ist sowieso Teil jugendlicher Bewältigungsaufgaben, sie ist zudem besondere Herausforderung im Kontext von Migration und danach, sie ist dem Islam seit der Frühzeit seiner Theologie vertraut und sie ist Gegenstand des öffentlichen Diskurses in der freiheitlichen und demokratisch verfassten Zivilgesellschaft. Vorausgesetzt es tritt nicht die vom französischen Politologen und Islamismusexperten Gilles Kepel (Die neuen Kreuzzüge. München 2005) befürchtete „Verweigerung der Zugehörigkeit“ ein, kann der Islamische Religionsunterricht dies zusammenzuführen. Soviel zu seiner bildungspolitischen Agenda. Dabei die Verbesserung der Lebenssituation muslimischer Schülerinnen und Schüler, ihr Glück und die Würde ihrer Personen im Blick zu haben ist sein pädagogisches Programm. Und sein religiöses? Das steht im Koran, in 89:27-30. 9