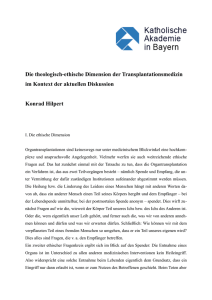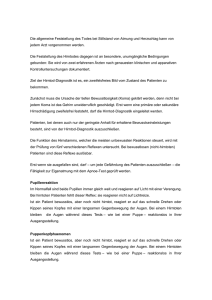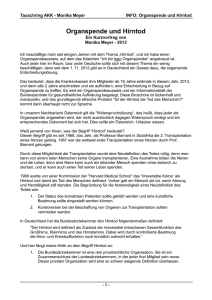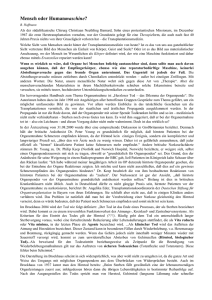Hirntod
Werbung
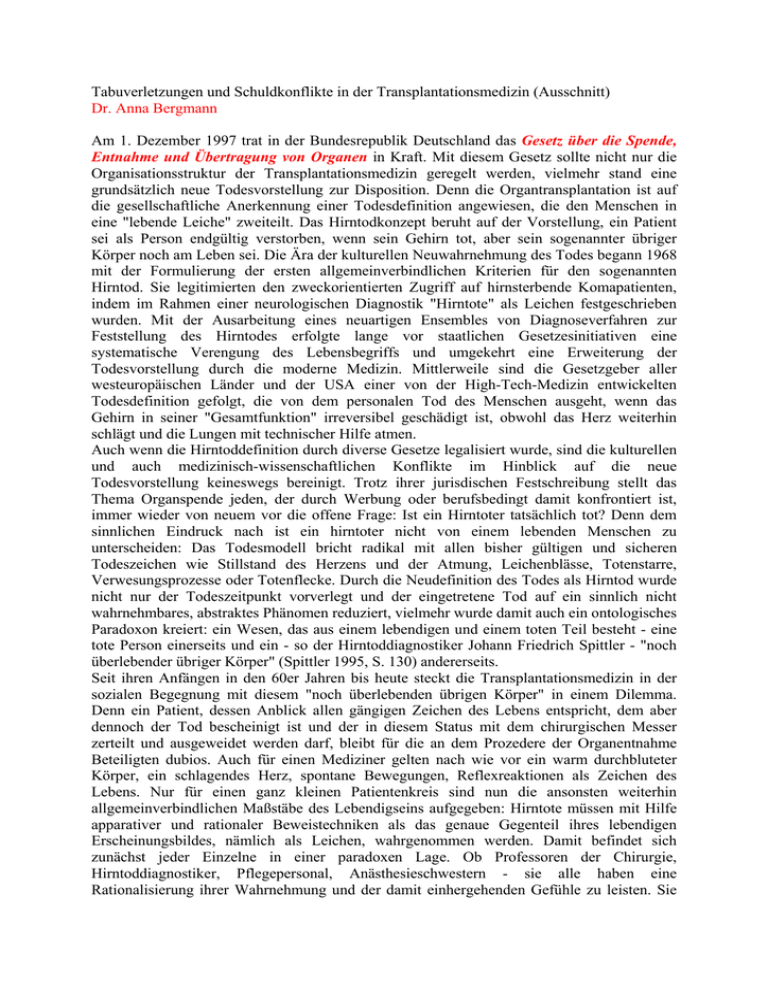
Tabuverletzungen und Schuldkonflikte in der Transplantationsmedizin (Ausschnitt) Dr. Anna Bergmann Am 1. Dezember 1997 trat in der Bundesrepublik Deutschland das Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen in Kraft. Mit diesem Gesetz sollte nicht nur die Organisationsstruktur der Transplantationsmedizin geregelt werden, vielmehr stand eine grundsätzlich neue Todesvorstellung zur Disposition. Denn die Organtransplantation ist auf die gesellschaftliche Anerkennung einer Todesdefinition angewiesen, die den Menschen in eine "lebende Leiche" zweiteilt. Das Hirntodkonzept beruht auf der Vorstellung, ein Patient sei als Person endgültig verstorben, wenn sein Gehirn tot, aber sein sogenannter übriger Körper noch am Leben sei. Die Ära der kulturellen Neuwahrnehmung des Todes begann 1968 mit der Formulierung der ersten allgemeinverbindlichen Kriterien für den sogenannten Hirntod. Sie legitimierten den zweckorientierten Zugriff auf hirnsterbende Komapatienten, indem im Rahmen einer neurologischen Diagnostik "Hirntote" als Leichen festgeschrieben wurden. Mit der Ausarbeitung eines neuartigen Ensembles von Diagnoseverfahren zur Feststellung des Hirntodes erfolgte lange vor staatlichen Gesetzesinitiativen eine systematische Verengung des Lebensbegriffs und umgekehrt eine Erweiterung der Todesvorstellung durch die moderne Medizin. Mittlerweile sind die Gesetzgeber aller westeuropäischen Länder und der USA einer von der High-Tech-Medizin entwickelten Todesdefinition gefolgt, die von dem personalen Tod des Menschen ausgeht, wenn das Gehirn in seiner "Gesamtfunktion" irreversibel geschädigt ist, obwohl das Herz weiterhin schlägt und die Lungen mit technischer Hilfe atmen. Auch wenn die Hirntoddefinition durch diverse Gesetze legalisiert wurde, sind die kulturellen und auch medizinisch-wissenschaftlichen Konflikte im Hinblick auf die neue Todesvorstellung keineswegs bereinigt. Trotz ihrer jurisdischen Festschreibung stellt das Thema Organspende jeden, der durch Werbung oder berufsbedingt damit konfrontiert ist, immer wieder von neuem vor die offene Frage: Ist ein Hirntoter tatsächlich tot? Denn dem sinnlichen Eindruck nach ist ein hirntoter nicht von einem lebenden Menschen zu unterscheiden: Das Todesmodell bricht radikal mit allen bisher gültigen und sicheren Todeszeichen wie Stillstand des Herzens und der Atmung, Leichenblässe, Totenstarre, Verwesungsprozesse oder Totenflecke. Durch die Neudefinition des Todes als Hirntod wurde nicht nur der Todeszeitpunkt vorverlegt und der eingetretene Tod auf ein sinnlich nicht wahrnehmbares, abstraktes Phänomen reduziert, vielmehr wurde damit auch ein ontologisches Paradoxon kreiert: ein Wesen, das aus einem lebendigen und einem toten Teil besteht - eine tote Person einerseits und ein - so der Hirntoddiagnostiker Johann Friedrich Spittler - "noch überlebender übriger Körper" (Spittler 1995, S. 130) andererseits. Seit ihren Anfängen in den 60er Jahren bis heute steckt die Transplantationsmedizin in der sozialen Begegnung mit diesem "noch überlebenden übrigen Körper" in einem Dilemma. Denn ein Patient, dessen Anblick allen gängigen Zeichen des Lebens entspricht, dem aber dennoch der Tod bescheinigt ist und der in diesem Status mit dem chirurgischen Messer zerteilt und ausgeweidet werden darf, bleibt für die an dem Prozedere der Organentnahme Beteiligten dubios. Auch für einen Mediziner gelten nach wie vor ein warm durchbluteter Körper, ein schlagendes Herz, spontane Bewegungen, Reflexreaktionen als Zeichen des Lebens. Nur für einen ganz kleinen Patientenkreis sind nun die ansonsten weiterhin allgemeinverbindlichen Maßstäbe des Lebendigseins aufgegeben: Hirntote müssen mit Hilfe apparativer und rationaler Beweistechniken als das genaue Gegenteil ihres lebendigen Erscheinungsbildes, nämlich als Leichen, wahrgenommen werden. Damit befindet sich zunächst jeder Einzelne in einer paradoxen Lage. Ob Professoren der Chirurgie, Hirntoddiagnostiker, Pflegepersonal, Anästhesieschwestern - sie alle haben eine Rationalisierung ihrer Wahrnehmung und der damit einhergehenden Gefühle zu leisten. Sie geraten in eine schizoide Situation, in der sie nicht mehr wissen, ob sie ihren Augen oder einer Definition trauen sollen. Der Anblick von sogenannten spinalen Reflexen hat die Transplantationskoordinatorin Frauke Vogelsang - wie sie sagt - "erst einmal erschreckt. Ich glaube, wenn ich nicht das, Wissen gehabt hätte, hätte ich emotional gesagt: 'Der bewegt sich noch und hebt die Arme, er kann doch gar nicht tot sein."' Wie ein solches motorisches Verhalten eines hirntoten Menschen während seiner Organentnahme wahrgenommen werden kann, erklärt die Anästhesieschwester Margot Worm. Sie schildert die Angst, die ein sich bewegender toter Mensch im Operationssaal in ihr auslöst: "Wenn man daneben steht und ein Arm kommt von einem Toten hoch und fasst einen so an den Körper oder um den Körper. Das ist furchterregend." Manche gewöhnen sich mit der Zeit an diese Vorstellung von Tod, andere wiederum sind schon während ihres Studiums "über die Definition des Hirntodes gestolpert" so die Anästhesistin Gabriele Wasmuth. Sie nehmen auch nach zwanzig oder dreißig Jahren Berufspraxis einen hirntoten Patienten nicht als Leichnam wahr. Historisch gesehen wurzelt die Entstehung einer Definition des Hirntodes in der Entwicklung technischer Wiederbelebungsverfahren. Im Zuge der künstlichen Aufrechterhaltung der Herzund Atemtätigkeit machte man in den 50er Jahren die Erfahrung, dass bei bestimmten Patienten eine technisch erzeugte und erfolgreiche Wiederbelebung des Herzens nicht zwingend den Menschen wieder zum Atmen anregen konnte. Auch das volle Bewusstsein kehrte nicht zurück, weil im Gehirn bereits Sterbeprozesse stattgefunden hatten, die den Tod des Patienten ankündigten. Diese neue Problematik infolge des Einsatzes der Herz-Lungen-Maschine löste eine internationale Diskussion unter Kardiologen und Anästhesiologen über die Frage aus, ab wann die künstliche Beatmung eingestellt werden dürfe, auch wenn das Herz des Patienten noch schlägt. Die ersten Diskussionsbeiträge zu diesem Problem wurden Ende der 50er Jahre vorgelegt (vgl. Mollaret/Goulon 1959). Das Verständnis des "Hirntods" schloss zu diesem Zeitpunkt den Tod des zentralen Nervensystems noch mit ein, so dass er noch als der Verlust aller Reflexe gekennzeichnet wurde. Die Entwicklung der Hirntoddefinition stand insofern anfänglich im Zeichen einer gänzlich anderen Fragestellung: Es ging ausschließlich um die medizinische Behandlung und das Schicksal einer durch die Intensivmedizin neuartig entstandenen Gattung von Komapatienten. Ab welchem Zeitpunkt befindet sich ein künstlich beatmeter Komapatient unwiederbringlich im Sterben, so dass Wiederbelebungsmaßnahmen im Sinne des Patienten unsinnig würden? Es ist also wichtig festzuhalten, dass der Hirntod ursprünglich von der Intensivmedizin als Problem aufgeworfen wurde, um die Grenze zu ermitteln, ab wann therapeutische Bemühungen gegenüber einem hirnsterbenden Menschen beendet werden dürfen. Die ethisch höchst prekäre Überlegung, ab wann bestimmte Komapatienten als verstorbene Menschen definiert und in dem zugeschriebenen Totenstatus deren Organe für die Therapie anderer Patienten nutzbar gemacht werden könnten, kam erst im Zuge der Transplantationsmedizin während der 60er Jahre auf. Dass die Hirntoddefinition nicht im Zusammenhang mit der Transplantationsmedizin entstand, darauf wird heute immer wieder gerne verwiesen, um zu unterstreichen, dass sie nicht zweckorientiert für die Bedürfnisse der Transplantationsmedizin extra erfunden wurde. Neben der aus den 50er Jahren stammenden Kategorisierung eines hirnsterbenden Komapatienten bezieht sich die heutige Transplantationsmedizin zu Unrecht auf eine zweite Grundlage, nämlich auf die von einer Kommission der Harvard University ausgearbeiteten Richtlinien für die Hirntoddiagnostik vom 5. August 1968. (Vgl. A Definition 1968) Auch dieser Kodex legte noch fest, dass der Hirntod erst dann eingetreten sei, wenn alle Reflexe und entsprechend die spontanen Bewegungen ausgefallen sind. Das heißt, in diesem Hirntodverständnis zählte die Medizin das zentrale Nervensystem morphologisch noch zum Gehirn. Diese erhebliche Differenz zwischen einem den Harvardkriterien entsprechenden Hirntoten und einem heute als hirntot geltenden Menschen wird in der Selbstdarstellung der Transplantationsmedizin immer wieder unterschlagen und ist offensichtlich selbst in den eigenen Reihen unbekannt. So bezieht sich auch der Berliner Anästhesist Wolfgang Peschke auf "den Hirntod" der 60er Jahre: "Die Hirntodvorstellung ist zirka 1968 definiert worden. Aber es gab diese Vorstellung schon viel früher." War der nach den Harvardkriterien definierte Tote zu keiner einzigen Reflexreaktion mehr fähig, so gelten mittlerweile in Europa und den USA 17 mögliche Reflexe beim Mann und 14 bei der Frau als mit der Todesdefinition als vereinbar (vgl. Binder u.a. 1979, S. 103). Laut Statistik der Transplantationsmedizin sind 75 Prozent aller Hirntoten noch in der Lage, sich zu bewegen (vgl. Schlake/Rosen o. J., S. 54). Dazu gehören beispielsweise Reflexe der unteren Extremitäten, der Fußsohle, der Achillesferse, Nacken-, Finger-, Rumpf-Beugereflexe sowie Bauch-, Vaginal-, Unterleib- oder Analreflexe, wovon 11 durch Stiche ausgelöst werden (vgl. Pendl 1986, S. 30ff.). Auch "Reaktionen auf Schmerzreize im spinalen Niveau" -also Symptome, die im Bereich der Wirbelsäule und des Rückenmarks angesiedelt werden - zählen zu den "klinischen Kriterien" des Hirntods (Ebd., S. 24). Bei der Eröffnung des Bauchfells und Hautschnitten des Organspenders kann er noch mit einer ansteigenden Herzfrequenz und höherem Blutdruck reagieren, außerdem ist mit Hautrötungen und Schweißsekretionen zu rechnen (vgl. Schwarz, 1990, S. 44f.). Auch wenn man entgegen seiner sinnlichen Wahrnehmung den "hirntoten" Patienten als einen endgültig verstorbenen Menschen anerkennt, überschreitet die Organtransplantationsmedizin das Todestabu, das den Toten vor der Bemächtigung anderer in seinem unberührbaren Status schützt. Der Patient gilt als verstorben und wird mit einem Totenschein in den Operationssaal zur Organspende gefahren. Schon per Gesetz besitzt er als Leichnam den Anspruch auf einen pietätvollen Umgang. Laut §168 "Störung der Totenruhe" schützt normalerweise das bundesdeutsche Strafgesetzbuch den Verstorbenen mit Eintritt seines Todes vor der Straftat der Leichenschändung. Wie ist dieses Recht auf Totenruhe mit dem Akt der chirurgischen Zerstückelung überhaupt vereinbar? Die Zergliederung des Organspenders in Augen, Haut, Herz, Lungen, Bauchspeicheldrüse, Luftröhre, Leber, Nieren, Gelenke, Innenohren, Kieferknochen, Dünndärme und neuerdings auch Hände und Unterarme entspricht dem Akt der Leichenschändung. Die anatomische Verstümmelung des Leichnams - sei sie auch noch so rational, wissenschaftlich und gleichermaßen christlich fundiert - stellt eine per se mit Ekel, Angst und vor allem Schuld beladene Tabuüberschreitung dar. Das heißt, normalerweise löst eine Leichensektion Gefühle von Ekel, Angst und Schuld aus. Die Überwindung und Verdrängung solcher Affekte werden gleich zu Beginn des Medizinstudiums im Sektionskurs rituell exerziert. Eine solche "Initiation", die den allerersten Patienten als Leiche vorsieht und ihn zerstückeln lehrt - so die Psychologin Christine Linkert (Linkert, 1993) -, hat das in der Explantation beteiligte Pflegepersonal in seiner beruflichen Sozialisation nicht erfahren. Während der Explantation treffen also zwei Berufsgruppen mit einer sehr konträren Beziehung zum Akt der Leichenschändung und dem sozialen Umgang mit Toten aufeinander. Ein zweites Tabu, das Tötungsverbot, wird eklatant berührt, sofern man dem Hirntodkonzept nicht glaubt. Halten die an der Organentnahme professionell beteiligten Menschen an dem Herztod als den Zeitpunkt eines abgeschlossenen Sterbeprozesses fest, der für jeden von sinnlich wahrnehmbaren Todeszeichen markiert ist, dann entsteht durch die Mitarbeit an einer Explantation ein Tötungsbewusstsein und mobilisiert Schuldgefühle. Dem Pflegepersonal gelingt die Abwehr von solchen Schuldgefühlen am wenigsten. Denn im Gegensatz zu den diversen chirurgischen Teams erfährt es die Organentnahme von Anfang bis Ende. Auch erlebt es immer das medizinisch systematisch herbeigeführte Moment des Herztodes von hirnsterbenden Patienten und die sich einstellenden Todeszeichen mit. Dieser Augenblick, in dem sich der hirnsterbende Patient in eine "richtige Leiche" verwandelt, ist von dem Pflegepersonal, das wir gesprochen haben, durchweg als ein traumatisches Ereignis geschildert worden. Denn die Transformation des Hirntoten in einen "richtigen Toten" wird systematisch vollzogen, entweder direkt durch die Herzentnahme oder - wenn das Herz nicht freigegeben oder unbrauchbar ist -wird der Patient durch einen Schnitt in die Aorta ausgeblutet. "Man weiß, der wird hier aufgelegt, und er wird hier sterben" - so die österreichische Anästhesieschwester Johanna Weinzierl: "Die Operation endet mit dem Herzstillstand." Diese Situation wird um so unerträglicher, als der Tote auch noch aufgeschnitten auf dem Operationstisch liegt und das Sterben des sogenannten Restkörpers im aufgeklappten Leibesinneren zu beobachten ist. Auch nach diesem Augenblick muss an dem Leichnam weitergearbeitet werden, und nicht jeder am Operationstisch kann - wie etwa der Herzchirurg - diese Situation fliehen. Henning Harten - Professor für Neurochirurgie in einem Transplantationszentrum - beschreibt die erste Explantation, die er erlebte: "Das ist in der Hinsicht bemerkenswert, weil pathophysiologisch etwas abläuft, was man sonst nie sehen würde. Es wird ein Organ kalt und weiß, plötzlich hören alle auf, etwas zu tun. Man steht da mit der Leiche, - komisches Gefühl." Die Anästhesieschwester Johanna Weinzierl schildert die Atmosphäre im Operationssaal: "In dieser Situation ist immer eine gewisse Spannung. Vorher ist man beschäftigt und gibt dem Patienten Medikamente, da ist etwas zu tun. Und dann kommt irgendwann der Augenblick, in dem der Patient sehr viel Blut verliert und man steht daneben und schaut zu, wie das Herz aufhört zu schlagen. Für mich ist diese Situation furchtbar. Ja, manchmal bin ich auch gegangen. Es schaut in diesem Moment so aus, als wenn ich erlebe, wie ein Patient stirbt." Der Moment des "richtigen Todes" steht von vornherein fest, denn er wird in gemeinsamer Arbeit am Operationstisch selbst erzeugt: "Man schaut zu, und das ist berechenbar. Man sieht ja, wie die Todeszeichen sich einstellen. Da ist einem der Schauer über den Rücken gelaufen." Der Krankenpfleger Georg Feldmann hat einmal, ohne es zu wollen, die vorgeschriebene Logik des Hirntodes nicht nachvollzogen und das auch noch schriftlich dokumentiert. Denn in ihm hat sich ein Tötungsbewusstsein verankert: "Es ist einfach eine unbegreifliche Sache, dass Tod durch Menschenhand geschieht. Es ist keine natürliche Todesursache. Ich habe das auch einmal auf einem Fußzettel unter 'unnatürlicher Todesursache' angekreuzt. Das war nicht so beliebt, weil es als eine 'natürliche Todesursache' durch das Unfallgeschehen definiert wird. Das hatte ich damals nicht begriffen, und die haben sich anschließend über mich dagegen beschwert." Der Akt der Organentnahme stellt einen heiklen Punkt im Ablauf der Organspende dar. Gleich mehrere Tabus werden jetzt an einem als tot definierten Menschen überschritten. Immerhin wird nach allen Regeln der medizinischen Kunst in den "lebenden Restkörper" auf eine aggressive und zerstörerische Weise eingegriffen, die einer ganz eigenen Operationslogik folgt und das Programm des Ablaufes setzt. Die Organspende steckt prinzipiell in einer schizoiden Situation: Während der Entnahme muss die enorme Spannung zwischen den zu vollziehenden Tabuverletzungen und dem Anspruch, die Illusion einer normalen Operation aufrechtzuerhalten, irgendwie bewältigt werden. Mehrere Techniken in der Arbeitsorganisation und in der Werbung für Organspende werden bemüht, um die Tabuüberschreitungen in der Transplantationsmedizin von Schuld zu entlasten, so dass diese neuartige, todesabhängige Therapieform menschlich und kulturell durchsetzbar wird.