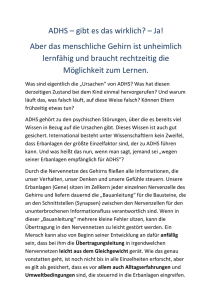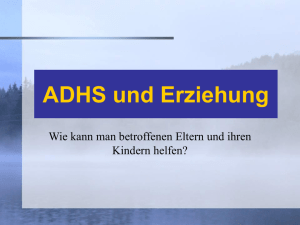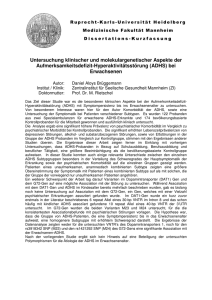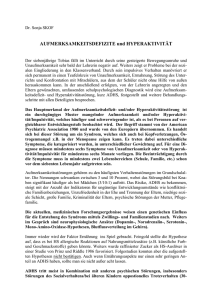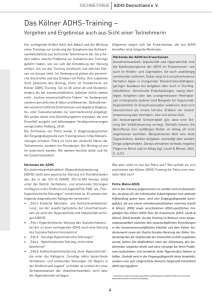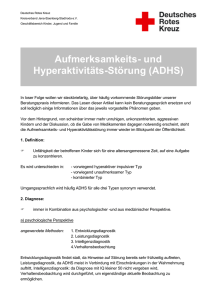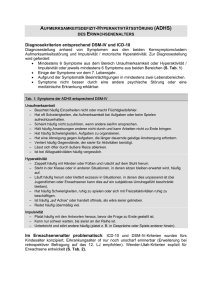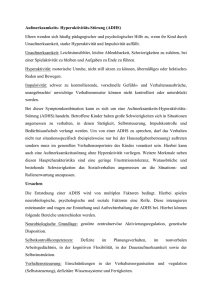ADHS im Erwachsenenalter - Forum und Chat der salus klinik
Werbung

ADHS im Erwachsenenalter Von Dr. Dietmar Kramer erschienen in der salü 1/2005 In direkter Nachbarschaft der salus klinik, nämlich in Frankfurt am Main, schenkte der Arzt Heinrich Hoffmann im Jahre 1844 seinem erstgeborenen Sohn Carl Phillip, damals drei Jahre alt, ein selbst geschriebenes Büchlein zu Weihnachten, den „Struwwelpeter“. Indem er mit dem „Zappelphillip“ seine Sorgen und Nöte mit dem – offensichtlich hyperaktiven – Sohn in einer liebenswerten Weise zu Papier brachte, beschrieb der engagierte Arzt die heute häufigste kinder- und jugendpsychiatrische Krankheit: die AufmerksamkeitsdefizitHyperaktivitätsstörung, abgekürzt ADHS. Die von dieser Erkrankung betroffenen Kinder haben eine ausgesprochene Bewegungsunruhe, können kaum ruhig sitzen, sich nur schlecht konzentrieren, sind leicht ablenkbar und impulsiv in ihrem Handeln. Viele Eltern geraten mit der Erziehung eines solchen Kindes an ihre Grenzen, in der Schule sind diese Kinder oft verhaltensauffällig. War die Vorstellung zunächst, dass sich diese Störung mit dem Erwachsenwerden der Kinder und Jugendlichen „verwächst“, kamen vor über zehn Jahren erste Berichte auf, dass dies eben nicht in allen Fällen geschieht, sondern die Störung durchaus bis ins Erwachsenenalter hinein persistieren kann. Das Time Magazine widmete dieser Erkrankung 1994 eine Titelgeschichte und benannte als wahrscheinlich Betroffene unter anderem Benjamin Franklin, Winston Churchill, Albert Einstein und Bill Clinton. Aktuelle Zahlen besagen, dass ca. 6-10 % aller Kinder an einer ADHS leiden; Jungen sind etwa 3 bis 4 mal häufiger betroffen als Mädchen. In wie vielen Fällen diese Störung bis ins Erwachsenenalter weiterbesteht, ist umstritten, die Angaben schwanken zwischen 4% und 70%. Zwischen 0,3 % bis 6% aller Erwachsenen sollen an einer persistierenden ADHS leiden. Einigkeit herrscht darin, dass ein Erstauftreten einer ADHS beim Erwachsenen nicht vorkommt, die Diagnose einer ADHS im Erwachsenenalter ein Betroffensein bereits in der Kindheit voraussetzt. Nach heutigem Wissensstand ist bei ADHS von einer komplexen Dysregulation von Neurotransmittern auszugehen, möglicherweise in Form einer Dysfunktion der präsynaptischen Wiederaufnahmekanäle (Dopamintransporter) in den Basalganglien. Als gut belegt kann eine starke genetische Komponente gelten. Es wird zur Zeit geschätzt, dass etwa 80 % der Symptomatik vererbt wird. ADHS und Abhängigkeitserkrankungen ADHS ist eine Störung, die häufig mit Begleiterkrankungen (komorbiden Störungen) einhergeht, so z.B. häufig Abhängigkeitserkrankungen. In verschiedenen Studien wurde bei 33%-44 % der erwachsenen ADHS-Patienten ein Alkoholmissbrauch beschrieben. Die Rate für Drogenabusus (insbesondere Missbrauch von Cannabis und Cocain) liegt nach Studien sogar noch darüber. Alkoholabhängige Patienten, die zusätzlich an einer ADHS leiden, beginnen nach einer Studie früher mit dem Trinken, konsumieren größere Mengen an Alkohol und weisen häufiger eine antisoziale Persönlichkeitsstörung auf als Alkoholabhängige ohne ADHS. Zwischen 15 und 32 % (!) aller Patienten, die wegen einer Alkoholabhängigkeit in Behandlung sind, sollen zusätzlich an einer ADHS leiden. Diese hohe Komorbiditätsrate wird in mehreren Studien beschrieben, spiegelt sich jedoch in keiner Weise im klinischen Alltag wider. Im Gegenteil: Die Diagnose einer ADHS bei Suchtpatienten im klinischen Alltag wird äußerst selten gestellt. Laut Basisdokumentation 2003 des Fachverbandes Sucht, in dem die Daten von 13.955 Patienten, die im Jahre 2003 eine stationäre Entwöhnungsbehandlung absolvierten, zusammengefasst werden, wurde lediglich bei 0,3% der Fälle neben der Abhängigkeitsdiagnose eine ICD-10-Diagnose aus dem Kapitel F9 gestellt, worunter auch die ADHS subsumiert wird. Wie kommt es zu dieser Diskrepanz zwischen den hohen Zahlen in den Studien und den niedrigen Zahlen in der Praxis? Entweder wird diese Störung im Klinikalltag deutlich unterdiagnostiziert oder in den beschriebenen Studien überdiagnostiziert. Dass die Störung deutlich seltener diagnostiziert wird als es aufgrund der Studien zu erwarten wäre, könnte folgende Gründe haben: • • Die Störung ist auch in Fachkreisen immer noch sehr wenig bekannt und wird daher übersehen. Noch vor ca. 10 Jahren war gängige Lehrmeinung, dass ADHS eine Erkrankung des Kinder- und Jugendalters ist und bei Erwachsenen nicht vorkommt. Es wird noch einige Zeit benötigen, bis eine ADHS im Erwachsenenalter so selbstverständlich diagnostiziert wird wie andere psychische Störungen. • • Die Störung wird in der Fülle der anderen Diagnosen übersehen. Eine ADHS geht häufig mit einer Vielzahl komorbider Störungen einher. Insbesondere sind dies Depressionen, Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen (v.a. antisoziale und emotional instabile Persönlichkeitsstörung) und Abhängigkeitserkrankungen. Wenn schon mehrere psychiatrische Diagnosen gestellt wurden, die die Mehrzahl der vorliegenden Symptome erklären, wird eine zusätzliche ADHS-Diagnose möglicherweise nicht gestellt. • • Es wird zwar an das Vorliegen dieser Diagnose gedacht, die Diagnose aber letztlich nicht gestellt, weil daraus keine therapeutischen Konsequenzen erwachsen. Entsprechend der Leitlinien soll eine ADHS im Erwachsenenalter erst dann behandelt werden, wenn der Patient in mindestens einem Lebensbereich durch die Erkrankung stark eingeschränkt ist. Da dies häufig nicht der Fall ist wäre denkbar, dass zwar nach ICDoder DSM-Kriterien die Diagnose gestellt werden könnte, dies aber – gerade weil bei diesen Patienten häufig schon mehrere psychiatrische Diagnosen vorliegen – nicht getan wird. Möglicherweise werden aber auch nur deshalb keine therapeutischen Konsequenzen gezogen, weil Unklarheiten über die therapeutischen Optionen bei Suchtpatienten mit ADHS bestehen (s. Diskussion weiter unten). Die Störung wird in den genannten Studien möglicherweise überdiagnostiziert, weil in jenen Studien aus Gründen der Reproduzierbarkeit die Diagnose ADHS häufig ausschließlich testdiagnostisch gestellt wird, meist indem der WURS (Wender Utah Rating Scale zur Beurteilung der Symptome in der Kindheit) und ein anderes Testverfahren, welches das aktuelle Vorliegen von ADHS-Symptomen im Erwachsenenalter erfragt (z.B. Brown Scales), über dem Cut-off liegen. Gemäß den Leitlinien ist die Diagnose einer ADHS aber keine testdiagnostische, sondern eine klinische. Insbesondere die möglichen Differentialdiagnosen werden durch diese Testdiagnostik zu wenig berücksichtigt. Voraussetzung für die Diagnosestellung ist laut DSM IV: „Die Symptome treten nicht ausschließlich im Verlauf einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung, Schizophrenie oder einer anderen psychotischen Störung auf und können auch nicht durch eine andere psychische Störung besser erklärt werden (z.B.affektive Störung, Angststörung, dissoziative Störung oder eine Persönlichkeitsstörung)“. Das heißt, ADHS ist eine Ausschlussdiagnose, die nur dann gestellt werden soll, wenn andere psychische Diagnosen das Krankheitsbild nicht ausreichend erklären, was möglicherweise in den Studien zu wenig berücksichtigt wird. Therapie der ADHS Wie oben schon angedeutet, stellt sich neben der Unsicherheit in der Diagnosestellung für Patienten mit Abhängigkeitserkrankungen und ADHS auch noch die Frage nach der geeigneten Therapie. Gemäß den Leitlinien wird bei ADHS im Erwachsenenalter eine „multimodale Therapie“ bestehend aus pharmakologischen und psychotherapeutischen Therapien empfohlen. Bei Kindern und Jugendlichen ist Mittel der ersten Wahl für eine ADHS-Behandlung Methylphenidat, eine amphetaminähnliche Substanz. Im Erwachsenenalter ist Methylphenydat zwar zur Behandlung einer ADHS nicht zugelassen, aber in der Literatur wird dieses Medikament auch bei Erwachsenen als Mittel der ersten Wahl bezeichnet. Die Studienlage ist nicht überwältigend groß, aber die vorliegenden Studien belegen die Wirksamkeit von Methylphenidat auch im Erwachsenenalter. Methylphenydat ist eine Substanz mit Missbrauchs- und Abhängigkeitspotential. Die Studien weisen zwar darauf hin, dass Jugendliche, die mit Methylphenidat behandelt werden, seltener an einer Sucht erkranken als Jugendliche, die dieses Medikament nicht bekommen. Es gibt allerdings wenig Informationen, wie Patienten, die bereits manifest an einer Abhängigkeitserkrankung leiden, auf dieses Medikament reagieren. Zum einen besteht natürlich die Gefahr, dass dieses Medikament gerade von dieser Personengruppe missbräuchlich konsumiert wird bis hin zur Abhängigkeit. Zum anderen ist aber auch denkbar, dass diese Menschen Alkohol oder andere Drogen im Sinne einer Selbstmedikation nutzen, um die Symptome ihrer ADHS zu bessern. Dann könnte eine Therapie der ADHS mit Methylphenidat die Abhängigkeitserkrankung sogar verbessern. Beides wurde in unserer Klinik schon beobachtet: Die Besserung der Abstinenzfähigkeit alkoholabhängiger ADHS-Patienten unter Methylphenidat, aber auch der Missbrauch von Methylphenidat im Sinne eines ständigen Drängens nach höheren und häufigeren Dosen und die Einnahme unregelmäßiger Dosen entgegen der Verordnung. Eine Alternative zu Stimulanzien stellen Antidepressiva mit noradrenerger Wirkkomponente dar (z.B. Reboxetin, Venlafaxin). Gerade bei ADHS-Patienten mit einer Abhängigkeitsproblematik wird häufig auf diese Substanzen zurückgegriffen, wobei aussagekräftige Vergleichsuntersuchungen zu einer Behandlung mit Stimulanzien aber noch ausstehen. Zur medikamentösen Therapie von Suchtpatienten mit ADHS sind daher dringend weitere Studien notwendig. Zur Psychotherapie von Patienten mit ADHS im Erwachsenenalter sind bislang keine kontrollierten Studien publiziert. Vergleichende Studien zeigen jedoch die Wirksamkeit einer störungsspezifischen Psychotherapie. Hier werden sowohl verhaltenstherapeutische als auch tiefenpsychologisch orientierte Verfahren empfohlen. Die Freiburger Arbeitsgruppe um B. Hesslinger hat kürzlich ein Therapiemanual zur Psychotherapie der ADHS vorgelegt, welches sich an der Dialektisch-Behavioralen Therapie (DBT) nach M. Linehan zur Behandlung von Patienten mit emotional instabiler Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ (Borderline-Persönlichkeits-Störung) orientiert. Grundlage der DBT ist das dialektische Balancieren zwischen Validierung und Veränderung. Damit ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den beiden Polen „Akzeptanz der Störung wie sie ist, Rückmeldung, dass die Störung nachvollziehbar und verständlich ist“ und „Arbeit in Richtung Veränderung, kontinuierliche Besserung der Symptomatik“ gemeint. Die Therapieziele werden in der DBT nach Wichtigkeit hierarchisiert. Beide Prinzipien wurden in dem Therapiemanual von Hesslinger et al. auf die Therapie einer ADHS angewandt. Übergeordnetes Therapieziel des Verfahrens ist es, dass der Patient lernt, ADHS zu kontrollieren und nicht mehr von ADHS kontrolliert zu werden. Das Verfahren wird als Gruppentherapieprogramm beschrieben und arbeitet mit 13 Modulen à zwei Stunden in wöchentlichem Abstand. Wesentliche Bestandteile sind Psychoedukation (Aufklärung über das Krankheitsbild und die Begleiterkrankungen), Erlernen von Achtsamkeitsübungen, Zeitund Organisationsplanung, Erstellen von Verhaltensanalysen in Eigenregie, Gefühlsregulation, Impulskontrolle und Stressmanagement. Eine erste Studie belegt die Wirksamkeit dieses Verfahrens. War ADHS im Erwachsenenalter in den letzten Jahren noch ziemlich unbekannt, so wird diese Erkrankung im Moment immer mehr zu einer Modediagnose: „ADHS ist in“. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Entwicklung in den nächsten Jahren auch in den Institutionen der Suchtkrankenhilfe widerspiegelt. Ein erster entsprechender Trend, dass Patienten mit dieser Störung häufiger in Suchtfachkliniken betreut werden, deutet sich an. Eine stationäre Behandlung dieser Patienten bietet sich aufgrund der hohen Komorbiditätsrate und der damit verbundenen Notwendigkeit einer mehrdimensionalen Therapiestrategie an. Symptomatik In leicht modifizierter Form übernommen aus „ADHS im Erwachsenenalter – Leitlinien auf der Basis eines Expertenkonsensus mit Unterstützung der DGPPN“, basierend auf den Wender-Utah-Kriterien der ADHS (Ebert et al., Der Nervenarzt 10, 2003; S. 939-944) 1. Aufmerksamkeitsstörung: Gekennzeichnet durch das Unvermögen, Gesprächen aufmerksam zu folgen, erhöhte Ablenkbarkeit, Schwierigkeiten, sich auf schriftliche Dinge oder Aufgaben zu konzentrieren, Vergesslichkeit, häufiges Verlieren oder Verlegen von Gegenständen wie Autoschlüssel, Geldbeutel oder der Brieftasche. 2. Motorische Hyperaktivität: Charakterisiert durch das Gefühl innerer Unruhe, Unfähigkeit, sich zu entspannen, „Nervosität“ Unfähigkeit, sitzende Tätigkeiten durchzuhalten, z. B. am Tisch still sitzen, Spielfilme im Fernsehen ansehen, Zeitung lesen, stets „auf dem Sprung“ sein, dysphorische Stimmungslagen bei Inaktivität. 3. Affektlabilität: Diese charakteristische Stimmungsstörung wird nicht im DSM-IV beschrieben. Sie besteht gewöhnlich schon vor der Adoleszenz, gelegentlich schon so lange, wie sich der Patient erinnern kann. Gekennzeichnet ist sie durch Wechsel zwischen normaler und niedergeschlagener Stimmung sowie leichtgradiger Erregung. Die niedergeschlagene Stimmungslage wird vom Patienten häufig als Unzufriedenheit oder Langeweile beschrieben. Die Stimmungswechsel dauern Stunden bis maximal einige Tage; hat das Verhalten bereits zu ernsthaften oder anhaltenden Schwierigkeiten geführt, können sie sich ausdehnen. Im Gegensatz zur „major depression“ (endogene Depression) finden sich kein ausgeprägter Interessenverlust oder somatische Begleiterscheinungen. Die Stimmungswechsel sind meist reaktiver Art, deren auslösende Ereignisse zurückverfolgt werden können. Gelegentlich treten sie aber auch spontan auf. 4. Desorganisiertes Verhalten: Aktivitäten werden unzureichend geplant und organisiert. Gewöhnlich schildern die Patienten diese Desorganisation in Zusammenhang mit der Arbeit, der Haushaltsführung oder mit schulischen Aufgaben. Letztere werden häufig nicht zu Ende gebracht, die Patienten wechseln planlos von einer Aufgabe zur nächsten und lassen ein gewisses „Haftenbleiben“ vermissen. Unsystematische Problemlösestrategien liegen vor, daneben finden sich Schwierigkeiten in der zeitlichen Organisation und Unfähigkeit, Zeitpläne oder Termine einzuhalten. 5. Affektkontrolle: Patienten (und ihre Partner) berichten von andauernder Reizbarkeit, auch aus geringem Anlass, verminderter Frustrationstoleranz und Wutausbrüchen. Gewöhnlich sind die Wutanfälle nur von kurzer Dauer. Eine typische Situation ist die erhöhte Reizbarkeit im Straßenverkehr im Umgang mit anderen Verkehrsteilnehmern. Die mangelhafte Affektkontrolle wirkt sich nachteilig auf Beziehungen zu Mitmenschen aus. 6. Impulsivität: Einfache Formen hiervon sind Dazwischenreden, Unterbrechen anderer im Gespräch, Ungeduld, impulsiv ablaufende Einkäufe und das Unvermögen, Handlungen im Verlauf zu protrahieren, ohne dabei Unwohlsein zu empfinden. 7. Emotionale Überreagibilität: Patienten sind nicht in der Lage, adäquat mit alltäglichen Stressoren umzugehen, sondern reagiert überschießend oder ängstlich, sie beschreiben sich selbst häufig als schnell „belästigt“ oder gestresst.