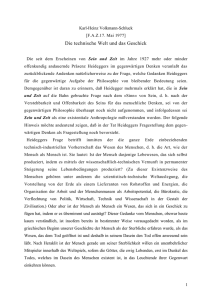35 - Theologische Fakultät Paderborn
Werbung
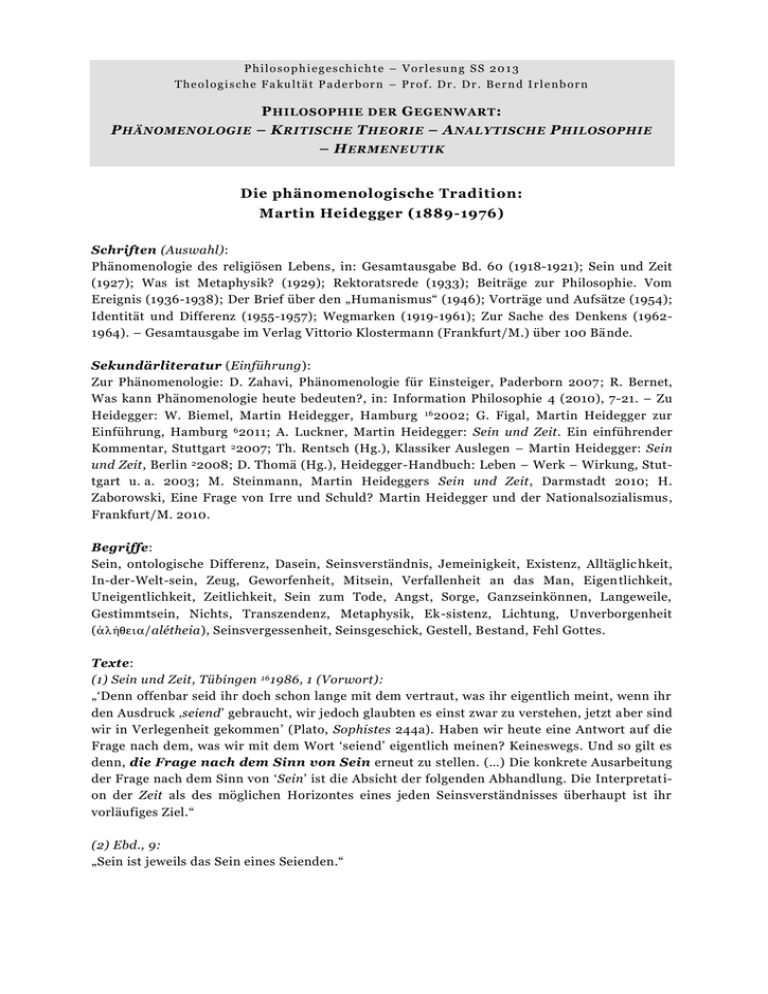
P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t e – V or l e s u n g S S 2 0 1 3 T h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t P a d e r b or n – P r o f . D r . D r . B e r n d I r l e n b or n P HILOSOPHIE DER G EGENWART : P HÄNOMENOLOGIE – K RITISCHE T HEORIE – A NALYTISCHE P HILOSOPHIE – H ERMENEUTIK Die phänomenologische Tradition: Martin Heidegger (1889-1976) Schriften (Auswahl): Phänomenologie des religiösen Lebens, in: Gesamtausgabe Bd. 60 (1918-1921); Sein und Zeit (1927); Was ist Metaphysik? (1929); Rektoratsrede (1933); Beiträge zur Philosophie. Vom Ereignis (1936-1938); Der Brief über den „Humanismus“ (1946); Vorträge und Aufsätze (1954); Identität und Differenz (1955-1957); Wegmarken (1919-1961); Zur Sache des Denkens (19621964). – Gesamtausgabe im Verlag Vittorio Klostermann (Frankfurt/M.) über 100 Bä nde. Sekundärliteratur (Einführung): Zur Phänomenologie: D. Zahavi, Phänomenologie für Einsteiger, Paderborn 2007; R. Bernet, Was kann Phänomenologie heute bedeuten?, in: Information Philosophie 4 (2010), 7-21. – Zu Heidegger: W. Biemel, Martin Heidegger, Hamburg 16 2002; G. Figal, Martin Heidegger zur Einführung, Hamburg 6 2011; A. Luckner, Martin Heidegger: Sein und Zeit. Ein einführender Kommentar, Stuttgart 2 2007; Th. Rentsch (Hg.), Klassiker Auslegen – Martin Heidegger: Sein und Zeit, Berlin 2 2008; D. Thomä (Hg.), Heidegger-Handbuch: Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart u. a. 2003; M. Steinmann, Martin Heideggers Sein und Zeit, Darmstadt 2010; H. Zaborowski, Eine Frage von Irre und Schuld? Martin Heidegger und der Nationalsozialismus, Frankfurt/M. 2010. Begriffe: Sein, ontologische Differenz, Dasein, Seinsverständnis, Jemeinigkeit, Existenz, Alltäglic hkeit, In-der-Welt-sein, Zeug, Geworfenheit, Mitsein, Verfallenheit an das Man, Eigen tlichkeit, Uneigentlichkeit, Zeitlichkeit, Sein zum Tode, Angst, Sorge, Ganzseinkönnen, Langeweile, Gestimmtsein, Nichts, Transzendenz, Metaphysik, Ek-sistenz, Lichtung, Unverborgenheit (¢l»qeia/alétheia), Seinsvergessenheit, Seinsgeschick, Gestell, Bestand, Fehl Gottes. Texte: (1) Sein und Zeit, Tübingen 16 1986, 1 (Vorwort): „‘Denn offenbar seid ihr doch schon lange mit dem vertraut, was ihr eigentlich meint, wenn ihr den Ausdruck ‚seiend’ gebraucht, wir jedoch glaubten es einst zwar zu verstehen, jetzt aber sind wir in Verlegenheit gekommen’ (Plato, Sophistes 244a). Haben wir heute eine Antwort auf die Frage nach dem, was wir mit dem Wort ‘seiend’ eigentlich meinen? Keineswegs. Und so gilt es denn, die Frage nach dem Sinn von Sein erneut zu stellen. (…) Die konkrete Ausarbeitung der Frage nach dem Sinn von ‘Sein’ ist die Absicht der folgenden Abhandlung. Die Interpretation der Zeit als des möglichen Horizontes eines jeden Seinsverständnisses überhaupt ist ihr vorläufiges Ziel.“ (2) Ebd., 9: „Sein ist jeweils das Sein eines Seienden.“ (3) Ebd., 41-43: „§ 9. Das Thema der Analytik des Daseins: Das Seiende, dessen Analyse zur Aufgabe steht, sind wir je selbst. Das Sein dieses Seienden ist je meines. Im Sein dieses Seienden verhält sich dieses selbst zu seinem Sein. Als Seiendes dieses Seins ist es seinem eigenen Sein überantwo rtet. Das Sein ist es, darum es diesem Seienden je selbst geht. Aus dieser Charakteristik des Daseins ergibt sich ein Doppeltes: 1. Das ‚Wesen’ dieses Seienden liegt in seinem Zu-sein. Das Was-sein (essentia) dieses Seienden muß, sofern überhaupt davon gesprochen werden kann, aus seinem Sein (existentia) begriffen werden. Dabei ist es gerade die ontologische Aufgabe zu ze igen, daß, wenn wir für das Sein dieses Seienden die Bezeichnung Existenz wählen, dieser Titel nicht die ontologische Bedeutung des überlieferten Terminus existentia hat und haben kann; existentia besagt ontol ogisch soviel wie Vorhandensein, eine Seinsart, die dem Seienden vom Charakter des Daseins wesensmäßig nicht zukommt. Eine Verwirrung wird dadurch vermieden, daß wir für den Titel existentia immer den interpretierenden Ausdruck Vorhandenheit gebrauchen und Existenz als Seinsbestimmung allein dem Dasein zuweisen. Das ‚Wesen’ des Daseins liegt in seiner Existenz. Die an diesem Seienden herausstellbaren Charaktere sind daher nicht vorhandene ‚Eigenschaften’ eines so und so ‚aussehenden’ vorhandenen Seienden, sondern je ihm mögliche Weisen zu sein und nur das. Alles Sosein dieses Seienden ist primär Sein. Daher drückt der Titel ‚Dasein’, mit dem wir dieses Seiende bezeichnen, nicht sein Was aus, wie Tisch, Haus, Baum, sondern das Sein. 2. Das Sein, darum es diesem Seienden in seinem Sein geht, ist je meines. Dasein ist daher nie ontologisch zu fassen als Fall und Exemplar einer Gattung von Seiendem als Vorhandenem. Diesem Seienden ist sein Sein ‚gleichgültig’, genau besehen, es ‚ist’ so, da ihm sein Sein weder gleichgültig noch ungleichgültig sein kann. Das Ansprechen von Dasein mu ß gemäß dem Charakter der Jemeinigkeit dieses Seienden stets das Personalpronomen mitsagen: ‚ich bin’, ‚du bist’. Und Dasein ist meines wiederum je in dieser oder jener Weise zu sein. Es hat sich schon immer irgendwie entschieden, in welcher Weise Dasein je meines ist. Das Seiende, dem es in seinem Sein um dieses selbst geht, verhält sich zu seinem Sein als seiner eigensten Möglichkeit. Dasein ist je seine Möglichkeit und es ‚hat’ sie nicht nur noch eigenschaftlich als ein Vorhandenes. Und weil Dasein wesenhaft je seine Möglichkeit ist, kann dieses Seiende in seinem Sein sich selbst ‚wählen’, gewinnen, es kann sich verlieren, bzw. nie und nur ‚scheinbar’ gewinnen. Verloren haben kann es sich nur und noch nicht sich gewonnen haben kann es nur, sofern es seinem Wesen nach mögliches eigentliches, das heißt sich zueigen ist. Die beiden Seinsmodi der Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit – diese Ausdrücke sind im strengen Wortsinne terminologisch gewählt – gründen darin, daß Dasein überhaupt durch Jemeinigkeit bestimmt ist. Die Uneigentlichkeit des Daseins bedeutet aber nicht etwa ein ‚weniger’ Sein oder einen ‚niedrigeren’ Seinsgrad. Die Uneigentlichkeit kann vielmehr das Dasein nach seiner vollsten Konkretion bestimmen in seiner Geschäftigkeit, Angeregtheit, Interessiertheit, Genußfähigkeit.“ (4) Ebd., 126: „Das Dasein steht als alltägliches Miteinandersein in der Botmäßigkeit der Anderen. Nicht es selbst ist, die Anderen haben ihm das Sein abgenommen. Das Wer ist nicht dieser und nicht jener, nicht man selbst und nicht einige und nicht die Summe aller. Das ‚Wer‘ ist das Neutrum, das Man.“ (5) Ebd., 258f.: „Der Tod als Ende des Daseins ist die eigenste, unbezüglichste, ge wisse und als solche unbestimmte, unüberholbare Möglichkeit des Daseins.“ 2 (6) Was ist Metaphysik? (in: Wegmarken, Frankfurt/M. 1978, 109-117): „() So sicher wir nie das Ganze des Seienden an sich absolut erfassen, so gewiss finden wir uns doch inmitten des irgendwie im Ganzen enthüllten Seienden gestellt. Am Ende besteht ein wesenhafter Unterschied zwischen dem Erfassen des Ganzen des Seienden an sich und dem Sichbefinden inmitten des Seienden im Ganzen. Jenes ist grundsätzlich unmöglich. Dieses geschieht ständig in unserem Dasein. Freilich sieht es so aus, als hafteten wir gerade im alltäglichen Dahintreiben je nur an diesem oder jenem Seienden, als seien wir an diesen oder jenen Bezirk des Seienden verloren. So aufgesplittert der Alltag erscheinen mag, er behält immer noch das Seiende, wenngleich schattenhaft, in einer Einheit des »Ganzen«. Selbst dann und eben darin, wenn wir mit den Dingen und uns selbst nicht eigens beschäftigt sind, übe rkommt uns dieses »im Ganzen«, z. B. in der eigentlichen Langeweile. Sie ist noch fern, wenn uns lediglich dieses Buch oder jenes Schauspiel, jene Beschäftigung oder dieser Müßi ggang langweilt. Sie bricht auf, wenn »es einem langweilig ist«. Die tiefe Langeweile, in den Abgrü nden des Daseins wie ein schweigender Nebel hin- und herziehend, rückt alle Dinge, Menschen und einen selbst mit ihnen in eine merkwürdige Gleichgültigkeit zusammen. Diese Langeweile offenbart das Seiende im Ganzen. Eine andere Möglichkeit solcher Offenbarung birgt die Freude an der Gegenwart des Daseins – nicht der bloßen Person – eines geliebten Menschen. Solches Gestimmtsein, darin einem so und so »ist«, lässt uns – von ihm durchstimmt – inmitten des Seienden im Ganzen befinden. Die Befindlichkeit der Stimmung enthüllt nicht nur je nach ihrer Weise das Seien de im Ganzen, sondern dieses Enthüllen ist zugleich – weit entfernt von einem bloßen Vorkommnis – das Grundgeschehen unseres Da-seins. Was wir so »Gefühle« nennen, ist weder eine flüchtige Begleiterscheinung unseres denkenden und willentlichen Verhaltens, noch ein bloßer verursachender Antrieb zu solchem, noch ein nur vorhandener Zustand, mit dem wir uns so oder so abfinden. Doch gerade wenn die Stimmungen uns dergestalt vor das Seiende im Ganzen führen, verbe rgen sie uns das Nichts, das wir suchen. 1 Wir werden jetzt noch weniger der Meinung sein, die Verneinung des stimmungsmäßig offenbaren Seienden im Ganzen stelle uns vor das Nichts. Dergleichen könnte entsprechend ursprünglich nur in einer Stimmung geschehen, die ihrem eigensten Enthüllungssinne nach das Nichts offenbart. Geschieht im Dasein des Menschen ein solches Gestimmtsein, in dem er vor das Nichts selbst gebracht wird? Dieses Geschehen ist möglich und auch wirklich - wenngleich selten genug - nur für Augenblicke in der Grundstimmung der Angst. Mit dieser Angst meinen wir nicht die recht häufige Ängstlichkeit, die im Grunde der nur allzu leicht sich einstellenden Furch tsamkeit zugehört. Angst ist grundverschieden von Furcht. Wir fürchten uns immer vor diesem oder jenem bestimmten Seienden, das uns in dieser oder jener bestimmten Hinsicht bedroht. Die Furcht vor fürchtet jeweils auch um etwas Bestimmtes. Weil der Furcht diese Begrenztheit ihres Wovor und Worum eignet, wird der Fürchtende und Furchtsame von dem, worin er sich befindet, festgehalten. Im Streben, sich davor - vor diesem Bestimmten - zu retten, wird er in bezug auf Anderes unsicher, d. h. im Ganzen »kopflos«. Die Angst lässt eine solche Verwirrung nicht mehr aufkommen. () In der Angst - sagen wir - »ist es einem unheimlich«. Was heißt das »es« und das »einem«? Wir können nicht sagen, wovor einem unheimlich ist. Im Ganzen ist einem so. Alle Dinge und wir selbst versinken in eine Gleichgülti gkeit. () Es bleibt kein Halt. Es bleibt nur und kommt über uns - im Entgleiten des Seienden - dieses »kein«. Die Angst offenbart das Nichts. Hintergrund dieser Suche im vorangehenden Text von Was ist Metaphysik?: „() Erforscht werden soll nur das Seiende und sonst - nichts; das Seiende allein und weiter - nichts; das Seiende einzig und darüber hinaus - nichts. Wie steht es um dieses Nichts? Ist es Zufall, dass wir ganz von selbst so spr echen? Ist es nur so eine Art zu reden - und sonst nichts? Allein was kümmern wir uns um dieses Nichts? ()“ 1 3 () In der hellen Nacht des Nichts der Angst ersteht erst die ursprüngliche Offenheit des Seienden als eines solchen: dass es Seiendes ist - und nicht Nichts. Dieses von uns in der Rede dazugesagte »und nicht Nichts« ist aber keine nachgetragene Erklärung, sondern die vor gängige Ermöglichung der Offenbarkeit von Seiendem überhaupt. Das Wesen des Nichts liegt in dem: es bringt das Da-sein allererst vor das Seiende als ein solches. () Da-sein heißt: Hineingehaltenheit in das Nichts. Sich hineinhaltend in das Nichts ist das Dasein je schon über das Seiende im Ganzen hinaus. Dieses Hinaussein über das Seiende nennen wir die Transzendenz. Würde das Dasein im Grunde seines Wesens nicht transzendieren, d. h. jetzt, würde es sich nicht im vorhinein in das Nichts hineinhalten, dann könnte es sich nie zu Seiendem verhalten, also auch nicht zu sich selbst. () Die Hineingehaltenheit des Daseins in das Nichts auf dem Grunde der verborgenen Angst macht den Menschen zum Platzhalter des Nichts. So endlich sind wir, dass wir gerade nicht durch eigenen Beschluss und Willen uns ursprünglich vor das Nichts zu bringen vermögen. So abgründig gräbt im Dasein die Verendl ichung, dass sich unserer Freiheit die eigenste und tiefste Endlichkeit versagt. Die Hineingehaltenheit des Daseins in das Nichts auf dem Grunde der verborgenen Angst ist das Übersteigen des Seienden im Ganzen: die Transzendenz. () Metaphysik ist das Hinausfragen über das Seiende, um es als ein solches und im Ganzen für das Begreifen zurückzuerhalten. In der Frage nach dem Nichts geschieht ein solches Hinausgehen über das Seiende als Seiendes im Ganzen.“ (7) Brief über den „Humanismus“ (in: Wegmarken, 327f.): „Der Mensch ist vielmehr vom Sein selbst in die Wahrheit de s Seins ‚geworfen’, dass er, dergestalt ek-sistierend, die Wahrheit des Seins hüte, damit im Lichte des Seins das Seiende als das Seiende, das es ist, erscheine. Ob es und wie es erscheint, ob und wie der Gott und die Götter, die Geschichte und die Natur in die Lichtung des Seins hereinkommen, an- und abwesen, entscheidet nicht der Mensch. Die Ankunft des Seienden beruht im Geschick des Seins. Für den Menschen aber bleibt die Frage, ob er in das Schickliche seines Wesens findet, das diesem Geschick entspricht; denn diesem gemäß hat er als der Ek-sistierende die Wahrheit des Seins zu hüten. Der Mensch ist der Hirt des Seins.“ (8) Gespräch mit der Zeitschrift „Spiegel“ (1968): „Wenn ich kurz und vielleicht etwas massiv, aber aus langer Besinnung antworten darf: Die Philosophie wird keine unmittelbare Veränderung des jetzigen Weltzustandes bewirken kö nnen. Dies gilt nicht nur von der Philosophie, sondern von allem bloß menschlichen Sinnen und Trachten. Nur noch ein Gott kann uns retten. Uns bleibt die einz ige Möglichkeit, im Denken und im Dichten eine Bereitschaft vorzubereiten für die Erscheinung des Gottes oder für die Abwesenheit des Gottes im Untergang; dass wir im Angesicht des abwesenden Gottes untergehen.“ (9) Identität und Differenz, Frankfurt/M. 91990, 64f. „Zu diesem Gott der Philosophen; B. I. kann der Mensch weder beten, noch kann er ihm opfern. Vor der Causa sui kann der Mensch weder aus Scheu ins Knie fallen, noch kann er vor diesem Gott musizieren und tanzen. Dem gemäß ist das gott-lose Denken, das den Gott der Philosophen, den Gott als Causa sui preisgeben muss, dem göttlichen Gott vielleicht näher.“ 4