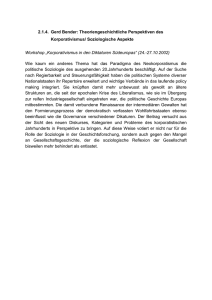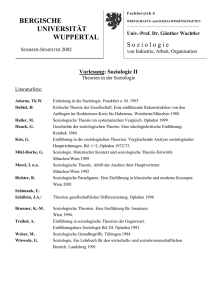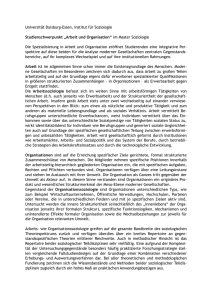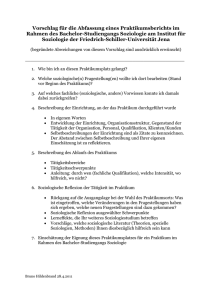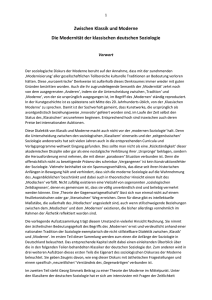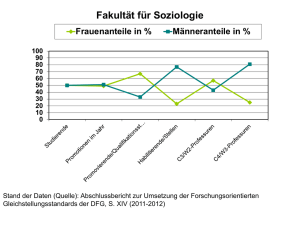Frank Hillebrandt Praktiken des Tauschens
Werbung

Frank Hillebrandt Praktiken des Tauschens Wirtschaft + Gesellschaft Herausgegeben von Andrea Maurer und Uwe Schimank Beirat: Jens Beckert Christoph Deutschmann Susanne Lütz Richard Münch Wirtschaft und Gesellschaft ist ein wichtiges Themenfeld der Sozialwissenschaften. Daher diese Buchreihe: Sie will zentrale Institutionen des Wirtschaftslebens wie Märkte, Geld und Unternehmen sowie deren Entwicklungsdynamiken sozial- und gesellschaftstheoretisch in den Blick nehmen. Damit soll ein sichtbarer Raum für Arbeiten geschaffen werden, die die Wirtschaft in ihrer gesellschaftlichen Einbettung betrachten oder aber soziale Effekte des Wirtschaftsgeschehens und wirtschaftlichen Denkens analysieren. Die Reihe steht für einen disziplinären wie theoretischen Pluralismus und pflegt ein offenes Themenspektrum. Bisher erschienen: Andrea Maurer Handbuch der Wirtschaftssoziologie, 2008 Christoph Deutschmann Kapitalistische Dynamik. Eine gesellschaftstheoretische Perspektive, 2008 Andrea Maurer · Uwe Schimank Die Gesellschaft der Unternehmen – Die Unternehmen der Gesellschaft. Gesellschaftstheoretische Zugänge zum Wirtschaftsgeschehen, 2008 Richard Swedberg Grundlagen der Wirtschaftssoziologie, 2009 Frank Hillebrandt Praktiken des Tauschens Zur Soziologie symbolischer Formen der Reziprozität Band 2 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar. 1. Auflage 2009 Alle Rechte vorbehalten © VS Verlag für Sozialwissenschaften | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2009 Lektorat: Frank Engelhardt VS Verlag für Sozialwissenschaften ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media. www.vs-verlag.de Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Umschlaggestaltung: KünkelLopka Medienentwicklung, Heidelberg Titelbild: Uwe Schimank/Ute Volkmann Druck und buchbinderische Verarbeitung: Krips b.v., Meppel Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier Printed in the Netherlands ISBN 978-3-531-16040-5 „Ich habe Neigung und Lust, Eigenschaften und ihre Verknüpfungen unmittelbar von meinem Leben in ein anderes, von einem anderen Leben in meins, von meinen Büchern in andere, von anderen Büchern in meine zu übertragen. Es scheint mir, die Regeln, die auf das fremde Leben oder das fremde Buch einwirken, sind vergleichbar, ablösbar, ja sogar austauschbar. Aber das muss eine Täuschung sein. Die Logik des Lebens, die Logik der Bücher kann nicht nur aus ewigen Regeln bestehen, es muss auch solche geben, die im jeweiligen Leben, im jeweiligen Buch geboren sind, und diese können nicht einfach eins zu eins in andere Leben, in andere Bücher übertragen werden.“ (Ernst-Wilhelm Händler 2006: 272) Inhalt 1 Einleitung 2 Praxistheorie 2.1 Sozialphilosophie der Praxis 2.2 Soziologie der Praxis als Analyse sozialer Kämpfe 2.3 Praxistheorie als allgemeine soziologische Theorie 2.3.1 Praxis als Gegenstand der Soziologie 2.3.2 Praxis und die Relation von inkorporierter und objektivierter Sozialität 2.3.3 Der Sinn und die symbolischen Formen der Praxis 2.4 Resümee: Paradigmen einer soziologischen Theorie der Praxis 9 19 21 38 49 50 58 71 83 3 Praxistheorie des Tausches 3.1 Begriff des Tausches 3.2 Ware, Geld, Markt und Tausch 3.3 Gabe, Symbol, Reziprozität und Tausch 3.4 Die praktische Simultanität von Tauschlogiken 3.5 Praxisformen des Tausches 3.5.1 Die Sachdimension der Tauschpraxis 3.5.2 Die Sozialdimension der Tauschpraxis 3.5.3 Die Zeitdimension der Tauschpraxis 3.5.4 Die Vielfalt der Tauschpraxis 3.6 Resümee: Begriff, Theorie und Praxis des Tausches 91 93 100 126 156 163 165 180 206 214 234 4 Schluss: Die Dynamik der Praxis und der Tausch 243 Literatur 249 Personenregister 269 1 Einleitung 1 Einleitung 1 Soziologische Beschäftigungen mit dem Thema Tausch sind in der gegenwärtigen Theoriediskussion des Fachs selten geworden. So gehört etwa die breit angelegte Tauschtheorie von Peter M. Blau (vgl. 1992 [1964]) aus den 1960er Jahren inzwischen zur weniger bekannten Geschichte der Soziologie.1 Dabei ist der Tausch in der Gegenwartsgesellschaft allgegenwärtig. Nicht nur, dass wir alle fast täglich Geld gegen Gebrauchsgegenstände und Lebensmittel tauschen und unsere Arbeitskraft auf dem Arbeitmarkt anbieten und verkaufen, belegt diese Feststellung. Wir sind alle auch regelmäßig an geldlosen Tauschprozessen beteiligt, wenn wir etwa mit Kollegen am Arbeitsplatz Informationen austauschen oder sehr genau darauf achten, demjenigen oder derjenigen, der oder die uns ein Geburtstagsgeschenk gemacht hat, selbst zu seinem oder ihrem Geburtstag ein Geschenk zu machen. Der Tausch ist dabei nicht nur in seinem praktischen Vollzug, der sich nicht selten in höchst komplexer Form ereignet, für die soziologische Theoriebildung und Forschung interessant, denn er bleibt häufig nicht folgenlos für die Form der Reproduktion von Sozialität, weil durch Tauschprozesse soziale Beziehungen zwischen sozialen Akteuren entstehen und auf Dauer gestellt werden können, die neue Formen der Sozialität hervorbringen. Dies veranschaulicht eine Beobachtung, die Claude Lévi-Strauss (vgl. 1981: 115f.) um das Jahr 1950 herum in einem südfranzösischen Restaurant gemacht hat. Demnach sitzen sich hier regelmäßig einander fremde Gäste gegenüber und nehmen ihre Mahlzeiten ein, die sie vorher bei der Bedienung des Lokals bestellt haben und gewillt sind zu bezahlen, also durch Kauf zu erwerben. Soweit geschieht hier alles im Rahmen einer ökonomischen Transaktion und ist deshalb nicht weiter bemerkenswert. Denn eine Mahlzeit wird, wie es für die gegenwärtige Ökonomie typisch ist, gegen Geld getauscht, um das jeweilige Bedürfnis nach Nahrung zu stillen. Die soziale Beziehung zwischen Käufer und Verkäufer kann dabei auf den Tausch begrenzt bleiben. Der Tausch von Waren (also hier der Mahlzeit) gegen Geld lässt prinzipiell keine Verpflichtungen zurück, weil mit dem Bezahlen des Geldes für die Ware der Tausch eindeutig abgeschlossen ist. Diese Unverbindlichkeit des Warentausches ist uns allen sehr vertraut, weil sie, wie bereits Georg Simmel (1989: 298ff.; 1992: 662 und öfter) im Einklang mit anderen Klassikern der Soziologie deutlich macht, eine der wichtigsten Charakteristika der Gegenwartsgesellschaft ist. 1 Peter P. Ekeh (vgl. 1974) bündelt die Diskussion des Tausches in den 1960er Jahren, indem er kollektivistische und individualistische Tauschtheorien voneinander unterscheidet, und bringt die Debatte um den Tausch dadurch zu einem vorläufigen Abschluss. Daran anschließend entstehen in Deutschland noch einige weitere Studien, die sich explizit um eine Soziologie des Tausches bemühen (vgl. etwa Clausen 1978 und Stentzler 1979), bevor die Diskussion fast vollständig versiegt. Inzwischen bahnt sich mit Bezug auf eine traditionell intensiv geführte Debatte in Frankreich (vgl. hierzu exemplarisch Caillé 2008) in der deutschen Soziologie eine Renaissance des Tauschthemas an, die aus einer verstärkten Auseinandersetzung mit dem Essay über die Gabe von Marcel Mauss (vgl. 1990) entspringt, auf den auch ich unten (3.3) ausführlich zurückkomme. Siehe hierzu aktuell die Beiträge in Adloff und Mau (2005a) und in Moebius und Papilloud (2006), sowie Moebius (2006), Hillebrandt (2006b; 2007a) und Adloff und Papilloud (2008). 10 1 Einleitung Bezüglich des Weins ereignet sich in dem südfranzösischen Restaurant jedoch etwas Seltsames: Niemand der Gäste schenkt sich aus den vor ihnen stehenden Weinflaschen selbst, sondern ausschließlich dem jeweiligen anderen Gast Wein ein. Während also die Mahlzeit niemandem anderen angeboten, also als persönlicher Besitz, der zuvor durch Kauf erworben worden ist, bewahrt wird, ist der Wein Gegenstand des Tausches zwischen den sich gegenseitig fremden Gästen. Diese kleinen Weingeschenke sind dabei, und das macht sie aus, obligatorisch. Ein Gast, der das Ritual des gegenseitigen Schenkens von Wein nicht kennt und deshalb nur sich selbst Wein einschenkt, wird von den anderen Gästen, die mit dem Ritual vertraut sind, durch dezente aber bestimmte Gesten darauf aufmerksam gemacht, dass es sich bei der Verweigerung des Weingeschenks um ein grobes Fehlverhalten handelt. In der Praxis des gegenseitigen Weingeschenks ist somit eine auf dem ersten Blick schwer zu verstehende Verpflichtung wirksam, den Wein freiwillig zu verschenken (vgl. Caillé 2005: 178). Diese Verpflichtung ist hoch komplex, in ihr bündeln sich sehr unterschiedliche Gesichtspunkte – nämlich psychologische, soziale, normative, rechtliche – zu symbolischen Formen, die sich praktisch nicht entwirren lassen, weil sie nur durch ihre Bündelung wirksam werden können. Und würden die am Ritual beteiligten Akteure selbst nach ihren Motiven für die kleinen Weingeschenke befragt, würde der oder die Fragende gerade von den Gästen, die mit dem Ritual des gegenseitigen Weingeschenks eng vertraut sind, keine befriedigende Antwort erhalten. Die Komplexität des Rituals ist nur schwer in Worte zu fassen. Deshalb würde die Frage nach den eventuellen Gründen für das Ritual den an ihm beteiligten Akteuren sehr wahrscheinlich als unhöflich oder deplatziert erscheinen. Sie halten das Verschenken von Wein in einem Restaurant für selbstverständlich und können bzw. wollen es deshalb nicht hinterfragen. So wenig überraschend die beschriebene Praxis des gegenseitigen Verschenkens von Wein für die beteiligten Akteure ist, umso überraschender ist es für einen externen Beobachter dieser rituellen Praxis. Denn hier geschieht unter kalkulatorischem Gesichtspunkt etwas völlig Sinnloses: Wenn sich alle Gäste auf die Praxis des gegenseitigen Schenkens von Wein einlassen, und sie werden dazu offensichtlich durch bestimmte soziale Mechanismen verpflichtet, ist das quantitativ messbare Ergebnis dieser Tauschpraxis, dass alle Gäste etwa genauso viel Wein erhalten, als wenn sie alle nur an sich selbst gedacht und den Wein nicht untereinander getauscht hätten. Warum geschieht das gegenseitige Verschenken des Weins aber trotzdem regelmäßig zumindest in südfranzösischen Restaurants? Lévi-Strauss zeigt mit seiner Auslegung der von ihm beobachteten Szene die Richtung an, in die eine soziologische Antwort auf diese Frage zielen muss: „Jeder, der an dieser aufschlussreichen Szene beteiligt ist, hat letztlich nicht mehr erhalten, als wenn er sein eignes Quantum getrunken hätte. Ökonomisch gesehen hat niemand gewonnen und niemand verloren. Doch der springende Punkt ist, dass es beim Tausch um sehr viel mehr geht als um die ausgetauschten Dinge.“ (Lévi-Strauss 1981: 116; Hervorh. F.H.) Dieses „Mehr“ wird im hier angeführten Beispiel darin sichtbar, dass die Gäste, die sich zunächst einander fremd sind, durch die gegenseitigen Weingeschenke miteinander ins Gespräch kommen und zumindest für die Zeit ihres Zusammenseins im Restaurant in soziale Beziehungen zueinander treten. Die streng ritualisierten Weingeschenke, die sich die Restaurantgäste in Südfrankreich gegenseitig machen (müssen), erzeugen folglich neue Formen der Sozialität, sie bilden unter Umständen soziale Strukturen. 1 Einleitung 11 Der soziologischen Theorie ist es bis heute nicht gelungen, das von Lévi-Strauss herausgestellte „Mehr“ der Tauschpraxis angemessen zu untersuchen. So findet die strukturale Anthropologie des scharfsinnigen Beobachters der südfranzösischen Restaurantszene die theoretische Erklärung für die hier praktisch werdenden Austauschprozesse, die sich mit einer ökonomischen Austauschtheorie nicht erklären lassen, letztlich in dem theoretischen Postulat einer generell wirksamen Norm der Reziprozität, die mental in den Akteuren verankert ist und sich nicht nur im gegenseitigen Austausch von Weingeschenken Ausdruck verschafft. Der mentale Strukturalismus nach Lévi-Strauss, dessen Einfluss auf die soziologische Theoriebildung kaum zu unterschätzen ist, sieht die Funktion von derartigen Praktiken der Reziprozität darin, den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft zu erzeugen. Auf diese Weise werden die dynamischen Aspekte von Tauschprozessen kurzerhand zugunsten einer universalen Erklärung ihrer Entstehung marginalisiert, indem ein generell wirksames Symbol der Reziprozität theoretisch konstruiert wird, ohne die Vielgestaltigkeit der im Tausch wirksam werdenden symbolischen Formen angemessen in den theoretischen Blick zu nehmen. Der Tausch erscheint hier als ein Epiphänomen der Reziprozität. Folglich sucht diese von Peter P. Ekeh (vgl. 1974) kollektivistisch genannte Tauschtheorie die Erklärungen für Tauschprozesse in überindividuellen Strukturen der Reziprozität, aus denen Praktiken des Tausches deduktiv abgeleitet werden (vgl. exemplarisch Gouldner 1984: 97ff.). Parallel dazu entwickeln sich akteurzentrierte Austauschtheorien, wie etwa die Verhaltenstheorie von George C. Homans (vgl. 1958), welche die Antriebe für den Tausch in vorgeblich ahistorischen Eigenschaften der tauschenden Akteure zu finden glauben. Diese Ansätze, die Ekeh (vgl. 1974) als individualistische Tauschtheorien bezeichnet, gelten dem methodologischen Individualismus (vgl. exemplarisch Coleman 1991: 46 und öfter; Esser 2000: 305ff.) als wichtige Referenzpunkte zur Entwicklung einer soziologischen Theorie der rationalen Handlungswahl. Die Erklärung für Tauschprozesse finden diese Theorien in einer nomologisch gefassten Rationalitätsidee des kalkulatorischen Abwägens von Kosten und Nutzen des Handelns, das als treibende Kraft jeder Sozialität und mithin auch des Tausches verstanden wird. Die symbolischen Formen des Tausches, also das von Lévi-Strauss identifizierte „Mehr“ von Tauschprozessen, werden in den beiden genannten Theoriesträngen zugunsten einer monokausalen Erklärung des Austausches marginalisiert. Oder anders gesagt: Für die Identifikation und Analyse der symbolischen Formen des Tausches stellen beide Theorierichtungen kein geeignetes Instrumentarium bereit, weil sie die Vielfältigkeit dieser symbolischen Formen entweder durch das theoretische Postulat einer generellen Norm der Reziprozität oder durch das theoretische Postulat einer generell wirksam werdenden Rationalität auf jeweils nur eine kulturelle Formung des Tausches reduzieren. Tauschprozesse werden mit anderen Worten deutlich zu voraussetzungsvoll definiert. Um derartige Verkürzungen der soziologischen Tauschtheorie zu vermeiden, steht im Mittelpunkt der hier verfolgten Untersuchung der Entwurf einer soziologischen Praxistheorie des Tausches. Das zentrale Augenmerk liegt dabei auf der Identifikation unterschiedlicher symbolischer Formen des Tausches, um auf diesem Wege eine kultursoziologische Fundierung der soziologischen Tauschtheorie zu ermöglichen. Dies erlaubt eine Bestimmung unterschiedlicher Praxisformen des Tausches, die als soziale Mechanismen mit strukturbildenden Effekten untersucht werden. Zur Analyse gerade auch dieser strukturierenden 12 1 Einleitung Wirkungen unterschiedlicher Tauschformen benötigt die soziologische Theorie ein praxistheoretisches Instrumentarium, das sich nicht an vereinheitlichenden Theorieprinzipien orientiert, sondern die Mannigfaltigkeit der symbolischen Formen des Tausches sichtbar macht. Nur ein solches Instrumentarium kann der Komplexität der Tauschpraxis gerecht werden, die sich bereits in der alltäglichen Restaurantszene in Südfrankreich manifestiert. Eine wichtige These der hier von mir verfolgten Praxistheorie des Tausches ist es folglich, dass ein derartiges Instrumentarium entwickelt werden kann, wenn sich die Soziologie des Tausches am Begriff der Praxis orientiert. Praxis steht als Begriff für ein soziologisches Theorieprogramm, das den methodologischen Individualismus ebenso wie den Strukturalismus überwinden will, indem bei der soziologischen Theoriebildung und Forschung von dem ausgegangen wird, was praktisch geschieht, ohne dabei hinter den Erkenntnisstand klassischer soziologischer Ansätze zurückzufallen. Diesen hohen Anspruch bringt Pierre Bourdieu, der prominenteste Vertreter einer am Praxisbegriff orientierten Soziologie, wie folgt zum Ausdruck: „Die Theorie der Praxis als Praxis erinnert gegen den positivistischen Materialismus daran, dass Objekte der Erkenntnis konstruiert und nicht passiv registriert werden, und gegen den intellektualistischen Idealismus, dass diese Konstruktionen auf dem System von strukturierten und strukturierenden Dispositionen beruht, das in der Praxis gebildet wird und stets auf praktische Funktionen ausgerichtet ist.“ (Bourdieu 1987: 97) Dieser von Bourdieu umrissene Ausgangspunkt soziologischen Theoretisierens und Forschens macht die Entwicklung einer neuen Form der soziologischen Theoriebildung nötig, die jenseits der „scholastischen Vernunft“ (Bourdieu 2001) eine praxisnahe Auseinandersetzung mit der sozialen Wirklichkeit ermöglicht, indem sie den praktischen Sinn, der von den sozialen Akteuren erzeugt wird, in den Mittelpunkt der soziologischen Forschung stellt. Und gerade für die Praxisformen des Tausches, die hier zum Thema einer theoretischen Untersuchung gemacht werden sollen, ist die von Bourdieu vorgeschlagene Ausrichtung der Soziologie auf den praktischen Sinn der Praxis, der sich in kulturellen und symbolischen Formen Ausdruck verschafft, viel versprechend, um die bereits angesprochenen monokausalen Erklärungen für die Entstehung und Wirkung von Tauschprozessen zu überwinden. Ich gehe in meiner Untersuchung also ganz allgemein davon aus, dass die Genese von Praxisformen nicht mit einfachen Kausalmodellen erklärt werden kann. Diese Skepsis bezüglich kausaler Erklärungen von beobachtbaren Regelmäßigkeiten der Sozialität speist sich vor allem aus dem von Max Weber (vgl. 1980: 5f.) ausgehenden, die soziologische Wissenschaft wesentlich prägenden sinnorientiert-intentionalen Handlungsverständnis der verstehenden Soziologie, dem zufolge die Soziologie ein anderes, interpretatives Erklärungskonzept benötigt als die Naturwissenschaft, weil alle Formen der Sozialität nicht ohne Sinnadäquanz der an Sozialität beteiligten Akteure verstanden und deshalb nicht auf allgemeine Gesetzmäßigkeiten, also auf „Kausaladäquanz“ (Weber) reduziert werden können.2 2 Siehe zur Rekonstruktion der klassischen Kontroverse zwischen erklärenden und verstehenden Ansätzen in der Soziologie, die als wichtiger Ausgangspunkt der Entwicklung der Soziologie zu einer wissenschaftlichen Disziplin angesehen werden muss, die diesbezüglichen Ausführungen von Andreas Reckwitz (2000: 98-117). 1 Einleitung 13 Mit dem theoretischen Konzept des praktischen Sinns gelingt es der Praxistheorie, wie zu zeigen sein wird, diese grundlegende Einsicht der Soziologie für die kultursoziologische Theoriebildung zu nutzen, ohne dabei eine reine Kulturwissenschaft zu betreiben, die sich auf die Identifikation und Analyse symbolischer Formen beschränkt. Dagegen will die Praxistheorie als Kultursoziologie symbolische Formen als Katalysatoren von Praxis bestimmen, so dass mit ihr keine Kulturtheorie verfolgt wird, die Kultur lediglich als Text der Gesellschaft versteht. Die Praxistheorie strebt vielmehr eine Soziologie der Praxis an, die vielfältige Formen der Praxis, womit der Tausch als Praxisform eingeschlossen ist, in ihrer Entstehung und Reproduktion analysiert. Wird die Praxistheorie aus den genannten Gründen zum Ausgangspunkt der Entwicklung eines soziologischen Instrumentariums zur Erforschung der vielfältigen Tauschpraxis gewählt, stellt sich allerdings ein zentrales Problem: Eine Theorie, in der zur Analyse von Praxisformen der praktische Sinn in den Mittelpunkt der Soziologie gestellt wird, lässt sich nur schwer systematisieren. Sie kann sich nicht, wie bereits Ernst Cassirer (vgl. 1994: 96ff.) in seiner Kulturtheorie herausstellt, um Substanzbegriffe herum entfalten, mit denen ein statisches Bild der Sozialität erzeugt wird. Eine Praxistheorie muss einen anderen Weg der Systematisierung wählen, weil sie die Mannigfaltigkeit der symbolischen Formungen des praktischen Sinns nicht mit Substanzbegriffen verdecken, sondern erst sichtbar machen will. Ein derartiges Vorhaben, das Cassirer als „Form-Analyse“ (ebd.: 96) bezeichnet hat, birgt die Schwierigkeit, dass jede theoretische Systematisierung eine eigene, theoretische Logik erzeugt, die sich von der praktischen Logik, die mit der Theorie erfasst werden soll, konstitutiv unterscheidet. Sie steht, kurz gesagt, vor dem erkenntnistheoretischen Dilemma, Praxis als Theorie ausdrücken zu müssen. Diese erkenntnistheoretische Problematik, die sich nur schwer auflösen lässt, ist sicher der wichtigste Grund dafür, dass die Praxistheorie bisher noch nicht zu einer allgemeinen soziologischen Theorie systematisiert worden ist.3 In der primär makrosoziologisch angelegten Variante der Praxistheorie, die von Bourdieu als bisher am weitesten ausgearbeitete Spielart dieser Theorierichtung vorgelegt wird, findet sich eine Engführung der Theoriebildung auf Praxisformen der Macht- und Herrschaftsausübung, die eine Analyse anderer Praxisformen wie etwa den Tausch sehr stark einschränkt. Die von Bourdieu betriebene Fokussierung der Praxistheorie auf die Analyse und Erklärung der Reproduktion makrosozialer Ungleichheitsstrukturen verschenkt große Teile des sozialtheoretischen Potenzials der Praxistheorie. Sie eignet sich, so meine im Verlauf der Untersuchung zu belegende These, erst dann hervorragend zur Analyse von mikro-, meso- und makrosozialen Tauschprozessen, wenn sie als soziologische Theorie trotz aller damit verbundenen Schwierigkeiten systematisiert und dadurch aus ihrer herrschaftssoziologischen Engführung herausgeführt wird. Denn nur dadurch lässt sich das in der Praxistheorie bisher verborgene sozialtheoretische Potenzial zur Analyse der Tauschpraxis freilegen. Aus den beiden Problemstellungen, dass der Tausch trotz seiner Relevanz für die Sozialität inzwischen nur noch marginal oder vereinfachend zum Gegenstand soziologischer Forschung und Theorie gemacht wird und dass die Praxistheorie, in der ein viel verspre- 3 Erste, bisher allerdings noch fragmentarische Ansätze dazu finden sich bei Reckwitz (2003), Schatzki (1996), Reuter (2004), Hörning (2004) und anderen. Auf diese Arbeiten werde ich bei meinem eigenen Versuch zurückkommen, die Praxistheorie zu einer allgemeinen soziologischen Theorie weiterzuentwickeln. 14 1 Einleitung chender Ansatz zur Erforschung der vielförmigen Tauschpraxis angelegt ist, bisher noch nicht hinreichend als allgemeine soziologische Theorie gefasst worden ist, ergeben sich die beiden zentralen, komplementär aufeinander bezogenen Ziele meiner hier verfolgten theoretischen Überlegungen zur Entwicklung einer Praxistheorie des Tausches: Das erste Ziel ist die Systematisierung der soziologischen Praxistheorie zu einer allgemeinen soziologischen Theorie, die sich auf alle Phänomenbereiche der Soziologie anwenden lässt. Das zweite, eng damit verbundene Ziel ist die Entwicklung einer soziologischen Praxistheorie des Tausches, in der die zuvor konturierten Paradigmen einer praxistheoretischen Soziologie angewendet werden, um die komplexe Tauschpraxis angemessen zu beschreiben und Erklärungen für das Zustandekommen und die Wirkung bestimmter Tauschformen zu erzielen. Die Untersuchung gliedert sich folglich in zwei Hauptkapitel. An diese Einleitung schließt das zweite Kapitel mit dem Titel „Praxistheorie“ an. Hier wird zunächst unabhängig vom Themenkomplex Tausch die Praxistheorie in ihren unterschiedlichen Ausprägungen mit dem Ziel diskutiert, die zentralen Paradigmen einer praxistheoretischen Soziologie zu konturieren. Der wichtigste Referenzpunkt ist dabei die umfangreiche Theorievorgabe Pierre Bourdieus, die vor dem Hintergrund einer am Begriff der Praxis orientierten Diskussion sozialphilosophischer Praxistheorien (2.1) nicht nur bezüglich ihres sozialtheoretischen Gehalts, sondern auch bezüglich ihrer wichtigsten Schwächen untersucht wird (2.2). Auf dieser Grundlage werden die zentralen Paradigmen einer soziologischen Theorie der Praxis allgemein bestimmt (2.3) und in einem resümierenden Abschnitt gebündelt (2.4). Diese Theoriearbeit liefert das Instrumentarium zur Entwicklung einer praxistheoretischen Soziologie des Tausches, die das Ziel des dritten Kapitels ist, dem Hauptteil der Untersuchung. Zur Entwicklung einer Praxistheorie des Tausches (Kapitel 3) entwerfe ich zunächst einen Begriff des Tausches, indem ich die zentralen Paradigmen der soziologischen Praxistheorie auf den Tausch beziehe, um ihn als Praxisform bestimmen zu können (3.1). Auf dieser Grundlage diskutiere ich die wichtigsten Thematisierungsformen des Tausches in der soziologischen Theorie, um eine reflexive Ausgangsbasis für eine praxistheoretische Soziologie des Tausches zu schaffen. Hier sehe ich zwei zentrale Thematisierungsstränge, die ich getrennt voneinander untersuche: Zum einen wird der Tausch in der soziologischen Theorie als Warentausch thematisiert, der eine wichtige Rolle spielt für die Reproduktion der modernen Ökonomie. Meine Auseinandersetzung mit dieser Sicht des Tausches macht der neuen Wirtschaftssoziologie den Vorschlag, Praxisformen des Tausches in neuer, kultursoziologischer Form in das Zentrum wirtschaftssoziologischer Forschung zu stellen, um ein genuin soziologisches Verständnis der ökonomischen Praxis der Gegenwartsgesellschaft zu erzielen (3.2). Zum zweiten sehe ich eine Thematisierungsweise des Tausches, die sich zentral um die Formen des Tausches herum entwickelt, die genuin nicht als Warentausch oder als ökonomischer Tausch verstanden werden können. Diese Theorierichtung, die gegenwärtig, wie bereits angedeutet, so etwas wie eine Renaissance erfährt, kristallisiert sich an einer Auseinandersetzung mit dem Essai sur le don von Marcel Mauss (vgl. 1990). Hier geht es um Formen des Gabentausches, die sich in Verbindung mit symbolischen Formen ereignen und eigentümlichen Praxisprinzipien entspringen. In der theoretischen Beschäftigung mit dem Gabenessay und seinen vielschichtigen und heterogenen Interpretationen geht es mir um die kultursoziologische Fundierung einer Praxistheorie des Tausches und nicht um den Entwurf einer „Kulturtheorie der Gabe“ (Moebius und Papilloud 2006), wie Mauss’ Unter- 1 Einleitung 15 suchungen zum Gabentausch gegenwärtig häufig interpretiert werden (3.3). Nach diesen beiden Gängen durch die soziologische Theoriebildung des Tausches führe ich die beiden von mir in praxistheoretischer Ausrichtung diskutierten Theoriestränge zusammen, indem ich das Argument entfalte, dass sich in der gegenwärtigen Tauschpraxis eine Simultanität unterschiedlicher Tauschlogiken identifizieren lässt. Die regelmäßig zu beobachtende Dichotomisierung von Waren- und Gabentausch durch die soziologische Theorie ist folglich wenig hilfreich, um die Komplexität der Tauschpraxis angemessen in den soziologischen Blick zu nehmen (3.4). Dieses zentrale Zwischenergebnis der Theoriearbeit schafft eine breite Basis zur Identifikation und Analyse unterschiedlicher Praxisformen des Tausches, die sich als Mischformen der Logiken des Waren- und des Gabentausches bestimmen lassen, wenn die einzelnen Praktiken, aus denen der Tausch sich formt, mit den Mitteln einer kultursoziologischen Analyse der symbolischen Formen des Tausches auf die Sach-, Sozial- und Zeitdimension des Sinngeschehens bezogen werden (3.5). Am Ende des dritten Kapitels steht ein Resümee, das sich der Aufgabe stellt, die wichtigsten Ergebnisse einer praxistheoretischen Soziologie des Tausches zusammenfassend zu verdeutlichen (3.6). Im Schlusskapitel der Arbeit (Kapitel 4) führe ich die beiden von mir verfolgten Hauptziele der Untersuchung zusammen, indem ich den Ertrag einer praxistheoretischen Soziologie des Tausches für die soziologische Theoriebildung veranschauliche. Bevor ich mit der Umsetzung dieses Programms beginne, möchte ich den Entstehungszusammenhang des vorliegenden Buches kurz umreißen. Denn eine Praxistheorie der Erkenntnis, auf die ich im Abschnitt 2.2 genauer eingehen werde, weist mit Recht darauf hin, dass für die Produktion wissenschaftlicher Aussagen, also für die Praxis der Erkenntnisproduktion, nicht nur der im Programm der Untersuchung dargelegte Begründungszusammenhang, sondern auch der Entdeckungszusammenhang eine wichtige Rolle spielt. Dieser weist wissenschaftlicher Forschung die Richtung, weil er die Forschungspraxis rahmt und dadurch anleitet. Nicht nur persönliche Erkenntnisinteressen – die Praxistheorie fasziniert mich bereits seit einigen Jahren als viel versprechende Neuorientierung soziologischer Forschung –, sondern auch institutionelle Rahmungen haben die zentralen Ideen und Ziele auch der vorliegenden Forschungsarbeit angeleitet. Sie ist aus einer langjährigen Forschungstätigkeit im interdisziplinären Forschungsfeld Sozionik entstanden, das durch Thomas Malsch initiiert wurde. In dieser Forschungsrichtung, die im Grenzgebiet zwischen Soziologie und Informatik angesiedelt ist, wird soziologisches Wissen über die soziale Welt dafür genutzt, „intelligente“ Computertechnologien zu entwickeln. Ähnlich wie die Bionik biologische Funktionsweisen und Strukturen von Lebewesen unter dem Aspekt ihrer Übertragbarkeit auf technische Systeme untersucht, erforscht die Sozionik, inwieweit sich Vorbilder aus der sozialen Welt für eine Weiterentwicklung von Technologien künstlicher Intelligenz eignen und auf welche Weise sich informationstechnische Probleme nach dem Vorbild sozialer Problembewältigung lösen lassen. Die Sozionik soll dazu anregen, Forschungsdesiderate aus der Informatik zur Entwicklung von soziologischen Theorieelementen zu nutzen. In der so entstehenden sozionischen Forschungspraxis werden somit disziplinäre Unterschiedlichkeiten der epistemischen Kulturen von Informatik und Soziologie zur Irritation vertrauter Denkarten ge- 16 1 Einleitung nutzt, um neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu befördern (vgl. Beck und Hillebrandt 2006).4 Die Idee für eine soziologische Praxistheorie des Tausches entstand im Kontext des sozionischen Forschungsprojekts „Modellierung sozialer Organisationsformen in VKI und Soziologie“. Die hier von 1999 bis 2006 durchgeführten Untersuchungen befassten sich in der ersten Phase mit der Frage, wie die Praxistheorie Bourdieus für die Modellierung von Softwaresystemen der Verteilten Künstlichen Intelligenz genutzt werden kann. Die Arbeit an dieser Forschungsfrage, die durch empirische Studien zur Kooperationsbildung in der Transportwirtschaft flankiert wurde, ist der wichtigste Ausgangspunkt für das erste Ziel der hier verfolgten Überlegungen, die Praxistheorie zu einer allgemeinen soziologischen Theorie zu systematisieren. Denn die interdisziplinäre Analyse der Übertragbarkeit zentraler Konzepte der Praxistheorie Bourdieus in die Modellierung von Softwaresystemen zwingt zu einer mikrosoziologischen Weiterentwicklung der Bourdieuschen Theorievorgabe, die sich in zentralen Punkten auf die Analyse makrosozialer Ungleichheitsstrukturen fokussiert. In der Diskussion mit Computerwissenschaftlern stellte sich in diesem Zusammenhang der Phänomenbereich Tausch als ein zentraler Kristallisationspunkt für die mikrosoziologische Fundierung der Praxistheorie heraus, weil mechanische Tauschvorgänge zwischen Softwareeinheiten (Agenten) in Systemen der Verteilten Künstlichen Intelligenz grundlegende Mechanismen zur Reproduktion dieser Systeme sind (vgl. hierzu Alam et al. 2005). Der Versuch, diese im Kausalschema konzipierten, technischen Tauschmechanismen durch ein Konzept des Gabentausches, wie es von Bourdieu (vgl. 1987: 180ff.; 1998: 161ff.; 2001: 246ff.) in praxistheoretischer Perspektive vorgeschlagen wird, iterativ zu sozialen Mechanismen weiterzuentwickeln, um den Gabentausch dadurch in Experimenten der computergestützten Sozialsimulation untersuchen zu können (vgl. Hillebrandt et al. 2004; Alam et al. 2005), diente als Ideengeber für das zweite Ziel der hier von mir angestrebten Praxistheorie des Tausches, die soziologische Tauschtheorie auf eine praxistheoretische Basis zu stellen, um nicht nur der Komplexität, sondern auch den Strukturdynamiken der Tauschpraxis soziologisch gerecht werden zu können. Die Mitarbeit an dieser sozionischen Forschung führte Siehe für den Begriff der Sozionik u.a. Malsch et al. (1998), Malsch (2001), Florian und Hillebrandt (2004: 10f.). Weil das Forschungsfeld Sozionik, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft im gleichnamigen Schwerpunktprogramm von 1999-2006 gefördert wurde, sehr jung ist und deshalb in der soziologischen Fachöffentlichkeit nicht sehr bekannt sein dürfte, bedarf es einer kurzen Erläuterung zur Entstehung der sozionischen Zusammenarbeit zwischen Soziologie und Informatik: Erst die Ausdifferenzierung der Informatik in unterschiedliche Forschungsschwerpunkte macht sie für die Soziologie als Kooperationspartner interessant. Denn während die klassische Forschung zur Künstlichen Intelligenz (KI) das menschliche Gehirn als Ort der Entstehung intelligenter Problemlösungen betrachtet und sich dem entsprechend bemüht, kognitive Fertigkeiten von Menschen technisch nachzubilden, geht die Verteilte KI (VKI) in den USA seit Beginn der 1980er Jahre und in Deutschland seit Beginn der 1990er Jahre davon aus, dass intelligente Lösungen komplexer Probleme häufig nicht das Werk individueller, sondern sozialer Intelligenz sind, also aus der Interaktion vieler handelnder Einheiten resultieren (vgl. hierzu Malsch 1998). Der VKI geht es deshalb darum, KIProgramme kooperationsfähig zu machen. Am deutlichsten findet sich dieses Entwicklungsziel auf dem Gebiet der Multiagentensysteme. Multiagentensysteme bilden das koordinierte Verhalten mehrerer künstlicher „Agenten“ ab. Als Agenten werden Software-Programme bezeichnet, die über bestimmte, von ihnen selbst gesteuerte Verhaltensweisen verfügen und in der Lage sind, ihre eigenen Aktionen mit denen anderer Agenten abzustimmen, um ein übergreifendes Problem zu lösen (vgl. Wooldridge 1999; Timm und Hillebrandt 2006: 257ff.). Inzwischen gibt es eine relativ umfangreiche Literatur zu sozionischen Forschungsergebnissen. Siehe hierzu u.a. Schimank (2005), Hillebrandt (2005) und die anderen Beiträge in Fischer et al. (2005) sowie Hillebrandt et al. (2004), Alam et al. (2005), Timm und Hillebrandt (2006). 4 1 Einleitung 17 mich am Ende dazu, ein Forschungsstipendium bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu beantragen, das dankenswerter Weise bewilligt wurde. Diese zweijährige Förderung erlaubte es mir, die Erfahrungen und Ergebnisse aus der sozionischen Forschungsarbeit in ein soziologisches Theorieprojekt zu verwandeln. Viele Ideen, Argumente und Herleitungen der vorliegenden Arbeit gehen folglich implizit auf die Zusammenarbeit in einem interdisziplinären Team von Forscherinnen und Forschern zurück. Für diese Zusammenarbeit bedanke ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen des Forschungsprojektes „Modellierung sozialer Organisationsformen in VKI und Soziologie“, die sich auf das gewagte Experiment der sozionischen Forschung eingelassen haben und mir in vielen Diskussionen immer wieder neue Ideen für die soziologische Theoriebildung aufzeigten. Auf der informatischen Seite des Tandemprojektes waren dies unter anderem Michael Schillo, Shah Jamal Alam, Christian Hahn und Klaus Fischer vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken, die uns, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des soziologischen Projektteils, durch ihre Bereitschaft, sich auf soziologische Forschungsfragen einzulassen, dazu gezwungen haben, die soziologische Theorie so zu präzisieren, dass sie sich zur computertechnischen Modellbildung eignet. Dies ermöglichte neue Theorieperspektiven, die ohne diese interdisziplinäre Forschungsarbeit nicht möglich geworden wären und die implizit in die vorliegende Theoriearbeit eingeflossen sind. Darüber hinaus gilt mein besonderer Dank dem Leiter des soziologischen Projektteils, Michael Florian vom Institut für Technik und Gesellschaft der Technischen Universität Hamburg-Harburg, der durch sein mutiges Engagement in einem bis dahin unbekannten Forschungsfeld die sozionische Theoriearbeit zur Weiterentwicklung der Praxistheorie erst ermöglichte und in einer außergewöhnlich fachkompetenten, kollegialen und freundschaftlichen Weise leitete. Auch den soziologischen Mitstreiterinnen in diesem Forschungsprojekt, Andrea Maria Dederichs, Kerstin Beck, Daniela Spresny und Bettina Fley, verdanke ich viele Anregungen für die vorliegende Arbeit. Darüber hinaus möchte ich es nicht versäumen, mich bei den studentischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Forschungsarbeit, namentlich bei Nicole Diekmann, Matthias Hambsch und Stefanie Schäfer, für ihre vielfältige Unterstützung zu bedanken. Der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Bonn danke ich für die Gewährung eines Forschungsstipendiums und für die finanzielle Förderung der Publikation dieses Buches. Ferner danke ich Tobias Brändle für seine Unterstützung in der Endphase der Fertigstellung des Buches in Münster. Das deutsche akademische Feld sieht es bis heute vor, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf ihrem Weg zur Professur eine größere wissenschaftliche Arbeit als Habilitationsschrift einreichen. Diese Feldkonstellation führte mich im Jahr 2008 dazu, eine erste Fassung des vorliegenden Buches, die ich für die Publikation leicht überarbeitet habe, dem Fachbereich für Sozialwissenschaften der Universität Hamburg als soziologische Habilitationsschrift vorzulegen, wo sie 2009 als solche angenommen wurde. In diesem Zusammenhang danke ich Rolf von Lüde nicht nur für seine kollegiale Unterstützung, sondern auch für seine Hilfe in einer Phase, in der ich ohne sie nicht weiter gekommen wäre. Darüber hinaus gilt mein Dank Thomas Malsch für die stets gewinnbringende Betreuung der Arbeit sowie Uwe Schimank und Andreas Reckwitz für die konstruktive Begutachtung des Buches, die mir viele Anregungen gegeben hat, einige Stellen noch einmal zu überdenken und zu verbessern. Jörg Ebrecht danke ich für seine freundschaftliche Kritik und Unterstüt- 18 1 Einleitung zung. Nicht zuletzt, sondern vor allem möchte ich mich bei Ulrike Cleemann für all das Wichtige bedanken, das sich nicht in Worte fassen lässt. 2 Praxistheorie 2 Praxistheorie 2 „Wenn man vor der Welt, wie sie ist, fliehen will, kann man Musiker werden, Philosoph, Mathematiker. Aber wie flieht man vor ihr, wenn man Soziologe ist? Es gibt Leute, die das schaffen. Man braucht nur mathematische Formeln zu schreiben, Spieltheorieübungen oder Computersimulationen durchzuexerzieren. Wenn man wirklich die Welt wenigstens ein bisschen so sehen und so über sie reden will, wie sie ist, dann muss man akzeptieren, dass man sich immer im Komplizierten, Unklaren, Unreinen, Unscharfen usw. und also im Widerspruch zu den gewöhnlichen Vorstellungen von strenger Wissenschaftlichkeit befindet.“ (Bourdieu 1988b: 282f.) Die Begriffe Theorie und Praxis stehen sich häufig als unauflösliche Gegensätze gegenüber. Dem liegt die regelmäßige Erfahrung zugrunde, dass das, was in der Theorie schlüssig und logisch erscheint, sich in der Praxis nicht selten als unrealisierbar erweist. Die Kombination der beiden genannten Begriffe zum Begriff Praxistheorie scheint deshalb zunächst ein absurdes Vorgehen zu sein. Theorie und Praxis lassen sich nicht zusammenführen. Dieser Eindruck relativiert sich bei einem Blick auf die Geschichte soziologischer Forschung. In ihrer wissenschaftlichen Form setzt sie sich seit ihrer Entstehung mit der zentralen Frage auseinander, wie eine Theorie der Sozialität möglich ist, die methodisch genau das einfängt, was die Lebenswirklichkeit der Menschen ausmacht. Dafür ist die Einsicht Max Webers richtungweisend, dass sich die soziologische Forschung als „Wirklichkeitswissenschaft“ (Weber 1988: 170) nicht darin erschöpft, soziale Gesetzmäßigkeiten oder Erklärungen für soziale Mechanismen theoretisch zu konstruieren. Sie ist immer auch als Erfahrungswissenschaft zu begreifen, die sich mit dem subjektiv gemeinten Sinn zu befassen hat, mit dem die Akteure die Sozialität, von Max Weber als soziale Handlungen gefasst, versehen. Die soziologische Praxistheorie schließt an diese frühe Einsicht der verstehenden Soziologie Max Webers an (vgl. exemplarisch Bourdieu 2000a: 14). Sie will ein zu hohes Generalisierungsniveau vermeiden, indem theoretische Aussagen mit Hilfe des Praxisbegriffs auf die praktischen Bedingungen der Sozialität und des Lebens der sozialen Akteure bezogen werden. Die Faszination der Praxistheorie besteht darin, dadurch die landläufig als Gegensätze definierten Perspektiven des Strukturalismus und des methodologischen Individualismus mit Hilfe des Praxisbegriffs in einem neuen Paradigma der soziologischen Theoriebildung zusammenführen zu wollen, um die Soziologie von Einseitigkeiten und Verkürzungen zu befreien.1 Unübersehbar ist in diesem Zusammenhang: Der Begriff Praxis avanciert gegenwärtig zu einem paradigmatischen Schlüsselbegriff, um den Gegenstand der Soziologie als Wissenschaft neu zu bestimmen (vgl. Schatzki 2001). Er steht für ein sozialwissenschaftliches Erkenntnis- und Forschungsprogramm, das sozialtheoretische Engführungen überwinden will, indem induktive und deduktive Methoden der soziologischen Forschung zu einem neuen Konzept kombiniert werden. Der praxistheoretische Zugang zur Sozialität will dem 1 “When considering the nature of social life, social theory has always availed itself of two master concepts, those of totality (whole) and the individual.” (Schatzki 1996: 1) Mit diesem Einleitungssatz seiner am Praxisbegriff orientierten Sozialtheorie benennt Theodore Schatzki das Spannungsfeld, dem die Praxistheorie entgehen will. 20 2 Praxistheorie Anspruch nach der Dynamik und den Regelmäßigkeiten der sozialen Welt gleichzeitig gerecht werden. Dies geschieht durch eine Verortung der Sozialtheorie jenseits der Verabsolutierung der subjektiven Perspektive der Sozialphänomenologie und jenseits der Verabsolutierung der objektiven Perspektive des Strukturalismus. Im Folgenden gilt es zu zeigen, warum sich gerade der Praxisbegriff für eine solche Neuformulierung der soziologischen Theorie eignet. Wenn der Praxisbegriff für ein neues, integratives Paradigma der soziologischen Theoriebildung stehen soll, ist zu fragen, was gerade diesen Begriff für diese Aufgabe qualifiziert. Das wichtigste Ziel der hier verfolgten Argumentation ist es deshalb, die Praxistheorie als allgemeine soziologische Theorie zu konturieren, um sie zur Analyse von Tauschformen einsetzen zu können. Dazu ist es notwendig, den Begriff der Praxis auf seinen Gehalt und seine theoretische Analysefähigkeit hin zu untersuchen.2 Zur Lösung dieser theoretischen Aufgaben muss zunächst gesehen werden: Der Begriff Praxis besitzt eine ungeheure Suggestivkraft, weil er in den unterschiedlichsten Zusammenhängen eingesetzt wird und wurde. Zur Konturierung eines soziologischen Praxisbegriffs, die das Ziel verfolgt, eine allgemeine Sozialtheorie der Praxis zu formulieren, ist es notwendig, zunächst die wichtigsten Kristallisationspunkte der (sozial)philosophischen Diskussion um den Praxisbegriff frei zu legen. Dadurch werden Missverständnisse im soziologischen Gebrauch des Begriffs vermieden. Werden nämlich die verschiedenen Verwendungsweisen des Begriffs beleuchtet, zeigen sich die Anschlussstellen für eine allgemeine Soziologie, die sich am Praxisbegriff orientieren will. Deshalb gehe ich in einem ersten Schritt auf einige wichtige Spielarten der Praxisphilosophie ein, um einen soziologischen Begriff der Praxis zu konturieren (2.1). Daran schließt im zweiten Schritt eine grundlegende Diskussion und Kritik der prominentesten soziologischen Praxistheorie, der Kultursoziologie Bourdieus, an, die nicht in ihren Grundannahmen aber in ihrer primären Anwendung zu einseitig auf die sozial strukturierte Reproduktion sozialer Ungleichheit fokussiert ist, um als allgemeine soziologische Theorie Perspektiven auf andere Aspekte der Sozialität eröffnen zu können (2.2). Die Auseinandersetzung mit Bourdieu erlaubt es im dritten Schritt, die Praxistheorie über die Diskussion der Relation zwischen inkorporierter und objektivierter Sozialität sowie der Konzeption, wie sich praktischer Sinn in symbolischen Formen Ausdruck verschafft, als allgemeine soziologische Theorie zu reformulieren (2.3). Im Resümee dieses Kapitels wird das Potenzial der Praxistheorie für den im dritten Kapitel angestrebten Entwurf einer allgemeinen Soziologie des Tausches gebündelt (2.4). 2 Inzwischen wird nicht selten von einem „practice turn“ in den Sozialwissenschaften gesprochen (vgl. etwa Schatzki 2001), der sich darin zeigen soll, dass holistische und individualistische Konzepte der Soziologie überwunden werden, um eine neue, stärker an kulturellen Deutungsmustern orientierte Soziologie betreiben zu können. Siehe dazu neben den Beiträgen in Hörning und Reuter (2004) auch die ausführliche Diskussion von Andreas Reckwitz (vgl. 2000: 644ff.), in der so unterschiedliche Theoretiker wie Alfred Schütz, Erving Goffman, Charles Taylor, Michel Foucault und Pierre Bourdieu als Ausgangspunkte einer praxistheoretischen Soziologie vorgestellt werden. An dieser Aufzählung zeigt sich im Übrigen ein Wandel in der Rezeptionsgeschichte des Praxisbegriffs vom Marxismus hin zu einer allgemeinen Soziologie: Unter dem Titel Praxistheorie firmieren nämlich in den 1980er Jahren ausschließlich explizit marxistische Autoren wie Lefebvre, Castoriadis und andere, die Reckwitz um die letzte Jahrhundertwende für seine Theorie der Praxis nicht mehr berücksichtigt. Ganz anders hingegen die Studie von Rainer Schmalz-Bruns (vgl. 1989), die sich Ende der 1980er Jahre zur Dokumentation der Diskussion um die Praxistheorie ausschließlich auf den französischen Marxismus bezieht und deshalb, ganz im Gegensatz zu Reckwitz, kaum soziologische Aufmerksamkeit binden kann. 2 Praxistheorie 21 2.1 Sozialphilosophie der Praxis Bei einer Suche nach signifikanten Verwendungen des Praxisbegriffs in der Sozialtheorie fällt zunächst auf, dass der Begriff in marxistischer Tradition für den Versuch steht, Theorie in praktischer Absicht zu formulieren (vgl. Habermas 1978: 9), die Theorie also als praktisch relevantes Ausdrucksmittel der Gesellschaft zu begreifen, um so die Differenz zwischen Theorie und Praxis zu überwinden. Es ist Karl Marx, der diese Differenz erstmals grundlegend in der zweiten Feuerbachthese reflektiert: „Die Frage, ob dem menschlichen Denken gegenständliche Wahrheit zukomme – ist keine Frage der Theorie, sondern eine praktische Frage. In der Praxis muss der Mensch die Wahrheit, i. e. Wirklichkeit und Macht, Diesseitigkeit seines Denkens beweisen. Der Streit über die Wirklichkeit oder Nichtwirklichkeit des Denkens – das von der Praxis isoliert ist – ist eine rein scholastische Frage.“ (Marx 1969: 5) Der Begriff Praxis, definiert als „sinnlich menschliche Tätigkeit“ (ebd.), steht im Frühwerk von Marx für den Versuch, das theoretische Denken mit der Lebenswirklichkeit der Menschen einer Gesellschaft zu verbinden. Mit dem Praxisbegriff will Marx dem PraktischSinnlichen der menschlichen Existenz, dem „Reichtum des Sinnlichen“ (Lefebvre 1972: 35) Geltung verschaffen und gleichsam verdeutlichen, dass jede Theorie über die Praxis selbst eine Form von Praxis ist. Damit wendet sich Marx gegen die scholastische Vorstellung, Philosophie sei nur durch eine grundsätzliche Distanz des Philosophen zum gewöhnlichen Leben möglich. Über eine Kritik des Idealismus versucht Marx diese, für ihn ideologische Form der Philosophie zu überwinden. Dem entsprechend heißt es in der achten Feuerbachthese: „Alles gesellschaftliche Leben ist wesentlich praktisch. Alle Mysterien, welche die Theorie zum Mystizismus veranlassen, finden ihre rationelle Lösung in der menschlichen Praxis und in dem Begreifen dieser Praxis.“ (Marx 1969: 7) Die von Marx entwickelte Kritik der politischen Ökonomie soll eine praktische, revolutionäre Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse der Produktion und des Klassenantagonismus auslösen. „Diese Praxis versteht Marx als Aufhebung und Verwirklichung der Philosophie zugleich.“ (Habermas 1999: 323) Die Theorie und das alltägliche Leben, insbesondere in Form der Lebens- und Produktionsbedingungen, werden im Praxisbegriff zusammengeführt, um Philosophie von Ideologie zu befreien, was es nach Marx letztlich und ausschließlich erlaubt, die gesellschaftlichen Verhältnisse angemessen zu analysieren und zu transformieren. „Marx denkt von Anbeginn als Handelnder.“ (Lefebvre 1972: 26) Damit wird das Problem der Philosophie in wirkmächtiger Weise neu gestellt: Im Mittelpunkt steht jetzt nicht mehr die Frage, wie eine reine, von den gesellschaftlichökonomischen Verhältnissen abgelöste Form der Philosophie konsistent und widerspruchsfrei formuliert werden kann. Das Problem ist jetzt, wie eine praktisch relevante Analyse gerade dieser Verhältnisse ermöglicht werden kann, indem die Differenz zwischen der Praxis und der Theorie der Reflexion zugänglich gemacht wird. Marx geht es dem entsprechend um die systematische Analyse der die Lebenswirklichkeit der sozialen Akteure be- 22 2 Praxistheorie stimmenden gesellschaftlich-ökonomischen Verhältnisse. Diese Analyse, also die von Marx formulierte Kritik der politischen Ökonomie, versteht sich als Teil der Praxis, die von ihr untersucht wird. Wenn sich die gesellschaftliche Praxis nach Marx jedoch wesentlich im grundlegenden gesellschaftlichen Antagonismus zwischen Lohnarbeit und Kapital, also in praktischen Kämpfen manifestiert, die in eine dialektisch-teleologisch angelegte Geschichtsphilosophie eingeordnet werden, gerät der Marxsche Praxisbegriff in die Nähe einer Sozialmechanik, die sich am Kausalschema orientiert. Die Praxis des Klassenkampfes erscheint als Motor einer auf das Ziel des Kommunismus determinierten Geschichte. Dieser Determinismus ist ein wichtiger Kristallisationspunkt für die kritische Auseinandersetzung mit dem Marxismus durch Cornelius Castoriadis. Seine Sozialphilosophie orientiert sich zwar an der von Marx grundlegend vorbereiteten Reflexion der Differenz zwischen Theorie und Praxis, kommt jedoch über eine Kritik der marxistischen Geschichtsphilosophie zu einer Bestimmung des Praxisbegriff, die den Fallen des Funktionalismus und des Determinismus entgehen will. Dies macht sie für die soziologische Konturierung des Praxisbegriffs interessant.3 Nach Castoriadis erfordert es der Marxismus, „alles in kausalen Begriffen zu fassen und gleichzeitig in Sinnbegriffen zu denken; indem er behauptet, die Geschichte sei eine einzige ungeheure Kausalkette, die zugleich eine einzige, ungeheure Sinnkette sei, verschärft er die Spannung zwischen beiden Polen derart, dass das Problem keiner rationalen Behandlung mehr zugänglich ist“ (Castoriadis 1984: 91). Es ist in Castoriadis’ Lesart des Marxismus vor allem die marxistische Geschichtsphilosophie, die überwunden werden muss, um eine der sozialen Wirklichkeit angemessene Theorie der Praxis formulieren zu können. Jede teleologische Denkweise zwingt dem Geschehen eine gesetzmäßige Vernunft auf, die in Form von historischen Notwendigkeiten formuliert wird. Dagegen betont Castoriadis die Kontingenz der Praxis, indem er das „Nicht-Kausale“ (Castoriadis 1984: 77) menschlicher Tätigkeit hervorhebt: Das Nicht-Kausale „erscheint nicht nur als ‚unvorhersehbares’, sondern als schöpferisches Verhalten (der Individuen, Gruppen, Klassen, ganzer Gesellschaften); nicht bloß als Abweichung von einem bestehenden, sondern als Setzung eines neuen Verhaltenstyps; als Institution einer neuen gesellschaftlichen Regel, Erfindung eines neuen Gegenstandes oder einer neuen Form“ (Castoriadis 1984: 77). Die Begründung hierfür findet er in der Aussage, dass das lebende Wesen mehr ist als „bloßer Mechanismus“ (ebd.), denn es ist nach Castoriadis in der Lage, nicht nur in neuartigen, sondern auch in immer wieder gleichen Situationen neuartige Antworten zu geben sowie neue Situationen zu schaffen. Dies ist der Grund dafür, dass die Geschichte nicht in deterministischen Schemata oder dialektischen Mustern gedacht werden kann. Wird die Kausalität für menschliche Praxis verworfen, weil sie als kontingent und unvorhersehbar Die Sozialphilosophie Castoriadis’ dient mir hier als ein besonders interessantes Beispiel dafür, wie der Marxismus kultur- und symboltheoretisch erweitert werden kann. Weitere Ansätze für diese breite Theorietradition entstehen in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren vor allem im Umfeld der Cultural Studies und beziehen sich häufig auf Antonio Gramsci (vgl. 1967). Siehe hierzu vor allem Stuart Hall (1989), der die strukturalistische Variante des Marxismus, vor allem vertreten durch Louis Althusser, hinter sich lässt, indem er mit Gramsci kulturelle Praktiken als strukturierende Momente der Praxis herausarbeitet, und Lawrence Grossberg (1997), der den Ökonomismus des Marxismus dadurch zu überwinden sucht, dass er Kultur nicht nur als Ausdruck der ökonomischen Basis der Gesellschaft, sondern als wichtigen Bestandteil einer dynamischen Praxis fasst, sowie Ernesto Laclau (vgl. vor allem 1981: 176ff.), der über eine Dekonstruktion des Marxismus eine diskurstheoretische Erweiterung der Marx’schen Praxistheorie anstrebt. Ausgearbeitet findet sich dieser Versuch in Laclau und Mouffe (2000). 3 2 Praxistheorie 23 beschrieben wird, verbietet sich eine Rekonstruktion der Praxis in Kausalbegriffen, mit wichtigen Konsequenzen für die Beobachtung und Beschreibung der Praxis: Jede Festlegung von Ordnungsmodellen ist ausgeschlossen, weil jede auch nur sukzessive Annäherung an eine fachlich rationale Ordnung, „die vorab in der Welt schon existiert“ (Castoriadis 1981: 11), im Kontext des nicht-kausalen Praxisbegriffs als illusionär gelten muss. Es gibt für Castoriadis keine Möglichkeit, sich einer Ordnung schrittweise zu nähern oder sie systematisch auszumessen. Wissenschaft ist demnach eine Form von Praxis, die bestimmte Aufgaben erfüllen kann, indem hier Techniken „des Experimentierens, Argumentierens, Schließens oder auch der Psychoanalyse“ (ebd.: 88) angewendet werden. Die dabei entstehende bzw. angewendete Theorie kann „immer nur ein lückenhaftes und bruchstückhaftes Moment der Aufklärung“ (ebd.: 89) sein, weil keine Theorie „ihre Gewissheit aus sich selbst [hat], nicht einmal die Mathematik“ (ebd.). Die Theorie, die wissenschaftlichen Techniken sowie die Logik sind für Castoriadis deshalb keine Werkzeuge an sich, sie bekommen ihren „Sinn erst dann, wenn sie in eine aufklärerische Praxis eingebettet werden, die über jede Logik und jede Theorie hinausweist und deren Kriterien nicht ohne weiteres gehorcht“ (ebd.: 89). Deshalb muss wissenschaftliche Praxis selbstreflexiv verfahren, um im Anschluss an Aristoteles Kategorien des Denkens zu entwickeln.4 Die von Castoriadis notierten Grenzen wissenschaftlichen Denkens bedeuten für ihn keinen Freibrief für Relativismus und Beliebigkeit. Sie werden vielmehr genutzt, um das Problem der Wissenschaftsgeschichte im Rahmen der wissenschaftlichen Selbstreflexion aufzugreifen (vgl. Joas 1992a: 148). Dazu schließt Castoriadis an die Kritik des Marxismus eine allgemeine Kritik der Sozialwissenschaften an, deren wichtigster Kristallisationspunkt der soziologische Begriff der Gesellschaft ist: „Schon wenn es gilt, ihren Gegenstand [der Soziologie, F.H.] zu fassen, tritt eine entscheidende Schwierigkeit auf: Bildet das Gesellschaftliche eine Wirklichkeitsebene für sich, und was verbirgt sich hinter diesem Wort? Oder ist das, was wir damit bezeichnen, nur eine Ansammlung verschiedenartiger Realitäten, und welcher?“ (Castoriadis 1981: 173) Ein entscheidender Aspekt dieses Problems ist für Castoriadis die „Unmöglichkeit, das Gesellschaftliche auf das Individuelle zurückzuführen“ (ebd.). Der soziologische Zugang zur Gesellschaft kann daher nicht über eine Analyse der menschlichen Psyche gelingen. Er muss sich eines anderen Mittels bedienen, um Gesellschaft mit wissenschaftlichen Mitteln 4 Denken heißt für Castoriadis, dies sei der Vollständigkeit halber angemerkt, jedoch auch handeln; und zwar handeln mit einem Anderen (vgl. Castoriadis 1981: 89). Das Denken hat nur dann Sinn, wenn es in Handlungsbezüge eingebettet ist: „Dass man tatsächlich annehmen muss, es existierten überregionale Kategorien, denen ohne Rücksicht auf den Typus des betrachteten Gegenstandes überall derselbe volle Sinn zukommt, ist ... weder zufällig noch nebensächlich, sondern eine aus der innersten Organisation des herkömmlichen Denkens erwachsene Notwendigkeit. Dies bleibt selbst dann wahr, wenn dieses Denken jedem Gegenstandstyp eine besondere logische Organisation ausdrücklich zuzugestehen scheint. [...] Das herkömmliche Denken muss also in der Tat behaupten, der Ausdruck ‚ein‘ habe den nämlichen Sinn, gleichviel, ob es sich um einen Hilbert-Raum, eine Fabrik, eine Neurose, eine Schlacht, einen Traum, eine biologische Art, eine Bedeutung, eine Gesellschaft, einen Widerspruch, eine juristische Vorschrift, eine Ameise, eine Revolution oder ein Werk handelt. Es muss so tun, als habe ‚zugehören‘ in allen Bereichen und Instanzen, in denen man von einem ‚Zugehörigkeitsverhältnis‘ sprechen kann, dieselbe Bedeutung; und so fort. Nun sind diese Behauptungen augenscheinlich und unmittelbar falsch. Denn ‚ein‘ spielt nicht dieselbe Rolle in ‚ein Elektron‘, ‚eine große Liebe‘ oder ‚eine Feudalgesellschaft‘.“ (Castoriadis 1981: 187f.) 24 2 Praxistheorie fassbar zu machen. Eine Lösung dieses Problems sieht Castoriadis in der Beobachtung der gesellschaftlichen Sinnproduktion: „Natürlich kann keine Rede davon sein, die Gesellschaft im eigentlichen oder auch nur metaphorischen Sinne in ein ‚Subjekt’ zu verwandeln. Ausgehend von dem Imaginären, das unmittelbar an der Oberfläche des gesellschaftlichen Lebens wuchert, können wir zwar in das Labyrinth der Symbolisierungen des Imaginären eindringen. Und wenn wir die Analyse weit genug vorantreiben, kommen wir zu Bedeutungen, die nicht für etwas anderes stehen, sondern gleichsam die letzten Strukturen sind, die die betreffende Gesellschaft der Welt, sich selbst und ihren Bedürfnissen auferlegt hat – Organisationsschemata, die den Rahmen möglicher Vorstellungen abstecken, die sich diese Gesellschaft zu geben vermag.“ (Castoriadis 1984: 245f.) Der Begriff Gesellschaft wird auf die Sinnproduktion bezogen, weil Castoriadis es als Tatsache ansieht, „dass das gesellschaftlich-geschichtliche Feld niemals als solches, sondern immer nur über seine ‚Wirkungen’ zugänglich ist“ (Castoriadis 1984: 247). Gesellschaft und Sozialität erscheinen dann als symbolisch vermittelte Sinnzusammenhänge, die nur durch den Bezug auf einen imaginären Bedeutungshorizont entstehen können (vgl. Honneth 1990a: 134). Ganz in diesem Sinne hält Castoriadis eine Analyse der Sozialität nur für möglich, wenn gesehen wird, „dass die Welt, wie sie in ihrer Gesamtheit einer Gesellschaft gegeben ist, praktisch, affektiv und geistig in bestimmter Weise erfasst wird, dass ihr ein artikulierbarer Sinn auferlegt wird“ (Castoriadis 1984: 250). Castoriadis will demnach die Logik der gesellschaftlichen Sinnproduktion, die sich in Symbolbildung niederschlägt, analysieren, um eine Theorie der Praxis zu entwerfen. Dabei ist für ihn die Behauptung, „Sinn sei schlicht und einfach das Ergebnis einer Zeichenkombination“ (Castoriadis 1984: 237), nicht haltbar. Sinn ist immer etwas Imaginäres, das sich nicht in Gesetzmäßigkeiten erschöpft. Sinngebung ist konstitutiv mit der Einbildungskraft sozialer Akteure verbunden, also mit der Fähigkeit, den Dingen, Strukturen, Gesetzen und Mitakteuren spezifischen, individuell erzeugten Sinn zuzuschreiben. Deshalb lässt sich auch Praxis „nicht auf ein Zweck-Mittel-Schema zurückführen. Das Zweck-Mittel-Schema ist vielmehr gerade ein Kennzeichen technischer Tätigkeit, denn nur diese hat es mit einem wirklichen Zweck zu tun, einem Zweck (fin), der ein Ziel (fin) ist, der endlich und begrenzt ist und der als notwendiges oder wahrscheinliches Ergebnis angenommen werden kann“ (Castoriadis 1984: 129). Praxis ist also für Castoriadis konstitutiv mit schöpferischen Aspekten verquickt. Sie versetzt die Welt mit Sinn, der ursprünglich imaginär ist und nicht von der äußeren Welt diktiert wird, sondern den Dingen der äußeren Welt ihren Platz zuweist. Die Ordnung der Welt ist folglich immer eine imaginäre Ordnung, die sich dynamisch wandeln kann, wenn das Imaginäre in neuer Form erzeugt wird. Derartige Veränderungen der gesellschaftlichen Sinn- und Symbolebene fasst Castoriadis mit dem Begriff der Praxis, der quasi mit dem Begriff der Revolution zusammenfällt. Denn Praxis erscheint als die ganz bestimmte Art des Handelns, „worin der oder die anderen als autonome Wesen angesehen und als wesentlicher Faktor bei der Entfaltung ihrer eigenen Autonomie betrachtet werden“ (ebd.: 128). Praxis wird mit der revolutionären Energie einer Gesellschaft gleichgesetzt, die sich auf die Herstellung einer autonomen Lebensführung und einer authentischen Selbstverwirklichung 2 Praxistheorie 25 der Einzelnen in Solidarität und Freiheit bezieht. Praxis erscheint dadurch als ein besonderer, normativ definierter Handlungstyp, der die Kreativität des Handelns bezeichnet und auf ein utopisches Ziel gerichtet ist. Castoriadis setzt der marxistischen Dogmatik den ursprünglichen Sinn einer emanzipatorischen Praxis entgegen (vgl. Habermas 1985a: 382), indem er die revolutionäre Energie einer Gesellschaft in einem Praxisbegriff bündelt, der auf die imaginäre Symbolisierung und Sinnproduktion der Gesellschaft gerichtet ist. Der dadurch von ihm selbst reproduzierte Mythos der Revolution verstellt ihm den Blick auf die für eine soziologische Praxistheorie entscheidenden Fragen, ob Praxis nicht per se dynamisch gefasst werden muss und wie die Dynamik der Praxis bestimmt werden kann, wenn revolutionäre Tendenzen ausbleiben, die von Castoriadis selbst sehr voraussetzungsreich definiert werden. Denn auch ohne eine unwahrscheinliche Revolution ist die Dynamik der Praxis evident, was zur Analyse von Praxisformen nicht vernachlässigt werden darf. Ein soziologischer Begriff der Praxis kann mit anderen Worten das Praxisverständnis nicht auf eine Praxisform verengen, wie es in der Sozialphilosophie Castoriadis’ in Bezug auf Praxisformen der Revolution offensichtlich angestrebt wird. Einer soziologischen Theorie der Praxis kann es, anders gesagt, nicht nur um die Formulierung einer praktisch relevanten Theorie der Revolution gehen. Wird diese Schwäche seiner Theorie gesehen, können in Castoriadis’ sozialphilosophischem Gesellschaftsentwurf jenseits des Funktionalismus Anknüpfungspunkte für eine Theorie der Praxis gefunden werden: Die Hervorhebung der Bedeutung der gesellschaftlichen Symbolebene zur Identifikation von Praxisformen sowie die Betonung der prinzipiellen Kontingenz und Dynamik der Praxis, die sich nach Castoriadis nicht kausal rekonstruieren lässt, bieten gewinnbringende Anschlussstellen für eine Theorie der Praxis, wenn diese Annahmen für alle Praxisformen geltend gemacht werden. Dies lässt sich explizieren, wenn der Begriff der Praxis mit Grundannahmen einer allgemeinen Handlungstheorie korrespondiert wird. Dies erlaubt die Entwicklung eines soziologischen Praxisbegriffs, der sich zur Definition der Letztelemente der Sozialität als Praktiken eignet, der also die Konstruktion eines Instrumentariums zur Analyse der Sozialität ermöglicht. Charles Taylors Praxisphilosophie ist hierzu hilfreich, weil seine „interpretative Kulturtheorie“ (vgl. Reckwitz 2000: 484) deutlich grundlegender ansetzt als die Revolutionstheorie Castoriadis’. Taylor arbeitet sich nicht an einer Kritik des Marxismus ab und ist deshalb nicht wie Castoriadis bestrebt, die marxistische Theorie der Revolution zu präzisieren. Er stellt stattdessen die grundlegende Frage, warum menschliches Handeln nicht ursächlich auf Intentionen zurückgeführt werden kann und deshalb als Praxis bezeichnet werden muss. Folglich konturiert Taylor den Begriff Praxis im Kontrast zu rationalistischen und naturalistischen Theorien des Handelns, die er einer grundsätzlichen Kritik unterzieht. Nach Taylor gibt es keine radikale Wahl zwischen Handlungsalternativen. So genannte Handlungen sind immer auch Ausdruck des Selbst und der historischen, nicht artikulierbaren Erfahrung, die ein Handelnder gemacht hat. Wird etwa das Handeln bewertet, wird zwangsläufig auch das Selbst bewertet (vgl. Taylor 1988: 19). Anhand der Unterscheidung zwischen starker (qualitativer) und schwacher (quantitativer) Wertung wird die These plausibel gemacht, dass Handlungsoptionen sich nicht als objektivierbare Alternativen darstellen lassen und somit Handlungen nicht ausschließlich rational begründet werden können: „Der entscheidende Punkt bei der Einführung der Unterscheidung zwischen starken und 26 2 Praxistheorie schwachen Wertungen besteht in der Gegenüberstellung der unterschiedlichen Arten des Selbst, mit denen sie jeweils verknüpft sind.“ (Ebd.: 20f.) Gemeint ist, dass sich die Handlungsoptionen aus einer Authentizität des Selbst ergeben können. Sie orientieren sich an individuell für richtig gehaltene Werte. Handlungen und Entscheidungen des Einzelnen sind also mit Wertungen verbunden, die sich deshalb nicht objektiv bestimmen lassen, weil sie sich im Selbst bilden und dadurch individuell verschieden sind. Dies meint der Begriff der starken Wertungen, der sich auf die dem Selbst eigene Weltsicht bezieht, die nicht generalisiert werden kann. Wir bewerten die Welt nach Taylor also nicht nur in einem Prinzip der Rationalität, sondern auch im Prinzip der Wertorientierung, das sich auf individuelle Überzeugungen stützt, die sich nicht quantitativ, sondern nur qualitativ bestimmen lassen. Handlungen sind auf diese wertende Weltsicht bezogen und können nur dann als authentisch gewertet werden, wenn sie dieser Weltsicht nicht widersprechen. Starke, qualitative Wertungen, die sich in der Praxis durch Handlungen manifestieren, beziehen sich auf die Authentizität des Selbst und müssen von schwachen, quantitativen Wertungen unterschieden werden, die sich ausschließlich auf eine praktisch mögliche Nutzenmaximierung beziehen. Dies verdeutlicht für Taylor, „dass wir keine Wesen sind, deren einzige authentische Wertungen nicht-qualitativer Natur sind, wie dies die utilitaristische Tradition nahe legt“ (ebd.: 21). Es gibt demnach keine objektiv bestimmbaren Wahlalternativen zwischen Handlungsoptionen, weil die Werte des authentischen Selbst, die das Handeln bestimmen können, individuell erzeugte Werte sind, also einem individuellen, unvergleichlichen und deshalb nicht generalisierbaren Selbstentwurf entstammen. Daraus folgt für Taylor: „Das Subjekt radikaler Wahl ist eine weitere Manifestation jener immer wiederkehrenden Figur, die unsere Kultur zu realisieren trachtet – das entkörperlichte Ego, das Subjekt, das alles Sein objektivieren kann, einschließlich seines eigenen Selbst, und das in radikaler Freiheit wählen kann. Aber dieses Versprechen des totalen Selbstbesitzes bedeutet in Wahrheit den totalen Selbstverlust.“ (Taylor 1988: 38) Gegen den Utilitarismus formuliert Taylor die Einsicht, dass alle Praxis auf vielschichtige Bedingungen zurückgeführt werden muss. Diese Bedingungen lassen sich nicht allein und nicht vorrangig in den Intentionen der Akteure finden, sie sind eingebettet in die kulturellen Erscheinungsformen sowie in die inkorporierten Strukturen der Akteure, die sich im Verlauf der Praxis wandeln. Die von der utilitaristischen oder voluntaristischen Handlungstheorie aufgestellten Regeln des Handelns sind für Taylor keine Regelmäßigkeiten der Praxis. Diese Regelmäßigkeiten lassen sich nicht ahistorisch bestimmen, weil sie sich im Verlauf der Praxis wandeln und praktischen Anforderungen angepasst werden. Das Insistieren der Philosophie auf Wahlalternativen des Handelns hält Taylor für eine wenig reflektierte Erscheinungsform der modernen Kultur, die sich zwar für bestimmte Zwecke einsetzen lässt, die jedoch zur Aufklärung über die Praxis nur bedingt nützlich ist, weil sie die Bedingungen für Praxisformen zu einfach in Handlungsregeln der radikalen Wahlalternative sucht und zudem in das Innere von Subjekten verlegt, die dadurch als der Praxis enthoben erscheinen. Ebenso entschieden wie gegen den Utilitarismus einer am Subjektivismus orientierten Handlungstheorie wendet sich Taylor dagegen, die Bedingungen für Praxis ausschließlich 2 Praxistheorie 27 in den Strukturen der Gesellschaft zu suchen, wie es strukturalistische Theorien der Praxis tun. Der tiefere Sinn dieser doppelten Kritik der soziaphilosophischen Tradition, der sie für die Soziologie höchst interessant macht, erschließt sich bei einer Betrachtung der von Taylor (vgl. 1988: 227ff.) vorgenommenen Interpretation des von Michel Foucault in seinem mittleren Werk entwickelten Verständnisses von Praktiken der Disziplin. Betrachtet man den von Foucault hier verwendeten Begriff Praktiken, drängt sich der Verdacht auf, dass in Bezug auf Praktiken der Herrschaft und der Disziplin eine mechanische, kausal rekonstruierbare Verkettung der Praktiken behauptet werden kann. Foucault konzentriert sich in seinen materialen Analysen (vgl. vor allem Foucault 1969; 1977) primär auf das Aufdecken moderner Machtpraktiken und verwendet hier sehr häufig den Begriff des Mechanismus, um die Mechanik der modernen Beziehungen zwischen Akteuren besonders zu betonen: „Man muss die Archäologie der Humanwissenschaften auf die Erforschung der Machtmechanismen gründen, die Körper, Gesten und Verhaltensweisen besetzt haben.“ (Foucault 1976: 111) In postulierten bzw. konstruierten Zusammenhängen, in denen strukturelle Bedingungen die Praxis fast vollständig bestimmen, ist nach Foucault offensichtlich eine Mechanik der Praktiken feststellbar. Dabei verweist die Foucaultsche Verwendung des Begriffs „Kräfteverhältnisse“ (Foucault 1978: 72) auf die Verortung der Macht in den Räumen zwischen den sozialen Akteuren, also in den Relationen der Positionen, die soziale Akteure besetzen. Foucaults Schlussfolgerung aus seiner Genealogie der sich in Kräfteverhältnissen manifestierenden Machtpraktiken ist bekannt: Praktiken der Disziplin beherrschen die gesamte Gesellschaft, weil sie in alle Bereiche des menschlichen Lebens eindringen. Für Foucault hat sich in der Moderne die Gesellschaft umfassend und irreversibel als Disziplinargesellschaft geformt (vgl. hierzu Hillebrandt 1997). Sie wird quasi als Metagefängnis verstanden, das alle denkbaren Kräfteverhältnisse mit den Praktiken der Disziplin ausfüllt: „In den Disziplinen kommt die Macht der Norm zum Durchbruch. Handelt es sich dabei um das neue Gesetz der modernen Gesellschaft? Sagen wir vorsichtiger, dass seit dem 18. Jahrhundert die Macht der Norm zu anderen Mächten hinzutritt und neue Grenzziehungen erzwingt [...]. Das Normale etabliert sich als Zwangsprinzip im Unterricht zusammen mit der Einführung einer standardisierten Erziehung und der Errichtung der Normalschulen; es etabliert sich in dem Bemühen, ein einheitliches Korpus der Medizin und eine durchgängige Spitalversorgung der Nation zu schaffen, womit allgemeine Gesundheitsnormen durchgesetzt werden sollen; es etabliert sich in der Regulierung und Reglementierung der industriellen Verfahren und Produkte.“ (Foucault 1977: 237) Taylor weist nun darauf hin, dass sich Praktiken nicht auf Formen der Disziplinierung und Herrschaft begrenzen lassen. Er spricht der Genealogie Foucaults lediglich für diese Praxisformen eine gewisse Plausibilität zu: „Die Disziplinen (...), die diese neue Existenzweise [von Macht- und Herrschaftspraktiken; F.H.] hervorbringen, sind gesellschaftlicher Natur; sie sind die Disziplinen der Kaserne, der Schule, der Fabrik. Aufgrund ihres spezifischen Charakters eignen sie sich zur Beherrschung der einen durch die anderen. In diesen Zusammenhängen besteht das Einprägen eines Habitus der Selbstkontrolle häufig darin, dass den einen die Disziplin von den anderen aufgezwungen wird. Dies sind die Orte, an denen Herrschaftsformen durch ihre Verinnerlichung befestigt werden.“ (Taylor 1988: 200) 28 2 Praxistheorie In der Sicht Taylors wird der innere Zusammenhang von Naturbeherrschung und Herrschaft über den Menschen von Foucault prägnant beschrieben. Gegen die mechanische Verwendung des Begriffs der Praktiken betont Taylor jedoch berechtigterweise, dass es keine Deckungsgleichheit etwa zwischen den Regeln der Kaserne und der Praxis in der Kaserne geben kann. Richtig ist zwar: Praxisformen der Herrschaft bilden sich aus Praktiken in bestimmten Feldkonstellationen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Strukturen der Kaserne alle Praktiken in der Kaserne determinieren, wie es Foucault in seinem mittleren Werk noch suggeriert. Foucault selbst kann diese Suggestion nicht lange aufrechterhalten, weil er die Disziplinierung und Normalisierung der Einzelnen nicht für nützlich zur Reproduktion der Gesellschaft hält. Er sieht hier einen Destruktionsmechanismus, in dem des Reich der Freiheit letztlich vollständig verschwindet. Seine totale Kritik der Gegenwartsgesellschaft begreift, ähnlich wie der Marxismus und die Kritische Theorie, die modernen Disziplinar- und Normalisierungspraktiken als emergente und produktive, weil gesellschaftliche Dispositive wie das Gefängnis hervorbringende Strukturen, die über ihre Verselbständigung und massenhafte psychische Internalisierung individuelle Freiheit bis zur Unkenntlichkeit destruieren.5 Die Disziplinierungen und Normalisierungen der Einzelnen sind für Foucault also alles andere als Bedingungen der Möglichkeit individueller Freiheit. Die Genealogie der Disziplinargesellschaft hat schließlich das Ziel, die die Freiheit einschränkenden Strukturen der Gegenwartsgesellschaft zu entlarven und dadurch kritisierbar zu machen. Kritik ist dabei für Foucault „die Kunst, nicht dermaßen regiert zu werden“ (Foucault 1992: 12). Deshalb muss Foucault seine eigene Annahme einer totalen Vergesellschaftung des Einzelnen durch die modernen Disziplinartechniken schon bald selbst in Frage stellen. Denn nur wenn es in der Gesellschaft und in den Individuen etwas gibt, „das durchaus nicht ein mehr oder weniger fügsamer oder widerspenstiger Rohstoff ist, sondern eine zentrifugale Bewegung, eine umgepolte Energie, ein Entwischen“ (Foucault 1978: 204f.), kann sich die Kunst, nicht dermaßen regiert zu werden, überhaupt herausbilden. Taylor bezieht sich in seiner Kritik der Theorie der Disziplinargesellschaft auf derartige Aussagen Foucaults und kommt dabei zu folgendem Schluss: Foucaults Theorie „lässt außer Betracht – oder genauer, sie verdeckt – die Möglichkeit eines Wandels der Lebensformen, der als ein Schritt hin zu größerer Akzeptanz der Wahrheit begriffen werden kann und somit auch, unter bestimmten Bedingungen, als ein Schritt hin zu größerer Freiheit“ (Taylor 1988: 229). Die Foucaultsche Genealogie der Selbstpraktiken, die nach Taylors Kritik formuliert wird, nimmt mit anderen Begriffen genau diesen Gedanken auf (vgl. zur Dokumentation seiner späteren Philosophie Foucault 2004). Dies wird deutlich, wenn Foucault Praktiken der Macht von Praktiken des Selbst unterscheidet. Der Einzelne wird in Foucaults Spätwerk als fähig betrachtet, sich selbst zu erschaffen. Er kann den Disziplinar- und Normalisierungspraktiken der modernen Gesellschaft über seine Selbstpraktiken „entwischen“. Die Sichtweise, die moderne Gesellschaft forme den Menschen vollständig über Disziplinstrukturen, wird somit von Foucault selbst in Zweifel gezogen, indem er in seinem Spätwerk die modernen Selbstpraktiken in das Zentrum seiner Genealogie rückt. Über diesen Perspekti- 5 Wie diese von Marx ausgehende Denktradition der radikalen Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen auch durch die Produktion von literarischen Texten reproduziert wird, habe ich an anderer Stelle (vgl. Hillebrandt 2004a) am Roman „Gravity’s Rainbow“ von Thomas Pynchon nachgezeichnet. 2 Praxistheorie 29 venwechsel wird deutlich, dass nicht alle humanen Dispositionen Produkte der Disziplinstruktur sind (vgl. Hillebrandt 2000: 203-209). In praxistheoretischer Perspektive ist diese Wende in Foucaults Werk ein Indiz dafür, dass die Annahme einer disziplinierenden und normalisierenden Integration der Gesellschaft durch die gesellschaftliche Determination der zu ihr in Beziehung stehenden Menschen auf sehr dünnem Fundament steht und letztlich nicht haltbar ist. Deshalb ist Taylor zuzustimmen, wenn er gegen den versteckten Strukturalismus der Foucaultschen Genealogie der Machtpraktiken sagt: „Der Struktur absolute Priorität einzuräumen macht genauso wenig Sinn wie der gleiche und konträre Irrtum des Subjektivismus, der dem Handeln als einer Art von totalem Neubeginn absolute Priorität einräumte.“ (Taylor 1988: 220) Taylor erweist sich mit derartigen Formulierungen als Philosoph der Praxis, der jede strikte Festlegung auf theoretische Logiken und Gesetzmäßigkeiten zur Beschreibung der Praxis ablehnt. Ob diese Logik aus einer Subjektperspektive oder aus einer strukturalistischnaturalistischen Perspektive formuliert ist, macht für Taylor zunächst keinen Unterschied, weil es ihm auf das Prinzip ankommt, die Praxis nicht verstehen zu können, wenn man sie in enge, ahistorisch festgelegte Regel- und Gesetzessysteme zwingt. Strikte theoretische Regelsysteme, woher sie auch immer abgeleitet werden, reichen nicht, um ein angemessenes Verständnis der Praxis zu gewinnen. Auf eine einfache Formel gebracht heißt das: Wer die Regeln der Praxis zu kennen glaubt, kennt noch nicht die Praxis.6 Dieser Gedanke hat in der Philosophie spätestens seit Ludwig Wittgenstein Tradition. Wittgenstein (vgl. 1984: 345) hatte in seinem bekannten Regel-Regress-Argument in Bezug auf die Verwendung der Sprache darauf aufmerksam gemacht, dass das Folgen einer (Sprach)Regel Praxis ist, dass also die Regeln, wie sie logisch konstruiert und empirisch nachgezeichnet werden können, in ihrer Befolgung zwangsläufig geändert werden. Keine Regel lässt sich demnach praktisch umsetzen. Wenn die Regel praktisch wird, ändert sie sich unweigerlich. Als scheinbare Lösung dieses Problems können Regeln aufgestellt werden, wie Regeln zu befolgen sind, um weitere Regeln aufzustellen, wie diese Regeln wiederum befolgt werden müssen, usw. Die Differenz zwischen einer konsistent und logisch formulierten Regel und der praktischen Anwendung dieser Regel lässt sich dadurch nicht verwischen. Dieser Regel-Regress verdeutlicht, dass der Regel folgen immer etwas anderes ist als die Regel selbst (vgl. Brandom 2000a: 59ff.).7 Daraus lässt sich schließen: Ebenso wie eine Handlungstheorie, die das Handeln der sozialen Akteure methodisch aus deren regelgeleiteten, nomologisch bestimmten Intentionen ableitet, ins Leere laufen muss, läuft auch eine Strukturtheorie ins Leere, die das gesellschaftliche Geschehen aus den objektiven Strukturen der Gesellschaft quasi naturalistisch ableitet. Dennoch haben beide Sichtweisen, die sich im soziologischen und sozialphilosophischen Diskurs zumeist gegenseitig ausschließen, eine gewisse Berechtigung. Dies wird bei einem Blick auf Robert B. Brandoms breit angeleg6 Und umgekehrt gilt gleichsam: Wer die Praxis zu kennen glaubt, kennt nicht zwangsläufig auch die Regeln der Praxis. 7 So ist die Aussage Nr. 202 in Wittgensteins (1984: 345) Philosophischen Untersuchungen: „Darum ist ‚der Regel folgen’ eine Praxis“, zu verstehen.