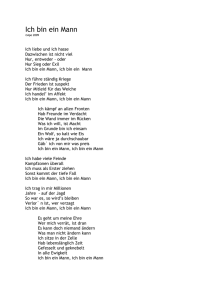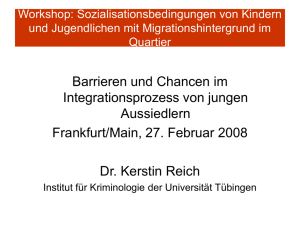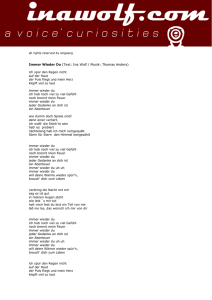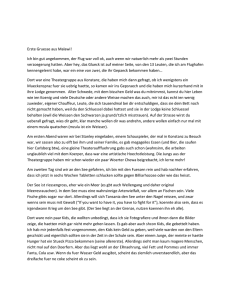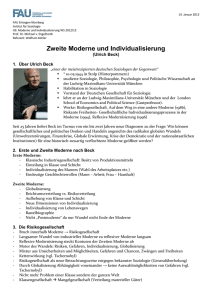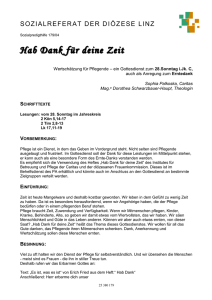Die subjektive Sicht von Kindern und Jugendlichen mit
Werbung

Die subjektive Sicht von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte auf ihr Lebensumfeld. Expertise zum 9. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Nordrhein-Westfalen Die Expertise wurde im Auftrag des Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen und Integration (MGFFI) NRW erstellt von der: Fachhochschule Köln, Institut für interkulturelle Bildung und Entwicklung (INTERKULT) Prof. Dr. Markus Ottersbach Dipl. Soz.päd. Solveigh Skaloud Dipl. Soz.päd. Andreas Deimann Mai 2009 Inhalt Einleitung 4 1. Einige Vorbemerkung zur subjektiven Sichtweise und deren Relevanz 8 1.1 Verortung und zeitliche Einordnung der Subjektivität als Produkt der Individualisierung 8 1.2 Die Ambivalenzen der Individualisierung 10 1.3 Das Zusammenspiel von Individualisierung, Pluralisierung und Globalisierung und 1.4 dessen Auswirkungen auf die Subjektivität 12 Die subjektive Sichtweise als Produkt und Reflexion des Lebensumfelds 15 2. Das Lebensumfeld von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte 2.1 Die zentralen Aspekte der systemischen Integration von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte 2.2 19 Die zentralen Aspekte der sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte 2.3 18 30 Mögliche Ursachen für das prekäre Lebensumfeld von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte 39 3. Die subjektive Sichtweise von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte auf ihr Lebensumfeld in der Literatur 47 2 4. Empirische Studie zur Erkundung der subjektiven Sichtweise von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte auf ihr Lebensumfeld 57 4.1 Fragestellung, Forschungsdesign und Sample der empirischen Untersuchung 57 4.2 Ergebnisse der Studie 62 4.2.1 Nachkommen der Arbeitsmigration 63 4.2.2 Spätaussiedler/innen 72 4.2.3 Asylmigration 82 4.2.4 Deutsche ohne Zuwanderungsgeschichte 90 5. Fazit 98 Anhang 102 Literatur 104 3 Einleitung Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte sind schon längere Zeit Objekte öffentlicher und speziell auch wissenschaftlicher Diskurse. Lange Zeit hat man sie in beiden Bereichen jedoch eher als „Problemgruppen“ betrachtet, sei es, dass sie entweder als „kriminell“ oder als „fundamentalistisch orientiert“ gebrandmarkt wurden. Sie waren Teile des allgemeinen Diskurses über Migrantinnen und Migranten, in dem immer wieder auf die angeblich hohe Relevanz einer „Parallelgesellschaft“ hingewiesen wurde; mit der subjektiven Sichtweise dieser Gruppen hat man sich jedoch nur selten ernsthaft auseinandergesetzt. Seit den wichtigen rechtlichen Reformen, der Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes und der Novellierung des Zuwanderungsgesetzes, dem öffentlichen Bekenntnis auch konservativer Kreise, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, und der Bekanntwerdung realer demographischer Zahlen durch den Mikrozensus im Jahr 2005 hat sich der Diskurs über Migration und Integration schrittweise und entscheidend gewandelt. Diese Änderung der Perspektive war enorm wichtig, um Integration zu ermöglichen und sie vor allem gerechter und effektiver zu gestalten. Die subjektive Sichtweise des Lebensumfelds von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte zu erkunden, ist im Rahmen der gesellschaftlichen Aufgabe der Integration nochmals besonders bedeutsam, weil damit einerseits der Partizipationsaspekt dieser Gruppen gestärkt und andererseits die Voraussetzungen für effektives politisches und pädagogisches Handeln geschaffen werden. Die Expertise will deshalb auch versuchen, den diesbezüglich bisher vernachlässigten Gruppen der Kinder und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte durch die Präsentation ihrer subjektiven Sichtweise in der Öffentlichkeit mehr Gehör zu verschaffen. Ziel der Untersuchung ist es zunächst, die Entwicklung und die Relevanz der subjektiven Sichtweise zu verdeutlichen (Kapitel 1). Die subjektive Sichtweise ist ein Produkt der Individualisierung, die in zwei Schritten erfolgte: Die erste Phase beginnt mit der Industrialisierung bzw. der Aufklärung und die zweite Phase startet mit der Entwicklung der Wohlfahrtssysteme in den westlichen Staaten seit der Nachkriegszeit. Ein weiteres Ziel ist, das Lebensumfeld der Kinder und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte in Nordrhein-Westfalen darzustellen (Kapitel 2). Dafür wird einerseits die systemische Integration und andererseits die soziale Integration von Kindern und Jugendlichen mit Zuwande4 rungsgeschichte in Nordrhein-Westfalen beschrieben1. Mit der systemischen Integration ist die Eingliederung der Menschen in die gesellschaftlichen Funktionssysteme der Bildung, der Arbeit, der Politik, der Gesundheit und des Wohnens gemeint. Hier steht ergo die gesellschaftliche Partizipation im Mittelpunkt der Betrachtung. Die soziale Integration bezieht sich u.a. auf die kulturellen Werte und Traditionen, die sozialen Bindungen und auf das Rollenverhalten. Sie impliziert die Entwicklung der Persönlichkeit und der Identität jeder einzelnen Person in unserer Gesellschaft. Beachtet werden muss, dass systemische und soziale Integration nicht linear verlaufen müssen. Nicht selten gibt es Fälle, in denen die systemische Integration als erfolgreich einzustufen ist, die soziale Integration aber als problematisch bezeichnet werden muss2. Umgekehrt bleibt eine problematische systemische Integration bei gleichzeitig erfolgreicher sozialer Integration jedoch eher eine Ausnahme. Der Einfluss der systemischen Integration auf die soziale ist weitaus höher als umgekehrt. Nach der Klärung der Entwicklung und der Relevanz der subjektiven Sichtweise und der Darstellung der zentralen Aspekte des Lebensumfelds der Kinder und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte in Nordrhein-Westfalen geht es um die Darstellung der aktuellen Literatur zur Thematik (Kapitel 3). Hier werden wir uns auf Studien konzentrieren, die die subjektive Sichtweise des Lebensumfelds der Kinder und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte mittels qualitativer Methoden versucht haben zu erkunden. Zum Schluss wird es in dieser Expertise um die Präsentation einer eigenen Studie zur subjektiven Sichtweise des Lebensumfelds von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte gehen (Kapitel 4). Konkrete Forschungsfragen dieser Studie sind demnach: • Welche sind die zentralen Kategorien oder Aspekte des Lebensumfelds von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte? • Wie gehen diese Kinder und Jugendliche mit diesen Aspekten ihrer Lebenssituation um? Welche Bewältigungsformen haben sie entwickelt? Wie erfolgreich sind sie damit? 1 Die Differenzierung zwischen Systemintegration und sozialer Integration geht auf Habermas (1988) zurück und ist ein allgemein akzeptiertes Modell der gesellschaftlichen Integration in den Sozialwissenschaften. 2 Zu denken ist hier an Personen, die z.B. über einen hohen Bildungsgrad, einen gesicherten Arbeitsplatz und ein ho- hes Einkommen verfügen, sich jedoch gleichzeitig an fundamentalistischen Werten und Traditionen orientieren und ein klassisches Rollenverhalten pflegen. Solche Fälle finden sich im Übrigen in unterschiedlichen Milieus und unabhängig von der Staatsangehörigkeit. 5 • In welchen Bereichen können Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte in Nordrhein-Westfalen ihr Leben selbst gestalten bzw. wo sehen sich Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte eher fremdbestimmt, abhängig von Personen oder sozialen Bedingungen? Auch und gerade Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte erleben in Deutschland eine individualisierte Jugendphase. Wie alle Kinder und Jugendliche stehen sie zwischen Autonomie und Anpassung • im Familiensystem • im Erziehungs- und Bildungssystem • beim Übergang von der Schule in den Beruf und • in sozialen Netzwerken. Allgemein von vielfältigen Faktoren geprägt (Status der Eltern, Bildung, Gesundheit, Wohnen, politische Partizipation, Freizeit) kommen bei Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte Aspekte hinzu, die direkt mit der Migration zusammenhängen: • unterschiedliche Migrationsmotive und Integrationsverläufe • unterschiedliche Aufnahmebedingungen und soziale Erwartungen im Einwanderungsland. Zweifellos gibt es „die“ Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte nicht als eine homogene soziale Gruppe. Dies hat einmal mehr die aktuelle SINUS-Studie zu Migrant(inn)enMilieus verdeutlicht. Innerhalb der Gruppe der Kinder und Jugendlichen, als deren gemeinsames Merkmal die Zuwanderungsgeschichte gilt, ist eine große Heterogenität von Lebenslagen und Lebensstilen zu finden. Um die Nuancen der Zuwanderung angemessen zu berücksichtigen, werden drei Formen der Zuwanderung unterschieden: • Arbeitswanderungen und Familiennachzug • Zuwanderung von Asylsuchenden • Spätaussiedler(innen) und Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS). Angenommen wird, dass die subjektive Sicht von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte auf ihr Lebensumfeld durch die Form der Zuwanderung objektiv vorstrukturiert ist. 6 Diese Annahme wird mit sechs qualitativen Leitfadeninterviews überprüft, von denen jeweils zwei einer der drei Zuwanderungsformen entsprechen. Pro Zuwanderungsform wurden ein Mädchen und ein Junge im Alter von 12-25 Jahren interviewt, um auch mögliche Geschlechterdifferenzen aufzunehmen. Um Kulturalisierungen vorzubeugen, wurden zudem noch zwei weitere Interviews mit Kindern und Jugendlichen ohne Zuwanderungsgeschichte durchgeführt. 7 1. Einige Vorbemerkung zur subjektiven Sichtweise und deren Relevanz 1.1 Verortung und zeitliche Einordnung der Subjektivität als Produkt der Individualisierung Die hohe Relevanz, die moderne Gesellschaften der subjektiven Perspektive der Menschen zuweisen, ist sowohl historisch bedingt als auch territorial beschränkt. Mit anderen Worten: Weder im Mittelalter noch in Gesellschaften, in denen ein großer Teil der Einwohner/innen von Armut betroffen ist, spielt die subjektive Sichtwiese eine wichtige Rolle. Ganz anders in den westlichen Gesellschaften, die in der Tradition der Aufklärung bzw. der Individualisierung stehen: Säkularisierte und industrialisierte, demokratische Gesellschaften heben immer wieder den Wert des Individuums, des Einzelnen und seiner besonderen, subjektiven Sichtweise hervor. Insofern kann man behaupten, die subjektive Perspektive ist ein Produkt örtlicher Beschränktheit und zeitlicher Entwicklung, d.h. der westlichen, reflexiv gewordenen Moderne (Beck), deren Kern die Individualisierung darstellt. Dabei ist der örtliche kaum vom zeitlichen Bezug der Entwicklung der Subjektivität zu trennen: Insbesondere in den hoch industrialisierten Ländern des Westens, in denen die Religion ihren Anspruch absoluter Wahrheit eingebüßt hat, spielt die Individualität eine zentrale Rolle. Zwei Stränge sind zentral: die Industrialisierung und die Aufklärung. Die Industrialisierung, die sich zunächst in den westeuropäischen Ländern und später auch in der Neuen Welt ausbreitete, hat die Vorbedingungen geschaffen, damit Wohlstand zum Leit- und Sinnbild ganzer Gesellschaften in West- und Mitteleuropa und später in Nordamerika avancieren konnte. Dieser erste, durch die Begründung einer neuen Produktionsweise eingeleitete Schritt der Individualisierung, geht bekanntermaßen einher mit der Arbeitsteilung bzw. der Trennung von Wohnen und Arbeiten, mit dem Beginn der bürgerlichen Gesellschaft, der Zunahme ökonomischer und utilitaristischer Beziehungen, der Zerrüttung traditioneller sozialer (Ver-)bindungen, dem Zerfall der Lebensform des „Ganzen Hauses“ und der dörflichen Gemeinschaften und der Zunahme der Bedeutung des Individualismus als bürgerliches Ideal, wie es sich z.B. in Form der „Liebesheirat“ oder der Selbstverwirklichung realisierte. Der zweite, durch die Expansion wohlfahrts- und sozialstaatlicher Modelle in der Nachkriegszeit geprägte Schritt der Individualisierung stellte eine Radikalisierung und Universalisierung des Prozesses der Individualisierung dar und ging einher mit dem so genannten „Fahrstuhl-Effekt“ (Beck 1986), der für die breite Masse der Bevölkerung ein Mehr an Einkommen, eine Reduzierung der Arbeitszeit und eine Verlängerung der Lebenszeit bedeute8 te. Die Zunahme des Wohlstands für alle zog einen weiteren Ausbau an Wahlmöglichkeiten nach sich, nicht nur in Bezug auf Beruf und Arbeit, sondern vor allem bezüglich der Pluralisierung der Lebensstile und Beziehungsformen. Allerdings implizierte die Zunahme an Wahlmöglichkeiten für alle gleichzeitig den Zwang zur Wahl (Sartre). Kennzeichen der heutigen Gesellschaft ist nach Beck (1996) die reflexiv gewordene Moderne, in der die Bedeutung des Individuums und dessen Konkretisierung als Träger einer eigenen Identität nochmals deutlich zunimmt. Konnte Identität im Zuge der Nationalstaatsentwicklung und dessen Festigung noch lange Zeit nationalstaatlich als eine kollektive konstruiert und geprägt werden, so entwickelt sie sich im Kontext der Globalisierung und des Bedeutungsverlusts nationalstaatlicher Befugnisse einerseits und kultureller Traditionen andererseits immer mehr zu einer hochindividuellen, patchworkartigen Identität, bei der die individuelle Biografie, die Selbstbestimmung und die Eigenverantwortung inzwischen eine dominante Stellung einnehmen. Neben der Industrialisierung ist der zweite Strang der Individualisierung die Aufklärung: Während vor der Aufklärung die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens noch weitestgehend religiös geprägt, sprich gottgegeben war, eröffnete sich für die Menschen im Zuge der Säkularisierung und noch deutlicher im Zuge des Dominanzverlusts der bürgerlichen Gesellschaft Mitte des 20. Jahrhunderts ein mannigfaltiges Angebot in Bezug auf das Verständnis bzw. die Erklärung des Lebensursprungs, des Lebenssinns und auch in Bezug auf Werte und moralische Vorstellungen. Komplettiert wird der Bedeutungsverlust der „großen Erzählungen“ (Lyotard) durch den Niedergang des Kommunismus. Damit sind die großen Vorbilder ad acta gelegt, der Mensch ist fortan dazu verurteilt, sich in seiner Freiheit zu Recht zu finden. Für alles wird er nun als individueller Entscheidungsträger verantwortlich gemacht, sei es, wenn es um die Wahl des Lebenspartners/der Lebenspartnerin, um die Bewältigung von Arbeitslosigkeit oder um die Abtreibung eines behinderten Kindes geht: die Freiheit des Individuums schlägt um in eine Nichthintergehbarkeit der Verantwortung für sein Handeln. Auch in der Wissenschaft spiegelt sich inzwischen die Bedeutungszunahme der subjektiven Sichtweise wider. So wird in der Sozialforschung die individuelle Perspektive immer wieder gerne abgefragt. In quantitativen Studien geht es neben den so genannten „harten“ Daten der ökonomischen, rechtlichen und sozialen Lebenssituation meist auch um die Lebenszufriedenheit der Menschen. In qualitativen Studien wird per se auf die subjektive Sichtweise großen Wert gelegt. Hier geht es ja geradezu vor allem um die Erkundung der eigenen, subjektiv gefärbten Perspektive der Befragten. 9 1.2 Die Ambivalenzen der Individualisierung In der soziologischen Literatur der letzten Jahre fand wohl kaum ein Begriff so viel Aufmerksamkeit wie das Phänomen der Individualisierung. Fast zwangsweise neigt man dazu zu sagen, dass dies der Grund für seine diffuse Interpretation ist3. Im Folgenden beziehe ich mich bei der Darstellung des Phänomens der Individualisierung auf die von Beck (1986, S. 205ff.) aufgenommene und weiterentwickelte These der Individualisierung moderner Gesellschaften. Die Individualisierung bedeutet zunächst nichts anderes als Steigerung von Individualität durch Enttraditionalisierung. Die bis dahin gültigen Kontrollnetze mit einer klaren und geschlossenen Weltanschauung und funktionierenden Autoritätsverhältnissen werden zugunsten eines Zuwachses an neuen Optionen, Freiheiten, Wahlmöglichkeiten und Chancen einer individuellen Lebensgestaltung abgelöst. Zwar gab es bereits in der Renaissance, in der höfischen Kultur des Mittelalters und im Protestantismus individualisierte Lebensstile. Allerdings nimmt die Individualisierung jetzt eine neue Gestalt und vor allem ein neues Ausmaß an. Die Lockerung familiärer Bindungen, die Anhebung des Bildungsniveaus und des verfügbaren Einkommens, eine veränderte Lage der Frauen, die Verrechtlichung von Arbeitsbeziehungen, ein verändertes Freizeitverhalten, neue Technologien, der Ausbau des Sozialstaats4, veränderte Wohnverhältnisse, die zunehmende Mobilität und der Bedeutungsverlust der Religiosität sind die Konturen dieser Veränderungen. Damit verbunden ist eine Aufwertung des Individuums, eine Subjektzentrierung. Der Enttraditionalisierungsprozess impliziert gleichzeitig eine qualitative Änderung zwischen Individuum und Gesellschaft. Die Produktion neuer Beziehungen, Traditio3 Eine aktuelle und immer mehr Beachtung findende eindimensionale Interpretation der Individualisierung findet sich z. B. in den Schriften Heitmeyers (z.B. 1994, S. 29ff.; 1996, S. 33ff.). In Rekurs auf Beck hebt Heitmeyer lediglich die „Schattenseiten“ der Individualisierung hervor, „halbiert“ und entwertet also das – konstruktivistisch gesehen – „Konzept“ von Individualisierung. Beck (1993, S. 153f.) selbst hat gegen eine Reduzierung der Individualisierung opponiert. Vgl. zu den Implikationen dieses Ansatzes und der Kritik daran Ottersbach/Yildiz 1997. 4 Diese Entwicklung gilt für die Zeit bis zur „Wende“ 1983. Danach ist der Sozialstaat sukzessiv zurückgefahren worden mit der Konsequenz, dass für ein Drittel der Gesellschaft einzelne Faktoren der Individualisierung wieder eingeschränkt worden sind. Die „Wahl“ ist durch die systematische Benachteiligung der unteren Einkommensschichten (vor allem der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger(innen) zur Farce geworden. Interessant ist jedoch, dass diese Entwicklung wiederum neue Formen des zivilgesellschaftlichen Engagements fördert und bewirkt, wie man es z.B. in der neuen Arbeitslosenbewegung, die zudem auf europäischer Ebene agiert, sehen kann. 10 nen und Verhaltensmuster beruht nämlich auf Selbstverantwortung und Selbststeuerung bzw. auf Selbst-Organisation und Selbst-Politik, wie Beck (1997b, S. 184ff.) betont5. Eingebettet sind diese Veränderungen in eine immer stärker voranschreitende Ausdifferenzierung und Spezialisierung gesellschaftlicher Subsysteme (Luhmann)6, die Zunahme bürokratischer Verfahren und eine Rationalisierung der zur Verfügung stehenden Zeit. Die individuell ausgestaltete Terminierung des Alltags führt langfristig gesehen zu individuell konstruierten Biographien, zu so genannten „Bastelmentalitäten“ (vgl. Gross 1985). Die Individualisierung ist jedoch in zweifacher Hinsicht ein ambivalenter Prozess: Erstens impliziert er sowohl einen Auf- als auch einen Ablösungsaspekt. Der Auflösungsaspekt bezieht sich vor allem auf Traditionsbestände, die in modernen Industriegesellschaften einen elementaren Wandel erfahren haben. Unmittelbar damit verbunden ist jedoch ein produktiver Ablösungsaspekt, d.h. es entstehen neue Traditionen, die von nun an Gültigkeit beanspruchen7. Die Ablösung alter durch neue Formen gesellschaftlicher Integration ist also nur vordergründig ausschließlich eine Bedrohung (vgl. Beck 1997a, S. 32). Im Grunde genommen ist sie auch eine Chance, denn die neue Vergesellschaftungsform berücksichtigt einen höheren Grad an Individualität, Selbstverantwortung und an Freiwilligkeit, zumindest was den sozialen und kulturellen Bereich anbelangt. Zweitens ist die Individualisierung eine neue Standardisierung. Die freiwillige Wahl sozialer Beziehungen und Traditionen hat nämlich einen Pferdefuß, sie basiert auf neuen Standardisierungen wie dem Zwang zur Wahl, zur individuellen Rechtfertigung und zur persönlichen Übernahme der mit dieser Wahl verbundenen Risiken8. Alle möglichen Krisen des Lebens sind von nun an 5 Im Grunde genommen geht diese Form der Politik bereits auf die Vorstellungen Foucaults von der „Kultur seiner selber“ (1986, S. 55ff., S. 60) zurück, der sie wiederum bei der griechischen Kultur und bei Nietzsche „angeliehen“ hat. 6 Leisering (1997, S. 144; kursiv i.Orig.) spricht in Bezug auf die Individualisierung treffend von einem „Korrelat fortgeschrittener funktionaler Differenzierung der Gesellschaft“. 7 Der Modernisierungsprozess führt nach Beck zu einer dreifachen Individualisierung. Zunächst werden die Men- schen aus historisch vorgegebenen Sozialformen herausgelöst, im Anschluss daran folgt der Verlust traditionaler Sicherheiten. An diesem Punkt endet der Prozess jedoch nicht, sondern er mündet in neue Formen der sozialen Einbindung, in denen neue Traditionen begründet werden. Dieser letzte Abschnitt wird geflissentlich übersehen. Paradigmen wie die allseits beklagte Orientierungslosigkeit sind die Folge solcher Reduktionen. 8 Die Individualisierung der Beziehungsformen wird mittels so genannter „sekundärer Institutionen“ wie der Medien- , Arbeits- oder Konsumentenmarkt, der Wohlfahrtsstaat und das Rechtssystem konstituiert. Sie steuern das individu- 11 mit einer individuellen Verantwortung behaftet, d.h. Arbeitsplatzverlust, Scheidungen, Verschuldung, Erziehungsprobleme oder gar Obdachlosigkeit; alle diese »Schicksalsschläge« sind einem individuellen Versagen geschuldet. Deutlich wird hier die Ambivalenz dieses Prozesses: Den vielfältigen, aber dennoch standardisierten Optionen und Entscheidungsmöglichkeiten wohnen zahlreiche Risiken inne, die Verlässlichkeit reduzieren9. 1.3 Das Zusammenspiel von Individualisierung, Pluralisierung und Globalisierung und dessen Auswirkungen auf die Subjektivität Individualisierung, Pluralisierung und Globalisierung stehen in einem reziproken Verhältnis zueinander, d.h. sie lenken nicht nur das Verhalten der Individuen, sondern sie beeinflussen sich gegenseitig. Diese Beeinflussung geschieht sowohl in Form der Förderung als auch der Hemmung der jeweiligen gesellschaftlichen Herausforderungen. Die gegenseitige Beeinflussung oder das Ineinander-Wirken möchte ich im Folgenden exemplarisch an den Entwicklungen gesellschaftlicher Risiken und Chancen in Deutschland seit den 80er Jahren darstellen. Für die 80er und 90er Jahre sind gleichzeitig ein Rückgang der Individualisierungschancen und eine Zunahme der Individualisierungsrisiken für ein Drittel der Gesellschaft zu beobachten. Eine neo-liberale Wirtschaftspolitik, zunehmende Arbeitslosigkeit, Einsparungen bei der Versorgung von Arbeitslosen und zahlreiche politische Entscheidungen zuungunsten der unteren Schichten haben in Deutschland dazu geführt, dass sich einerseits die Schere zwischen Reichtum und Armut weiter geöffnet hat und andererseits die aus diesen Einbrüchen resultierenden Lasten immer stärker individualisiert werden. Damit hat der durch die scheinbar unvermeintliche Globalisierung begründete Abbau des Sozialstaats – so könnte man formulieren – zum einen die positiven Auswirkungen der Individualisierung („Fahrstuhleffekt“ etc.) für einen großen Teil der Bevölkerung eingeelle Handeln der Menschen indirekt, d.h. sie stellen einerseits eine breite Palette an Wahlmöglichkeiten zur Verfügung, andererseits erzwingen sie aber auch diese Wahl. 9 Die Diskussion um die Konsequenzen der Individualisierung, deren Ausmaß von der prinzipiellen Skepsis (vgl. die Kommunitaristen Etzioni, MacIntyre etc., die von der Orientierungslosigkeit als Grund allen Übels sprechen) bis zur prinzipiellen Verherrlichung (z.B. Clermont/Goebel, die dafür plädieren, die Komplexität zu umarmen bzw. die Ungewissheit lieben zu lernen) reicht, soll hier nicht geführt werden. Vermutlich ist der Anknüpfungspunkt der Orientierungslosigkeit falsch gewählt, da es sich dabei eher um eine Ablenkung von den realen Problemen (neue soziale und ökonomische Disparitäten, Verweigerung politischer Partizipation von Minderheiten) handelt. 12 schränkt. Zum anderen hat die Individualisierung das aus zunehmender Arbeitslosigkeit und dem Abbau des Sozialstaats entstandene Elend verschärft, indem die Betroffenen mit ihrer Situation alleine gelassen werden10. Die damit verbundene Vereinzelung bewirkt zweifellos Apathie, die einer Mobilisierung hinderlich ist. Sind die sozialen Sicherheitsrechte gefährdet, kann Individualisierung in Atomisierung (vgl. Beck 1997c, S. 393) umschlagen. Die Folge ist, dass Menschen derart abstürzen, dass sie nicht mehr in der Lage sind, ihr eigenes Leben zu bewältigen11. Umgekehrt hat die Individualisierung Auswirkungen auf die Globalisierung. Globalisierung geht ja vor allem von den industrialisierten und hoch individualisierten Ländern aus. Dies bedeutet, dass insbesondere die kulturellen und politischen Errungenschaften der Demokratien exportiert werden. Zahlreiche zivilgesellschaftliche Vereinigungen tragen dazu bei, dass im Rahmen von so genannten Entwicklungshilfeprojekten die zivilgesellschaftlichen Strukturen des Wohlfahrts- und Rechtsstaats in anderen Ländern hergestellt, gefördert oder gestärkt werden. Ähnlich ist es mit dem Verhältnis von Pluralisierung und Globalisierung. Auch die kulturelle Vielfalt wird globalisiert, d. h. die tradierten Muster des Zusammenlebens, der Lebensführung und des Lebensstils werden auf dem ganzen Erdball in Frage gestellt und neu geordnet. Ob Waren, Lebensmittel, Wohnen, Kleidung, Freizeit, Dienstleistungen oder gesellschaftliche Risiken, in den von der Globalisierung am stärksten betroffenen Ländern lassen sich immer öfter die gleichen Konsumgewohnheiten und Lebensstile, ähnliche Risiken und Probleme finden und die Vielfalt ist längst zur globalen Einheit geworden. Individualisierung, Pluralisierung und Globalisierung bestimmen maßgeblich die Ausgestaltung der Subjektivität in der reflexiven Moderne. Alle diese Faktoren haben ambivalente Effekte auf die heutige Subjektivität. So sind im Rahmen der Individualisierung auf der einen Seite zahlreiche Traditionen, Riten und Gebräuche „abhanden“ kommen. Zu einer ernst zu nehmenden Gefahr für die Individuen kann diese Enttraditionalisierung durch den Abbau sozialer Sicherheits10 Tatsächlich hat die Globalisierung aber allenfalls dazu beigetragen, dass in Deutschland aufgrund von Firmenzu- sammenschlüssen und Produktionsverlagerung die so genannten einfachen Arbeitsplätze abgebaut wurden. Insofern hat sie tatsächlich die Arbeitslosigkeit gefördert und Armut anwachsen lassen. Die staatliche Versorgung der ehedem schon an den Rand gedrückten Benachteiligten wegen des aus der Globalisierung resultierenden Konkurrenzdrucks zu reduzieren, ist allerdings eher der Spitzfindigkeit deutscher Arbeitgeberverbände und konservativer Politiker/innen geschuldet. 11 Beck (1997c, S. 393f.) spricht in diesem Zusammenhang von „Grauzonen der Überlagerung von Individualisie- rung und Atomisierung“. Allerdings schätzt er die Situation in Deutschland noch nicht so ein, dass bereits viele Menschen von einem solchen Absturz bedroht sind. 13 rechte führen. Ab einem gewissen Punkt droht Individualisierung dann tatsächlich in Atomisierung umzuschlagen. Auf der anderen Seite tragen diese gesellschaftlichen Rahmenbedingungen jedoch auch dazu bei, den verloren gegangenen Zusammenhalt aus tradierten Beziehungen zu erneuern. So sind in den letzten Jahren zahlreiche neue Formen des selbst gewählten Zusammenhalts entstanden, vor allem im zivilgesellschaftlichen Bereich (vgl. Ottersbach 2003, S. 158ff.). Ähnlich ist es mit den Auswirkungen der Pluralisierung: Zum einen fördert die neue Vielfalt der Themen eine Zersplitterung der Individualität, zum anderen werden mit der Pluralisierung sozialer Beziehungen und Lebensstile neue Entfaltungsmöglichkeiten geschaffen, die neue Anschlussmöglichkeiten für vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten schaffen. Allerdings sind diese frei gewählten Beziehungsformen und Lebensstile wiederum einer neuen Standardisierung unterworfen, die das Neue schnell reglementiert und zur Routine erstarren lässt. Im Rahmen dieser Ambivalenz ist auch die Pluralisierung der Öffentlichkeit zu sehen. Die Mannigfaltigkeit der Medienformen und -inhalte bewirkt sowohl eine Steigerung der Möglichkeiten als auch zusätzliche Risiken. Die Differenzierung zwischen interessanten und wertlosen Informationen fällt immer schwerer; Routine, Apathie und Vergleichgültigung werden zu einem wesentlichen Schutzmechanismus gegen das Übermaß an Informationen. Auch die Globalisierung bewirkt Ambivalenzen in Bezug auf die Entwicklung der Individualität. Allerdings verteilen sich Chancen und Risiken hier auf die verschiedenen Sparten der Globalisierung. Während die ökonomische Globalisierung eher zu einer Ausbreitung und Intensivierung sozialer Ungleichheit beiträgt, Atomisierung bewirkt und zivilgesellschaftliche Strukturen ernsthaft in Gefahr bringt, leistet die kulturelle Globalisierung eher einen positiven Beitrag für die vielfältige Gestaltung der Subjektivität. Wichtig ist es jedoch, schon jetzt hervorzuheben, dass das Zusammenspiel von Individualisierung, Pluralisierung und Globalisierung nur einen Möglichkeitsraum (vgl. Scherr 2005, S. 17) darstellt, im Rahmen dessen sich Subjektivität entfaltet. Zudem ist dieser Möglichkeitsraum – wie angedeutet – selbst ambivalent und vielfältig, also keineswegs homogen und eindimensional. Seine Einwirkung ist auch beschränkt, denn Subjektivität entwickelt sich stets im Kontext konkreter Interaktionen und Kommunikationen in zahlreichen sozialen und nur mehr oder weniger stark institutionalisierten Kontexten. Mit anderen Worten: Peer groups, die Familie, auch die Arbeitsbeziehungen der Menschen beinhalten immer auch ein Repertoire an subjektiven Einwir- 14 kungen, aus deren buntem, widersprüchlichem und mannigfaltigem Zusammenspiel erst die Subjektivität des Anderen entsteht12. 1.4 Die subjektive Sichtweise als Produkt und Reflexion des Lebensumfelds Die subjektive Sichtweise ist einerseits Produkt oder Resultat und andererseits Reaktion auf die systemische und soziale Integration. Sie ist das Bindeglied zwischen gesellschaftlicher Prägung oder Sozialisation und der Reflexion derselben. Aspekte der systemischen Integration wie z.B. das Recht, das Geld, die Arbeit und das Wissen, und Aspekte der sozialen Integration wie z.B. Werte, Normen, Sitten und Gebräuche und der Rollen, ermöglichen und helfen uns, unseren Alltag so zu gestalten, wie wir ihn gestalten. Die subjektive Sichtweise ist der kurze Moment, in dem wir uns etwas bewusst werden, was vorher unbewusst, sozusagen automatisch und ohne weitere Reflexion verlief. Dies verweist darauf, dass nach wie vor Werte, Traditionen, Sitten und Gebräuche eine große Rolle bei der Bewältigung unseres Alltags spielen. Ohne diese kulturellen Überlieferungen wären wir gezwungen, jede Handlung zu hinterfragen und zu reflektieren, so dass wir möglicherweise gar nicht mehr dazu kämen, in dem gewohnten Umfang und auf die uns lieb gewordene Art und Weise zu handeln. Die subjektive Sichtweise ist insofern zunächst ein Störmoment des Alltags, etwas, das in der Lage ist, unseren Alltagsablauf aus den Fugen oder in eine Krise geraten zu lassen. Allerdings stellt sie auch ein Instrument dar, den Weg aus der Krise zu finden. Als Element der Reflexivität verhilft die subjektive Sichtweise uns dazu, einen Moment innezuhalten, um sich den Alltag mit samt seinen ritualisierten Handlungen zunächst anzueignen und ihn dann zu überdenken, gegebenenfalls unserem Handeln eine veränderte Richtung zu geben oder auch die alte Richtung zu stabilisieren. Die subjektive Sichtweise kann man insofern gleichzeitig als Instrument der Krisenauslösung und der Krisenbewältigung bezeichnen. Spannende Fragen sind nun, in welchen Momenten die subjektive Sichtweise überhaupt zur Geltung kommt? Und: Bei wem kommt sie zur Geltung? Taucht sie generell bei allen auf oder sind einige Menschen sozusagen dafür prädestiniert, sie zu aktivieren? 12 Ließe man diesen Spielraum nicht zu, könnte man nur schwerlich sozialen Wandel erklären. Gäbe es ihn nicht, wä- ren wir tatsächlich mit der „Wiederkehr des Immergleichen“ (Nietzsche) konfrontiert. 15 In Bezug auf die erste Frage ist sicherlich festzustellen, dass die subjektive Sichtweise vor allem dann aktiviert wird, wenn wir mit Einflüssen seitens der Umwelt konfrontiert sind, die uns zunächst fremd sind. Das Fremde ist – vorausgesetzt, wir lassen es an uns heran – immer ein Garant für Konfusion und Verwirrung. Es lockt uns heraus, es drängt oder zwingt uns geradezu zu einer Auseinandersetzung und Überprüfung unserer eigenen Identität bzw. unserer eigenen mehr oder weniger vorurteilsvollen Perspektiven. Eine solche Konfrontation mit einer fremden Umwelt kann auch die Situation eines Interviews sein, in dem wir dazu aufgefordert werden, über unseren Alltag im Allgemeinen oder über bestimmte Probleme oder Situationen in unserem Alltag zu berichten. Wir werden dann dazu gedrängt, Handlungen, die bisher mehr oder weniger automatisch abliefen, einer Person zu präsentieren und ihr gegenüber diese Handlungen zu legitimieren. Ein solcher Prozess kann in der Tat auch zu Krisen führen, vor allem dann, wenn wir uns bewusst werden, dass wir Handlungen nur unzureichend präsentieren oder legitimieren können. Dazu muss der Interviewer bzw. die Interviewerin nicht mal kritisch sein (passierte ihm/ihr dies, wäre er/sie sogar ein schlechte/r Interviewer/in); es reicht schon, wenn wir selbst ins Stocken geraten oder unsicher werden. Ein solches Interview ist insofern immer auch eine Grenzsituation bzw. erfahrung, die es uns ermöglicht, uns über uns selbst bewusst zu werden bzw. unser Handeln zu reflektieren. Bezüglich der zweiten Frage ist sicherlich anzumerken, dass die subjektive Sichtweise prinzipiell bei allen „schlummern“ kann. Nach wie vor handeln viele Menschen sehr ritualisiert, d.h. sie hinterfragen ihr Handeln nur sehr bedingt. Der Konfrontation mit dem Fremden kann man ja auch aus dem Weg gehen, wenn man es unbedingt will. Man muss sich auch nicht unbedingt der Situation eines qualitativen Interviews stellen. Im Rahmen der qualitativen Sozialforschung erlebt man es – je nach Brisanz des Themas – immer wieder, dass Menschen nicht bereit sind, ein Interview zu geben. Dies gilt es selbstverständlich zu akzeptieren. Schwierig oder sogar unzulässig ist es zweifellos, die Bereitschaft zur Reflexion an bestimmten individuellen Charaktermerkmalen fest zu machen. Allerdings gibt es starke Indizien dafür, dass sowohl Bildung als auch ein bereits geübter Umgang mit dem Fremden die Bereitschaft zur Reflexion fördern. Die subjektive Sichtweise spielt aber noch in einem anderen Zusammenhang eine wesentliche Rolle: Sie ist Motor und Auslöser des sozialen Wandels. Gäbe es nur Menschen, die ihren Alltag streng nach überlieferten Wissensbeständen oder kulturellen Überlieferungen und Traditionen gestalten würden, sozusagen die Einflüsse der systemischen und der sozialen Integration deckungsgleich in ihrem Alltag realisieren würden, könnte es nicht zum gesellschaftlichen Wandel 16 kommen. In diesem Zusammenhang spielen die sozialen Bewegungen eine zentrale Rolle. Ohne das zivilgesellschaftliche Engagement der Menschen, das als kulturorientierte Bewegung an der sozialen Integration und als politisch orientiertes Engagement an der systemischen Integration ansetzt, gäbe es keine gesellschaftlichen Veränderungen. Mit anderen Worten. Solange es die subjektive Sichtweise als Moment der Reflexion gibt, kann man sicher sein, dass gesellschaftliche Veränderungen bewirkt werden bzw. sozialer Wandel stattfindet. Allerdings ist nicht garantiert, dass der Wandel stets als menschlicher Fortschritt, als Zivilisationsprozess, erfolgt. 17 2. Das Lebensumfeld von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte Der Stellenwert der subjektiven Perspektive steht und fällt mit den eingangs erwähnten Aspekten der systemischen und der sozialen Integration. Denn nur die Kenntnis des Lebensumfelds der Kinder und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte macht auch deren subjektiven Umgang mit demselben vergleichbar und deshalb spannend. Vor dem Hintergrund einer politischen Steuerung oder eines pädagogischen Einwirkens auf dieses Lebensumfeld sind beide Schritte, d.h. die Erkundung der gesellschaftlichen Integration und der subjektive Umgang damit unerlässlich. Berücksichtigte man nur das Lebensumfeld und ließe man die subjektive Sichtweise außer Acht, liefe man Gefahr, an den Interessen und Bedürfnissen der Menschen vorbei zu agieren. Konzentrierte man sich umgekehrt nur auf die subjektiven Motive und bezöge man die Lebenssituation der Kinder und Jugendlichen in politische und pädagogische Konzepte nicht mit ein, bestünde eventuell die Gefahr, sich in rein fiktiven Welten zu bewegen. Erst die Betrachtungen beider Seiten ermöglicht effektives politisches oder pädagogisches Handeln. Zudem wird dadurch der Partizipationsgedanke gestärkt, was wiederum positive Effekte auf die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte hat. Um das Lebensumfeld von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte z.B. in Schule, Ausbildung und auf dem Arbeitsmarkt zu beschreiben, wird meist auf quantitative Daten zurückgegriffen. Gültigkeit und Relevanz der „harten“ Zahlen mussten lange Zeit eingeschränkt werden. Im Gegensatz zu Politik und Verwaltung kannte die Statistik die Kategorie der Zuwanderinnen und Zuwanderer oder Menschen mit Zuwanderungsgeschichte nicht, sondern differenzierte entlang der Staatsangehörigkeit in Deutsche und Ausländer. Diese Unterscheidung sagte schon damals wenig über den Sachverhalt der Migration aus, da sich in beiden Gruppen sowohl Menschen mit als auch ohne Zuwanderungsgeschichte befanden, ohne dass dies ablesbar gewesen wäre. Die Folge war, dass Indikatoren wie Arbeitslosigkeit, berufliche Stellung, Einkommen etc. vermutlich günstiger ausgefallen wären, wenn sie nicht nur Daten für Ausländer/innen, sondern auch für Eingebürgerte berücksichtigt hätten. Denn es sind in der Regel die sozioökonomisch besser gestellten Zuwanderinnen und Zuwanderer, die einen deutschen Pass erwerben (vgl. hierzu Salentin/Wilkening 2003), so dass tatsächliche Integrationserfolge von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte nicht dazu führten, dass sich der statistische Abstand zwischen Ausländer(inne)n und Deutschen verringerte. Im Gegenteil, er vergrößerte sich, da die erfolgreichen 18 (eingebürgerten) Zuwanderinnen und Zuwanderer als Deutsche erfasst wurden. Reale Integrationserfolge wurden auf diese Weise statistisch „vernichtet“. Und auf ein weiteres Problem muss hingewiesen werden: Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler waren im Zuge dieser Erfassung der „blinde Fleck“ der amtlichen Daten. Wie sich ihre Integration vollzog, ob sie sich verbesserte, wie hoch ihre Arbeitslosenquote war, wie das Einkommen ausfiel etc. war weitgehend unbekannt, da sie statistisch als Deutsche betrachtet wurden. Insbesondere nach der Novellierung des neuen Staatsangehörigkeitsrechts im Jahr 2000 und der Liberalisierung der Einbürgerungspraxis wurde die Schwäche der bisherigen Statistik für alle offensichtlich (vgl. Santel 2008, S. 2f.). Seit 2005 erfasst das Bundesamt für Statistik mit dem Mikrozensus deshalb Personen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte13. Zur Gruppe der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zählen jetzt neben Ausländer(inne)n auch Einwanderinnen und Einwanderer, die sich haben einbürgern lassen oder im Ausland geboren sind und sofort die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben können, und Menschen, die im Inland geboren wurden und Eltern mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit haben. Dadurch wird sowohl eine Bestandsaufnahme als auch ein kontinuierliches Monitoring von Migration und Integration deutlich verbessert. 2.1 Die zentralen Aspekte der systemischen Integration von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte Betrachtet man das Lebensumfeld von Kindern und Jugendlichen, springen sofort Bildung, Ausbildung und ggf. auch die Arbeit als zentrale Aspekte ins Auge. Auch der rechtliche Status, die gesundheitliche und die Wohnsituation spielen wichtige Rollen bei der Positionierung der Kinder und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte. Bildung und Ausbildung gelten aus soziologischer Sicht nicht nur als wesentliche Bestandteile der Lebenslage, sondern auch als die wichtigsten Ressourcen der Veränderung derselben. Dies gilt insbesondere für Jugendliche und Heranwachsende, da die Bildungs- bzw. Ausbildungsphase gemeinhin als Vorbereitung und Übergang zum Erwachsensein gewertet wird. Ob diese Phase zu einem Moratorium wird oder als Transition (vgl. Reinders 2003) bezeichnet werden kann, hängt 13 Das Landesamt für Statistik NRW hat sich dem angeschlossen. Allerdings gibt es nach wie vor keine (bundes-) einheitliche Definition des Zuwanderungsgeschichtes bzw. der Zuwanderungsgeschichte. 19 maßgeblich davon ab, wie erfolgreich sie absolviert wird bzw. inwiefern die Integration in den Arbeitsmarkt gelingt. Die im Bildungssystem erworbenen bzw. nicht erworbenen Qualifikationen sind somit eine entscheidende Voraussetzung für die Positionierung am Arbeitsmarkt. Vor dem Hintergrund der Bildungsexpansion sind die erworbenen Qualifikationen allerdings nur eine Voraussetzung und kein Garant für eine erfolgreiche Positionierung. Spätestens seit den PISA-Ergebnissen ist allgemein bekannt, dass zahlreiche Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte das deutsche Bildungssystem nur mit geringem Erfolg absolvieren. Belegt ist auch, dass meist nicht sie für diese Misere verantwortlich zu machen sind, sondern vor allem das System selbst. Nachgewiesen ist, dass insbesondere die frühe Selektion bereits nach vier Jahren Grundschule einer angemessenen Förderung dieser Kinder und Jugendlichen nicht gerecht werden kann. Auch die vielmals glorifizierte soziale Mobilität des dreigliedrigen Schulsystems entspricht einem Mythos. Zudem erfolgt die Durchlässigkeit nach wie vor eher als Ab- denn als Aufstieg. Betrachtet man die Chancen der Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte auf dem Ausbildungsmarkt, so erkennt man auch hier, dass ihre Chancen im Vergleich zur Gruppe der Jugendlichen ohne Zuwanderungsgeschichte wesentlich schlechter sind. Insofern kann man zu Recht behaupten, dass Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarktzugang für Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte häufig institutionalisierte Sackgassen darstellen (Ottersbach i.E.). Schulische Bildung ist sowohl eine zentrale ökonomische als auch eine wichtige soziale Ressource. Durch erworbene Bildungsgüter wird maßgeblich über die Positionierung am Arbeitsmarkt entschieden und mit dem Bildungserwerb erhöhen sich auch das Prestige und die Lebensperspektiven. Bildung beeinflusst nicht nur die Positionierung im Schichtengefüge, sondern die gesamte Lebenslage (Entfaltung der Persönlichkeit, Entwicklung der Identität, Teilhabe am sozialen, kulturellen und politischen Leben etc.). Zu sozialer Mobilität tragen Auf- und Abstiegsprozesse bei, die maßgeblich durch schulische Bildung und durch schulisch vermittelte Qualifikationen beeinflusst werden. Entscheidend sind dabei zwei Übergänge: von der Grund- in die weiterführende Schule und von der Schule in die Ausbildung. Über die weitergehende Anschlussfähigkeit der Bildungsabschüsse entscheidet schließlich die wirtschaftliche Konjunktur bzw. der Arbeitsmarkt. Um die Situation der Schüler/innen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte in Nordrhein20 Westfalen zu analysieren, ist ein Blick auf die Bildungsexpansion erforderlich. Der zeitliche Ausgangspunkt der Bildungsexpansion wird häufig auf den so genannten Sputnik-Schock im Jahre 1957 datiert. Die Angst des Westens gegenüber der damaligen Sowjetunion, ihr gegenüber im Wettlauf um geopolitische Erfolge ins Hintertreffen zu gelangen, führte dazu, dass die Investition in Bildung expandierte. Sowohl das Schul- als auch das Hochschulsystem wurden ausgebaut, es drängten mehr Schüler/innen an höher qualifizierende Schulen und mehr Schüler/innen erlangten auch tatsächlich höher qualifizierte Schulabschlüsse und auch die Zahl der Studierenden schnellte in die Höhe. Die zunächst durchaus positiv zu bewertende Entwicklung zeitigte jedoch auch paradoxe Effekte (vgl. Geißler 2006, S. 286). Erstens in Bezug auf die Platzierungsfunktion: Die Tatsache, dass immer mehr Schüler/innen mittlere und höhere Schulabschlüsse erreichten, führte zu einer Bildungsinflation und somit zu einer Entwertung der Bildungsabschlüsse. Diese hat wiederum begünstigt, dass die ehemals hinreichenden Bedingungen des Bildungserwerbs bzw. des Erwerbs aussichtsreicher Positionen durch notwendige Bedingungen ersetzt wurden, die zudem nur den Minimalstandard repräsentieren und noch lange keinen sozialen Aufstieg sichern. D.h.: Ein hohes Bildungsniveau ist seitdem nur noch eine Voraussetzung, aber keine Garantie mehr für einen qualifizierten und sicheren Arbeitsplatz, und um diesen zu erhalten, wird immer öfter der Nachweis von Zusatzleistungen erforderlich. Zweitens in Bezug auf die Selektionsfunktion: Die Bildungsexpansion hat die Ausbildungsund Arbeitsmarktchancen für viele verbessert, jedoch die schichtspezifischen Ungleichheiten nicht beseitigt, sonder eher noch verschärft. D.h.: Trotz oder wegen der Steigerung des Bildungsniveaus haben die Chancen für Angehörige der unteren sozialen Schichten auf akzeptable Jobs abgenommen. Letztendlich hat die Bildungsexpansion vielen Angehörigen der Mittelschicht und auch vielen Frauen zum sozialen Aufstieg verholfen. Allerdings ist auch eine große Gruppe so genannter Bildungsverlierer/innen anzuführen: die Angehörigen der unteren sozialen Schichten, in denen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte überproportional stark vertreten sind. Erste Studien wie die in den 90er Jahren publizierte IGLU-Studie oder die im Jahr 2000 veröffentlichte PISA-Studie haben nachgewiesen, dass in Deutschland die Korrelation von sozialer Herkunft und Bildungserwerb am stärksten von allen, an der Studie beteiligten Länder ist, und dass das Ziel der Herstellung von Chancengleichheit durch die Schule sich einmal mehr als Illusion entpuppt hat. Zu Recht kann deshalb behauptet werden, dass die Schule in Deutschland ihrem staatlichen 21 Auftrag inzwischen nicht mehr gerecht wird und das bestehende Schichtengefüge eher zementiert. Betrachtet man sich die Schulabschlüsse ausländischer Kinder und Jugendlicher bundesweit zwischen 1983 und 2003 (vgl. Geißler 2006, S. 244, Tabelle 11.5), wird deutlich, dass es in den ersten zehn Jahren zu einer deutlichen Verbesserung der Schulabschlüsse von Bildungsinländer(inne)n gegenüber den deutschen Schüler(inne)n gekommen ist. In den darauf folgenden zehn Jahren konnte diese sukzessive Verbesserung jedoch nicht fortgesetzt werden, so dass ausländische Kinder und Jugendliche weiterhin deutlich seltener eine der drei qualifizierten Abschlussformen der Fachoberschulreife, der Fachhochschulreife oder der Hochschulreife erreichen als deutsche. Dieser Trend bestätigt sich auch für Nordrhein-Westfalen, wenn man den höchsten und den niedrigsten Schulabschluss der deutschen und ausländischen Jugendlichen und Heranwachsenden14 vergleicht. Ausländische Schüler/innen haben weiterhin nach der allgemein bildenden Schule einen entscheidenden Wettbewerbsnachteil in der Konkurrenz um lukrative Ausbildungs-, Studien- und schließlich Arbeitsplätze: Deutsche und ausländische Schulabgänger/innen aus Schulen der allgemeinen Ausbildung 1985/86 bis 2006/07 (Angaben in Prozent) Deutsche Schüler/innen Ausländische Schüler/innen ohne Hauptschulabschluss 1985/86 5,1 mit Hochschulreife 27,5 ohne Hauptschulabschluss 22,9 mit Hochschulreife 5,7 1990/91 5,2 31,5 18,0 8,2 1995/96 4,8 29,4 13,0 11,5 2000/01 6,0 29,1 14,2 13,1 2004/05 6,0 27,8 14,5 10,2 2005/06 5,7 29,1 14,3 10,9 2006/07 5,6 29,2 14,8 10,9 Quelle: Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration NRW 2008, S. 134. 14 Um zeitliche Vergleiche anzustellen, ist es jedoch erforderlich, auf die alten Kategorien zurückzugreifen, da es an- sonsten zu Verzerrungen kommt. 22 Dank der Ergebnisse des Mikrozensus 2005 sind auch für die Gruppe der Schüler/innen inzwischen genauere Angaben möglich, die eben auch den Unterschied zwischen Personen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte verdeutlichen15. Was die Herkunft bzw. den Zuwanderungsstatus anbelangt, zeigt die folgende Statistik, dass es immense Differenzen gibt: Bevölkerung ab 15 Jahre in Nordrhein-Westfalen 2006 nach Zuwanderungsstatus und höchstem allgemein bildenden Schulabschluss (Angaben in Prozent) Bevölkerung insgesamt Deutsche Schüler/innen eingebürgerte ohne Ohne Abschluss 4,9 12,1 2,1 23,4 Ausländische und eingebürgerte Schüler/innen 20,8 Mit HS- 46,6 38,8 48,0 39,0 39,0 Mit FOS 21,9 18,7 22,8 14,7 15,6 Mit (Fach-) Hochschulreife 26,6 30,3 27,1 22,9 24,6 ZG16 Ausländische Schüler/innen Abschluss Quelle: Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration NRW 2008, S. 130. Deutlich wird, dass eingebürgerte Schüler/innen durchweg bessere Schulabschlüsse erlangen als ausländische Schüler/innen. Vor allem bei den beiden Gruppen, die entweder keinen oder den höchsten Schulabschluss erreichen, ist der Unterschied enorm groß. Bei der zuletzt genannten Gruppe schneiden die Eingebürgerten sogar besser ab als die Deutschen ohne Zuwanderungsgeschichte. Zudem hat sich im Vergleich der gesamten Population und der Jugendlichen bzw. Heranwachsenden mit Zuwanderungsgeschichte einiges getan: Während jede fünfte Person (20,8%) 15 Einschränkend muss man jedoch anmerken, dass trotz der Zahlen des Mikrozensus bisher nicht alle Bundes- und Landesministerien und -behörden diese Zahlen verwenden. So benutzt die Bundesagentur für Arbeit nach wie vor nur die Kategorie „deutsch-ausländisch“. Auch in NRW haben bisher nicht alle Ministerien nachgezogen. In Bezug auf die Berufbildungsstatistik haben wir die Auskunft erhalten, dass hier ebenfalls nur die alte Kategorie und diese sogar ohne Altersdifferenzierung verwendet wird. 16 Zuwanderungsgeschichte. 23 mit Zuwanderungsgeschichte noch immer ohne Schulabschluss ist, sind es bei der jungen Generation nur noch 9%. Diese große Differenz gilt auch in Bezug auf das Erlangen der (Fach-) Hochschulreife. Von Interesse sind auch noch die starken Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen und zwischen den einzelnen Nationalitäten. Bei den meisten Nationalitäten schneiden die Mädchen deutlich besser ab als ihre männlichen Altersgenossen17. Besonders häufig erlangen Albaner/innen und Serb(inn)en keinen Schulabschluss. Hingegen sind Russ(inn)en, Aussiedler/innen und die Griech(inn)en besonders erfolgreich. Jede/r dritte Russin bzw. Russe erlangt das (Fach-) Abitur; im Vergleich dazu nur 27,1% der Deutschen ohne Zuwanderungsgeschichte (vgl. ebd., S. 135). Die Bildungsexpansion hat auch direkte Auswirkungen auf die Ausbildungssituation der Jugendlichen. Die mit der Bildungsexpansion verbundene Inflation der Bildungsabschlüsse bedeutet für den Ausbildungsmarkt, dass Jugendliche ohne Schulabschuss oder mit Hauptschulabschluss kaum noch Chancen auf einen Ausbildungsplatz haben. Während Banken oder Versicherungen früher Jugendlichen mit Hauptschulabschluss durchaus einen Ausbildungsplatz angeboten haben, zählt für diese Unternehmen heute nur noch das Abitur als Eintrittskarte für eine Ausbildung in ihrem Metier. Hinzu kommt, dass im Wettbewerb um Ausbildungsplätze ausländische Jugendliche mit denjenigen deutscher Jugendlicher18 um das seit 1995 knapper werdende Lehrstellenangebot konkurrieren (vgl. im Folgenden Geißler 2006, S. 246). War der Anteil der ausländischen Auszubildenden unter den berufsschulpflichtigen Jugendlichen zwischen 1980 und 1994 noch von 19% auf 44% gestiegen, so betrug er 2001 nur noch 38% und im Jahr 2005 nur noch 25% (vgl. Uhly/Granato 2006). Zwar ist der Anteil der Ausbildungsbeteiligungsquote deutscher Jugendlicher ebenfalls gesunken, jedoch nur um 11% seit 1994. Damit liegt sie um fast 60% höher als diejenige, ausländischer Jugendlicher. Häufig werden restriktive kulturelle, familiäre oder individuell bedingte Einstellungsmuster gegenüber einer beruflichen Karriere oder schulisches Versagen als Gründe dieser Entwicklung genannt. Empirische Studien belegen jedoch, dass diese Faktoren nicht für die fatale Entwicklung herangezogen werden können (vgl. Granato 2006). Bedeutsamer ist in diesem Zusammenhang, 17 Ausnahmen bilden nur die Bosnierinnen und die Griechinnen. 18 Auch die Berufsbildungsstatistik des Statistischen Bundesamtes erfasste bis 2004 nur die Staatsangehörigkeit, nicht den Zuwanderungsgeschichte. 24 dass eine höhere Qualifikation für Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte nicht gleichbedeutend ist mit einer Zunahme an Chancen auf einen Ausbildungsplatz. Die ansonsten gültige hohe Korrelation zwischen hoher Qualifikation und hohen Chancen auf einen Ausbildungsplatz gilt für die Gruppe der Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte nur sehr eingeschränkt. Während 25% der ausländischen Bewerber/innen mit Hauptschulabschluss nur wenig seltener als deutsche Bewerber/innen (29%) einen Ausbildungsplatz finden, steigt die Differenz bei Realabschlussabsolvent(inn)en bereits deutlich an. Hier erlangen immerhin 47% der deutschen Bewerber/innen einen Ausbildungsplatz, hingegen nur 34% der ausländischen Absolvent(inn)en. Besonders krass ist der Unterschied dann bei denjenigen, die zudem auch noch eine gute Mathematiknote erreichen: Hier sind es 64% der deutschen und nur 41% der ausländischen Bewerber/innen, die eine Ausbildung beginnen können (vgl. zu den Zahlen Granato 2006). An dieser Stelle zeigt sich deutlich, dass die als Gatekeeper fungierenden Personalleiter/innen in den Ausbildungsfirmen Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte offensichtlich nicht dieselben Chancen einräumen wie Jugendlichen ohne Zuwanderungsgeschichte. Dies bestätigen auch andere Studien19. Mit anderen Worten: Selbst bei hoher Anstrengung und guten Leistungen bleibt Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte der soziale Aufstieg systematisch versperrt. Allgemein bekannt ist, dass Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und insbesondere Ausländer/innen häufig nur eine Anstellung in niedrig qualifizierten Arbeitssegmenten finden und zudem überproportional stark von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Wenn sie eine Arbeit finden, dann meistens in körperlich anstrengenden, gefährlichen, gesundheitsschädigenden und schlecht bezahlten Berufen (vgl. Geißler 2006, S. 242f.). Dieser Trend gilt auch für die Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen. Die Erwerbsstruktur junger Menschen zeigt die Verteilung auf einzelne ausgewählte Wirtschaftsbereiche nach dem Mikronzensus 2005: 19 Vgl. hierzu Imdorf 2008. Der Autor zeigt auf, dass so genannte schulische Defizite keine hinreichende Erklärung liefern für das schlechte Abschneiden von Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Stattdessen weist er nach, dass Organisationen, die Ausbildungsplätze vergeben, höchst selektiv bei ihrer Vergabe verfahren, d.h. Menschen ohne Zuwanderungsgeschichte systematisch vorziehen, indem sie z.B. in der industriellen Welt als „weniger kompetent und damit leistungsfähig“ gelten, in der Marktwelt „ein Kundenrisiko darstellen“ oder in der häuslichen Welt „als potenzielle Störer einer eingespielten sozialen Ordnung wahrgenommen werden“ (Imdorf 2008, S. 145). 25 Erwerbstätige im Alter von 15 bis 25 Jahren in Nordrhein-Westfalen 2006 nach Zuwanderungsstatus und nach Wirtschaftsbereichen Insgesamt (in Tsd.) insgesamt 814 darunter im Wirtschaftsbereich (in Prozent) Produzierendes Handel, Gastge- Sonstige DienstGewerbe werbe und Verleistungen kehr 27,6 27,7 42,9 Eingebürgerte 33 23,7 33,5 42,8 Deutsche ohne Zuwanderungsgeschichte Ausländer/innen 628 27,3 26,8 43,9 79 27,7 35,3 35,9 Ausländer/innen und Eingebürgerte 112 26,5 34,8 37,9 Quelle: Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration NRW2008, S. 130. Weitaus erschreckender als der trotz Arbeit erlangte geringe berufliche und soziale Status der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte ist ihre deutliche Überrepräsentation in der Arbeitslosenstatistik. Bundesweit und auf die gesamte Bevölkerung bezogen war der Anstieg der Arbeitslosigkeit seit 2000 bei der Gruppe der Ausländer/innen deutlich höher und auch die positive konjunkturelle Entwicklung in den letzten Jahren hat in Bezug auf die Gruppe der Menschen ohne deutschen Pass bisher nur wenige positive Auswirkungen gehabt: 26 Arbeitslosigkeit nach Nationalität in Prozent Deutsche Ausländer 1996 13,9 19,5 1998 11,7 20,1 2000 10,2 17,1 2002 10,2 18,8 2004 11,0 20,3 2006 11,0 23,6 2007 9,3 20,3 Quelle: Bundesagentur für Arbeit (BA): Analytikreport der Statistik 04/2008 Der Abstand zwischen Deutschen und Ausländer(inne)n hat sich seit 2000 sukzessive vergrößert. Lag die Arbeitslosenquote der Ausländer/innen in 1996 „nur“ ca. 40% über derjenigen der Deutschen, so lag sie im Jahr 2007 fast 120% höher! Mit anderen Worten: Gerade in Bezug auf prekäre ökonomische Verhältnisse hat die Differenz zwischen Deutschen und Ausländer(inne)n in den letzten Jahren bundesweit stark zugenommen. Auch der rechtliche Status ist eine erhebliche Voraussetzung für die Positionierung Jugendlicher mit Zuwanderungsgeschichte in unserer Gesellschaft. In den vorangegangenen Statistiken ist bereist deutlich geworden, dass es einen großen Unterschied macht, ob man als Deutscher ohne Zuwanderungsgeschichte, als Eingebürgerter oder als Ausländer/in das deutsche Schulsystem durchläuft. Auch die (ehemalige) Staatsangehörigkeit spielt eine Rolle, denn Griech(inn)en, Aussiedler/innen oder Russ(inn)en erzielen durchweg gute schulische Leistungen und Abschlüsse, teilweise sogar bessere als Deutsche ohne Zuwanderungsgeschichte. Hingegen schneiden Türk(inn)en oder Italiener/innen weitaus schlechter ab. Begründet werden kann dies teilweise durch die Dauer des Aufenthalts bzw. damit, dass in der Gastarbeiterphase gezielt bildungsferne junge Männer von Deutschland angeworben wurden. Eine Gruppe Ausländer/innen, die statistisch gar nicht erfasst wird, ist die Gruppe der in Deutschland sich illegal aufhaltenden Flüchtlinge. Deren Größe kann man nur schätzen. Als sicher gilt jedoch, dass diese Gruppe es vor dem Hintergrund eines unsicheren Status besonders schwer hat, eine erfolgreiche schulische bzw. berufliche Karriere zu absolvieren. Vor dem Hin27 tergrund unsicherer Zahlen kann hier nicht weiterhin auf diese Gruppe eingegangen werden. Nichtsdestotrotz muss sie Erwähnung finden. Zuletzt sollte noch auf die Wohnsituation und auf die gesundheitliche Situation von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte hingewiesen werden. Beide Elemente des Lebensumfelds lassen sich – zumindest in diesem Alter – jedoch noch weitestgehend auf den sozialen Status der Eltern zurückführen. Wo Kinder und Jugendliche aufwachsen, bestimmen in der Regel ihre Eltern, vorausgesetzt, sie können es überhaupt bestimmen, was keine Selbstverständlichkeit ist für die Bevölkerung mit Zuwanderungsgeschichte. Denn vielfach sind die Alternativen aufgrund der ökonomischen Situation der Familien mit Zuwanderungsgeschichte stark eingeschränkt. Viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sind deshalb mehr oder weniger gezwungen, dort zu wohnen, wo der Wohnraum preisgünstig ist, d.h. in so genannten marginalisierten Quartieren. Bekannt ist, dass Menschen mit Zuwanderungsgeschichte einen überproportional hohen Anteil der Bevölkerung marginalisierter Quartiere stellen. Charakteristika solcher Quartiere sind vor allem • wirtschaftliche Schwäche (geringe Löhne, geringes Bruttosozialprodukt, hohe Arbeitslosigkeit und hohe Sozialhilfedichte), • wenige kulturelle Einrichtungen (keine oder wenige hoch qualifizierende Schulen, wenig Bibliotheken, aber auch geringe Ärztedichte und wenige oder nicht gepflegte Spielplätze) • eine schlechte Infrastruktur (hoher Lärmpegel, keine Grünanlagen), hohe Bevölkerungsdichte, schlechte Bauweise (dünne Wände, monotone Architektur, keine Balkone, unzureichende Pflege und Instandsetzung der Räumlichkeiten) und „angstbesetzte Räume“ (dunkle Hinterhöfe) • eine Häufung sozialer Probleme (Drogenhandel, Prostitution, hohe Scheidungs- bzw. Trennungsrate, Vernachlässigung der Erziehungspflichten, (Klein-) Kriminalität) • eine eindimensionale Sozialstruktur (Wegzug der Mittelschicht, hoher Anteil der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte) • keine bedeutsamen sozialen Netzwerke seitens der Bewohner/innen (keine Kontakte zu „relevanten“ Personen bzw. so genannten Gatekeepern) • ein schlechtes bzw. negatives Stadtteilimage (vgl. Ottersbach 2008, S. 58f.). 28 Das Leben in solchen Quartieren hängt auch davon ab, um welchen Typ eines marginalisierten Quartiers es sich handelt. Besonders problematisch ist das Leben meist in Quartieren, die im Zuge der rapiden Bevölkerungszunahme der Großstädte als Maßnahme der Wohnraumbeschaffung außerhalb der Großstädte und innerhalb der sog. Trabantenstädte entstanden sind. In fast allen großen bundesdeutschen Städten sind solche Trabantenstädte während der 60er und 70er Jahre auf der grünen Wiese errichtet worden. Beispiele für diesen Quartierstyp lassen sich in NRW zahlreiche viele finden: Dortmund-Nordstadt, Essen-Katernberg, Köln-Chorweiler, DuisburgMarxloh oder Düsseldorf-Garath. Die Bevölkerungsdichte ist dort immens hoch, in KölnChorweiler wohnen mehr als 25.000 Menschen, etwa 70 Einwohner/innen pro Hektar20. Bis Ende der 80er Jahre waren die Wohnungen dort äußerlich verwahrlost, es gab lange Zeit nur wenige Grünanlagen, kaum kulturelle und soziale Einrichtungen und nur wenige und ausschließlich zentrale Einkaufsmöglichkeiten. Es gibt fast nur Sozialwohnungen, die Entfernungen zur Arbeit und in die City sind in der Regel weit, jedoch meist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Die Entwicklung dieser sog. Trabantenstädte ist schillernd, d.h. es gab Phasen, in denen das Wohnen dort als sozialer Abstieg gewertet wurde, und solche, in denen der Wunsch, dort zu wohnen, bei vielen Bewohner(inne)n durchaus vorhanden war. Maßgeblich begünstigt wurde dieser Trend durch umfangreiche Sanierungsarbeiten, die in den 90er Jahren in diesen Trabantenstädten vollzogen wurden. Sie verbesserten das Gesamtbild dieser Vororte deutlich. Die Häuser wurden gestrichen, Balkone installiert, Hinterhöfe erhellt, neue Freizeit- und Kultureinrichtungen geschaffen, die das Leben in diesen Quartieren deutlich attraktiver machten. Das Lebensumfeld der Kinder und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte in diesen Quartieren ist von dem ihrer Altersgenossen ohne Zuwanderungsgeschichte kaum zu unterscheiden. Hier kumulieren die Nachteile sämtlicher Aspekte der mangelhaften systemischen Integration: hohe Arbeitslosigkeit, geringer Bildungsgrad, kleine soziale Netzwerke, kaum kulturelle Herausforderungen, prekärer rechtlicher Status und geringe Möglichkeiten der politischen Partizipation (vgl. Ottersbach 2004, S. 106f.; Ottersbach 2008, S. 62f.). Ähnlich verhält es sich mit der gesundheitlichen Situation. Sie basiert zum größten Teil auf der Ernährung, der Körperhygiene, dem Schlafrhythmus und der körperlichen Aktivität. In frühen Jahren beeinflussen die Eltern diese Faktoren maßgeblich (vgl. Langness/Leven/Hurrelmann 20 Im Vergleich dazu wohnen in dem eher ländlichen Stadtteil Köln-Fühlingen gerade 4 Menschen pro Hektar. 29 2006, S. 89). Allerdings kommen auch noch weitere Faktoren hinzu, wie z.B. die Wohnlage, die die Eltern nicht oder kaum beeinflussen können. Bekanntlich ist es ein erheblicher Unterschied, ob man in der Stadt neben einer Autobahn und einer Fabrik oder auf dem Land neben einem Wald und einem See aufwächst. Vor dem Hintergrund einer starken Konzentration von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte in marginalisierten Quartieren sind sie erheblich stärker mit Umweltschadstoffen konfrontiert und gesundheitlichen Risikofaktoren ausgesetzt als ihre Altersgenossen ohne Zuwanderungsgeschichte. In späteren Jahren nimmt der Einfluss der Eltern deutlich ab, es wird ein eigener Lebensstil ausgeprägt, der maßgeblich auch über die gesundheitliche Entwicklung entscheidet. Studien wie die Shell-Jugendstudie 2006 (ebd., S. 90ff.) zeigen auf, dass das gesundheitliche Verhalten stark schichtabhängig ist. Angehörige der Unterschicht achten weniger auf ihre Gesundheit und konsumieren häufiger Alkohol, Tabak und andere Drogen. Da Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte überproportional häufig der Unterschicht angehörigen, sind sie auch im Jugendalter deutlich stärker mit gesundheitlichen Risiken konfrontiert als Kinder und Jugendliche ohne Zuwanderungsgeschichte 2.2 Die zentralen Aspekte der sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte Drei Sozialisationsagenturen spielen im Leben der Kinder und Jugendlichen eine zentrale Rolle: die Familie, die peer group und die sozialen Netzwerke. Alle drei Agenturen spiegeln das soziale Milieu wider, in dem eine Person aufwächst und im Rahmen dessen die Person sich im Laufe ihrer Biografie bewegt. Vor dem Hintergrund zunehmender sozialer Mobilität und der Auflösung bzw. Aufweichung der Grenzen sozialer Milieus in den westlichen Wohlfahrtsgesellschaften ist ein Wechsel des sozialen Milieus keine Seltenheit mehr. Galt es früher im Rheinland als üblich, während des gesamten Lebenslaufs z.B. dem bürgerlich-katholischen Milieu anzugehören, so sind wir heute damit konfrontiert, dass Personen im Laufe ihres Lebens z.B. vom konservativtechnokratischen in das liberal-intellektuelle Milieu wechseln. Der Grund für diese Entwicklung ist, dass die wesentlichen Bestandteile der sozialen Milieus, die Lebensstile, im Zuge der Konfrontation der Menschen mit unterschiedlichen Lebenswelten und Lebenslagen sich im Verlauf der individuellen Biografie ändern können. Dies ist nicht generell der Fall, angesichts der Pluralisierung und der schnellen Veränderung der Kulturen jedoch heute – gerade für die Bevölkerung 30 in den Städten – keine Ausnahme mehr. Lange Zeit ist man davon ausgegangen, dass die Menschen mit Zuwanderungsgeschichte andere Lebensstile entwickeln als die Bevölkerung ohne Zuwanderungsgeschichte. Man nahm deswegen auch an, dass sie eigene soziale Milieus ausbilden, die sich von denjenigen der Menschen ohne Zuwanderungsgeschichte aufgrund der unterschiedlichen kulturellen Herkunft unterschieden. Diese Annahmen reichten teils sogar so weit, den Menschen mit Zuwanderungsgeschichte die Herausbildung so genannter Parallelegesellschaften zu unterstellen. Neuere Untersuchungen wie die aktuelle SINUS-Studie zu Migrant(inn)en-Milieus21 zeigen jedoch auf, dass sich die sozialen Milieus der Bevölkerung mit Zuwanderungsgeschichte von denen der Menschen ohne Zuwanderungsgeschichte kaum unterscheiden. Sinus-Sociovision hat im Zeitraum 2006 bis 2008 erstmals eine qualitative ethnografische Studie sowie eine Quantifizierung auf repräsentativer Basis zu den Lebensstilen und Lebenswelten der Bevölkerung mit Zuwanderungsgeschichte durchgeführt und insgesamt acht Migrant(inn)en-Milieus typisiert: - zwei bürgerliche Milieus, darunter das adaptive bürgerliche Milieu mit 16% der Bevölkerung mit Zuwanderungsgeschichte, dass sich durch eine pragmatische moderne Mitte kennzeichnet, die sich nach sozialer Integration und einem harmonischen Leben in gesicherten Verhältnissen sehnt, und das statusorientierte Milieu mit 12% der Bevölkerung, ein klassisches Aufsteiger-Milieu, das durch Leistung und Zielstrebigkeit materiellen Wohlstand und soziale Anerkennung erreichen will, - zwei ambitionierte Migrant(inn)en-Milieus, darunter das multikulturelle PerfomerMilieu mit 13% der Bevölkerung, ein junges, leistungsorientiertes Milieu mit bikulturellem Selbstverständnis, das sich mit dem westlichen Lebensstil identifiziert und nach beruflichem Erfolg und intensivem Leben strebt, und das intellektuellkosmopolitische Milieu, mit dem sich 11% der Menschen identifizieren, ein aufgeklärtes, global denkendes Bildungsmilieu mit einer weltoffenen, multikulturellen Grundhaltung und vielfältigen intellektuellen Interessen, - zwei traditionsverwurzelte Migrant(inn)en-Milieus, darunter ein religiös verwurzeltes Milieu mit 7% der Bevölkerung, ein vormodernes, sozial und kulturell isoliertes Milieu, das den patriarchalischen und religiösen Traditionen der Herkunfts- 21 Die Studie ist bisher nur in Ausschnitten veröffentlicht (vgl. hierzu Sinus-Sociovision 2008). 31 region verhaftet ist, und ein traditionelles Arbeitermilieu mit 16% der Bevölkerung, ein traditionelles Blue Collar Milieu der Arbeitsmigrant(inn)en und Spätaussiedler/innen, das nach materieller Sicherheit für sich und seine Kinder trachtet, - zwei prekäre Migrant(inn)en-Milieus, darunter ein entwurzeltes Milieu mit 9% der Bevölkerung, ein sozial und kulturell entwurzeltes Milieu, das heimatorientiert ist, seine Identität sucht und das nach Geld, Ansehen und Konsum strebt, und das hedonistisch- subkulturelle Milieu mit 15% der Menschen, ein Milieu unangepasster Kinder und Jugendlicher mit defizitärer Identität und Perspektive, das Spaß haben will und sich den Erwartungen der Mehrheitsgesellschaft widersetzt. Vergleicht man diese Milieus mit den bisherigen SINUS-Studien zu Milieus in Deutschland, fällt sofort auf, dass dieselben Milieus zu finden sind, abgesehen von den noch existierenden Milieus, die (noch) typisch ostdeutsch sind22. Die zentralen Ergebnisse dieser neuen SINUS-Studie sind: - Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sind keine kulturell homogene Gruppe. Stattdessen existiert eine vielfältige Milieulandschaft, in der sich insgesamt acht verschiedene soziale Milieus mit ganz unterschiedlichen Lebensauffassungen und Lebensweisen identifizieren lassen. - Auch bei der Bevölkerung mit Zuwanderungsgeschichte kann man nicht von der Herkunft auf das soziale Milieu und umgekehrt schließen. Nicht ethnische Herkunft oder soziale Lage sind besonders prägend für die Ausbildung der einzelnen sozialen Milieus, sondern Wertvorstellungen, Lebensstile und gemeinsame ästhetische Vorlieben. Es existieren gemeinsame lebensweltliche Muster bei Menschen mit Zuwanderungsgeschichte aus unterschiedlichen Herkunftskulturen. Menschen mit denselben Lebensstilen und mit unterschiedlicher Zuwanderungsgeschichte verbindet mehr miteinander als Menschen derselben Herkunftskultur. - Aspekte wie ethnische Zugehörigkeit, Religiosität und Zuwanderungsgeschichte beeinflussen zwar die Alltagskultur, sind aber nicht Milieu prägend und langfristig nicht Identität stiftend. Die Bedeutung der Religiosität wird deutlich überschätzt. Fundamentalistische Einstellungen lehnen drei Viertel der Menschen mit Zuwan- 22 Dies hängt aber eben mit der DDR-Geschichte und damit zusammen, dass in Ost-Deutschland kaum Menschen mit Zuwanderungsgeschichte wohnen. 32 derungsgeschichte ab, fast 85% sind der Meinung, Religion sei eine private Angelegenheit. - Integrationsdefizite finden sich am ehesten in den bildungsfernen, unteren sozialen Schichten – auch das unterscheidet die Milieus der Bevölkerung mit Zuwanderungsgeschichte nicht von derjenigen ohne Zuwanderungsgeschichte. Mit anderen Worten: Erfolgreiche Integration ist maßgeblich bildungsabhängig. Die Urbanität der Herkunftsregion und das Bildungsniveau korrelieren stark miteinander. Die meisten Menschen mit Zuwanderungsgeschichte verfügen über einen hohen Bildungsoptimismus, eine hohe Leistungsbereitschaft und einen ausgeprägten Willen zum sozialen Aufstieg. Strukturelle Barrieren, Informationsdefizite und Fehleinschätzungen sorgen jedoch dafür, dass der Optimismus oftmals nicht eingelöst werden kann. - Die überwiegende Mehrheit (85%) sieht im Erlernen der deutschen Sprache den entscheidenden Integrationsfaktor, für 82% ist Deutsch die übliche Verkehrssprache im Freundes- und Bekanntenkreis. Die geringsten Deutschkenntnisse findet man in den traditionsverwurzelten Migrant(inn)en-Milieus. - Interessant ist zudem noch, dass bei den Menschen mit Zuwanderungsgeschichte das Spektrum der Grundorientierungen breiter und heterogener ist als bei der Bevölkerung ohne Zuwanderungsgeschichte, d.h. es gibt in Migrant(inn)en-Milieus sowohl traditionellere als auch modernere Segmente in den sozialen Milieus als in den Milieus der Bevölkerung ohne Zuwanderungsgeschichte. Ein wesentliches Fazit ist, dass man im Grunde gar nicht mehr von typischen Migrant(inn)enMilieus sprechen kann, da nicht die ethnische oder kulturelle Herkunft das entscheidende Unterscheidungsmerkmal der Milieus ist, sondern traditionelle versus moderne Einstellungen, die im Übrigen im selben Ausmaß sowohl bei der Bevölkerung mit Zuwanderungsgeschichte als auch bei den Menschen ohne Zuwanderungsgeschichte vorzufinden sind. Was den öffentlichen Diskurs jedoch weiterhin dominiert, ist ein Negativ-Klischee, ein Mythos vom „bäuerlichen, traditionsbewussten Ausländer“, den es im behaupteten Ausmaß nicht (mehr) gibt – und den es wahrscheinlich in diesem Ausmaß auch nie gegeben hat. Nur noch eine marginale Gruppe fühlt sich diesem Milieu angehörig – und auch darin unterscheidet sie sich nicht von derjenigen der Menschen ohne Zuwanderungsgeschichte. 33 Zu fragen ist nun noch, welche Rolle spielen die beiden klassischen Sozialisationsagenturen, die Familie und die peer group einerseits, und die neueren Agenturen, die sozialen Netzwerke andererseits, bei der konkreten Sozialisation der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte? Die Familie hatte lange Zeit eine dominante Stellung inne. Sie war Dreh- und Angelpunkt der primären Sozialisation. Angesichts der Pluralisierung der Lebens- und Beziehungsformen musste die bürgerliche Familie jedoch einen Bedeutungsverlust hinnehmen. An die Stelle der Normalfamilie (verheiratete Eltern und zwei Kinder) treten immer häufiger Alternativen wie nicht-eheliche Familien, kinderlose Ehen oder Partnerschaften, Ein-Eltern-Familien, homosexuelle Ehen oder Partnerschaften oder Patchworkfamilien. Von dieser Entwicklung sind auch Familien mit Zuwanderungsgeschichte – vielleicht etwas zeitversetzt – betroffen. Zwar wird ihnen in der wissenschaftlichen Literatur oft ein stärkerer Zusammenhalt diagnostiziert, dennoch nehmen auch in diesen Familien die Scheidungen zu, es wird seltener und später geheiratet und auch die Fruchtbarkeitsrate nähert sich derjenigen der Familien ohne Zuwanderungsgeschichte. Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte sind insofern denselben Veränderungsprozessen ausgesetzt. Ob sie sie nun konservativ als Verlust oder progressiv als Chance zur Veränderung interpretieren, sie hier mal dahingestellt. Der Bedeutungsverlust, den die Familie als primäre Sozialisationsinstanz hinnehmen musste, bedurfte jedoch einer Kompensation. Diese erfahren Kinder und Jugendliche heute vor allem durch die Schule, durch die peer group und durch weitere soziale Netzwerke, die im Zeitalter der Informalisierung auch virtuellen Charakter annehmen können. Damit wird die primäre Sozialisation durch die Familie zwar nicht ersetzt, jedoch in ihrem Bedeutungsumfang und auch in Bezug auf ihre zeitliche Einflussnahme reduziert. D.h. Kinder werden heute sowohl stärker als auch früher und länger als zuvor durch die Schule, durch peer groups und durch andere soziale Netzwerke sozialisatorisch geprägt. Neben den Lebens- und Beziehungsformen hat sich auch die Gestaltung des Zusammenlebens in den Lebens- und Beziehungsformen gewandelt. Vor dem Hintergrund zunehmender Berufstätigkeit der Frauen musste das geschlechtsspezifische Rollenverhalten im Zusammenleben zur Disposition gestellt werden. Kinderbetreuung und Arbeiten im Haushalt müssen neu ausgehandelt und verteilt werden. Neuere Studien zeigen auf, dass die Bereitschaft bei Männern, Tätigkeiten im Haushalt und im Rahmen der Kinderbetreuung zu übernehmen, zwar zunimmt, jedoch nach wie vor nur sehr eingeschränkt ist. Die Bereitschaft, Aufgaben der Kinderbetreuung zu übernehmen, ist dabei höher, als Tätigkeiten im Haushalt durchzuführen. Zudem neigen Männer 34 höherer Bildungsschichten eher dazu als ihre Genossen aus unteren sozialen Schichten. Über das geschlechtsspezifische Rollenverhalten von Familien mit Zuwanderungsgeschichte liegen kaum Untersuchungen vor. Im Rahmen der bereits erwähnten SINUS-Studie wurde auch das Rollenverhalten zwischen den Geschlechtern erfasst. Deutlich wurde, dass sich die Zuschreibung von Aufgaben zwischen den Geschlechtern bei der Bevölkerung mit Zuwanderungsgeschichte nur unwesentlich von derjenigen der deutschen Bevölkerung23 unterscheidet. Große Unterschiede findet man jedoch zwischen den einzelnen Milieus: So vertreten die Angehörigen der traditionsverwurzelten Milieus erwartungsgemäß häufiger ein klassisches Rollenverhalten, während die Vertreter/innen der ambitionierten und bürgerlichen Milieus der Gleichberechtigung viel positiver gegenüberstehen. Auch diese Ergebnisse unterschieden sich nicht von den entsprechenden Milieus der Bevölkerung ohne Zuwanderungsgeschichte. Einmal mehr zeigt sich hier ganz deutlich, dass das Rollenverhalten allgemein und das geschlechtsspezifische Rollenverhalten im Besonderen milieu- und nicht nationalitäten-, ethnien- oder kulturspezifisch orientiert sind. Wenn es in Bezug auf die Milieuzugehörigkeit grundsätzlich keine Differenzen zwischen Kindern und Jugendlichen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte gibt, ist davon auszugehen, dass auch das Freizeitverhalten und die Aktivitäten innerhalb der peer group keine ethnien- oder nationalitätenspezifische Unterschiede aufweisen. Langness/Leven/Hurrelmann (2006, S. 77f.) untermauern diese These, da hauptsächlich geschlechts- und schicht- bzw. bildungsspezifische Unterschiede im Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen beobachtet wurden. Im Rahmen der schichtspezifischen Differenzen ist jedoch darauf aufmerksam zu machen, dass Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte in Bezug auf die Wahl ihrer Freizeitaktivitäten eingeschränkt sind, insbesondere dann, wenn diese mit höheren Kosten verbunden sind. So wird Kindern und Jugendlichen der Unterschicht beispielsweise der Internetzugang wesentlich seltener ermöglicht (59% in 2006) als denjenigen der Mittel- und Oberschicht (84% bzw. 94%) (ebd., S. 84). Mit anderen Worten: Die Nutzung von Informations- und Kommunikationsmedien, die im Zeitalter der Informalisierung eine immer höhere Bedeutung gewinnt, ist nach wie vor ungleich verteilt. Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte sind überproportional stark benachteiligt, wenn die Ausübung von Freizeitstilen mit höheren Kosten verbunden ist. Auch in Bezug auf die Bedeutung der peer-group bzw. der Bereitschaft zur Cliquenbildung scheint es keine ethnien- oder nationalitätenspezifischen Differenzen zu geben (ebd., S. 83f.). 23 Verglichen wird tatsächlich mit der deutschen Bevölkerung, obwohl zahlreiche Menschen mit Zuwanderungsge- schichte ja die deutsche Staatsangehörigkeit (wie z.B. Aussiedler/innen oder Eingebürgerte) besitzen. 35 Festgestellt wurden lediglich geringe alters-, geschlechts- und regionale (Ost-West-) Differenzen. Forschungsstudien haben jedoch gezeigt, dass die sozialen Netzwerke, die für die spätere berufliche (und somit auch soziale) Karriere wichtig sind, stark schichtspezifisch konstruiert sind (vgl. Bommes 1996) . Sie sind ein Teil des Milieus, in denen schichtspezifische Ausprägungen der Lebensstile nach wie vor zu finden sind. Zudem spielen soziale Netzwerke (der Eltern) immer noch eine erhebliche Rolle in der Schule und im Übergang von der Schule in den Beruf. Personalentscheider selektieren Auszbildende und Angestellte nicht nur nach den bereits beschriebenen Kriterien, bei denen Kinder und Jugendliche der Unterschicht und insbesondere mit Zuwanderungsgeschichte benachteiligt werden. Bekannt ist zudem, dass bei der Vergabe lukrativer Ausbildungs- und Arbeitsplätze auch die sozialen Netzwerke (der Eltern) bedeutsam sein können. Eine wichtige Dimension der sozialen Integration ist die Erfahrung von Diskriminierungen. Zu unterscheiden ist zwischen struktureller und personaler Diskriminierung. Unter struktureller Diskriminierung versteht man eine Art institutionalisierter Ungleichbehandlung, wie sie nachgewiesenermaßen im dreigliedrigen deutschen Schulsystem oder auf dem Wohnungsmarkt vorkommt. Personale Diskriminierungserfahrungen sind konkreter Art wie z.B. Beleidigungen oder sogar körperliche Angriffe aus fremdenfeindlichen Motiven. Mehrere Studien (vgl. z.B. Schneekloth 2006, S. 138f.; Brettfeld/Wetzels 2007, S. 333) zeigen auf, dass die Diskriminierungserfahrungen von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte in den letzten Jahren in Deutschland zugenommen haben. Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte sind vermehrt mit zurückweisenden und ausgrenzenden Verhaltensweisen konfrontiert. Insbesondere Muslime werden häufig pauschal als intolerant und gewalttätig stigmatisiert. Nicht übertrieben ist es deshalb zu behaupten, dass Diskriminierungserfahrungen bei Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte zum Alltag gehören und ihre durchaus hohe Bereitschaft zur Integration vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen auf eine harte Probe gestellt wird. Wichtige Rollen bei der sozialen Integration spielen auch die religiösen und politischen Einstellungen der Kinder und Jugendlichen. Religiosität ist ein Aspekt der sozialen Integration, der vor dem Hintergrund der Individualisierung das Leben der Kinder und Jugendlichen in Deutschland immer weniger bestimmt. Gensicke (2006, S. 208ff.) verdeutlicht, dass nur noch die Hälfte der Kinder und Jugendlichen als reli- 36 giös und nur ein Drittel als kirchennah eingestuft werden können24. Zudem fügt der Autor an, dass die große Masse der Kinder und Jugendlichen sich mit ihren Problemen bei den Kirchen nicht aufgehoben fühlt. In Bezug auf Religiosität wurden Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte in einigen Studien im Verhältnis zu Kindern und Jugendlichen ohne Zuwanderungsgeschichte deutliche Abweichungen attestiert25. Auch Gensicke (ebd., S. 220f.) hat in seiner Untersuchung herausgefunden, dass Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte die „echte“ Religion verkörperen (61% bekennen sich als „religiös“), Kinder und Jugendliche ohne Zuwanderungsgeschichte höchstens noch eine Art „Religion light“ (mäßige Religiosität, ca. 53% sagen von sich, sie seien „religiös“) ausüben bzw. – vor allem im Osten – überwiegend ungläubig seien (nur 21% meinen, sie seien „religiös“). Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte, zu denen im Übrigen nicht nur islamisch, sondern zu einem großen Teil auch katholisch und evangelisch orientierte Migrant(inn)en gehören, präferieren eine Art „harte“ Religion. Zudem erhalte die Religion für Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte eine besondere Bedeutung bei der sozialkulturellen Integration in ihr spezifisches Migrantenmilieu. Er schlussfolgert daraus, dass vor dem Hintergrund der Bedeutung der Religion für die soziale Integration die Gefahr wachse, dass sich die Migrant(inn)en von der einheimischen Kultur abschotten bzw. isolieren. Dies wird jedoch durch den Befund konterkariert, dass die Religion für die Wertebildung nur noch sekundär sei, d.h., dass viele Werte heute inzwischen nicht mehr aus religiösen Traditionen abgeleitet werden, sondern Produkte säkularisierter Prozesse sind. Er resümiert: „Traditionen, Normen, Gewohnheiten und Umgangsformen der Familien und Peergroups haben heute für Kinder und Jugendliche zum großen Teil die wertestützende Funktion der Religion übernommen (…)“ (Gensicke 2006, S. 239). Damit dürfte der Stellenwert der Religion eine reine private Angelegenheit geworden sein und in Bezug auf die soziale Integration doch nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Bei den politischen Einstellungen der Kinder und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte müssen zunächst die Möglichkeiten der politischen Partizipation berücksichtigt werden. Lange Zeit war es diesen Kindern und Jugendlichen nicht möglich, die Zusammensetzung des politischen Gemeinwesens mitzubestimmen. Aufgrund der Änderung des 24 Religiosität wird dabei nicht an der Konfessionszugehörigkeit fest gemacht, sondern an der Selbsteinschätzung der Jugendlichen in Bezug auf Glaubensferne bzw. Glaubensnähe. 25 Vgl. hierzu Heitmeyer/Müller/Schröder 1997, und die Kritiken an dieser Studie z.B. bei Bukow/Ottersbach 1999, Bozay 2005. 37 Staatsangehörigkeitsrechts hat sich die Situation für Jugendliche inzwischen gewandelt, da sie fortan (auch) die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und ab dem 17. bzw. 19. Lebensjahr wählen dürfen. Sie geniessen dann dieselben Rechte wie deutsche Jugendliche ohne Zuwanderungsgeschichte. Ein wichtiges Kriterium politischer Einstellungen ist die Haltung zu „Demokratie und Gesellschaft“. Obwohl Demokratie von den meisten Jugendlichen als wichtiger Wert betrachtet wird, ist die Zufriedenheit mit der Ausgestaltung der Demokratie, insbesondere mit den politischen Parteien, seit Jahren eher gering. Die skeptische Haltung ist zudem bei den Jugendlichen in prekären Lebenslagen deutlich größer als bei denjenigen in einer materiell abgesicherten Lage (vgl. Schneekloth 2006, S. 110f.). Etwas überraschend ist jedoch, dass ausländische Jugendliche, die zum großen Teil der Unterschicht angehören, diese Skepsis nicht aufweisen: Mit 76% ist eine deutliche Mehrheit der ausländischen Jugendlichen in Deutschland mit der Demokratie alles in allem eher bzw. sehr zufrieden. (…) Die Bedeutung der Demokratie scheint, unabhängig von deren aktueller sozialer Lage, bei ausländischen Jugendlichen entsprechend höher bewertet zu werden“ (Schneekloth 2006, S. 111). In einer Untersuchung zu „Muslimen in Deutschland“, in der es u.a. um Autoritarismus und Demokratiekritik bei jungen Muslimen und Nicht-Muslimen geht (vgl. hierzu Brettfeld/Wetzels 2007, S. 273f.), wurden – den Bildungsstand und die Schichtzugehörigkeit berücksichtigend – zwar keine Differenzen, aber eben auch – wie in früheren Studien (vgl. Heitmeyer/Müller/Schröder 1997) nahegelegt – keine höheren Werte bei Muslimen festgestellt. Dies gilt im Übrigen auch für religiöse Toleranz bzw. Intoleranz (vgl. ebd., S. 277) und für die Haltung zu politisch-religiös motivierter, terroristischer Gewalt (ebd., S. 330). Dieselben Befunde führt Schneekloth im Übrigen auch für das politische Engagement an. Auch hier tendieren Kinder und Jugendliche der Unterschicht zu Zurückhaltung, während das Engagement bei Kindern und Jugendlichen der Mittel- und der Oberschicht deutlich höher ist. Und auch hier machen ausländische Kinder und Jugendliche eine Ausnahme, obwohl sie mehrheitlich der Unterschicht angehören. Sie neigen zu einem hohen Engagement, was der Autor auf die scheinbar homogenen Sozialräume von Migrant(inn)en zurückführt. Den Grund sieht er darain, „(…), dass insbesondere Migrantinnen und Migranten häufiger in Sozialräumen leben, die stärker durch die eigene Kultur und Nationalität geprägt sind und in denen neben der Pflege der Traditionen ganz pragmatische Unterstützungsleistungen untereinander üblich sind.“ Und weiter: „Dass entsprechende Sozialräume allerdings auch die notwendige Integration in Deutschland 38 erschweren können (Spracherwerb, soziale Kontakte und Kommunikationsverhalten, Erfahrung im Umgang mit Institutionen etc.), stellt in diesem Fall die Kehrseite der Medaille dar“ (ebd., S. 125). Auch hier werden – wie weiter oben – ohne nähere empirische Kenntnisse einfach kulturalistische Gründe bemüht, um die Differenz zu erklären. Hier zeigt sich einmal mehr, dass quantitative Verfahren zwar einen groben Überblick über Aspekte der sozialen Integration verschaffen können. Um weitergehende Erkenntnisse zu gewinnen und um vor allem auch die Motive und Gründe für das Handeln der Kinder und Jugendlichen zu erfahren, ist es unerlässlich, qualitative Verfahren anzuwenden. Die subjektive Sichtweise kann erst durch ein vertrauensvolles Interview an die Oberfläche gelangen. 2.3 Mögliche Ursachen für das prekäre Lebensumfeld von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte In einer Gesellschaft, in der sich die Individuen primär über ökonomisches und kulturelles Kapital26 definieren, sind die Aspekte der systemischen Integration zentral. Die Aspekte der sozialen Integration sind nicht unwichtig, jedoch sekundär. Für die Situation der Kinder und Jugendlichen sind demnach vor allem die soziale Herkunft bzw. der Status der Eltern, die Bildung und der Übergang von der Schule in Ausbildung und Arbeit bedeutsam. Die Bildungsforschung hat in Bezug auf die Institution der Schule nachgewiesen, dass diese mittelschichtorientiert ist, d.h. ihre Kriterien der Bewertung der Leistung, aber vor allem der informellen Bildungsinhalte entsprechen denjenigen der Mittelschicht. Kinder der unteren sozialen Schichten sind dadurch per se benachteiligt, weil sie aufgrund der schichtspezifischen Sozialisation nicht dieselben Voraussetzungen mit in die Schule bringen können wie die Kinder der Mittel- bzw. der Oberschicht. 26 Vgl. Bourdieu 1987. Pierre Bourdieu spricht angesichts der Bedeutung des kulturellen Kapitals auch von kulturel- ler Kompetenz bzw. von einem spezifischen oder „angemessenen Code“, den man besitzen und anwenden können muss, um bestimmte kulturelle Spielarten „lesen“ oder verstehen zu können (vgl. Bourdieu 1987, S. 19). Dieser Code – so könnte man in Bezug auf unsere Thematik sagen – wird Jugendlichen aus den unteren sozialen Schichten und mit Zuwanderungsgeschichte verwehrt. 39 Die Reproduktion der Schichtzugehörigkeit durch die Schule kann aber nicht als die einzige Ursache für ungleiche Bildungschancen gelten. Nach wie vor sind Bildungsabschlüsse in modernen Gesellschaften auch eine Folge sozialisatorischer Bedingungen. Schicht-, Geschlechts- und Regionalzugehörigkeit beeinflussen den Bildungserwerb maßgeblich. Die Prägung, die die Heranwachsenden durch den Status der Familie und auch durch die peer group erfahren, bestimmt über den Erfolg bzw. den Misserfolg der eigenen Karriere. Die Ergebnisse der schichtspezifischen Sozialisationsforschung legen nahe, dass insbesondere die familiären Sozialisationsprozesse schichtspezifisch geprägte Persönlichkeiten erzeugen. Die berufliche Stellung des Vaters und der Mutter haben einen enormen Einfluss auf das Bildungsverhalten der Kinder. Schichtspezifische Denk- und Handlungsmuster werden teils intendiert, teilweise auch unbewusst auf die Kinder übertragen. Schon Basil Bernstein (1971, S. 52ff.) hat über die Differenzierung zwischen restringiertem und elaboriertem Code den Nachweis erbracht, dass die Kommunikation und die Art und Weise, wie über welche Themen im Elternhaus debattiert wird, den Schulerfolg der Kinder maßgeblich beeinflussen. Satzbau, Wortschatz und -wahl, Abstraktionsvermögen und Ausdrucksfähigkeit der Kinder werden erheblich durch die Kompetenzen und Kenntnisse der Eltern vermittelt. Zudem werden mit der Schichtzugehörigkeit typische Wertvorstellungen, Gesellschaftsbilder, Erziehungseinstellungen und auch -praktiken vermittelt. Vermutungen tendieren sogar dahin, dass Unterschichten gegenüber hoch qualifizierenden Bildungsinstitutionen wie Gymnasien oder Universitäten eine affektive Distanz hätten bzw. über geringere Informationen und Kenntnisse in Bezug auf mögliche Bildungschancen in besser oder sogar hoch qualifizierten Berufen verfügen (vgl. Bolder 1987, S. 151f.). Im Gegensatz zur klassischen Sozialisationsforschung tendiert die neuere soziologische Forschung dazu, sich nicht mehr so sehr mit der Entstehung von Bildungsprozessen zu beschäftigen, sondern mit den Auswirkungen der Bildung bzw. der Bildungsungleichheit. Nicht mehr die Bildungsungleichheiten an sich, sondern die Frage, wie soziale Ungleichheit über Bildung reproduziert wird, steht nun im Vordergrund des wissenschaftlichen Interesses. In der neueren soziologischen Forschung wird die enge Verbindung von Statuserwerb, Mobilitätsprozessen und Netzwerken hervorgehoben. Soziale Herkunft, Bildungserfolg und erreichter beruflicher Status sind stark miteinander verflochten. Hohe Bildungsabschlüsse korrelieren mit dem Einstieg in hoch qualifizierte Berufsfelder und hohem sozialen Status. Sie sind entscheidend für die spätere berufliche Platzierung und für das soziale Ansehen. Als besonders prägnant gilt auch weiterhin die „Weiterleitung“ des Status’ der Eltern, insbesondere des Vaters, auf den der eigenen Kinder. Niedriger 40 Status und enge soziale Netzwerke der Eltern schränken einen angemessenen Informationsfluss über Bildungsmöglichkeiten ein. Die Folge ist, dass das Spektrum der Bildungs- und Berufswahlprozesse ebenfalls relativ gering ist. Eltern der Unterschicht und insbesondere Eltern mit Zuwanderungsgeschichte verfügen über wenig Macht bzw. Einfluss. Rechtlich und politisch der deutschen Bevölkerung nicht gleichgestellt, verfügen sie auch über geringe ökonomische Ressourcen. Hinzu kommen Sprach- und Kommunikationsbarrieren. Die zunehmende Polarisierung der Quartiere innerhalb der Städte verstärkt zudem die unfreiwillige Bildung isolierter, homogener Netzwerke. Eine besondere Bedeutung erhalten die zur Verfügung stehenden sozialen Netzwerke nochmals bei der Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatzsuche. Untersuchungen haben gezeigt (vgl. Bommes 1996, S. 44), dass die informellen Beziehungen mindestens so ausschlaggebend sind wie die öffentlich proklamierten und in einer Leistungsgesellschaft üblicherweise geforderten Kompetenzen wie Qualifikation, Wissen, hohe Motivation, Flexibilität, Disziplin, hohe Kommunikationsfähigkeit etc. Verwandt- bzw. Bekanntschaftsverhältnisse haben offenbar auch Einfluss auf die Gestaltung und die Ergebnisse der Versuche, einen Ausbildungs- bzw. einen Arbeitsplatz zu bekommen. Ungleiche Bildungs- und Ausbildungsbeteiligung sind Pierre Bourdieu (1983) nach als Folge der endogenen Schichtzugehörigkeit, wie sie sich in der ungleichen Verteilung von ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital ausdrückt, und der damit einhergehenden schichtspezifischen Sozialisationsprozesse zu interpretieren. So erschwert z.B. die relativ niedrige Ausstattung der Eltern der unteren sozialen Schichten mit ökonomischem Kapital eine ausreichende Unterstützung der Kinder bei schlechten Schulleistungen. Auch in kultureller Hinsicht sind sie benachteiligt, da sie z.B. in der Familie seltener und später mit den entsprechenden Technologien konfrontiert werden. Begrenzte Bildungskapazität bzw. -mobilität der Eltern schränken die Unterstützungsmöglichkeiten ebenfalls ein. Die Ausprägung und die Entfaltung eines spezifischen Lebensstils, der unmittelbar mit der IT verknüpft ist, werden den Jugendlichen erschwert. Zudem sind die verschiedenen Generationen mit geringerem sozialem Kapital ausgestattet. Ihre informellen Netzwerke sind beschränkt, sie müssen große Hürden nehmen, um intensivere Beziehungen außerhalb ihrer Schichtzugehörigkeit und außerhalb ihres Wohnortes aufzubauen. Alle diese Beispiele zeigen, dass es nach wie vor Zugangsbarrieren in Form einer niedrigen oder geringen Ausstattung mit den drei genannten Kapitalarten sind, die Kindern und Jugendli- 41 chen der unteren sozialen Schichten den Aufstieg zu machtvollen Positionen in unserer Gesellschaft erschweren bzw. diesen sogar ganz verhindern. Auch die neueren gesellschaftlichen Entwicklungen haben die Bildungs- und Mobilitätsprozesse maßgeblich beeinflusst. Zu nennen sind hier vor allem die Prozesse der Individualisierung und der Pluralisierung. Individualisierung bezeichnet nach Ulrich Beck (1986) sowohl einen Auflösungs- als auch einen Ablösungsprozess. Bestimmte kulturelle Errungenschaften, Einstellungen und Werte werden nicht mehr automatisch tradiert. Häufig sind eklatante Brüche zwischen den Eltern und ihren Kindern in Bezug auf die Religionsausübung, auf elementare Einstellungen oder in Bezug auf spezifische Werte festzustellen. Auch die Pluralisierung von Lebens- und Beziehungsformen hat den Einfluss der Familie bzw. der Eltern auf die Bildungschancen der Kinder verändert. Die Kinder von Ein-Eltern-Familien profitieren eventuell nur noch bedingt vom Statuserwerb des Vaters. Auf der anderen Seite kann die Erweiterung der Familie auch völlig neue Perspektiven eröffnen. Festgehalten werden muss jedoch, dass die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Individualisierung und der Pluralisierung nicht alle Bevölkerungsgruppen in gleichem Maße betreffen. Der von Beck als „Fahrstuhl-Effekt“ bezeichnete Prozess der Lohnsteigerung bei gleichzeitiger Verringerung der Erwerbsarbeitszeit (vgl. Beck 1986, S. 124) betrifft Jugendliche der unteren sozialen Schichten heute nur noch sehr bedingt. Sie profitieren weitaus weniger von den Errungenschaften, auch wenn ihre Eltern einen wichtigen Beitrag bzw. entscheidende Voraussetzungen für diese Entwicklung geleistet haben. Für die Gruppe der Kinder und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte, die zu einem großen Teil ebenfalls der unteren sozialen Schichten angehören, haben Mechthild Gomolla und Frank-Olaf Radtke (2002) nachgewiesen, dass sie sowohl der direkten als auch der indirekten institutionellen Diskriminierung unterworfen sind27. Die Autor(inn)en weisen nach, dass u.a. die Begrenzung der Bildungsmöglichkeiten auch durch eine überwiegende Zuweisung der Kinder mit Zuwanderungsgeschichte (nach Abschluss der Primarstufe) in niedrig qualifizierende weiterführende Schulen (Real- und Hauptschulen) erfolgt. Folglich sind auch ihre Schulabschlüsse niedriger und die Schulabbrecherquote ist immer noch überproportional hoch. Zudem beurteilen Lehrerinnen und Lehrer Schulleistungen von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsge27 Mit der Bezeichnung der institutionellen Diskriminierung wird das Augenmerk nicht mehr auf die Individuen, sondern auf die institutionalisierten Strukturen sozialer Prozesse gelegt. Die Ursachen von Diskriminierung werden dabei im organisatorischen, nicht mehr im individuellen Handeln gesehen. 42 schichte schlechter als diejenigen der Kinder und Jugendlichen ohne Zuwanderungsgeschichte. Die überproportional hohen Sonderschuleinweisungen von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte sind ebenfalls als ein Zeichen einer institutionellen Diskriminierung zu werten (vgl. Bommes/Radtke 1993, S. 483-497). Eine weitere Form der institutionellen Diskriminierung könnte in Bezug auf die Einstellungspraxis der Unternehmen behauptet werden. Zweifellos gibt es auch hier Diskriminierungsformen, wenn Unternehmen aufgrund der Befürchtung, dass Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte einen negativen Eindruck auf Kund(inn)en machen könnten, Jugendliche ohne Zuwanderungsgeschichte bevorzugen. Da die IT-Branche jedoch großen Wert auf ihre globale Orientierung legt und offen für die hohe Bedeutung interkulturelle Kompetenzen eintritt, kann berechtigterweise höchstens ein geringes Diskriminierungspotenzial seitens der Unternehmerinnen und Unternehmer vermutet werden. Eine weitere Hypothese betrifft die Bedeutung interkultureller Kompetenzen wie Mehrsprachigkeit, Empathie, hohe kulturelle Mobilität etc. Solche Kompetenzen werden sowohl vom Schul- als auch vom Ausbildungssystem bisher zu wenig be- und geachtet. Gerade im IT-Sektor sind solche Kompetenzen jedoch ein enormer Vorteil. Von der Branche werden interkulturelle Kompetenzen häufig auch gefordert. Die Bedeutung der Mehrsprachigkeit, vor allem auch die Kenntnis von Minderheitensprachen, ist im IT-Bereich besonders hoch. Wichtige Bestandteile eines kompetenten Umgangs mit Kund(inn)en sind auch soziale und kommunikative Kompetenzen. Dazu gehört angesichts einer zunehmenden Pluralisierung der Lebenswelten auch die Kenntnis der sehr differenzierten Lebensstile inklusive ihrer spezifischen Konsumorientierungen. Interkulturelle Kompetenzen können dazu beitragen, die Kontaktsituationen mit der Kundschaft aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, eigene und fremde Deutungsmuster zu reflektieren und die Kommunikation konstruktiver und konfliktfreier zu gestalten. Allerdings unterliegt auch diese Branche denselben informellen Mechanismen der Inklusion bzw. der Exklusion, mit denen Jugendliche und junge Erwachsene mit Zuwanderungsgeschichte benachteiligt werden, so dass diese Kompetenzen bei Auswahlverfahren nur bedingt ins Gewicht fallen. Die Vermutung, dass schichtspezifische Selektionsmechanismen, indirekte institutionelle Diskriminierung und die fehlende Anerkennung interkultureller Kompetenzen ein einseitiges Bildungsverhalten der Kinder und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte bewirken und diese 43 daher sich in ihrer Berufswahl überwiegend an sog. „einfachen“ Berufen orientieren, entspricht einem deduktiven Automatismus, der empirisch nur bedingt haltbar ist. Denn trotz dieser strukturellen, institutionellen und kommunikativen Benachteiligungs- bzw. Diskriminierungsformen gelingt es Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte immer wieder, die Leiter des Erfolgs empor zu klettern. Quantitative Erhebungen wie z.B. der Mikrozensus reichen deshalb nicht aus, um die für das Verstehen der Unterrepräsentation erforderlichen Aspekte des Migrationskontextes, der Migrationsbiografie und der konkreten Bildungsentscheidungen der Bevölkerung mit Zuwanderungsgeschichte zu ermitteln bzw. zu rekonstruieren. Dies kann nur mit qualitativen Methoden geschehen. Qualitative Methoden haben den Vorteil, dass soziale Prozesse wie der Berufswahlprozess, die Entwicklung sozialer Bindungen oder das Rollenverhalten detailliert rekonstruiert werden können, zweifellos nicht ohne ein gewisses Potenzial an Konstruktion. Biografien werden mittels qualitativer Forschungsmethoden in der Tat rekonstruiert, d.h. es entsteht eine subjektive, gefärbte, von bestimmten äußeren Umständen abhängige „Erfindung der eigenen Biografie“. Abgesehen davon, dass auch mit quantitativen Methoden die Ziele der Authentizität und der Repräsentation nicht automatisch erreicht werden können, bieten qualitative Methoden den Vorteil, dass die Betroffenen, über die in der Regel immer nur berichtet und gesprochen wird oder auch Geschichten konstruiert werden, an dieser Stelle selbst zu Wort kommen können. Der biographischen Methode kommt damit noch eine ganz besondere Bedeutung zu: Ganz im Sinne der modernen Ethnographie geht es darum, „den Anderen“ die Möglichkeit zu geben, „(...) ihre Diskurse im eigenen zum Sprechen zu bringen“ (Fuchs/Berg 1993, S. 93). Die Wissenschaft hat dementsprechend vor allem die Aufgabe, Räume zu öffnen, in denen sich „die Anderen“ selbst zur Geltung bringen können, um der Gefahr vorzubeugen, „(...) nicht mehr nur über und vor allem nicht mehr für die Anderen sprechen zu wollen (...)“ (Fuchs/Berg 1993, S. 72). Einer durch die gängigen klassischen und modernen Theorien der sozialen Ungleichheit immer wieder erneuerten Inszenierung der Repräsentation „der Anderen“ könnte damit eine angemessene Perspektive entgegengesetzt werden. Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist der während der Rekonstruktion der eigenen Biografie einsetzende Reflexionsprozess, der es den Interviewpartner(inne)n ermöglicht, teils bereits beendete, teils sich noch im Prozess befindende Entwicklungen und Ereignisse zu reflektieren und ggf. neu zu bewerten. Bei der Evaluation des „biographischen Materials“ muss es darum gehen, bei den Interviewpartner(inne)n sowohl die traditionalen als auch die innovativen sozialen Bestandteile der indivi44 duellen Bewältigungsformen sozialer Ereignisse (vgl. Apitzsch 1996, S. 145f.) herauszukristallisieren. Aus der dialektischen Vorgehensweise einer – im Sinne von Fritz Schütze – phänomenologisch orientierten Rekonstruktion sozialer Prozesse und des Erkennens teils offener, teils latenter Potenziale der Reflexion und der Transformation der eigenen Situation der Interviewpartner/innen kann dann ein passgenaues Maßnahmenbündel entwickelt werden. Diese Maßnahmen können schließlich eine Verbesserung der Situation der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und eventuell auch eine Erhöhung des Anteils der Kinder und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte in hoch qualifizierten Berufsfeldern bewirken. Neben den im Rahmen der Bildungs- und der Migrationsforschung eruierten allgemeinen Gründen ermöglichen biographische Interviews sehr detaillierte Einblicke in die Lebenslagen und welten der jungen Erwachsenen mit Zuwanderungsgeschichte. Die Gruppe der Interviewpartner/innen unterscheidet sich nicht nur durch die einzelnen Migrationskontexte bzw. die verschiedenen Migrationsgründe24. Auch die weitere Sozialisation bzw. die konkrete Behandlung im Aufnahmeland ist von entscheidender Bedeutung bei der Entwicklung diverser Karrieremuster. Biografieentwicklungen oder Karrieren werden heute maßgeblich durch den Umgang mit Risiken geprägt. Diese können sowohl äußerlicher als auch innerlicher Art sein. Tritt ein Risiko von außen auf, ist es nur so lange als objektiv zu bewerten, bis der, zwar strukturell geprägte, jedoch individuell entschiedene und vollzogene Umgang mit dem Risiko beginnt. Unsicherheitserfahrungen, wie z.B. die Nicht-Anerkennung eines im Herkunftsland erworbenen Zertifikats durch das Aufnahmeland, können auf sehr verschiedene Art und Weise bewältigt werden. Die eine Person wirft z.B. das Handtuch und kehrt wieder in ihr Herkunftsland zurück, eine andere Person mag diese Unsicherheitserfahrung als Herausforderung interpretieren und versucht, den Abschluss im Aufnahmeland nachzuholen oder ggf. auch für dessen nachträgliche Anerkennung zu kämpfen. In beiden Fällen geht es jedoch darum, auf irgendeine Art und Weise (wieder) biographische Sicherheit zu erlangen. Dafür bedient man sich so genannter Sicherheitskonstruktionen, mit denen deutend bzw. Sinn gebend versucht wird, die Unsicherheitserfahrung zu bearbeiten. Die Wahl der Sinngebung bzw. des Deutungsmusters beeinflusst maßgeblich den Umgang mit dem Risiko und somit auch die Auswahl des Handwerkzeugs, mit dem man versucht, das Risiko abzustellen, es zu umgehen oder zu kompensieren. 45 Im Rahmen eines Forschungsprojekts28 konnten in Interviews mit Auszubildenden mit Zuwanderungsgeschichte eine ganze Reihe solcher Unsicherheitserfahrungen erkundigt, jedoch eine nur sehr geringe Anzahl an Sicherheitskonstruktionen in den Biografieverläufen offenbart werden. Die Auszubildenden waren einerseits mit allgemeinen, andererseits aber auch mit branchenspezifischen Unsicherheiterfahrungen konfrontiert. Zudem gab es auch einige Erfahrungen, die nur die zugewanderte Bevölkerung machen kann bzw. die bei der Vergleichsgruppe der Auszubildenden ohne Zuwanderungsgeschichte nicht auftreten. Das Verhältnis von Unsicherheitserfahrungen und Sicherheitskonstruktionen entscheidet schließlich über die Art und Weise der individuellen beruflichen Karriere. (vgl. hierzu ausführlicher Deimann/Ottersbach 2005; Deimann/ Ottersbach 2007). Gezeigt wurde, dass Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte in der zweiten und auch noch in der dritten Generation der soziale Aufstieg in unserer Gesellschaft systematisch erschwert wird. Sie werden in allen zentralen gesellschaftlichen Bereichen, d.h. im Bildungs-, Ausbildungs- und auch im Arbeitsmarktsystem, häufig in institutionalisierte Sackgassen geleitet. Gerade das Bildungssystem, dessen Aufgabe es ist, Aufstiege zu ermöglichen und für Chancengleichheit zu sorgen, offenbart sich als völlig dysfunktional. Insbesondere das dreigliedrige Schulsystem selektiert viel zu früh und gestattet kaum soziale Aufstiege. Stattdessen begünstigt es die Festigung des sozialen Status der Angehörigen der unteren sozialen Schichten. Die im Rahmen der Jugendhilfe, der Jugendsozialarbeit oder auch der Schulsozialarbeit angebotenen Unterstützungsleistungen sollen dieses Manko kompensieren. Eine eigens initiierte interkulturelle Pädagogik soll Pädagog(inn)en in die Lage versetzen, auf die Belange von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte mit besonderer Sensibilität zu reagieren. Zielgruppenspezifische Maßnahmen haben jedoch häufig den negativen Effekt, dass sie die zu unterstützende Gruppe stigmatisieren. Ob die „positive Diskriminierung“ tatsächlich als eine effektive Kompensation der sozialen Ungleichheit bzw. der Defizite der Selektion bewertet werden kann, ist umstritten und kann im Rahmen dieser Expertise als Problem nur angerissen werden. 28 Vgl. hierzu das im Rahmen des EQUAL-Programms und im Auftrag des ehemaligen Landeszentrums für Zuwan- derung durchgeführte Projekt „OpenIT – Öffnung der IT-Berufe für Migrantinnen und Migranten“. Das von uns wissenschaftlich begleitete Projekt sah seinen Auftrag darin, – neben Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern und jüdischen Kontingentflüchtlingen – vor allem die Zielgruppe der zweiten und dritten Generation der Einwanderinnen und Einwanderer näher an hoch qualifizierte Berufe des IT-Sektors heranzuführen (vgl. hierzu Deimann/Ottersbach 2005). 46 3. Die subjektive Sichtweise von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte auf ihr Lebensumfeld in der Literatur Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte rücken immer mehr in den Fokus des öffentlichen Interesses. Bei der Recherche der aktuellen Literatur zur Thematik wird jedoch deutlich, dass sie immer noch häufig nur als Problem präsentiert werden und dass der wissenschaftliche Blick weniger die subjektive Sichtweise auf ihr Lebensumfeld berücksichtigt, sondern in Form von Expertenwissen (von Lehrer(inne)n, Sozialarbeiter(inne)n etc.) dargeboten wird. Autor(inn)en, die jedoch die subjektive Sichtweise von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte erforschen, tun dies wiederum hauptsächlich aus Interesse an ganz bestimmten Aspekten des Lebensumfelds, z.B. im Zusammenhang mit Bildung, sozialer Ungleichheit, Armut, Religion usw. oder auch als Kombination bzw. gegenseitige Beeinflussung verschiedener Aspekte des Lebensumfelds. Eine Forschung, die die subjektive Sichtweise von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte auf ihr Lebensumfeld als Gesamtheit von systemischer und sozialer Integration mittels qualitativer Methoden untersucht, ist nicht bekannt. Eine Ausnahme bildet die 15. Shell-Jugendstudie aus dem Jahr 2006, in der rund 2500 Jugendliche aus Deutschland, sowohl ohne als auch mit Migrationshintergrund hinsichtlich ihrer (politischen) Einstellungen, individuellen Hoffnungen und Werte befragt wurden. Im qualitativen Teil dieser Studie wurden 25 Leitfadengespräche inhaltsanalytisch ausgewertet. Darüber hinaus werden 20 Jugendliche in Porträts vorgestellt, von denen wiederum vier eine Zuwanderungsgeschichte aufweisen können. Im Folgenden werden aktuelle Studien, die die subjektive Perspektive der Kinder und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte auf ihr Lebensumfeld mittels qualitativer Methoden erforschen, aus analytischen Gründen nach bedeutsamen Aspekten des Lebensumfelds dieser Kinder und Jugendlichen vorgestellt. Diese Studien verdeutlichen auch eine gewisse Rangordnung der verschiedenen Aspekte. Dem Alter entsprechend dominieren Aspekte wie Bildung, Ausbildung, Berufsperspektive, Familie und die peer group. Darin unterschieden sich Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte nicht von denjenigen ohne Zuwanderungsgeschichte. An zusätzlichen, herkunftsspezifischen Aspekten werden „lediglich“ institutionelle und persönliche Diskriminierungserfahrungen im Alltag erwähnt. Allerdings sind diese negativen Erfahrungen vielfach prägend für die Einstellungen der Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte in Bezug auf ihre Identitätsentwicklung, ihr Zugehörigkeitsgefühl und die Integration. 47 Bildung und Ausbildung Bildung und Ausbildung haben einen sehr hohen Stellenwert im Alltag der Kinder und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte. In der erwähnten Shell-Jugendstudie äußern die Jugendlichen, dass sie bemüht sind, gute Schulabschlüsse zu erreichen, um später genug Geld zu verdienen und einen Ausbildungsplatz zu bekommen. So schätzt z.B. ein Jugendlicher seine Chancen als Realschüler eher schlecht ein, so dass er einen Wechsel aufs Gymnasium anstrebt. Die Einschätzungen zur Schule reichen von keinen oder geringen Probleme in der Schule weder hinsichtlich der Leistungen noch im sozialen Umgang bis hin zu erheblichen schulischen Problemen, die durch geringe Unterstützung seitens der Lehrer und durch mangelnden Kontakt zu den Mitschülern flankiert werden. Vera King (2006) hat in 60 qualitativen Interviews Familienbeziehungen und Bildungsbiographien erfragt. Sie stellt dabei heraus, dass Bildungsaufstieg z.B. damit verknüpft sein kann, im Kontext der elterlichen Erwartungen einen eigenen Weg finden zu müssen, und dass ein solcher elterlicher Auftrag von den Kindern als besonders bedrängend erlebt wird, wenn er in der Elterngeneration vor dem Hintergrund von Missachtungs- oder Ausgrenzungserfahrungen formuliert wurde oder wenn die Kinder mit ihrem sozialen Aufstieg das Leid und die Mühen der Eltern zu kompensieren versuchen. Gerade hinsichtlich der in der Adoleszenz anstehenden Entwicklungsaufgaben können Widersprüche entstehen, wenn beispielsweise Bildungsanstrengungen hauptsächlich als Anpassung an elterliche Wünsche erlebt werden. Diesbezüglich untersuchte King die Verschränkung von adoleszenten Entwicklungen und Bildungsverläufen und trifft dabei auf zwei Konstellationen. Zum einen gibt es Jugendliche, die die elterliche Bildungsaspiration übernehmen und denen es nicht gelingt, sich vom Erwartungsdruck der Eltern zu lösen. Dies kann man jedoch bei Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund beobachten. Durch Erfahrungen der Diskriminierung, der Kinder aus Migrantenfamilien öfter und in stärkerem Maße ausgesetzt sind, kann dieser Prozess jedoch verstärkt werden und dazu führen, dass sich die Betroffenen trotz Bildungsaufstieg nicht in etablierten und anerkannten Positionen verorten, sondern die Nähe zu den ‚Gescheiterten’ und Außenseitern beibehalten. Zum anderen gibt es Jugendliche, denen Erfahrungen, die sie im Bildungssystem machen, bei der Erarbeitung innerer und äußerer Freiräume in der Adoleszenz hilfreich sein können, was wiederum dazu führt, dass die Veränderung im Verhältnis zur Herkunftsfamilie die Motivation und das Interesse im schulischen Bereich verstärken 48 kann. Da sich Kinder aus bildungsfernen und/oder Migrantenfamilien per se gesteigerten Transformationsanforderungen gegenüber sehen, können sich in dem Maße, wie die gesteigerten Anforderungen bewältigt werden, die persönlichen Kompetenzen und biografischen Ressourcen erweitern. Diese beiden Konstellationen machen deutlich, dass soziale Anerkennung auf der einen Seite und gesellschaftliche Missachtung, Ausgrenzung oder Diskriminierung, wie sie gerade Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte erfahren, auf der anderen Seite Auswirkungen auf adoleszente und familiale Entwicklungen haben können: „Die Mechanismen des Einund Ausschlusses in die Bildungssituationen sind auf verschiedene Weise mit daran beteiligt, ob und wie Transformationsanforderungen der Adoleszenz zur Überforderung werden“ (King 2006, S. 43). Auch Andreas Pott (2006) unterstützt diese Aussage. Er untersucht mittels qualitativer Interviews den Bildungsaufstieg von Mädchen der zweiten türkischen Migrationsgeneration und stellt heraus, dass sie neben den Anforderungen einer höheren Bildungskarriere mit zusätzlichen Schwierigkeiten konfrontiert werden, die mit der allmählichen Entfernung von ihrem Herkunftsmilieu zusammenhängen. So fühlt sich z.B. eine junge Frau sehr in der Familie verortet und trifft ihre Entscheidungen mit großem Respekt und Rücksichtnahme gegenüber den Einstellungen und Meinungen der Eltern. Da die Eltern nicht wünschen, dass sie als Frau alleine wohnt, wird der Studienort in der Nähe des Elternhauses gewählt, damit sie weiterhin zu Hause wohnen kann. Eine andere junge Frau begreift ihre Bildungskarriere als Modernisierung und persönliche Emanzipation. Dies hat auch Einfluss auf die Wahl ihres Berufes. Sie möchte ihre Erfahrungen und erworbenen Kompetenzen als Pädagogin weitergeben. Erika Schulze (2007) zeigt anhand biografischer Beispiele, mit welchen konkreten Folgen und Barrieren Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte im Schulalltag aufgrund stereotyper Vorstellungen und defizitorientierter Perspektiven des öffentlichen Diskurses konfrontiert sind. Die interviewten Jugendlichen haben von ihren Eltern einen deutlichen Bildungsauftrag erhalten, wobei das große Bildungsinteresse der Eltern an die eigenen Erfahrungen in der Migration geknüpft ist. Die sich daraus ergebende Unterstützung zeigt sich in der Befürwortung des Bildungsaufstiegs und in emotionaler Stärkung, fällt aber in Abhängigkeit von ökonomischen und sozialen Ressourcen sowie der familiären Situation sehr verschieden aus. Während die einen große Unterstützung erhalten, wird von den anderen eine enorme Eigenständigkeit abverlangt. In ihren Beispielen zeigt Schulze, wie Bildungsprozesse bzw. -aufstiege von privaten und verwandtschaftlichen Netzwerken flankiert und unterstützt werden. „Häufig als ‚Integrationshemmnis’ wahrge49 nommen, bilden diese Netzwerke einen wichtigen Faktor im individuellen Bildungsweg (…)“ (Schulze 2007, S. 225). So werden die entsprechenden Unterstützer nicht nur als Mittler und Nachhilfe, sondern auch als Vorbild wahrgenommen, denen eine große Bedeutung zugeschrieben wird. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der von den Interviewten genannt wird, ist die Zusammensetzung der Schülerschaft und deren Auswirkung auf das Lernklima und den Schulalltag allochthoner Jugendlicher. Der Anpassungs- und Selektionsdruck, der auf die Schüler/innen sowohl durch die Lehrer/innen als auch durch die Mitschüler/innen ausgeübt wird, wird als sehr massiv erlebt. Sogar die selbstverständliche Mitgliedschaft zur Institution Schule wird dabei angezweifelt. Hingegen lassen eine heterogene Zusammensetzung der Schülerschaft z.B. auf einer weiterführenden Schule die Erfahrungen als ‚Abweichender’ und ‚Fremder’ in den Hintergrund treten. Berufliche Perspektiven In der Shell-Jugendstudie wird seitens der interviewten Jugendlichen zum einen der Wunsch nach einer Arbeit, die ausfüllend ist und die Grundlage für ein materiell sorgenfreies Leben ist, geäußert. Es werden aber auch Sorgen hinsichtlich des Arbeitsmarktes und der internationalen Konkurrenz geäußert. Ein Jugendlicher sieht z.B. gute Entfaltungs- und Wahlmöglichkeiten im Vergleich zu seinem Herkunftsland Jordanien, trotzdem fühlt er sich durch die pessimistische Sichtweise von anderen verunsichert. Deimann/Ottersbach (2005) zeigen in ihrer bereits erwähnten Studie auf, dass das berufliche Arrangement junger Menschen mit Zuwanderungsgeschichte im Gegensatz zu einheimischen deutschen Jugendlichen von „zahlreichen und sehr vielfältigen Unsicherheitserfahrungen und von eher wenigen Sicherheitskonstruktionen“ (2005, S. 45) begleitet wird. Ihre Interviews zeigen auf, dass Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte über „weniger soziale Kontakte zu Verantwortlichen in Unternehmen und über deutlich geringeres ökonomisches Kapital“ (ebd.) verfügen. Allerdings gibt es auch Abweichungen. So bewegen sich politische Flüchtlinge (z.B. aus dem Iran), deren ökonomische Situation bereits in ihrem Herkunftsland als gut zu bezeichnen war, im Aufnahmeland unabhängiger und erfolgreicher. „Die Kapitalien migrieren mit ihnen, ohne an Wert einzubüßen. (...) Lediglich die im Herkunftsland erworbenen sozialen Kontakte verlieren im Aufnahmeland in der Regel an Bedeutung, es sei denn, es handelt sich um Anschlussmigration mit Bezugspersonen im Einwanderungsland“ (ebd.). Die Interviews dieser Studie verdeutlichen zu50 dem, dass der Migrationskontext weiterhin eine wichtige Rolle bei der Positionierung im Aufnahmeland spielen kann. Junge Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sind in hoch qualifizierten Berufen nach wie vor deutlich unterrepräsentiert. Befragte Neuzuwanderer (anerkannte Asylbewerber, Spätaussiedler, Familienangehörige) entwickeln z.B. in Bezug auf die Ausbildung in IT-Berufen nur ein „schwaches berufliches Arrangement“, das häufig sogar von sozialem Abstieg begleitet wird. Anders ist es bei den Befragten aus zugewanderten Familien: Diese Jugendlichen entwickeln – vor dem Hintergrund des relativ niedrigen Status ihrer Eltern – eher ein starkes berufliches Arrangement. Ihre Eltern sind als Gastarbeiter eingereist, waren in unteren Arbeitssegmenten beschäftigt, so dass deren Kinder ihre Karriere als sozialen Aufstieg interpretieren können. Dieser gelingt jedoch nur einer Minderheit der zweiten oder dritten Generation. Hingegen entspricht die Einmündung der befragten einheimischen jungen Deutschen in die Ausbildung eines IT-Berufs eher einem selbstverständlichen beruflichen Arrangement. Der soziale Aufstieg ist hier öfter realisierbar bzw. er wird gar nicht als soziale Mobilität aufgefasst, weil ihre Eltern vergleichbar auf dem Arbeitsmarkt positioniert waren oder sind. Wohnen Schulze und Spindler (2006) haben in Gesprächen mit Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte deren Lebenssituation in marginalisierten Quartieren rekonstruiert. Sie stellen heraus, dass die Straße – mit all ihren positiven und negativen Seiten – für die Jugendlichen Normalität und Alltag bedeutet. Allerdings müssen sie sich mit der Stigmatisierung ihres Quartiers und der damit verbundenen Problematisierung der eigenen Person auseinander setzen. Im Umgang damit werden unterschiedliche Strategien der Jugendlichen deutlich. Die einen versuchen, dem Stigma ein positives Bild entgegen zu setzen, kämpfen um Anerkennung und verteidigen ihre Umwelt oder nutzen sogar das Stigma zur strategischen Vorteilnahme, während andere zur Übernahme der problematisierenden Sicht tendieren, indem sie die Nachbarschaft oder andere Jugendcliquen für das Übel verantwortlich machen. Politische Partizipation In der Shell-Studie spielen bezüglich der politischen Partizipation der Kinder und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte die ganz persönlichen Erfahrungen eine große Rolle. So ist z.B. eine Jugendliche im Jugendgemeinderat engagiert und findet es wichtig, sich aktiv gegen Miss51 stände zu wehren, gerade auf Grund ihrer eigenen Erfahrung mit Rassismus. Ein anderer Jugendlicher teilt diese Meinung und findet es gut, jung wählen zu dürfen, um verantwortlicher zu urteilen. Eine Jugendliche findet sich im Gegensatz dazu noch zu jung und möchte sich später erst gesellschaftlich engagieren. Ein Jugendlicher meint, die Jugend würde zu sehr unter Leistungsdruck stehen und dass es viele gibt, die keine Ziele haben, was seiner Meinung durch Probleme innerhalb der Gesellschaft (Arbeitslosigkeit) und in den Familien (fehlendes Geld) begründet ist. Intergration Schramkowski (2007) beklagt in ihrer Arbeit, dass der Diskurs über Integration als fortdauernde Aufgabe der gesamten Gesellschaft fast ausschließlich aus der Perspektive der Mehrheitsgesellschaft dargestellt wird. Sie lässt junge Erwachsene mit Zuwanderungsgeschichte zu Wort kommen, die ihrem ganz eigenen Verständnis und Erleben zum Thema Integration Ausdruck geben. In ihren Aussagen werden die alltagsrassistischen Zuschreibungen und Ausgrenzungen, denen sie in den verschiedensten Lebenskontexten ausgesetzt sind, deutlich. Ohne Berücksichtigung ihrer individuellen Orientierungen und Lebenslagen werden sie von der Mehrheitsgesellschaft nicht als gleichberechtigte Gesellschaftsmitglieder anerkannt, sondern auf ihr ‚Anderssein’ bzw. ‚Fremdsein’ reduziert. Die Erfahrungen von Zuschreibung und Ethnisierung können dazu führen, dass die Befragten Integration als negativ konnotierten Terminus wahrnehmen. „Für mich aber hat dieses Integrationswort seinen Wert verloren und es ist jetzt ein negatives Wort, weil durch das Wort Integration werden […] diese Ausgrenzungen gemacht. Du bist das, und du bist das.“ (2007, S. 154). Und nicht nur das, der alltäglich erfahrene Rassismus kann dazu führen, dass durch deutliche Abgrenzung und Rückzug der Betroffenen von der Mehrheitsgesellschaft das genaue Gegenteil von Integration erreicht wird. Jugendkultur, die Bedeutung der peergroup und Freizeit Ganz selbstverständlich wird auch in der Shell-Studie die hohe Bedeutung der Freunde für Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte erwähnt. Einem Jugendlichen ist Musik sehr wichtig, sowohl als Konsument als auch als Praktizierender, weil sie zu seiner Persönlichkeitsentwicklung beigetragen hat. Er verbindet damit Kultur, die auch durch seinen Kleidungsstil zum Ausdruck kommt. 52 Lübcke (2007) geht in ihrer Arbeit davon aus, dass „sich in den Jugendkulturen junger Muslime die Vielfalt westlicher Jugendkulturen ebenso widerspiegelt, wie in den Jugendbiografien und sozialen Gruppenstrukturen Jugendlicher aus muslimischen Milieus.“ Sie untersucht dabei die Verortung junger Muslime einerseits innerhalb der westlichen Jugendkulturen und anderseits innerhalb muslimischer und ethnischer Jugendkulturen. Sie stellt vor dem Hintergrund des umfangreichen empirischen Materials von 80 narrativen Interviews und vier Gruppendiskussionen heraus, dass sich junge Muslime in Deutschland mit der Ausnahme des HipHop nur wenig den einzelnen Jugendszenen zuordnen lassen. Dabei sind die Charakteristika der muslimischen Jugendkulturen, ähnlich der „westlich-angelsächsischen Jugendkulturen, [von] Abgrenzung gegenüber antiquierten kulturellen wie gesellschaftlichen Leitbildern und Rollenzuweisungen“ (ebd., S. 313) geprägt. „Wie in den individualisierten westlichen Jugendkulturen werden auch in muslimischen Szenen eigene identitätsrelevante Stile und ästhetische Ausdrucksformen im Kontext pluraler kommerzieller Freizeitwelten generiert, die nicht nur der Integration in die Gleichaltrigengruppen, sondern auch der Entwicklung persönlicher Autonomie und – ansatzweise – sexueller Orientierung dienen.“ Innerhalb dieser Szenen ist es aber auch möglich, sich mit den Beziehungen zur Mehrheitsgesellschaft und mit den Werten und Traditionen der Eltern- und Großelterngenerationen auseinander zusetzen. Lübcke macht aber auch deutlich, dass es kaum Forschungsmaterial gibt, das die Vielfalt der Ausdrucksformen junger Migrant(inn)en hinsichtlich ihrer biografischen Relevanz auf Dimensionen und Gestalten spezifischer Generationenkonflikte untersucht. Familie In der Shell-Studie äußern alle Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte, dass ihnen ihre Familie als Basis und Rückhalt für ihr gesamtes Handeln sehr wichtig ist. Es werden für die Jugend normale Ablöseschwierigkeiten benannt, wie z.B. von einer Mutter, die Probleme mit der zunehmenden Selbständigkeit ihres Sohnes hat. Aber auch spezifische Problematiken, wie z.B. der kontrollierende Bruder oder die Ferne von Familienangehörigen im Herkunftsland spielen eine Rolle. 53 Werte und Religion In der Shell-Studie (2006) werden Selbstbewusstsein, Sicherheit, Spaß haben und der Einsatz für persönliche Ziele als wichtige Werte der Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte genannt. Es wird von einer Jugendlichen auch als große Freiheit empfunden, in der Schule und im Beruf Kopftuch tragen zu können, obwohl sie selber keines trägt. Der Blick auf die Wichtigkeit der Religion ist gemäß der Ergebnisse der befragten Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte in der Shell-Studie (2006) sehr verschieden. Grundwerte werden als wichtig erachtet, müssen aber nicht zwangsläufig auch Einfluss auf die Lebensweise haben. Nökel (2007) hat eine Studie veröffentlicht, die 18 narrativ-biografische Interviews mit Frauen zwischen 18 und 25 Jahren beinhaltet, die sich als praktizierende und moderne Muslime definieren. Sie kommt zu dem Schluss, dass „innerhalb der zweiten Immigrantengeneration aus muslimischen Ländern eine spezifische Gruppe im Sinne einer ‚sozialen Fraktion’ entstanden ist, die dem Islam einen großen Wert als ethisches und moralisches Ordnungswerk beimisst“ (2007, S. 137). Es wurde auch deutlich, dass sich junge Muslime eine bessere religiöse Erziehung bzw. Aufklärung über ihre Religion durch Eltern, muslimische Organisationen oder die staatlichen Schulen wünschen. Außerdem stellt Nökel heraus, „dass eine intensive religiöse Orientierung am Islam aus Sicht der muslimischen Jugendlichen nicht im Gegensatz zu einer zeitgemäßen Lebensführung stehen muss, sondern selbstverständlicher Bestandteil ihrer je individuell entwickelten Identität sein kann“ (2007, S. 168). Rollen In der Shell-Jugendstudie (2006) werden seitens der befragten Jugendlichen durchaus auch Rollenkonflikte aufgezeigt. Eine Jugendliche sieht z.B. junge Leute von den älteren Menschen öfters ungerecht behandelt, was sie sehr stört. Der Unterschied zwischen Mann und Frau wird beobachtet und thematisiert, jedoch unterschiedlich interpretiert. Ein Mädchen fühlt sich selbst emanzipiert, empfindet jedoch große Ungerechtigkeit, aber sieht die junge Generation auf einem guten Weg zur Gleichberechtigung. Eine andere Jugendliche fühlt sich, bezüglich des Ausgehens mit Jungen, durch ihre Familie in der Rolle als Mädchen eingeschränkt und unter Druck gesetzt. Sie 54 wünscht sich eine gleichberechtigte Partnerschaft. Einer meint, dass es Jungen leichter haben und Mädchen unter stärkerem gesellschaftlichen Druck stehen. Mertol (2007) untersuchte auf der Basis qualitativer Fallstudien an fünf türkischen Jungen deren Orientierungsmuster in den geschlechtsspezifischen Konzepten der Jugendlichen. So differieren, wie nicht anders zu erwarten, die Männlichkeitsbilder. Sie reichen von eher traditionellen Orientierungen, z.B. der Mann als Ernährer und Oberhaupt der Familie auch mit der Verbindung von Beruf und größerem beruflichem Erfolg gegenüber der Frau bis hin zu Mustern, die auf Gleichberechtigung beruhen, auch hinsichtlich der Berufswahl. In der Rolle als Vater und Ehemann in der Familie werden sowohl traditionelle als auch moderne Ansichten geäußert. Bei vier der fünf befragten Jungen machte Mertol ein eher distanziertes Verhältnis zum Männlichkeitsbild des Vaters aus. Mit Blick auf Arbeit und Beruf zeigten sich eher egalitär orientierte Berufsbilder für Mann und Frau, was darauf hinweist, dass die traditionellen geschlechtspezifischen Berufsbilder und Berufsrollen auch hier dem sozialen Wandel unterliegen. Zusammenfassung Es zeigt sich, dass die in Angriff genommene Fragestellung ein sehr komplexes Thema beinhaltet und dass das Lebensumfeld von Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte weit mehr ist als die Summe der es ausmachenden Teile. In allen vorab vorgestellten Arbeiten wurde also jeweils nur ein kleiner Teil beleuchtet und es wurde deutlich, dass es unmöglich ist, von ‚der’ Sichtweise von Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte zu sprechen, sondern dass hier die jeweils individuellen und biografischen Zusammenhänge eine große Rolle spielen, wie die Jugendlichen ihr Lebensumfeld in ihren gegenwärtigen und ganz spezifischen Lebenskontexten wahrnehmen. Offensichtlich wird jedoch, dass dabei weniger die Zuwanderungsgeschichte eine Rolle spielt als die Frage, von welchen sozialen, familiären, gesellschaftlichen und ökonomischen Umständen die Lebenswelt des Jugendlichen geprägt wird. Damit ist ein dringender Perspektivenwechsel verbunden, der weniger die Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte in den Blick nimmt, sondern die Bedingungen der Aufnahmegesellschaften, die das Lebensumfeld der Jugendlichen prägen. Wie wichtig der Perspektivenwechsel ist, wird bei Bukow/Jünschke/Spindler/Tekin (2003) deutlich. Hier wird der Frage nachgegangen, inwiefern Wechselwirkungen von Ethnisierung und Kriminalisierung, verbunden mit der gesellschaftlichen Vorstellung von „Ausländerkriminalität“, eine Rolle für die Inhaftierung von Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte spielen. Dabei 55 werden die Kriminalitätskarrieren von verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Vor diesem Hintergrund wurden männliche Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte aus Köln, die straffällig geworden und inhaftiert waren, interviewt. Im Zuge der detaillierten Beschäftigung mit der Lebenssituation der inhaftierten allochthonen Jugendlichen wurde deutlich, dass diese in sehr spezifischen Situationen leben, die im Wesentlichen von der Lage als Migrant/in bestimmt ist. Dabei stellte sich heraus, dass weniger die Zuwanderungsgeschichte eine Rolle spielt, sondern dass ihre Lage dadurch geprägt war, „dass sie zunächst einmal als „Ausländer“ und dementsprechend wie selbstverständlich gesellschaftlich, politisch, sozial, kulturell und ökonomisch deutlich anders und zwar unvergleichlich ungünstiger als die einheimischen Gleichaltrigen platziert sind“ (2003, S. 293). Nur unter Berücksichtigung dieser Perspektive kann man erkennen, wie „ohne Rekurs auf deren [die Jugendlichen mit Migrationshintergrund] spezifische Lebenslage generell ethnisiert und gegebenenfalls auch kriminalisiert wird“ (2003, S. 34), was schließlich im öffentlichen Diskurs in Bezeichnungen wie „Ausländerkriminalität“ seinen Ausdruck findet. Auf Grundlage der in dieser Studie bezüglich ihres Lebensumfeldes gemachten Betrachtungen der Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte ist es eben nicht möglich, Aussagen über spezielle Probleme der Zuwanderungsgeschichte dingfest zu machen. Es ist eher zu beobachten, dass diese „Zuwanderungsgeschichten“ mit der ganz speziellen Biografie des einzelnen in Zusammenhang stehen und daher keine generalisierenden Aussagen getroffen werden können. 56 4. Empirische Studie zur Erkundung der subjektiven Sichtweise von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte auf ihr Lebensumfeld Die vorliegende Expertise hat einleitend die Entwicklung und Relevanz der subjektiven Sichtweise verdeutlicht und auf die ambivalenten Folgen des individuellen Zwangs zur Wahl hingewiesen. Mit der Unterscheidung zwischen systemischer und sozialer Integration wurde anschließend ein soziologischer Blick auf das Lebensumfeld der Kinder und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte gerichtet und mit quantitativen Daten belegt. Schließlich sind aus der Literatur bekannte Ergebnisse von Studien vorgestellt worden, die ihrerseits die subjektive Sichtweise von Kindern und Jugendlichen auf ihr Lebensumfeld mittels qualitativer Methoden erkundet haben. Auf dieser Basis wurde eine kleine empirische Untersuchung geplant und durchgeführt, die ebenfalls mit qualitativen Methoden einen Beitrag zur Rekonstruktion der subjektiven Sicht von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte auf ihr Lebensumfeld leisten möchte. In diesem Kapitel wird die Fragestellung, das Forschungsdesign und Sample beschrieben. Anschließend werden die Ergebnisse vorgestellt. 4.1 Fragestellung, Forschungsdesign und Sample der empirischen Untersuchung Für eine Erkundung der subjektiven Sichtweise des Lebensumfelds von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte in Nordrhein-Westfalen ist von Interesse, wie diese Kinder und Jugendliche mit den zentralen Aspekten ihrer Lebenssituation umgehen, welche Bewältigungsformen sie entwickelt haben und wie erfolgreich sie mit diesen Bewältigungsformen sind. Zu erkunden ist auch, wie sich die dargestellten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen institutionell in Bezug auf Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte realisieren. Denn auch und gerade Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte erleben in Deutschland eine individualisierte Jugendphase. Wie alle Kinder und Jugendliche befinden sie sich zwischen Autonomie und Anpassung in den sie begleitenden institutionellen Kontexten des Familiensystems, des Erziehungs- und Bildungssystems, des Übergangs von der Schule in den Beruf und in sozialen Netzwerken. Während sie auf der einen Seite mit denselben gesellschaftlichen Zusammenhängen und institutionellen Faktoren wie Status der Eltern, Bildung, Gesundheit, Wohnen, politische Partizipati57 on, Freizeit etc. konfrontiert sind wie ihre Altersgenossen ohne Zuwanderungsgeschichte, kommen bei zugewanderten Kindern und Jugendlichen jedoch Aspekte hinzu, die direkt mit Migration zusammenhängen. Zu nennen sind hier z.B. die individuell unterschiedlichen Migrationsmotive und Integrationsverläufe und die unterschiedlichen Aufnahmebedingungen der einzelnen Gruppen mit Zuwanderungsgeschichte und die damit verbundenen verschiedenen sozialen Erwartungen der autochthonen Bevölkerung im Einwanderungsland. Amtliche Statistiken beinhalten in der Regel die so genannten „harten“ Daten zur systemischen Integration der Menschen, d.h. sie spiegeln z.B. die Erwerbsquote, die Arbeitslosigkeit, das Einkommen, die Wohnsituation, die gesundheitliche Lage oder die Bildungssituation verschiedener Bevölkerungsgruppen wider. Dank des seit 2005 differenzierten Mikrozensus verfügen viele Ämter inzwischen nicht mehr nur über die entsprechenden Daten von Deutschen und Ausländer(inne)n, sondern auch über diejenigen von Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte. Was den zweiten Teil des Lebensumfelds, die so genannte soziale Integration, angeht, sieht es mit den amtlichen Statistiken weitaus schlechter aus. Das hängt damit zusammen, dass diese Daten nur sehr schwierig zu generieren sind. Soziale Bindungen, Werte, Normen und Traditionen oder das Rollenverhalten sind nicht statistisch erfassbar - oder zumindest nicht in einer für den Zweck der politischen oder pädagogischen Verwertung zufrieden stellenden Art und Weise. Zwar gibt es durchaus auch quantitative Untersuchungen zu Werten, Normen und Einstellungsmustern verschiedener Bevölkerungsgruppen; diese bleiben jedoch notgedrungen sehr oberflächlich. Um Fragebögen zweckmäßig auszuwerten, können eben nur bestimmte Raster abgefragt werden, die meist nur einen ersten Eindruck von der Situation vermitteln können. Will man tiefer in die Gefilde der sozialen Integration und der subjektiven Sichtweise vordringen, muss man mit qualitativen Methoden agieren, deren Einsatz jedoch weitaus aufwändiger ist. Aufgrund der relativ kurzen Zeit, die für die Erfassung der Daten zur Verfügung steht, bietet sich lediglich eine Querschnittsstudie an. Längsschnittdaten stehen in Bezug auf die systemische Integration in ausreichendem Maße zur Verfügung. Längsschnittdaten, die Auskunft geben über das Rollenverhalten oder die subjektive Sichtweise der Kinder und Jugendlichen auf ihr Lebensumfeld, gibt es nicht. Sie können im Rahmen dieser Studie auch nicht zur Verfügung gestellt werden. Stattdessen muss man sich mit Daten einer Querschnittsstudie zufrieden geben, die allerdings durchaus schon eine starke Aussagekraft haben können. Als Methoden bieten sich weiterhin die Beobachtung oder face-to-face-Interviews an. Eine teilnehmende Beobachtung in Form einer ethnografischen Feldanalyse durchzuführen, wäre in 58 Bezug auf die soziale Integration und die subjektive Sichtweise von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte besonders spannend – jedoch auch sehr aufwändig. Man müsste dann tage- oder sogar wochenlang den Alltag der Menschen als Begleiter/in beobachten, sich Notizen machen und anschließend die Beobachtungen im Team auswerten. Stattdessen bieten sich Möglichkeiten der verbalen Kommunikation an, die deutlich weniger Zeit in Anspruch nehmen, jedoch auch die bekannten Nachteile haben. Verbale Kommunikation basiert immer auf den Erwartungen des Gegenüber, d.h. die Mitteilungen sind oft auf den Interviewer bzw. die Interviewerin abgestimmt und Art und Umfang der Aussagen hängen sehr stark vom Vertrauen zwischen den Kommunizierenden ab. Soll die subjektive Sichtweise der Menschen auf ihr Lebensumfeld erfragt werden, kommen häufig biografische Interviews zum Einsatz. Gemeinsam ist allen qualitativen Forschungsverfahren die Absicht, den Sinn individueller Erfahrungen und Deutungen zu rekonstruieren. Anhand der Interpretation von Einzelfällen wird deren Beispielhaftigkeit für eine größere Anzahl von Fällen in vergleichbarer Lage herausgearbeitet. Konkret bedeutete dies, dass Interviews als offene, so genannte narrative Interviews angelegt worden sind. Im Kontext der hier vorliegenden Fragestellung wurde jedoch ein spezifischer Fokus auf institutionelle Kontexte gelegt, die im Jugendalter zu biographischen Statuspassagen werden: Familie, Erziehung und Bildung, Übergang Schule-Beruf. Allerdings konnte, das wurde in den ersten Gesprächen schnell deutlich, auf einen Leitfaden nicht verzichtet werden. Zwar widerspricht das „Frage-Antwort-Schema“ eines Leitfadens der Absicht, dem Subjekt einen größtmöglichen Freiraum für eigene Gestaltung und eigene Sinn- und Deutungsstrukturen zu lassen. Es durfte aber auch nicht ignoriert werden, dass die Jugendlichen, vor allem die Jungen, von der bloßen Aufforderung, über sich selbst zu erzählen, teilweise überfordert waren. Schließlich wurden mit einem Leitfaden einzelne Aspekte in das Zentrum gestellt, die sich im laufenden Forschungsprozess als relevant erwiesen hatten. Neben den biographischen Passagen Familie, Erziehung und Bildung, Übergang Schule-Beruf wurden soziale Netzwerke und ein Vergleich zwischen zugewanderten und nicht-zugewanderten Jugendlichen explizit angesprochen. (vgl. Anhang 1: Leitfaden). Zu diesen Themenfeldern ist die Erhebung schließlich mit fokussierten Interviews (vgl. Merton/Kandall 1979) durchgeführt worden, die sich durch die Fokussierung auf einen spezifischen Gegenstand bei gleichzeitiger Offenheit des Interviews auszeichnen. So sollte noch eine Offenheit gewährleistet werden, die es den Befragten ermöglicht, neue, nicht antizipierte Gesichtspunkte in das Interview einzubringen. 59 Die folgende Abbildung veranschaulicht das Sample der Untersuchung. Alle Namen wurden zur Wahrung der Anonymität geändert. Nachkommen der Arbeitsmigration Spätaussiedler/-innen Flüchtlinge/Asylsuchende Deutsche ohne Zuwanderungsgeschichte Jungen Karim, 17 Jahre, 2. Generation, Marokko Deutscher Egon, 16 Jahre, mit 11 Jahren zugewandert, Kasachstan Deutscher Amir, 16 Jahre, mit 5 Jahren zugewandert, Kurde aus Irak Iraker Tim, 20 Jahre, mit 19 Jahren von Berlin nach Köln gezogen Mädchen Elizabeta, 18 Jahre, 3. Generation, eh. Jugoslawien Deutsche Marta, 17 Jahre, mit 12 Jahren zugewandert, Kasachstan Deutsche Aicha, 17 Jahre, mit 6 Jahren zugewandert, Kurdin aus Irak Deutsche Claudia, 25 Jahre, nach Umzügen innerhalb Nordrhein-Westfalens zurück in ihrer Heimatstadt Aachen Zweifellos gibt es „die“ Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte nicht als eine homogene soziale Gruppe. Dies hat einmal mehr die aktuelle SINUS-Studie zu Milieus der Migrantinnen und Migranten verdeutlicht. Innerhalb der Gruppe der Kinder und Jugendlichen, als deren gemeinsames Merkmal die Zuwanderungsgeschichte gelten kann, ist eine große Heterogenität von Lebenslagen und Lebensstilen zu erwarten. Um die verschiedenen Hintergründe der Zuwanderung angemessen zu berücksichtigen, werden drei Formen der Zuwanderung unterschieden: • Arbeitsmigration • Spätaussiedler/innen • Asylmigration Mit qualitativen Methoden erreicht man keine Repräsentativität, was im Übrigen auch nicht das Ziel qualitativer Methoden sein kann. Allerdings kann man durchaus die Vielfalt eines Samples berücksichtigen. Dies wollen wir im Rahmen dieser Untersuchung auch tun, d.h. die unterschiedlichen Migrationsgruppen, ihr unterschiedlicher rechtlicher Status und damit verbunden die unterschiedlichen Möglichkeiten der Entfaltung im Aufnahmeland auf der einen Seite und die man60 nigfaltigen Erwartungshaltungen seitens der autochthonen Bevölkerung auf der anderen Seite sollen bei der Auswahl des Samples eine Rolle spielen. Angenommen wurde, dass die subjektive Sicht von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte auf ihr Lebensumfeld durch die Form der Zuwanderung objektiv vorstrukturiert ist. Diese Annahme wurde in der Auswertung der Leitfadeninterviews überprüft. Pro Gruppe wurden ein Mädchen und ein Junge im Alter zwischen 15 und 25 Jahren interviewt, um auch mögliche Geschlechterdifferenzen aufzunehmen. Interviews mit Kindern wurden nicht geführt, weil von ihnen keine Reflexion über ihr Lebensumfeld erwartet werden kann. Um Kulturalisierungen vorzubeugen, wurden zudem noch zwei Interviews mit Jugendlichen ohne Zuwanderungsgeschichte durchgeführt. Alle Interviews wurden in zwei sozialstrukturell verschiedenen Kölner Stadtteilen geführt. Der Zugang zum Feld wurde über Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe hergestellt. Dazu kamen im „Schneeballverfahren“ Bekannte nach dem Zufallsprinzip. Die Schwächen dieses Vorgehens sind klar: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Teilnehmenden über die Interviews wechselseitig informieren und damit ihre Aussagen beeinflussen. Und eine Vergleichbarkeit des Lebensumfeldes darf zwischen Bekannten sogar erwartet werden (vgl. Przybarski/ Wohlrab-Sahr 2008, 180). Dennoch ist das Verfahren hilfreich für eine erste Erschließung des Feldes, auch wenn eine bewusste Suche nach möglichst heterogenen Milieus ein sinnvoller nächster Untersuchungsschritt wäre. Im Forschungsfeld wurde schon die einfache theoriegeleitete Bestimmung des Samples (Zuwanderungsform/Geschlecht) als Zumutung empfunden. Denn Jugendliche unterscheiden sich selbst nicht danach, ob sie Spätaussiedler/innen, Nachkommen der Arbeitsmigrant(inn)en oder Flüchtlinge sind. Auch für die „Türöffner“ der Kinder- und Jugendhilfe waren diese Kategorien irrelevant. Teilweise war das Interesse der Jugendlichen so groß, dass mehrere Interviews mit Jugendlichen einer Kategorie geführt wurden. Die Interviewsituation selbst wurde durch einen separaten Raum und Getränke möglichst angenehm gestaltet. Alle Interviews wurden aufgezeichnet und später vollständig transkribiert. Zusätzlich wurden Postskripte zu jedem Interview erstellt, die den Eindruck des Interviewers in der Erhebungssituation dokumentieren. In die Darstellung der Ergebnisse sind acht Interviews aufgenommen worden. Von den zwölf erhobenen Erzählungen wurden vier in der Auswertungsphase zurückgestellt. Die Doppelungen haben sich dabei als günstig erwiesen, denn manche Gespräche sind so oberflächlich und einsilbig geblieben, dass eine sinnvolle Interpretation nicht möglich war. Wieder waren es die Jungen, deren anfängliches 61 Interesse bei persönlichen Fragen stark nachließ und in einsilbigen Antworten mündete. Anhand der transkribierten Interviewtexte wurden für die Auswertung Kategorien gebildet, d.h. Textsequenzen wurden Themenfeldern zugeordnet, die in Zusammenhang mit den leitenden Forschungsfragen stehen (vgl. Witzel 2000). Dabei waren die Kategorien durch den Leitfaden vorstrukturiert: • Familie • Erziehung und Bildung • Übergang Schule - Beruf • Soziale Netzwerke/Bezug zur Politik29 und • Vergleich zwischen Jugendlichen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte. Zu jedem Themenfeld werden im Folgenden typische Aussagen in Form selektiver Plausibilisierung dargestellt (vgl. Flick 1995, 167ff). Prägnante Abschnitte aus dem Forschungsmaterial werden zitiert und anschließend im Kontext der Studie interpretiert. 4.2 Ergebnisse der Studie Die Ergebnisse der Studie werden entsprechend der Untersuchungsgruppen in vier Unterkapiteln dargestellt. Einleitend wird jeweils die Zuwanderungsgeschichte der verschiedenen Migrantengruppen kurz skizziert. Anschließend werden die im Rahmen der Expertise befragten Jugendlichen vorgestellt. Entsprechend der Kategorien des Leitfadens werden danach die Aussagen der Jugendlichen zu den Themenfelder wiedergegeben. Dabei bleiben die Kommentare der Autoren zur Erläuterung möglichst nah an den Daten. Erst im abschließenden Fazit werden die Aussagen der Jugendlichen im Kontext theoretischer Vorannahmen interpretiert. 29 In dieser Studie wird diesbezüglich von einem engen Politikverständnis ausgegangen, d.h. es geht um den Bezug der Kinder und Jugendlichen zur „großen“ Politik, zum repräsentativen politischen System. Ein weites Politikverständnis würde hingegen das gesamte zivilgesellschaftliche Engagement der Kinder und Jugendlichen beinhalten, also auch eine Mitgliedschaft in Vereinen, Verbänden und sonstigen zivilgesellschaftlichen Vereinigungen (Kirche, Greenpeace, Attac etc.) (vgl. zur Differenzierung des zivilgesellschaftlichen Engagements auch Ottersbach 2003, S. 28f.). 62 4.2.1 Nachkommen der Arbeitsmigration Mitte der 1950er Jahre traf die bundesdeutsche Politik im Konsens mit den Tarifpartnern die Entscheidung, ausländische Arbeitskräfte für gering qualifizierte Tätigkeiten im industriellen Bereich anzuwerben. Alle Beteiligten, auch die Migrantinnen und Migranten selbst, gingen vom temporären Charakter der Zuwanderung aus. Gesucht und ins Land geholt wurden „Personen, für die es auch Arbeit gab: überwiegend schlecht bezahlte, wenig prestigeträchtige und unangenehme Arbeit, für die sich Bundesdeutsche kaum interessierten“ (Münz/Seifert 1997, S. 37). Da nach wenigen Jahren eine Rückkehr in die Herkunftsländer erfolgen sollte und an dieser Zielsetzung auch noch festgehalten wurde, als sich bereits deutliche Niederlassungstendenzen zeigten, kam erst spät die Forderung nach einer begleitenden Integrationspolitik auf. Diese Faktoren, die gezielte Anwerbung für gering qualifizierte und bezahlte Arbeitsplätze in der Industrie, die Ausrichtung der Zuwanderung auf einen zeitlich befristeten Aufenthalt und der langjährige Verzicht auf aktive Integrationspolitik, haben soziale Folgen bis in die Gegenwart. Die so einmal festgelegte, weitgehend homogene Beschäftigtenstruktur ging notwendig mit deutlich verminderten Chancen auf eine spätere berufliche Aufwärtsmobilität einher. Aufgewachsen im Arbeitermilieu, wurde auch für die nachkommenden Generationen eine Arbeiterkarriere wahrscheinlich. 1973, in Folge der sog. Ölkrise und einer sich abzeichnenden Rezession, wurde ein Anwerbestopp beschlossen, der noch heute Gültigkeit hat. Dadurch wurde das Pendeln zwischen Herkunfts- und Einwanderungsland erschwert und ein Anreiz zur Aufenthaltsverfestigung und Familienzusammenführung geschaffen. Im Rahmen der Expertise wurde ein Interview mit der 18jährigen Elizabeta geführt, die zurzeit die 12. Jahrgangsstufe eines Kölner Gymnasiums besucht. Sie ist in Köln geboren und deutsche Staatsangehörige. Ihre Großeltern sind als „Gastarbeiter“ aus dem früheren Jugoslawien angeworben worden, ihre Eltern im Kindesalter zugewandert. Das zweite Interview in dieser Gruppe wurde mit Karim geführt. Er ist 17 Jahre alt, wie Elizabeta in Köln geboren und besucht die 10. Klasse einer Hauptschule, Typ B, also mit dem Ziel Fachoberschulreife. Sein Vater ist als „Gastarbeiter“ aus Marokko zugewandert. Karim gehört also zur zweiten Generation im Einwanderungsland, seine Großeltern leben in Marokko. Die Antworten auf die einleitend offen gestellte Frage, was aktuell für die Jugendlichen wichtig ist, machen deutlich, dass zurzeit der Schulabschluss für beide im Vordergrund steht. Die 63 Aussage von Elizabeta zeigt, dass sie nach Unterrichtsausfall in Folge eines Unfalls im Sportunterricht unter Leistungsdruck steht, dem sie sich selbstbewusst stellt: „Momentan liegt mein Schwerpunkt so auf Schule. Ist ja klar. Halt Abitur, so in einem Jahr und dafür muss ich auch viel tun. Ich habe ein halbes Jahr gefehlt, weil ich einen Kreuzbandriss hatte und dadurch nicht wirklich zur Schule gehen konnte. So muss ich einiges wieder nachholen. Aber sieht eigentlich im Moment noch gut aus, dass ich das so alles schaffe. Momentan ist alles wieder gut mit meinem Knie und so. Ich wurde halt operiert. Das halt alles lange gedauert, Reha und so, deshalb habe ich so viel verpasst, in der Schule und so. (…) Ich hab ja jetzt mein Zeugnis bekommen und dafür, dass ich da die ganze Zeit gefehlt habe, ist das echt noch gut. Also, ich hab keine Defizite oder so. Ich denk auch, dass ich die Zulassung fürs Abitur gut erreichen kann und das dann auch gut schaffe.“ Im Vergleich zu der gewissenhaften Haltung von Elizabeta, demonstrierte Karim in der Interviewsituation eine typisch männliche Coolness, mit der er auch dem Schulabschluss entgegen sieht und betont andere Interessen, die ihm vielleicht sogar wichtiger sind: „Mir geht es gut. Auf jeden Fall. Probleme habe ich eigentlich nicht so viele. Halt nur mit der Schule ein bisschen, muss man sehen. Muss man alles unterbringen mit der Schule, Freizeit, Freunde, Familie. Besonders gut in meinem Leben ist meine Fitness. Ich fühle mich fitt. Ja, ich trainiere ein bisschen. Im Jugendzentrum. Fußball spiele ich auch. Das ist mir wichtig.“ Die Vereinbarkeit von Schule und persönlichen Leidenschaften ist aber auch für Elizabeta eine alltägliche Herausforderung: „Ich bin halt auf dem Musikzweig und da ist das so, dass man Wahlpflichtfächer hat, wie Chor oder Band und so. Man muss da auch Instrumente spielen, also ich habe momentan Klavier- und Gesangsunterricht. Ich hatte auch zwei Jahre Querflötenunterricht. Also ich bin da immer schon so im musischen Bereich gewesen. Dann mache ich momentan so eine studienvorbereitende Ausbildung, weil ich das später auch mal studieren möchte. Da bekomme ich auch noch so Musiktheorieunterricht. Und es ist so, dass ich dadurch den Klavierunterricht auch bezahlt bekomme. Man musste da so ein Vorspielen machen. Und dadurch, dass ich bei „Jugend musiziert“ mitgemacht hatte und beim Bundeswettbewerb den zweiten Platz gemacht hab, bin ich da so automatisch rein gekommen. Ich will das später auch studieren, Gesang. Klavier, wenn nur als Nebenfach. Das muss ich nehmen, wenn ich Gesang studiere. Also, Operngesang. Ich würde gerne später an die Oper gehen.“ Während Karim seine körperliche „Fitness“ wichtig ist, ist für Elizabeta Musik, genauer „Operngesang“, eine Leidenschaft. Karims sportliche Ambitionen sind auf seine Freizeit beschränkt; Elizabeta hat ihre Neigung dagegen in der Schule ausgebildet und verbindet damit auch einen konkreten Berufswunsch. Dabei belegt ihr großer Erfolg im renommierten Wettbewerb „Jugend musiziert“, dass ihre Absicht durchaus realistisch ist. 64 Familie Das familiäre Lebensumfeld der beiden Jugendlichen könnte kaum unterschiedlicher sein. Elizabeta lebt in einem Mehrgenerationenhaushalt: „Ich lebe mit meinen Großeltern zusammen und meinen Eltern und meiner Schwester. Meine Schwester ist 16 Jahre alt, jünger als ich. Aber ich versteh mich relativ gut mit der. Wir haben auch den gleichen Freundeskreis und unternehmen auch viel. Meine Tante und meinen Onkel würde ich auch noch zur Familie zählen. Die leben zwar nicht hier. Aber wir haben ziemlich viel Kontakt. Sonst habe ich noch eine ziemlich große Familie. Aber da kennt man jetzt auch nicht jeden.“ Mit dem letzen Satz deutet Elizabeta an, dass ihre Familie Teil einer Großfamilie ist, die für sie aber keine große Rolle spielt. Karim wohnt allein mit seinem Vater zusammen: „Also, ich hab zwei Geschwister, eine ältere Schwester, einen jüngeren Bruder. Meine Mutter, meinen Vater. Aber wir leben geschieden. Ich lebe mit meinem Vater. Meine Geschwister leben mit meiner Mutter. Das ist jetzt so neun Jahre vielleicht. Klappt. Muss klappen. Mein Vater ist 1a Koch. Die besten Köche der Welt sind ja Männer. Ich muss spülen.“ Dem Klischee, fixer Geschlechterrollen in Migranten-Milieus, entspricht Karims Aussage ganz und gar nicht. Er hat sich nach der Scheidung seiner Eltern, vor neun Jahren war er im achten Lebensjahr, mit seinem alleinerziehenden Vater arrangiert und muss auch im Haushalt mitarbeiten. Trotz der vollkommen unterschiedlichen Familiensituation sind beide Jugendlichen in ihrer Wertung der Bedeutung von Familie einig bis in den Wortlaut. Elizabeta antwortet etwas ausführlicher: „Ich würde mal sagen: alles. Ich versteh mich halt ziemlich gut mit meiner Familie. Natürlich gibt das da immer mal wieder Schwierigkeiten oder dass man da Differenzen hat. Aber meine Familie unterstützt mich auf jeden Fall, in allen Sachen, die ich so hab. Auf jeden Fall. Jetzt auch in Musik. Die sind extra, jetzt als ich den Bundeswettbewerb hatte, überall hin mitgefahren und haben sich das angeguckt. Das motiviert natürlich noch mehr, auch gut zu sein und das zu schaffen. Die geben eigentlich immer wieder so Stärke.“ Karim bringt seine Einschätzung auf den Punkt: „Meine Familie ist alles. Alles was ich habe. Das wichtigste. Der Rückhalt. Auf jeden Fall. Mein Vater.“ Festzustellen ist, dass die eigene Familie für beide „alles“ bedeutet, also die zentrale Größe ihres jugendlichen Lebensumfeldes darstellt. Familie wird, unabhängig von ihrer konkreten Gestalt, als Ressource individueller Entwicklung erlebt, als „Stärke“ (Elizabeta) oder „Rückhalt“ (Karim) für 65 die Interaktion außerhalb der Familie. Das bedeutet freilich nicht, dass die Jugendlichen ihr Familienleben rein harmonisch erleben. Die im Jugendalter fällige Lösung von den Eltern ist auch für sie „manchmal schwierig“, erklärt Elizabeta: „Wenn man das vergleicht mit der Kindheit, da ist man in einem viel engeren Bezug zur Familie. Ist total klar, dass man jetzt mehr mit Freunden macht. Aber trotzdem würde ich sagen, dass ich noch ein gutes Verhältnis zu meiner Familie hab. Meine Mutter lässt eher weniger los, das ist manchmal schwierig.“ Karim erklärt seine Situation kurz und klar: „Hat sich nichts verändert. Ich werde immer noch wie ein Baby behandelt.“ Zu einem Konflikt hat diese Situation aber bei beiden nicht geführt. Karim erklärt: „Falls wir uns streiten, dann legt es sich wieder ganz schnell. Auf jeden Fall.“ Und auch Elizabeta erklärt ihr defensives Konfliktverhalten: „Wir versuchen das so zu regeln, dass man normal miteinander reden kann. Ich weiß nicht, bei mir ist das so, wenn ich mich sagen wir mit meiner Mutter streite, dass ich dann eher zurück gehe und warte, bis sich die Situation aufgeklärt hat, und man wieder normal miteinander reden kann und auch darüber reden kann. Ich bin nicht derjenige, der die ganze Zeit mit streiten muss und laut werden muss oder so.“ Mit Blick auf ihr zukünftiges Familienleben zeigt sich ein Unterschied zwischen beiden. Während Elizabeta sich sicher ist, „(…) auf jeden Fall (…) auszuziehen“, macht Karim seine Auszugspläne abhängig von einer Partnerin: „Wenn ich heirate, lebe ich ja mit meiner Frau. Wenn nicht, dann lebe ich noch bei meinen Eltern, eigentlich. So habe ich mir das vorgestellt.“ Erziehung und Bildung Beide Jugendlichen haben einen Kindergarten vor der Schule besucht und diese Zeit in glücklicher Erinnerung. Für Karim war es offensichtlich wichtig zu betonen, dass seine Bildungslaufbahn „ganz normal“ verlaufen ist. Die folgende Aussage lässt darauf schließen, dass er mit der pädagogischen Zuschreibung „Problemkind“ vertraut ist und diese für sich nicht gelten lassen will: „Das war eigentlich eine ganz coole Zeit. Ich bin ja hier geboren. Ich war hier auf dem Kindergarten. Ganz normales Kind. Ganz normaler Kindergarten. Ganz normales Kindergartenkind.“ 66 Die Aussage von Elizabeta geht in eine ganz andere Richtung und verbindet eine dauerhafte Freundschaft mit der Kindergartenzeit: „Ich war auch mit meiner besten Freundin im Kindergarten. Daher kenne ich die auch. Wir hatten schon so die ganze Laufbahn, sage ich jetzt mal so, miteinander zu tun. Kindergarten hat Spaß gemacht.“ Spaß bringt Karim nicht mit der Beschreibung seiner weiteren Schullaufbahn in Verbindung. Vielmehr scheint die Schule für ihn ein notwendiges Übel zu sein, das es möglichst unbeschadet zu überstehen gilt: „Auch immer ganz normal. Hab eigentlich immer ganz souverän die Stufen bestanden, die Klassen. Und sonst halt die ganz normalen Probleme, ab und zu mal die Hausaufgaben nicht, Pausenprobleme mit anderen Schülern und so mal, immer dasselbe. Aber da muss man durch. Sind ja nur 6 Stunden am Tag, sieben oder acht. Augen zu und durch. Und dann hat man den Tag erledigt. Ein bisschen lernen abends, dann hat man das geregelt.“ Für Elizabeta hat das Lebensumfeld Schule eine ganz andere Bedeutung: „Ich war in der 1. und 2. in der Feldstraße. In der Erinnerung hatte ich ziemlich viel Spaß da, ich kann mich halt so an viele Spiele erinnern. Dann bin ich auf die Montessori-Schule gewechselt, weil meine Lehrerin ins Ausland gegangen ist und dann nicht klar war - ziemlich viel die Lehrer gewechselt und so. Da bin ich dann auf die Montessori-Schule gegangen, wo meine Schwester auch war. Und da bin ich eigentlich gut klar gekommen, weil die Lernart auch anders war. Man macht halt viel so selbständiges Arbeiten. Ich würde auch sagen, was ich da mitgenommen habe, dass ich das auch heute noch gebrauchen kann. Das war mir in den Jahren gar nicht bewusst, aber dadurch, dass man sich das alles selber bei gebracht hat, immer Hilfen vom Lehrer, aber man hat da dieses selbständige Arbeiten, dass man da gelernt hat, wie man lernen kann. Ich weiß von Mitschülern, dass das schwierig sein kann in Bereichen, wo ich super klar kam. Da hab ich auch Blockflötenunterricht genommen und bin dadurch in diese musikalische Schiene gekommen. Dann bin ich auf ´s Gymnasium gekommen, hab die Aufnahmeprüfung für Musik auch gemacht, mit Blockflöte dann und bin auch genommen worden. Seitdem bin ich halt auf der Schule. Klar, auch meine beste Freundin ist da auf der Schule. Aber wir sind auch nicht in einer Klasse, weil ich diesen Musikzweig da gekommen bin. Also im fünften Schuljahr hatte ich schon ein bisschen Probleme, weil das ja eine ganz andere Schulform war. Ich war es nicht so gewöhnt, Noten und so zu bekommen und auch Klausuren zu schreiben und der ganze Druck, der dann auf einem lastet. Da hatte ich schon anfangs ziemliche Schwierigkeiten. Aber das hat sich natürlich mittlerweile geändert und ist auch gar nicht mehr so.“ In dieser Passage wird deutlich, dass sich Elizabeta auf dem Gymnasium dem Lebensumfeld Schule ganz anders stellt als Karim auf der Hauptschule. Einen Schulwechsel im Grundschulalter, nicht selten Anlass für Entwicklungsschwierigkeiten, hat sie gut überstanden. Mehr noch, sie hat nach eigener Einschätzung von dem Wechsel auf eine Montessori-Schule profitiert. Schließ67 lich hat sie dort nicht nur „selbständiges Arbeiten“ gelernt, sondern ist auch auf die „musikalische Schiene“ gekommen. Die hat ihr dann auch den Zugang zu einem renommierten Gymnasium eröffnet, dessen Musikzweig sie besucht. Trotz oder gerade wegen ihres Schulerfolgs benennt sie auch an dieser Stelle den „Druck“, der von ihr schon aus aktuellem Anlass (Folge eines Sportunfalls) ins Feld geführt worden ist. Sie hat diesem Leistungsdruck standgehalten, hat sich daran gewöhnt und leidet auch nicht (mehr) darunter. Karims Äußerung, zuvor zitiert, „Augen zu und durch“, lässt dagegen auf einen alltäglichen Überlebenskampf in der Schule schließen, bei dem der Druck nicht auf dem Anspruch, schulischen Leistungsanforderungen gerecht zu werden, basiert. Es scheint, als ob ihm die bloße Anwesenheitspflicht bedrückt, die Hausaufgaben Zeit kosten, die er lieber anders nutzen würde, „Pausenprobleme mit anderen Schülern“ für ihn eine größere Bedeutung bekommen können als der Unterricht. In einer anderen Gesprächssequenz macht Karim deutlich, dass er aber durchaus einen Sinn in seiner Schulzeit sieht: „Überhaupt, generell so, für meine Allgemeinbildung. So dass man sich auch draußen mit den Leuten unterhalten kann und nicht nur rum steht und nichts versteht. Deshalb ist die Schule eigentlich was Ideales.“ Übergang von der Schule in den Beruf Elizabeta und Karim stehen vor ihrem Schulabschluss und haben konkrete Vorstellungen von ihrem Übergang in den Beruf entwickelt. Elizabeta weiß, was sie will: „Ich möchte Gesang studieren. (…). Es kommt bei Gesang auch sehr auf den Lehrer an. Ich bin halt im Moment auf Lehrersuche. Die Harmonie zwischen Lehrer und Schüler muss bei Gesang halt auch stimmen, damit man auch weiter kommt. Weil es oft so ist, dass man auf einer Wellenlänge sein muss, um zu verstehen, was der Lehrer möchte. Bei Gesang ist es ja schon immer abstrakt, schwierig zu beschreiben. Was ich viel kenne, sind Sänger. Da habe ich auch einen Meisterkurs mitgemacht und da habe ich natürlich voll viele Sänger in meinem Alter kennen gelernt. Aber Gesangslehrer kenne ich eher weniger. Ich kenn halt meine Lehrerin und die hat mir auch ein paar Professoren empfohlen, wo ich vorsingen soll und gucken, ob das klappt.“ Im Gesprächsverlauf wird deutlich, dass sich Elizabeta langfristig auf ein Gesangsstudium vorbereitet hat. Sie hat sich schon im Grundschulalter der Musik zugewendet, ein darauf spezialisiertes Gymnasium besucht, ist in einem Wettbewerb platziert worden, hat einen „Meisterkurs mitgemacht“, bekommt Klavierunterricht und übt täglich mit großer Intensität. Da ist die Studienwahl nur konsequent. So langfristig hat sich Karims Berufswunsch nicht entwickelt, ist aber dennoch sehr konkret: 68 „Ich möchte eine Ausbildung machen. Als Zerspanungsmechaniker. Versuchen eine Stelle zu kriegen und meine Ausbildung da zu machen. Das ist ein interessanter Beruf. Ich hab mich mal mit einer Freundin und einem Freund darüber unterhalten. Die Freundin macht das. Ist auch gut bezahlt und deswegen könnte ich mir vorstellen, mein Leben lang da zu arbeiten.“ Der gewünschte Ausbildungsgang in der Metallverarbeitung ist mit Karims anvisiertem Schulabschluss durchaus zugänglich, seine subjektiven Vorstellungen sind also keineswegs unrealistisch. Interessant ist, dass er auch hier als emanzipierter Mann spricht, der die Anregung, sich für einen metallverarbeitenden Beruf zu interessieren, von einer Freundin hat, die in diesem Beruf tätig ist. Auffällig ist die langfristige Perspektive des Jugendlichen, die Vorstellung, er können sein „Leben lang“ dort arbeiten und sein Motiv „gut bezahlt“, das auch in realistischem Verhältnis zu seinen Möglichkeiten nach der Schule steht. Auf die Frage, ob es Vorbilder für die Jugendlichen gebe, beziehen sich beide auf Menschen in ihrem Lebensumfeld. Karim nennt einen Sozialpädagogen, den er aus dem Jugendzentrum kennt: „Vorbilder habe ich viele. Es gibt so einige, aber keine Berühmten halt. Die man draußen hier sieht. Ich kenn hier so einen Sozialpädagogen, der studiert Sport und Pädagogik und arbeitet hier bei unserem Jugendzentrum. Der ist sportlich, cool und locker drauf, ist auch diplomatisch. Und das finde ich echt cool, dass man so cool sein kann und trotzdem so diplomatisch und was erreicht, das finde ich cool.“ Coolness ist Karim offenbar wichtig, die er mit Sportlichkeit und Diplomatie verbindet. Diplomatisch zu sein bedeutet wohl, Konflikte konstruktiv mit Worten lösen zu können. Auch Elizabeta nennt keine Stars der Opernszene als Vorbilder: „Im Moment ist mein Vorbild meine Lehrerin. Weil die hat mich schon so weit gebracht. Ich finde, die macht das total gut. Natürlich, wenn ich jetzt weiter will, an die Oper… die hat jetzt nichts mit der Oper zu tun, da ist die kein Vorbild, aber im Moment strebe ich das an.“ Die Vorbildfunktion für Elizabeta hat ihre Lehrerin in mehrjähriger Zusammenarbeit gewonnen, in der sie sich als Mentorin für die talentierte Sängerin engagiert hat. Elizabeta ist ihr in Dankbarkeit verbunden und sieht doch mit dem Ende der Schulzeit die Notwendigkeit, sich an neuen Vorbildern zu orientieren, die mit der Oper zu tun haben. Karim kann sich vorstellen, seine berufliche Mobilität durch ein Auto zu vergrößern. Umziehen möchte er aus Verbundenheit zu seiner Familie eher nicht: „Ja, nicht unbedingt. Eher nicht. Der Kontakt zu meiner Familie ist mir schon wichtig. Kommt drauf an wo. Umziehen heißt ja 100 Kilometer oder was. Wenn ich ein Auto hätte könnte ich ja jeden morgen hinfahren. Aber ohne nicht.“ 69 Elizabeta hatte bereits eine konkrete Gelegenheit, ihre Heimatstadt zu verlassen, der sie jedoch nicht nachgekommen ist, weil für sie als Großstadtbewohnerin ein Gang in die Provinz abschreckend wirkt. „Ich hatte mal überlegt, nach Detmold zu gehen, weil die Schule da einen wirklich guten Ruf hat und ich da den Meisterkurs gemacht hab. Aber ich kann mir nicht wirklich vorstellen, da zu leben, weil das so ein totales Kaff ist. Und ich bin halt so gewohnt, Großstadtleben. So nach Düsseldorf zu gehen, kann ich mir schon eher vorstellen.“ Soziale Netzwerke Zum Lebensumfeld der Jugendlichen gehören auch soziale Beziehungen außerhalb der Familie. Elizabeta hat einen festen Freundeskreis aus ihrer Schule und Nachbarschaft, mit dem sie ihre Freizeit regelmäßig gestaltet. „Mein bester Freund noch und ein anderer Freund aus unserer Stufe. Es ist so, dass wir uns eigentlich jedes Wochenende treffen mit ziemlich vielen Leuten aus unserer Stufe, machen halt was zusammen. Ein Freund von mir hat seinen Keller so eingerichtet, dass wir da ziemlich viel Zeit verbringen können. Und wir gehen abends auch teilweise weg, in die Kneipe, Disco. Und wenn schönes Wetter ist, sind wir auch im Volksgarten, oft. Und sonst habe ich auch noch eine Freundin, die mit meiner Schwester voll lange befreundet ist, so von Geburt an, weil die halt auch in unserer Nachbarschaft gewohnt hat. Die Eltern haben sich getrennt und die wohnt halt jetzt bei ihrer Mutter, aber trotzdem ist die voll oft hier, so jedes zweite Wochenende.“ Auch für Karim sind Nachbarschaft, „die Straße“ und Schule die sozialen Orte, um Freundschaften zu knüpfen und zu pflegen. „Meine Freunde. Wenn man so nachdenkt, wie man die kennen gelernt hat, kann man sich so richtig nicht erinnern. Halt hier von der Straße. Man sieht sich, man kennt sich, man spricht die anderen an, spielt Fußball zusammen, so bildet sich halt eine Freundschaft. Wenn man sich das nächste mal wieder sieht, begrüßt man sich, irgendwann verabredet man sich. In der Schule, wenn man in ein Klasse kommt, muss man klar kommen. Irgendwie klappt das ja.“ In einem Verein, einer Gemeinde oder sonst wo ist Elizabeta nicht aktiv. Ihre Freizeit ist durch Musik voll und ganz erfüllt. Anders Karim, der im Feizeitangebot des Jugendzentrums ehrenamtlich mitarbeitet. Politik spielt im Lebensumfeld beider Jugendlichen keine Rolle. Elizabeta geht zwar bei Gelegenheit mal zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus, mit ihrem Alltag hat das aber wenig zu tun. Auch Karim ist politisch nicht aktiv, betont aber, dass ihm die Möglichkeit, seine Meinung frei zu äußern, wichtig ist: 70 „Natürlich, wir sind ja hier eine Demokratie. Kann jeder machen und sagen, was er denkt. Kann man seine Meinung schon äußern.“ Vergleich zwischen Jugendlichen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte Mit Absicht wurde das Themenfeld Migration und Integration erst zum Abschluss der Interviews angesprochen. Und tatsächlich war es Elizabeta und Karim wichtig, sich selbst als „ganz normale“ Jugendliche zu beschreiben. Elizabeta versteht sich als Deutsche, die „kulturelle Unterschiede“ aus ihrer Familie kennt, die für ihr Lebensumfeld an sich kein Problem darstellen. Erst die Markierung einer Differenz erzeugt das Problem: „Ich fühl mich schon so ziemlich Deutsch, weil ich auch hier geboren bin. Vom Migrationshintergrund ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Ich mein halt so, klar bekomme ich schon noch eine andere Kultur mit, so von meinen Großeltern, die auch hier wohnen, die auch Geschichten erzählen über früher, über Jugoslawien. Wir gehören ja auch so den Roma und Sinti an. Da es schon, sage ich mal in Anführungszeichen kulturelle Unterschiede gibt, was so Feste und so was angeht, dass die auch andere Feiertage haben, so was halt in der Richtung. Aber ich würde mich jetzt nicht als anders oder so bezeichnen. In der Schule und so ist so was eigentlich gar kein Problem. Allerdings ist Elizabeta durchaus damit vertraut, dass ethnische Unterschiede in sozialen Beziehungen zum Problem werden können. Sie hat erfahren, dass es eine an äußeren Erscheinungsmerkmalen orientierte Definition des Deutschen gibt, die sie für überholt und rassistisch hält: „Ich weiß so, wegen meiner Schwester, die hatte halt schon Schwierigkeiten, besonders wegen Roma und Sinti. Die konnte das da nicht so einfach sagen, weil ihre Klassenkammeraden schon ein bisschen rassistisches Denken, sage ich jetzt mal so, hatten, also ziemlich viele Vorurteile ihr gegenüber. Die hat sich da jetzt nicht geoutet, sag ich mal so. Aber bei mir in der Klasse war es halt gar nicht so. Die wussten das von Anfang an. Da kam jetzt auch irgendwie gar nichts, dass das anders ist. Klar hat man so nachgefragt, wie das denn ist oder wie man halt so lebt. Aber dann war das relativ schnell klar, dass es da eigentlich gar keine großen Unterschiede gibt. Ja, sonst so allgemein. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich mach halt schon öfters die Erfahrung, dass ich nicht so als wirklich deutsch angesehen werde, weil ich oft als Spanierin oder Italienerin oder was weiß ich gehalten werde, aufgrund meiner Haarfarbe oder so. Irgendwie finde ich das schon ein bisschen traurig. Ich meine es leben so viele verschiedene Nationalitäten in Deutschland, die man eigentlich schon als deutsch bezeichnen kann. Weil es gibt jetzt so keine arisch Deutschen mehr. Aber es gibt halt trotzdem immer noch dieses rassistische Denken. Das finde ich schon traurig. Ich hoffe mal, dass sich das ändert.“ Karim geht in seiner Anspruchnahme von Normalität soweit, dass er zunächst gar keine Unterschiede anerkennt und sich implizit von bloß behaupteter Diskriminierung abgrenzt: 71 „Es gibt für mich keine Vorteile oder Nachteile. Also Nachteile gibt es definitiv nicht. Zwar behauptet man so was, aber das gibt es nicht, wenn du hier geboren bist und zum Kindergarten gegangen bist, mit hier russischen, deutschen, polnischen Kindern.“ Als Unterschied lässt Karim dann aber doch den Spracherwerb gelten, bei dem es dann aber doch vom individuellen Willen der Zugewanderten abhängt, ihren Nachteil zu kompensieren: „Es ist ein bisschen schwieriger, weil diese Sprache. Wenn man aus einer deutschen Familie kommt, spricht man zu Hause Deutsch. Man beherrscht die deutsche Sprache zwar besser. Aber man kann das auch mit Familien machen, die mit Migrationshintergrund, also die aus dem Ausland eingewandert sind. Man ist ja jeden Tag in der Schule, tagtäglich, man ist draußen, man guckt fernsehen. Also ich denke, wenn einer will, dann schafft der es. Auf jeden Fall.“ Elizabeta sieht in der Zuwanderungsgeschichte ihrer Familie auch eine Ressource für ihre persönliche Bildung: Dadurch ist die Toleranz, dass man viel anderes kennen lernt. Ich sag mal, meine Großeltern sind zum Beispiel auch muslimisch. Dadurch bekommt man auch eine andere Religion noch mit. Aber halt positiv. Ich denk mal, deshalb habe ich auch so ein aufgeschlossenes Denken.“ 4.2.2 Spätaussiedler/innen Spätaussiedler/innen sind Deutsche und ihre Familienangehörigen, die aus Polen und Rumänien, seit 1990 vor allem aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion zugewandert sind. Ihre Vorfahren waren vor Generationen ausgewandert, 1763 zuerst „angeworben“ von der russischen Zarin Katharina II., die selbst aus Preußen stammte. Auch hier waren wirtschaftliche Motive ausschlaggebend. Deutsche Bauern sollten die Erträge der Landwirtschaft steigern und brachliegende Flächen nutzbar machen. Viele pflegten ihre deutsche Muttersprache und Herkunftskultur im Einwanderungsland und litten unter Diskriminierung. Um nach den Völkerwanderungen in Folge des II. Weltkrieges in die Bundesrepublik Deutschland zurück zu kehren, mussten Aussiedler ihre „deutsche Volkszugehörigkeit“ nachweisen. Bis zum Ende des Kalten Krieges 1989 sah sich die Bundesrepublik zu einer großzügigen Aufnahmepraxis und bevorzugten Integration der Rückwanderer verpflichtet. Seit 1996 müssen Spätaussiedler/innen auch schon im Herkunftsland ausreichende mündliche Deutschkenntnisse nachweisen. Insgesamt sind nach dem Ende des Kalten Krieges drei Millionen Spätaussiedler/innen nach Deutschland gekommen. Sie sind neben den türkischstämmigen Migrantinnen und Migranten die größte Zuwanderergruppe. 72 Im Rahmen der Expertise wurde ein Interview mit der 17jährigen Marta geführt, die 2002 im Alter von zwölf Jahren als Spätaussiedlerin aus Kasachstan eingewandert ist. Sie besucht zurzeit die 10. Klasse einer Hauptschule (Typ B) mit dem Ziel Fachoberschulreife und lebt mit ihren Eltern, einer älteren Schwester und einem Zwillingsbruder zusammen in Köln. Das zweite Interview in dieser Gruppe wurde mit dem 16jährigen Egon geführt. Auch er ist als Spätaussiedler im schulpflichtigen Alter, im elften Lebensjahr, aus Kasachstan eingewandert. Er besucht die gleiche Hauptschule wie Marta und zweifelt aktuell an seinen Chancen, dort die Fachoberschulreife zu erwerben. Er lebt mit seinen Großeltern in Köln. Familie Egon erklärt sein familiäres Lebensumfeld: „Ja, ich wohne eigentlich mit mein Opa und Oma, weil meine Eltern geschieden sind. Und meine Mutter ist in Kasachstan geblieben und mein Vater ist direkt hier mit anderer Familie, geheiratet und hat eigene Kinder und so weiter. Aber der lebt hier und meine Mutter in Kasachstan. Ich wohne seit ich zwei bin bei meinen Großeltern, weil meine Mutter nicht mehr auf mich aufpassen wollte und so weiter. Ich bin also mit meinem Vater und seinen Eltern hier nach Deutschland gezogen. Und meine Mutter ist in Kasachstan geblieben, weil sie keine Deutsche ist. Mein Vater wohnt auch hier in der Straße, den seh ich auch. (…) Also meine Großeltern bedeuten mir mehr als meine Eltern. Weil die mich schon seit ich zwei bin erziehen.“ Obwohl Egons Eltern schon lange vor seiner Migration nach Deutschland geschieden waren, hat diese doch die Trennung von der Mutter vergrößert. Neben der Scheidung begründet Egon den Verbleib der Mutter in Kasachstan damit, dass sie keine Deutsche sei und der Vater in Deutschland eine neue Familie gegründet habe. Egon ist nicht Teil dieser „anderen“ Familie, hat aber Kontakt zum Vater, der jedoch die elterliche Sorge für den Sohn seinen Eltern überlässt. Martas Familie ist dagegen von der Erwerbstätigkeit der Eltern geprägt: „Meine Familie bedeutet für mich alles. Ich liebe die. (…) Ich bin auch älter geworden. Und Vertrauen ist mehr in der Familie, so halt. Wird immer auch gefragt: Wie geht’s? Wie war heute der Tag? Also ein bisschen näher gekommen als früher. Früher hatten meine Eltern nicht so viel Zeit für uns. Die mussten arbeiten. Also jetzt auch müssen die arbeiten, aber die haben viel mehr Zeit jetzt für uns auch abends. Früher waren die, also waren müde und, also sehr müde, Hausaufgaben kontrolliert und schlafen gegangen. Früher war meine Mutter Bäcker. Jetzt arbeitet sie in einem Sportcenter. Da räumt die auf. Früher musste die zweimal, hat die so den ganzen Tag gearbeitet. Und jetzt acht Stunden.“ 73 Dass ihre Mutter durch ein neues berufliches Arrangement mehr Zeit für die Familie hat, findet Marta offenbar positiv. Ihre Äußerung macht aber auch deutlich, dass sie durchaus Verständnis dafür hatte, dass ihre Eltern vorher wenig Zeit für sie und ihre Geschwister hatten und ihre elterliche Sorge alltäglich auf die Kontrolle der Hausaufgaben beschränken mussten. Egon betont dagegen seinen eigenen Willen. Er entzieht sich einer Hausaufgabenkontrolle durch seine Großeltern und betont, dass sie für ihn nicht die gleiche Autorität wie seine Eltern besitzen. „Ich bin älter geworden. Manchmal mache ich was ich will. Dann höre ich gar nicht auf meine Großeltern. Zum Beispiel nach draußen gehen und so weiter. Die mir sagen, du musst Hausaufgaben machen, aber manchmal mache ich das nicht. Die ziehen mich auch nicht. Meine Eltern hätten das gemacht. Aber nicht Großeltern. Mein Opa kann gar kein Deutsch. Meine Oma teilweise. Zu Hause sprechen wir russisch. Ich helfe denen fast jeden Tag. Einkaufen, putzen, übersetzen auch. Papiere zum Beispiel, Arbeitsamt zum Beispiel.“ Die Autorität der Großeltern hat in Egons Augen offenbar auch dadurch abgenommen, dass er im Einwanderungsland schneller und besser Deutsch gelernt hat. So kommt ihm eine wichtige Rolle in der Familie zu, wo er nicht nur im Haushalt hilft, sondern auch übersetzt. Mit der Kontrolle der Hausaufgaben ist auch die der Freizeit verbunden. Während Egon auch nicht auf seine Großeltern hört, wenn sie vorschreiben wollen, wann er nach draußen geht, hat Marta kein Problem ihren Ausgang den zu erklären: „Hausaufgaben, klar auf jeden Fall und dann kann ich mir überlegen, was ich machen will. Ich hab auch viel Zeit, Freizeit und so. Ich muss nur bescheid sagen mit wem, wohin und wann ich zurück komme, dann darf ich auch.“ Für Egon kann sein eigensinniges Agieren durchaus zu Konflikten mit und zwischen den Großeltern führen. „Manchmal ist das besser, wenn ich mich gar nicht einmische. Weil mein Opa sehr streng ist. Wenn ich mich einmische, gibt es noch mehr Streit. Manchmal misch ich mich da ein, aber allgemein macht meine Oma das allein. Manchmal wegen mir. Wegen der Schule, lernen und so weiter. Manchmal bin ich faul. Eigentlich bin ich ständig faul. Weil ich was anderes machen will, entweder fernsehen oder PC oder draußen spielen und so weiter.“ Offenbar weiß Egon, dass seine „Faulheit“ nicht ganz richtig ist und sein Großvater ihn auch manchmal zu recht kritisiert. Doch einerseits kann er sich auf die Parteilichkeit der Großmutter verlassen. Andererseits ist sein Wille, die Zeit außerhalb der Schule frei zu gestalten, größer als die Bereitschaft, schulischen Pflichten nachzukommen. Marta sagt im Interview gar nicht, worüber sie sich mit ihrer Familie streitet, betont aber, dass sie wie ihre Familie durchaus konfliktfähig ist. 74 „Wir reden darüber. Okay, manchmal wird schon geschrieen und so. Aber wir versuchen schon, uns gegenseitig ausreden zu lassen. Manchmal geht’s nicht mehr, also manchmal müssen wir auseinander gehen. Aber manchmal geht’s schon so richtig ab, dass jeder in sein Zimmer geht und fertig. Und so halt. Aber danach geht es wieder. Nicht immer so schlimm, finde ich. Also jeder kann was sagen, was ihm nicht passt und das finde ich auch gut, dass jeder seine Meinung sagt.“ Auf die Frage, wie sich ihr Familienleben zukünftig entwickelt, antwortet Marta mit Blick auf einen eigenen Haushalt: „Ja, also ich stell mir das gut vor. Eltern besuchen, denen auch helfen, zum Markt mit denen fahren oder so. Oder wenn die zu mir kommen. Oder ich rufe Mama an, wie wird das gekocht? Gegenseitig helfen und so, finde ich gut.“ Egon hat noch gar keine Vorstellung davon, wie er in Zukunft zu seiner Familie steht. Zwar erkennt er die Autorität der Großeltern nicht an, weiß aber dennoch zu schätzen, dass er nicht allein lebt. „Keine Ahnung. Ich will bei meinen Großeltern leben. Das ist auch so besser. Wenn ich alleine wohne, muss ich mich selber erziehen, selber einkaufen und so weiter.“ Erziehung und Bildung Beide Jugendlichen haben einen Kindergarten in Kasachstan besucht. Während Egon sagt, dass er sich an diese Zeit nicht erinnern kann, erzählt Marta eine Anekdote, in der sie sich selbst über ihre dominante Rolle im sozialen Gefüge amüsiert: „Ja, in Kasachstan habe ich den besucht, meinen Kindergarten. Wir sind früh morgens gekommen und dann haben wir gespielt. Dann wurde uns was vorgelesen. Also im Kindergarten mussten wir schon lesen lernen. Und wir haben auch was gegessen, also Mittagessen da und dann schlafen. Und vor dem Schlafen hat unsere Erzieherin noch was vorgelesen, eine kleine Geschichte halt und dann mussten wir schlafen. Danach wachen wir auf, dann ist Abendessen und dann wurden wir von unseren Eltern wieder abgeholt. Viel mitspielen und man muss immer sein Bett aufräumen und viel auf Sauberkeit achten. Ich kann mich schon erinnern. Mit meinem Zwillingsbruder habe ich mich da immer geschlagen. Wir haben uns immer das Spielzeug abgenommen. Wenn mir was nicht passte, dann direkt abnehmen. Das ging auch nicht immer bei mir. Weil es wurde gesagt, nein, das geht nicht, musst du fragen und so. Kann ich mich gut erinnern, an mein Bett. Jeder wollte auf diesem Bett schlafen. Als ich nicht da war, war jeder froh. Meine Erzieherin wohnt jetzt auch hier in Deutschland. Wir haben uns vor kurzem getroffen. Die hat mir auch erzählt, wie ich da war und so und meinte auch, jeder wollte auf deinem Bett schlafen. Das war so ein ganz kleines Bett. Und wenn du gehört hast, da hat jemand geschlafen, wenn du nicht da warst, dann ging’s richtig los.“ 75 Martas Erinnerungen an ihre Schullaufbahn sind mit ihrer Migrationserfahrung und der daraus folgenden Notwendigkeit, verschiedene Sprachen zu erlernen, verknüpft. Auch beengte Wohnverhältnisse sind ihr in Erinnerung geblieben. Vor der Auswanderung nach Deutschland ist Martas Familie wegen der Arbeitssuche des Vaters von Kasachstan nach Russland gezogen, in Russland von einem Dorf in eine Stadt, aus Russland wieder zurück nach Kasachstan. Wie bei Egon ist ein Elternteil nicht deutscher Abstammung. „Kasachstan erste Klasse zweite Klasse, danach bin ich nach Russland umgezogen. Da musste ich die zweite Klasse wiederholen. Weil in Kasachstan wird das anders gemacht als in Russland. In Kasachstan musste ich auch die kasachische Sprache lernen, was schwer war, das ist genauso wie türkische Sprache, ein bisschen was anders aber ansonsten das gleiche. In Kasachstan haben wir in einem Dorf gewohnt. Ich bin auch da geboren. Dann sind wir nach Russland in ein größeres Dorf, das war richtig groß, dann bin ich da zur Schule gegangen und dann sind wir in die Stadt umgezogen. Dann war ich da bis dritte Klasse. Mein Vater hat da gearbeitet und hat uns mitgenommen nach Russland zum Wohnen da. Wir hatten da ein Grundstück, aber wir mussten dafür bezahlen. Auf diesem Grundstück konnten wir auch so Kartoffeln wachsen lassen oder Karotten und so. Da mussten wir ausziehen, weil der Besitzer brauchte das Haus. Danach sind wir in die Stadt umgezogen, in eine Wohnung, da mussten wir mit zwei Familien wohnen. Also das war eine große Wohnung mit fünf Zimmern. Da waren zwei Familien, die haben zwei Zimmer gemietet. In einem Zimmer haben mein Bruder, meine Schwester und ich gewohnt. Das war auch nicht so groß, drei Betten und ein Schrank und ein kleiner Platz zum Spielen. Und im Wohnzimmer haben meine Eltern geschlafen. Dann waren wir da ein Jahr glaube ich. Und dann ist meine Oma aus Kasachstan auch nach Russland gekommen. Meine Oma, die ist Deutsche. Und die hat gesagt, ja wir haben dieses Visum bekommen. Wir müssen jetzt Papiere machen und so und dafür müssen wir nach Kasachstan wieder ausziehen. Mein Vater hatte schon damit ein Problem. Der wollte nicht so halt, der ist nur wegen uns gekommen. Das war die Mutter von meiner Mutter. Meine Oma wollte unbedingt nach Deutschland, weil hier wohnen alle ihre Verwandten, Bekannte, Geschwister und so von meiner Mutter Seite. Von meiner Vater Seite die wohnen in Kasachstan. Mein Vater wollte seine Eltern nicht verlassen und so. Aber er hat nachgedacht, warum soll er seine Familie verlassen? Lieber zusammen, dann kann er ja besuchen kommen. Danach sind wir nach Kasachstan umgezogen in Einzimmerwohnung. Das war noch schlimmer. Sechs Leute in einem Zimmer, also Küche und ein Wohnzimmer, da haben wir alle geschlafen. Manchmal sind wir auch zu Nachbarn gegangen zum Übernachten. Das war schon sehr schwer, kein Platz, was kann man machen. Das war meine beste Zeit in Kasachstan. Ich hab verschiedene Freunde gehabt. Wir haben immer gespielt. Winter war die beste Zeit da. Aber das Problem war, wir mussten schon Deutsch lernen. Meine Mutter hatte so Hefte bestellt. Nach der Schule mussten wir die Hausaufgaben machen plus eine Seite von diesem Buch auswendig lernen und dann Mutter erzählen, danach durften wir erst raus. Ich dachte mir immer so, ja, nein, ich will nicht. Wir haben trotzdem gelernt, aber immer wieder vergessen. Weil wir mussten noch kasachische Sprache lernen, Russisch, Deutsch und so. Zu viel für mich war das. Nach einem Jahr sind wir dann wieder nach Russland gefahren und von Russland nach Deutschland geflogen. Am 3. Mai 2002 sind wir nach Deutschland gekommen, kann ich mir gut merken. Dann waren wir zwei Tage in Friedland. Und danach ungefähr einen Monat in Unna-Massen. Da bin ich auch 76 zur Schule gegangen. Da habe ich auch Deutsch gelernt. Aber da ging es auch schneller. Weil alle reden Deutsch. Und in Kasachstan war das so, jeder redet russisch, da konnte ich mir das nie merken. Das war viel schwieriger. (…) Am 5. Juni sind wir nach Köln umgezogen. Seitdem wohnen wir hier. Ich war da elf und ich konnte das nicht so gut realisieren, dass ich jetzt auf einmal in einem anderen Land bin. Ich konnte schon verstehen, ja jetzt bin ich hier in Deutschland und alle meine Verwandten sind hier, meine Uroma. Ich kannte die gar nicht. Ja Fotos hatte ich gesehen, aber wenn man so ins Gesicht guckt sehen die schon ein bisschen anders aus. Wir haben hier erst in so einem Wohnheim erst gewohnt, da waren wieder fünf russische Familien und wir haben halt russisch gesprochen. Man hat mir schon erklärt, wir bleiben da, aber ich habe das nicht so gesehen. War schon schwer. Ich hab das nicht so realisiert, für immer hier, aber hier komme ich auch gut klar.“ Martas ausführlicher Schilderung zeigt, wie sehr sich die Schullaufbahn von Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte, die selbst im schulpflichtigen Alter eingewandert sind, von der einheimisch deutscher Jugendlicher unterscheidet. Marta hat sich bei geringen familiären Ressourcen mehrfach auf neue schulische Anforderungen einstellen müssen. Ihren Ausführungen ist zu entnehmen, dass ihr manches zwar „schwer“ gefallen ist. Sie blickt aber durchaus selbstbewusst zurück. Ausgerechnet die Phase der am stärksten beengten Wohnverhältnisse erscheint ihr im Nachhinein als ihre „beste Zeit in Kasachstan“. Und Marta beschreibt die mehrfache Notwendigkeit, neu anzufangen, nicht als Überforderung, sondern betont auch an anderer Stelle: „Es macht schon Spaß, was Neues zu lernen.“ Auch Egon ist als Seiteneinsteiger in die deutsche Schule gekommen und beschreibt den Spracherwerb als das größte Problem dabei: „Bis zur vierten Klasse bin ich in Kasachstan zur Schule gegangen. Nicht ganz die vierte Klasse, da waren noch zwanzig Tage übrig. Danach bin ich hier in Deutschland in die Fünfte gegangen. Fünfte, sechste war Vorbereitungsklasse, da habe ich Deutsch gelernt, aber nicht allzu perfekt. Danach bin ich in die Regelklasse gegangen, siebte, achte, neunte. Danach bin ich in 10 Klasse. In der Hauptschule gibt es doch 10 Typ b, Realschulabschluss. Dann bin ich in 10 Typ b übergegangen, weil ich gute Noten hatte. Und jetzt sieht das glaube ich bei mir nicht gut aus wegen Sprachproblemen. Sprachlicher Ausdruck und so weiter. Jetzt kriegen wir doppelt so viele Hausaufgaben auf sind doppelt so lang angestrengt. Ist schwieriger geworden. Der Druck. Man muss ständig zu Hause sitzen und lernen und so weiter. Aber ich mache das nicht immer.“ Seine Schilderung geht schnell in die Gegenwart, die ihn beschäftigt. Wie Elizabeta und Karim empfindet Egon, dass die Schule „Druck“ auf ihn ausübt. Für ihn ist das der Leistungsdruck, der im zehnten Schuljahr an der Hauptschule mit dem Ziel Fachoberschulreife einsetzt. Aber Egon ist offenbar nicht bereit, diesem Druck stand zu halten. Zur Erklärung der aktuellen Schwierigkeiten in der Schule kommen jetzt neben der vorher von ihm eingeräumten „Faulheit“ „Sprachproble77 me“ zur Geltung. Die hat Egon von Anfang an und ergänzt die Ausführungen von Marta, denen zu entnehmen war, dass die Anforderung, verschiedene Sprachen gleichzeitig zu sprechen, von ihr als Zumutung empfunden wurde, mit Hinweis auf die Umgangssprache zwischen Jugendlichen in Deutschland und Kritik an einer separaten Vorbereitungsklasse. „In der Vorbereitungsklasse waren viele Russen, habe ich nur noch ständig Russisch geredet, aber kein Deutsch. Hätte ich lieber eine Klasse runtergesetzt. Hätte ich nicht in die fünfte gegangen, sondern in die vierte, wäre das besser, hätte ich mehr Deutsch gelernt. Ich musste eigentlich mehr Deutsch sprechen. Aber ich unterhalte mich jeden Tag auch auf Russisch. In der Schule auch mit russischen Freunden, draußen auch. Als ich Praktikum gemacht habe, habe ich nur Deutsch geredet. Danach bin ich nach Hause gekommen und hatte ein bisschen Schwierigkeiten, russisch zu reden. Ich rede lieber russisch als deutsch, weil die mich verstehen. So kann ich mich besser ausdrücken.“ Egon weiß, dass seine Umgangssprache über den Spracherwerb entscheidet. An dieser Stelle wird deutlich, dass er seine Deutschkenntnisse nur verbessern kann, wenn er regelmäßig Deutsch spricht. Er hat aber die Erfahrung gemacht, dass seine Russischkenntnisse darunter leiden. Das möchte Egon nicht, denn Russisch ist ihm wichtig, um richtig verstanden zu werden, um auch die Zwischentöne ausdrücken zu können. Nicht nur in der Familie spricht er russisch, auch mit Freunden in der Schule und in der Freizeit. Und doch deutet Egon ein Bedauern darüber an, dass er nicht gezwungen war, in der Schule mehr Deutsch zu sprechen. Jetzt ist es für ihn zu spät, seine Deutschkenntnisse entsprechend der gewachsenen schulischen Anforderungen zu verbessern: „Lieber mache ich einen guten Hauptschulabschluss als einen schlechten Realschulabschluss. Ich sehe einen Elternsprechtag auf mich zu kommen. Sind ja nur noch 10 Wochen und Osterferien dazwischen.“ Übergang von der Schule in den Beruf Marta hat im zehnten Schuljahr eine konkrete Vorstellung von ihrem Übergang in den Beruf: „Ich habe mich schon bei einem Berufskolleg angemeldet. Erzieherin möchte ich gerne werden. Das wäre mein Wunschberuf. Ich mag das sehr mit Kindern und so. Auch wenn das nicht klappt, mache ich auf jeden Fall Fachabitur. Entweder mit der Ausbildung oder so für Soziales.“ Sie hat sich gleichzeitig für eine Erzieherausbildung und für einen Platz an einer Fachoberschule beworben und möchte in jedem Fall ihre Fachhochschulreife machen. Diese Möglichkeit zieht Egon nicht mehr in Betracht. Ohne den Realschulabschluss fehlt ihm auch die Voraussetzung dazu. Stattdessen bewirbt sich Egon um eine Ausbildungsstelle im Handwerk: 78 „Eine Ausbildung. Wenn das nicht klappt, gehe ich in ein Berufskolleg. Bei Ausbildung habe ich schon sieben Bewerbungen geschickt. Nur drei Zusagen zum Einstellungstest bekommen, sonst nur Absagen. Zwei Einstellungstests habe ich geschrieben. Und noch gar nichts bekommen. Als Tischler. Wenn das nicht klappt, Berufskolleg. Da habe ich auch einen Einstellungstest gemacht. Die meinten, Sie werden von uns noch was hören. Wenn ich nicht bestanden habe, komme ich auf Warteliste, aber wenn schon, laden die mich zu einem Vorstellungsgespräch ein. Also zwei Jahre – wie heißt das – also Metalltechnik, was Handwerkliches. Mit Handwerk kann ich besser umgehen als zu reden. (…) Ja eigentlich schon mit Holz. Ich weiß nicht wie ich darauf gekommen bin. Das letzte Praktikum war ein Einzelhandelskaufmann, hat mir nicht gefallen.“ Egons Vorstellungen sind weniger bestimmt und zuversichtlich als die von Marta. Er hat schon mehrere Bewerbungen geschrieben und auch an Einstellungstests teilgenommen. Auch Egon sichert seinen Bewerbungsprozess durch die Alternative Berufskolleg ab, hat aber kaum eine Vorstellung von dem Bildungsgang, der dort zu absolvieren wäre. Immerhin hat er im Praktikum gelernt, dass er keine kaufmännische Tätigkeit ausüben möchte. Eine positive Verbindung zum Handwerk – zur Tischlerei oder Metallverarbeitung – benennt Egon nicht. Seine Äußerung lässt eher darauf schließen, dass er keine Alternative sieht. Während Egon sagt, dass er keine Vorbilder habe, bezieht sich Marta in ihrer Antwort auf ihr Praktikum in einer Kindertagesstätte, dass auch ihre Berufswahl positiv verstärkt hat: „Ich hab Praktikum gemacht und meine Betreuerin hat mir vieles beigebracht. Die hat mich auch machen lassen mit den Kindern, so in einen Streit rein gehen und die Kinder erklären lassen, was passiert ist, selber entscheiden. Einen Nachmittag gestalten mit Kindern und so. Wenn ich Fachabi habe, werde ich mich auf jeden Fall bei der bewerben. Von der kann man auch vieles lernen.“ Auch auf die Frage nach der beruflichen Mobilität fallen die Antworten der beiden Jugendlichen unterschiedlich aus. Während Egon fast entsetzt zurück fragt „Wie umziehen? Lieber nicht“, kann Marta, deren Schullaufbahn ja durch viele Ortswechsel geprägt war, in einem möglichen Umzug den Reiz des Neuen entdecken: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich eine Ausbildung in einer Stadt bekomme, auf jeden Fall. Man braucht viel Geduld um eine Ausbildungsstelle zu finden. Andere Stadt kennen lernen, was Neues sehen, mal da und da wohnen finde ich schon gut. Meine Familie wäre richtig froh. Ich hab immer so viel Fragen. Nein ich glaube nicht, dass die ein Problem hätten. Wir würden uns besuchen. 79 Soziale Netzwerke Marta erzählt von einer Freundin, die wie sie aus Russland kommt und mit der sie ihren Alltag teilt: „Ja, meine beste Freundin. Wir kennen uns schon seit 3 ½ Jahren. Wir haben uns bei einer Konfirmation kennen gelernt. Die ist halt auch Russin. Wenn wir miteinander reden, verstehen wir uns auch sehr gut. Weil wir haben auch gleiche Probleme. Wir sehen uns jeden Tag. Wir akzeptieren uns gegenseitig. Wenn ich eine andere Meinung habe als sie, dann versuchen wir das so zu erklären, dass sie meine Meinung versteht und ich ihre Meinung verstehe. Dann sage ich so, ich versteh deine Meinung, aber ich habe eine andere Meinung. Manchmal sind wir auch gleicher Meinung. Das finde ich auch gut. Jeder Mensch soll zu seiner Meinung stehen.“ Auffällig ist, dass Marta, wie in ihrer Familie, an ihrer Freundschaft, die Fähigkeit zu streiten, schätzt. Egon scheint gelangweilt von dem, was er mit Freunden macht, und verbringt seine Freizeit offenbar lieber allein mit elektronischer Unterhaltung. „Ja Freunde geht, aber meine Familie ist wichtiger. Fast jeden Tag immer das gleiche. Fußballspielen, spazieren gehen. Aber die meiste Zeit verbringe ich zu Hause am PC, chatten und so. Auch fernsehen, russisch und deutsch. Eigentlich mehr russisch.“ Marta ist auch in einer Kirchengemeinde aktiv und wirkt dort und im Jugendzentrum in Mädchengruppen mit. „Ich besuche eine Mädchengruppe, evangelische Gemeinde. Da habe ich auch vieles gelernt, da habe ich eine Jugendleiterkarte gemacht, also Juleika Grundkurs. Und da habe ich auch früher eine Kindergruppe geleitet. Das kann ich jetzt auch alleine machen. Das finde ich gut. Gute Erfahrung auf jeden Fall. Nachhilfe bekomme ich, Mathe und Englisch. Und im Jugendzentrum mache ich auch mit in der Mädchengruppe.“ Egon hatte wohl einmal die Absicht, in einen Sportverein zu gehen, drückt aber auch dazu den Trotz aus, der auch in früher zitierten Passagen anklingt: „Wollte ich eigentlich. Fußball oder Basketball. Aber habe ich nicht.“ Mit Politik können beide nicht viel anfangen. Marta denkt an Politik, die in Nachrichten vorkommt und sagt: „Politik das ist zu kompliziert für mich. Ich weiß nicht. Ich höre gerne so Nachrichten, da denke ich, was reden die da. Ich hab auch Politik in der Schule gehabt. Das ist nichts für mich.“ Auch Egon bringt Nachrichten mit Politik in Verbindung und distanziert sich davon: „Ich hasse Politik. Ich interessiere mich auch gar nicht. Aber Nachrichten muss man schon gucken. Tue ich aber gar nicht.“ 80 Vergleich zwischen Jugendlichen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte Marta sieht in ihrer Zuwanderungsgeschichte und der erlebten Armut einen Vorteil für ihre persönliche Entwicklung: „Die Leute, die hier geboren sind, wenn die in den Urlaub fahren, lernen die auch andere Kulturen. Aber nicht immer. Die liegen am Stand und bräunen sich und keine Ahnung. Aber da ich in Kasachstan geboren bin und noch in Russland war und hier in Deutschland kenne ich mehrere Kulturen. Ich hab mehr Lebenserfahrungen. Vielleicht haben die auch verschiedene Erfahrungen. Aber ich denke schon, ich hab schon das und dies erlebt. Wir waren nicht immer in super Ferien, sondern meine Eltern mussten hart arbeiten, damit wir was zu essen hatten. Sogar ich habe da gearbeitet am Wochenende. Dann habe ich mir Eis gekauft, meinem Bruder Eis gekauft, meiner Schwester Eis gekauft. Ich denke schon, dass das Leben hier in Deutschland sicherer ist. Da kann man sehr schnell auf der Straße landen. Das keiner dir hilft. Und hier wird schon öfters geholfen. (…) Ja, ich hab viele Erfahrungen gesammelt – wie das in Kasachstan war, in einem Dorf und in Russland in einer Stadt und danach hier in Deutschland in einer großen Stadt – das war schön, das zu sehen. Ich danke Gott, dass ich das erlebt habe. Ich hab viel vom Leben gesehen und ich werde noch mehr sehen.“ Trotz dieser großen Zuversicht, gibt es auch für Marta Momente, in denen sie sich wünscht, ihr Leben wäre anders verlaufen. Auslöser ist die Erfahrung, dass sie sich im Deutschen nicht so gut ausdrücken kann wie Jugendliche, die hier geboren sind. „Wenn ich mich mit deutschen Leuten unterhalte, die verstehen mich nicht immer richtig, was ich meine. Ich kann ja auch nicht perfekt Deutsch und so. Manchmal bereue ich richtig, warum bin ich nicht in Deutschland geboren, dann könnte ich auch viel mehr Deutsch, dann hätte ich das richtig erklären können.“ Auch Egon hebt hervor, dass es einen Unterschied zwischen ihm und denen gibt, die in Deutschland geboren wurden: „Die schon hier geboren sind, da ist das ihr Heimatland, also vorteilhaft. Und mein Vaterland ist doch jetzt Kasachstan, nicht Deutschland. Eigentlich bin ich schon in Deutschland zu Hause, aber Kasachstan will ich auch mal besuchen fahren. Zuerst hatte ich ja Heimweh, wollte ich immer nach Kasachstan. Aber nach einigen Zeiten ging das schon.“ Er sieht, dass es Konflikte zwischen Jugendgruppen verschiedener Herkunft gibt und ist offenbar müde, sich daran zu beteiligen: „Türken, Kurden, Russen und so weiter alle sitzen in einer Ecke. Jedes mal in der Schule wird jemand blöd angemacht und geschlagen und so weiter. Jedes mal verteidigen und so weiter.“ 81 Egon, der zur Gruppe der russischen Jugendlichen gehört, hebt auch noch einmal den für ihn damit verbunden Nachteil hervor: „Wenn ich mit russischen Freunden mich unterhalte, ist das eigentlich Nachteil, weil ich kein Deutsch lerne.“ Schließlich vergleicht Egon sein Leben in Deutschland mit dem in Kasachstan und betont Menschenrechte, Freiheit und seinen relativen Wohlstand als Vorteile Deutschlands: „In Deutschland ist es ganz anders als in Kasachstan. In Kasachstan gibt es ganz andere Gesetze und so weiter. In Deutschland gibt es viele Menschenrechte, also Freiheit, jeder darf sagen, was er will. In Kasachstan, glaube ich, ist das anders. Wir sind eigentlich nach Deutschland umgezogen, weil wir in Kasachstan nicht so gut lebten, also fast arm waren. In Deutschland kann ich mir fast alles leisten.“ Auch Marta weiß Demokratie und kulturelle Vielfalt als Vorteile ihres neuen Lebensumfeldes zu schätzen: „Ich finde es sehr schön, dass Deutschland ein demokratisches Land ist. Das viele verschiedene Kulturen hier sind. Man kann vieles lernen hier. Das ist in Russland nicht so. Da wird man halt – da glaubst du an einen.“ 4.2.3 Asylmigration Die kleinste Gruppe der Zugewanderten im Land sind Asylsuchende und Flüchtlinge. Auch für sie hat sich die Situation in Deutschland seit den 1990er Jahren grundlegend verändert. Nach der Einschränkung des früher generösen Grundrechts auf Asyl im sog. "Asylkompromiss", ist die Neuzuwanderung klar und nachhaltig zurückgegangen - von fast 440.000 Erstanträgen im Jahr 1992 auf 21.029 Anträge im Jahr 2006 (BAMF 2007). Von den 430.000 Asylsuchenden, die 2005 im Ausländerzentralregister erfasst waren, hatten ein Drittel Asyl gefunden - 20 % im Sinne des Grundgesetzes, 13 % im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention. Sie sind anderen Zugewanderten weitestgehend gleichgestellt und erhalten nach drei Jahren Aufenthalt eine Niederlassungserlaubnis, wenn das Schutzbedürfnis fortbesteht. Jeder sechste hielt sich während des laufenden Asylverfahrens in Deutschland auf, das oft mehr als zwei Jahre dauert und in der Regel ohne Anerkennung abgeschlossen wird. Die übrige Hälfte der Asylsuchenden war bereits rechtskräftig abgelehnt, musste aber geduldet werden, weil ein akutes Abschiebungshindernis festgestellt wurde (vgl. Deimann 2007). 82 Im Rahmen der Expertise wurde ein Interview mit der 17jährigen Aicha geführt, die 1998 im Alter von sechs Jahren mit ihrer kurdischen Familie aus dem Irak nach Deutschland geflohen ist. Sie besucht zurzeit die 10. Klasse einer Hauptschule (Typ B) mit dem Ziel Fachoberschulreife. Aicha lebt mit einer älteren und einer jüngeren Schwester, einem „kleinen“ Bruder und ihren Eltern zusammen in Köln. Das zweite Interview in dieser Gruppe wurde mit Amir geführt. Auch er ist als Kurde mit seiner Familie aus dem Irak geflohen und im fünften Lebensjahr nach Nordrhein-Westfalen gekommen. Amir lebt mit einer älteren Schwester, zwei jüngeren Brüdern und seinen Eltern in Köln und besucht die 10. Klasse einer Hauptschule. Familie Auf die Frage, welche Bedeutung seine Familie für ihn habe, antwortet Amir entschieden: „Was heißt meine Familie? Liebe. Stolz. Alles.“ Die Antwort von Aicha bringt auch starke Gefühle für ihre Familie zum Ausdruck: „Meine Familie bedeutet erst mal eine ganz normale Familie: Wir lieben uns. Wir hassen uns. Ja.“ Aufschlussreich zum Verständnis ihres familiären Lebensumfeldes ist Aichas Antwort auf die Frage, ob sich ihr Verhältnis zur Familie in den letzen Jahren geändert habe: „Ja, die sind strenger mit mir geworden, als ich erwachsener werde. Ich bekomme mehr Grenzen jetzt. Ja, mehr als früher. Bei deutschen Familien ist das ja nicht so. Dann ist man freier da. Rausgehen jetzt zum Beispiel. Ich darf jetzt halt nicht so oft raus. Halt solche Sachen. Nach der Schule direkt nach Haus. Keine Partys. Keine Jungs. So was geht nicht bei uns. Ich rauche nicht. Ich trinke nicht. Mit Freundin kann ich schon raus gehen. Darf nicht so spät sein. Sieben, acht Uhr. Als Kind durfte ich schon bis neun raus gehen. Durfte ich Spielen, Spielplatz und so. Mit 14 ist das nicht mehr so. Meine Eltern sind sich da einig. Mein Vater ist etwas strenger als meine Mutter. Mein Vater hat auch um meine Mutter Angst. Bei meiner älteren Schwester sind die etwas lockerer, weil deren Freundeskreis sind auch unsere Landsleute. Eltern und so kennen sich alle. Deshalb darf die auch mal 11 Uhr nachts nach Hause kommen mit denen. Weil meine Eltern wissen, dass die mit denen ist. Aber wenn ich jetzt mal mit einer Freundin gehe und die kennen sich nicht, dann muss ich sehr früh zu Hause sein.“ Während sich in den anderen Interviews die Erwartung bestätigt hat, dass Jugendliche mit zunehmenden Alter an persönlicher Freiheit gewinnen, wenn auch teilweise im Konflikt mit ihren Eltern, ist Aichas Situation genau umgekehrt. Ihre Eltern sind strenger geworden, als sie in die Pubertät gekommen ist. Sie muss früher zu Hause sein, keine Partys, keine Jungs, nicht rauchen, 83 nicht trinken, Freundschaften sollten nach Ansicht der Eltern am besten mit ihnen bekannten Kurden bestehen. Aichas Aussage lässt darauf schließen, dass sie die Angst ihrer Eltern durchaus nachvollziehen kann, aber unter ihrem Misstrauen und strengen Verboten leidet. Amir sieht dagegen für sich keine Veränderungen mit zunehmendem Jugendalter: „Nein. Kann man nicht so sagen. Alles bleibt eigentlich wie es ist.“ Seine Antwort zur Frage nach familiären Konflikten macht aber deutlich, dass auch in seiner Familie ein eher autoritärer Erziehungsstil herrscht. Allerdings war Amir in der Interviewsituation nicht zu einer Erzählung zu stimulieren, so dass der Interviewer Nachfragen gestellt hat: Amir: „Es gibt ja nicht öfters Streit. Aber wenn sich meine Eltern streiten, versöhnen die sich auch wieder. Sagen wir so einen Tag.“ Nachfrage: „Ich meine ganz alltäglichen Streit, der überall vorkommt über Taschengeld zum Beispiel oder wie lange du weg warst.“ Amir: „Dann wird eigentlich so Hausarrest zwei Wochen – wird sofort geklärt.“ Amir kennt auch Situationen, in denen seine Eltern kontrollieren wollen, wie lange er ausgeht. Allerdings hat er offenbar die Möglichkeit, sich darüber hinweg zu setzen: Amir: „Also, da ich weiß, was ich sage, denke ich mal das was ich sage richtig ist.“ Nachfrage: „Und das wird von Deinen Eltern auch anerkannt?“ Amir: „Natürlich gibt es, ja das ist nicht richtig, eher so. Geh nicht so lange raus. Es kann dir was passieren. Aber ich sag dann immer, ich pass schon auf, auf mich. Dann sagen die, die jetzt im Gefängnis sitzen, haben das auch immer gesagt. Dann kommen Probleme auf die zu.“ Mit Blick auf die zukünftige Entwicklung seines Familienlebens sagt Amir: „Ja, wenn ich erwachsen bin, werd ich hoffentlich eine eigene Wohnung haben. Mein eigenes Geld haben. Familie ab und zu besuchen. Die kommen auch zu mir. Ich weiß nicht, dann hab ich ja mein eigenes Leben, meine eigene Familie.“ Dass Amir in Zukunft sein eigenes Leben, seine eigene Familie haben möchte, kann bedeuten, dass sein Leben und seine Familie jetzt nicht ihm gehören, vielmehr im Besitz seines Vaters sind. Aicha erzählt, dass es in ihrer Familie zwar öfter zu Konflikten kommt, wenn sie gegen das Ausgehverbot aufbegehrt, aber am Ende muss sie gehorchen: „Wir streiten uns immer eigentlich. Ja, wir streiten uns, dann gehen wir uns aus dem Weg, dann ist auch wieder gut. Manchmal reden wir auch. Aber selten. Und das hilft auch nicht weiter. Kommt es nur zu mehr Streit. Öfters will ich mit Freunden halt was machen und das geht dann halt nicht. Und ich muss dann auf die hören. Dann muss ich zu Hause bleiben.“ 84 Aicha kann sich vorstellen, dass sich ihre Freiheiten, wie die der Schwester, mit Erreichen der Volljährigkeit vergrößern: „Das geht die nächsten Jahre so weiter. Ich glaub bis ich 18 bin, dann werde ich ein bisschen erwachsener behandelt. Aber sonst bleibt das gleich. Meine Schwester ist auch 18, die darf schon ein bisschen mehr machen. Ich weiß, dass ich nichts Schlimmes mache, muss aber trotzdem zu Hause bleiben.“ Erziehung und Bildung Amir und Aicha haben beide in Deutschland schon die Grundschule besucht und sind nach einem Scheitern an der Realschule an eine Hauptschule gekommen. Was sich Egon in einem oben zitierten Interview als bessere Alternative zu einer Vorbereitungsklasse aus zugewanderten Seiteneinsteiger/-innen vorstellen konnte, die Wiederholung einer Jahrgangsstufe in der Regelklasse, hat Aicha erlebt: „Ich bin direkt in die erste Klasse gekommen. Ja, dann musste ich da wiederholen, weil ich konnte die Sprache nicht. In der ersten Klasse komm ich einfach rein und dann fangen die an zu lernen und ich hab ja nichts verstanden. Muss ich wiederholen. Ohne extra Deutschunterricht. Und dann komm ich in die Realschule. Ich kam mit Englisch und Mathe nicht klar. Ich konnte nicht. Ich weiß nicht. Ich wollte einfach nicht. Dann war auf der Hauptschule besser. Jetzt bin ich in die 10b gekommen und kann einen Realschulabschluss machen.“ Auch Amir war nicht in einer Vorbereitungsklasse, musste aber keine Klasse wiederholen, trotz eines Umzuges innerhalb der Stadt während seiner Grundschulzeit. „Zuerst war ich erste zweite Klasse in Mechenich auf einer Grundschule. Dann sind wir umgezogen. Dritte, vierte hier eine Grundschule. Dann war ich fünfte, sechste Klasse auf einer Realschule. Und dann haben sich meine Noten verschlechtert. Dann war ich siebte, achte auf der Haupt. Eigentlich so hin und her. Auf der Hauptschule die meiste Zeit.“ Aicha ist aktuell mit ihrem persönlichen Lebensumfeld in der Schule ganz zufrieden. Sie erklärt: „Mein Lehrer und meine Mitschüler, die sind eine besondere Schule. Mein Klassenlehrer ist ein intelligenter Mann. Der ist echt, der kann immer jemandem weiter helfen. Wenn man Probleme hat, kann man direkt zu dem gehen. Mitschüler auch nett und so. Unsere Schule ist sehr, wie nennt man das, eine kleine Schule, wie eine Grundschule, hat nicht viel anzubieten, aber man kennt sich.“ Allerdings bringt Aicha auch eine Unzufriedenheit mit ihrer Lebenssituation zum Ausdruck, die auch mit der Schulroutine zusammen hängt: 85 „Ich fühle gar nicht. Ich denke nur, dass dasselbe passiert wie immer. Ich steh auf, mache mich fertig und gehe in die Schule. Wie immer. Ich komme in die Klasse. Mathe, Deutsch, Englisch. Wie immer. Eigentlich ist mein Leben langweilig. Dann komm ich nach Hause. Oder ich komm ins Jugendzentrum. Dann geh ich nach Hause schlafen.“ Amir erklärt, dass er nach dem Wechsel von der Realschule zur Hauptschule keinen Leistungsdruck mehr empfindet: „Die Hauptschule ist sehr, also nicht sehr einfach, aber ist sehr einfacher als die Realschule. Auf der Realschule war schon zu spät. Dann war ich noch drei vier Wochen krank und da habe ich einige Arbeiten verpasst und dann ging’s nicht mehr.“ Übergang von der Schule in den Beruf Amir hat noch recht zufällig anmutende Vorstellungen von seinem Übergang von der Schule in den Beruf. Auch er fährt die Strategie, sich gleichzeitig um eine weiterführende Schule und eine Ausbildungsstelle zu bewerben: „Im Moment melde ich mich schon mal an Schulen an. Damit das parat schon mal steht, falls ich keine Ausbildung finde. So weiterführende Schule für meinen Realabschluss. Aber bewerben tue ich mich auch für Ausbildungsstellen. Einzelhandel. Fachkraft für Lagerlogistik und so. Ja, so was. Ich war zum Beispiel einmal Poko, dann hab ich gesehen, wie man im Lager so was abholt und so. Sah in Ordnung aus, dachte ich.“ Er hat zwar Hilfe bei seiner beruflichen Orientierung erfahren, kann aber mehr mit individueller Unterstützung bei der Bewerbung anfangen als mit dem Angebot der Arbeitsagentur: „Im Biz30 zum Beispiel wird man öfters eingeladen. Aber da, so die geben dir ganz viele Adressen, so, so. Das habe ich nicht so wahrgenommen, ehrlich. Da ist eine Berufslehrerin. Die fragt immer, was machst du dann? Die hilft dir Bewerbungsschreiben.“ Vorbilder hat Amir nicht. Interessant ist, wie er Erfolg definiert: „Mir fällt jetzt keiner ein. Es gibt viele Erfolgreiche. Erfolgreich ist gesund zu sein, genug Geld, vielleicht auch ein bisschen mehr Geld in der Tasche zu haben als man braucht.“ Gesundheit, die im Jugendalter für viele selbstverständlich ist, ist für ihn, neben Geld, ein Erfolgsfaktor. Amir kann sich nicht vorstellen, für eine Ausbildung umzuziehen: „Also, dann würde mein Job und meine Wohnung wo anders sein. Nee, ich glaub. Also, wenn es keine andere Chance gibt schon. Aber ich würd mich auch da, wo es im Umkreis 30 Berufsinformationszentrum der Bundesagentur für Arbeit. 86 Köln ist zum Beispiel. Man kann sich nicht vorstellen woanders. Ist nicht so schön. Dann muss man die Gegend und die Leute.“ Aicha hat noch gar keine Vorstellung von ihrem Übergang in den Beruf. Aktuell hat sie sich an zwei Fachoberschulen verschiedener Fachrichtung beworben: „Ich hab keinen Plan. Gar nichts. Ich hab mich da ja beworben, die eine ist Richtung Soziales, die andere ist in wirtschaftliche Richtung. Aber ich weiß noch nicht.“ Für Aicha ist klar, dass ihre Ungewissheit nicht an mangelnder Unterstützung durch die Schule liegt: „Die helfen mir auch. Das liegt an mir, dass ich nicht weiß. Ich bin unsicher. Immer. Mm, nee. Ich suche immer noch, aber keinen gefunden.“ Anders als Amir kann sich Aicha durchaus vorstellen, für eine Ausbildung umzuziehen, hält die Vorstellung aber aufgrund der Einstellung ihrer Eltern für unrealistisch: „Weg von meinen Eltern? Geht nicht. Ich kann mir das schon vorstellen, aber meine Eltern nicht. Das wird nichts.“ Soziale Netzwerke Aicha hat eine beste Freundin und hatte auch einen Freund, von dem die Eltern nichts wissen: „Meine beste Freundin und mein Freund. Mein Ex-Freund eigentlich. Meine beste Freundin, die ist an meinem Nebenplatz. Mit meinem Ex-Freund war ich ein Jahr und acht Monate zusammen. Habe ich Schluss gemacht. Mit meinem Freund, das wissen meine Eltern nicht. Meinen Freund habe ich wegen meiner Freundin kennen gelernt und meine Freundin in der Schule. Wir gehen ins Kino, reden was, in den Park, wir reden.“ Ihre Partnerschaft ist nicht etwa am Elternhaus gescheitert, vielmehr am Verhalten des Freundes, dass dem ihrer Eltern gleich kam: „Mein Freund hat mir auch so, wie meine Eltern ähnlich, Sachen verboten: geh nicht dahin. Zieh das nicht an. Ganz genau so. Der hat seine Grenzen nicht mehr gesehen. Der hat mit mir nicht mehr normal geredet. Dann hat er angefangen zu beleidigen wegen Kleinigkeiten, wenn dem was nicht gefallen hat. Schlimme Beleidigungen. Der war auch so ein stolzer Ausländer. Der meinte auch immer Ehre, Ehre und so.“ Aicha besucht das örtliche Jugendzentrum. Daneben hat sie „gar nichts“ an sozialen Zusammenhängen, in denen sie ihre Freizeit gestaltet. Von Politik hat sie nach eigenen Worten „keine Ah87 nung“. Auch Amir trifft seinen Freundeskreis ausschließlich in der Schule und im Jugendzentrum: „Außerhalb meiner Familie sind meine Freunde und Freundinnen und die engsten sind mir schon wichtig. Durch Schule. Wir hängen meistens im Jugendzentrum ab. Dann haben wir da gemeinsam Spaß. Internet, Playstation, fernsehen, wir kochen, da gibt es auch Fitness im Jugendzentrum, machen wir auch.“ Vergleich zwischen Jugendlichen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte Amir sieht Erziehung, Familie und Sprache als Unterschiede zwischen Jugendlichen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte an: „Erziehung und Familie ist eigentlich nur anders. Sonst, wir gehen alle gleich zur Schule. Draußen hängen wir alle zusammen ab. Ich habe auch deutsche Freunde. Und die Sprache, in meiner Familie wird kurdisch gesprochen.“ Er sieht weniger in seiner Zuwanderungsgeschichte einen persönlichen Vorteil als in seiner Einwanderung nach Deutschland. Dass Amir dir kurdische Sprache spricht und Besuche zwischen Verwandten aus verschiedenen westlichen Ländern möglich sind, findet er auch gut. „Die Vorteile sind für mich, dass ich halt dreiviertel meines Lebens schon hier wohne, könnte man sagen ungefähr. Und ich find `s hier einfach besser. Ich könnt mir nicht vorstellen, jetzt im Irak mein Leben weiter zu machen. Ich bin alles gewohnt hier in Deutschland. Ich war nie wieder da. Kurdisch kann ich. Da sind mehrere Verwandte in Amerika, Norwegen, London, Dänemark. Im Irak die meisten und hier in Deutschland sind auch schon viele – 40, 50. In Norwegen war ich vor zwei Jahren. Nächste Woche besuchen die uns.“ Dass Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte in Deutschland Nachteile haben könnten, sieht Amir nicht: „Nachteile eigentlich nicht. Nee, ehrlich nicht.“ Ihm ist es vielmehr wichtig, abschließend noch einmal seine Verbundenheit mit dem Stadtviertel zu demonstrieren, in dem er lebt. Amir blickt aus dem Fenster eines Plattenbaus auf die öffentliche Grünanlage, die sicher die Lebensqualität im „sozialen Brennpunkt“ steigern sollte: „Das ist jetzt kein schönes Bild. Ist ja nur der Wald. Ich kann `s mir nicht vorstellen hier weg zu gehen. Überhaupt Straße so, Gebäude, meine Nachbarn. Seit acht Jahren wohne ich schon hier. Schon ne Weile. Sind alle sehr nett, die Leute. Sehr in Ordnung.“ 88 Aicha konkretisiert das, was auch Amir mit unterschiedlicher Erziehung gemeint ha,t für ihre Lebenswelt als Mädchen in einer kurdischen Familie: „Zwei verschiedene Welten denke ich. Die dürfen halt viel mehr Sachen. Die dürfen Sachen, die ich nicht mal denken darf. Die Erziehung ist anders. Bei uns viel strenger. Die Erziehung ist ganz anders. Die dürfen viel mehr als wir. Klamotten, Rausgehen, Freund und so. Das dürfen wir alles nicht. Kurze Sachen anziehen, meine ich mit Klamotten. Es ist mir auch nicht so wichtig. Für manche andere Mädchen schon. Es gibt halt Unterschiede, wenn ich mich sehe und deutsche Mädchen. Ich darf halt nicht bei einer Freundin schlafen. Die dürfen auch bei Freunden schlafen, also männlichen, die meisten. Es gibt auch Deutsche, die das nicht dürfen. Vorteile bei den Deutschen, dass die offener sein können. Die sind auch viel zivilisierter. Wenn man auch die Länder anguckt. Bei uns sind die noch, sagen wir mal, hängen geblieben noch ein bisschen. Eine Sängerin sagen wir mal, die zieht was Kurzes an, alle sagen, das ist eine Hure und so. Aber hier ziehen die Mädchen das an, sogar auf der Straße, ist normal. Das ist ein Vorteil hier. Dort sind die echt hängen geblieben meistens. Ich finde auch, wenn man hier ist, dann sollte man sich echt hinein integrieren. Und nicht immer so denken, Ehre und so. Denken aber leider voll viele so.“ Und auch Unterschiede, die es für kurdische Mädchen und Frauen im Lebensumfeld Familie gibt, macht Aicha am Beispiel Heirat konkret: „Wenn ein Mann um meine Hand anhalten kommt - meine Eltern suchen keinen Mann aus – aber wenn ein Mann kommt – ich könnte mich auch verlieben und sagen, komm um meine Hand anhalten. Und wenn dieser Mann meinen Eltern gefällt, können die ja sagen oder nein sagen. Meine Eltern sagen immer: Ist kein Problem, Hauptsache er ist ein guter Moslem, er hat gute Eltern und man redet gut über den und ja er hat Geld, gute Job und so, er kann dich ernähren. Religiös sind diese kulturellen Unterschiede in Aichas Familie nicht begründet: „Ich muss kein Kopftuch oder so tragen. Meine Eltern gehen nicht in die Moschee. Weil hier die meisten sind für Türken und so. Das will mein Vater nicht. Wir beten zu Hause. Meine Mutter trägt auch kein Kopftuch.“ Positiv empfindet sie ihre Identifikation mit dem kurdischen Volk und ihre Kenntnis der kurdischen Sprache, doch auch ihre Aussage dazu verbindet sie mit Kritik am restriktiven Erziehungsstil: „Vorteile? Ich bin auch stolz, eine Kurdin zu sein. Aber voll streng, könnte lockerer sein. Ja, ich kann kurdisch, das ist der Vorteil.“ Die Interviewsituation hat bei Aicha offenbar einen Reflexionsprozess ausgelöst, dem sie sich zuvor nicht in dieser Form gestellt hatte. Zum Abschluss sagt sie: „Mein Leben, da fehlt was. Da fehlt irgendwas. Mein Leben ist langweilig. Ich steh auf, ich weiß gar nicht wofür ich aufstehe.“ 89 Möglicherweise hat das Interview Aicha in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt. Hier zeigt sich, dass die Interviewsituation auch einen reflexiven Umgang mit dem Alltag auslösen kann. 4.2.4 Deutsche ohne Zuwanderungsgeschichte Im Rahmen der Expertise wurde ein Interview mit dem 20jährigen Tim geführt, der im letzen Jahr mit seinem geschiedenen Vater aus Berlin nach Köln gezogen ist. Er hat eine Hauptschule ohne Abschluss verlassen und ist seither erwerbslos. Das zweite Interview in dieser Gruppe wurde mit der 25jährigen Claudia geführt. Sie ist nach einer bewegten Schul- und Ausbildungsbiographie Studentin der Sozialen Arbeit und lebt nach Umzügen innerhalb Nordrhein-Westfalens wieder in ihrer Heimatstadt Aachen. Familie Tims Familie kommt aus Köln. Er selbst ist dort geboren, doch schon als Kleinkind mit seinen Eltern und seiner Schwester nach Berlin gezogen. So ist der jüngste Umzug mit seinem Vater, nach der Trennung der Eltern, eine Rückkehr. Für Tim eine Rückkehr zu einer Familie, die er nur von Besuchen kennt: „Vater, meine Schwester, meine Muter, Tanten, Onkel, Oma, Opa, da gibt es noch sehr viele. Die sind alle hier, außer meiner Mutter und meine Schwester. Damals, als meine Schwester und ich geboren sind, da sind wir nach Berlin gezogen. Und ich jetzt mit meinem Vater zurück. Vorher war ich immer mal zu Besuch hier. Aber gewohnt ist was anderes.“ Die Entscheidung für einen Neuanfang in Köln ging von der beruflichen Mobilität seines Vaters aus. Tim ist nach einer Übergangszeit, in der er allein in dessen Berliner Wohnung lebte, seinem Vater ins Rheinland nachgezogen: „Als wir noch in Berlin gewohnt haben, da wollte ich ausziehen. Da hatte ich meine Freundin in Berlin. Und war noch chaotisch, ein bisschen. Ja. Mein Vater hat dann einen Job in Holland angenommen. Ist dann nach Köln gezogen. Und immer arbeiten und wieder zurück und wieder nach Berlin. Ich hab dann halt seine Wohnung gehabt, weil die haben getrennt gelebt, aber waren noch zusammen. Ich hab die Wohnung übernommen von meinem Vater. Hab dann da allein gewohnt, ein Jahr lang. Meine Schwester ist mit meiner Mutter in eine andere Wohnung gezogen. Und dann kam mein Vater und meinte: Willst 90 du nicht mit nach Köln? Fangen wir von vorne an? Du hast hier keine Schule. Und Verwandte helfen uns da auch. Und dann sind wir halt hierher gezogen.“ Auch Claudias Eltern leben getrennt. Allerdings schon so lange, dass sich Claudia nicht an ihren Vater erinnern kann. Für sie besteht ihre Familie aus ihrer Mutter, einem Bruder und einer Schwester: „Meine Mutter ganz klar. Und meine Schwester, die wohnt in Berlin und mein Bruder, der wohnt in Düsseldorf. (…) Mein Vater wohnt nicht mehr in Aachen, wo der wohnt ist auch nicht bekannt, ich kenne ihn leider auch nicht, meine Eltern haben sich sehr früh getrennt, als ich noch sehr klein war und ich habe keine Erinnerung an ihn. Ich bin ohne Vater ganz gut groß geworden.“ Zwischen Claudia und ihren Geschwistern besteht eine enge Bindung, gestärkt durch ihren Zusammenhalt in einer Zeit, als ihre Mutter pflegebedürftig war: „Besonders meine Geschwister bedeuten sehr viel für mich. Meine Mutter war eine Zeit sehr krank und die haben mich mit durch die Schule getragen, also haben so ein bisschen – die Mutterrolle übernommen ist jetzt Quatsch, aber wir haben schon einen sehr engen Zusammenhalt und haben schon versucht, das zusammen irgendwie hinzukriegen, diese Krankheitsphase meiner Mutter. Das hat schon zusammen geschweißt, also wir haben ein sehr gutes Verhältnis.“ Für Tim ist klar: „Familie bedeutet für jeden viel. Familie ist das Wichtigste an sich.“ Er erklärt, dass sich sein Verhältnis zur Familie nach einer schwierigen Jugendphase verbessert hat: „Ich war ein Raufbold und ein bisschen chaotisch immer. Deshalb habe ich auch keinen Schulabschluss. Das ist halt alles wieder halbwegs glatt durchgekommen.“ Auch Claudia blickt zurück auf eine Jugendphase, in der sie sich von ihrer Familie abgegrenzt hatte. Heute fühlt sie sich für die nicht vollständig genesene Mutter verantwortlich: „Als ich noch jünger war, war ich, glaube ich, eine Zeit sehr schwierig und habe mich von meiner Familie abgekapselt. Aber jetzt sehe ich meine Mutter regelmäßig und helfe ihr im Alltag. Es hat sich schon so eine Fürsorge entwickelt, was nicht war, als ich kleiner war.“ Claudia glaubt, ihrer Mutter keine Konflikte mehr zumuten zu können. Mit ihren Geschwistern kann sie aber durchaus streiten: „Wir haben tatsächlich sehr wenig Streit, mit meiner Mutter eigentlich gar nicht. Mit meinen Geschwistern schaffen wir das, in Gesprächen zu lösen. Als wir jünger waren, haben 91 wir uns gekloppt deswegen, aber heute nicht mehr. Wir können reden, da gibt es keine körperlichen Auseinandersetzungen mehr und keine verbalen Attacken oder Übergriffe. Meiner Mutter kann ich keinen Streit zumuten. Da kommt es nicht zu Streit, weil wir nicht über Themen reden, die zu Streit führen könnten. Ich geh einfach zweimal die Woche hin und mach den Einkauf.“ Für Tim beschränkt sich die familiäre Auseinandersetzung jetzt auf das alltägliche Zusammenleben mit seinem Vater, der ihm gleichberechtigt gegenüber steht: „Ich wohne mit meinem Vater zusammen in einer Zweizimmerwohnung. Ja, kleine Streits kommen immer wieder. Aber nichts Großes. Manchmal hat er Recht, manchmal hab ich Recht. Je nachdem. Vielleicht mal schlecht gelaunt, eigentlich kein Streit. Gleichberechtigt sind wir.“ Tim erwartet, dass sich an seiner familiären Situation so schnell nichts ändert, kann sich aber vorstellen, danach allein zu wohnen. „Die Schulzeit will ich auf jeden Fall noch bei meinem Vater wohnen. Wenn `s Abi wird, dauert das sowieso noch etwas länger. Ausbildung, dann so langsam in Richtung eigene Wohnung. Aber auch nicht wegen Konflikten oder so. Sondern einfach, man muss ja auf eigene Beine kommen.“ Claudia sieht, dass sich der Gesundheitszustand ihrer Mutter in Zukunft weiter verschlechtern kann und erwartet mehr Unterstützung von ihren Geschwistern: „Zu meiner Familie, die ich habe, würde ich mir wünschen, wenn meine Mutter noch mehr abhängig von Pflege wird, dass sich meine Geschwister auch einbringen könnten, noch mehr einbringen könnten. Sie hat aber auch die Gründung einer eigenen Familie im Blick und möchte mit ihrem Partner Wege finden, Beruf und Kindererziehung zu vereinbaren: „Ich möchte natürlich die klassische Familie, dass ich einen tollen Mann kennen lerne und nette zwei Kinder habe. Und wir irgendwie Arbeit und Haushalt beide stemmen und man sich beruflich und familiär verwirklichen kann. Also mein Ziel ist nicht nur zu Hause zu bleiben. Aber mein Ziel ist auch nicht nur Karriere zu machen. Ich muss da so einen Mann finden, mit dem ich so eine Mittelschiene fahren kann.“ 92 Erziehung und Bildung Claudia und Tim waren vor der Schule nicht im Kindergarten. Claudia hat das bedauert: „Nein. Ich als einzige aus der Familie nicht. Meine Mutter wollte mich irgendwie nicht gehen lassen. Meine Geschwister schon, da war ich immer sehr neidisch drauf, aber ich habe keinen Kindergarten besucht.“ Beide Jugendlichen blicken selbstkritisch auf ihre Schullaufbahn zurück. Tim beschreibt sein Scheitern an einer Hauptschule: „Das war eine schwierige Zeit. Das war noch in Berlin. Ich bin halt auf die Hauptschule gekommen. Ich war halt nicht so gut im letzen Jahr in der Grundschule. Wurde ich dann auf die Hauptschule geschickt. Da ging `s dann irgendwie. Ich hab mich hängen lassen. Ich war faul. Wollte nicht mehr. Hab einfach nicht mehr aufgepasst. Bin dann irgendwann gar nicht mehr zur Schule gegangen. Jetzt bereue ich natürlich. Ja, dann wurde ich von der Schule geschmissen. Und dann war ich natürlich zu alt. Hatte meine zehn Jahre voll. Das war einfach nur Faulheit. Und Dummheit. Hätte ich fertig gemacht, müsste ich jetzt nicht die Schule nachholen, wär` jetzt mit der Ausbildung fertig, bald, und hätte mehr Erfolg.“ Während Tim eine Hauptschule verlassen musste und noch vier Jahre später ohne Schulabschluss da steht, ist Claudia von einer Gesamtschule verwiesen worden, konnte aber danach eine Hauptschule abschließen: „Ich wurde mit sieben eingeschult. Nach der Grundschule bin ich auf eine Gesamtschule gekommen, hatte aber, als ich in der 7. Klasse war eine schwierige Phase, in der ich ungern zur Schule gegangen bin und auch so ein bisschen rebelliert habe. Ich hatte so eine Clique, mit der ich immer draußen rum hing, da war ich wirklich schwierig und musste dann auch die Schule verlassen. Dann bin ich auf die Hauptschule gekommen, wo ich auch nicht hingehen wollte. Ich hab dann da aber irgendwie meinen Abschluss bekommen, aber klar, mit wenig Einsatz.“ Im Nachhinein fallen die subjektiven Erklärungen für den Schulverweis unterschiedlich aus. Claudia blickt selbstbewusst zurück auf eine Phase jugendlicher Rebellion: „Man wollte immer von mir, dass ich auf der Gesamtschule mein Abitur mache und dass ich studiere und ich hab einfach gegen alles – was man von mir wollte, da habe ich immer das Gegenteil gemacht. Ich kann auch gar nicht so genau sagen warum. Sehr, sehr aufmüpfig, hab´s dann erst recht nicht gemacht, aus Protest einfach nicht.“ Ein Grund dafür ist, dass Claudia ihr Leben schnell wieder in den Griff bekommen hat, Tim aber ohne Schulabschluss erneut in einer Qualifizierungsmaßnahme gescheitert ist und schließlich arbeitslos wurde. Tim kann seinem unangepassten Verhalten keinen Sinn geben und urteilt mit „Faulheit“ und „Dummheit“ hart über sich. Er erzählt: 93 „Es war halt die Sache. Dieses Aufstehen morgens mochte ich nicht. Dann immer zur Schule. Kalt. Die Leute waren nett. Die Lehrer waren eigentlich auch nett. Das habe ich mir halt verscherzt mit denen. Und es ist halt gemütlicher als arbeiten, wie ich nachher gemerkt habe. Dann habe ich einen Schulkurs, das heißt vom Jugendamt so ne Maßnahme für eben schwer Vermittelbare, die eben keinen Schulabschluss machen. Die können dann eben nach machen, müssen aber gleichzeitig arbeiten. War ich in so einer Maßnahme halt. Aber das war dann gar nichts für mich. Weil die vier Tage in der Woche Arbeit, einen Tag Schule und das halt drei Jahre lang, bis ich meinen Hauptschulabschluss hab. Und da hatte ich keine Lust drauf. Weil ich halt nur den Hauptschulabschluss machen wollte und nicht nebenbei noch arbeiten jeden Tag. Ich wollte eigentlich nur meine Schule nachmachen. Man hätte auch eine Tischlerausbildung bekommen. Aber das ist gar nicht mein Ding. Mehr so Computer, Büro, so ne Richtung. Ja und dann hat mir auch nicht gefallen. Hab ich gefragt, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt. Ja, andere Möglichkeit gab`s nicht. Nur mit Werkstätten, das gleiche eigentlich. Dann habe ich das abgebrochen, drei vier Monate. Da war ich 17. Dann war ich ziemlich lange arbeitslos. Ich glaube zwei Jahre habe ich nichts gemacht. Jeden Monat habe ich Bewerbung geschrieben, dann halt Ausbildung, Friseur, bei der Stadtreinigung - wo man halt nicht hohe Ansprüche braucht. Aber immer abgelehnt. Im Nachhinein ist auch klar warum. Schlechtes Zeugnis, bin halt nie da gewesen. So einen will ja keiner haben.“ Aber auch für Claudia hatte ihr Schulverweis einen Preis: „Ich hab auch viele Freunde zurück gelassen. Die meisten haben nicht so übertrieben wie ich. Die haben Sachen angestellt oder sind zur Schule gegangen, aber sind im Rahmen geblieben. Ich hab in der Zeit ein bisschen zu Extremen geneigt, glaube ich. Da hatte ich auch meine ersten Erfahrungen mit Alkohol, habe das erste Mal irgendwie gekifft und ja.“ Obwohl Claudia klar ihre individuelle Verantwortung für diese Phase sieht, kann sie doch auch Kritik an der Schule üben, deren plötzliche Konsequenz ihr früher hätte deutlich gemacht werden können: „Ich finde Gesamtschule ist eigentlich ein ganz gutes Konzept und ich hatte auch ganz gute Lehrer. Was für mich nicht so gut war, es war sehr offen, da wurde noch mal drüber geredet und ich habe erst sehr spät die Konsequenz gespürt mit dem Schulverweis. Auf der Gesamtschule wird halt gerne diskutiert und ich habe das nicht ernst genommen. Das war für mich nicht so, nicht so gut. Wäre ich mal für eine kurze Zeit von der Schule verwiesen worden, beurlaubt worden, das hätte vielleicht gereicht, um mich wach zu rütteln. Aber diese ganzen Gespräche mit den Lehrern, wo keine Konsequenz folgt, also für mich in der Zeit, kommt ja immer auf den Menschen an, war es keine Hilfe.“ Übergang von der Schule in den Beruf Der von Claudia mit geringem Einsatz erreichte Hauptschulabschluss hat ausgereicht, um eine Ausbildung als Zahnarzthelferin zu machen, die sie auch dazu animiert hat, ihr Abitur nachzuholen und schließlich einen Studiengang zu wählen, der ihren Fähigkeiten mehr entspricht: 94 „Ich hab dann eine Ausbildung angefangen, weil, ich hatte überhaupt keine Lust mehr auf Schule, das ging mir alles auf die Nerven. Ich wollte arbeiten und mein Geld verdienen. Ich hab dann eine Ausbildung als Zahnarzthelferin angefangen, hab die auch beendet, lief zwischendurch auch ganz gut. Ich hab zwischenzeitlich dann auch meine Quali für das Abi nachgeholt, während der Ausbildung und hab mich eigentlich schon im ersten Lehrjahr entschlossen, dass ich mein Abi nachhole, weil mir das nicht genug war. Also ich hatte schon nach dem ersten Lehrjahr das Gefühl, das nicht mehr so viel kommt, das ich nicht mehr viel lerne. Das ist auch nicht ein Beruf, der mir liegt. Das sind eher so Handlangertätigkeiten. Ich arbeite lieber selbständig. Dann habe ich mein Abitur auf einem Kolleg nachgeholt, direkt im Anschluss und hab immer nebenbei gejobbt und habe danach angefangen zu studieren. Es war mir klar, dass mir das liegt, der soziale Bereich. Ich hab schon vor dem Studium in der OT gearbeitet und kann ganz gut mit Menschen umgehen, finde da ganz gut Bezug, hab ganz gut Kontakt und deswegen habe ich für das Studium der Sozialen Arbeit entschlossen. Über einen Umweg. Aber ich glaub, das musste auch sein, sonst hätte ich das nicht so zu würdigen gewusst.“ An einer anderen Stelle betont Claudia noch einmal, dass sie ihren Weg für sich gehen musste und das erst konnte, nachdem die Erwartungshaltung ihrer Familie nachgelassen hatte: „Und als die mich alle in Ruhe gelassen haben, sich schon damit abgefunden hatten, dass ich Zahnarzthelferin werde, da hatte ich für mich die Ruhe darüber nachzudenken, dass ich für mich einen anderen Weg gehe.“ Tims Vorstellungen von seinem Übergang in den Beruf sind noch unbestimmt. Er hat die Absicht, seinen Schulabschluss nachzuholen, und auch eine Möglichkeit dazu in Köln gefunden: „Zurzeit habe ich keine Arbeit, keine Schule und meinen Abschluss habe ich auch noch nicht. Allerdings habe ich meinen festen Schulplatz. Im Februar fange ich den an. Dann möchte ich – das ist eine Abendschule. Dann werde ich meinen Real erstmal nach machen. Abi möchte ich vielleicht versuchen. Kommt eben drauf an.“ Was danach kommt ist für Tim noch ungewiss: „Am liebsten wäre mir natürlich was, was mit meinem Hobby in Verbindung geht. Beziehungsweise Computer, Musik, technisch, Audio. Aber mir würde auch Spaß machen, Verkäufer also. Einzelhandelskaufmann könnte auch was sein. Aber da bin ich noch offen. Ich will mich erst mal auf die Schule voll konzentrieren. Mehr gar nicht denken. Und wenn ich dann das letzte Jahr angehe, dann werde ich mir Gedanken machen, was ich genau will, was ich mir jetzt für die nächsten zwanzig Jahre vorstellen und dann durchziehen.“ Vorbilder hat Tim nicht, aber große Ambitionen: „Ne, Vorbilder habe ich nicht. Keine Ahnung. Ich will einfach nur mein Hobby zum Beruf machen. Musik halt.“ 95 Soziale Netzwerke Tim hat in Köln noch keine neuen Freundschaften aufbauen können, hat aber noch Kontakt zu Freunden aus seiner Schulzeit in Berlin. „Ja, die Freunde in Berlin. Das sind noch ziemlich viele. Die bleiben auch Freunde. Die kommen mich auch besuchen. Halt selten, wegen Arbeit und so. Ist klar. Aus der Grundschule noch, aus der Oberschule. Das ist halt so, Freunde, die ich schon zehn Jahre kenne oder so. Zwei davon sind auch arbeitslos. Die aber nicht so denken wie ich. Also die, hocken immer zu Hause. Ich bin derjenige, der zu denen sagt, Jungs wird mal Zeit.“ Soziale Bezugspunkte in Köln hat Tim noch nicht. Er hält sich mehr für einen „Einzelgänger, der viel Zeit am Computer verbringt.“ Claudia pflegt alltäglich langfristige Beziehungen zu drei Freundinnen, die sie zu verschiedenen Zeiten ihrer Schullaufbahn kennen gelernt hat. „Ich hab drei sehr gute Freundinnen, die ich in unterschiedlichen Lebensphasen kennen gelernt habe, die mir aber alle drei sehr wichtig sind, die eigentlich schon fast meine Familie sind. Wir telefonieren täglich und sehen uns sehr oft. (…) Eine Freundin habe ich kennen gelernt in der Grundschule schon, in der Grundschulzeit, die hat mit mir im gleichen Stadtteil gewohnt. Die andere in der Gesamtschule dann, die dritte erst, als ich mein Abitur nachgeholt habe. Aber wir sind trotzdem sehr gut befreundet. Die kennen sich zwar untereinander, aber haben nichts miteinander zu tun.“ Wichtig sind Claudia auch ihr Partner und ihre Arbeitskollegen. Doch Studium und Job zu vereinbaren, verlangt von ihr ein Zeitmanagement, das die Beziehungen einschränkt: „Dann gibt es auch diese Bekannten, mit denen man ab und zu mal rausgeht, aber die zählen nicht zum Netzwerk. Mein Partner ist für mich ein bisschen Familie geworden. Und ich hab nette Arbeitskollegen, mit denen ich auch was mache. Beschränkt sich aber auf Leute, mit denen man echt gern was macht. Nicht mehr wie früher in Cliquen rumhängen, die Zeit, die fehlt. Die Zeit, die man übrig hat, will man dann auch mit Menschen verbringen, die einem wirklich wichtig sind. Dadurch schränkt sich das immer mehr ein.“ Vergleich zwischen Jugendlichen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte Tim weiß davon, dass Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sein können. „Kommt halt auf die Leute an, die außerhalb stehen, nicht in der Familie und so. Zum Beispiel die Arbeitgeber. Es gibt solche, die wollen keine Ausländer haben. Das habe ich oft erlebt in Berlin.“ 96 Mehr hat Tim zu diesem Thema nicht zu sagen. Claudia hat die Erfahrung gemacht, dass Zugewanderte auf dem Wohnungsmarkt diskriminiert werden und nimmt auch an, dass mangelnde Deutschkenntnisse in der Schule zum Problem werden: „Ich hab `s sehr viel leichter. Also es fängt an bei Wohnungssuche. Da hilft ein deutscher Name ungemein, habe ich festgestellt. Wir haben mal so einen Test gemacht. Also meine Freundin hat einen ausländischen Nachnamen. Und da war die Wohnung schon weg am Telefon. Wenn ich angerufen habe, konnte man sich die noch angucken. Also man merkt wirklich, dass viele Vorbehalte gegenüber Menschen haben, die keine deutschen Pass haben, mit Sprachproblemen. Auch in der Schule. Die sind ja nicht alle doof. Die haben einfach Probleme mit der Sprache. Und das zieht so einen Rattenschwanz hinter sich her, finde ich. Es kostet sehr viel Mühe und Anstrengung da raus zu kommen. Die müssen sich sehr viel mehr Mühe geben, um das gleiche zu erreichen, glaube ich.“ Ihrer Einschätzung nach haben die Haar- und Hautfarbe in der Wahrnehmung der sozialen Umwelt große Bedeutung, was sie völlig unangemessen findet: „Menschen, die einfach nur schwarze Haare haben, sind ja fast schon akzeptiert. Aber wenn man dann noch eine dunkle Haut hat, ist es ja noch schlimmer. Gerade diese äußeren Faktoren spielen, was ich mitbekomme, eine total große Rolle, was eigentlich in einem freien oder demokratischen Land wie Deutschland schade ist.“ 97 5. Fazit Die empirische Erkundung der subjektiven Sichtweise von Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte mit qualitativen Methoden konnte und wollte keine repräsentativen Ergebnisse liefern. Vielmehr sollte sich die Befragung auf die Lebenswelt der Jugendlichen und ihre subjektive Sichtweise einlassen, ohne Beschränkungen theoretischer Vorannahmen. So sind die Ergebnisse dieses explorativen Vorgehens selbst noch hypothetisch, mit Einzelfällen begründete Annahmen zur subjektiven Sicht von Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte auf ihr Lebensumfeld. Angenommen wurde, dass die subjektive Perspektive der Jugendlichen durch die Form ihrer Zuwanderung objektiv vorstrukturiert ist. Diese Annahme hat sich in der Auswertung der Leitfadeninterviews nur partiell bestätigt. Auffällig ist zwar, dass sich die Aufenthaltsdauer der befragten Jugendlichen in den drei Gruppen unterscheidet: Beide Nachkommen der Arbeitsmigrant(inn)en wurden in Deutschland geboren, die befragten Jugendlichen, die als Asylsuchende nach Nordrhein-Westfalen gekommen sind, leben bereits seit ihrem fünften bzw. sechsten Lebensjahr hier. Später, im Alter von elf bzw. zwölf Jahren, sind die befragten Jugendlichen zugewandert, die zu den Spätaussiedler/innen gehören. Die Befragten zeigen aber, wie einheimisch deutsche Jugendliche, individuell verschiedene Perspektiven auf ihr Lebensumfeld, die sich nicht primär auf die Form ihrer Zuwanderung zurückführen lassen. Tatsächlich sind ja auch die rechtlichen Rahmenbedingungen für Aufenthalt und Arbeitsmarktzugang aller interviewten Jugendlichen gleich. Bis auf Amir verfügen alle über die deutsche Staatsangehörigkeit und auch Amir kann und will sich einbürgern lassen, wenn er seinen irakischen Pass vorlegen kann. Signifikante Unterschiede wären sicher festzustellen gewesen, wenn etwa geduldete Flüchtlinge oder Neuzugewanderte befragt worden wären. Hier wird vielmehr deutlich, dass auch Asylmigration zu einem dauerhaften Aufenthalt, zu Integration und Einbürgerung führen kann. Die Befragung hat die Ergebnisse sowohl der erwähnten quantitativ als auch der qualitativ orientierten Studien weitestgehend bestätigt: Familie, Erziehung und Bildung, der Übergang von der Schule in den Beruf sowie soziale Netzwerke, also Freundschaften bzw. Peergroups sind zentrale Felder des Lebensumfeldes von Kindern und Jugendlichen sowohl mit als auch ohne Zuwanderungsgeschichte. Die Aussagen der Jugendlichen verdeutlichen exemplarisch, wie sie sich in jedem dieser Felder zwischen Autonomie und Anpassung bewegen und ganz unterschiedliche Bewältigungsformen entwickelt haben. 98 Alle befragten Jugendlichen haben – ähnlich wie die Befragten in der Shell-Studie (2006) – eine hohe emotionale Bindung an ihre Familie beschrieben. Konflikte bleiben nicht aus, wo die Erwartungen der Eltern den Interessen der Jugendlichen widersprechen. Elizabeta räumt z.B. Schwierigkeiten bei der ihrem Alter entsprechenden Lösung von der Mutter ein und reagiert nach eigenen Angaben im Streitfall mit Rückzug. Karim sieht sich vom Vater noch „wie ein Baby behandelt“, demonstriert aber Gelassenheit, vielleicht weil ihm das gar nicht missfällt. Egon kennt Konflikte um seinen Schulerfolg und seine Freizeitgestaltung, überlässt die Kontroverse mehr oder weniger seinen (Groß-)Eltern, denn der autoritären Haltung des Einen steht die Fürsorge der Anderen gegenüber. Marta weiß lebendig ausgetragene Konflikte in ihrer Familie offenbar zu schätzen und mit Leidenschaft auszutragen. Aicha versteht, dass ihre Eltern sie aus Angst mit zahlreichen Verboten einschränken und übt sich meist in Gehorsam, hat aber auch schon die Strategien erprobt, eine Freundschaft zu verheimlichen. Ihre Erzählung macht darauf aufmerksam, dass es junge Mädchen im Einwanderungsland gibt, die den kulturell begründeten Erziehungsstil der Eltern als Einschränkung ihrer individuellen Freiheit erleben und darunter leiden. Aicha tröstet sich in der Hoffnung auf mehr persönliche Freiheit, wenn sie volljährig wird. Amir demonstriert Coolness und Gleichgültigkeit gegenüber harten Strafen. Claudia vermeidet Konflikte, weil sie davon ausgeht, dass sie ihrer Mutter keinen Streit zumuten kann. Tim blickt schließlich zurück auf sein Scheitern in der Schule und beim Übergang von der Schule in den Beruf und distanziert sich davon mit Schuldzuweisungen an sich selbst und großen Ambitionen für die Zukunft. Hier zeigt sich, dass die Familie ein Konflikt- und Reibungsfeld ist, in dem Kinder und Jugendliche mit und ohne Zuwanderungsgeschichte sehr individuell agieren, d.h. mal autonomieorientiert, mal angepasst und mal mit Rückzugstendenzen. Im Lebensumfeld Schule erleben die Jugendlichen einen dreifachen Anpassungsdruck. Die bloße Anwesenheitspflicht kann in der subjektiven Sicht der Jugendlichen als Einschränkung ihrer Selbstbestimmung wahrgenommen werden. Egon, Claudia und Tim haben sich dem entzogen, ihre regelmäßige Teilnahme am Unterricht mehrfach verweigert und das mit „Faulheit“, „Dummheit“ oder „Rebellion“ begründet. Hier zeigt sich sehr deutlich, wie auch schon Jugendliche im Zuge der Individualisierung die eigene Verantwortung für sozialisatorische Einflüsse übernehmen. So werden Schulprobleme – ähnlich wie Arbeitslosigkeit – individualisiert. Die daraus resultierenden Folgeprobleme sind den Jugendlichen mehr oder weniger klar, doch in ihren Augen können sie phasen- oder situationsbezogen nicht anders handeln, ohne genau zu wissen, warum. Die zweite Form des schulischen Anpassungsdrucks ist der Leistungsdruck. In der 99 Erzählung von Elizabeta wird anschaulich, dass ihr der Leistungsdruck beim Übergang in die Sekundarstufe noch fremd gewesen ist. Mit der Zeit und mit Erfolgen, die sie hatte und hat, konnte sie sich aber den Leistungsanspruch ihrer Schule zu Eigen machen und in ihr Selbstverständnis integrieren. Das ist bei Egon ganz anders, der einen Leistungsdruck erst mit Blick auf die zentrale Abschlussprüfung der Fachoberschulreife an seiner Hauptschule empfindet und sich diesem zu entziehen weiß, weil er sein Scheitern antizipiert. An seiner Erzählung wird deutlich, was auch die Aussagen von Marta, Aicha und Amir zeigen: das Erlernen der deutschen Sprache ist für Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte, insbesondere für die, die selbst erst im schulpflichtigen Alter einwandern, das zentrale Integrationsproblem. Eine erfolgreiche Lösung für dieses Problem hat die Schulorganisation in Nordrhein-Westfalen bisher nicht gefunden. In der subjektiven Sicht der Jugendlichen ist weder eine separate Eingangsklasse für Seiteneinsteiger/innen erfolgreich, wenn, wie bei Egon, die Jugendlichen gleicher Herkunft in den separaten Gruppen umgangssprachlich ihre Herkunftssprache sprechen. Und auch die Alternative, die sofortige Aufnahme in eine Regelklasse, muss zu einem Fehlstart führen, wenn das Kind wie Aicha einfach dazu kommt, zusieht und nichts versteht. Schließlich haben die Interviewten einen Anpassungsdruck im Klassen- oder Stufenverband, in der sozialen Gruppe der Schülerinnen und Schüler erfahren. Der kann, wie bei Karim, in der subjektiven Sicht der Jugendlichen zum Hauptmerkmal des schulischen Lebensumfeldes werden. Aus Sicht der Jugendlichen üben auch die notwendigen Entscheidungen im Wettbewerb um Ausbildungs- und Schul- und Studienplätze Druck aus. Manche Jugendlichen haben konkrete Vorstellungen von ihrem Übergang in den Beruf geäußert, wie Karim, der über Freundeskreise auf ein konkretes Berufsbild gekommen ist, oder Elizabeta, deren Schullaufbahn und Freizeitaktivitäten auf ein bestimmtes Berufsbild hinauslaufen. Andere haben wie Amir noch recht zufällig anmutende Vorstellungen von ihrer beruflichen Zukunft oder auch gar keine wie Aicha. Selbstverständlich scheint, dass Jugendliche auf die unsichere Marktlage reagieren, indem sie sich zur Sicherheit zeitgleich um einen Schulplatz an einem Berufskolleg bewerben. Dabei haben sie vielleicht auch nur diffuse Vorstellungen von Inhalten und Zielen dieses Bildungsgangs. Die berufliche Mobilität war bei allen befragten Jugendlichen, bis auf Marta, durch ihre enge Bindung an die Familie und den vertrauten Sozialraum sehr eingeschränkt. Allochthone Jugendliche sind aufgrund ihrer Zuwanderungsgeschichte (der Eltern) keineswegs mobiler als einheimische Deutsche. Wer Vorbilder benannt hat, hat sich an konkreten Personen, zumeist Pädagog(inn)en oder Familienangehörigen, orientiert. 100 Nachbarschaft, „die Straße“ und Schule sind in der Lebenswelt Jugendlicher die sozialen Orte, um Freundschaften zu knüpfen und zu pflegen. Dabei können die Freundeskreise primär oder sogar ausschließlich aus der eigenen Herkunftsgruppe kommen, wie bei Aicha oder auch explizit Herkunftsgrenzen überschreiten, wie bei Amir. Es kommt auch vor, dass Jugendliche wie Tim bevorzugen, ihre Freizeit lieber allein mit elektronischer Unterhaltung zu verbringen. Wenige der befragten Jugendlichen waren wie Marta und Karim in einem Verein, einer Gemeinde oder sonst wo organisiert. Alle gingen von einem engen Politikbegriff aus, wobei Politik das ist, was in Nachrichten vorkommt. Damit konnte keiner der befragten Jugendlichen etwas anfangen. Gerade Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte haben in diesem Zusammenhang aber darauf verwiesen, dass sie die Möglichkeit, ihre Meinung frei zu äußern, sehr schätzen, auch wenn sie davon bisher nur wenig Gebrauch gemacht haben. Damit wird auch die in der Shell-Studie (2006) erwähnte, überwiegende Akzeptanz der demokratischen Grundwerte seitens der Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte betätigt. Für alle befragten Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte gilt, dass sie um die Zuschreibung als „Problemgruppe“ im politischen und pädagogischen Kontext wissen und bemüht sind, diese Zumutung zurückzuweisen und als „normale“ Jugendliche wahrgenommen zu werden. Ihre Aussagen lassen auf eine hohe Identifikation mit dem Einwanderungsland Deutschland schließen und zeigen keine Anzeichen für eine bewusste Abgrenzung in eine „Parallelgesellschaft“. Konfrontationen zwischen Jugendgruppen verschiedener Herkunft sind ihnen genauso vertraut wie Solidarität zwischen Jugendlichen mit vergleichbarer Zuwanderungsgeschichte. Alle Jugendlichen beschreiben verschiedene Erziehungsstile in zugewanderten und einheimisch deutschen Familien und halten dabei die einheimisch deutschen Familien tendenziell für liberaler. Der Erwerb der deutschen Sprache stellt für Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte die größte Schwierigkeit dar. Selbst bei fortgeschrittenen Deutschkenntnissen empfinden sie einen Mangel im Vergleich zu „Native Speakern“. Dabei wird der Umstand, dass sie in ihren Familien und Peergroups zumeist die Herkunftssprache sprechen, ambivalent beurteilt. Denn einerseits wissen sie die Vertrautheit mit der Sprache zu schätzen. Andererseits ist ihnen durchaus bewusst, dass sie ihre Deutschkenntnisse dadurch nicht verbessern. 101 Anhang 1: „Die subjektive Sicht von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte auf ihr Lebensumfeld.“ Expertise zum 9. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Nordrhein-Westfalen Interviewleitfaden Einleitende Worte: Vorstellung und Verwendung der Daten 1. Eröffnungsfragen • Am Anfang möchte ich dich bitten, deine aktuelle Lebenssituation kurz zu beschreiben… • Was ist im Moment besonders wichtig für dich? • Gibt es ein akutes Problem, das du lösen musst? • Gibt etwas, das dir im Alltag besondere Freude macht? 1. • • • • • Familie Wer gehört zu deiner Familie? Was bedeutet deine Familie für dich? Hat sich dein Verhältnis zu deiner Familie in den letzen Jahren verändert? Wenn es einmal Streit gibt, wie wird das dann gelöst? • Welche Bedeutung hat deine Meinung in so einem Fall? Wie stellst du dir das Verhältnis zu deiner Familie vor, wenn du erwachsen wirst? 3. Erziehung und Bildung • Hast du früher, als du ein Kind gewesen bist, einen Kindergarten besucht? § Wenn ja, welche Erinnerung hast du an deine Kindergartenzeit? • Wie fühlst du dich, wen du morgens zur Schule (oder) zur Arbeit gehst? • Gibt es etwas, dass du richtig gut findest an der Schule (oder) deiner Arbeit? • Und umgekehrt: Gibt es etwas, dass du ganz schlecht findest an der Schule / deiner Arbeit? • Wie würdest du deine bisherige Schullaufbahn beschreiben? 4. Übergang von der Schule in den Beruf • Weißt du heute schon, was du nach der Schule machen möchtest? (oder) Weißt du noch, wie du dich nach der Schule für deine Arbeit entschieden hast? • Fühlst du dich durch die Schule gut vorbereitet auf deine Berufswahl? (oder) Hast du dich durch die Schule gut auf deine Berufswahl vorbereitet gefühlt? • Gibt es ein Vorbild für dich? Einen Menschen der beruflich macht, was du dir für dich auch vorstellen kannst? 102 • Kannst du dir vorstellen für deine Ausbildung umzuziehen? 5. • • • • • Soziale Netzwerke Gibt es Menschen außerhalb deiner Familie, die dir wichtig sind? Wie hast du die kennen gelernt? Was machst du gemeinsam mit deinen Freunden/Freundinnen? Hat dein Freundeskreis Einfluss darauf, wie du die Dinge siehst? Bist du in einem Verein, einer Gemeinde, einem Jugendhaus oder sonst wo regelmäßig aktiv? Hast du das Gefühl, dich politisch einbringen zu wollen und zu können? • 6. Vergleich Zuwanderung/Einheimisch • Wenn du deine Lebenssituation mit der von einheimisch deutschen (oder) zugewanderten Jugendlichen vergleichst: o Hat es Vorteile für dich, dass deine Familie (nicht) in Deutschland eingewandert ist? o Hat es Nachteile für dich, dass deine Familie (nicht) in Deutschland eingewandert ist? 7. Abschlussfrage • Gibt es etwas, das für deine Sicht auf dein Leben noch wichtig ist? • Möchtest du etwas ergänzen oder noch erzählen? Personendaten: Alter Geschlecht Zuwanderungsgeschichte Schule/Beruf 103 Literatur Apitzsch, Ursula (1996): Biographien und berufliche Orientierung von Migrantinnen, in: Ralph Kersten/Doron Kiesel/Sener Sargut (Hrsg.): Ausbilden statt Ausgrenzen. Jugendliche ausländischer Herkunft in Schule, Ausbildung und Beruf. Frankfurt/Main. Beck, Ulrich (1986): Die Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt/Main. Beck, U. (1993): Die Erfindung des Politischen. Frankfurt/Main. Beck, Ulrich (1996): Das Zeitalter der Nebenfolgen und die Politisierung der Moderne. In: Ulrich Beck/Anthony Giddens/Scott Lash (Hg.): Reflexive Modernisierung. Eine Kontroverse. Frankfurt/Main, S. 19-112. Beck, Ulrich (1997a): Kinder der Freiheit. Wider das Lamento über den Werteverfall. In: ders. (Hrsg.): Kinder der Freiheit. Frankfurt/Main, S. 9-33. Beck, Ulrich (1997b): Die uneindeutige Sozialstruktur. Was heißt Armut, was Reichtum in der „Selbst-Kultur“? In: ders/Peter Sopp (Hrsg.): Individualisierung und Integration. Neue Konfliktlinien und neuer Integrationsmodus? Opladen, S. 183-197. Beck, Ulrich (1997c): Ursprung als Utopie: Politische Freiheit als Sinnquelle der Moderne. In: ders. (Hrsg.): Kinder der Freiheit. Frankfurt/Main, S. 382-402. Bernstein, Basil (1971): Sozio-kulturelle Determinanten des Lernens mit besonderer Berücksichtigung der Rolle der Sprache. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 4, S. 52-79. Bolder, Axel (1987): Bildungsentscheidungen im Arbeitermilieu, Frankfurt/New York. Bommes, Michael (1996): Ausbildung in Großbetrieben. Einige Gründe, warum ausländische Jugendliche weniger Berücksichtigung finden. In: Ralph Kersten/Doron Kiesel/Sener Sargut (Hrsg.): Ausbilden statt Ausgrenzen. Jugendliche ausländischer Herkunft in Schule, Ausbildung und Beruf. Frankfurt/Main. Bommes, Michael/Radtke, Frank-Olaf (1993): Institutionelle Diskriminierung von Migrantenkindern. Die Herstellung ethnischer Differenz in der Schule. In: Zeitschrift für Pädagogik, 39, Heft 3, S. 483-497. Bourdieu, Pierre (1983): Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. In: Reinhard Kreckel (Hrsg.): Soziale Ungleichheiten. Göttingen, Soziale Welt Sonderband 2. 104 Bourdieu, Pierre (1987): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt/Main. Bozay, Kemal (2005): „… ich bin stolz, Türke zu sein!“ Ethnisierung gesellschaftlicher Konflikte im Zeichen der Globalisierung. Schwalbach/Ts. Bukow, W.-D./Ottersbach, Markus (1999) (Hrsg.): Der Fundamentalismusverdacht. Plädoyer für eine Neuorientierung der Forschung im Umgang mit allochthonen Jugendlichen. Opladen. Bukow, Wolf-Dietrich/Jünschke, Klaus/Spindler, Susanne/Tekin, Ugur (2003): Ausgegrenzt, eingesperrt und abgeschoben. Migration und Jugendkriminalität. Opladen. Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.): Analytikreport der Statistik 04/2008. Brettfeld, Katrin/Wetzels, Peter (2007): Muslime in Deutschland – Integration, Integrationsbarrieren, Religion sowie Einstellungen zu Demokratie, Rechtsstaat und politisch-religiös motivierter Gewalt. Ergebnisse von Befragungen im Rahmen einer multizentrischen Studie in städtischen Lebensräumen. Hrsg. vom Bundesministerium des Innern. Berlin. Deimann, Andreas (2007): Eine Möglichkeit sozialer Integration im deutschen Asyl. Ergebnisse der empirischen Begleitforschung zum Modellprojekt Sprach- und Kulturmittler/-innen der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft TransKom. In: Niels-Jens Albrecht/Theda Borde (Hrsg.): Interdisziplinäre Reihe Migration – Gesundheit – Kommunikation. Band 5: Netzwerke und didaktische Konzepte. Frankfurt am Main, S. 66-118. Deimann, Andreas/Ottersbach, Markus (2003): Die Unterrepräsentation von Migranten im ITSektor: theoretische Aspekte und praktische Lösungsstrategien. In: IMIS-Beiträge, Heft 22, S. 65-80. Deimann, Andreas/Ottersbach, Markus (2005): Migration, berufliche Bildung und biographische Unsicherheit. Ergebnisse der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft openIT. Hrsg. vom Landeszentrum für Zuwanderung NRW, Solingen. Deimann, Andreas/Ottersbach, Markus (2006):) Risiken und Chancen in Biographieverläufen hoch qualifizierter Migrant(inn)en. In: Karl-Siegbert Rehberg (Hrsg.): Soziale Ungleichheit Kulturelle Unterschiede, Verhandlungen des 32. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in München 2004, Frankfurt/New York, CD-Beilage. Deimann, Andreas/Ottersbach, Markus (2007): Chancen und Barrieren eines beruflichen Arrangegements. In: Wolf-D. Bukow/Claudia Nikodem/Erika Schulze/Erol Yildiz (Hrsg.): Was heißt hier Parallelgesellschaft? Zum Umgang mit Differenz. Wiesbaden, S. 229-243. Flick, Uwe u.a. (Hrsg.) (1995): Handbuch qualitative Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, 105 Methoden und Anwendungen. Weinheim. Foucault, Michel (1986): Die Sorge um sich. Sexualität und Wahrheit. Bd 3. Frankfurt/Main. Fuchs, Martin/Berg, Eberhard (1993): Phänomenologie der Differenz. Reflexionsstufen ethnographischer Repräsentation. In: Eberhard Berg/Martin Fuchs (Hrsg.): Kultur, soziale Praxis, Text. Die Krise der ethnographischen Repräsentation. Frankfurt/Main. Gensicke, Thomas (2006): Jugend und Religiosität. In: Shell Deutschland Holding (Hrsg.): Jugend 2006. Eine pragmatische Generation unter Druck. Frankfurt/Main, S. 203-239. Geißler, Rainer (2006): Die Sozialstruktur Deutschlands. Zur gesellschaftlichen Entwicklung mit einer Bilanz zur Vereinigung. Wiesbaden. Gomolla, Mechthild/Radtke, Frank-Olaf (2002): Institutionelle Diskriminierung – Die Herstellung ethnischer Differenz in der Schule. Opladen. Granato, Mona (2006): Ungleichheiten beim Zugang zu einer beruflichen Ausbildung: Entwicklungen und mangelnde Perspektiven für junge Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. In: Maurizio Libbi/Nina Bergmann/Vincenzo Califano (Hrsg.): Berufliche Integration und plurale Gesellschaft. Zur Bildungssituation von Menschen mit italienischen Zuwanderungsgeschichte. DGB-Bildungswerk, Bereich Bildung und Qualifizierung. Gross, Peter (1985): Bastelmentalität: Ein „postmoderner“ Schwebezustand. In: Thomas Schmid (Hrsg.): Das pfeifende Schwein. Berlin, S. 63-84. Habermas, Jürgen (1988) Theorie des kommunikativen Handelns. Bd I und Bd II. Frankfurt/Main. Heitmeyer, Wilhelm (Hrsg.) (1994): Das Gewalt-Dilemma. Franfurt/Main. Heitmeyer, Wilhelm (Hrsg.) (1996): Die bedrängte Toleranz. Ethnisch-kulturelle Konflikte, religiöse Differenzen und Gefahren politisierter Gewalt. Frankfurt/Main. Heitmeyer, Wilhelm/Müller, Joachim/Schröder, Helmut (Hrsg.) (1997): Verlockender Fundamentalismus. Türkische Jugendliche in Deutschland. Frankfurt/Main. Imdorf, Christian (2008): Migrantenjugendliche in der betrieblichen Ausbildungsplatzvergabe – auch ein Problem für Kommunen. In: Michael Bommes/Marianne Krüger-Potratz (Hrsg.): Migrationsreport 2008 – Fakten – Analysen – Perspektiven. Frankfurt/New York, S. 113-158. Kaufmann, Jean-Claude (2005): Die Erfindung des Ich. Eine Theorie der Identität. Konstanz. King, Vera (2006): Ungleiche Karrieren. Bildungsaufstieg und Adoleszenzverläufe bei jungen Männern und Frauen aus Migrantenfamilien. In: Vera King/Hans-Christoph Koller (Hrsg.): 106 (2006): Adoleszenz – Migration – Bildung. Bildungsprozesse Jugendlicher und junger Erwachsener mit Migrationhintergrund. Wiesbaden, S. 27-46. Langness, Anja/Leven, Ingo/Hurrelmann, Klaus (2006): Jugendliche Lebenswelten: Familie, schule, Freizeit. In: Shell Deutschland Holding (Hrsg.): Jugend 2006. Eine pragmatische Generation unter Druck. Frankfurt/Main, S. 49-102. Leisering, Lutz (1997): Individualisierung und »sekundäre Institutionen« – der Sozialstaat als Voraussetzung des modernen Individuums. In: Ulrich Beck/Peter Sopp (Hrsg.): Individualisierung und Integration. Neue Konfliktlinien und neuer Integrationsmodus? Opladen, S. 143159. Lübcke, Claudia (2007): Jugendkulturen junger Muslime in Deutschland. In: Hans-Jürgen von Wensierski/Claudia Lübcke (Hrsg.) (2007): Junge Muslime in Deutschland. Opladen, S. 285318. Mertol, Birol (2007): Männlichkeitskonzepte von Jungen mit türkischem Migrationshintergrund. In: Hans-Jürgen von Wensierski/Claudia Lübcke (Hrsg.) (2007): Junge Muslime in Deutschland. Opladen, S.173-194. Merton, Robert King/Kendall, Patricia (1979): Das fokussierte Interview. In: C. Hopf/E. Weingarten (Hrsg.): Qualitative Sozialforschung. Stuttgart, S. 171-204. Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration (Hrsg.) (2008): NordrheinWestfalen: Land der neuen Integrationschancen. 1. Integrationsbericht der Landesregierung. Düsseldorf Nökel, Siegfried (2007): Neo-Muslimas – Alltags- und Geschlechterpolitiken junger muslimischer Frauen zwischen Religion, Tradition und Moderne. In: Hans-Jürgen von Wensierski/Claudia Lübcke (Hrsg.) (2007): Junge Muslime in Deutschland. Opladen, S.135-154. Ottersbach, Markus (2003): Außerparlamentarische Demokratie. Die neuen Bürgerbewegungen als Herausforderung an die Zivilgesellschaft, Frankfurt/New York. Ottersbach, Markus (2004): Die Marginalisierung städtischer Quartiere in der metropolitanen Gesellschaft unter besonderer Berücksichtigung der Migration. In: Markus Ottersbach/Erol Yildiz (Hrsg.): Migration in der metropolitanen Gesellschaft. Zwischen Ethnisierung und globaler Neuorientierung. Münster, S. 103-116. 107 Ottersbach, Markus (2008): Jugendliche in marginalisierten Quartieren Deutschlands. In: Markus Ottersbach/Thomas Zitzmann (Hrsg.): Jugendliche im Abseits. Zur Situation in französischen und deutschen marginalisierten Quartieren. Wiesbaden, S. 51-74. Ottersbach, Markus (i.E.): Bildung, Ausbildung und Arbeit: Institutionalisierte Sackgassen für Jugendliche und junge Heranwachsende mit Zuwanderungsgeschichte. In: Wassilios Baros/ Franz Hamburger/Paul Mecheril (Hrsg.): Zwischen Praxis, Politik und Wissenschaft. Die vielfältigen Referenzen Interkultureller Bildung (Arbeitstitel). Berlin. Ottersbach, Markus/Yildiz, Erol (1997): Der Kommunitarismus: eine Gefahr für das Projekt der pluralistischen Demokratie? In: Soziale Welt, Heft 3, S. 291-312. Pott, Andreas (2006): Tochter und Studentin – Beobachtungen zum Bildungsaufstieg in der zweiten türkischen Migrantengeneration. In: Vera King/Hans-Christoph Koller (Hrsg.): Adoleszenz – Migration – Bildung. Bildungsprozesse Jugendlicher und junger Erwachsener mit Migrationhintergrund. Wiesbaden, S. 47-65. Przyborski, Aglaja/Wohlrab-Sahr, Monika (2008): Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch. München. Reinders, Heinz (2003). Jugendtypen. Ansätze zu einer differentiellen Theorie der Adoleszenz. Opladen. Salentin, Kurt/Wilkening, Frank (2003): Ausländer, Eingebürgerte und das Problem einer realistischen Zuwanderungs-Integrationsbilanz. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Heft 2, S. 278-298. Santel, Bernhard (2008): Integrationsmonitoring: Neue Wege in Nordrhein-Westfalen. In: Rat für Migration e.V. (Hrsg.): Politische Essays zu Migration und Integration, Heft 2. Sauer, Karin Elinor (2007): Integrationsprozesse von Kindern in multikulturellen Gesellschaften in Thomas Geisen/Christine Riegel (Hrsg.): Jugend, Partizipation und Migration. Orientierungen im Kontext von Integration und Ausgrenzung. Wiesbaden, S. 169-193. Scherr, Albert (2005): Vergesellschaftung und Subjektivität – Rückfragen an die Theorie reflexiver Modernisierung. In: Benno Hafeneger (Hrsg.): Subjektdiagnosen. Subjekt, Modernisierung und Bildung. Schwalbach/Ts., S. 11-24. Schramkowski, Barbara (2007): Für mich aber hat dieses Integrationswort mit der Zeit seinen Wert verloren – Perspektiven junger Erwachsener mit Migrationshintergrund in Thomas Gei- 108 sen/Christine Riegel (Hrsg.): Jugend, Partizipation und Migration. Orientierungen im Kontext von Integration und Ausgrenzung. Wiesbaden, S. 149-167. Schulze, Erika (2007): Zwischen Ausgrenzung und Unterstützung. Bildungsbiographien von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. In: Wolf-D. Bukow/Claudia Nikodem/Erika Schulze/Erol Yildiz (Hrsg.): Was heißt hier Parallelgesellschaft? Zum Umgang mit Differenzen. Wiesbaden, S. 213-228. Schulze, Erika/Spindler, Susanne (2006): „…dann wird man direkt als asozial abgestempelt.“ – Vom Stigma und seinen Folgen. In: Wolf-D. Bukow/Markus Ottersbach/Elisabeth Tuider/Erol Yildiz (Hrsg.): Biographische Konstruktionen im multikulturellen Bildungsprozess. Individuelle Standortsicherung im globalisierten Alltag. Wiesbaden, S. 63-81. Schneekloth, Ulrich (2006): Politik und Gesellschaft: Einstellungen, Engagement und Bewältigungsprobleme. In: Shell Deutschland Holding (Hrsg.): Jugend 2006. Eine pragmatische Generation unter Druck. Frankfurt/Main, S. 103-144. Uhly, Alexandra/Granato, Mona (2006): Werden ausländische Jugendliche aus dem dualen System der Berufsausbildung verdrängt? In: Berufsbildung und wissenschaftliche Praxis, Heft 3. Wensierski, Hans-Jürgen von/Lübcke, Claudia (Hrsg.) (2007): Junge Muslime in Deutschland. Opladen. Witzel, Andreas (2000): Das problemzentrierte Interview [25 Absätze]. Forum Qualitative Sozialforschung, Art. 22, http://nbnresolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0001228. 109