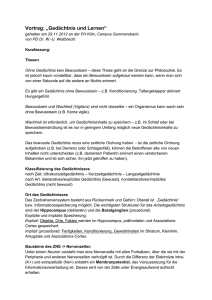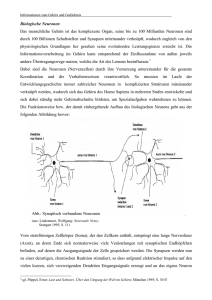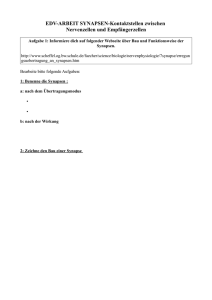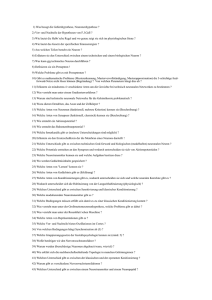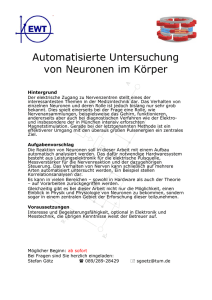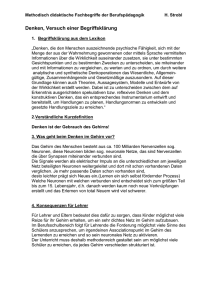Hirnbiologie des Gedächtnisses
Werbung

WWU Münster WS 2000/2001 Dozent: Prof. Dr. K. Sturzebecher Verfasser: Dennis Pongs Semesterarbeit für das Seminar „Kognitionstheorie II“ – Hirnbiologie des Lernens und der Informationsspeicherung 1 Möglichkeiten der biologischen Hirnforschung Die ersten Erkenntnisse über das Gehirn stammen aus Untersuchungen an Tieren und an Ge­ hirnen verstorbener Menschen. Zunächst wurden jedoch nur anatomische Kenntnisse ge­ sammelt. Kenntnisse über die Funktion der einzelnen Gehirnregionen gewann man aus Tier­ versuchen, in denen die Auswirkungen untersucht wurden, die sich ergaben, wenn man die je­ weiligen Regionen operativ entfernte. Aus moralischen Gründen gibt es diese Möglichkeit für die Untersuchung am Menschen nicht. Man hat aber zahlreiche Menschen ausführlich stu­ diert, die aufgrund von Erkrankungen (Schlaganfall, Verletzung...) Fehlfunktionen aufwiesen. Mit der entsprechenden Kenntnis, welche Gehirnregionen beschädigt waren, konnten die Aus­ wirkungen beobachtet und analysiert werden. Seit Hans Berger, ein Schweizer Amateurwissenschaftler, in den zwanziger Jahren elektrische Aktivitäten im Gehirn entdeckte und dies von anerkannteren Wissenschaftlern bestätigt wurde, untersucht man zudem Gehirndünnschnitte, die in glukosehaltiger Salzlösung mehrere Stunden funktionstüchtig bleiben. Diese Experimente dienen zur Erforschung der Mechanis­ men in den Gehirnzellen (Neuronen), unter anderem bei der Informationsspeicherung. In den letzten Jahrzehnten hat man zudem bildgebende Verfahren entwickelt, wie z. B. die Positronenemissionstomographie (PET) oder die Kernspintomographie (fMRI), die es ermöglichen, Bereiche sichtbar zu machen, die beim Lösen bestimmter Aufgaben (Lösen von Mathematikaufgaben oder dem einfachen Zuhören von Musik) aktiv sind. Verfahren wie die Magnetenzephalographie, die in der Lage sein wird, die mit den im Gehirn fließenden Strömen einhergehenden Magnetfelder sichtbar zu machen, befinden sich in der Entwicklung. Die British Telecom hat sich mit dem Projekt „Seelenfänger“ sogar vorgenom­ men, in diesem Jahrhundert in der Lage zu sein, die im Gehirn gespeicherten Daten in einen Computerchip herunterzuladen. Über das Gelingen wird uns die Praxis noch aufklären und sicherlich wird der Fortschritt, der immer noch exponentiell wächst (Prof. Wolf Singer: Für und wider die Natur), weiterhin zunehmen. Im folgenden soll aber der aktuelle Stand der Forschung im Bereich „Hirnbiolo­ gie“ dargestellt werden. 2 2 Die Zelltypen des Gehirns Das Gehirn eines gesunden Menschen besteht aus ca. 100 Mrd. Nervenzellen (Neuronen) und ungefähr genauso vielen Gliazellen (Glia). Die Gliazellen haben die Aufgabe, die Neuronen zu stützen und zu ernähren, da das Gehirn selber nicht durchblutet wird und folglich über das Blut keine Nährstoffe aufnehmen kann. Ein typisches Neuron besteht aus einem Zellkörper (Soma), der einen Durchmesser zwischen 10 und 100 µm hat, und enthält zahlreiche faserartige Verzweigungen. Eine einzige dieser Verzweigungen wird Axon genannt und ist in der Lage, Informationen zu anderen Neuronen weiterzuleiten, während alle anderen Verzweigungen Dendriten genannt werden, die in der Lage sind, Informationen von anderen Neuronen aufzunehmen. Die einzelnen Neuronen sind nicht direkt miteinander verbunden, sondern besitzen an den Kontaktstellen sogenannte Synapsen. Die Lücke zwischen der präsynaptischen Zellen (von der aus das Signal übertragen wird) und der postsynaptischen Zelle (welche das Signal auf­ nimmt) nennt man synaptischen Spalt. Das Gehirn besitzt bis zu 100 Billionen dieser Synap­ sen, die die komplizierten Berechnungen, die das Gehirn permanent leisten muß, erst ermögli­ chen. Die Übertragung eines von einem Neuron erzeugten Signals erfolgt entlang seines Axons elektrisch, und zwar wird es von geladenen Natrium- und Kaliumionen weitergeleitet., wäh­ rend die Übertragung über den synaptischen Spalt hinweg chemisch geschieht, indem Neuro­ transmitter in der präsynaptischen Zelle freigesetzt werden und zur postsynaptischen Zelle ge­ langen und dort wiederum Prozesse auslösen, die dafür sorgen, daß das Signal elektrisch wei­ tergeleitet wird. Es gibt beträchtliche Unterschiede in der äußeren Gestalt der Neuronen, wobei jeder Gehirn­ teil durch eine Gruppe morphologisch andersartiger Neuronentypen gekennzeichnet ist (s. Abb. 1). 3 3 Die Entstehung des Gehirns Es stellt sich nun die Frage, wie sich die einzelnen Teile des Gehirns und die unterschiedli­ chen Neuronentypen entwickeln konnten. Das Gehirn geht aus der Neuralplatte hervor, einer flachen Zellschicht auf der dorsalen Seite des entstehenden Embryos. Im weiteren Verlauf der Entwicklung faltet sich diese Zellschicht entlang der antero-posterioren Achse zum Neuralrohr, einem länglichen, hohlen Gebilde. Am Kopfende des Neuralrohrs bilden sich im weiteren Verlauf auffällige Verdickungen, die schließlich das Vorderhirn, Zwischenhirn und Rautenhirn bilden. Aus dem hinteren Abschnitt geht das Rücken­ mark hervor (s. nebenstehende Abb.). Neue molekulargenetische Untersuchungen liefern bis jetzt zwar keine Beweise, wie die ein­ zelnen Regionen entstehen, sie lassen aber vermuten, daß unterschiedliche Muster der Genex­ pression in den frühen Entwicklungsphasen die eindeutig festgelegten Grenzen ziehen. Nachdem sich das Neuralrohr geschlossen hat, bilden sich durch Zellteilung mit hoher Ge­ schwindigkeit neue Zellen, so daß aus der Neuralplatte, die zuvor nur eine Zellschicht umfaßt hat, eine Platte entsteht, die mehrere Zellschichten umfaßt. Die Methode der Autoradio­ graphie (entwickelt in den sechziger Jahren) ermöglichte es, die genauen Angaben über den Ursprung der einzelnen Gehirnzellen zu machen. Nach erfolgreicher Teilung gibt es zwei Möglichkeiten, was mit den entstandenen Gehirnzellen geschieht. Entweder treten einzelne Tochterzellen erneut in den Mitosezyklus ein oder sie werden postmitotisch und beginnen sich von den gemeinsamen Stammzellen zu differenzieren. Die Zellen, die sich zu Neuronen entwickeln, werden nicht mehr in der Lage sein, sich zu teilen, d. h. Neuronen, die später ab­ sterben, sei es im Prozeß des Alterns, durch Verletzungen oder durch Zufuhr schädlicher Stof­ fe (zu denen schon Ethanol gehört), können nicht mehr ersetzt werden. Der entstehende Platz wird entweder mit Dendriten bzw. Axonen oder einfach mit Gliazellen aufgefüllt, die auch im ausgereiften Gehirn weiterhin in der Lage sind, sich zu teilen. Es ist zwar noch unklar, wie der Vermehrungsmechanismus der Gehirnzellen gesteuert wird, es ist jedoch sicher, daß der Zeitpunkt genau festgelegt sein muß, damit bei der Geburt die ty­ pisch geordnete Struktur vorhanden ist. 4 4 Die Anatomie und Struktur des Gedächtnisses In diesem Kapitel wird das Gedächtnis als große Funktionseinheit aufgefaßt, da nur auf dieser relativ allgemeinen Analysenebene geklärt werden kann, welche Strukturen des Gehirns am Gedächtnis beteiligt sind und welche Aufgaben sie erfüllen. Im nächsten Kapitel sollen elementare Mechanismen erläutert werden, durch die Informationen in den einzelnen Neuronen gespeichert werden. Einerseits gibt es im Gehirn feste Strukturen und Funktionen, die angeboren sind, zu denen die einzelnen Gehirnregionen gehören und die Fähigkeiten mit unseren fünf Sinnen umzuge­ hen, sowie Durst, Hunger und den Drang zu schlafen verspüren. Auf der anderen Seite besitzt das Gehirn die Fähigkeit zur Plastizität, die individuelles Lernen überhaupt erst ermöglicht. Die ersten Erkenntnisse über die Anatomie des Gedächtnisses stammen aus Tierversuchen, hauptsächlich an Affen, was darin begründet ist, daß uns die Wirbeltiere unter Evolutionsge­ sichtspunkten am nächsten stehen und ähnliche zelluläre und molekulare Eigenschaften auf­ weisen. Außerdem sind die einzelnen Zellen in Regionen angeordnet, die über die Artgrenzen hinweg entsprechen. Die Unterschiede zwischen Menschen und anderen Wirbeltieren im Be­ zug auf ihre kognitiven Fähigkeiten liegen wahrscheinlich lediglich in der unterschiedlich ho­ hen Zahl der Neuronen und deren Verknüpfungen begründet. Das Gehirn eines Kleinaffens beträgt beispielsweise nur ein Zehntel der Größe eines menschlichen Gehirns. Eingehendere Forschungen wurden erst ab dem Jahr 1953 unternommen, in dem einem Pati­ enten, der später als HM bekannt wurde, aus der Mitte des Schläfenlappens beider Gehirnhälf­ ten ein ca. 5 cm langes Stück entfernt wurde. Das Ziel, seine schwere Epilepsie zu lindern, wurde zwar erreicht, aber sein Erinnerungsvermögen für alltägliche Ereignisse wurde schwer beeinträchtigt. Während er nach dem Eingriff zwar noch in der Lage war, auf vorhandenes Wissen zurückzugreifen und auch sein Kurzzeitgedächtnis funktionstüchtig blieb sowie seine überdurchschnittlichen geistigen Fähigkeiten, war er von dem Tag der Operation an nicht mehr in der Lage, neues Wissen abzuspeichern. Der heute 74 Jahre alte Mann ist z. B. nicht in der Lage, Personen wiederzuerkennen, die er nach dem Eingriff „kennengelernt“ hat. Aus diesem Fall läßt sich schließen, daß der mittlere Bereich des Schläfenlappens für die Ge­ dächtnisfunktion wichtig ist und daß die Verarbeitung von Informationen und das Abspei­ chern von Informationen, also das Gedächtnis selbst, eigenständige, voneinander unabhängige kognitive Funktionen sind. 5 Zu den entfernten Gehirnregionen gehören der Hippokampus, der Mandelkern sowie die para­ hippokampale, entorhinale und perirhinale Rinde, dargestellt in der nebenstehenden Ab­ bildung. Das oberste Bild zeigt das Gehirn von unten vertikal und macht das Ausmaß des Schadens deutlich. Die anderen vier Abbildungen sind Querschnitte vom vorderen bis zum hinteren Teil des Gehirns. Bei der Operation wurden zwar in beiden Hemisphären die gleichen Re­ gionen entfernt, die rechte Gehirnhälfte ist zum Vergleich jedoch vollständig dargestellt. Genauere Kenntnisse, welche Gehirnstrukturen im einzelnen an der Gedächtnisfunktion betei­ ligt sind, gewann man aus anderen sorgfältigen Untersuchungen von Gedächtnisstörungen, die zeigten, daß der Hippokampus selbst einen entscheidenden Bestandteil des Gedächtnissys­ tems darstellt. Dies zeigte z. B. die Gedächtnisstörung des Patienten RB, der nach einer Ischämie lediglich an einer mäßig schweren Gedächtnisstörung litt. Eine nach seinem Tod durchgeführte Untersuchung des Gehirns zeigte, daß ein ganzer Abschnitt des Hippokampus, den man CA 1 nennt, zerstört war. Aus Tierversuchen geht hervor, daß dieser Abschnitt des Hippokampus besonders anfällig für Ischämie-Schäden ist und daß durch diesen Bereich die Informationen in und aus den Hippokampus fließen. Untersuchungen an Affen bestätigten diese Ergebnisse und zudem, daß auch andere Struk­ turen, die in der Umgebung des Hippokampus liegen und anatomisch mit ihm verbunden sind, von großer Bedeutung für das Gedächtnis sind. Die entorhinale Rinde ist die wichtigste Quelle für Projektionen im Bereich des Hippokampus. Fast zwei Drittel des aus dem Kortex stammenden Input in die entorhinale Rinde stammen aus den benachbarten perirhinalen und parahippokampalen Rindenanteilen, die ihren Input ihrerseits von den Assoziationsfeldern im Stirn-, Schläfen- und Scheitellappen erhalten. Weitere Leitungsbahnen reichen unmittelbar von den Rändern des frontalen Kortex, vom Gyrus cinguli, vom Lobus insularis und vom Gy­ rus temporalis superior in die entorhinale Rinde. Andere Untersuchungen zeigten, daß auch Schädigungen in tiefer gelegenen Gehirnstruk­ turen, wie dem Thalamus, zu einer Amnesie führen können, was bedeutet, daß alle Gehirnbe­ 6 reiche im limbischen System und im Zwischenhirn als wichtige Teile des Gedächtnissystems in Frage kommen könnten. Die Tatsache, daß Amnesiepatienten zwar häufig schlechte Leistungen in herkömmlichen Ge­ dächtnistests zeigten, in denen sie sich bekannten Fakten oder Ereignissen erinnern sollten, beim Erlernen von Fähigkeiten und Gewohnheiten jedoch nicht beeinträchtigt waren, läßt dar­ auf schließen, daß es zwei unterschiedliche Formen des Gedächtnisses gibt. Das im Falle der Amnesie meist beeinträchtigte Gedächtnis, welches dem bewußten Erinnern von Tatsachen und Ereignissen dient, wird deklaratives Gedächtnis genannt. Es ist auf unver­ sehrte Strukturen des limbischen Systems und des Zwischenhirns angewiesen. Das prozedurale Gedächtnis hingegen speichert Informationen unbewußt als Veränderungen in spezifischen Wahrnehmungs- oder Reaktionssystemen, oder die Informationen werden als Veränderungen in bestimmte Wissenssysteme integriert. Dieses Gedächtnis umfaßt das Erler­ nen von Fähigkeiten und Gewohnheiten, die assoziative Aktivierung, die einfache klassische Konditionierung und das nicht-assoziative Lernen. Larry R. Squire beobachtete mit Marcus Raichle und Kollegen mit Hilfe der PET die lokale Durchblutung einzelner Gehirnregionen bei Versuchspersonen, die mehrere ähnliche Auf­ gaben zu lösen hatten. Bei dem Versuch wird den Personen zuvor ein Sauerstoffisotop mit einer geringen Halbwertszeit von 2 Minuten in die Arterie, die zum Gehirn führt, injiziert, mit dessen Hilfe die Durchblutung gemessen werden kann. Die Durchblutungssteigerung wird be­ stimmt, indem die gemessene Durchblutung, die im Grundzustand vorhanden ist, von der Durchblutung „subtrahiert“ wird, die beim Lösen der Aufgaben vorhanden ist. Die Personen mußten Wörter lernen, die nacheinander präsentiert wurden. Nach 3 Minuten sahen die Personen Wortanfänge aus drei Buchstaben, die sich zu jeweils mindestens zehn all­ gemein bekannten Wörtern vervollständigen ließen. Sie hatten folgende vier Aufgaben nach­ einander zu lösen: 1. keine Reaktion: Die Versuchspersonen sahen Wortanfänge, die nicht zu den gelernten Wörtern vervollständigt werden konnten, und reagierten nicht verbal darauf. 2. Ausgangsniveau: wie 1, jedoch sollten die Wortanfänge zu dem Wort vervollständigt werden, das ihnen zuerst einfiel 3. assoziative Aktivierung: Die Versuchspersonen sahen Wortanfänge, die diesmal zur Hälfte zu den gelernten Wörtern vervollständigt werden konnten, und hatten alle zu vervollstän­ digen. 4. Gedächtnis: wie 3, jedoch waren alle Wortanfänge zu den gelernten Wörtern zu vervoll­ ständigen und laut auszusprechen 7 Ein typischer Befund des Experiments ist in der nebenstehenden Abbildung dargestellt. Beim Lösen der Aufgaben ist eine erhöhte Durchblutung im mittleren und hinteren Be­ reich des rechten Schläfenlappens zu beobach­ ten, also dort, wo sich der Hippokampus und der Gyrus parahippokampalis befinden. Interessant ist hierbei, daß der rechte Hippo­ kampusbereich aktiviert wurde, immerhin handelt es sich um verbale Informationen, die bei den gestellten Aufgaben verarbeitet werden mußten. Diese Tätigkeit wird hauptsächlich der linken Hemisphäre zugeordnet und folglich könnte man erwarten, daß auch der linke Hippokampusbereich stärker aktiviert wird. Diese Annahme ist jedoch nur in erster Näherung richtig, tatsächlich ist bei dieser Aufgabenstellung die rechte Hemisphäre aktiv, weil die Leistung nicht von dem Klang oder der Bedeutung der Wörter abhängt, sondern von ihrer visuellen Form als Hinweisreiz. Des weiteren ist eine erhöhte Aktivierung des präfrontalen Kortex bei der Gedächtnistätigkeit zu beobachten, wobei bereits aus früheren PET-Studien bekannt ist, daß diese Region bei Aufgaben aktiviert ist, in denen die Wahl zwischen mehreren Reaktionen verlangt wird. Eine Schädigung dieses Bereichs führt zu einer Verschlechterung der Leistung bei Suchprozessen im Gedächtnis. Bei der dritten Aufgabe zeigte sich eine verminderte Aktivität im rechten okzipitalen Kortex, der Teilen der Sehrinde entspricht. Das spricht dafür, daß bei der assoziativen Aktivierung le­ diglich die niederen Ebenen der Kodierung durchlaufen werden. Der Befund liefert eine Er­ klärung für das Phänomen der wiederholten Auslösung: Einige Zeit nach der ersten Präsenta­ tion eines Reizes ist eine geringere Neuronenaktivität zur Weiterverarbeitung notwendig. Die beiden Gedächtnissysteme, das deklarative und das prozedurale Gedächtnis, arbeiten par­ allel. Eindrücke, die wir von Personen oder Sachverhalten haben, sind sowohl auf bewußte Erfahrungen zurückzuführen als auch auf unbewußtes Wissen, das dem prozeduralem Ge­ dächtnis zugeordnet werden kann und sich z. B. in Neigungen äußert. Man kann nicht erwarten, daß man auf unbewußtes Wissen genauso zugreifen kann wie auf bewußtes Wissen. Es gibt Fälle, in denen sind Abneigungen oder Phobien im prozeduralem Gedächtnis gespei­ chert, ohne daß die Ereignisse, die sie verursacht haben, noch gespeichert sind. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn ein Kind eine Phobie hat, welche auf ein Ereignis mit einem Hund vor 8 dem zweiten Lebensjahr, also bevor sich das deklarative Langzeitgedächtnis etabliert hat, zu­ rückzuführen ist. Oft wird allerdings auch deklaratives Wissen gespeichert, so daß Bezüge hergestellt werden können. In der Regel ändert sich ein Verhalten, das aus dem prozeduralem Gedächtnis hervor­ geht, dadurch, daß neue Gewohnheiten entstehen. Es besteht allerdings auch die Möglichkeit, sich einer Gewohnheit bewußt zu werden und sie durch Übung zu verändern oder die Reize, die sie auslösen, zu unterbinden. Das Gedächtnis besitzt zwar feste Strukturen im Bereich des mittleren Schläfenlappens, in dem Informationen zusammenfließen müssen, um dauerhaft gespeichert zu werden, aber die Informationen selber sind schon bei der Repräsentation und auch später je nach Art der In­ formation über den Neokortex verteilt. Gespeichert werden vielmehr die Verbindungen der einzelnen Einheiten vom mittleren Schläfenlappen aus, die je nach Bedarf (Wiederholung) eine Zeitlang die einzelnen Teile des Neokortex als vollständige Erinnerung wiederbeleben können, selbst dann, wenn es sich bei dem aktivierenden Reiz nur um einen partiellen Hin­ weisreiz handelt. Teile des mittleren Bereichs des Zwischenhirns und im mittleren Bereich des Thalamus wirken hier ebenfalls mit. Sie schaffen möglicherweise eine Verbindung zu den Stirnlappen, so daß bewußtes Wissen zu Handlungen führen kann. Auf jeden Fall ermöglicht die Verbindung des limbischen Systems und des Zwischenhirns, die dem deklarativen Ge­ dächtnis zugrunde liegt, bewußte Erinnerungen. Das deklarative Gedächtnis ist zwar fehleranfällig, da Wissen vergessen werden kann oder ein Zugriff auf Wissen nicht mehr möglich sein kann, es ermöglicht jedoch unsere individuelle Entwicklung und eine kulturelle Evolution. Das prozedurale Gedächtnis hingegen ist zuverlässig, entwicklungsgeschichtlich alt und bietet beispielsweise durch Konditionierung einige Möglichkeiten, die Realität schnell zu begreifen, schon bevor das deklarative Gedächtnis ausgebildet ist. Die Inhalte spiegeln unsere Nei­ gungen und Gewohnheiten wieder, beeinflussen unser Handeln und sind Teil unserer Persön­ lichkeit. 9 5 Die Physiologie des Gedächtnisses Wie schon zu Beginn des vorherigen Kapitels angekündigt, geht es nun darum, zu erläutern, welche elementaren Mechanismen der Neuronen an der Informationsspeicherung beteiligt sind. Zunächst muß jedoch geklärt werden, wie Signale überhaupt im Nervensystem weiterge­ leitet werden. Wie im Kapitel 2 bereits erwähnt wurde, ist ein Nervenimpuls, der in einem Neuronen entsteht, elektrisch und breitet sich entlang der Axone aus. Gelangt er nun zur Synapse wird durch sein Ak­ tionspotential mindestens ein Neuro­ transmitter in den synaptischen Spalt ausgeschüttet (vergl. nebenstehende Abb.), welcher zuvor aus Aminosäuren und anderen Verbindungen synthetisiert und im Zytoplasma der Endplatte der präsynaptischen Zelle gespeichert wurde. Die Konzentration des Neurotransmitters wird vor allem durch das Enzym Monoaminoxidase (MAO) gesteuert, das mit den Mitochondrien der Zelle assoziiert ist. Der Neurotransmitter diffundiert sehr schnell zur postsynaptischen Zelle, wo er an spezifische Rezeptoren bindet. Einige dieser Rezeptoren sind mit spannungsge­ steuerten Ionenkanälen gekoppelt, die übrigen sorgen für die Synthese sekundärer und terti­ ärer Botenstoffe, die wiederum vielseitige Aufgaben erfüllen, wie die Regulation des Calci­ umspiegels. Sie können sich aber auch auf die Genexpression in der postsynaptischen Zelle auswirken. Nach der Reaktion werden die Neurotransmitter von spezifischen Transportmole­ külen wieder in die präsynaptische Zelle zurückgeführt. Thomas Elliott, Physiologiestudent der Universität Cambridge, entdeckte, daß im sympa­ thischen Nervensystem, einem Teil des peripheren Nervensystems, das beim Auftauchen po­ tentieller Gefahrensituationen aktiviert wird, eine dem Adrenalin ähnliche Substanz ausge­ schüttet wird, welche später Noradrenalin genannt wurde. 20 Jahre später sorgten Sir Henry Dale, Otto Loewie und andere Physiologen und Pharmakologen für die Entdeckung eines zweiten Neurotransmitters (Acetylcholin), der im parasymphatischen Teil des peripheren Ner­ vensystems vorkommt. 10 Heute geht man selbst nach vorsichtigen Schätzungen davon aus, daß es insgesamt über 50 Neurotransmitter gibt. Zu ihnen gehören Aminverbindungen, zu denen auch das Noradrenalin und Acetylcholin zählen, Aminosäuren wie Glutamat und Gamma-Aminobuttersäure (GABA) und Neuropeptide wie Enkephalin und die Substanz P. Es wird vermutet, daß die Zahl der Neurotransmitter deshalb so hoch ist, damit sich die Anzahl der Reaktionsmöglichkeiten für unterschiedliche Situationen erhöht. Die Neurotransmitter werden aus Vorläufersubstanzen (häufig aus der Nahrung) in den Neuronen synthetisiert und bis zum Gebrauch gespeichert. Sie können an der postsynap­ tischen Zelle Ionenkanäle öffnen, in die z. B. Kalium-, Natrium- und Calciumionen eindringen können und die Spannung an der Zellmembran beeinflussen, so daß Aktionspo­ tentiale weitergeleitet werden. Neurotransmitter, die die Wahrscheinlichkeit zur elektrischen Weiterleitung erhöhen, indem sie den Ionenkanal für bestimmte Ionen öffnen, wirken exzita­ torisch, andere vermindern die Wahrscheinlichkeit und wirken inhibitorisch. Andere Neuro­ transmitter können durch Veränderungen am genetischen Material der postsynaptischen Zelle ihre Funktion dauerhaft ändern. In diese Prozesse greifen moderne Medikamente ein, wie Antidepressiva, Antipsychotika und Anxiolytika, die Fehlfunktionen in den Mechanismen kompensieren sollen. Problematisch dabei ist, daß viele Medikamente auch auf andere Gehirnregionen wirken. Benzodiazepine vermindern beispielsweise Angstzustände, verschlechtern allerdings auch die kognitiven Fä­ higkeiten, da in den zugehörigen Verarbeitungsmodulen ähnliche molekulare Vorgänge ab­ laufen. „Umgekehrte Agonisten“ wirken kognitionsverstärkend, wie in Laboruntersuchungen gezeigt wurde, lösen allerdings entsprechend umgekehrt Angstzustände aus. Es bleibt wün­ schenswert, daß weitere Forschungsarbeiten zur Entwicklung von Medikamenten führen, die sehr gezielt wirken, um mögliche Nebenwirkungen auszugrenzen. Es bleibt nun die Frage, wie es für die einzelnen Neuronen möglich ist, Informationen zu Speichern. Da die Neuronen die elektrischen Impulse nicht mit unterschiedlicher Amplitude (Intensität) abfeuern können (Alles-oder-nichts-Prinzip), kommt als Ort, an dem sich etwas ändert/an dem gespeichert wird, nur die Synapse in Frage. Es muß einen Mechanismus geben, der in Abhängigkeit von der Aktivität die Übertragung an Synapsen effizienter macht. Die meisten Befunde, die nun folgen, stammen aus Experimenten mit Dünnschnitten von Ge­ hirngewebe, die in Kulturgefäßen mehrere Stunden am Leben erhalten werden, indem sie mit einer sauerstoff- und glukosehaltigen Salzlösung durchströmt werden. Sämtliche Fähigkeiten, die sie zuvor im lebenden Organismus hatten, bleiben dabei erhalten. Ausgewählt wurden Be­ 11 reiche des Hippokampus, weil dieser wichtig für die Verarbeitung von Erinnerungen und für die Speicherung selbst ist. Außerdem war es nur mit dem Hippokampus möglich, geeignete Experimente durchzuführen. Die meisten Synapsen, die man durch einen Tetanus aktivierte, zeigten nur eine kurzfristige Steigerung der Effizienz (posttetanische Potenzierung), die nur zwei Minuten anhielt. Bei der Stimulation des Tractus perforans (Hauptleitungsbahn zum Hippokampus) konnten Tim Bliss und Lomo in Neuronen des Gyrus dentatus neben der erwarteten posttetanischen Potenzierung eine viel länger anhaltende Zunahme der Synapseneffizienz feststellen, die sie als Langzeitpo­ tenzierung (LZP) bezeichneten. Der Tractus perforans transportiert auf höheren Ebenen ko­ dierte Seh-, Hör- und Riechinformationen von der entorhinalen Rinde zum Gyrus dentatus. Die erhöhte Synapseneffizienz blieb bei narkotisierten Kaninchen mehrere Stunden lang be­ stehen, bei wachen Kaninchen, denen zuvor unter Narkose Elektroden eingepflanzt worden waren, schließlich mehrere Tage. In weiteren Experimenten konnte man zeigen, daß die LZP auch in anderen Leitungsbahnen des Hippokampus und in Synapsen der Hirnrinde initiiert werden kann. Während die postte­ tanische Potenzierung allerdings eine Eigenschaft aller Synapsen des Kortex ist, kann es zur LZP nur in einigen Synapsen kommen. In weiteren Experimenten zeigte sich, daß die LZP noch weitere Eigenschaften besitzt, die für das Gedächtnis sehr hilfreich sind. Bei einem Experiment wurde die Reaktion der Pyramiden­ zellen (Neuronen mit spezieller Form und oft über 20000 Synapsen; Abb. Kapitel 2) des Be­ reichs CA 1 des Hippokampus aufgezeichnet. Wie in der nebenstehenden Abbildung oben sichtbar, wurden die stimulierenden Elektroden beidseitig von der Aufzeichnungselektrode ange­ bracht, und zwar an Axone von Pyramidenzellen der benachbarten Hippokampusregion CA 3, die mit den CA 1-Zellen exzitatorische Synapsen bilden. Die beiden Elektroden, S 1 und S 2, ak­ tivieren unterschiedliche Fasern, die jedoch mit der selben Population von CA 1-Zellen verbunden sind. Man stellt die Reize so ein, daß S 1 zu wenige Fasern anregt, als daß die LZP entstehen könnte und daß S 2 dazu in der Lage ist. In a) ist zu erkennen, daß die schwachen Impulse (erstes helles Dreieck) der Elektrode S 1 zwar eine 12 geringe Potenzierung hervorrufen, jedoch ist sie nur von kurzer Dauer. Die starken Impulse (erstes schwarzes Dreieck in b)) führen hingegen zur LZP, aber nur in der zugehörigen Leitungsbahn. Diese Eigenschaft wird Input-Spezifität genannt und sorgt dafür, daß jede Synapse als unabhängige Rechenmaschine arbeiten kann. Dadurch wird die Informations­ menge enorm gesteigert, die ein Neuron speichern kann, zumal Pyramidenzellen häufig über 20000 Synapsen besitzen. Verabreicht man den Tetanus über S 1 (zweites weißes Dreieck) jedoch zur gleichen Zeit wie den über S 2 (zweites schwarzes Dreieck), so kommt es in der schwach stimulierten Leitungs­ bahn ebenfalls zur LZP. Diese Eigenschaft nennt man Assoziativität und erklärt auf neurona­ ler Ebene modellhaft den Prozeß der klassischen Konditionierung. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß eine exzitatorische Synapse im Hippokampus po­ tenziert wird, wenn sie zu dem Zeitpunkt aktiv ist, an dem der Dendrit, zu dem sie gehört, stark depolarisiert wird. Es bleibt die Frage, welche Mechanismen in der Synapse zur LZP führen. Da die Synapsenef­ fizienz nach einer Potenzierung größer ist, muß für deren Initiierung ein exzitatorischer Trans­ mitter verantwortlich sein. Der wichtigste dieser Transmitter ist die Aminosäure Glutaminsäu­ re (Glutamat). Seine Wirkung ist abhängig von dem Rezeptor, an dem er bindet. Zu jedem Transmitter gehört eine ganze Familie von Rezeptoren, manchmal sogar mehrere solche Fa­ milien. Für den Zusammenhang der LZP interessieren zwei Familien von Glutamatrezeptoren, die AMPA- und die NMDA-Rezeptoren (s. nebenstehende Abb.). Bei der normalen Übertragung a) wird von dem präsynap­ tischen Ende der Neurotransmitter Glutamat ausgeschüttet, der an den AMPARezeptor des postsynaptischen Neurons bindet, so daß dieser eine Konformations­ änderung durchmacht. Dadurch können Na­ triumionen in die Zelle einströmen und den Spannungsunterschied ∆ V an der Zell­ membran verringern. An den NMDA-Re­ zeptor bindet der Transmitter zwar auch, aber dieser ist durch Magnesiumionen blo­ ckiert, so daß es hier zu keiner weiteren Re­ aktion kommt. Wenn die Aktivierung der Synapse jedoch stark genug ist (wie die Stimulation im Experiment, die über die Elektrode S 2 durchgeführt wurde), wird eine größere Trans­ 13 mittermenge freigesetzt, die auch entsprechend zu einem stärkeren Ionenstrom durch den AMPA-Kanal führt. Dadurch verringert sich der Spannungsunterschied stärker als bei der normalen Übertragung. Sinkt der Spannungsunterschied unter 30 mV, so ist die elektrische Anziehungskraft vom Inneren des postsynaptischen Endes auf das Magnesiumion nicht mehr stark genug, um es im NMDA-Kanal zu halten, so daß es entweicht. Nun können Calciu­ mionen ungehindert den NMDA-Kanal durchlaufen, was wahrscheinlich der Auslöser für die LZP ist. Da für die LZP der Transmitter gebunden sein muß und der Dendrit stark depolarisiert sein muß, damit der NMDA-Kanal aufnahmefähig ist, nennt man ihn auch „molekulares UNDTor“ oder „molekularer Koinzidenzdetektor. Es gibt zahlreiche Indizien dafür, daß der Calciumeinstrom durch die NMDA-Kanäle tat­ sächlich die Ursache für die LZP ist. Z. B. verliert eine Zelle, in die ein Calcium-Chelatbild­ ner injiziert wird, die Fähigkeit zur LZP. Die Calciumionen selbst lösen in der Zelle eine Viel­ zahl von biochemischen Reaktionen aus, wie die Aktivierung von Proteinkinasen (eine Gruppe von Enzymen), die an bestimmte Aminosäuren in einer Proteinkette Phophatgruppen anhängen und so ihre Funktion verändern können. Ihre Aktivierung kann außerdem zur Trans­ kription von Genen und zur Synthese neuer Proteine führen, die die Zelle nachhaltig verändern. Die dauerhafte Verstärkung der Übertragung kann durch die Phosphorilierung der Glutamat­ rezeptoren oder durch den Einbau neuer Rezeptoren in die postsynaptische Membran er­ folgen. Allerdings ist es erstaunlich, daß nach der LZP beobachtet werden kann, daß größere Mengen an Neurotransmittern freigesetzt werden. Welche Veränderungen aber im präsynap­ tischen Ende der Synapsen eintreten, ist unklar und entsprechende Theorien sind derzeit um­ stritten. Bis weitere Forschungen Fakten liefern, wird sich laut Tim Bliss auch nicht viel daran ändern. Damit die präsynaptische Zelle jedoch mehr Neurotransmitter produzieren und frei­ setzen, muß sie die Information erreichen, daß eine LZP stattgefunden hat. Dafür kommen als Botenstoffe das Stickoxid, ein Gas, welches unter anderem die Blutgefäße erweitern kann, und die Arachidonsäure, ein Lipid in den Zellmembranen, in Frage. Außerdem könnte es eine bisher nicht identifizierte, diffusionsfähige Substanz geben, die die Effizienz aller Synapsen erhöht, die sich in unmittelbarer Umgebung einer potenzierten Synapse befinden. Die LZP hat allerdings auch ihre Grenzen; so können Synapsen nach wiederholten Tetani nicht weiter potenziert werden. Es ist jedoch unklar, ob die LZP ein Alles-oder-nichtsVorgang ist, da man aus technischen Gründen noch keine einzelnen Synapsen stimulieren 14 konnte. Es könnte also sein, daß bei der jeweilige Gruppe von Synapsen entweder alle Synap­ sen gleichzeitig bis zu einer Sättigung mehr und mehr potenziert werden oder bei jedem Te­ tanus mehr Synapsen potenziert werden. Das Lernen ist allerdings ein lebenslanger Vorgang und es ist zu klären, wie es nicht zu einer „Überflutung“ des Gedächtnisses kommt. Zum einen ist unbekannt, wie viele Synapsen für die interne Repräsentation von Wissen benötigt werden, zum anderen konnte in Experimenten eine Absenkung der Synapseneffizienz und sogar eine Depotenzierung erreicht werden. Glei­ ches ist also für die Informationsspeicherung nicht auszuschließen. In Abhängigkeit von der Zeit verschlechtert sich die Wiedergabeleistung von Informationen, sei es durch Interferenz, durch mangelnden Gebrauch oder durch proaktive Hemmung. 15 6 Literaturangaben Eine Literaturkritik entfällt, da mir deren Wahl offenstand und ich mich für das Buch „Ge­ hirn, Gedächtnis und Bewußtsein“ von Steven Rose (Hrsg.) entschieden habe, das mich auch privat interessiert hat. Steven Rose, Professor für Biologie und seit 1969 Direktor der „Brain and Behaviour Rese­ arch Group“ an der Open University, faßte in dem Buch die Ergebnisse des zweitägigen Sym­ posiums seiner Sektion an der Jahrestagung der Gesellschaft (1996) zusammen. Fast alle Referenten willigten ein, ihre Vorträge als Buchkapitel niederzuschreiben, als Rose sie darum bat. Für die Hausarbeit wurden vor allem folgende Kapitel verwendet: Das Gehirn des Menschen: 100 Milliarden verknüpfte Zellen John Parnavelas Die Pharmakologie von Denken und Fühlen Trevor Robbins Gedächtnis und Gehirnsysteme Larry R. Squire Die physiologischen Grundlagen des Gedächtnisses Tim Bliss 16