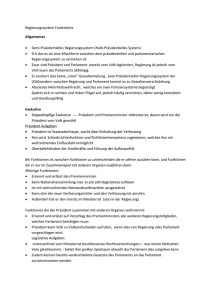Das schweizerische Regierungssystem - ein
Werbung

Das schweizerische Regierungssystem - ein Sonderfall Thomas Fleiner Professor Pernthaler hat sich während seiner ganzen wissenschaftlichen Tätigkeit mit dem schweizerischen Staatsrecht und insbesondere mit der schweizerischen Staatslehre auseinandergesetzt. Seine 1987 erschienene Allgemeine Staats- und Verfassungslehre hat er unserem allzu früh verstorbenen Peter Saladin und mit ihm der ganzen schweizerischen Staatslehre gewidmet. Schon diese Referenz der Schweiz gegenüber, aber auch die vielen wissenschaftlichen Begegnungen in Zusammenhang mit den Fragen des Föderalismus und der Staatslehre sind Grund genug, Professor Pernthaler in seiner Festschrift einige grundsätzliche Überlegungen zum schweizerischen Regierungssystem zu widmen. Wesentliche Elemente der schweizerischen Volkssouveränität War nach der Verfassung von 1848 das Regierungssystem noch weitgehend eine repräsentative Demokratie, so setzten sich allmählich über die Kantone mehr und mehr Elemente einer direkten Demokratie auch auf Bundesebene durch. 1874 wurde das Referendum, 1891 das Initiativrecht für die Partialrevision der Verfassung und 1918 das Referendum für Staatsverträge (ausgebaut 1977) eingeführt. Von zentraler Bedeutung ist schliesslich auch die Einführung des Verhältniswahlverfahrens im Jahre 1918. Der Grundsatz der proportionalen Vertretung im Parlament und später in Regierung, Verwaltung, Gericht - ja in allen Behörden - durchzieht heute den eidgenössischen Bundesstaat wie ein roter Faden. Er steht in einem gewissen Gegensatz zum reinen Prinzip des Mehrheitsentscheides, dem sich die Minderheit fügen muss. Die proportionale Vertretung in allen Behörden soll nämlich sicherstellen, dass auf allen Stufen ein Kompromiss gefunden wird, der möglichst vielen Interessen Rechnung trägt und allen im Volke vorhandenen Bestrebungen die Möglichkeit gibt, einen Entscheid zu beeinflussen. Damit bringt das Proporzsystem auch zum Ausdruck, dass Demokratie in der Schweiz nicht in erster Linie als Mehrheitsherrschaft, sondern als Möglichkeit weitgehender Selbstbestimmung verstanden wird. Das Proporzprinzip führt dazu, dass jeweils ein möglichst einstimmiger Entscheid gesucht wird. Andere Demokratisierungstendenzen wurden vom Volke abgelehnt, so beispielsweise die Volkswahl des Bundesrates, das Finanzreferendum, das konstruktive Referendum und die Gesetzesinitiative. Die seit 1848 anhaltende Tendenz zur Ausweitung der direkten Demokratie ist aber trotz verschiedener negativer Entscheidungen des Volkes nicht zum Stillstand gekommen. Die Ausweitung des Staatsvertragsreferendums und die vielen neuen Initiativen, welche grosse politische Probleme (Atomkraftwerke, Nationalstrassenbau) über einen Volksentscheid lösen wollen, beweisen dies zur Genüge. Was sind nun die wesentlichen Elemente des schweizerischen Regierungssystems im Vergleich zu anderen Systemen? Entscheidend ist die Tatsache, dass das Parlament im Gegensatz zur parlamentarischen Demokratie nicht über unbeschränkte Souveränität verfügt. Es wird zwar in Art. 148 der Bundesverfassung (BV) unter Vorbehalt der Rechte des Volkes als oberstes Organ des Bundes bezeichnet, aber eben unter Vorbehalt der Rechte des Volkes. Gleichzeitig be- zeichnet Art. 194 BV den Bundesrat als oberste vollziehende Behörde der Eidgenossenschaft. Im Gegensatz aber zu den Regierungssystemen nach Westminstermodell sind das Parlament und vor allem die Parlamentsfraktionen, aus denen sich die Exekutive zusammensetzt, überhaupt nicht in die Regierungstätigkeit eingebunden. Da die Exekutive und vor allem auch die einzelnen Bundesräte während der Amtszeit nicht abgesetzt werden können, sind sie von ihrer Fraktion, bzw. von Mehrheitsentscheiden im Parlament, relativ unabhängig. Im Gegensatz zum Präsidenten der Vereinigten Staaten können aber die einzelnen Bundesrätinnen oder Bundesräte ihre Vorlagen in beiden Kammern direkt vertreten und müssen sich nicht durch ein Mitglied der jeweiligen Kammer vertreten lassen. So kann die Exekutive den beiden Kammern zwar Gesetzes- und Haushaltsvorschläge unterbreiten und diese in der Ratssitzung vertreten. Die Mitglieder des Bundesrates haben aber kein Stimmrecht. Das Parlament entscheidet völlig frei über die Vorlagen der Exekutive. Im Gegensatz zu manchen anderen Staaten werden Gesetze im Parlament und vorher bereits in den parlamentarischen Kommissionen wesentlich überarbeitet. Es gibt in der Schweiz keine parlamentarische Regierungsmehrheit, die mittels Fraktionsdisziplin die Gesetzesvorlagen der Exekutive im Parlament durchpeitschen muss. Die eidgenössischen Räte sind nach Verfassung unter dem Vorbehalt der Rechte des Volkes Inhaber der obersten Gewalt. Gestützt auf diese Bestimmung der Verfassung nimmt das Parlament seine Aufsichtsrechte über Bundesrat und Bundesgericht wahr. Allerdings hat sich die Exekutive aus Gründen der Gewaltenteilung lange gegen ein zu weitgehendes Aufsichtsrecht des Parlamentes namentlich bei parlamentarischen Untersuchungen gewehrt, wobei die Regierung ihre Argumentation auf die dogmatische Gewaltenteilung stützte. Mit dem Gegenargument der Gewaltenkontrolle als wesentliche Ergänzung der Gewaltenteilung hat sich das Parlament schliesslich gegenüber dem Bundesrat durchgesetzt. Im Gegensatz zu den Westminstermodellen erfüllt die Untersuchungskompetenz des Parlamentes nicht die Funktion eines Minderheitenrechts der Oppositionsfraktion. Die parlamentarische Untersuchungskompetenz ist ein Teil der ordentlichen Gewaltenkontrolle des Parlaments. Die eidgenössischen Räte sind auch Wahlorgan der Mitglieder des Eidgenössischen Bundesgerichtes. Die Bundesrichter sind auf eine fixe Amtszeit (sechs Jahre) gewählt und müssen nach Ablauf der Amtszeit wiedergewählt werden, falls sie in ihrer Funktion bleiben wollen. Diese Wiederwahl ist in der Regel Routine. Es kann aber vorkommen, dass das Parlament die Entscheide gewisser Bundesrichter unter die Lupe nimmt und die Wiederwahl in Frage stellen kann, falls eine Mehrheit der Räte mit der Amtstätigkeit der betreffenden Richter nicht einverstanden ist. In diesen Fällen ist die Unabhängigkeit der Justiz nicht absolut geschützt. Neben der Aufteilung der Exekutiv- und der Legislativgewalt kommt den Volksrechten als wesentlichem Charakteristikum des politischen Systems entscheidende Bedeutung zu. Während in der parlamentarischen Demokratie das Volk den Parteien mit der Wahl auch das Mandat erteilt, im Sinne des von ihnen vertretenen Programms zu regieren, erhalten Parlament und Regierung im schweizerischen System ihr Mandat weniger durch die Wahl als vielmehr durch vom Volk beschlossene Verfassungsaufträge. Das schweizerische Regierungssystem entspricht nicht einer reinen Volksherrschaft. Das Volk regiert nicht. Es ist lediglich oberste Instanz wie früher die Gerichtsversammlung, die Landsgemeinde, die ein Mandat zur Regierungsausübung in personeller, sachlicher und finanzieller Hinsicht erteilt oder verweigert. An der eigentlichen Regierung sind alle Organe beteiligt: das Volk, das Parlament, der Bundesrat und das Bundesgericht. Im Rahmen dieser vom Volk abgedeckten Legitimation kann aber die Exekutive beim Vollzug der Gesetze auf eine breite Unterstützung von Seiten der Bevölkerung zählen. Diese verstärkte Legitimation erleichtert den Vollzug der Gesetze. Dies hat auch erhebliche Auswirkungen auf die Stellung der Parteien. Diese sind im Gegensatz zu den Parteien der parlamentarischen Demokratie nicht Träger eines besonderen Regierungsmandates. Es sind Gruppierungen, die im Parlament im Rahmen des Volksmandates eine beschränkte Legislativgewalt ausüben und allenfalls der Exekutive helfen, die notwendigen Mehrheiten im Volke zu finden oder als oppositionelle Gruppierungen der Regierung Unzufriedenheit im Volke anzeigen. Die Regierung wird also nicht von einer Fraktionsmehrheit getragen, sondern von ihrem Verfassungs-, Gesetzes- und Finanzauftrag. Eine Trennung zwischen parlamentarischer Regierungsmehrheit und parlamentarischer Opposition im Sinne der parlamentarischen Demokratie hätte in der Schweiz recht wenig Sinn, da die Exekutive immer Anregungen der Opposition in ihre Politik aufnehmen kann, um das Mandat des Volkes zu erhalten. Die Opposition muss keine Neuwahlen erzwingen, sie kann der Exekutive über die Instrumente der direkten Demokratie neue politische Ziele aufzwingen, was ihr als Minderheit im Westminstersystem nicht möglich ist. Erteilt das Volk aber einer Vorlage der Exekutive seine Zustimmung, hat die Opposition in der betreffenden Sachfrage die Grundlage ihrer Politik zumindest vorübergehend verloren. Die Legitimation einer Volksabstimmung ist für eine gewisse Zeit unwiderruflich. Sie muss dann nach neuen Möglichkeiten suchen, wenn sie ihr Anliegen verwirklichen will, da sich gegen die Volksmehrheit schlecht Opposition machen lässt. Dies alles führt gleichzeitig auch zu einem Machtschwund der Parteien, denen eher personalpolitische denn sachpolitische Aufgaben zukommen. Wollen Bürgerinnen und Bürger auf die Sachgeschäfte Einfluss nehmen, brauchen sie dies nicht über die Parteien zu tun. Sie können sich vielmehr durch Bildung von Referendumskomitees oder über bestehende überparteiliche Vereinigungen oder Wirtschaftsverbände mit der Verfassungsinitiative oder dem Referendum Gehör verschaffen. Die Aufteilung der Souveränität zwischen Volk, Parlament und Exekutive entspricht also der schweizerischen Tradition; dagegen gab es gegen die Umsetzung des klassischen Konzepts einer horizontalen Gewaltenteilung zwischen Gesetzgebungs-, Vollziehungs- und richterlicher Gewalt mehr Widerstand. Vor allem das Volk als letzte und oberste Instanz wollte nicht auf das Recht verzichten, in allen Geschäften oberste und vor allem letzte Legitimationsinstanz zu sein. Die weitgehende Abstützung der Regierungsgewalt im Volke verleiht der Exekutive eine starke Integrationsgewalt. Oft besteht sogar noch ein patriarchalisches Verhältnis der Menschen zu ihrer Exekutive oder zu ihrem „Vertreter“ in der Exekutive. Sowohl bei kantonalen Regierungen wie auch beim Bundesrat wird erwartet, dass die Gesamtregierung, aber auch ihre einzelnen Mitglieder über dem Parteienstreit stehen. Sie sollen die Interessen des Gemeinwohles ver- wirklichen. Diese besondere Stellung der Exekutive ist umso bedeutsamer, weil sich die Legitimität der Regierung im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Staaten nie von einem König von Gottes Gnaden ableitete. Die Legitimation oligarchischer Herrschaft lag letztlich immer beim Volk, das sich allerdings seiner beschränkten – in den katholischen Kantonen an Gott gebundenen – Souveränität bewusst war. Dies ermöglichte die Erhaltung einer differenzierten und strukturierten Staatsgewalt und verhinderte gleichzeitig die Zentralisierung staatlicher Souveränität in einem Organ. Heute wird diese Volkssouveränität oder Volkslegitimität besonders auf dem Gebiet des Steuerwesens spürbar. Im Bund und in den meisten Kantonen sind neue Steuern und z.T. Steuererhöhungen von der Zustimmung des Volkes abhängig. Was in anderen Ländern die Parlamente allein entscheiden können, steht in der Schweiz dem Volke zu. Dies führt dazu, dass Exekutive und Parlament ihre Leistungen gegenüber dem Volke vertreten müssen, um es für einen positiven Entscheid zu gewinnen. Das Parlament kann sich nicht vom Volk isolieren und zur Finanzierung seiner eigenen Interessen Einnahmen beschliessen. Es unterliegt der gleichen Kontrolle wie die Exekutive. Leistungen des Staates müssen den Stimmbürgerinnen und -bürgern einen spürbaren oder zumindest erkennbaren Nutzen bringen, will die Regierung sicherstellen, dass ihre Vorlage in einer Steuerabstimmung vom Volke honoriert wird. Doch dürfen auch die Mängel der schweizerischen Volkssouveränität nicht übersehen werden. Heute leben gegen 20% Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz. Dieser Bevölkerungsgruppe ist die politische Mitsprache, abgesehen von einigen wenigen Kantonen und Kirchgemeinden, durchwegs verwehrt. Wie lässt sich aber in der heutigen Zeit ein Staat auf der Grundlage der demokratischen Volkssouveränität aufbauen, wenn diese sich auf ca. 80% der wahlberechtigten Bevölkerung beschränkt? Der Bundesrat: ein Sonderfall Die Schweizerische Eidgenossenschaft hat ein auf der Welt einzigartiges Regierungssystem, das einerseits von der demokratischen Geschichte des Landes und andererseits von seiner Multikulturalität bestimmt wird. Der Bund kennt kein monokratisches Staatsoberhaupt. Der Bundesstaat wird vielmehr von einer kollegialen Exekutive geführt, die auf eine feste Amtszeit von vier Jahren gewählt ist. Weder der Gesamtbundesrat noch die einzelnen Mitglieder können während dieser Amtszeit abgewählt werden. Überdies wurden im 20. Jahrhundert alle jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die sich nach Ablauf der Amtszeit zur Wiederwahl stellten, von den eidgenössischen Räten in ihrem Amt für die nächste Amtsperiode bestätigt. Erst zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde eine Kandidatin von der Vereinigten Bundesversammlung nicht wiedergewählt, obwohl sie sich zur Wiederwahl gestellt hat. Die Exekutive wird trotz dieses weiter unten behandelten Ausnahmefalles in der Regel nach Verfassungsusance nicht abgewählt. Im Gegensatz zu den parlamentarischen Regierungssystemen, in denen jeweils die nationale Kammer das Kabinett bestimmt, wird für die Wahl des Bundesrates jeweils eine besondere Wahlbehörde, nämlich die aus beiden Kammern der Legislative gebildete Vereinigte Bundesversammlung eingesetzt. Da diese Wahlbehörde nur zu Wahlgeschäften zusammenkommt, besteht somit auch keine Gelegenheit, die Exekutive während der Amtsperiode der Mitglieder wieder abzuwählen. Der amerikanische Präsident wird über das Verfahren der Wahlmänner der Gliedstaaten vom Volk auf eine bestimmte Amtszeit gewählt. Er ist gegenüber dem amerikanischen Kongress für seine Tätigkeit verantwortlich und kann zwar nicht abgewählt aber über das Impeachment Verfahren auf Antrag des Repräsentantenhauses vom Senat zur Rechenschaft gezogen werden. Die Schweiz hingegen kennt kein Impeachment Verfahren. Gegen ein Mitglied des Bundesrates könnte lediglich mit dessen Zustimmung, bzw. mit Zustimmung des Gesamtbundesrates, oder letztinstanzlich auf Antrag der Strafverfolgungsbehörde durch die Vereinigte Bundesversammlung ein Strafverfahren eingeleitet werden. Allerings muss es sich dabei um Verbrechen oder Vergehen handeln, die nicht mit der Amtsausübung in Zusammenhang stehen.1 Die Realität der halbdirekten Demokratie macht es unerlässlich, dass bereits auf der Stufe der Exekutive ein Gremium tätig ist, das die verschiedenen Volksmeinungen berücksichtigt und in der Lage ist, den notwendigen Kompromiss zu finden, der allein Chance hat, in einer Volksabstimmung eine Mehrheit zu finden. Ein Wechsel zu einem System von Oppositions- und Regierungsmehrheit nach Mehrheitsprinzip des Parlamentes wäre in der Schweiz politisch chancenlos, da es der eigentlichen Opposition einer Volksmehrheit nicht Rechnung trägt. Eine mit der Mehrheitspartei des Parlamentes identische Exekutive nach Westminstermodell hätte im Referendum keine Aussicht auf Zustimmung. Das Volk als „Souverän“ hat gegen Ende des 19. Jahrhunderts die von einer kleinen politischen Mehrheit getragene Regierungspolitik der aus einer kleinen Parlamentsmehrheit zusammengesetzten Exekutive konsequent zurückgewiesen und mit der konstanten Ablehnung der Vorlagen indirekt ein Wahlsystem nach Proporz erzwungen, das zu einer getreueren Wiederspiegelung der gesellschaftlichen Kräfte im Parlament führte. Dieses Parlament musste seinerseits eine Exekutive schaffen, die im Volk eine möglichst breite Unterstützung finden konnte. Dies wiederum war nur mit einem kollegialen Exekutivrat möglich, in welchem die verschiedenen Machtzentren der Gesellschaft, aber auch die unterschiedlichen Ansichten und Kulturen der Bevölkerung vertreten waren und der unabhängig von den Parteien eine Politik führen konnte, die vom großen Konsens des Volkes getragen wurde. Die Gewaltenbeschränkung bestand also weniger in den „Checks and Balances“ zwischen Parlament und Exekutive, wie in den Vereinigten Staaten, sondern im Zwang zum kollegialen Konsens in der „ersten“ exekutiven Instanz und der „zweiten“ parlamentarischen, aus zwei Kammern zusammengesetzten Legislativinstanz. Entscheidenden Einfluss auf das seit 1848 unveränderte Regierungssystem hatte der erst 15 Jahre nach dessen Schaffung beginnende Ausbau der direkten Demokratie, der Ende des 19. Jahrhunderts und im 20. Jahrhundert zu einer konstanten allmählichen Ausweitung der Volksrechte führte. Das 1874 eingeführte Referendumsrecht gegenüber Bundesgesetzen beispielsweise führte dazu, dass diejenigen gesellschaftlichen Kräfte, wie namentlich die Wirtschaft und die Gewerkschaften, die in der Lage waren, ein Referendum und den späteren Abstimmungskampf zu finanzieren, an Einfluss gewinnen konnten. Die Parteien 1 vgl. Art. 61a Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (Systematische Rechtssammlung 170.21), http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/172.010.de.pdf hingegen, die kaum über die finanziellen Mittel verfügen, um einen Referendumskampf zu finanzieren, haben an Einfluss verloren und sind weitgehend zu Organisationen geworden, welche zwar auf die Wahl von Kandidaten für politische Ämter Einfluss nehmen, hingegen auf die programmatische Entwicklung des Landes wenig Einfluss haben. Hingegen haben die verschiedenen Volksabstimmungen und namentlich die Mitwirkung des Volkes bei Verfassungsabstimmungen die Verfassungspolitik des Bundes wesentlich beeinflusst. Zwar haben wenige Volksinitiativen die Gnade beim „Souverän“ gefunden. Jede Verfassungsabstimmung hat aber im Volk einen intensiven Grundsatzdiskurs ausgelöst, der seinerseits entweder in einen Gegenvorschlag des Parlamentes mündete und in der Verfassung verankert wurde oder mittel- oder langfristig zu Gesetzesänderungen führte, die sich auf die Gesamtpolitik des Landes auswirkten. Die Verfassung ist damit von einem Instrument, das die Staatsgewalt ermöglicht aber auch gleichzeitig beschränkt, zu einem Dokument geworden, das überdies die Grundpolitik des Staates wesentlich bestimmt. Damit hat die Verfassung einen wichtigen programmatischen Charakter erhalten. Direktorium der französischen Revolution Während sich die Vorstellung einer geteilten Staatssouveränität zwischen Bund und Kantonen durchsetzen konnte, liess sich die geteilte Souveränität zwischen den Organen des Bundes im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten nur zum Teil verwirklichen. Die Zuweisung gleicher Befugnisse an die beiden Kammern des Parlamentes etwa lässt sich noch mit der amerikanischen, ursprünglich vom England des 18. Jhs. übernommenen Aufteilung der Kompetenzen zwischen Commons und House of Lords vergleichen. Nationalrat (Volkskammer) und Ständerat (Kammer der kantonalen Vertreter) haben gleiche Funktionen und Befugnisse, beschränken aber gegenseitig ihre Macht. Die Organisation der Bundesgewalt wurde aber nicht nur von der amerikanischen, sondern auch von der kurzlebigen Verfassung der Helvetik beeinflusst. Diese übernahm das von MONTESQUIEU beeinflusste Modell einer personellen Trennung der Gewalten. (Vgl. Art. 3 des Entwurfes einer neuen helvetischen Verfassung vom 5. Juli 1800: „Die gesetzgebende, richterliche und vollziehende Gewalt dürfen nie vereinigt werden.“) Nach diesem Modell sind Legislative, Exekutive und richterliche Gewalt personell voneinander getrennt. Im Gegensatz zur parlamentarischen Regierung kann die Exekutive in der Schweiz vom Parlament, aber nicht durch ein Misstrauensvotum abgesetzt werden. Der Bundesrat kann vom Parlament zwar zur Rechenschaft gezogen werden, eine Abwahl durch Misstrauensvotum oder ein Impeachment ist aber nicht möglich.2 Die Bundesversammlung hat lediglich das Recht, nach Ablauf der Amtsperiode über die Wiederwahl der Exekutive zu entscheiden. Während die Vereinigten Staaten die oberste Vollzugsgewalt einem Präsidenten übertragen haben, übernahm die schweizerische Verfassung das System des kollegialen Direktoriums, das sich in der Revolutionsverfassung in Frankreich (1795–99) nicht durchsetzen, aber über die Helvetik mit dem schwei2 vgl. Parlamentsgesetz Art. 141ff. über den Verkehr zwischen Bundesrat und Bundesversammlung http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/171.10.de.pdf zerischen Gedankengut verbinden konnte. Die Versuche, auf Bundesebene ein Präsidialsystem analog den Regierungen einiger Kantone, die unter der Leitung eines Landammanns stehen, zu verwirklichen, sind letztlich am Föderalismus und der Multikulturalität gescheitert. Die Kantone konnten nicht zulassen, dass ein „Landammann“ die umfassende Vollziehungsgewalt des Bundes in sich vereinigt. Sie wollten – wenn auch nicht gleich wie in der Legislative, so doch beschränkt – auch in der Exekutive vertreten sein. Überdies gab es bereits Vorbilder für eine kollegiale Exekutive im Kleinen, vom Schultheiss geführten Rat der Stadtkantone. Der Artikel 132 der Verfassung des 5. „Fruktidor“ des Jahres III (22. August 1795) bestimmte zur Zeit der Französischen Revolution: „Die vollziehende Gewalt ist einem aus fünf Mitgliedern bestehenden Vollziehungsdirektorium übertragen.“ Artikel 71 der ersten von den Französischen Revolutionstruppen der Eidgenossenschaft verordneten Verfassung der Helvetik vom 12. April 1798 lautete: „Die vollziehende Gewalt ist einem aus fünf Mitgliedern bestehenden Vollziehungsdirektorium übertragen.“ Artikel 174 der heute geltenden Bundesverfassung von 1999 bestimmt: „Der Bundesrat ist die oberste vollziehende und leitende Behörde des Bundes.“ Artikel 62 des Bonner Grundgesetzes bestimmt demgegenüber: „Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und aus den Bundesministern.“ „Staatsoberhaupt ist der Bundespräsident, dessen Funktionen als Staatsoberhaupt im Grundgesetz aber nur teilweise umschrieben werden.“ Die französische Verfassung von 1958 umschreibt die verschiedenen Regierungsfunktionen wie folgt: Art. 5 regelt die Funktionen des Präsidenten als Staatsoberhaupt und bestimmt: „Der Präsident der Republik wacht über die Beachtung der Verfassung. Er sichert durch seinen Schiedsspruch die ordnungsgemässe Tätigkeit der öffentlichen Gewalt sowie die Kontinuität des Staates. Er ist der Garant der nationalen Unabhängigkeit, der Integrität des Staatsgebietes, der Einhaltung der Gemeinschaftsabkommen und der Verträge.“ Art. 20: „Die Regierung bestimmt und leitet die Politik der Nation. Sie verfügt über die Verwaltung und die Streitkräfte.“ Art. 21: „Der Premierminister leitet die Tätigkeit der Regierung. Er ist für die Landesverteidigung verantwortlich. Er sorgt für die Ausführung der Gesetze.“ Während die Texte, welche die Funktion des Direktoriums der Französischen Revolution und der Helvetik einerseits sowie die Funktion des jetzigen schweizerischen Bundesrates andererseits umschreiben, sehr ähnlich, ja beinahe identisch lauten, sind die Verfassungstexte, welche die verschiedenen Funktionen der Regierung und des Staatsoberhauptes im parlamentarischen oder präsidentiell/parlamentarischen System umschreiben ganz anders konzipiert, da sie die Regierungsfunktionen zwischen Staatsoberhaupt, Premierminister, Kabinett und Kabinettsminister, z.B. Verteidigungs-, Justiz- oder Finanzminister, aufteilen müssen. Der Vergleich der geltenden Schweizerischen Verfassung mit der Französischen Revolutionsverfassung einerseits und den geltenden modernen Verfassungen andererseits zeigt deutlich, wie sehr das schweizerische Regierungssystem viel eher dem alten revolutionären französischen Modell entspricht und wie wenig es sich mit einer Staatsorganisation vergleichen lässt, die eine doppelspitzige Regierung, aufgeteilt in Staatsoberhaupt und ein vom Premierminister geleitetes Kabinett, kennt. Das Regierungssystem des helvetischen Einheitsstaates konnte sich allerdings nur während kurzer Zeit halten. Der helvetische Einheitsstaat entsprach weder der Tradition noch den besonderen Bedürfnissen einer vielfältigen Eidgenossenschaft. Erst die liberalen Kantone, die im Laufe der Regenerationszeit im Anschluss an die Julirevolution Frankreichs (1830) liberale Verfassungen erliessen, übernahmen zum Teil das Modell der Direktorialverfassung, das übrigens auch mit den alten kollegialen Städteverfassungen verwandt ist. Das tief verwurzelte Misstrauen des Volkes, das keiner Behörde und vor allem keinem Menschen zu viel Macht anvertrauen will, die Tradition des Föderalismus und das bereits in den Städten erprobte oligarchische Kollegialsystem waren wohl die historischen Wurzeln, welche die Verfassungsväter des schweizerischen Bundesstaates dazu bewogen, für die neu zu schaffende schweizerische Regierung ein Kollegialorgan vorzusehen. Nur einem derartigen Kollegialorgan wollte man die Verantwortung übertragen, den durch verschiedene Revolutionen und Bürgerkriege belasteten jungen Bundesstaat zu regieren. In Frankreich währte die Direktorialverfassung nur drei Jahre. Das 1848 begründete schweizerische Regierungssystem hat demgegenüber während 150 Jahren unverändert den Deutsch-Französischen Krieg von 1870, zwei Weltkriege, die Französische Revolution der 1870er Jahre, die russische Revolution, das Dritte Reich, dann die jüngsten Wirtschafts-, Umwelt- und Versorgungskrisen ebenso überdauert wie die grosse Zeitenwende nach 1989 und die Ereignisse des 11. September 2001. In Frankreich hingegen konnte der erste starke Mann, Napoleon, das Direktorium umstürzen. In der Schweiz gelang es weder einem der zur Wahrung der Neutralität gewählten Oberbefehlshaber der Armee (General) während der drei grossen Nachbarkriege noch sonst einer starken Persönlichkeit, den Bundesrat aus den Angeln zu heben. In diesem Sinne ist das Direktorialsystem schweizerischer Prägung, der dritte Typus eines Regierungssystems demokratischer Staaten, das sich seit der glorious revolution von 1689, wenn auch nur in einem einzigen Land, seit fast 200 Jahren behaupten konnte. Das erste Modell, das amerikanische Präsidialsystem, wurde von der englischen Verfassung des 17. Jahrhunderts übernommen, das zweite Modell, das parlamentarische Kabinettssystem, ist wohl das verbreiteteste Modell. Es entspricht dem Konzept der Westminsterverfassung, wie es sich im 19. Jahrhundert in England entwickelt hat. Das französische präsidentielle Modell, das teilweise parlamentarischen und teilweise präsidentiellen Charakter hat, ist teilweise vom Westminstermodell beeinflusst, hat aber seine eigenständigen Wurzeln der französischen revolutionären Geschichte. Grundzüge des Direktorialsystems Das Direktorialsystem ist das einzige Regierungssystem, das die Regierungsfunktion des Staatsoberhauptes, des Premierministers und des Kabinetts in einem Kollegialorgan zusammenfasst und gleichzeitig auf sieben gleichberechtigte Mitglieder dezentralisiert. Aus diesem Grunde kennt die Schweiz die Probleme nicht, welche Verfassungen zu lösen haben, welche die Befugnisse zwischen dem Staatsoberhaupt, dem Premierminister und dem Kabinett aufteilen müssen. Ebenso wenig konnte sich in der Schweiz ein Diktator nach dem Muster der lateinamerikanischen Präsidialverfassungen etablieren. Das Direktorialsystem ermöglicht es, Persönlichkeiten mit verschiedener Parteizugehörigkeit, ohne Koalitionsprogramm einer parlamentarischen Mehrheit in die Regierung zu wählen, womit den Parteien ein unmittelbarer Einfluss auf die Regierung verwehrt bleibt. In der Tat verstehen sich die verschiedenen, dem Bundesrat angehörigen Bundesräte nicht in erster Linie als Parteienvertreter, welche in der Exekutive die Parteiauffassung wiederzugeben haben. Aus diesem Grunde sind sie eher in der Lage, mit den anderen Bundesräten im Kollegium gemeinsame Lösungen zu finden, welche sich als Synthese oder „volonté générale“ präsentieren lassen. Sie wurden auch nicht in die Exekutive gewählt, weil sie einem von den Parteien vereinbarten Koalitionsprogramm unterstehen. Sie müssen vielmehr eigenständig und unabhängig von ihrer Partei ein Regierungsprogramm vereinbaren, das sich gegenüber dem Parlament und dem Volke vertreten lässt. Da es keine Mehrheitspartei gibt, die zusammen mit der Regierung das Ziel verfolgen muss, die nächsten Wahlen zu gewinnen, gibt es weder eine Regierungspartei noch Koalitionspartner, welche die Arbeit ihres Kabinetts stets unter dem Gesichtspunkt beurteilen müssen, ob mit ihren Entscheidungen eine nächste Wahl gewonnen werden kann. Da jeder Bundesrat im Parlament wie auch später in der Referendumsentscheidung beim Volk seine eigene Mehrheit finden muss und da sich dabei mit keiner auch noch so grossen Partei mehr als einen Viertel der Stimmen gewinnen lässt, kann sich das Bundesratsmitglied nie allein auf seine eigene Partei abstützen. Es muss für jeden Entscheid, den es im Parlament und womöglich im Volk durchbringen will, eine besondere, parteiübergreifende Unterstützung finden. Fast alle ursprünglichen Monarchien haben das Westminstermodell in irgendeiner Weise übernommen und dabei entweder den Monarchen als Staatsoberhaupt beibehalten oder einem Staatspräsidenten die entsprechenden Funktionen anvertraut. Lediglich über das amerikanische Präsidialsystem war es letztlich möglich, die Befugnisse des englischen Monarchen zu wahren und diesen durch einen gewählten Präsidenten zu ersetzen. Nach dem Westminstermodell waren die Monarchien verpflichtet, viele Regierungsbefugnisse des Monarchen an den Premierminister und sein Kabinett abzutreten. Nur am Pontomac ist deshalb noch das Staatsoberhaupt identisch mit dem Inhaber der gesamten Exekutivgewalt. Selbst der sehr mächtige französische Präsident muss seine von ihm eingesetzte Regierung der parlamentarischen Mehrheit anpassen. Die Co-habitation in Frankreich hat deshalb eine ganz andere Bedeutung als die „Co-habitation“, mit der der amerikanische Präsident auskommen muss, falls im Repräsentantenhaus und Senat die jeweils andere Partei über eine Mehrheit verfügt. Grundsätzlich haben sich damit fast alle modernen Regierungssysteme entweder vom amerikanischen Präsidialsystem oder vom Westminstermodell beeinflussen lassen. Allein die Schweiz hat das Direktorialsystem der Französischen Revolution übernommen und an schweizerische Verhältnisse angepasst. Die schweizerische Bundesverfassung hat das französische Modell allerdings noch in einem weiteren wesentlichen Punkten ergänzt und abgeändert. Im Gegensatz zum französischen Direktorium zählt der schweizerische Bundesrat nicht fünf, sondern sieben Mitglieder. Ursprünglich plante man zwar auch einen Bundesrat von lediglich fünf Mitgliedern. Vor allem die mittleren und kleinen Kantone verlangten aber eine Erhöhung der Zahl auf sieben, da sie befürchteten, sonst überhaupt nie im Bundesrat vertreten zu sein. Die Mitglieder des Bundesrates (Direktoriums) sind auf eine fixe Amtsperiode von 4 Jahren (ursprünglich 3) durch die Vereinigte Bundesversammlung gewählt. Die Bundesversammlung wählt jedes Mitglied einzeln. Zwar achtet sie auf eine proportionale Vertretung aller Landesteile und aller grossen Parteien. Der Bundesrat ist aber keine Koalitionsregierung, die durch Vereinbarung der Parteien eingesetzt wird. Es gibt Mitglieder des Bundesrates, die zwar einer Partei angehören, aber von der Bundesversammlung gewählt werden, obwohl sie nicht von ihrer Partei zur Wahl vorgeschlagen wurden. Wegen der direkten Demokratie ist die Macht einer Mehrheitskoalition im Parlament ohnehin eingeschränkt, denn das Volk und nicht eine Minderheitspartei ist Opposition der Regierung und des Parlamentes. Dies führt dazu, dass es keine Einheit von Bundesrat und einer Mehrheit im Parlament gibt. Der Bundesrat ist vielmehr im Gesetzgebungsverfahren die unterste Instanz, welche die Gesetzesvorlagen dem Parlament unterbreitet. Das Parlament beschliesst darüber unter Vorbehalt des Volksreferendums. Mitglieder des Bundesrates, die sich nach Ablauf ihrer Amtszeit wieder zur Wahl stellen, wurden im 20. Jahrhundert wie bereits erwähnt auch stets wiedergewählt. Da überdies der Bundesrat bisher noch nie als Gesamtorgan zurückgetreten ist, hat das Parlament seit 1848 immer nur für die frei werdenden Sitze eigentliche Neuwahlen vorgenommen. Die Schweiz ist damit wohl das einzige Land auf der Welt, das seit 1848 eine ununterbrochene Kontinuität seiner Regierung kennt, da nie gleichzeitig alle sieben Bundesräte oder Bundesrätinnen zurückgetreten sind. Im Dezember 2003 wurde nun erstmals seit über hundert Jahren ein Mitglied der Regierung zwar nicht ab- aber nicht mehr wiedergewählt, was faktisch einer Abwahl gleichkam. An Stelle einer Bundesrätin aus der Christlichen Volkspartei (Mitte) wurde aufgrund der starken Zunahme der Schweizerischen Volkspartei (Rechter Flügel) in den Parlamentswahlen eine starke politische Persönlichkeit der rechten Opposition in den Bundesrat gewählt. Diese Wahl und vor allem das Verhalten des Gewählten als Bundesrat haben in der Folge in der Schweiz erneut heftige Diskussionen über das Regierungssystem und das Kollegialitätsprinzip ausgelöst. In Zukunft werden die starken Institutionen der direkten Demokratie wie auch der multikulturellen föderalen Schweiz entweder dafür sorgen, dass auch eine aus Extremen zusammengesetzte Kollegialregierung zum Konsens gezwungen wird oder es muss mit einer grundlegenden Regierungskrise gerechnet werden, falls es den Parteifeinden in der Exekutive nicht gelingt, zu blossen Parteigegnern zu werden.