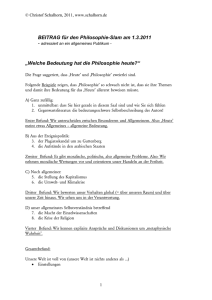PDF Leseprobe - Wilhelm Fink Verlag
Werbung

Markus Rautzenberg · Juliane Schiffers (Hg.) Ungründe Markus Rautzenberg · Juliane Schiffers (Hg.) Ungründe Potenziale prekärer Fundierung Wilhelm Fink Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft Umschlagabbildung: Niels Hillner Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Dies betrifft auch die Vervielfältigung und Übertragung einzelner Textabschnitte, Zeichnungen oder Bilder durch alle Verfahren wie Speicherung und Übertragung auf Papier, Transparente, Filme, Bänder, Platten und andere Medien, soweit es nicht §§ 53 und 54 UrhG ausdrücklich gestatten. © 2016 Wilhelm Fink, Paderborn (Wilhelm Fink GmbH & Co. Verlags-KG, Jühenplatz 1, D-33098 Paderborn) Internet: www.fink.de Einbandgestaltung: Evelyn Ziegler, München Printed in Germany Herstellung: Ferdinand Schöningh GmbH & Co. KG, Paderborn ISBN 978-3-7705-5765-3 Inhalt Markus Rautzenberg und Juliane Schiffers Zur Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 I. Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Rüdiger Zill Gründe und Un(ter)gründe. Zur Metaphorik des Bodens und der Bodenlosigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Gottfried Gabriel Begriffe und Metaphern. Zum Widerstreit zwischen Logik, Rhetorik und Poetik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Juliane Schiffers Geworfenheit, Sorge und Gelassenheit. Passivität als Ungrund bei Heidegger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Ryosuke Ohashi Der »Ungrund« in phänomenologischer Perspektive – immanent, aber interkulturell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 II. Figur und Grund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Peter Bexte »Metaphysische Müllabfuhr«. Anmerkungen zu einem dadaistischen Bonmot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Martin Urmann Die Untiefe des Grundes. Zur Intensität einer Figur des (post-)modernen Dichtens und Denkens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Andreas Wolfsteiner Ungrund, Szenario. Appräsentation und Wahrnehmungsentzug . . . . . . . . . . 115 Hans Stauffacher Yes we can! Über utopische Ungründe des Politischen und die kommende Demokratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 6 Inhalt III. Hintergründe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Alice Lagaay Ungrund, Neutrum, Indifferenz. Ein Versuch mit Salomo Friedlaender (1871–1946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Philipp Stoellger Vom Ungrund der Gründe oder: Was bringt Episteme in Bewegung? . . . . . . 157 Dirk Westerkamp Ungründige Überzeugungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Sybille Krämer Warum für Kant die mathematische Gewissheit nicht auf dem Schlussfolgern beruht. Über die Rolle von Anschauung, Räumlichkeit, Körperlichkeit und Deixis in Kants Erkenntnistheorie . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Danksagung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Markus Rautzenberg und Juliane Schiffers Zur Einleitung Wo fester Grund aufhört, ist es leicht, sich zu verirren. Nicht zuletzt dieser Umstand mag Martin Heidegger dazu veranlasst haben, den Aufbau seiner Vorlesung über den »Satz vom Grund« wie einen philosophischen Wegweiser durch einen undurchdringlichen Wald zu gestalten. Dem Denker der Lichtungen, Feld- und Holzwege hat so eine Vorgehensweise sicher generell recht nahe gelegen und doch ist die topografische Metaphorik undurchdringlichen Dickichts, schummriger Lichtverhältnisse, vorsichtiger Annäherungen, Umwege und gewagter Sprünge von ihm selten so eindringlich wie in dieser Vorlesung inszeniert worden. Ein kurzes Zitat mag einen Eindruck geben von der Art und Weise, wie sehr Heidegger hier dramatisch zuspitzt und eine Technik verwendet, die man, wenn es sich bei dem Vorlesungstext um einen Roman oder einen Film handeln würde, als foreboding bezeichnen könnte. Unheilschwanger bereitet uns der Philosoph auf jenen Weg vor, der – entlang der Frage nach dem Grund – zunächst nicht in eine Lichtung, sondern immer tiefer in das Dickicht führt, dorthin, wo Orientierung sehr schwer fällt: »Der Satz vom Grunde ist es also, der sogleich ein seltsames Licht auf den Weg zum Grund wirft und uns zeigt, daß wir, wenn wir uns auf die Grundsätze und Prinzipien einlassen, in eine merkwürdig zwielichtige, um nicht zu sagen gefährliche Gegend gelangen.«1 Die Aufsätze dieses Bandes, die auf die gleichnamige Tagung »Ungründe. Perspektiven prekärer Fundierung« am Institut für Philosophie der Freien Universität Berlin zurückgehen, haben es sich zur Aufgabe gemacht, sich in diese »gefährliche Gegend« zu begeben. Dabei ist es jedoch wichtig zu betonen, dass es sich bei dem Begriff des Ungrundes keineswegs um ein terminologisches Glasperlenspiel der Philosophie, geschweige denn um eine reine Heidegger-Paraphrase handelt. Vielmehr ist davon auszugehen, dass es sich bei der »gefährlichen Gegend« um einen Aufenthaltsort handelt, der ziemlich genau der geistigen Situation unserer Zeit entspricht. Festen Grund gibt es nicht. Das ist der Befund des zwanzigsten Jahrhunderts, dessen Erben wir sind. Dass in diesem Band vor allem Beiträge aus Philosophie und Bildtheorie versammelt sind, soll daher nicht den Eindruck erwecken, es ginge hier um Spezialprobleme dieser Disziplinen. Aber die Reflexion des Ungründigen hat hier ihren angestammten Platz.2 Man könnte das Thema auch ganz anders angehen und würde doch immer wieder auf ähnliche Denkfiguren stoßen. Stichworte wie 1 Martin Heidegger, Der Satz vom Grund, Stuttgart, 2006, S. 28. 2 Vgl. etwa: Forum für Philosophie Bad Homburg (Hg.), Philosophie und Begründung, Frankfurt am Main, 1987; Gottfried Boehm, Matteo Burioni (Hg.), Der Grund. Das Feld des Sichtbaren, Paderborn, 2012; XXII. Deutscher Kongress für Philosophie der Deutschen Gesellschaft für Philosophie e.V.: Welt der Gründe, September 2011. 8 Markus Rautzenberg und Juliane Schiffers »Risikogesellschaft«3 oder »Cultures of Fear«4 sind Varianten dieser grundständigen Atmosphäre absoluter Ungewissheit. So könnte man das Phänomen des Fundamentalismus (dessen Name ja unübersehbar auf das Problem des Grundes verweist) als Reaktion auf die transzendentale Obdachlosigkeit des 20. und 21. Jahrhunderts thematisieren, dessen Ausprägungen sich nicht nur auf Gewaltakte einzelner Gruppierungen beschränkt, sondern bis zur Kritik Papst Benedikts an Jacques Derridas angeblich ›gefährlichem‹ Relativismus reicht.5 Eine solche Dämonisierung des französischen Philosophen kann nur in einer Zeit funktionieren, in der Ungründigkeit so schmerzhaft empfunden wird, dass es eines Sündenbocks bedarf. Fundamentalismus ist ja, wie der Name sagt, ein krampfhaftes Festhalten an Grund und Begründung, das nur noch mit Gewalt gegen eine Welt zu verteidigen ist, in der solcherlei vermeintliche Sicherheit fraglich geworden ist. Die Unmöglichkeit festen Grundes ist paradoxerweise conditio sine qua non und zugleich einzige Konstante der Welt, in der wir leben. Und um die Ungründe, die diese Welt kennzeichnen, gedanklich zu vermessen, ließen sich Überlegungen aus Ethik und politischer Theorie ebenso miteinbeziehen wie mathematische und naturwissenschaftliche Fragestellungen. Es scheint fast, als könne die Geistes- und Wissenschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts als eine Geschichte der Ungründe rekonstruiert werden. Eine weitere Arbeitshypothese ist aber, dass die Ungründigkeit unserer Begründungen nicht nur eine Negation letzterer ist; das Präfix Un- also nicht einfach nur einen Begriff in sein Gegenteil wendet, was der rein grammatischen Definition dieser Wortkonstruktion entspräche. Es reicht nicht, mit dem Begriff des Ungrundes einen Entzug festzustellen, die Schwierigkeit der Verobjektivierung oder die Unmöglichkeit eines ersten Prinzips. Den Anspruch einer Fundierung ganz außer Acht zu lassen in der Analyse des Seins und des Seienden, des Sichtbaren und des Sagbaren, das kann nicht der letzte Schluss sein. Denn auch, wenn nichts außerhalb der Reihe steht als letzter Grund, muss die Möglichkeit für Neues, für Veränderung und für Zerstörung, die Möglichkeit für Kritik gedacht werden können. Der Befund der Ungründigkeit impliziert deshalb nicht automatisch einen existenziell aufgeladenen Nihilismus, denn Ungründe sind auf je spezifische Weisen immer noch Gründe. Nur so ist erklärbar, dass das »Un-« eine solch beispiellose ideengeschichtliche Karriere machen konnte. Unheimliches, Unbewusstes, Unbestimmtes, Unbegriffliches oder Unverborgenes, um nur einige der wichtigsten Beispiele des 20. Jahrhunderts zu nennen, zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass das Negierte als Negiertes stets auf eine je spezifische Weise mitgeführt wird. Noch die Wahl des »Unworts des Jahres« zeigt ja nichts anderes als die als penetrant empfundene Omnipräsenz des jeweiligen Wortes. 3 Ulrich Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt am Main, 1986. 4 Uli Linke, Danielle Smith (Hg.), Cultures of Fear: A Critical Reader, Chicago, 2009. 5Joseph Ratzinger, »Auf der Suche nach dem Frieden: Gegen erkrankte Vernunft und mißbrauchte Religion«, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11. Juni 2004, S. 39. Zur Einleitung 9 Dies gilt auch noch für jene Denkbewegungen neueren Datums, die im Namen einer objekt-orientierten Philosophie im Anschluss an Bruno Latour und Martin Heidegger oder des Spekulativen Realismus dem Kantschen »Korrelationismus« zugunsten der Restituierung einer vom menschlichen Bewusstsein unabhängigen Seinsqualität der Dinge eine Generalabsage erteilen. Philosophen wie Quentin Meillassoux,6 Ray Brassier,7 Eugene Thacker8 oder Graham Harman9 entdecken im Kant’schen Projekt einen Schutzwall gegen eine Realität, die den Begründungssorgen des Menschen indifferent gegenübersteht. Die Welt ist, so die These, nicht immer schon in Bezug zu den Erkenntniskräften des Menschen zu denken, sondern steht Letzteren letztlich fremd und gleichgültig gegenüber. Die Idee von der Beobachterabhängigkeit der Wirklichkeit gilt hier als Ursünde neuzeitlicher Philosophie insbesondere im Anschluss an Kant; eine Ursünde, die noch bis zum Poststrukturalismus reiche. Der so (wieder-)entdeckte abyssus intellectualis10 ist nicht nur Abgrund, sondern eben auch ein Ungrund11, auf dem eine Philosophie basiert, die nicht mehr als »Amtssiegel für gesunden Menschenverstand« verstanden werden will oder ihre Aufgabe darin sieht, »archivarische Nüchternheit« zu praktizieren.12 Vielmehr gehe es darum, die Philosophie ihrer falschen Begründungsanmaßung zu entledigen und eine »philosophy of futility«13 zu ermöglichen: »Thought that stumbles over itself, at the edge of an abyss.«14 Gemeint ist eine Philosophie, welche das Scheitern des Denkens an sich selbst als integral für jede philosophische Bemühung betrachtet und nicht als vermeidbaren Fehler. Im Unbewussten etwa ist das Bewusstsein ja auch nicht einfach abwesend, sondern auf eine bestimmte Weise modifiziert mit-anwesend; ebenso ist das Unbewusste stets in das Bewusste verwoben und durchwirkt so das Bewusstsein. Witze, Versprecher, Träume sind Weisen des Sich-Zeigens dieser Verflochtenheit. Heidegger hat – und unter anderem deswegen ist er für diese Thematik so einschlägig – mit dem Begriff der a-letheia einen Prototyp dieser Denkfigur ins Zentrum seines Denkens gestellt und man könnte leicht die These untermauern, dass die kontinentale Philosophie nach Heidegger sich an diesem Problem stetig abgearbeitet hat, einem Problem, das nicht nur in Griechenland, sondern in Heideggers Fall sicher vor allem in Husserls Konzept der Appräsentation verwurzelt ist. Heideggers voraristotelischer Wahrheitsbegriff als Un-Verborgenheit, so seine Übersetzung, ist ja 6 Quentin Meillassoux, Nach der Endlichkeit, Berlin, Zürich, 2008. 7 Ray Brassier, Nihil Unbound, Basingstoke, 2010. 8 Eugene Thacker, In the Dust of this Planet. Horror of Philosophy Vol. 1, Winchester (UK)/Washington (USA), 2011. 9 Graham Harman, Tool-being. Heidegger and the Metaphysics of Objects, Chicago, 2002. 10 Armen Avanessian, Björn Quiring (Hg.), Abyssus Intellectualis, Berlin, 2013. 11Eugene Thacker zitiert explizit Jakob Böhmes Konzept des Ungrundes, vgl: Thacker, In the Dust, S. 139 ff. 12 Graham Harman, »Über den Horror der Phänomenologie: Lovecraft und Husserl«, in: Avanessian, Quiring, Abyssos, S. 83–106, hier S. 85. 13 Eugene Thacker, Starry Speculative Corpse. Horror of Philosophy Vol. 2, Winchester (UK)/Washington (USA), 2015, S. 15. 14 Ebd., S. 14. 10 Markus Rautzenberg und Juliane Schiffers eben nicht Offenbarung. Unverborgenheit ist ein Sich-Zeigen, dessen Offenbarsein sozusagen widerwillig ist, von Spuren des Vorgangs der Ent-Deckung noch stets gekennzeichnet bleibt, genauer, dessen Sein überhaupt nur in diesem Vorgang der Entdeckung besteht. Festzuhalten bleibt die Frage, ob es sich bei der Denkfigur des »Un-grundes«, die sich in den genannten Begriffen zeigt, vielleicht gerade deswegen nicht um eine einfache Negation handelt, weil es hier um eine Problematisierung der Unterscheidung von positiv und negativ selbst geht? Im Unverborgenen ist ja nicht einfach das zuvor Verborgene jetzt schlicht entborgen, sondern in seiner Verborgenheit offenbar. Diese Dynamik verweist auf ein Drittes jenseits von Präsenz und Absenz, weshalb eine rein negativitätstheoretische Analyse zu kurz greift. Hans-Jörg Rheinbergers Theorie des Experimentalsystems etwa kann als Versuch gelesen werden, das Prinzip des Ungrundes als Konstituens naturwissenschaftlicher Forschung auszuweisen. Bekanntlich wendet sich Rheinbergers Theorie des Experimentalsystems gegen die Ansicht, Experimente wären schlicht Überprüfungsverfahren zuvor aufgestellter Hypothesen. Vielmehr müsse ein Experimentalsystem so eingerichtet sein, dass es in die Lage versetzt, noch unbekannte Antworten auf Fragen geben zu können, die auch der Experimentator noch gar nicht zu stellen in der Lage ist, so eine der Formulierungen Rheinbergers in Experimentalsysteme und epistemische Dinge.15 In einem solchen Forschungssetting wechseln Begründung und Ergebnis, Ursache und Wirkung ständig die Rollen. Der Forschungsgegenstand, auf den sich ein Experiment bezieht, und das technisch-diskursive Setting, mit dem es beobachtet wird, stehen in einem reversiblen Begründungsverhältnis. Rheinbergers berühmte Unterscheidung von epistemischem Ding und technischer Be-dingung, also Forschungsgegenstand und Beobachtungssetting, ist daher rein funktional und keine ontologische Qualifikation. Gängige technische Werkzeuge können im Forschungsgang in Zusammenhänge geraten, die über ihre ursprüngliche Zwecksetzung hinausgehen und somit unversehens zu epistemischen Dingen werden. Umgekehrt können epistemische Dinge zu technischen Bedingungen für die Beobachtung und Konstitution anderer Forschungsgegenstände dienen. Dies alles ist keine Relativierung naturwissenschaftlicher Forschung, im Gegenteil: Vielmehr handelt es sich um die Begründung der experimentellen Forschung in der vollen Komplexität ihrer eigenen performativen Dynamik. Diese Dynamik selbst allerdings ist ungründig, d. h. der Grund wird fraglich, flexibel, dynamisch. Das Sich-Selbst-in-FrageStellen von Grund und Begründung kann somit als innerstes Prinzip des Experimentalsystems begriffen werden. Der Erfolg der Bildwissenschaft und avancierten Bildtheorie der letzten Jahrzehnte kann wiederum durchaus auch darauf zurückgeführt werden, dass hier in Gestalt der Figur/Grund-Dynamik die Ungründigkeit der aisthesis noch einmal prominent thematisch werden konnte, und zwar – und das ist die spezifisch neue 15Hans-Jörg Rheinberger, Experimentalsysteme und epistemische Dinge, Frankfurt am Main, 2006, S. 25. Zur Einleitung 11 Wendung dieser Bildtheorie – nicht unter dem Vorzeichen poststrukturalistischer Absenzmetaphorik, sondern im Zeichen der Fülle der Potentialität. Nimmt man sich zum Beispiel Gottfried Boehms Begriff der ikonischen Unbestimmtheit16 vor, der ein wichtiger Bestandteil seines Konzepts der ikonischen Differenz ist, so wird man leicht erkennen, dass es sich für ihn um ein, wenn nicht vielleicht das Kernproblem der »Bilderfrage« handelt. Die von Boehm als Kennzeichen des Bildlichen attestierte »Logik der Intensität«17 ist als energetische Aufladung des Bildgrundes mit Potentialität zu verstehen: »Die Unbestimmtheit, die Husserl in der Abschattung des Gegenstandes identifiziert, wandert im Falle visueller Darstellungen von seiner Rückseite in den Grund der Darstellung selbst.«18 Man beachte, dass hier das Wesen des Bildlichen identifiziert wird mit seiner visuell gerade nicht-sichtbaren Potentialitätsfülle. Husserls Begriffe der Abschattung und Appräsentation betonen die Fülle dessen, was gerade nicht wahrgenommen werden kann, allerdings nicht in dessen schlichter Abwesenheit, sondern in einer spezifischen Verwobenheit ins Sichtbare selbst, die für Letztere konstitutiv ist. Zwar ist der Wahrnehmung immer nur ein winzig kleiner Ausschnitt der Welt zugänglich, aber die Welt ist in der Wahrnehmung trotzdem keine Pappkulisse. Ihre uns jeweils abgewandten Seiten bilden die Rahmung und den Grund der Wahrnehmung und sind deswegen ins Sichtbare verwoben, ohne selbst sichtbar zu sein. Für Husserl ist das Abgeschattete, Appräsente daher im »Kerngehalt der Wahrnehmung verbildlicht«19. In der »ikonischen Unbestimmtheit« Boehms zeigt sich der Grund des Bildes als »Träger von Energie« und diese Energie wiederum wird mit der Potentialität identifiziert, welche der Unbestimmtheit des Appräsentierten innewohnt. Der Ungrund kann so als ein Rest verstanden werden, der nach der Analyse eines Zusammenhangs zurückbleibt, wie ein von allen Bedingungen befreites Lächeln. Oder als eine Potentialität, die den Begriffen zu entgehen scheint, dann aber doch in ihnen wirksam ist – und es als Möglichkeit zur Veränderung auch bleibt. In jedem Fall hängt der Ungrund mit der Frage nach ihm zusammen: Er kommt der Reflexion nicht von außen zu. Aber es bedarf eines anderen Verständnisses von Reflexivität, als es ein feststellendes Denken, und sei es auch ein Denken der Negativität, liefern kann. Der Ungrund artikuliert sich nicht außerhalb eines Begründungsversuchs und er artikuliert sich auch nicht, ohne dass zugleich eine Erfahrung gemacht wird. Das kann eine Erfahrung der Grenzen der Erkenntnisfähigkeit sein, des Unvermögens, die begründende Kraft des Ungrundes selbst noch einmal zu begründen. Oder eine sinnliche Erfahrung der Verunsicherung, wie sie etwa Francis Bacons Bilder evozieren, wenn die Figur sich in Intensitäten auflöst und nichts als eine verzeitlichte, ungerichtete Bewegung im Bild zurückbleibt. Was ein 16Gottfried Boehm, »Unbestimmtheit. Zur Logik des Bildes«, in: Ders., Wie Bilder Sinn erzeugen, Berlin, 2007, S. 199–213. 17 Ebd., S. 211. 18 Ebd., S. 210. 19Edmund Husserl, Logische Untersuchungen, Hamburg, 2009 (= Husserliana XVIII, hg. von Elmar Holenstein, Den Haag, 1975, und Husserliana XIX/2, hg. von Ursula Panzer, Den Haag, 1984), S. 589. 12 Markus Rautzenberg und Juliane Schiffers Ungrund sein kann, was er vermag, hängt von der Art und Weise ab, wie die Frage gestellt wird – und von wem und in welchem Feld. Er verändert dann aber auch den Fragenden selbst: Das ist die Logik der Sensation, die Gilles Deleuze in Bacons Bildern findet,20 anders gesagt, die Logik der Erfahrung des Ungrundes. In diesem Sinne ist die Frage nach dem Ungrund der Frage nach der Wahrheit verwandt: als eine Frage, die es erfordert, sich selbst infrage zu stellen, an die Grenzen des Eigenen zu gehen und von dort aus die Kehrtwende zu vollziehen – so wie Derrida die Grenze begreift, die der Tod den Möglichkeiten des Verstehens setzt.21 Die Frage nach dem Ungrund zu stellen bedeutet, eine Erfahrung mit dem eigenen Sein zu machen: sich mit all den Kategorien, die es erlauben, etwas als etwas zu klassifizieren und damit auch handelnd in der Welt zu sein, aufs Spiel zu setzen. »Wer sich auf derartige Experimente einlässt, riskiert in der Tat nicht so sehr die Wahrheit seiner eigenen Aussagen, als vielmehr die Art seines Existierens, und er vollzieht, auf dem Feld seiner subjektiven Geschichte, eine anthropologische Mutation, die auf ihre Art ebenso entscheidend ist, wie es einst die Befreiung der Hand für die Primaten im Stadium des aufrechten Gangs war, oder, für die Reptilien, die Umformung der vorderen Gliedmaßen, die sie in Vögel verwandelte.«22 Was sich dann als veränderlich erweist, ist nicht nur der Modus des Erkennens. Was sich als veränderlich erweist, lässt sich besser ontologisch fassen: Es ist das Sein selbst. Die Dinge wie auch das von Grund auf Eigene erscheinen dann nicht anders als sie sind – sie werden andere. Es ist erahnbar, dass es sich bei der skizzierten Denkfigur des Ungrundes um eine Fragenmaschine handelt, die durchaus in ›gefährliche Gegenden‹ führt, ›gefährlich‹ zumindest, so lange man sich der gravitas der Fragestellung vollkommen unterwirft. Es sei jedoch zumindest darauf hingewiesen, dass man es hier nicht nur mit Abgründen, sondern auch mit playgrounds zu tun hat. Ungründe entfesseln Kreativität und verweisen auf den Reichtum des Möglichen. Der Gang in den dunklen Wald mag bedrohlich wirken und gegebenenfalls auch gefährlich sein, aber besteht nicht gerade darin seine Verlockung? Zwar lauern Gefahren überall des Weges, aber es fehlt nicht an mehr oder weniger freundlichen Gesellen, die einem mit Rat und Tat zur Seite stehen. In jenen Büchern etwa, die den Oxforder Mathematiker Charles Lutwidge Dodgson unter seinem Pseudonym Lewis Carroll berühmt gemacht haben, gibt es einen solchen Wegweiser. Und zwar in Gestalt einer Katze, die philosophische Ungründigkeit mit visueller Unbestimmtheit verbindet. Carroll, der nicht nur als Mathematiker und Schriftsteller tätig war, sondern auch das seinerzeit noch neue Medium der Fotografie meisterlich beherrschte, hatte das Talent, philosophische Probleme zu Bildern zu formen. Die Cheshire Cat, die mal hier, mal dort ist und sich in immer neuen Zwischenstufen der Sichtbarkeit zu 20 Gilles Deleuze, Logik der Sensation, München, 1995, S. 73. 21 Jacques Derrida: Aporien. Sterben – Auf die ›Grenzen der Wahrheit‹ gefaßt sein, München, 1998. 22Giorgio Agamben, »Bartleby oder die Kontingenz«, in: Ders.: Bartleby oder die Kontingenz gefolgt von Die absolute Immanenz, übers. v. Maria Zinfert u. Andreas Hiepko, Berlin: Merve, 1998, S. 7–75, hier S. 49 [leicht veränderte Übersetzung d. Verf.]. Zur Einleitung 13 befinden scheint, bietet Alice Orientierung durch Verwirrung an. Und aufgrund dieser Gleichzeitigkeit von logischer Ungründigkeit und visueller Unbestimmtheit wirkt sie ebenso gefährlich wie faszinierend. So scheint auch Alice die Situation zu beurteilen, wenn es heißt: »The Cat only grinned when it saw Alice. It looked good – natured, she thought: still it had very long claws and a great many teeth, so she felt that it ought to be treated with respect.«23 23 Lewis Carroll, Alice in Wonderland, New York, 2012, S. 52. I. Grundlagen Rüdiger Zill Gründe und Un(ter)gründe Zur Metaphorik des Bodens und der Bodenlosigkeit Präludium: Variationen über das »Un« »Ungrund« ist ein widerständiges Wort. Für das unbewaffnete Auge sieht es fremd aus, wir kennen es nicht aus unserem Alltagsverständnis. Gründe, ja; Abgründe, Untergründe, Hintergründe auch, aber Ungründe? Erst wenn wir die Fernrohre einschlägiger Enzyklopädien zu Hilfe nehmen, merken wir, dass es für einige Theoretiker wie Jakob Böhme oder Friedrich Wilhelm Joseph Schelling zu ihrer philosophischen Spezialterminologie gehört hat. Und das Grimm’sche Wörterbuch verrät uns zudem, dass auch die Literatur des 18. Jahrhunderts den Begriff kennt. Sie habe sich verleiten lassen, vor einem Gericht, dessen Legitimität sie nicht anerkenne, »ein Ohr zu leihen jenen Klagepunkten und ihren Ungrund darzuthun«, verkündet Maria Stuart bei Schiller.1 »Ungrund« ist hier also die Negation des Grundes: Grundlosigkeit, Unbegründetheit.2 Heute ist das Wort immerhin so ungewohnt, dass wir stutzen. Indem es dem Sprachfluss ein Hindernis entgegensetzt und für Verwirbelungen der Aufmerksamkeit sorgt, erzeugt es eine Art philosophischen Verfremdungseffekt. Anders als eindeutige Neologismen, die einer Fachterminologie zugeschrieben werden können, sind es oft gerade die leichten Verschiebungen in der Sprache, über die das Denken stolpert. Daher stellt sich die Frage: In welchem Verhältnis steht das »Un« eigentlich zu den »Gründen«? »Worin besteht die innere Logik der Denkfigur des ›Un‹, die gerade im zwanzigsten Jahrhundert unter postmetaphysischen Vorzeichen eine so steile Karriere gemacht hat (Unbegrifflichkeit, Unbewusstes, Unheimliches), worin ihre Attraktivität?«3 »Un« hat zunächst die Funktion der Verneinung, der einfachen Negation: »Unproblematisch« ist etwas, das nicht »problematisch« ist, »Unschuld« die Abwesenheit von »Schuld«, »Unruhe« die Zersetzung der »Ruhe«. Allerdings können diese Negativformen mit der Zeit auch ein Eigenleben annehmen. So wenn der positive 1Friedrich Schiller, Maria Stuart I, 7, in: Schillers Werke (Nationalausgabe) IX (Neue Ausgabe, Teil I), Weimar, 2010, S. 35 (712 f.), vgl. a. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, Bd. 24, Sp. 1031. 2Schiller steht hier in einer Tradition, die seit dem 16. Jahrhundert »Ungrund« vor allem als juristischen Terminus im Sinne eines falschen Beweisgrunds oder eines fehlenden Rechtsgrunds benutzt, vgl. Grimm/Grimm, Deutsches Wörterbuch, II.1. 3 Exposé der Tagung, vgl. auch die Einleitung von Markus Rautzenberg und Juliane Schiffers in diesem Band. 18 Rüdiger Zill und der negative Begriff noch aufeinander verwiesen, in ihren Konnotationen aber doch auseinander gewandert sind. Zwar ist »Unheil« das Gegenteil von »Heil«, doch ist die Positivform in diesem Fall viel stärker religiös aufgeladen als ihre Verneinung, die man gelegentlich auch einfach synonym mit »Unglück« verwenden kann. Selbst »Unschuld« hat Nebenbedeutungen entwickelt, die wir heute nicht einfach mehr als Schuldlosigkeit verstehen würden.4 Schließlich kann das ursprünglich Negierte zwar in der Sprachgestalt noch anwesend, aber doch so ferngerückt sein, dass es kaum noch mitgehört wird. Die eigentliche Verneinung verwandelt sich in eine positive Bedeutung eigenen Rechts. Das »Unheimliche« ist sprachgeschichtlich nichts anderes als das nicht Heimliche, im Sinne von »nicht zum Heim«, zur Geborgenheit Gehörige, wird aber heute für etwas Beängstigendes, Grauen Erregendes verwendet, ohne dass die ursprüngliche Koppelung noch Teil unseres aktiven Sprachschatzes wäre. Die einstige Verknüpfung muss sogar bei der Untersuchung des Unheimlichen erst wieder hergestellt werden, ohne dass dabei die aufgeladene Bedeutung wirklich rekonstruiert werden könnte.5 Interessanter wird es im Fall von nicht einfach kontradiktorischen Begriffspaaren: Untote zum Beispiel, Zombies also, sind nicht ordentlich tot, aber auch nicht einfach lebendig. Sie sind doch eigentlich Tote, die sich nur wie Lebende benehmen. Sie sind, philosophisch gesprochen, das Andere an sich selbst. Ganz ähnlich verhält es sich mit der »Unbegrifflichkeit«. Denn was wäre hier die Negation des Begriffs? Sie ist gerade nichts Außersprachliches; kein Ding. Aber mit Unbegrifflichkeit ist auch nicht jedes Denkmittel jenseits des Begriffs gemeint. Bilder zum Beispiel sind nicht begrifflich, aber sie sind nicht unbegrifflich. Unbegrifflichkeit ist etwas Sprachliches wie der Begriff. Und darüber hinaus sind ihre Grenzen zum Begriff äußerst unscharf. Die Unbegrifflichkeit, so der Vorschlag, ist selbst als das Andere des Begriffs zu verstehen, aber nicht das Ganz Andere, sondern das andere an ihm selbst. Welcher Logik folgt aber der Ungrund? Handelt es sich hier um eine einfache Negation wie bei Schillers Maria Stuart? Nun ist die erste Komplikation dieses Begriffs das Ineinanderspiel begrifflicher und unbegrifflicher Elemente. Zudem hat sich das Wort in zwei Begriffe aufgespalten, die aber nach wie vor miteinander korrespondieren: den tektonischen und den rationalen Grund. Der rationale Grund im Sinne von Begründung ist ursprünglich eine Metapher, die aus dem tektonischen Grund im Sinne einer Gründung, eines Fundaments entstanden ist. Sie ist, zugegeben, heute eine meist tote Metapher, oder besser: eine untote. Denn obwohl wir den rationalen Grund inzwischen in der Regel rein begrifflich benutzen und die Herkunft aus der Tektonik nicht mehr im Blick haben, so ist dieser altmetaphorische Hintergrund noch latent aktiv und wird 4So definiert der Duden zum Beispiel neben »Freisein von Schuld an etwas« Unschuld auch als »Reinheit« bzw. »(auf einem Mangel an Erfahrung beruhende) Ahnungslosigkeit, Arglosigkeit, Naivität« sowie als »Unberührtheit, Jungfräulichkeit«. 5Vgl. Sigmund Freud, »Das Unheimliche«, in: ders., Gesammelte Werke, London, 1940, Bd. XII, S. 227–278. Gründe und Un(ter)gründe 19 gelegentlich durchaus wiederbelebt, so wenn Karl Marx zum Beispiel schreibt: »Die Erde ist die natürliche Form des logischen Grundes … «6 Der Ungrund kann also die Negation des rationalen Grundes wie auch des tektonischen sein und sich dabei zuweilen aus den Einflüssen beider speisen. Sprachgeschichtlich erscheint der Ungrund übrigens zunächst als Verneinung des tektonischen Grundes. Er löst erst im 16. Jahrhundert das ältere Ab-, In- oder Urgrund ab.7 Der Abgrund ist aber keine abstrakte Negation, sondern eine konkrete. Ein Abgrund ist eine Bodenlosigkeit, die vom Rand eines Grundes her erfahren wird. Doch Ungrund wurde auch im Sinne von Unergründlichkeit verwand; er bezeichnete die Tiefe eines Mediums, das nicht recht trägt, aber doch das es selbst Tragende, den Boden, verdeckt. Grund und Boden So hat der Begriff einen reichen Fundus an Konnotationen, aus dem eine experimentelle Metaphorik schöpfen kann. Experimentell ist Metaphorik dann, wenn sie nicht einfach durch langen Gebrauch zur Formel erstarrt ist, sondern die möglichen Implikationen eines Begriffs in seiner metaphorischen Verwendung austestet und den Bedeutungsreichtum weiterentwickelt. Dieser Bedeutungsreichtum zeigt sich umso mehr, wenn man zudem ein Zwillingswort mit in den Blick nimmt: das des Bodens. Es wird im Folgenden also von Grund und Boden bzw. ihrer Negation, der Bodenlosigkeit, die Rede sein.8 Wir verwenden die Worte »Boden« und »Grund« alltagssprachlich zunächst als zwei zwar eigenständige, aber letztendlich gleichbedeutende oder doch wenigstens meist synonyme Begriffe. Ausnahmsweise kennen wir die enge Koppelung beider Worte in der Wendung »Grund und Boden«. Aber gerade diese Verdoppelung lässt uns stutzen: Kann man beide Worte begrifflich differenzieren? Schon 1802 hat Johann August Eberhard in seinem Synonymischen Handwörterbuch der deutschen Sprache »Boden« als die Unterseite einer Sache definiert (zum Beispiel eines Fasses), dem »Grund« aber noch die »Nebenbedeutung« beigemessen, eine darüber liegende Sache zu tragen (wie im Fall des Grunds eines Hauses oder beim Meeresgrund). »Beide Wörter werden in der Sprache oft verbunden (Grund und Boden)«, heißt es dann weiter, »indem Grund mehr auf das Innere, auf die Fähigkeit, etwas zu tragen (z. B. ein Gebäude), Boden aber mehr auf die 6Karl Marx: Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844. Marx-Engels-Werke, Bd. 40, Berlin, 1968, S. 587 (XXXIII). 7Grimm/Grimm, Deutsches Wörterbuch, Sp. 1030. 8Einen ersten Durchgang durch die philosophische Metaphorik von Grund und Boden habe ich in dem Aufsatz »Metaphern als Migranten. Zur Kulturgeschichte rhetorischer Formen«, in: Matthias Kroß, Rüdiger Zill (Hg.), Metapherngeschichten. Perspektiven einer Theorie der Unbegrifflichkeit, Berlin, 2011, S. 105–140, versucht. Einige Überschneidungen mit diesem älteren Aufsatz – v. a. in den Teilen zum Wiener Kreis und zu Vilém Flusser – ließen sich für die Schlüssigkeit der Argumentation nicht immer vermeiden. 20 Rüdiger Zill Oberfläche, namentlich auf den Ackerboden geht.«9 Aber inwiefern wäre er dann die »Unterseite einer Sache«? Ähnlich definiert schon Johann Christoph Adelung den Begriff »Boden« mit einer widersprüchlichen Wendung, Boden sei »überhaupt das Unterste einer jeden Sache. Besonders, 1. Die Oberfläche der Erde, im Gegensatze des Himmels, ohne Plural.«10 Natürlich kann man ganz einfach sagen: Der Erdboden ist nicht der Boden der Erde, sondern unser Boden, der aus Erde besteht. Aber warum ist er dann nicht viel eher unser Grund? In Eberhards Erklärung klingt aber schon eine andere Nuancierungsvariante mit an: Der Boden unterscheidet sich vom Grund im Maße seiner Festigkeit. So wird »Grund« zur Voraussetzung eines soliden Fundaments, der »Boden« aber findet seine Bestimmung synekdochisch im Ackerboden. Deutlicher spricht Hans Blumenberg das unter dem Titel »Grundverschiedenheiten« in Die Sorge geht über den Fluß aus: »Die Metaphorik des Bodens, in dem alles wurzelt, was wächst und fruchtet und nährt, und die des Grundes, auf dem alles geht und steht, gebaut und errichtet werden muß, was Dauer und Festigkeit haben soll, scheinen sich nicht leicht imaginativ zu vereinbaren: die Wurzel erfordert Durchdringbarkeit und Durchlässigkeit des Bodens, um Baum und Pflanze ins Licht aufsteigen zu lassen, von dem sie erst recht ihr Leben nehmen; das menschliche Gebäude verlangt im Gegenteil für seine Fundamente die felsennahe Dichte und Unlösbarkeit dessen, worauf sie beruhen.«11 Nun werden Grund und Boden nicht nur zu verschiedenen Aspekten einer Sache, sondern nachgerade eine Sache in zwei Zustandsformen, zwei Formen, die einander sogar widersprechen. Die Problematik von Grund und Boden ist bekanntlich konstitutiv für die neuzeitliche Philosophie. Hannes Böhringer schreibt in seinem Eintrag »Bauen« des Konersmann’schen Wörterbuchs der philosophischen Metaphern, ein Eintrag, der an vielen Stellen weniger ein begriffs- oder metapherngeschichtlicher als vielmehr ein am Sprachbild selbst weiterdenkender ist: »Die Philosophie sucht den Grund, der in sich selbst gründet. Auf diesen Grund stellt sie ihren Bau des Wissens, das System der Wissenschaften. Philosophie ist dessen Grundlegung. Gründen heißt anfangen, stiften, Stifte, Pfähle in den Grund zu setzen. Die Philosophie beansprucht, die Fundamente für den Bau des Wissens zu legen. Sie beschränkt sich auf das Wesentliche, Grundlegende und Schwierigste, die Basis. Den Überbau überläßt sie den anderen Wissenschaften oder späteren Zeiten. Wichtig ist nur, daß die Fundamente ›unerschütterlich‹ (inconcussum) sind, sagt Descartes.«12 9Johann August Eberhard, Synonymisches Handwörterbuch der deutschen Sprache (1802), Leipzig, 17 1910, Nr. 325. 10 Johann Christoph Adelung, Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart (1774– 86), 1811, Bd. 1, S. 1107–1110, hier S. 1107. 11 Hans Blumenberg, Die Sorge geht über den Fluß, Frankfurt am Main, 1987, S. 98. 12Hannes Böhringer, »Bauen«, in: Wörterbuch der philosophischen Metaphern, hg. v. Ralf Konersmann, Darmstadt, 2007, S. 34–46, hier S. 41. Gründe und Un(ter)gründe 21 Stifte, Pfähle? Pfahlbauten stehen im Wasser, oder doch immerhin im morastigen Untergrund. Seltsam, das Böhringer ausgerechnet diese Form der Gründung erwähnt, dass er auf prekäre, fast ungründige Untergründe anspielt, nicht auf die felsenfesten. Aber natürlich ist jedes Fundament etwas, dass nicht einfach auf einem Boden steht, sondern in ihn hineinragt, in ihm gewissermaßen »verwurzelt« sein muss. Dann aber sind vielleicht die Unterschiede zwischen architektonischem Grund und agrarischem Boden doch nicht mehr so groß? Nicht zufällig führt Böhringers Überlegung am Ende zu Descartes, dem Gründervater der neuzeitlichen Philosophie, der nach einem unerschütterlichen Fundament in festem Grund schlechthin suchte. Bevor er aber dieses »fundamentum inconcussum« finden konnte, hat ihn sein methodischer Zweifel in einen Abgrund gerissen, »wie bei einem unvorhergesehenen Sturz in einen tiefen Strudel«, sodass er zunächst »weder auf dem Grunde festen Fuß fassen, noch zur Oberfläche emporschwimmen kann«.13 Nun ist das ein prekäres Bild für seine Verfassung, denn keine der beiden von ihm erwähnten Alternativen sind eigentlich wünschenswert. Würde er auf dem Grunde des Strudels festen Fuß fassen, wäre das kaum der Ort, um darauf ein Leben oder eine Wissenschaft zu bauen; könnte er aber die Oberfläche erreichen, wäre zwar sein Überleben gesichert, doch auch dort ist nicht der Ort, um etwas Unerschütterliches darauf zu bauen. Descartes wechselt folgerichtig die Bildwelt, springt metaphorisch an Land: »Dennoch will ich mich herausarbeiten und von neuem ebenden Weg versuchen, den ich gestern eingeschlagen hatte: nämlich alles von mir fernhalten, was auch nur den geringsten Zweifel zuläßt […]«.14 Dann aber geht es doch wieder um den festen und unnachgiebigen Punkt: »Nichts als einen festen und unbeweglichen Punkt verlangte Archimedes, um die ganze Erde von ihrer Stelle zu bewegen, und so darf auch ich Großes hoffen, wenn ich nur das geringste finde, das sicher und unerschütterlich ist.«15 Das Problem solcher Begründungsfiguren ist natürlich immer, dass jeder Grund einen Untergrund braucht. Und dieser Untergrund im Grunde einen noch untergründigeren Grund. Wenn man danach gräbt, kann man hoffen auf das zu treffen, das bei Wittgenstein zwar wie das Ende einer Schatzsuche erscheint, aber doch auch leicht resignative Untertöne hat: den Punkt, an dem sich die Erklärungen erschöpft 13René Descartes, Meditationen über die Grundlage der Philosophie/Meditationes de prima philosophia, Hamburg, 1977, S. 40/41. 14Descartes, Meditationen II, S. 41, 43. Dirk Westerkamp hat schon darauf hingewiesen, dass Wegund Grundmetaphern eng miteinander verbunden sind: »Bemerkenswerterweise wird im deutschen Sprachgebrauch mit der zweiten Übertragung der verinnerlichte und übertragene ›Weg‹ in gewisser Weise wieder veräußerlicht, weil er sich mit dem semantischen Feld einer verwandten Metapher überlagert: Das Begründen als Aufsuchen eines Grundes reflektiert auf eine dem Bildspenderbereich ähnliche Ebene, nämlich auf das materielle Fundament des Weges (und damit auch auf die Metapher des Bauens).« Dirk Westerkamp, »Weg«, in: Wörterbuch der philosophischen Metaphern, hg. v. Ralf Konersmann, Darmstadt, 2007, S. 518–545, hier S. 519. 15Descartes, Medititationen, S. 43. 22 Rüdiger Zill haben, bei dem man »auf dem harten Fels angelangt« ist und der Spaten sich zurückbiegt. Man müsse dann dezisionistisch sagen, so sei es eben, bzw. da Wittgenstein an dieser Stelle über Begründungen von Handlungen redet: »So handele ich eben.« Er erinnert daran, dass man manchmal nicht aus inhaltlichen Gründen nach weiteren Begründungen frage, sondern der Form halber. »Unsere Forderung«, fährt er dann fort, »ist eine architektonische; die Erklärung eine Art Scheingesims, das nichts trägt.«16 Pragmatisch mag das eine Lösung sein, nicht aber da, wo man metaphysisch nach den letzten Gründen fragt. Dort stellt sich immer wieder die Frage nach einem Urgrund, einem Grund, der trägt, selbst aber nicht mehr getragen wird. Den findet man inhaltlich in Gott, terminologisch im »Ungrund«, einem Begriff, der mit dem arbeitet, was Blumenberg Sprengmetaphorik genannt hat.17 Eine Figur wird so sehr ins Extreme getrieben, dass sie sich selbst sprengt und gewissermaßen in ihr Gegenteil umschlägt. Auch hier ist der Begriff eigentlich keine einfache Negation, sondern folgt der Figur des Anderem an sich selbst. Descartes, der die unhintergehbare Begründung auf die Erde zurückholen will, argumentiert nicht sprengmetaphorisch, sondern so, wie es die Theoretiker der Letztbegründung im 20. Jahrhundert noch versuchen werden: reflexiv, d. h. indem man die Argumentation in eine Schleife schickt, aus der sie nicht mehr herauskommt. Er ist auf der Suche nach einem Satz, dessen Leugnung ein später so genannter performativer Selbstwiderspruch wäre, und findet ihn bekanntlich im Cogito ergo sum. Das Ich ist der Grund, der selbst nicht begründet ist und doch nicht geleugnet werden kann. Das ist auf den ersten Blick natürlich ein Geniestreich, hat aber doch den Nachteil, dass sich auf solchen Grund bei näherer Betrachtung so viel nicht bauen lässt. Die Konstruktion ruht zwar in sich, ähnelt aber fatal dem Wittgenstein’schen Scheingesims, das nichts trägt. Ist die Metaphorik damit erschöpft? Unendliche Schichtung von Untergründen: Hans Freyer zwischen Antaios und Herakles Einer der wenigen, die die metaphorische Dimension des Problems weiter ausloten, ist der junge Hans Freyer. Seine lebensphilosophisch-ekstatische Frühschrift Antäus. Grundlegung einer Ethik des bewussten Lebens beginnt er 1918 mit einer durch und durch metaphorisch formulierten Methodenreflexion. Die ersten Sätze 16Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, in: ders., Werkausgabe, Bd. 1, Frankfurt am Main, 1984, S. 350; § 217. Die Formulierung eines sich zurückbiegenden Spatens wäre eine eigene Untersuchung wert. Obwohl man sich nicht vorstellen kann, dass jemand so viel Kraft aufbringt, um das Metall eines Spatens so nachhaltig zu verbiegen, dass er sich sogar zurückwendet, ist die Formulierung doch so bildmächtig, dass sie zum Erfolg dieser Metapher beigetragen haben mag. 17 Vgl. Hans Blumenberg, Paradigmen zu einer Metaphorologie, Frankfurt am Main, 1998, S. 179.