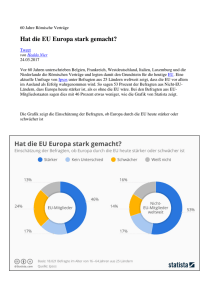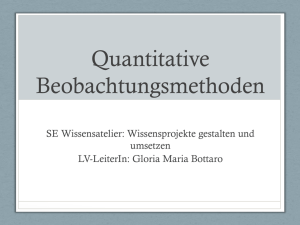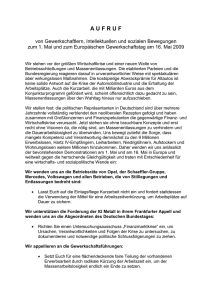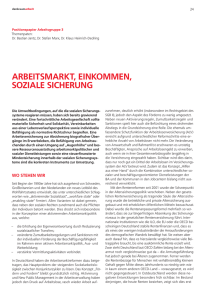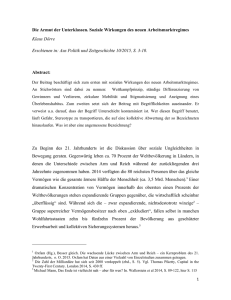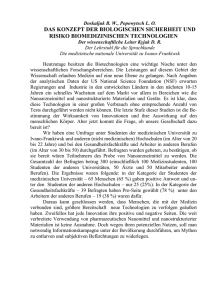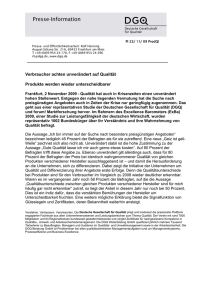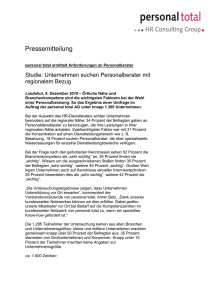Präsentation Doerre - Deutscher Verein für öffentliche
Werbung

Dörre, Klaus (2014): Stigma Hartz IV. Für- und Selbstsorge an der Schwelle gesellschaftlicher Respektabilität. In: Aulenbacher, Brigitte/Dammayr, Maria (Hrsg.) (2014): Für sich und andere sorgen. Krise und Zukunft von Care in der modernen Gesellschaft. Weinheim/Basel: Beltz Juventa, S. 40-52. Stigma Hartz IV. Für- und Selbstsorge an der Schwelle gesellschaftlicher Respektabilität Klaus Dörre Gruppen, die sich durch gravierende ökonomisch-soziale Unterversorgung auszeichnen, befinden sich in sozialer Nähe zu privater oder staatlicher Fürsorge. Das dem Fürsorgestatus stets anhaftende Bedenken, Fürsorgeeinrichtungen könnten die Abhängigkeit und Passivität der Leistungsempfänger verstärken, findet sich schon bei Klassikern der Armutssoziologie. Im Unterschied zu Marx, der den Pauperismus mit dem industriellen Krisenzyklus erklärte und in der Herausbildung einer industriellen Reservearmee eine funktionale Entsprechung zur Akkumulation des Kapitals sah, haben liberale Armutsdiagnosen stets andere Akzente gesetzt. So argumentierte Tocqueville (2006: 72), jede Maßnahme, „welche die gesetzliche Wohltätigkeit“ verstetige, erzeuge „damit eine untätige und faule Schicht, die auf Kosten der Gewerbetreibenden und arbeitenden Schichten“ lebe. Und Simmel (1992: 541) hielt es für eine Unzulänglichkeit der Fürsorge, dass sie ein „Zuviel“ gewähren könne, welches „den Armen zum Müßiggang“ erziehe. Liberale Armutsanalysen wollen so auf eine immanente Widersprüchlichkeit von Institutionen aufmerksam machen, die Sozialbeziehungen an der Schwelle gesellschaftlicher Respektabilität regulieren. Gerade weil sie darauf gerichtet sind, das Los der unteren Schichten etwas erträglicher zu gestalten, ist diesen Institutionen die Möglichkeit eingeschrieben, die soziale Positionierung der Fürsorgebedürftigen zu verfestigen. Fürsorgeeinrichtungen ermöglichen das Überleben in Positionen, die sich gesellschaftlicher Missachtung ausgesetzt sehen. Damit zielen sie jedoch, so jedenfalls die liberale Behauptung, in gewisser Weise auf die Verstetigung dieses sozialen Status, nicht auf seine Überwindung. Wer jedoch beständig auf Fürsorge angewiesen ist, dem geht allmählich die Fähigkeit zur Selbstsorge verloren. Aus einer solchen Perspektive erscheint es geradezu als Akt der Emanzipation, wenn Gesellschaft und Staat die Gewöhnung einzelner an Fürsorgeleistungen aufbrachen, um so die Fähigkeit der betreffenden Personen zur Selbstsorge zu stärken. Dies zu leisten beansprucht die aktivierende Arbeitsmarktpolitik, wie sie seit etwa einem Jahrzehnt in Deutschland praktiziert und inzwischen auch anderen europäischen Ländern zur Nachahmung empfohlen wird. Der nachfolgende Beitrag beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Für- und Selbstsorge, wie es im aktivierenden Arbeitsmarktregime angelegt ist. Die Implementation dieses Regimes, wie sie in Deutschland nach 2003 im Zuge der sogenannten Hartz-Reformen erfolgte, lässt sich als Durchsetzung eines bereichsspezifischen Wettkampfsystems interpretieren. Dies geschieht mittels Umdefinition alter, teils aber auch als Quasi-Institutionalisierung neuer Auswahlprüfungen, die neben dem Zugang zu regulärer oder sozial geförderter Beschäftigung 1 auch die Verfügung über Sozialeigentum, Qualifizierungschancen, Anerkennung und die Integration in soziale Netze regulieren. Im gesamten Prozess der Durchsetzung von Instrumenten und Verfahrensregeln einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik geht es im Grunde um die Etablierung von Prüfungsformaten, in denen sich entscheidet, ob eine Person weiterhin respektiertes Mitglied der Gesellschaft ist, oder ob sie sich dauerhaft mit einem Status arrangieren muss, der unterhalb einer „Schwelle der Sicherheit“ (Bourdieu 2000: 92) und der Respektabilität angesiedelt ist. Da diese Wettkämpfe um Respektabilität mit der kollektiven Abwertung und Stigmatisierung von Leistungsempfängerinnen verbunden sind, bewirkt die aktivierende Arbeitsmarktpolitik jedoch in mancherlei Hinsicht das genaue Gegenteil dessen, was sie zu leisten vorgibt. Sie schwächt die Fähigkeit zur Selbstsorge und erzeugt gerade dadurch Lähmung und Passivität. Zur Begründung dieser Sichtweise wird nachfolgend auf Ergebnisse einer qualitativen empirischen Längsschnittstudie zurückgegriffen (Dörre; Scherschel; Booth u. a.: 2013), in deren Rahmen über sieben Jahre hinweg Expertinnen der Arbeitsmarktpolitik (n = 94) sowie Leistungsbezieherinnen (n = 189) des Arbeitslosengeld II, besser bekannt als Hartz IV, befragt wurden. 1 Wettkampf, Kraftprobe, Wertigkeitsprüfung Zuvor sei jedoch ein Blick auf den theoretischen Rahmen der Untersuchung erlaubt. Nach Luc Boltanski (2010) lässt sich die Akzeptanz sozialer Ungleichheit durch eigensinniges Handeln von Akteuren in obligatorischen Bewährungsproben erklären. Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass ausdifferenzierte kapitalistische Gesellschaften Wettbewerbssysteme hervorbringen, die nach dem meritokratischen Prinzip funktionieren. Menschen müssen sich für Prüfungen qualifizieren, um Zugang zu bestimmten sozialen Positionen zu erhalten. Elementar für den Ansatz sind die Begriffe Wettkampf (bzw. Bewährungsprobe oder Auswahlprüfung), Kraftprobe und Wertigkeitsprüfung. Eine Gesellschaft kann „durch die Natur der von ihr begründeten Bewährungsproben definiert werden“ (Boltanski; Chiapello 2003: 74). Gesellschaften konfrontieren Individuen (Mikroperspektive) oder Klassen von Individuen (Makroperspektive) immer wieder mit Situationen, in denen sie ihre Kräfte messen. Als bloße Kraftproben münden Bewährungsproben in eine Feststellung und gegebenenfalls in eine Fixierung von Kräfteverhältnissen. Moral spielt dabei keine Rolle; es geht allein um den Einsatz von Machtressourcen, um ein Ringen ohne Werturteile, bei dem auch auf Ressourcen zurückgegriffen werden kann, die für das Prüfungsformat eigentlich unspezifisch sind. Anders verhält es sich in der Dimension sozialer Ordnungen, wo das Kräftemessen einem Rechtfertigungszwang unterliegt, „Wertigkeitsprüfungen“ (Boltanski; Chiapello 2005: 311) vorgenommen und moralische Urteile gefällt werden. Hier wird über die Wertigkeit von Personen und Personengruppen im sozialen Gefüge geurteilt. Wertigkeitsprüfungen kommen daher niemals ohne Gerechtigkeitsvorstellungen aus. Der Oberbegriff des Wettkampfs führt beide Konzepte zusammen. 2 Es obliegt den gesellschaftlichen Institutionen, Bewährungsproben „eine Form zu geben, ihren Ablauf zu kontrollieren und dem illegitimen Einsatz externer Ressourcen vorzubeugen“, um Gerechtigkeit zu wahren (Boltanski; Chiapello 2003: 73). In Gesellschaften, in denen viele Bewährungsproben Rechtfertigungszwängen unterliegen, „wird die Stärke der Starken gemindert“ (ebd.). Legitim wird eine Bewährungsprobe durch Institutionalisierung, das Festlegen von Regeln und Prüfungsformaten, die den Wettbewerb steuern. Dabei nehmen die Akteure unweigerlich auf bereichsspezifische Konventionen von Gleichwertigkeit bezug. Dennoch wird die Kraftprobe niemals vollständig durch eine legitime Bewährungsprobe ersetzt. Auch weitgehend institutionalisierte Wettkämpfe sind stets Veränderungen zugänglich und der Kritik ausgesetzt, daher ist die „Verfeinerungsarbeit endlos“ und die Praxis ist „innerhalb eines Kontinuums zwischen einer ‚reinen’ Wertigkeitsprüfung und einer ‚reinen’ Kraftprobe zu lokalisieren (Boltanski; Chiapello 2005: 313 f.), im Wettkampf ist stets beides enthalten. 2 Erwerbslosigkeit als Bewährungsprobe – Zugänge zu Arbeit und Fürsorge Was bedeutet es nun, Arbeitslosigkeit und Arbeitsmarktpolitik als Wettkampfsystem zu interpretieren? Im Leitbild der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik werden Langzeitarbeitslose zu „Kunden“ der Arbeitsverwaltungen, die mittels spezieller Förderungen und strenger Zumutbarkeitsregeln ein eigenverantwortliches, quasi-unternehmerisches Verhältnis zu ihrem Arbeitsvermögen entwickeln sollen. Eine intensivere Konkurrenz zwischen Beschäftigten und Arbeitslosen, aber auch unter den Arbeitslosen selbst, soll den „Reservationslohn“, also das „Einkommen“ von Erwerbslosen, senken und so den Anreiz zur Arbeitsaufnahme erhöhen. Dem liegt die Vorstellung zu Grunde, ein marktgerechtes Verhalten der Erwerbslosen, das auf der Stärkung von Eigeninitiative und Selbstsorge basiert, könne Beschäftigung erzeugen. 2.1 Das Wettkampfsystem des Forderns und Förderns Die Institutionalisierung dieses Leitbildes begründet ein Wettbewerbssystem, das den Arbeitsmarkt und die Arbeitsmarktpolitik auf neue Weise strukturiert. Die Umsetzung und Praxis der Reformen wird zum Gegenstand eines Kräftemessens zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren. Dieses Ringen ist in ein feldspezifisches Rechtfertigungsregime eingebettet, das den Grundsatz „Gerecht ist, was Arbeit schafft“ als Basisregel anerkennt. Dementsprechend sind alle Maßnahmen und Anreize legitim, die Erwerbslose zur aktiven Verbesserung ihrer Beschäftigungsfähigkeit motivieren. Ohne jede Garantie, einen einmal erreichten sozialen Status dauerhaft halten zu können, müssen sich die Erwerbslosen durch Eigenaktivitäten und Selbstsorge für Fördermaßnahmen qualifizieren, vor allem aber den Bezug von Transferleistungen rechtfertigen. Auf diese Weise konstituieren die Arbeitsmarktakteure ein Wettkampfsystem. Erwerbslosigkeit wird nicht nur für Leistungsbezieher, sondern auch für die zuständigen Sachbearbeiter der Arbeitsverwaltungen, die eine Schiedsrichterfunktion ausüben, zur permanenten Bewährungsprobe, die sowohl machtgestütztes Kräftemessen, als auch moralische Wertigkeitsprüfungen umfasst. Entscheidend für die Praxis aktivierender Arbeitsmarktpolitik 3 ist die Sachbearbeiterebene, wo die Auswahlprüfungen im direkten Kontakt mit den „Kundinnen“ durchgeführt werden. Auf dieser Ebene muss ein Profiling betrieben werden, sollen Leistungsansprüche geprüft, Fördermaßnahmen oder Arbeitsgelegenheiten zugeteilt und gegebenenfalls Sanktionen verhängt werden. Vermittler und Fallmanager verfügen über eine gewisse Definitionsmacht, weil sie Handlungsspielräume unterschiedlich ausschöpfen und Zumutbarkeitsregeln mehr oder minder streng auslegen können. Dabei geraten die Sachbearbeiter häufig in einen Zwiespalt zwischen legalen Vorgaben und deren fallbezogener Praktikabilität. In ihrem Selbstverständnis sind sie häufig Arbeitsvermittler und Sozialarbeiter in einer Person. Selbst im Zwiespalt, versuchen die Fallbearbeiter, ihre „Kunden“ auf ein wechselseitiges Geben und Nehmen zu verpflichten. Zugleich fordern sie die Eigenverantwortung der Leistungsbezieher im Sinne einer Gerechtigkeitsnorm aktiv ein. Dementsprechend fühlen sich die Fallbearbeiter geradezu persönlich angegriffen, wenn Vereinbarungen seitens der „Kunden“ nicht eingehalten werden. Das schlägt sich in einem ständigen, wenngleich asymmetrischen Kräftemessen zwischen Fallbearbeitern und Erwerbslosen nieder, in welchem darüber entschieden wird, ob Leistungsbeziehern der Sprung in die Gesellschaft der respektierten Bürgerinnen und Bürger doch noch gelingt. Jede Eingliederungsvereinbarung enthält Anforderungen an die Leistungsbezieher. Diese Anforderungen müssen erfüllt werden, um den Leistungsbezug zu rechtfertigen. Auf diese Weise wird der Leistungsbezug als Wettkampf inszeniert, bei dem die jeweils Erfolgreichen die Norm vorgeben, an denen sich diejenigen zu orientieren haben, die den Sprung in bessere Verhältnisse vorerst nicht geschafft haben. Je schwieriger die Arbeit mit den Erwerbslosen wird, desto eher neigen Sachbearbeiter dazu, die Verantwortung für die Fortdauer des Leistungsbezugs bei den „Kundinnen“ zu suchen. Selbst nach Zielvereinbarungen (Vermittlungsfälle) geführt, konzentrieren sich die Sachbearbeiter zunächst auf jene „Kunden“, die leicht zu vermitteln sind. Ist diese Gruppe vermittelt, verbleiben nur noch die schwierigeren Fälle. Zugleich steigt die Neigung der Sachbearbeiter, den verbliebenen „Kunden“ Vertragsverletzungen vorzuhalten. Wer lange im Leistungsbezug verharrt und somit auf Fürsorge angewiesen bleibt, der verzichtet in den Augen der meisten Sachbearbeiterinnen auf individuelle Autonomie und verhält sich damit geradezu antiemanzipatorisch. Getrieben von dem Ziel, ihre Leistungsvereinbarungen in der Verwaltung zu erfüllen, machen die Fallmanager die Motivation, den „guten Willen“ der Leistungsbezieherinnen zum Selektionskriterium für die Ressourcenverteilung und ihre eigenen Bemühungen. Wer lange im Leistungsbezug verbleibt und sich nicht vertragsgemäß oder gar unbotmäßig verhält, der wird in der Tendenz zum Objekt negativer Klassifikationen und kollektiver Abwertung. Beweist die betreffende Person doch, dass sie sich – weil von Fürsorge abhängig und damit zu umfassender Selbstsorge nicht mehr fähig –, mit dem Ausschluss aus der Gesellschaft respektierter Bürgerinnen zu arrangieren bereit ist. 4 2.2 Prüfungsformate: Eigenverantwortung versus kollektive Abwertung Strenge Zumutbarkeitsregeln, die von den Sachbearbeiterinnen als adäquate Antwort auf nicht vertragsgemäßes Verhalten der „Kunden“ betrachtet werden, erleben die Leistungsbezieherinnen überüberwiegend als bürokratische Disziplinierung und engmaschige Kontrolle ihres Alltags. Strenge Zumutbarkeitsregeln beschränken sich keineswegs auf Sanktionen, von denen trotz deutlicher Zunahme nur eine Minderheit der Erwerbslosen unmittelbar betroffen ist. Die Strenge des Regimes gründet sich auf materielle Knappheit (Regelleistungen unter der Schwelle relativer Armut) und eine teilweise rigide Überwachung von Eigenaktivitäten (Bewerbungen, Maßnahmen, Bereitschaft zu sozial geförderter Beschäftigung). Sie resultiert aus Regeln und Eingriffen, die die Lebensformen der Anspruchsberechtigten betreffen – Aufwendungsgrenzen für die Wohnung oder die Überwachung von Besitz und Zuwendungen (z. B. Höchstgrenzen für geldwerte Geburtstagsgeschenke). Und sie ist nicht zuletzt das Ergebnis ständig wiederkehrender Missachtungserfahrungen in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit. „Als Hartzi bis du nichts“, lautet ein bezeichnender Satz, der so oder ähnlich in vielen Interviews auftaucht. Ganz gleich, wie die Wertigkeitsprüfungen im Einzelfall verlaufen, wer das mit „Hartz IV“ verknüpfte Format absolvieren muss, bekommt in der Selbstwahrnehmung einen Status in der Nähe der Fürsorge und damit unterhalb einer Schwelle gesellschaftlicher Respektabilität zugewiesen. Die damit einhergehende Stigmatisierung trifft Leistungsbezieherinnen, welche in unserem Sample in ihrer großen Mehrheit wenig mit dem Klischee gering qualifizierter und daher schwer vermittelbarer Außenseiter gemein haben. Ausschließlich erwerbslos ist nicht einmal ein Drittel unserer Befragten. Ein weiteres Drittel ist in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen beschäftigt. Das verbleibende Drittel verteilte sich auf erwerbstätige Leistungsbezieher, sogenannte Aufstocker. Dazu zählten sowohl Selbstständige als auch abhängig Erwerbstätige, deren Einkommen das gesetzlich festgelegte Existenzminimum unterschreitet. Bei unseren Befragten finden sich alle Schulabschlüsse. Fast die Hälfte aller Interviewten hat eine Berufsausbildung. Auffällig ist die hohe Zahl an Hoch- und Fachschulabschlüssen mit rund 17 Prozent. Hinzu kommt eine kleine Gruppe von Befragten mit Fachschulqualifikationen. Nur rund ein Fünftel der Befragten besitzt keinen berufsqualifizierenden Abschluss. Ohne Anspruch auf statistische Repräsentativität machen solche Daten deutlich, dass eine überaus heterogene Gruppe Befragter, die auch nach sozialer Herkunft, Erwerbsbiographie, Lebensalter, Familienformen und sozialen Netzwerken erheblich differiert, ohne Unterschied einem Arbeitsmarktregime unterworfen wird, das die Bedürftigen in ihrer Selbstwahrnehmung auf dem Niveau der früheren Sozialhilfe „zwangshomogenisiert“. Gleich ob Beinahe-Rentnerin mit jahrzehntelanger Berufstätigkeit, arbeitslose Akademikerin, jugendlicher Punk mit Szeneverankerung oder ehemalige Sozialhilfebezieherin ohne jegliche Erwerbsarbeitserfahrung – „Hartz IV“ macht sie in gewisser Weise alle gleich. 5 Was eigentlich als großer Fortschritt gedacht war, die formale Gleichstellung von Sozialhilfebeziehern und Arbeitslosen, erweist sich sozialpsychologisch wie sozialstrukturell als überaus problematisch. Selbst Befragte, die aus der ehemaligen Sozialhilfe kommen, fühlen sich keineswegs als Gewinner der Arbeitsmarkreformen. Teilweise ist ihnen die Fähigkeit zu einer eigenständigen Lebensführung, zu umfassender Selbstsorge, tatsächlich abhandengekommen, weshalb sie z. B. die Verantwortung für ihre Finanzen an eine externe Instanz delegieren. Schon aus diesem Grund können sie die formale Gleichstellung mit Erwerbslosen nicht als persönliche Aufwertung betrachten. Arbeitslose wiederum, die lange erwerbstätig waren, sehen sich auf einen Fürsorgestatus zurückgeworfen. Vor allem Frauen in Ostdeutschland, deren Berufsbiographie bis in die Zeit der DDR zurückreicht, betrachten sich im Regime strenger Zumutbarkeit als Verliererinnen. Aus diesem Grund erzeugt die in Verfahren und Regelungen praktizierte soziale „Zwangshomogenisierung“ der Transferbezieher eine Gerechtigkeitsproblematik, die von den Befragten allerdings nur selten offen und ungeschützt ausgesprochen wird. In der Konsequenz bleiben die Auswahlprüfungen des aktivierenden Arbeitsmarktregimes hinsichtlich der ihnen eigenen Gerechtigkeitsmaßstäbe uneindeutig. Ganz gleich wie die individuellen Prüfungen im Wettbewerbssystem der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik ausgehen, das Format selbst sorgt für eine kollektive Abwertung von Fürsorgebedürftigen, Erwerbslosen und Prekarisierten, die sich im Leistungsbezug des ALG II befinden. 2.3 Erwerbsorientierungen eigensinniger „Kunden“ Zur Legitimationsordnung aktivierender Arbeitsmarktpolitik gehört das Versprechen, die Erwerbsneigung der Leistungsempfängerinnen zu verbessern. In den Auswahlprüfungen treffen Sachbearbeiter und Fallmanager allerdings auf Personen mit bereits relativ verfestigten Ansichten und Präferenzen. Was geschieht, wenn Sachbearbeiter mit ihren besonderen Interessen und eigensinnige „Kunden“ mit einsozialisierten Erwerbsorientierungen in Auswahlprüfungen aufeinander treffen, können wir anhand einer Typologie subjektiver Erwerbsorientierungen von Leistungsbeziehern nachvollziehen, die wir im Rahmen einer explorativen, longitudinal angelegten Studie gewonnen haben. Subjektive Erwerbsorientierungen entstehen – in Abhängigkeit von sozialer Herkunft, Bildungsweg und beruflicher Sozialisation – in einem lebensgeschichtlichen Entwicklungsprozess. Unsere Typologie subjektiver Erwerbsorientierungen umfasst drei Dimensionen des Arbeitsbewusstseins: das Tätigkeitskonzept, die normative Arbeitsorientierung sowie die individuellen Kompromissbildungen, die in Abhängigkeit von den antizipierten Chancen zwischen Norm und Tätigkeitskonzept vermitteln, sich zu einem dominanten Verarbeitungsmodus verdichten und so die Typen „schneiden“. Um es vorab zu sagen: Unsere Rekonstruktion der Erwerbsorientierungen von Leistungsbezieherinnen belegt alles andere als einen Verfall von Arbeitsmoral, bürgerlichen Tugenden. Die Befragten sind überwiegend von sich aus bestrebt, sich aktiv für die Auswahlprüfungen des Arbeitsmarktregimes zu 6 qualifizieren. Reguläre Erwerbsarbeit gilt ihnen als Norm, die nicht in Frage gestellt werden darf. Dies ist jedoch keine Leistung des neuen Arbeitsmartregimes und seiner Prüfungsformate. Vielmehr halten die Befragten häufig trotz mehrjähriger Erwerbslosigkeit an subjektiven Erwerbsorientierungen fest, die sie zunächst völlig unabhängig vom Wettkampfsystem des Forderns und Förderns ausgebildet haben. Ihr Hauptbestreben ist es, das mit Hartz IV verknüpfte Prüfungsformat zu verlassen und eine Position oberhalb der Respektabilitätsschwelle zu erreichen. Den Auswahlprüfungen des neuen Arbeitsmarktregimes müssen sie sich unterziehen, ohne dies für sinnvoll und gerecht zu halten. Wir unterscheiden drei Typen von Erwerbsorientierungen. Leistungsbezieher, die wir dem Typus der Um-jeden-Preis-Arbeiterinnen zurechnen, würden ungeachtet strenger Zumutbarkeitsregeln nahezu jede positionsverbessernde Erwerbstätigkeit akzeptieren, die ihnen ein Leben unterhalb einer Schwelle der Sicherheit und Respektabilität erspart. Maßnahmen der Arbeitsverwaltung betrachten diese Befragten häufig als überflüssig oder gar als Drangsalierung, weil das, wonach sie eigentlich streben – reguläre Erwerbsarbeit, die das eigene Leben oberhalb eines kulturellen Minimums dauerhaft absichert – häufig nicht im Angebot der Arbeitsagenturen ist. Leistungsbezieher, die dem Typus der „Als-obArbeitenden“ entsprechen, wollen liebend gerne einer regulären Erwerbstätigkeit nachgehen, müssen sich aber mehr und mehr mit Arbeitsersatz abfinden. Sozial geförderte Tätigkeiten wie Ein-Euro-Jobs empfinden sie nicht als Bestrafung. Vielmehr erlauben es die Arbeitsgelegenheiten zeitweilig, Fassaden der Normalität aufrecht zu erhalten. Eigenaktivitäten, sei es nun das bürgerschaftliche Engagement oder der Ein-Euro-Job, werden subjektiv so umgedeutet, als handele es sich um eine reguläre Erwerbsarbeit. Die Spannungen zwischen Erwerbsarbeitsnorm und Tätigkeitskonzept lassen sich auf diese Weise mildern, aber niemals völlig überwinden. Je länger die Arbeitslosigkeit und die Erfahrung mit prekären Jobs und „Arbeitsersatz“ andauern, desto eher macht sich allerdings ein Bewusstsein eigener Chancenlosigkeit bemerkbar, das sowohl die Tätigkeitskonzepte als auch die normativen Arbeitsorientierungen unter Veränderungsdruck setzt. Nur jene Befragten, die wir dem Typus der Nichtarbeitenden zurechnen, haben mit der hegemonialen Erwerbsarbeitsnorm gebrochen oder sie, auf Zeit, subjektiv außer Kraft gesetzt. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Befragte Frauen, die über viele Jahre im Sozialhilfebezug und niemals erwerbstätig waren, konnten eine Erwerbsorientierung gar nicht ausbilden. Für sie waren Kinder und Familie häufig die letzte und meist auch die einzige Chance, Anschluss an gesellschaftliche „Normalität“ zu gewinnen. Die teilweise zerrütteten Familienstrukturen zeugen jedoch davon, dass auch dieses Normalitätsrefugium eher fiktiv bleibt. Ebenfalls (auf Zeit) blockiert ist die Ausbildung einer Erwerbsorientierung bei Jugendlichen, die in subkulturelle Szenen eintauchen und aus der Not antizipierter Chancenlosigkeit eine Tugend machen, indem sie sich als bewusste Arbeitsverweigerer präsentieren. Wiederum anders gelagert sind Fälle, bei denen Krankheiten oder der Verschleiß in prekären Beschäftigungsverhältnissen die subjektive Erwerbsorientierung allmählich zerstört hat. Auch gibt es besonders 7 im Osten einige wenige „politische Erwerbslose“, die ihre soziale Identität auf den Arbeitslosenstatus gründen, um so die Kränkungen zu verarbeiten, die mit gebrochenen Berufskarrieren einhergehen. Schließlich finden sich gerade in ländlichen Regionen auch Leistungsbezieher, die Transferleistungen mit informeller Arbeit kombinieren und so gut über die Runden kommen. Solche Leistungsbezieherinnen müssen, werden ihre Aktivitäten entdeckt, mit Sanktionen rechnen. Auch deshalb deutet wenig darauf hin, dass sie es sich in der „Hartz-IV-Hängematte“ bequem machen können. Nicht ihr Reservationslohn ist zu hoch, vielmehr sind in den jeweils erreichbaren Arbeitsmarktsegmenten die antizipierten Löhne so gering, die Arbeitsbedingungen in einer Weise belastend und die Beschäftigungsverhältnisse derart unsicher, dass sie keinen wirklichen Anreiz zu Verhaltensänderungen darstellen. Insgesamt lässt sich bei einer großen Mehrzahl unserer Befragten keine Abkehr von der Erwerbsarbeitsnorm feststellen. Eher ist das Gegenteil der Fall. Man hält überwiegend selbst dann so gut es geht an der Norm fest, wenn man bereits ahnt oder gar schon sicher weiß, dass die Chance für einen Sprung in eine sichere und halbwegs attraktive Erwerbstätigkeit eigentlich nicht mehr existiert. Wie die meisten Menschen favorisieren die Befragten nachhaltige biographische Handlungsstrategien, „die darauf zielen, eine gewohnte gesellschaftliche Stellung und Lebensweise im umfassenden Sinne, moralisch wie materiell, zu erhalten“ (Vester 2011: 57). Hartz IV bedeutet für den größten Teil der Befragten jedoch einen gesellschaftlichen Abstieg, mit dem sie sich nur schwer arrangieren können. Deshalb sind sie bestrebt, und das ist das eigentlich Überraschende, nicht nur ihre reproduktiven, sondern auch ihre inhaltlichen, qualitativ-subjektbezogenen Ansprüche an Arbeit so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Selbst in einer Lebenssituation, die z. T. durch extreme materielle Knappheit geprägt wird, streben viele Befragte von sich aus nach gesellschaftlicher Anerkennung, ja nach Möglichkeiten zu Selbstentfaltung und zu autonomer Lebensführung. Erst wenn diese Ansprüche über längere Zeiträume hinweg nicht (mehr) in der Erwerbssphäre einzulösen sind, werden sie auf Alternativtätigkeiten und Alternativrollen projiziert. Dies, das Bestreben, aktiv auf die eigenen Lebensumstände einzuwirken, prägt die Tätigkeitskonzepte der Befragten. Im scharfen Kontrast zum Klischee der passiven Arbeitslosen sind die Leistungsbezieherinnen zu einem erheblichen Teil ausgesprochen aktiv. Um ihre Situation zu verändern oder zumindest einigermaßen lebbar zu gestalten, müssen die Arbeitslosen häufig hart arbeiten. Die Hierarchisierung ihrer Tätigkeit wird allerdings in erheblichem Maße von außen bestimmt. Minijob und verordnetes Praktikum können sich zeitweilig schon zu einer 48-Stunden-Woche summieren. Hinzu gesellen sich Anforderungen aus dem Familienzusammenhang und der Kindererziehung. Trotz aller Anstrengungen kommt, das zeigen unsere Folgeerhebungen, ein Großteil der Befragten beruflich nicht vom Fleck. Nur eine winzige Minderheit hat im Verlauf von sieben Jahren den Sprung in eine Beschäftigung geschafft, die vom Leistungsbezug dauerhaft befreit. Die Mehrzahl befindet sich beruflich und sozial noch immer dort, wo wir sie während der ersten Befragung auch schon angetroffen hatten. Bei 8 einem kleineren Teil der Leistungsbezieherinnen, unter ihnen vor allem Soloselbstständige, zeichnet sich trotz günstiger Konjunktur gar eine Abwärtsmobilität ab. Zudem zeigt sich: Lange Jahre in Arbeitslosigkeit und Prekarität bewirken, dass die Betroffenen regelrecht ausbrennen. Ohne eine realistische Chance auf grundlegende Besserung ihres Lebens, gehen die subjektiven Antriebskräfte für Aufstiegsbemühungen mehr und mehr verloren. 2.4 Bewährungsproben für die Lebensführung Indem es eine reguläre Erwerbsarbeit, sei sie nun prekär oder sicher und anerkannt, zur einzig legitimen Zielstellung erklärt, erzeugt das Wettkampfsystem aktivierender Arbeitsmarktpolitik an der Schnittstelle von Erwerbsarbeit, sozial geförderter Beschäftigung und Erwerbslosigkeit eine soziale Hierarchie, die auf ihre Weise die Perspektive eines Minderheitenstatus festschreibt. Am unteren Ende dieser Hierarchie sind in der Wahrnehmung der „Mehrheitsgesellschaft“ die „faulen Arbeitslosen“, „Sozialschmarotzer“ und „Illegalen“ angesiedelt, Konstruktionen von denen sich nahezu alle Leistungsbezieherinnen vehement abzugrenzen versuchen. Oberhalb davon befinden sich in der sozialen Hierarchie je nach Situation und lebensweltlichem Kontext Ein-Euro-Jobber, Beinahe-Rentner, bürgerschaftlich Engagierte, Maßnahmeabsolventen oder prekäre Soloselbstständige. Sie alle fühlen sich von dem ausgeschlossen, was in der Gegenwartsgesellschaft noch immer Normalität garantiert. Es mangelt an einer stabilen Erwerbsarbeit, die ihnen ein akzeptables Einkommen, soziale Wertschätzung und vor allem eine halbwegs stabile Basis für eine in die Zukunft gerichtete Lebensplanung bieten könnte. Freundschaftsbeziehungen und soziale Netze können die damit verbundenen Unsicherheitserfahrungen nicht oder nur teilweise kompensieren. Zwar lässt sich Robert Castels Arbeitshypothese, derzufolge zunehmende Beschäftigungsunsicherheit mit porösen sozialen Netzwerken korreliert, in dieser Pauschalität nicht bestätigen. Doch einiges spricht dafür, dass ein erheblicher Teil der Leistungsbezieherinnen zu einer Homogenisierung ihrer sozialen Verkehrskreise tendiert. Mit anderen Worten: Die Bewährungsproben des neuen Arbeitsmarktregimes beeinflussen in ihrer Wirkung selbst das Privatleben und die Sozialbeziehungen der Leistungsempfängerinnen. Den Anforderungen an flexible Arbeit im regulären Beschäftigungssystem vergleichbar, konstituieren die Auswahlprüfungen an der Schnittstelle von Erwerbsarbeit und Beschäftigungslosigkeit ein Regime diskontinuierlicher Zeit, das die Leistungsbezieherinnen in besonderer Weise fordert. Auch Erwerblose leiden, so paradox das klingen mag, häufig an Zeitmangel. Sie müssen jede sich bietende Chance nutzen, um ihre Lage zu verbessern. Zum Mini-Job im Reinigungsgewerbe gesellt sich bei einer jungen Langzeitarbeitslosen und Mutter von zwei Kindern mitunter das achtstündige Praktikum. Die Teilnahme an der Maßnahme wiederum ist Voraussetzung für den Bezug von Transferleistungen. Hinzu kommen Schnäppchenjagd und Altstoffsammlung in der freien Zeit, an der sich 9 auch die Kinder beteiligen. Der Mann, als Niedriglohnbezieher ebenfalls im Reinigungsgewerbe tätig, ist bis zum späten Abend außer Haus. In dieser familialen Konstellation wird der Alltag zu einer Dauerprüfung, deren Bewältigung eine erschöpfte Familie produziert. Übermäßiger TV-Konsum auch für Kinder entspringt bei solchen Lebensbedingungen dem Bedürfnis, dem belastenden Alltag wenigstens zeitweilig eine Ruhephase abzuringen. Frei verfügbare Zeit wird in solchen Familienkonstellationen trotz, ja wegen der Erwerbslosigkeit zu einem knappen Gut. Die Befragten sehen sich mit einem permanenten Aktivitätszwang konfrontiert, an dem sich Teilhabechancen entscheiden. Die damit verbundenen Ausleseprozesse funktionieren über Ausschluss und Selbstselektion in sozialen Netzwerken. Gerade in prosperierenden Städten wähnen sich Arbeitslose den Ressentiments der „Mehrheitsgesellschaft“ ausgeliefert. Noch wichtiger ist jedoch, dass den Befragten häufig Equipment und finanzielle Mittel fehlen, um sich an den Freizeitaktivitäten von Freundinnen und Bekannten überhaupt beteiligen zu können. Wer nur über den Regelsatz verfügt und sich des Verdachts ausgesetzt sieht, das wenige Geld für Tabak und Alkohol auszugeben, verkneift sich den gemeinsamen Kneipenbesuch mit alten Bekannten. Man beginnt, Alltagssituationen zu meiden, in denen Stigmatisierungen wahrscheinlich sind. Nur solche sozialen Kontakte, Freundschaften und Beziehungen garantieren ein Minimum an sozialer Stabilität, in denen gemeinsam geteilte Erfahrungen zur Sprache kommen, ohne sogleich abwertende Klassifikationen auszulösen. Unbewusst verlagern der Freundeskreis oder die eigene Familie Prüfungssituationen ins Private. Zur Entscheidung steht die Zugangsberechtigung zum Kommunikations- und Lebenszusammenhang. Scham und die Angst, mit einer Welt konfrontiert zu werden, in der man selbst nicht (mehr) leben kann, bewirken, dass sich ein erheblicher Teil der Leistungsbezieher nur noch unter ihresgleichen bewegen. Das ohnehin existente Machtgefälle am Arbeitsmarkt wird auf diese Weise im Privaten geradezu verdoppelt. Dieser Homogenisierung sozialer Verkehrskreise können sich im Allgemeinen nur diejenigen erfolgreich widersetzen, die vergleichsweise gut qualifiziert und mit materiellen Ressourcen aus einem „früheren Leben“ ausgestattet sind. 3 Bürger auf Bewährung – eine Schlussbemerkung Unsere empirischen Befunde zeichnen die Wirkungen eines Wettkampfregimes nach, das auf Integration in eine prekäre Vollerwerbsgesellschaft zielt. Zwar bewegt sich die Erwerbstätigkeit in Deutschland auf einem Rekordniveau (41,6 Mio. Erwerbstätige im Sommer 2013). Das Arbeitsvolumen (geleistete Arbeitsstunden) hat aber nicht in gleichem Maße zugenommen; bezogen auf den einzelnen Lohnabhängigen ist es sogar rückläufig (von 1991 durchschnittlich 1.473 Stunden pro Arbeitnehmer auf 2012 durchschnittlich 1.316 Stunden.). Diese Zahlen belegen eine Verschiebung aus der Erwerbslosigkeit und der geschützten Vollzeitbeschäftigung in atypische und häufig prekäre Arbeitsverhältnisse. Die Ausweitung unsicherer, niedrig entlohnter Beschäftigung macht die strukturelle Erwerbslosigkeit und Unterbeschäftigung teilweise unsichtbar. Das ändert jedoch nichts daran, dass die Verallge- 10 meinerung des Erwerbsarbeitszwangs, wie er im Wettkampfregime aktivierender Arbeitsmarktpolitik erfolgt, strukturell und bezogen auf die Gesamtheit der potentiell Erwerbstätigen nicht einlösbar ist. Dies auch, weil die Ausübung einer Erwerbsarbeit an ein im Verhältnis dazu stetig steigendes Volumen an überwiegend unbezahlten, reproduktiven, nicht oder nur schwer rationalisierbaren Tätigkeiten und Sorgearbeiten gekoppelt ist. Eigentlich müsste diese Koppelung zu einer sozialen Aufwertung reproduktiver Tätigkeiten führen. Das aktivierende Arbeitsmarktregime und insbesondere Hartz IV sorgen jedoch dafür, dass oftmals das Gegenteil der Fall ist. Die Hartz-IV-Logik verlangt von den Leistungsbezieherinnen, ausgerechnet jene qualitativen Ansprüche an Arbeit und Leben aufzugeben, die besonderes Engagement in wie außerhalb der Erwerbssphäre motivieren. Besonders aktiv sind ausgerechnet diejenigen, die nicht alle Ansprüche an die Qualität von Arbeit und Leben aufgeben. Wenn sich im Zuge einer lediglich zirkularen Mobilität (zahlreiche erwerbsbiographische Stationen, ohne dauerhaft aus dem Leistungsbezug heraus zu kommen), allmählich Verschleiß einstellt, setzt Anspruchsreduktion ein – und genau das erzeugt letztendlich Resignation und Passivität. Insofern bewirkt Hartz IV exakt das Gegenteil von dem, was strenge Zumutbarkeitsregeln zu leisten beabsichtigen. Tatsächlich kommen die Leistungsbezieherinnen nicht umhin, sich in der einen oder anderen Weise mit ihren Lebensumständen zu arrangieren. Je länger die Erwerbslosigkeit oder das Pendeln zwischen unsicherer Beschäftigung und Arbeitslosigkeit andauern, desto stärker wird der Druck, sich individuell mit unwirtlichen Verhältnissen aussöhnen zu müssen. Der Entzug von Ressourcen bedeutet nicht zwangsläufig den vollständigen Verlust individueller Planungsfähigkeit. Um ihre Verwundbarkeit zu reduzieren, sind viele Befragte bestrebt, ihren Alltag auch ohne dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis zu strukturieren und die Planungsfähigkeit so gut es geht aufrecht zu erhalten. Doch die Planung bezieht sich zunehmend auf kurze und kürzeste Zeitintervalle. Um sich vor Rückschlägen zu schützen, entwickeln die Leistungsbezieherinnen eine Lebensführung, die auf materielle Knappheit, Unsicherheit, Diskontinuität und das Erleben sozialer Missachtung ausgerichtet ist. Sie habitualisieren Unsicherheit, materielle Knappheit und moralische Abwertung. Kurz: Sie eignen sich einen Überlebenshabitus an, der Praktiken generiert, die auf eine Verteidigung von Resten individueller Autonomie und Würde ausgerichtet sind. Dabei geht es den betreffenden Personen weniger um das physische, als um das soziale Überleben. Natürlich gelingen solche Anpassungen immer nur annäherungsweise. Eine Lebensführung unter dem Diktum von Ressourcenknappheit und strenger Zumutbarkeit belastet. Stets besteht die Gefahr des Abgleitens, der Verschuldung oder im Extremfall gar der Verwahrlosung. Aber dies lässt sich nicht auf die vermeintlich generösen Transferleistungen nach Hartz IV zurückführen. Vielmehr stimulieren die „ungemütlichen“ Auswahlprüfungen aktivierender Arbeitsmarktpolitik Rationalisierungsleistungen besonderer Art. Die Leistungsbezieherinnen stellen sich darauf ein, in von Unsicherheit, Deprivi- 11 legierung und sozialer Missachtung geprägten Lebenssituationen ausharren zu müssen. Doch gerade weil sich die Leistungsbezieher an widrige Bedingungen anpassen, werden sie zur Zielscheibe negativer Klassifikationen. In der Konsequenz sieht sich eine sozial ausgesprochen heterogene Gruppe von Leistungsbezieherinnen beständig mit einem institutionellen Vorbehalt konfrontiert. Nur wenn erkennbar ist, dass alle Anstrengungen auf eine reguläre Erwerbsarbeit gerichtet sind, besteht ein Anspruch auf staatliche Transfers und Sicherheitsgarantien. Um in den Auswahlprüfungen bestehen zu können, kommen die Befragten nicht umhin, ihre gesamte Lebensführung einem fiktiven Anderen, einem Leben mit regulärer Erwerbsarbeit, unterzuordnen. Zugleich sind sie aber auch gezwungen, sich an ein Leben ohne reguläre Erwerbsarbeit zu gewöhnen. Die Befragten müssen sich mit ihrer Lage arrangieren, um sie verändern zu können. Arrangieren sie sich, entwickeln sie notwendige Lebensformen, die sie von der gesellschaftlichen Mehrheit separieren. Separieren sie sich, werden sie zum Objekt negativer Klassifikationen durch eben diese Mehrheitsgesellschaft. Negative Zuschreibungen wiederum erschweren jegliche Veränderung – ein Sachverhalt, der individuelles Scheitern wahrscheinlich macht. Und wer scheitert, besitzt gute Chancen, dass sein Leben an oder unter der Schwelle gesellschaftlicher Respektabilität von Dauer ist. Er wird, ungeachtet seiner biographischen Besonderheiten, zum Angehörigen einer seitens der „Mehrheitsgesellschaft“ öffentlich abgewerteten Unterschicht. Aus diesem Grund entfaltet Hartz IV für die Leistungsbezieher eine ähnliche Wirkung wie die Hautfarbe im Falle rassistischer oder das Geschlecht bei sexistischen Diskriminierungen. Die Erwerbslosen und prekär Beschäftigten sind „diskreditierbar“ (Goffman 1975: 11). Haftet es einmal an der Person, können die Betroffenen sich des Stigmas Hartz IV nur noch schwer entledigen. Wer von staatlicher Fürsorge abhängig bleibt und sich den damit verbundenen Stigmatisierungen aussetzt, vernachlässigt an einem biographischen Umschlagpunkt allmählich auch die Sorge um sich selbst. Krankheiten, physischer und psychischer Verschleiß, ja, „Körpereigensinn“ bis hin zu totaler Erschöpfung, einem Leben im physischen und psychischen Ausnahmezustand können die Folge sein. Die Zementierung der Erwerbsnorm, die das Regime strenger Zumutbarkeit erzwingt, verhindert, dass bürgerschaftliches Engagement, Eigen- und Reproduktionsarbeit sowie autonome, nur um ihrer selbst willen ausgeübte Tätigkeiten objektiv wie subjektiv einen ähnliches Stellenwert erhalten wie bezahlte Erwerbsarbeit. Sie bleiben auch aufgrund erzwungener Normierungen Tätigkeiten zweiter und dritter Klasse, die eine bezahlte Arbeit ergänzen, aber nicht ersetzen können. Auf diese Weise werden gerade diejenigen Leistungsbezieherinnen, die im Ehrenamt, in selbstorganisierten Zusammenhängen oder sozial geförderter Ersatzarbeit aktiv sind, zu Objekten einer besonderen Ausbeutung. Sie betätigen sich im Sportverein, der Erwerbslosenberatung, der Sterbehilfe oder dem Umsonstladen. Sie verdingen sich als Aushilfen, Gelegenheitsjobber, Putz- und Haushaltshilfen. Sie sind vielfach und im wahrsten Sinne des Wortes hart arbeitende Erwerbslose. Und doch können sie sich des Generalverdachts, durch Überstrapazieren der „sozialen Hängematte“ das Gemeinwohl zu schädigen, letztendlich nicht entziehen. 12 Auf diese Weise erzeugen die Leistungsbezieher wider Willen einen Abschreckungseffekt, der auch die „Mehrheitsgesellschaft“ erreicht. Die Bereitschaft bei noch einigermaßen gesichert Beschäftigten, unterwertige, prekäre Jobs anzunehmen, um einen Status unterhalb der Schwelle der Respektabilität zu vermeiden, steigt. Auf diese Weise diszipliniert die Angst, auf Hartz IV abzurutschen, selbst oberhalb einer „Schwelle der Sicherheit“. Denn jeder und jede Festangestellte weiß: eine Niederlage im Wettbewerbssystem aktivierender Arbeitsmarktpolitik wird mit Freiheitsentzug bestraft. Dies vor Augen, sind wir – auf einem unvergleichlich höheren gesellschaftlichen Reichtums- und Sicherheitsniveau – offenbar wieder bei Verhältnissen angelangt, wie sie Robert Castel (2000) für die Frühphase kapitalistischer Lohnarbeit skizziert hat. Wer keiner Erwerbsarbeit nachgehen kann und – wie unterstellt wird – auch nicht nachgehen will, der muss mit dem Entzug von Freiheitsrechten rechnen. Er ist der Unfähigkeit zur Selbstsorge überführt und hat – nicht de jure, aber doch de facto – das Anrecht auf umfassende politische Teilhabe verwirkt. Er oder sie sind – wie Wolfgang Engler (2013) es treffend genannt hat – nur noch Bürger(innen) auf Bewährung; Menschen zweiter Klasse, denen das Anrecht auf Gleichwertigkeit verwehrt wird. Für demokratische Gesellschaften ist dies ein unhaltbarer Zustand. Die Reduzierung des Erwerbszwangs durch zumindest Aussetzung der Sanktionen gegen Leistungsbezieherinnen wäre ein erster kleiner Schritt, um diesen Zustand zu verändern. Literatur: Boltanski, Luc; Chiapello, Ève (2003): Der neue Geist des Kapitalismus. Konstanz: UVK. Boltanski, Luc; Chiapello, Ève (2005): Die Rolle der Kritik für die Dynamik des Kapitalismus: Sozialkritik versus Künstlerkritik. In: Max Miller (Hg.): Welten des Kapitalismus. Institutionelle Alternativen in der globalisierten Ökonomie. Frankfurt am Main; New York: Campus, S. 285–322. Boltanski, Luc (2010): Soziologie und Sozialkritik. Frankfurter Adorno-Vorlesungen. Berlin: Suhrkamp. Bourdieu, Pierre (2000): zwei Gesichter der Arbeit. Interdependenzen von Zeit- und Wirtschaftsstrukturen am Beispiel einer Ethnologie der algerischen Übergangsgesellschaft. Konstanz: UVK. Castel, Robert (2000): Die Metamorphosen der sozialen Frage. Eine Chronik der Lohnarbeit. Konstanz: UVK. Dörre, Klaus; Scherschel, Karin; Booth, Melanie; Haubner, Tine; Marquardsen, Kai; Schierhorn, Karen (2013): Bewährungsproben für die Unterschicht? Soziale Folgen aktivierender Arbeitsmarktpolitik. International Labour Studies - Internationale Arbeitsstudien, Band 3. Frankfurt am Main; New York: Campus. Engler, Wolfgang (2013): Bürger auf Bewährung. Soziologen aus Jena untersuchen die Folgen der Arbeitsmarktpolitik. Sie widerlegen das Vorurteil, dass Jobsuchende in Resignation abgleiten. TAZ vom 30.07.2013. Goffman, Erving (1975): Stigma. Über Techniken der Bewährung beschädigter Identität. Frankfurt a. M. Simmel, Georg (1992): Der Arme. In: Georg Simmel: Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. Gesamtausgabe Bd. 11. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 512-555. Tocqueville, Alexis de (2006): Denkschrift über den Pauperismus. In: Alexis de Tocqueville: Kleine politische Schriften. Berlin: Akademie-Verlag, S. 61-80. Vester, Michael (2011): Sozialstaat und Sozialstruktur im Umbruch. In: Peter Hammerschmidt und Juliane Sagebiel (Hg.): Die soziale Frage zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Frankfurt am Main: AG SPAK – Bücher, S. 55-76. 13