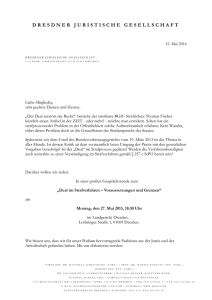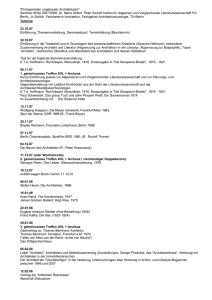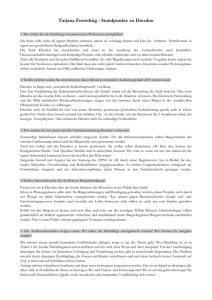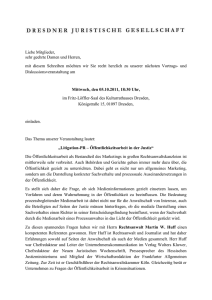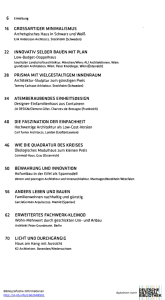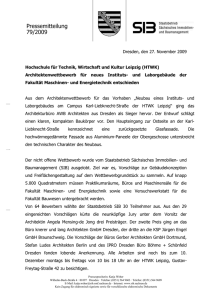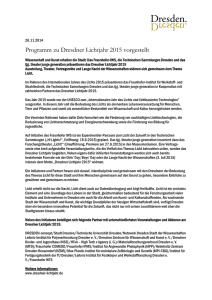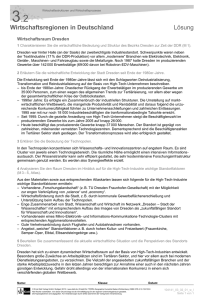Dresden-Leipzig
Werbung
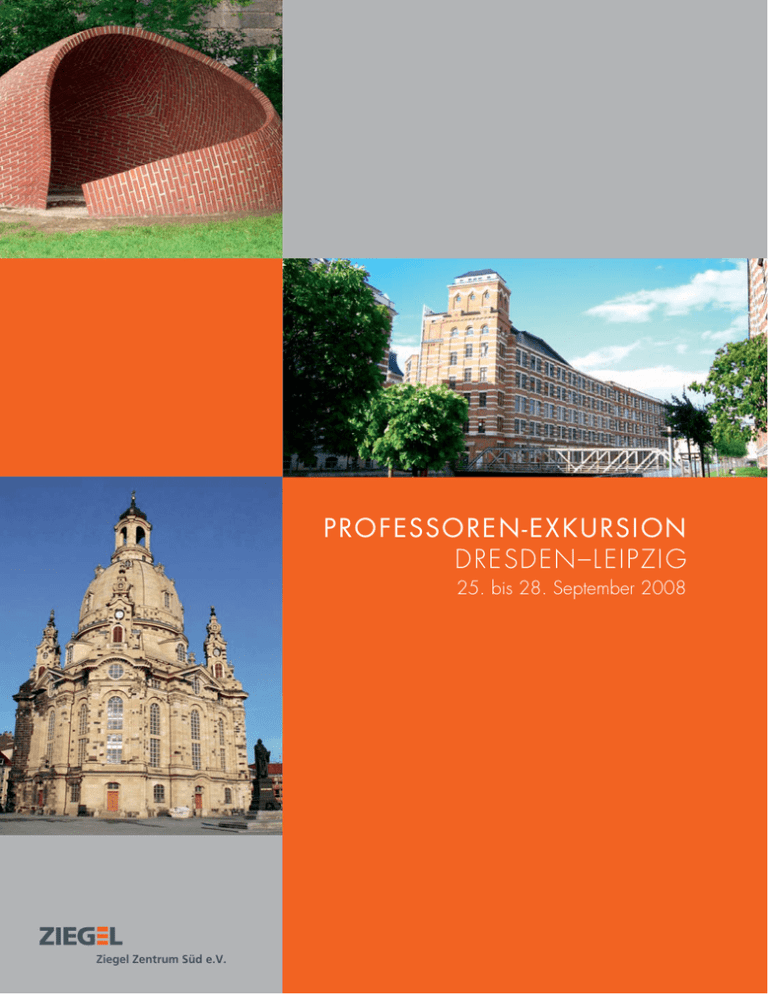
PROFESSOREN-EXKURSION DRESDEN–LEIPZIG 25. bis 28. September 2008 Ziegel Zentrum Süd e.V. PROFESSOREN-EXKURSION DRESDEN–LEIPZIG 25. bis 28. September 2008 03 Leipzig und Dresden Vorwort Dipl.-Ing. Arch. Waltraud Vogler Die Baugeschichte von Leipzig und Dresden über viele Jahrhunderte bis zur massiven Zerstörung beider Universitätsstädte im 2. Weltkrieg, ihre politische und planerische Entwicklung während der fast 45 Jahre DDR-Zeit und die umfassenden Eingriffe und Veränderungen nach der Wiedervereinigung ziehen Besucher in ihren Bann. Das urbane Gepräge der anspruchsvoll erneuerten Gründerzeitquartiere, die trotz der Kriegsschäden mit ihren erhaltenen Altbauten das Stadtbild bestimmen, war nach der Wende kein ausreichendes Gegengewicht im Kampf gegen die Abwanderung der Bevölkerung ins Umland. Der Neubauboom auf den grünen Wiesen vor den Toren der Städte wurde glücklicherweise durch einen Sanierungsboom in den gewachsenen Stadtvierteln abgelöst, der fast bis 2000 anhielt. Die Architektur der letzten 20 Jahre zeigt exemplarisch, wie der erste Run auf die vermeintlich schnellen Gewinne, die in den neuen Bundesländern zu machen waren, ungeheuere planerische Schnellschüsse nach sich zog. Inzwischen ist ein Diskurs unter Fachleuten gewachsen, der auf die schwierigen Entwicklungen nach der Wende neue Konzepte anwendet. Leerstand von schnell hochgezogenen „Einheitsbürogebäuden“ und notwendige Schrumpfung beim Wohnungsbestand sind brisante Themen dieses „Stadtumbaus“ in den großen Städten der neuen Bundesländer. Dresden und Leipzig sind Paradebeispiele für die aktuellsten Tendenzen der Denkmalpflege heute in einem heterogenen Umfeld, das noch immer deutlich ablesbare Lücken mitten in den pulsierenden Städten zeigt. Beide Städte müssen sorgfältig wieder aufgebaute Baudenkmäler neben Plattenbauten und groß angelegten städtebaulichen Neugestaltungen der 60er Jahre im Zeichen der klassischen Moderne zu einem Stadtbild zusammenführen. Die Universitätsbauten am City-Hochhaus und vor allem der Bau der Kirche und Aula am Leipziger Augustusplatz haben sehr lebhafte, kontroverse Diskussionen bewirkt. Nichts Neues für Erick van Egeraat, der häufig durch seine „exaltierten“ Bauwerke aneckt! Das bereits vorhandene Stil-Sammelsurium von City-Hochhaus und Gewandhaus über die Oper bis zu sozialistisch geprägten Großbauten auf der Ostseite des Georgi-Rings erschweren jede Baumaßnahme am Augustusplatz. Die Bewältigung dieser vielschichtigen – auch baulichen – Vergangenheit ist eine überaus anspruchsvolle Aufgabe für Stadtplaner und Architekten. Leipzig, eine lebendige Stadt mit ausgeprägten Stadtvierteln, die verschiedenen Themen zugeordnet sind, hat viel zu bieten. Auf den Spuren der Industriearchitektur der Gründerzeit, jenen ambitionierten Großprojekten mit ihren prachtvollen Backsteinfassaden, den „Kathedralen der Arbeit“ vor allem in Plagwitz, finden sich neue, beneidenswert idyllische Wohn- und Arbeitssituationen. Büros, Ateliers und Lofts in den Buntgarnwerken und der Baumwollspinnerei, die Erinnerungen an die Docklands in London wachrufen, als sie noch ursprünglicher und weniger kommerzialisiert waren. Firmenneugründungen sprießen in derart attraktivem und anregendem Umfeld. Stadtvillen beginnen sich im Musikerviertel, einem Ende des 19. Jahrhunderts entstandenen, ehemals repräsentativen, großbürgerlichen Viertel, auf Kriegsbrachen zu entwickeln. Auch wenn der Verkauf zögerlicher vorangeht, als man es den potentiellen Käufern und den zeitweilig auch als Bauträger agierenden Architekten wünschen möchte. Das Eintauchen in die klassischen Touristenbereiche Dresdens zwischen Frauenkirche und Semperoper konfrontiert auch mit den umstrittenen Planungskonzepten am Neumarkt oder dem Stadtbild prägenden Neubau der Synagoge. Erzeugt das Reproduzieren von Baudenkmälern „kunstgewerbliche Stadtattrappen unter Preisgabe der alltäglichen städtischen Funktionen“? – ein Thema, das Prof. Thomas Will im Rahmen der Debatte zum Denkmalschutz anspricht. Nach der aufwändigen Rekonstruktion der Frauenkirche sicher eine interessante Frage. In unmittelbarer Nachbarschaft konfrontiert die Prager Straße jeden Besucher, der sich der Altstadt vom Hauptbahnhof aus nähert, mit den allgegenwärtigen Kriegswunden, auch wenn die städtebauliche Leistung des Planungskollektivs in diesem wesentlichen innerstädtischen Gebiet zwischen 1965 und 1978 heute anerkannter ist, als sie bei der Eroberung eben dieses Areals durch das „freie Spiel der marktwirtschaftlichen Kräfte“ kurz nach der Wende war. Und all dies in einer Stadt, die dabei ist, sich den Titel „Weltkultur-Erbe“ durch den anscheinend verkehrstechnisch dringend notwendigen Bau der Waldschlösschenbrücke zu „verbauen“ und die klassizistische Fassade des Militärhistorischen Museums von Daniel Libeskind mit einem gigantischen Keil – als Zeichen für Pazifismus – aufbrechen zu lassen! Da taucht man gerne in die inzwischen wieder sehr heil anmutende Welt der Gartenstadt Hellerau ein. Ländliche Wohnidylle – zu Beginn des 20. Jahrhunderts vornehmlich geschaffen von den Architekten Riemerschmid, Tessenow und Muthesius – gemischt mit neuen Nutzungskonzepten, die in den Gebäuden der ehemaligen Werkstätten für viele kreative Menschen Raum bieten. Ähnlich kreativ wie die Mitarbeiter von Prof. Schulten, die an der TU Dresden eine freitragende Schalenkonstruktion aus Ziegelmauerwerk entwickelt und selbst gebaut haben, um die Machbarkeit einer komplexen Form zu erforschen und das Potential dieses gängigen Baumaterials zu demonstrieren. Auf einem Uni-Campus, der von mächtigen, sehr gut erhaltenen, historischen Sichtziegelgebäuden geprägt ist, fügt sich das kleine, gekurvte experimentelle Bauwerk ganz bescheiden ein. Es erregte dennoch Aufsehen bis nach München, um im Rahmen der Hochschularbeit des Ziegel Zentrum Süd einen weiteren Grund für die Reise nach Sachsen zu bieten. Der Anfang des „roten Fadens“, der die ProfessorenExkursionen begleitet, war gefunden. Vier Tage lang reist eine Gruppe von 27 Professorinnen und Professoren der Architektur und des Bauingenieurwesens anlässlich der Professoren-Exkursion gemeinsam nach Leipzig und Dresden. Sie besuchen im interdisziplinären Diskurs die TU Dresden, mit der Chance, sich über Hochschulgrenzen hinweg mit den Lehrenden vor Ort über aktuelle Themen auszutauschen. Diese Unternehmung ist eng verwoben mit der Lehre an den Hochschulen von fünf Bundesländern, mit denen das Ziegel Zentrum Süd im Rahmen von Studentenseminaren und -exkursionen in Süddeutschland zusammenarbeitet. Die jährlich im September durchgeführten Professoren-Exkursionen bieten allen Beteiligten die rare Gelegenheit, bestehende Beziehungen zu vertiefen, neue Anknüpfungspunkte zu finden und interessante Konzepte für die Zukunft in einer inspirierenden und entspannten Umgebung gemeinsam anzudenken und die aufgeworfenen Themen in der eigenen Lehre zum Einsatz zu bringen. 06 Inhaltsverzeichnis Leipzig und Dresden, Vorwort Inhaltsverzeichnis 03 06 Programm Tag 1 08 City-Hochhaus, Leipzig (Hermann Henselmann; Peter Kulka) Universitäts-Campus (Behet Bondzio Lin) Paulinerkirche, Aula der Universität (Erick van Egeraat) 10 11 13 Hauptbahnhof, Dresden (Giese, Weidner, Rosbach; Foster & Partners) Prager Straße (Peter Sniegon, Hans Konrad, Kurt Röthig) Rundkino (Gerhard Landgraf, Waltraud Heischkel) UFA-Kristallpalast (Coop Himmelblau) Neumarkt Frauenkirche (George Bähr) Alte Synagoge (Gottfried Semper) Neue Synagoge (Wandel, Lorch, Hirsch) Hotel Westin Bellevue (George Bähr; Takeshi Inoue) Waldschlösschenbrücke Schloss Eckberg/Villa Souchay (Christian Friedrich Arnold) 14 18 19 20 22 26 32 33 35 36 38 Programm Tag 2 40 Frei geformte Mauerschale, TU Dresden Zeuner-Bau der TU Dresden (Karl Weißbach) Goerg-Schumann-Bau der TU Dresden (O. Kramer; O. Schubert, G. Münter) Beyer-Bau der TU Dresden (Martin Dülfer) Fritz-Foerster-Bau der TU Dresden (Martin Dülfer) SLUB, Sächsische Landes- + Unibibliothek (Ortner + Ortner) Militärhistorisches Museum (Daniel Libeskind + H. G. Merz) Gartenstadt Hellerau Festspielhaus Hellerau (Heinrich Tessenow) Deutsche Werkstätten Hellerau (Richard Riemerschmid) Richard Riemerschmid Heinrich Tessenow Hermann Muthesius Sächsischer Landtag (Barthold + Tiede; Peter Kulka) Zwinger (Matthäus Daniel Pöppelmann) Semperoper (Gottfried Semper) Lipsiusbau (Constantin Lipsius; Auer + Weber + Partner) Blaues Wunder Villa Marie Standseilbahn 42 48 49 50 51 52 54 58 60 62 63 64 65 66 68 70 72 76 78 79 Programm Tag 3 80 Galerie für Zeitgenössische Kunst, Leipzig (Eelbo, Kulka, as-if Arch.) KPMG Stadtvillen im Musikerviertel (König Wanderer, Fuchshuber + P., u.a.) Café Grundmann Industriearchitektur in Leipzig-Plagwitz Buntgarnwerke (O. Jummel; Händel + Franke) Lofts am Elsterufer (Gregor Fuchshuber + Partner) Sweetwater (Weis + Volkmann) Baumwollspinnerei Konsumzentrale (Fritz Höger) Stelzenhaus (Herrmann Böttcher; Weis + Volkmann) Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft, Stadtumbau im Bestand Rundling (Hubert Ritter) Völkerschlachtdenkmal (Bruno Schmitz, Clemens Thieme) Nikolaischule (Storch, Ehlers + Partner) 82 85 86 90 91 93 94 95 96 98 100 102 104 106 108 Programm Tag 4 110 Grassi-Museum (C.- W. Zweck, H. Voigt, H. Ritter; Ilg Friebe Nauber) Gutenbergschule (Otto Droge) Haus des Buches (Hentrich-Petschnigg + P., Angela Wandelt) Schumann-Haus Reklam-Karree (Max Bösenberg; Bunk-Hartung + Partner) Grafischer Hof, Restaurant Castellum 1776 112 114 115 116 117 118 Quellenverzeichnis 119 Leipzig Stadtplan Dresden Stadtplan 120 121 TeilnehmerInnen Impressum 122 123 08 Tag 1 Zeitplan Donnerstag, 25.09.08 12.30 Uhr Treffpunkt in Leipzig, Restaurant Panorama Tower (Nähe Hbf), zum Mittagessen im 29. OG Augustusplatz 9, 04109 Leipzig, Telefon 0341/710 05 90 14.00 Uhr Blick über Leipzig mit Einführung Von der Dachterrasse im 31. OG aus Stadtentwicklung und Campusneubauten Leipzig Architekt Kirche: Erick van Egeraat Institutsgebäude + Läden: behet bondzio lin architekten Führung: Dipl.-Ing. Arch. Roland Bondzio Augustusplatz/Grimmaische Straße 30 14.45 Uhr Weiterfahrt nach Dresden Vortrag im Bus zur Geschichte der Frauenkirche Prof. Horst Thomas, Georg-Simon-Ohm Hochschule Nürnberg 16.00 Uhr Stadtführung in Dresden vom Hauptbahnhof zum Hotel Besichtigungen: • Hauptbahnhof, Sanierung: Forster & Partners • Prager Straße mit Rundkino, UFA-Kristallpalast • Frauenkirche Führung: Prof. Dr. Thomas Bulenda, FH Regensburg (Hbf), Prof. Horst Thomas, Georg-Simon-Ohm Hochschule Nürnberg mit Bus Bus fährt zum Hotel Prager Straße/Neumarkt/Am Hasenberg 17.15 Uhr Kaffeepause in der Cafeteria der Neuen Synagoge 17.30 Uhr Besichtigung der Neuen Synagoge Architekten: Wandel Lorch Hirsch Führung: Herr Just, Vertreter der Jüdischen Gemeinde Am Hasenberg/Rathenauplatz 18.30 Uhr Spaziergang zum Hotel über die Brühl’schen Terrassen und die Augustusbrücke 19.00 Uhr Einchecken Hotel Westin Bellevue Dresden Architekten: George Bär, 1724, Takeshi Inoue, 1985 Große Meißner Straße 15, 01097 Dresden, Telefon 0351/805 17 22 20.00 Uhr Fahrt zum Restaurant Schloss Eckberg Mit kurzem Zwischenstopp bei der Baustelle zur Waldschlösschenbrücke Erläuterungen im Bus: Prof. Dr. Thomas Bulenda, FH Regensburg 20.30 Uhr Abendessen im Restaurant Schloß Eckberg Architekt: Christian Friedrich Arnold, 1859–61 mit Bus Bautzner Straße 134, 01099 Dresden, Tel 0351/80 99-0 23.30 Uhr Busfahrt zum Hotel mit Bus 10 City-Hochhaus Augustusplatz 9 Architekten: Hermann Henselmann, 1968–73 Umbau: Peter Kulka, 2001 Das 34-geschossige Universitätshochhaus wurde 1973 übergeben. Es ist 142,5 m hoch (Gesamthöhe mit Antennenträger 155,40 m) und weist eine Stärke der Außenwände von 400 mm bis zum 13. Obergeschoß und von 300 mm bis zum letzten Normalgeschoß auf. Die 20 m hohe Spitze ist in Stahlfachwerkkonstruktion ausgeführt. In 110 m Höhe befand sich ein Café und vier weitere Panoramalokale. Das Gebäude wurde durch Peter Kulka umgebaut. Es beherbergt jetzt den Klangkörper des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR). Neben einer neuen Fassadenverkleidung aus Steinplatten erhielt das Hochhaus einen quaderförmigen Anbau. Die Form des „Uniriesen“, „Weisheitszahnes“ oder auch „(Steilen) Zahnes“ (wie das Gebäude im Volksmund häufig genannt wird) kann nachträglich als ein aufgeschlagenes Buch interpretiert werden. In Wirklichkeit ist der Querschnitt symmetrisch und stellt eine optimale Form einer Maschinenwelle dar. In den Jahren 1999 bis 2002 wurde das City-Hochhaus komplett saniert, sowohl alle 29 Etagen als auch die Fassade. Auf dem Dach ist eine Aussichtsplattform eingerichtet. Sie befindet sich in einer Höhe von ca. 130 m, bietet einen guten Überblick über die Innenstadt und ist daher ein beliebtes Touristenziel. Die Universität Leipzig ist heute nicht mehr im Inneren zu finden: das Gebäude wurde von der Landesregierung verkauft und gehört mittlerweile der US-Investmentbank Merrill Lynch. Mieter sind unter anderem der MDR und das Panorama-Restaurant in 110 Metern Höhe. Im März 2008 verlegte die Europäische Strom- und Energiebörse EEX ihren Hauptsitz in das Hochhaus. 11 Universitätscampus Augustusplatz, Grimmaische Straße, Universitätsstraße, Moritzbastei Architekten: Behet Bondzio Lin, 2004–10 Annette Menting Kleine Stadt in der Stadt Ein Zwischenbericht zum neuen Campus der Universität (gekürzter Text) Mit dem Universitätsquartier wird der wohl prägnanteste Bereich – die Stadt erhielt hier in den sechziger Jahren durch den Universitätsturm eine skylineprägende Akzentuierung – umgestaltet. Für die Universität bedeutet die Neugestaltung eine weitere Etappe im kontinuierlichen Wandel: Geutebrück ließ das Areal 1830 umgestalten und ergänzte es um das Augusteum, und Rossbach verlieh in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts den Bauten üppige Fassaden in zeittypischer Neogotik- bis Neobarock-Gestaltung, die wiederum einige Jahrzehnte später revidiert wurde. Ein radikaler Einschnitt war die Vernichtung des historischen Bestands in den sechziger Jahren und die ideologisch motivierte Neugestaltung im Sinne der sozialistischen Stadt. Nun erfolgt erneut ein erheblicher Eingriff, wobei von den Bauten der ehemaligen Karl-Marx-Universität wenig übrig bleiben wird. Als der Entwurf der Architekten Behet, Bondzio und Lin 2002 nach dem Wettbewerbsverfahren vorgestellt wurde, richtete das öffentliche Interesse sich im wesentlichen auf den Augustusplatz und insbesondere auf den ehemaligen Standort der Paulinerkirche. Die Wettbewerbsjury hatte seinerzeit dem Campus-Entwurf hohe Qualität attestiert. Die sich hier anschließende Kontroverse bewegte sich zwischen den gegensätzlichen Forderungen von originalgetreuer Rekonstruktion und interpretierender Neugestaltung. Aufgrund der Debatte folgte 2004 ein zusätzliches Qualifizierungsverfahren, aus dem der Entwurf von Erick van Egeraat zur Realisierung bestimmt wurde. In den aktuellen Mediendarstellungen wird oftmals verdrängt, dass das neue Universitätsquartier von zwei Architektenteams gestaltet wird: Neben den Gebäuden am Augustusplatz vom Rotterdamer Büro Egeraat entstehen an den anderen Seiten die Neu- und Umbauten, von der Mensa bis zum Seminargebäude, nach dem Entwurf des Münsteraner Architektenteams Behet, Bondzio und Lin. Angesichts dieser Konstellation stellt sich die Frage, wie die unterschiedlichen Entwürfe aufeinander abgestimmt sind. Eine Antwort scheint bereits gegeben, denn die neue Paulineraula ist derart exponiert, dass sie Diskussion und Image bestimmt. Bei der Frage nach einer neuen Identität der Leipziger Universität stehen sich die Außenwirkung einer repräsentativen Platzfront und die Atmosphäre eines vitalen Universitätslebens gegenüber. Behet, Bondzio und Lin hatten im Wettbewerb für den neuen Campus das Motiv einer „kleinen Stadt in der Stadt“ entwickelt, um die verschiedenen Universitätsbauten thematisch zu vereinen. Dieses Konzept wurde zwei Jahre später verändert, denn mit der Setzung einer baulichen Dominante am Augustusplatz wurde die einheitliche Fassung des Campushofs aufgelöst. Der hermetisch abgeschlossene Hörsaalbau wurde von einer neuen baulichen Schicht umgeben, die dem historischen Grundstücksverlauf folgt. Das frühere Erscheinungsbild wurde quasi umgekehrt, und anstelle eines geschlossenen Hörsaal-Solitärs bestimmt nunmehr die Mensa als offener, kontext-bezogener Stadtbaukörper den Ort. Die Universitätsstraße wird in ihren ursprünglichen Zustand versetzt, doch wichtiger erscheint die äußerst gelungene Bezugnahme zur Moritzbastei mit ihren terrassierten Plateaus. Bisher war sie als Fremdkörper vom Campus räumlich abgehängt, doch inzwischen entwickelt sich ein gelungenes Zusammenspiel mit der neuen Mensa durch die differenzierte Proportionierung und Staffelung. Möglicherweise wird aus der einstigen Randzone nun der einladendste Bereich des neuen Campus. Als einzige Bestandteile des früheren Universitätsareals bleiben das Hörsaal- und das Seminargebäude erhalten. Neben der vorgelagerten Raumschicht erfährt das Hörsaalgebäude eine zusätzliche Aufwertung, indem Lichthöfe eingestanzt werden, die auch der Bibliothek in den Untergeschossen eine Tageslichtstimmung verleihen. Behet, Bondzio und Lin entwarfen mit dem Institutsgebäude an der Grimmaischen Straße einen zweiten Campus-Neubau. In diesem Übergangsbereich von Innenstadt und Ring wird die Aufnahme früherer Baufluchten und Traufkanten räumlich besonders markante Änderungen bewirken. Anstatt der Möglichkeit, an den Brunnenanlagen zu verweilen oder auf den Freiflächen zu skaten, wird der Passant zukünftig durch eine passagenhafte Enge bis zum Augustusplatz geleitet. In den unteren Etagen des Neubaus werden Ladengeschäfte eingerichtet, die oberen Etagen werden von der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät genutzt. Die Doppelfunktion des Universitätsbaus spiegelt sich in der Fassadengestaltung mit ihren großzügigen Schaufenstern und den darüber liegenden Lochfassaden wider. Im Konzept von Egeraat soll sich die Paulineraula als neues Zeichen der Universität auch gegen das Hochhaus behaupten. Zwar gehört der Turm funktional nicht mehr zur Universität, doch ist er nach wie vor raumbestimmend. Zur wirkungsvollen Steigerung der expressiv-kristallinen Paulineraula wurden das Rektoratsgebäude und der Felsche-Bau in ihrem gestalterischen Duktus angepasst. Im Kontext des Gesamtcampus erscheinen die Egeraat-Bauten sehr auf sich bezogen und unabhängig von den übrigen Universitätsbauten gestaltet. Für das gesamte Universitätsquartier wäre es wichtig, dass vor allem der Campushof sich als interner „Marktplatz“ entfalten kann, um das universitäre Alltagsleben räumlich-atmosphärisch zu unterstützten und den Hauptnutzern des Quartiers eine neue identitätsstiftende Mitte zu bieten. 13 Paulinerkirche/Aula der Universität Augustusplatz Architekt: Erick van Egeraat, 2004–10 Die Jury des Architektenwettbewerbs für das Bauvorhaben „Aula/Kirche“ der Universität Leipzig am Augustusplatz hat den Entwurf des Rotterdamer Büros van Egeraat mit klarer Mehrheit (10:3 Stimmen) auf den 1. Platz gesetzt. Erste Stellungnahmen von Rektor Häuser, Finanzstaatssekretär Voß und Oberbürgermeister Tiefensee reichten von Erleichterung, Zufriedenheit bis Begeisterung. „Die expressive Architektur stellt etwas Besonderes dar, und um etwas Besonderes ist es uns auch gegangen. Damit nimmt die Universität auch architektonisch wieder eine herausgehobene Rolle am Augustusplatz ein, die auch in die Innenstadt hinein wirkt", sagte Prof. Dr. Franz Häuser. „Wichtig war und ist uns, dass der Entwurf den hohen Anforderungen, die wir an die Verbesserung der Bedingungen für Forschung und Lehre stellen, entspricht und gleichzeitig eine angemessene Erinnerung an die Universitätskirche und ihre Sprengung verkörpert.“ Erick van Egeraat unterstrich, dass sein Entwurf die ehemalige Architektur nicht kopiere, sie aber in moderner Form zurückzubringen versuche. Seine Philosophie sei es ohnehin, etwas wärmer, voller, reicher zu bauen, als das gemeinhin in den letzten 50 Jahren geschehen sei. Die weitere Qualifizierung des Entwurfs, versprach er, werde im ständigen Dialog mit allen Beteiligten geschehen. Der wird sich vorrangig mit einem ins Leben gerufenen Planungsbeirat vollziehen, in dem Universität, Stadt und Freistaat vertreten sind. Eine Aufgabe wird es beispielsweise sein, wie das auch schon in ersten Empfehlungen der Jury ausgesprochen wurde, den Charakter der Aula deutlicher nachzuweisen, also der Funktionalität des Innenraums, der den Eindruck einer dreischiffigen Hallenkirche vermittelt, besondere Beachtung zu schenken. Jury-Vorsitzender Prof. Zlonicky gab der Hoffnung Ausdruck, dass der beispielgebende Dialog zwischen den Architekten und den Jury-Mitgliedern in der letzten Phase des Wettbewerbs zum Nutzen der Realisierung weitergeführt werde. Er sei überzeugt, der Siegerentwurf, indem er Brücken baue in dem Spannungsfeld unterschiedlicher Erwartungen zwischen Rekonstruktion und Neuinterpretation, werde eine „friedenstiftende“ Wirkung entfalten. Der Sieger selbst erklärte – mit dem Blick auf die Aufgabe, an die willkürliche Vernichtung der Universitätskirche zu erinnern –, er habe in den 24 Jahren seiner Tätigkeit als Architekt noch nie zurückgebaut, aber er sei immer bereit gewesen, von früherer Qualität und Intensität des Bauens zu lernen. Also kein Nachbau des Gotteshauses, aber angesichts der Bedeutung seines Schicksals habe er die Silhouette der Kirche zum Leitmotiv der gesamten Planung des Neubaus gemacht. Er verstehe diesen Neubau als ein Projekt, das an Vergangenes erinnert, aber zugleich auch in die Zukunft verführt. http://db.uni-leipzig.de/aktuell Augusteum und Paulinerkirche um1890 14 Hauptbahnhof Dresden Am Hauptbahnhof Architekten Altbau: Ernst Giese, Paul Weidner und Arwed Rosbach, 1892–97 Architekten Umbau: Foster & Partners, Schmidt Stumpf Frühauf und Partner, 2001–07 Der alte Hauptbahnhof wurde anstelle des Böhmischen Bahnhofs 1892–97 von Ernst Giese, Paul Weidner und Arwed Rosbach erbaut. Die dreischiffige Stahlbogenhalle besitzt 18 Bahnsteige, im Mittelschiff (Spannweite 50 m) ebenerdig als Kopfbahnhof, in den Seitenschiffen (Spannweiten 30 m) als Hochbahnsteige für den Durchgangsverkehr. Der Dresdner Hauptbahnhof wurde als einer der letzten großen Deutschen Bahnhöfe von der „Deutschen Bahn AG“ saniert. Er bekam anstatt eines Glasdaches ein neues Membrandach, einem Material aus äußerst reissfestem Gewebe (Teflon-Dach aus Glasfaser). Die Farbe des transluzenten Materials ist weiß. Es lässt je nach Sonnenintensität verschiedene Farbtöne des Tageslichtes durchscheinen oder reflektiert es auf der Außenseite. Direkt über den eisernen Hallenbögen spaltet sich das zeltartige Dach zu schmalen Schlitzen, die den direkten Blick zum Himmel freigeben. Die selbstreinigende Teflon-Membran stammt von der Firma „Sky-span“ in Rirnsting am Chiemsee. Sie ist nicht einmal einen Millimeter dick, jedoch aufgrund ihrer Eigenschaften extrem wetterfest. Die Belastung hält bis zu 90 Tonnen pro laufendem Meter aus. Über die originalen Eisenstahlbögen musste ein sekundäres Tragwerk eingebaut werden, um die ungeheuren Zugkräfte, die durch die starke Spannung der Membran entstehen, in die Fundamente zu leiten. Zum ersten Mal konnte ein historisches Bauwerk mit diesem neuen Material in Verbindung gebracht werden. Das neue Dach ist schmutzresistent, lässt wieder Licht durch das Gebäude fließen und bringt das historische Tragwerk zur Wirkung. Die Weiterführung der lichtduchlässigen Dachkonstruktion auf die z. T. offenen Bahnsteige und deren halbkreisartige Zusammenführung wurde – wohl aus Kostengründen vom Bauherrn, ähnlich wie beim neuen Hauptbahnhof in Berlin, gestrichen. Ebenfalls gründlich saniert wird die imposante Eisenkonstruktion der 3 großen Hallenbögen, zur Entstehungszeit um 1892 das Modernste an europäischer Ingenieurleistung im wilhelminischen Deutschland und die große Eingangshalle mit Kuppel. Eine der schwierigsten ingenieurtechnischen Herausforderungen bestand darin, die Lasten des 30.000 qm großen Membrandachs in das historische Tragwerk und die Fundamente abzuleiten. Die neue Fosterkuppel lehnt sich stark an die ehemalige Gründerzeitform an, ohne sie komplett zu kopieren. Jene ehemals offene Glaskuppel ließ ab 1892 Tageslicht in die Halle scheinen. In der Nachkriegszeit war die beschädigte Kuppel vereinfacht repariert und mit einem spitz zulaufenden Schieferdach gedeckt worden, das die Kuppel völlig verschloss. Der Hauptteil der Eisen-Konstruktion der alten Belle Epoque Kronen-Form wurde dabei wieder verwendet. Aber man zog eine Zwischendecke ein, die die einstige prachtvolle Wirkung dieser Kathedrale des modernen Verkehrs stark beeinträchtigt hatte. Seit 2006 ist die Eingangshalle wieder hell durchlichtet und strahlt – auch ohne die alten Zwickelbemalungen – Opulenz aus. Allerdings wurde der Kuppelanlauf der inneren Kuppel verkürzt, was die Wirkung etwas schmälert und die Konzentration mehr auf das Konstruktive als auf das Dekorative lenkt. Licht durchflutet sind auch die hohen, gewölbten Hallen rechts und links der Kuppelhalle, desgleichen die beiden ehemaligen Speisesäle, welche jetzt ebenfalls direktes Tageslicht erhielten. Die beiden Ecktürme der Hauptfassade, in den 1970er Jahren ihres gründerzeitlichen Turmaufsatzes, der Fenster und eines umlaufenden Balkons beraubt, werden denkmalpflegerisch erneut hinzugefügt. Der neue Bahnhof von Foster respektiert die klassische Stahlbogenkonstruktion der drei Hallen. Das ist innerhalb der Moderne keineswegs eine Selbstverständlichkeit. In Dresden hätte während eines radikalisierten Modernisierungschubes nach 1969 der Hauptbahnhof kompromisslos seine Gestalt verloren. Am westlichen Ende war bereits damals ein neuer Busbahnhof konzipiert, der jedoch vollständig die eindrucksvollen Hallenbögen aus Stahl und Glas beseitigt hätte. Dank einer verantwortungsvollen starken Bürgerschaft, die in den 80er und 90er Jahren verstärkt auf die zu schützenden Errungenschaften der historischen Stadt aufmerksam machte, kann nun im neuen Jahrhundert ein aufgeklärtes und liberal gemäßigtes Bewusstsein in einer ausgeglichenen Balance zwischen Fortschritt und Tradition erwachsen. So ähnlich betonte es der Architekt Foster selbst, als er die größte Schwierigkeit bei der Konzeption für die Renovierung nannte, „das Beste aus der Vergangenheit in die Zukunft zu transponieren“. Systemgeometrie Stahlunterkonstruktion Computermodell der Mittelfelder Quelle: www.das-neue-dresden.de/hauptbahnhof.html Webseite des Architekturbüros zum Dresdner Hauptbahnhof: www.fosterandpartners.com Dachtragwerk – Stahlkonstruktion Modell, Maßstab 1:50 Dachtragwerk – Stahlkonstruktion Eine der schwierigsten ingenieurtechnischen Herausforderungen bestand darin, die Lasten des neuen Membrandaches in das historische Stahltragwerk ein- und in die Fundamente abzuleiten. Das eiserne Bestandstragwerk der Bahnsteighalle war in der statischen Grundkonzeption des Errichtungszeitraumes zur Ableitung der vorrangig vertikalen Dachlasten aus Eigengewicht des Eisentragwerkes, der Holz-, Glas- und Blechdacheinhausung sowie der Schneelast, als lineares Bogentragwerk konzipiert. Der Umbau von einer festen Dacheinhausung zu einem Membrandach führt einerseits zu einer Reduzierung des Tragwerkseigengewichtes, andererseits treten infolge der räumlichen Membranvorspannkräfte erhebliche Druckbeanspruchungen im Bogentragwerk auf. Die Umsetzung der raumgeometrischen und statischen Tragwerksanforderungen unter Beibehaltung der statisch-konstruktiven Gegebenheiten des linearen Bestandstragwerkes erforderte eine ergänzende sekundäre räumliche Stahlunterkonstruktion welche als Adapter die räumliche Membrangeometrie auf das orthogonale Bestandsbogentragwerk und die Lasteinleitung der Membrankräfte in das filigrane Stabtragwerk der Hallenbögen vermittelt. Oberhalb der Bogenbinderscheitel öffnet sich die Membranhaut linsenförmig bis zu den Systemachsen der einzelnen Bogenscheiben. Die entstehenden Öffnungen sind durch gläserne Oberlichter überdacht. Systemisometrie der Oberlichter Darstellung Membranspannungen – Lastfall Wind Dachtragwerk – Membran Im Gegensatz zu der bisherigen Dacheindeckung leitet die Membrandachhaut die Lasten mit in der Membranebene orientierten Zugkräften in den Stahlbau ein. Das Membrandach besteht aus einzelnen ca. 10 m breiten Paneelen, die zwischen den Bogentragwerken installiert wurden und im Endzustand die komplette Dachfläche überspannen. Die Membrane wird in Bogenlängs- und Querrichtung mit Hilfe von Membranklemmen an Stahlrohre der Stahlunterkonstruktion angeschlossen, wobei eine doppelt geschwungene Form dem Membrandach die erforderliche Steifigkeit verleiht. Die besonders schmutzresistente transluzente, teflonbeschichtete PTFE-Glasfaserfolie lässt 13 % des Tageslichts durch und bringt so das denkmalgeschützte Stahltragwerk elegant zur Wirkung. Bauausführung Je Bahnsteighalle wurde eine ca. 40 m lange verschiebbare stählerne Arbeitsbühne oberhalb der Stützenfüße des vorhandenen Bestandstragwerkes erstellt, die zur Durchführung der Instandsetzungs-, Korrosionsschutz- und Montagearbeiten und gleichzeitig als Absturzsicherung und Abschottung der Baumaßnahmen gegenüber dem Bahnhofsbetrieb diente. Der gewählte Bauablauf sah eine abschnittsweise Durchführung der Arbeiten in sieben Bauabschnitten vor. Für die gesamte Instandsetzung und den Umbau des Tragwerks wurden authentische Elemente erhalten und zeitgemäße Lösungen, die den Charakter des Gebäudes gerecht werden, hinzugefügt. Computermodell Membranhaut Literatur: Vitzthum, M., Voland, P., Foster & Partners; Stahlbau 75 (2006), H. 3, S. 311–218 Falk Jäger; Glas Nr. 4 (2007), S. 12–19 Foster & Partners; industrieBAU 2 (2005), S. 32–35 Fotos: Rudi Meisel, Foster & Partners Nigel Young, London Architektur und Tragkonstruktionen II, Tragwerksanalyse, Anne Mikoleit, 23.03.08 18 Prager Straße Architekten/Stadtplaner: Peter Sniegon, Hans Konrad und Kurth Röthig, 1965–78 Quellen: Broschüre zur Studentenexkursion 2007 der HS Karlsruhe nach Dresden und Prag mit Prof. Florian Burgstaller http://de.wikipedia.org/wiki/Prager_Stra Die Prager Straße wurde zwischen 1851 und 1853 als Verbindung zwischen der Dresdener Altstadt und dem Böhmischen Bahnhof, der nach seinem Abriss und Wiederaufbau in Hauptbahnhof umbenannt wurde, erbaut. Im Zuge der Industrialisierung wurden neue Wohnungen und Straßen benötigt, die auch die engen Gassen der Altstadt entlasten sollten. Anwohner beschwerten sich bereits um 1840 und als schließlich der Böhmische Bahnhof erbaut werden sollte, wurde eine Verbindung zwischen Innenstadt und Bahnhof nötig. Aufgrund der Knappheit an Bauland wurde beschlossen, die Prager Straße geschlossen zu bebauen. Sie entwickelte sich zu einer der prächtigsten Straßen in Dresden mit zahlreichen Einkaufs- und Vergnügungsmöglichkeiten. Einige architektonisch besonders bemerkenswerte Bauten waren das Viktoriahaus, das Residenzkaufhaus und das Gebäude der Feuerversicherungsgesellschaft. 1945 wurde das Areal bei den Luftangriffen auf Dresden fast vollständig zerstört. Mit einem Architekturwettbewerb wurde der Wiederaufbau 1962 eingeläutet. Es gab verschiedene Meinungen über die Umsetzung. Während einige Architekten für den teilweise originalgetreuen Aufbau plädierten, lehnten andere diese Vorstellung ab und befürworteten eine völlige Neubebauung. Keiner der Architekten war jedoch für die Wiederherstellung der Platz sparenden geschlossenen Bauweise. Ein Grund hierfür war, dass die Menschen im Feuersturm nur sehr schwer aus den engen Häusern fliehen konnten. Zwischen 1965 und 1978 entstand die neue Prager Straße. Im Westen wurden zwischen 1967 und 1970 drei Interhotelbauten errichtet. Auf der breiten Straße entstanden verschiedene Wasserspiele und Grünanlagen. Die Prager Straße entwickelte sich in den 1970er und 1980er Jahren durch die zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten, die Hotels und das Rundkino zum wichtigsten Fußgänger-Boulevard in Dresden. In den Jahren 1976 bis 1978 wurde das bekannte Centrum Warenhaus erbaut. Dieses Gebäude war durch seine markante Aluminiumfassade gekennzeichnet. Nach 1990 zog dort Karstadt ein, inzwischen wurde es abgerissen. Am 8. Oktober 1989 wurde auf der Prager Straße während der Demonstrationen gegen die SED-Herrschaft die Gruppe der 20 gegründet. Daran erinnert heute eine Gedenkplatte. Beim Elbehochwasser 2002 wurde der südliche Teil der Prager Straße von der über die Ufer getretenen Weißeritz überflutet. 19 Rundkino Prager Straße 6 Architekten: Gerhard Landgraf, Waltraud Heischkel, 1970/72 Ausstattung: Deutsche Werkstätten Hellerau Im Zuge der Neugestaltung der Prager Straße wurde dieser Entwurf für einen Kinoneubau ausgewählt. Gewünscht war eine geschwungene Form, als Kontrast zu der kubischen Nachbarbebauung. Die Rotunde mit einem Durchmesser von 50 m entsprach dieser Forderung am konsequentesten. Das ursprünglich freistehende zylindrische Gebäude hat eine Höhe von 20 m und wird äußerlich in drei Ebenen gegliedert. Das Erdgeschoss umläuft eine Glasfront, die zur Prager Straße zugunsten einer Arkade zurückgesetzt wird. Die Fassade des 1. OG besitzt ein vorgehängtes Stabwerksornament des Dresdner Grafikers Gerhard Papstein. Das 2. OG ist mit weiß emaillierten Metallbändern verkleidet, zwischen denen der mit schieferfarbenem Granulat beschichtete Saalkörper zu sehen ist. Die so entstehenden vertikalen „Zebrastreifen“ verleihen optisch mehr Höhe und lockern den kompakten Baukörper auf. Im Inneren des Gebäudes befindet sich der 1018 Zuschauer umfassende große Saal sowie in der Tiefebene der kleine Saal für 132 Zuschauer, welcher zu DDR-Zeiten als Filmkunstkino genutzt wurde. Ein großzügiges Foyer mit Garderoben im Erdgeschoss empfängt den Besucher. Über die breite Freitreppe gelangt man in das Obergeschoss mit dem umlaufenden Flaniergang und Imbiss-Raum. Der große Saal wurde bis zu seiner Schließung auch zu anderen Veranstaltungen genutzt, wie Jugendweihen, Versammlungen, Kongresse, Pop- und Schlagerkonzerte oder anderem. Für das Rundkino unvorteilhaft wirkte sich in den 90er Jahren die Umbauung des als Solitär geplanten Lichtspieltheaters aus. Die einschnürende Bebauung von Günter und Holger Just (Wöhrl-Plaza von 1995–96) drängte den charismatischen Rundbau in den Hinterhof ab und nahm ihm dadurch die auf Weitwirkung berechnete Ausstrahlung. Damalige städtebauliche Planungen des gleichzeitig als Stadtplanungsdirektor fungierenden Günter Just sahen (und sehen) eine Verengung der Prager Straße auf die ursprüngliche Breite von 19 Metern vor, um mehr Dichte, Urbanität oder weniger luftige Zugigkeit zu erzeugen. Allerdings schnitt diese veränderte Nachwendeplanung vorhandene Entwürfe für ein städtebauliches Umfeld des Rundkinos aus den 80er Jahren ab. Bereits als Kellergeschosse errichtete Fundamente von neuen postmodernen Wohngebäuden (ähnlich denen an der Ferdinandstraße) wurden Anfang der 90er Jahren wieder abgerissen. Sie hätten jedoch den freien Blick auf das Rundkino von der Prager Straße aus gewährleistet. 20 UFA-Kristallpalast St. Petersburger Straße 24a Architekten: Coop Himmelb(l)au (Wolf D. Prix und Helmut Swiczinsky), 1997/98 „In klarer, geometrischer Ordnung bilden die schlanken Scheibenhochhäuser an der Prager Straße in Dresden ein städtebauliches Ensemble, das mit dem Hauptbahnhof im Süden und dem Übergang zum Altmarkt im Norden ein typisches Ergebnis der Stadtplanung der 60er Jahre ist. Diesem Ensemble wurde mit dem Kinozentrum ein weiteres Element hinzugefügt, das einen neuen öffentlichen Raum östlich der Prager Straße definiert und damit zugleich die Querbezüge zur großen Achse verstärkt. Zur Belebung dieses neu gewonnenen urbanen Raumes werden sämtliche Zugänge zum komprimierten „Kinoblock“ als öffentliches Ereignis inszeniert. Das weite Foyer, die skulptural ausgeformten Treppenanlangen, die in einen Drahtkegel eingehängte Bar und zusätzliche Servicefunktionen werden weithin sichtbar in den öffentlichen Raum eingestellt und von einer kristallinen Stahl-Glaskonstruktion umfasst, die diesem neuen Treffpunkt inmitten der Stadt ein einprägsames Zeichen mit weiter Ausstrahlung gibt. In bewegtem Kontrast zu den sonst zumeist monofunktional konzipierten und im Gefüge der Stadt hermetisch abgeschlossenen Baukörpern solcher Unterhaltungsmaschinen wird hier dem Publikum eine vielfältig bespielbare Bühne gegeben, auf der sich vor allem die jüngere Generation spielerisch darstellen kann. Durch die Sichtbarkeit der Bewegungen und Interaktionen im – zumal abends hell erleuchteten – „Kristall“ wird der transparente Baukörper selbst gleichsam zu einem Medium der Öffentlichkeit, das für die Wiedergewinnung von Urbanität in unseren Städten einen beispielhaften Beitrag leisten kann. In der expressiven Formensprache kommt gegenüber der strikten Geometrie der Umgebung eine fast anarchisch anmutende Vitalität zum Ausdruck, die gerade in dieser Gelenksituation zwischen Altstadt und Nachkriegsmoderne einen bemerkenswerten, zukunftsweisenden Akzent von hoher gestalterischer Qualität setzt.“ Text aus der Laudatio zur Verleihung des Deutschen Architekturpreises 1999 Das Kino in der Prager Straße in Dresden ist eines der ersten größeren realisierten Bauten des Büros Coop Himmelb(l)au der Wiener Architekten Helmut Swiczinsky und Wolf D. Prix. Deren konzeptionelle und provokante Architekturvorstellungen wurden Ende der neunziger Jahre erstmals mit hohem digitalem und bautechnischem Aufwand für umgerechnet rund 25 Millionen Euro realisiert. Das Kino wurde in Form eines verzogenen, spitzwinkligen, zerfließenden Glaskristalls errichtet. Als Standort wählte der Bauherr eine Baulücke zwischen der Verkehrsschneise der St. Petersburger Straße und der Prager Straße. Der neue UFA-Palast liegt in unmittelbarer Nähe zum bestehenden, denkmalgeschützten „Rundkino“. Zur St. Petersburger Straße hin zeigt sich die rohe Betonstruktur des Neubaus mit einem Gitterrost verkleidet. Eingangsbereich und die gefaltete Glasfront sind zur Prager Straße hin orientiert. Im durch Sichtbeton und Stahl geprägten Innenraum herrscht überwiegend dekonstruierte Ruppigkeit; eine „Skybar“ schwebt als Attraktion unter dem Glashimmel. Das Raumerlebnis lebt gleichermaßen von den ungewohnten Geometrien und der unorthodoxen Verwendung und Fügung der Materialen Stahl, Glas und Beton. Besonders eindrucksvoll sind dabei die haushohen Betonwände im Foyer. Der hellgraue Beton weist eine sehr glatte Oberfläche auf. Konstruktiv lässt sich das Kino in zwei unterschiedliche Bereiche aufteilen: den Saalkomplex und das Foyer. Der Saalkomplex ist als monolithisches Bauwerk mit großen Raumhöhen, Deckensprüngen und teilweise geneigten Wänden konstruiert. Das Foyer wird von einer Glas-Stahl-Konstruktion abgeschlossen und beinhaltet eine raumbildende Kaskade stählerner Treppenläufe sowie zwei eigenwillig geknickte Türme für die Aufzüge. Das Fugenbild der Betonoberflächen wurde von den Architekten vorgegeben. Die letztlich realisierte Architektur sei eher eine Spar-Variante gegenüber den ursprünglichen Entwürfen gewesen, erläuterte Objektleiterin Silke Dikomey. Eigentlich sei geplant gewesen, in einen dreieckigen kristallinen Baukörper zwei Quader als Kinosäle zu hängen, die über eine lange gewundene Spiraltreppe zugänglich gewesen wären. Auch seien beleuchtete Fußböden vorgesehen gewesen. Diese Ideen seien aber zu teuer und zu unpraktisch gewesen. Quellen: www.baunetz.de (Januar 07) www.coophimmelblau.at http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Dresden_ Ufa_Cinema_Center.jpg 22 Neumarkt Prof. Dipl.-Ing. Horst Thomas Die Neubebauung um den Dresdner Neumarkt und die Frauenkirche Nach Beendigung der Diskussionen um die Frage, ob die Frauenkirche rekonstruiert werden solle oder nicht, setzte – nach der Entscheidung dafür und bei fortschreitender Bautätigkeit – die Diskussion um die Gestaltung der Umgebung ein. Dieses ehemals dicht bebaute Quartier um den Neumarkt, das bis ins 16. Jahrhundert teilweise außerhalb der befestigten Stadt lag und im Rahmen des Ausbaus der kurfürstlichen Residenz um 1530 einbezogen wurde, war 1945 völlig zerstört worden. 1. Zur Nachkriegsgeschichte und zu ersten Vorstellungen der Wiederbebauung Im Gegensatz zur Frauenkirche, deren Ruine und Trümmerberg als Mahnmal gegen den Krieg stehen gelassen wurde, sind die Ruinen der Quartiere um den Neumarkt abgeräumt worden und blieben unbebaut. Die großenteils erhaltenen historischen Keller wurden verfüllt, blieben aber erhalten. Die völlig ungegliederte Freifläche südwestlich der Kirchenruine reichte bis zum Altmarkt und wurde von diesem erst 1969 durch den Bau des Kulturpalasts getrennt. Zwischen der nördlich der Frauenkirche gelegenen Töpferstraße und dem reparierten bzw. rekonstruierten Gürtel von Monumentalbauten entlang der Elbe, entstand seit den späten 1980er Jahren ein Hotelkomplex (heute Hilton) sowie Wohnungen in angepassten, d.h. anspruchsvolleren Plattenbauten der späten DDR-Zeit. Für eine Wiederbebauung des Gebiets wurde schon früh die Konzeption entwickelt, dass besonders wichtige und gut dokumentierte Bauten der Vorkriegszeit als Leitbauten rekonstruiert werden sollten. Für die daneben und dazwischen gelegenen Bauten wurden jedoch zeitgemäße Lösungen angestrebt, die sich am Maßstab der Umgebung orientieren und mit Putzfassaden einfügen sollten. Eine Gestaltungssatzung von 2002 sieht in den 8 Quartieren auf über 100 zu bebauenden Parzellen 60 Leitbauten vor. Neben der Orientierung am Maßstab der Leitbauten war die zentrale Frauenkirche Orientierung für die Neubauten, für deren Traufhöhe die Höhe der senkrechten Mauern der Kirche verbindlich vorgegeben wurde. Die zu bebauenden Quartiere entsprechen denen der Vorkriegssituation, wodurch nicht nur die Platzanlage des Neumarktes und die anschließende Platzfläche des Jüdenhofs, sondern auch die teilweise nicht mehr erkennbaren Straßen und Gassen wiedererstehen sollten. Blick vom Rathaus in Richtung Prager Straße direkt nach dem Krieg und zu Beginn des Wiederaufbaus 2. Einschätzungen und Warnungen eines Denkmalpflegers Bereits im Jahr 2000 erklärte Thomas Will, Professor für Denkmalpflege und Entwerfen an der TU Dresden, in einem Vortrag, dass es sich beim Wiederaufbau des Gebiets nicht um eine denkmalpflegerische Aufgabe handele, weder nach seinem Verständnis als Denkmalpflegelehrer noch nach dem öffentlichen Willen – wie er sich im Denkmalschutzgesetz niedergeschlagen hat. Allenfalls Umgebungsschutz könne reklamiert werden, wobei dieser – da ja keine Umgebung mehr da war – über wichtige und gut dokumentierte ehemalige Einzelgebäude, die im Rahmen der Neubebauung wieder erstehen sollten, eher indirekt hergeleitet werden könne. Er warnte vor der positivistischen Auffassung, Kulturgüter seien mit Hilfe heutiger Technik reproduzierbar, kopierbar, aus denkmalpflegerischer Sicht sei eine solche Haltung sogar gefährlich, da sie die leichtfertige Beseitigung verbliebener Reste – im Bewusstsein ihrer Wiederherstellbarkeit – eher fördere. Wichtig waren ihm allerdings die historischen Keller, deren Erhaltung und Einbeziehung er als Chance sah. Er sah in ihnen Zeugen der Stadtgeschichte, die als städtebauliches Potenzial begriffen werden sollten und durch deren Einbeziehung eine wahrhafte Architektur des Ortes und der Erinnerung entstehen könnte. Im Übrigen sollte die Frage der Wiederbebauung weniger gereizt und mit Gelassenheit und Toleranz geführt werden, schließlich ginge es ja nicht um ein einzelnes Kunstwerk, das mit unbeirrbarer Konsequenz vollendet werden müsste, sondern um ein Stück Stadt, für die man zwar auch ein Leitbild brauche, jedoch keine fertige Ideallösung. Will sah – die bereits getroffene Entscheidung für eine Rekonstruktion voraussetzend – zwei alternative Szenarien, wobei er keinen Hehl aus der Bevorzugung der zweiten macht (sinngem. und gekürzt): - die statische, vermeintlich „historische“ Lösung: Rekonstruktion mit selektiven historischen Formen, bei der das nicht minder selektive Bild einer vergangenen Epoche beschworen wird; Reduzierung der Altstadt auf den musealen Nachbau, mit der Gefahr einer kunstgewerblichen Stadtattrappe und vermutlich Preisgabe der alltäglichen städtischen Funktionen; oder - Rekonstruktion als Reurbanisierung, als unmissverständliche Reparatur; Möglichkeit der Mischung unterschiedlicher Ansätze auf der Basis überlieferter städtebaulicher Regeln und materieller Strukturen; Zugeständnisse an städtisches Leben unter Verzicht auf Planungsziel des großen, fertigen Kunstwerks; Bereitschaft zum Risiko der architektonischen Einfühlung, aber auch zur Banalität, anstelle des verordneten Idealbilds. 3. Das Vergabeverfahren der Stadt Wills Empfehlung für eine kleinteilige Bebauung mit unterschiedlichen architektonischen Ansätzen auf einer gemeinsamen Plattform könnte mit seinen Empfehlungen, die historischen Keller zu nutzen, wohl nur auf der Grundlage eines individuellen Wiederaufbaus der einzelnen Grundstücke realisiert werden. Eine solche Lösung wäre jedenfalls am besten geeignet, die Normalität städtischen Lebens und urbaner Vielfalt sowie städtische Wandelbarkeit zu erreichen. Auf solch mühselige, die Fertigstellung des Wiederaufbaus hinauszögernde Verfahrensweise scheint sich die Stadt nicht einlassen zu wollen. Die Vergabe erfolgt wohl in größeren Einheiten, was zu Großlösungen mit Hotelkomplexen, Einkaufspassagen usw. führt, die sich – dem vagen Muster der Vorkriegsbebauung folgend – hinter kleinteiligen und unterschiedlichen Fassaden tarnen. Beispielhaft wird in einem Kolloquium von einem potentiellen Investor berichtet, der vorhatte, nur ein einzelnes, im Übrigen wichtiges Haus wiederaufzubauen, das aber originalgetreu. Angeblich soll die Stadt abgelehnt haben. 4. Die ersten Ergebnisse stoßen auf Kritik Einige Blöcke sind bereits fertig gestellt, andere im Bau bzw. in Vorbereitung. An den Ergebnissen gibt es viel Kritik. Bei einem Kolloquium der Sächsischen Akademie der Künste waren sich fast alle Experten einig in der Bewertung, dass die Stadtentwicklung viele Fehler machen würde, die nur schwer zu beheben seien. Zudem wird beklagt, dass die Investoren sich nicht an die vorgegebenen Regeln halten. Statt traditionelle Ziegelbauweise zu verwenden, werden Fassaden aus Beton gegossen, statt Putzfassaden werden bisweilen Plattenverkleidungen verwendet. Die durch die großteilige Vergabepraxis entstehenden Großnutzungen und ihre kleinteiligen Fassadengestaltungen werden als Mogelpackungen bezeichnet. Im Übrigen gibt es viel Kritik an der architektonischen Qualität der Bauten. Ein früherer Baubürgermeister (und Architekt) hält die im an die Töpferstraße angrenzenden Quartier I entstandene Glaspassage für die schlechteste Einkaufspassage der Stadt mit grob verarbeitetem Glasdach und einem Ausblick auf trist gestaltete Rückfassaden und spricht von einem Skandal. 5. Fazit Der Wiederaufbau der Quartiere um den Dresdner Neumarkt ist noch lange nicht abgeschlossen. Die bisher erkennbaren Ergebnisse stoßen auf breite Kritik und es bleibt abzuwarten, ob sich dadurch Änderungen in der Verfahrenspolitik ergeben. Dies könnte schon durch eine andere – kleinteiligere, sicher dadurch auch mühevollere und längere Realisierungszeit bedürfende – Vergabe der Grundstücke geschehen, sei es durch die stärkere Kontrolle der Einhaltung örtlicher Bauvorschriften, sei es durch stärkeren Einsatz oder Einfluss der Bauberatungsgremien. Das Gebiet um die mit großer Authentizität rekonstruierten Frauenkirche stellt sich dar als städtebaulich maßstäbliches aber letztlich historisierendes Bauen, bei dessen Bewertung es darauf ankommt, inwieweit man mit einer passenden Rahmung und auch touristisch verwertbarer Stimmigkeit zufrieden ist oder ob man architektonische Ansprüche an Neubauten in einer derart prominenten Umgebung stellt und diese sogar als Herausforderung zur Ausbildung einer besonderen Qualität versteht. Dazu noch einmal der Denkmalpfleger und Architekt Prof. Thomas Will: Wenn in einer Stadt einige Hüter des guten Geschmacks glauben, das Image damit pflegen zu müssen, dass sie am Neumarkt eine „gute Stube“ einrichten wollen, bei der es für zeitgenössische Architekten heißt: „Wir müssen draußen bleiben“, dann zeigt das, dass es ihnen nicht um Baukultur geht oder um Ästhetik im Sinne eines Erlebens schöner, interessanter Stadträume. Worum geht es dann? Um Ausgrenzung der Gegenwart unter dem Vorwand einer zurückholbaren Vergangenheit oder um plumpen Touristenfang. Zur Schaffung eines angenehmen Heimat- und Aufenthaltsorts müsse stattdessen beides vorhanden sein: das richtige Maß an Vertrautheit wie an Neuem. Nach Wills Überzeugung kann das Neue nicht vom Neumarkt fern gehalten werden, wenn nicht etwas Enttäuschendes entstehen soll. zusammengefasst aus veröffentlichten Berichten und Meinungen und eigener Besichtigung der ersten Rohbauten von Horst Thomas insbesondere verwendet: - Thomas Will: „Rekonstruktion der europäischen Stadt? – Zur Diskussion um den Dresdner Neumarkt“; db 3/2001 - wikipedia.org/wiki/Neumarkt_Dresden 26 Zum Wiederaufbau der Frauenkirche Neumarkt Architekt: George Bähr, 1726–43 Prof . Dipl.-Ing. Horst Thomas 1. Die städtebauliche und baugeschichtliche Bedeutung der Frauenkirche Kaum ein im 2. Weltkrieg zerstörtes Bauwerk hat solche Diskussionen, Emotionen und Aufwendungen initiiert wie die Frauenkirche. Ein wesentlicher Grund dafür kann darin gesehen werden, dass dieser in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts errichtete Bau architektonisch, baukonstruktiv wie städtebaulich von höchster Bedeutung war. Um die singuläre architektonische Qualität – die keine Nachfolge gefunden hat – im vorgegebenen hochwertigen Standard wiedererstehen zu lassen, mussten enorme baukonstruktive Probleme gelöst werden, über die zusammenfassend zu berichten ist. Entscheidender Auslöser für das gewaltige Unterfangen war sicher in erster Linie die städtebauliche Wirkung, die als steinerne Glocke die städtebauliche Neuordnung zur Zeit August des Starken vollendete und die der Stadt den Namen Elbflorenz eingebracht hat. Friedrich August, später gen. der Starke, gelang es, zum Ausbau seiner Residenz eine Reihe hervorragender Künstler und Baumeister nach Dresden zu holen und die höfische Baukunst stand in voller Blüte. Der Zimmermeister George Bähr hatte sich durch Kirchenbauten im Erzgebirge für höhere Aufgaben qualifiziert und erhielt 1722 den Auftrag für die protestantische Hauptkirche der Stadt. Sein erster Entwurf sah bereits einen Zentralbau mit hoher Kuppel vor und folgte damit einer grundsätzlichen Konzeption dieser Zeit über den protestantischen Kirchenbau. Die Realisierung war umstritten, es gab Gegenentwürfe anderer Baumeister, schließlich setzte sich Bähr mit einem neuen Entwurf (und reduzierten Kosten) durch. 2. George Bähr als avantgardistischer Baumeister Prof. Dipl.-Ing. Horst Thomas, Architekt, Stadtplaner, Denkmalpfleger, Georg-Simon-Ohm Hochschule, Nürnberg Planergruppe HTWW, Wiesbaden, Aschaffenburg, Erfurt Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung Arbeitskreis Theorie und Lehre der Denkmalpflege e.V. Der Bau wuchs bis unter die Kuppel, dann legte der Baumeister eine Planänderung zur Genehmigung vor: er wollte die Kuppel aus Stein und steinsichtig ausführen. Vermutlich hat er die Fundamente bereits zu Beginn für die entsprechenden Lasten ausgelegt. Es kam zum Streit, Kollegen warnten ihn, schließlich setzte er sich durch. Als er dann auch noch die Laterne aus Stein errichten will, kommt es zu neuem Streit. Die Kuppel hat zu dieser Zeit massive Risse. Nach einer Besichtigung der Schäden stirbt Bähr entkräftet und sein Schüler führt den Bau zu Ende – mit hölzerner Laterne. George Bähr hat in einer Zeit, in der es noch keine statischen Berechnungen gab, Vorstellungen über die Lastabtragung des riesigen Bauwerks mit seiner hohen und schweren Steinkuppel und der flacheren und daher gefährlicheren Innenkuppel entwickelt, die ihn als avantgardistischen Konstrukteur ausweisen. In die Steinkuppel legte er ringförmig mehrere Eisenanker ein, die er allerdings nur unzureichend anspannen konnte (mit Wärme und Keilen). Die Kuppel ruht auf 8 dünnen Pfeilern, die in tiefe, v-förmige Wandscheiben übergehen, die er Spieramen nannte. Den Lastabtrag der Kuppel stellte er sich pyramidal vor, d.h. dass die Spieramen in ihrer Tiefe nicht nur den verbliebenen (über die Aufnahmefähigkeit der Ringanker hinaus gehenden) Teil der horizontalen Kräfte aufnehmen sollten, sondern auch einen Teil der vertikalen. Zu diesem Zwecke ordnete er zusätzliche Anker in den oberen Spieramen an, die er jedoch nicht ausreichend anspannen konnte. Daher waren die inneren Pfeiler tatsächlich erheblich überlastet. Der Bau riss auch im Bereich der Spieramen massiv (im Bereich der Emporendurchgänge) aber stand bis 1945. Zu den der Zeit weit vorauseilenden Besonderheiten Bährs gehörte auch die Steinsichtigkeit der Kuppel. Die – älteren – Kuppeln von Florenz und Rom besitzen eine Dachdeckung aus Ziegel bzw. Metall. Bähr wollte eine Kirche bauen „aus einem Stein“. In einer Zeit, in der es üblich war, Holzaltäre mit Stuckmarmor zu überziehen, um ihnen das Aussehen eines anderen Materials zu verleihen, verfolgte er bereits Materialgerechtigkeit. Möglicherweise reicherte er den Mörtel der Kuppel mit Milch und Eiern an, die in so großen Mengen geliefert worden waren, dass sie nicht durch die Versorgung der Bauleute erklärt werden können. In den 20er Jahren kam es zu umfassenden Konstruktionsverstärkungen. Ein Ringanker wurde von innen in die untere Kuppel eingebaut, jedoch war auch deren Vorspannung noch nicht möglich (Ing. Prof. Rüth). Außerdem wurden zusätzliche Fundamente angeordnet. Die gerissenen Pfeilerquader wurden mit Flacheisen bandagiert. 1945 überstand die Frauenkirche den Luftangriff und die Zerstörung der Stadt. Ein Brand im Inneren führte zu Steinabplatzungen an den überlasteten Pfeilern und das brachte die Kuppel zum Einsturz und zerstörte den Bau bis auf wenige Ruinenteile, zu denen auch die Unterkirche gehörte. 3. Die Frage der Rekonstruktion als denkmalpflegerischer Streit Nach der Zerstörung gab es umfangreiche Untersuchungen (u.a. Henn und Siegel), und während die Monumentalbauten zur DDR-Zeit wiederhergestellt oder rekonstruiert wurden, wagte man sich nicht an die Frauenkirche, sondern erklärte den Trümmerberg als Mahnmal. Nach der Wiedervereinigung führte die Forderung nach dem Wiederaufbau zu einem erbitterten Streit, auch innerhalb der Denkmalpflege. Das politische Argument, der Wiederaufbau der Kirchen von Köln, Nürnberg usw. müsse wegen der politischen Verhältnisse eben jetzt nachgeholt werden, wollte man letztlich doch gelten lassen – trotz der Vorbehalte, dass ein Denkmal nicht beliebig reproduziert werden könne. 4. Die konstruktiven Fragen des Wiederaufbaus Die erste bindende Festlegung war die eines archäologischen Wiederaufbaus, also nicht mit anderem Material für Kuppel und Innenpfeiler, sondern so wie Bähr den Bau errichten ließ. Nach zahlreichen Untersuchungen wurden die Ingenieure Wenzel und Jäger beauftragt. Mit Ihnen waren zahlreiche weitere Büros tätig, die ich hier nicht alle nennen kann. Auch muss ich mich auf die Darstellung weniger grundsätzlicher Problemlösungen konzentrieren. Zwei Fragenkomplexe beinhalteten grundsätzliche Zielkonflikte: 4.1 Kann die Forderung nach archäologischer Rekonstruktion mit den Erfordernissen nach Sicherheit und Bauschadensfreiheit verbunden werden oder nicht? 4.2 Führen konstruktive Hinzufügungen (z.B. von wirksamen d.h. vorgespannten Ringankern) Bährs innovative Erfindungen (wie z.B. die Spieramen) ad absurdum? Zur Erläuterung: Bähr ließ geschmiedete und nicht ausreichend wirksame Zuganker in die Kuppel einbauen. Den restlichen Schub sollten die Spieramen übernehmen. Baute man jetzt voll wirksame, vorgespannten Ringanker in die Kuppel ein und diese würden den Kuppelschub tatsächlich vollständig aufnehmen, so wären die Spieramen funktionslos und von einem archäologischen Wiederaufbau könne nicht mehr gesprochen werden. 5. Lösungen Es sollen einzelne Problemlösungen heraus gegriffen werden. 5.1 Enttrümmerung und Wiederverwendung von Originalsubstanz Die Enttrümmerung sollte wieder verwendbare Teile bergen, identifizieren und ihre technische Qualität prüfen. Es sollten so viele Teile der Originalsubstanz wie möglich wieder an der ursprünglichen Stelle eingebaut werden. 22 Td. cbm Trümmervolumen wurde Stück für Stück beräumt, 25 % der ehemaligen Oberfläche wurde identifiziert, davon wurde 25 % wieder eingebaut. Darunter waren auch zusammenhängende Großteile. 5.2 Lastabtrag des Kuppelgewichts und -schubs Die schweren Sandsteinkuppeln (außen und innen) lasteten sich überwiegend auf den 8 dünnen Sandsteinpfeilern ab und überlasteten diese bis zur Steinspaltung. Der Kuppelschub spaltete die Spieramen, insbes. im Bereich der Perforierung durch die Emporendurchgänge. Alle alternativen Vorschläge mit Bauteilen aus Stahlbeton (Kuppel und/oder Pfeiler), aussteifende Stahlbetonscheibe am Kuppelansatz usw. schieden aus. Die Lösung bestand aus einer Kombination aus zwei Maßnahmen: - Der Herstellung der Pfeiler aus ausgesuchter Sandsteinqualität mit doppelt so hohen Steinformaten, exakt gesägten Lagerflächen, einem speziell bestimmten hochwertigen Mauermörtel mit lückenlos – immer wieder überprüftem – Mörtelauftrag in einer Stärke von nur 6 mm. In einer eigens erstellten Mauerwerkrichtlinie wurden 4 Beanspruchungsklassen definiert, deren anspruchsvollste (oben) zu einer Verdoppelung der Tragfähigkeit führte. - Eine weitere Halbierung der Belastung wurde durch die bereits von Bähr beabsichtigte Lastumlenkung im Sinne seines pyramidalen Lastabtrags erreicht. In Höhe des Ansatzes der Innenkuppel wurde ein frei schwebender Ringanker aus Stahl eingebaut. Die Verwendung von Stahl anstelle von Schmiedeeisen wurde als dem archäologischen Wiederaufbau nicht widersprechend zugelassen. Gegen diesen Ring sind strahlenförmig Anker innerhalb der Spieramen verspannt, in etwa dort wo auch George Bähr seine schmiedeeisernen Anker eingebaut hat. An deren anderem Ende wurden Betonplomben ins Mauerwerk eingebaut, die die Spannkräfte im Mauerwerk breiter verteilen sollen. Durch diese Spannanker werden äußere Kräfte in die Konstruktion eingebracht, die die Stützlinie verändern und so eine Umlenkung der Lastabtragung bewirken. Die Last wird so stärker nach außen und in die Spieramen gelenkt und die pyramidale Lastabtragung erreicht, die Bähr angestrebt hat, jedoch nicht erreichen konnte. Durch die – bereits angesprochene – weitere Halbierung der Last auf den Pfeilern wurde jetzt eine zumindest 4-fache Sicherheit gegenüber dem Vorkriegszustand erreicht, der ja zumindest standfest war (4 N/qmm statt 12 bis 13 N/qmm; Angaben des Büros Wenzel/Freese). 29 5.3 Baugrund, Fundamente, Ruinenteile Die Untersuchung der unteren Konstruktionsbereiche befasste sich mit dem Baugrund, den Fundamenten und der Belastbarkeit der Ruinenteile. Der Baugrund war gut: fest gelagerter Kies, darunter massiver Fels. Die Fundamentsteine waren in gutem Zustand und auch die Rüth’schen Betonfundamente der 1920er Jahre waren in gutem Zustand. Sie wurden rechnerisch jedoch nicht berücksichtigt und stellen eine zusätzliche Sicherheit dar. Durch zusätzlich angeordnete Funktionsräume unter der Straße, außerhalb des alten Bauwerks, ist eine zusätzliche Aussteifung gegeben und Grundbuch ausgeschlossen. Die Ruinenteile wurden auf ihre Brandschädigung hin untersucht. Diese sind nur bis in eine Tiefe von 10 cm durch die Hitze verändert, darunter voll tragfähig. Das belastete Ruinenmauerwerk wird zudem nur nach der geringsten Beanspruchungsklasse der speziellen Mauerwerksrichtlinie belastet. 5.4 Die Steinsichtigkeit der Kuppel Die Steinsichtigkeit machte die Kuppel der alten Frauenkirche zu einem ständigen Befassungsgegenstand der Bauunterhaltung. Er gibt eine (mit Hilfe der Camera obscura entstandenes) Stadtansicht von Dresden von Bellotto, gen. Canaletto (d.J.), bei dem er die Arbeiter auf dem Kuppelanlauf der Frauenkirche mit gemalt hat, die wohl mit Reparaturen beschäftigt waren. Um mehr Sicherheit gegen Feuchteschäden zu erreichen, wurden auf die Auflagerrippen der Decksteine Dübelsteine aus Sandstein in Vertiefungen eingesetzt und die Decksteine aufgelegt. Unter diesen sorgt eine zusätzliche Entwässerungsebene für eine sichere Ableitung des Wassers. 6. Alt und neu Die wiederaufgebaute Frauenkirche besteht aus in situ erhalten gebliebener und wieder verwendeter originaler Bausubstanz sowie hinzugefügter neuer Substanz aus gleichem Material. Dabei lässt das Baumaterial am Kirchenäußeren sofort erkennen, was alt ist und was neu. Diese Unterschiedlichkeit hat für uns heute erklärenden Wert, zeigt sie uns, was erhalten geblieben ist und was nicht. Wir werden also nicht getäuscht und es wird uns nicht die Information übermittelt, der 2. Weltkrieg sei anders verlaufen und habe hier möglicherweise nicht stattgefunden. Diese Information ist für diejenige Generation besonders wichtig, die sich über den Wiederaufbau uneinig war. Mit fortschreitender Zeit wird diese Information langsam weniger wichtig, weil andere Themen in den Vordergrund treten. Heute weiß fast niemand mehr, dass der Campanile von San Marco in Venedig bei einem Erdbeben um die vorletzte Jahrhundertwende eingestürzt und kurz danach wieder aufgebaut worden ist. Mit der Zeit gleicht sich aber auch die Farbe des Sandsteins immer stärker an und irgendwann wird sie vielleicht gleich sein. Dann gibt es immer noch die unterschiedliche Bearbeitung der Oberfläche, an der man – aus der Nähe – erkennen kann, was alt ist und was neu. Diese Information wird sehr lange erhalten bleiben und demjenigen Auskunft geben, der sich dafür interessiert. Der Wiederaufbau verlässt auch dann noch nicht den Pfad der Ehrlichkeit. 7. Fazit Als abschließendes Fazit lässt sich sagen, dass der Wiederaufbau der Frauenkirche in einer Weise erfolgt ist, der den Forderungen nach archäologischer Authentizität weitest gehend gerecht wird. Die Konstruktion folgt der George Bährs, statt schlaffem Schmiedeeisen wird vorgespannter Stahl für Anker eingesetzt. Was Sandsteinmauerwerk war, ist es auch wieder. Das ist – zusammenfassend gesagt – schon das einzige, was verändert wurde. Eine abschließende Bemerkung führt zum Anfang der Darstellung zurück. Dem Gewinn durch den Wiederaufbau der Frauenkirche steht der Verlust der Ruine gegenüber, die als Mahnmal an Krieg und Zerstörung erinnerte, nicht alleine an die Zerstörung einer einzigartigen Kirche, sondern an die Zerstörung einer bedeutenden Stadtanlage und an den Tod unzähliger Menschen. 8. Die Umgebung Die vor ihrer Zerstörung von der Bebauung am Neumarkt umgebene Frauenkirche wurde durch die Zerstörung der Stadt auch aus ihrem baulichen Zusammenhang gerissen. Die Blöcke der Umgebung werden seit einiger Zeit wiederaufgebaut, angeblich nach historischem Vorbild. Diese Neubebauung folgt jedoch einer anderen Vorgehensweise als der oben geschilderten. Sie soll in einem eigenen Beitrag vorgestellt werden. Horst Thomas Verwendete Literatur: „Berichte zum Wiederaufbau der Frauenkirche zu Dresden – Konstruktion des Steinbaus und Integration der Ruine“ Herausgeber: Fritz Wenzel Universitätsverlag Karlsruhe 32 Alte Synagoge Hasenberg 1 Architekt: Gottfried Semper, 1838–40 Chronik 01.11.1837 Unterzeichnung des Kaufvertrages 21.06.1838 Grundsteinlegung der Semper Synagoge 08.05.1840 Einweihung der Synagoge 1900 Israelische Religionsgemeinschaft Dresden wächst auf 5400 Mitglieder 1932 ca. 5000 Dresdner Juden 1933 Erste antijüdische Maßnahmen in Dresden, Verhaftungen, Beginn der Emigration 09.11.1938 Zerstörung der Synagoge in der sog. Reichsprognomnacht 1942 Beginn der Deportation Dresdner Juden in Konzentrationslager 1945 Wiederaufnahme der Arbeit der Jüdischen Gemeinde in Dresden, weniger als 100 Gemeindemitglieder 1949/1950 Aufbau der zerstörten Beerdigungshalle des Friedhofs Fiedlerstraße zur Interims-Synagoge 18.06.1950 Weihe der Synagoge auf der Fiedlerstraße 1996 Gründung des Förderkreises für den Neubau der Dresdner Synagoge 1997 Entscheidung für Entwurf „Neubau Synagoge“ der Architekten Wandel, Höfer, Lorch 09.11.1998 Erster Spatenstich für eine neue Synagoge in Dresden 21.06.2000 Grundsteinlegung in Anwesenheit der Schirmherren 16. März 2001 Richtfest 09.11. 2001 Einweihung der Neuen Synagoge Dresden www.freundeskreis-synagoge-dresden.de/chronik.htm 18.07.2008 Quelle: Informationsmappe Förderverein Bau der Synagoge Dresden e.V. Der Bau der Synagoge in Dresden (1838–40) Nachdem die Gemeinde einen Bauplatz am früheren Gondelhafen unterhalb der Brühl´schen Terrasse käuflich erworben hatte, wandte sich das „Comité zur Begründung einer allgemeinen Synagoge“ an Gottfried Semper. In Anlehnung an den Typus der byzantinischen Kreuzkuppelkirche wählte Semper eine Bauform, die innen und außen in eindrucksvoller Weise den Charakter einer Predigt- und Versammlungsstätte erkennen ließ. Die überhöhte Mitte wurde innen mit einem achtteiligen Klostergewölbe überdeckt, von dessen Scheitel ein Strahlenbündel auf blauem Grund ausging. Außen gab sie dem Bau als kräftiges Oktogon mit einem pyramidalen Dachabschluss ein markantes Aussehen. Im Inneren des quadratischen Hauptbaues fand an der Ostwand der um sieben Stufen erhöhte Thoraschrein, vor ihm das Lesepult und die in die Balustrade ingeordnete christliche Kanzel Platz. An den übrigen drei Seiten erhoben sich die doppeletagigen Frauenemporen. Semper entwarf die gesamte Innenausstattung und erzielte damit eine äußerst geschlossene Raumwirkung. Die der maurischen Kultur (Alhambra in Granada) entlehnten Motive wie Zackenbogen und Kapitellformen deuten sinnbildhaft auf das Judentum, auf die Verschmelzung der orientalischen mit der europäischen Kultur. Außen zeigte sich der Bau in kraftvoller, aber stilistisch weitgehend neutraler Gestalt. Nur sparsam waren romanische Schmuckelemente (Rundbogenfries, Zwerggalerie) eingesetzt. Mit der barbarischen Zerstörung der Dresdner Synagoge in der Reichsprogromnacht, am 9. November 1938, ist ein Gebäude dem Erdboden gleichgemacht worden, das vorbildhaft für spätere derartige Bauten wirkte und zudem der einzige Sakralbau gewesen ist, den Gottfried Semper jemals in seinem reichen Arbeitsleben hat errichten können. 33 Neue Synagoge Am Hasenberg/Rathenauplatz Architekten: Wandel, Lorch und Hirsch, 1998–2001 Am Jahrestag der Zerstörung der alten Synagoge Dresdens, dem 9. November, wurde 2001 – nach mehr als 60 Jahren – die neue Synagoge eingeweiht. Die dritten Preisträger des 1997 international ausgelobten Architektenwettbewerbs, das Architekturbüro Wandel, Hoefer, Lorch und Hirsch aus Saarbrücken, wurden mit der Realisierung beauftragt. Sie knüpften an demselben Ort an, an dem 1833 Gottfried Semper die erste Synagoge errichtet hatte: am Ende der Brühlschen Terrassen. Ein Sakralbau mit in sich nach Osten gedrehtem Kubus – die Gebetsrichtung nach Jerusalem. Die gewählte Würfelform orientiert sich an den ersten Tempeln der Israeliten, knüpft so an ursprüngliche Rituale und traditionelle Symbole an. Auf Fenster wurde verzichtet, da sie die monumentale Wirkung der Wandflä- Führungen unter: Jüdische Gemeinde zu Dresden Synagoge Hasenberg 1 01067 Dresden Telefon 0351/65 60 70 chen zerstören würden, vielleicht auch um nicht ein zweites Mal Glasscheiben klirren zu hören. Die 34 Schichten aus Formsteinmauerwerk des 24 m hohen Gotteshauses drehen sich schraubenförmig nach oben bis sie die exakte Ausrichtung nach Osten erreicht haben. Deren Reiz liegt gerade in jener eleganten Drehung und der feinen Stufung der Quaderblöcke. Nichts Verspieltes, Dekorierendes findet man an diesem ernsten, konzentrierten Bau, der ganz der inneren Sammlung dient. Wie ein Bollwerk steht der blockhafte Bau an den vorbeirauschenden Verkehrsströmen und setzt auf Entschleunigung, Besinnung und introvertierte, in sich gekehrte Meditation. Architektur gegen die Hast. Die provokante äußere Glätte der monochromen profillosen Fassade entspricht ganz dem heutigen architektonischen Zeitgeist und besteht aus massivem Formstein mit Sandsteincharakter, analog der Klagemauer Jerusalem. Das Eingangstor ist eine zweiflüglige Holztür von 2,2 Meter Breite und 5,5 Meter Höhe. Der vergoldete Davidstern, das einzige gerettete Originalstück der Sempersynagoge, wurde direkt über den Türflügeln angebracht. Der Dresdner Feuerwehrmann Alfred Neugebauer rettete ihn nach der Progromnacht. Über dem Tor steht außerdem in goldenen hebräischen Lettern die Inschrift der alten Sempersyn- Auszeichnung: Beste Europäische Architektur 2002 Neben der Mediathek in Lyon von Perrault wurde die Synagoge von Wandel Hoefer Lorch+Hirsch als beste europäische Architektur 2002 ausgezeichnet. Lohnende Lektüre: www.zeit.de/2001/46/200146_synagoge.xml www.das-neue-dresden.de/synagoge.html Synagoge Dresden – Architektur des 20. Jahrhunderts von Wandel, Lorch und Hirsch 2001 agoge: „Mein Haus sei ein Haus der Andacht allen Völkern“. Alle erforderlichen Elemente eines jüdischen Gottesdienstes finden sich in der neuen Synagoge wieder. Der Thoraschrein, das Lesepult, das ewige Licht, sowie natürlich Sitzreihen und Empore, alles umschlossen von einem symbolischen Stiftszelt aus Metallgeflecht. Gerade dieser festliche, golden flirrende Vorhang, der die betende Gemeinde wie ein schützendes Tuch umschließt, birgt eine wunderschön lyrische Poesie. Er symbolisiert zudem das Flexible, Aufbrechende des Judentums, während der steinerne Tempel an sich das ewig Währende, Unauslöschliche des jüdischen Glaubens zum Ausdruck bringt. Verlässt man das Gotteshaus gelangt man über den Baum bestandenen Innenhof zum Gemeindehaus. Dieser 1400 qm große 3-geschossige Funktionalbau mit Foyer dient als Mehrzweckgebäude für die Jüdische Gemeinde Dresden und als Haus der Begegnung mit dem Judentum. Im Gemeindesaal finden Veranstaltungen und Konzerte für ca. 300 Gäste statt. 39 Fenster schaffen eine helle, freundliche Atmosphäre. Eine Bibliothek, Verwaltungsräume, ein Sitzungszimmer und Schulungsräume sowie das Arbeitszimmer des Rabbiners sind in den zwei Obergeschossen untergebracht. Die Gemeinderäume sind durch die zum Hof geöffnete Glasfront von Nordlicht durchflutet. Die edel zurückhaltende, aber äußerst solid handwerkliche Ausstattung wurde in den traditionsreichen Deutschen Werkstätten Hellerau angefertigt. 35 Hotel Westin Bellevue Dresden Große Meißner Straße 15 Architekten: George Bähr, 1724, Takeshi Inoue (Kajima Corp. Tokyo), 1985 Ausschlaggebend für die Namensfindung „Bellevue“ war die Lage mit dem „Canaletto-Blick“ und die Tradition eines zerstörten Hotels am gegenüberliegenden Ufer. Der Entwurf wurde unter der Maßgabe realisiert, die auf dem Grundstück vorhandene barocke Bausubstanz zu erhalten: das ehemalige Wohn-, Brau- und Malzhaus ist das letzte Zeugnis einer geschlossenen, zumeist in das 18. Jahrhundert zurückreichende Bürgerhausbebauung, die sich bis zu ihrem Abriss 1950 an dieser Straße entlang zog. Nach NW und SO schließt sich der Neubautrakt des Hotelkomplexes an. Offenkundig hat man sich an der Proportionierung des Bürgerhauses orientiert, ihm entsprechende Traufhöhe und Neigung des Kupfer gedeckten Mansarddaches, ebenso die Gliederung der Achsen und Geschosse. Indem das Projekt von einer japanischen Firma verwirklicht wurde, versuchte man, einen internationalen Standard in der Tourismusbranche zu bedienen. Hotelinformation: Direkt im Zentrum, inmitten malerischer Gärten am Elbufer gelegen, bietet das Westin Bellevue Dresden seinen Gästen höchsten Komfort. Durch seine exponierte Lage präsentiert es den berühmten „Canaletto-Blick“ auf Dresdens Silhouette, den einst der Maler Bernardo Bellotto auf seinen Bildern verewigte. Die Bellevuegärten und die Terrassen mit herrlicher Aussicht auf Frauenkirche und Semperoper laden zum Verweilen ein. Das „Canaletto“ ist eines der ersten Adressen für Gourmets in Dresden. Bernardo Bellotto, genannt Canaletto, 1722– 80, ein venezianischer Maler, der für seine realistischen Veduten europäischer Städte (insbesondere Dresden, Wien, Turin und Warschau) bekannt ist: „Die Elbe bei Dresden“ 36 Waldschlösschenbrücke Dresden baut und baut und baut Der Welterbe-Titel ist futsch – darin sind sich die Dresdner Stadtoberen einig. Und in noch einem Punkt stimmen sie überein: Die Waldschlösschenbrücke wird gebaut – selbst wenn die sächsische Hauptstadt dasselbe Schicksal ereilen sollte wie das Sultanat Oman. Dresden/Hamburg – „Ich bin erschüttert“ – so kommentierte die künftige Dresdner Oberbürgermeisterin Helma Orosz (CDU) den Beschluss der UNESCO zur Waldschlösschenbrücke. Die Entscheidung sei „vollkommen unverständlich und ungerechtfertigt“. Faktisch bedeute sie eine Aberkennung des Welterbe-Titels. Quelle: SPIEGEL ONLINE 2008 Die UNESCO hatte zuvor im kanadischen Québec entschieden, dass Dresden den Weltkulturerbe-Titel für das Elbtal behalten darf – aber nur vorerst für ein Jahr. Denn die Stadt bleibt auf der Roten Liste der gefährdeten Kulturlandschaften. Nach dem Willen der UNESCO können nur ein Baustopp und der Rückbau der Waldschlösschenbrücke den Erhalt des Titels bewirken. Die geplante vierspurige Brücke über die Elbe, deren Bau im vergangenem November begonnen hat, verschandelt nach Ansicht der UNESCO den einzigartigen Blick auf die barocke Altstadt mit der Frauenkirche, der Semperoper und der prachtvollen Uferpromenade. Die Stadt steht deswegen schon seit 2006 auf der Roten Liste. Gegen den Bau eines Tunnels hat das Gremium dagegen keine Bedenken. So ein Tunnel hat allerdings nach derzeitigem Stand wenig Chancen. Denn trotz ihrer Bestürzung machte die künftige Dresdner Oberbürgermeisterin klar, dass die Brücke weitergebaut wird: „Es gibt keine andere Alternative, niemand wird glauben, dass wir eine halbfertige Brücke zurückbauen“, sagte Orosz. Auch der noch amtierende Oberbürgermeister Lutz Vogel (parteilos) sieht kaum Chancen für den Erhalt des Welterbetitels. Zwar respektiere er die Entscheidung der UNESCO, doch müsse diese sich „auch die Frage gefallen lassen, warum sie keinen realistischen Weg für Dresden aufgezeigt hat“, sagte Vogel. Was bleibe, sei eine „weitere Hängepartie für ein Jahr“. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht in eben dieser Galgenfrist jedoch eine Chance. „Damit ist Zeit gewonnen“, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Thomas Steg. Nun könne man ein Jahr lang noch einmal sehr intensiv die unterschiedlichen Belange prüfen. Es handele sich nicht um eine Denkpause, sondern um eine „Pause zum Denken“. Falls gewünscht, werde sich die Bundesregierung einer Lösung bei der Konsenssuche nicht verweigern, betonte Steg. Auch der Deutsche Kulturrat begrüßte die Entscheidung. Der Spitzenverband der Bundeskulturverbände sprach von einer allerletzten Chance. Zugleich rief er die Verantwortlichen dazu auf, das Warnsignal ernst zu nehmen und endlich mit der UNESCO über tragfähige Alternativen zu sprechen. „Die Streichung des Welterbetitels wäre nicht nur für die Stadt, sondern auch für das ganze Land eine große, schwer hinnehmbare Blamage“, erklärte Geschäftsführer Olaf Zimmermann. Unrecht hat er damit nicht: Dresden wäre erst die zweite Stätte weltweit, die aus der Liste gestrichen würde. Erstmals hatte die UNESCO im Jahr 2007 einem Naturschutzgebiet den Titel wieder aberkannt – im arabischen Oman. Die „Kleine Hufeisennase“: Die Fledermaus hatte im Sommer 2007 – vier Tage vor dem geplanten Baubeginn – die ersten Arbeiten zur umstrittenen Waldschlösschenbrücke durch das UNESCO-Welterbe Dresdner Elbtal vorerst gestoppt Ausführliche Informationen zur Umplanung der Waldschlösschenbrücke finden Sie unter: www.dresden.de/waldschloesschenbruecke 38 Schoss Eckberg (Villa Souchay) Bautzner Straße 134 Architekt: Christian Friedrich Arnold, 1859–61 Die Villa Souchay, wegen ihrer Lage auf dem Bergvorsprung zwischen Mordgrund und Elbe Schloß Eckberg genannt, wurde vom Semper-Schüler C.F. Arnold für den englischen Kaufmann Johann D. Souchay im neugotischen Stil errichtet, wobei der felsige Baugrund am Steilhang des Waldberges für diese aufstrebenden Bauformen wunderbar geeignet war. Arnoldt war nach ausgedehnten Studienreisen durch viele Länder Europas nach seiner Rückkehr nach Dresden bis 1885 als Professor der Baukunst an der Dresdner Kunst-Akademie tätig. Er war an zahlreichen Kirchenbauten in Sachsen beteiligt. Seine bekanntesten Dresdner Werke sind die ehemalige Kreuzschule und der nach seinen Plänen ausgeführte Umbau der Sophienkirche. Mit malerischen Durchblicken und einer einzigartigen Gartengestaltung war die Villa beispielhaft für die Spätromantik. In der Art eines englischen Herrschaftssitzes gebaut, ist sie das bedeutendste Zeugnis dieser Art im Dresdner Raum und ein Höhepunkt der von Arnold geprägten Neugotik. Das aus sächsischem Sand- stein über asymmetrischem Grundriss errichtete Schloss wird durch einen Hauptturm und zwei Nebentürme akzentuiert. Die einzelnen Baukörper wirken additiv aneinandergefügt, werden aber durch Balustradenbekrönung, gleiche Untergeschoßhöhe und einheitliche Formensprache, die sich auch in der Innengestaltung spiegelt, verbunden. Die gesamte innere Ausstattung entspricht völlig dem für das Haus gewählten Baustil. Fußböden, Wandverkleidungen und Türen sind aus Holz hergestellt, einige Decken wurden in Stuck gearbeitet. Auch die damaligen Möbel sind nach Entwürfen Arnoldts nach mittelalterlichen Stilmotiven gearbeitet worden. Die Parkanlagen wurden von dem Gartenbauarchitekten H.S. Neumann entworfen. Der Großteil des 15 ha großen Geländes trägt natürlichen Laubwaldcharakter, während die Anlage um den Hauptbau bewusst dem Tudorstil angepasst ist. 1925 übernahm der Dresdner Großindustrielle Dr. Ottomar Heinsius von Mayenburg, Besitzer der Leo-Werke, Schloss und Park. Die Innenräume des Obergeschosses wurden nach den Plänen seines Bruders, des Architekten von Mayenburg, zeitgemäß erneuert, wobei der Stilcharakter des unteren Bereiches vollständig bewahrt blieb. 1932 starb von Mayenburg, seine Witwe bewohnte das Haus noch bis 1947. Während der DDR-Zeit wurde das Schloss vorwiegend für Aktivitäten der Gewerkschaft, als Jugendbegegnungsstätte und ähnlichem genutzt. Nach der Wende ging es zurück in den Besitz der Familie von Mayenburg, die es aber verkaufte, so dass es heute im Besitz der ARGENTAUnternehmensgruppe München ist, die es nach umfassender Restaurierung und Sanierung seit 1997 als Luxushotel nutzt. Quellen: Architekturführer Dresden, Dietrich Reimer Verlag, Berlin www.schloss-eckberg.de 40 Tag 2 Zeitplan Freitag, 26.09.08 08.00 Uhr Frühstück 09.00 Uhr Abfahrt zur TU Dresden 09.15 Uhr Vortrag an der TU Dresden mit Besichtigung der frei geformten Ziegelschale Vortrag + Führung: Dipl.-Ing. D. Wendland, W. Kurtz + F. Schneider mit Bus Mommsenstraße 6 10.30 Uhr Besichtigung TU Gebäude Architekten: Karl Weißbach, Oskar Kramer, Martin Dulfers Führung: Dipl.-Ing. D. Wendland, W. Kurtz + F. Schneider George-Bähr-Straße1 + 3c, Münchner Platz 1–3, Mommsenstraße 6 11.00 Uhr Weiterfahrt zur TU-Bibliothek mit Bus 11.15 Uhr Besichtigung der SLUB Architekten: Ortner + Ortner Führung: Dipl.-Ing. D. Wendland, W. Kurtz + F. Schneider mit Bus Zellescher Weg 18 11.45 Uhr Weiterfahrt nach Dresden-Albertstadt 12.00 Uhr Besichtigung der Baustelle des Militärhistorischen Museums Architekt: Daniel Libeskind Führung: Dipl.-Ing. Arch. Jörg Scholich, SIB mit Bus Olbrichtplatz 13.00 Uhr Weiterfahrt nach Dresden-Hellerau 13.15 Uhr Mittagessen im Restaurant Schmidt´s in Hellerau Architekt: Richard Riemerschmid mit Bus Moritzburger Weg 67 15.00 Uhr Besichtigung Hellerau Architekten: R. Riemerschmid, H. Tessenow, H. Muthesius Führung: Dipl.-Ing. Arch. Clemens Galonska Gartenstadt und Festspielhaus etc. Moritzburger Weg 67 17.00 Uhr Weiterfahrt zum Sächsischen Landtag 17.30 Uhr Spaziergang • Sächsischer Landtag, Architekten: Barthold + Tiede, 1928–31, Peter Kulka, 1991–94 • Zwinger, Architekt: Matthäus Daniel Pöppelmann • Semperoper, Architekt: Gottfried Semper • Lipsiusbau, Ausstellungsgebäude an der Brühl´schen Terrasse, Kunstakademie, Architekten: Constantin Lipsius, Führung: Prof. Horst Thomas, Georg-Simon-Ohm Hochschule Nürnberg mit Bus Bernhard-von-Lindenau-Platz/Ostra-Allee/Terrassenufer/Theaterplatz/Brühl´sche Terrasse 18.45 Uhr Rückkehr zum Hotel zu Fuß 19.00 Uhr Pause im Hotel Westin Bellevue Dresden Große Meißner Straße 15, 01097 Dresden 19.30 Uhr Fahrt zum Restaurant Villa Marie beim Blauen Wunder 20.00 Uhr Stehempfang und Abendessen im Restaurant Villa Marie mit Bus Fährgässchen 1, 01309 Dresden, Telefon 0351/31 54 40 23.30 Uhr Busfahrt zum Hotel mit Bus mit Bus 42 Frei geformte Mauerschale Forschungsprojekt der Fakultät Architektur der TU Dresden Lehrstuhl Hochbaukonstruktion und Gebäudeerhaltung: Prof. Dipl.-Ing. Arch. C. Schulten Lehrstuhl Tragwerksplanung: Prof. Dr.-Ing. W. Jäger Betreuer: W. Kurtz, F. Schneider und D. Wendland, 2003–06 Eine frei geformte Schalenkonstruktion demonstriert die Möglichkeiten des Mauerwerks jenseits von senkrechten ebenen Bauelementen. Die Form wurde in skulpturalen Arbeitstechniken entwickelt und auf Basis einer numerischen Modellierung so optimiert, dass sie standfest ist. Durch die Umsetzung in studentischen Seminaren wurde das Ob und Wie der praktischen Realisierbarkeit ausgelotet und bestätigt. Das Projekt zeigt die Formbarkeit von Mauerwerk auch im Rahmen der allgemeinen technischen Anforderungen an Mauerwerksbau, und die Wege, wie sich dies erreichen lässt. Dabei erweist sich auch die Machbarkeit geometrisch komplexer Schalenkonstruktionen aus Mauerwerk. Eine weitere Besonderheit liegt in dem Ansatz, mithilfe moderner Informationstechnik wie in einem industriellen Prozess einen direkten Informationsfluss von der Planung zur Fertigung zu etablieren. Ein großer Vorteil des Mauerwerks beim Bau von Schalenkonstruktionen ist die Möglichkeit, doppelt gekrümmte Flächen zu realisieren, und dabei sogar auf eine vollflächige Schalung zu verzichten. Ein Blick in die Architekturgeschichte zeigt zahlreiche Beispiele geschwungener, einfach oder doppelt gekrümmter Mauerwerksflächen, insbesondere Gewölbe mit geometrisch komplexen Formen, die mitunter sogar in Sichtmauerwerk ausgeführt sind. Überdies ist bekannt, dass gemauerte Gewölbe in vielen Fällen freihändig errichtet werden konnten. Im Mauerwerksbau geht derzeit die Tendenz jedoch hin zu großformatigen Elementen und dünnen Fugen, mit denen sich ohne weiteres nur ebene Wandflächen herstellen lassen. Die Möglichkeit, gekrümmte Flächen zu erzeugen, tritt in den Hintergrund, und damit ein Charakteristikum des Mauerwerks. Die experimentelle Schalenkonstruktion an der TU Dresden demonstriert nun ein weiteres Mal das Potenzial dieser faszinierenden „anderen Seite“ des Mauerwerksbaus. Sie zeigt die Machbarkeit einer geometrisch komplexen Form, die sich obendrein als Schale selbst trägt, unter Verwendung gängiger Materialien, entsprechend der Regeln für einen korrekten Mauerverband und im Rahmen geltender Normen. Bei dem kleinen Gebäude auf dem Campus der Universität handelt es sich um eine Schale aus unbewehrtem Mauerwerk mit einem Randträger aus bewehrtem Mauerwerk. Die Abmessungen sind ca. 5,50 auf 4,50 m (Letzteres ist die größte freie Spannweite); die Schalendicke beträgt 11,5 cm, also einen Halbstein. Als Mauerziegel wurden Klinker im Dünnformat verwendet, als Mörtel diente Trasskalkmörtel. Für die Randträger der Schale wurde ein Konstruktionsdetail zur Bewehrung des Mauerwerks quer zur Lagerfuge entwickelt; ihre Bewehrung besteht aus Fiberglas-Stäben. Statt auf einer vollflächigen Schalung wurde die Schale über einem Lehrgerüst errichtet, das in einem Raster von 60 cm gitterförmig das Mauerwerk unterstützte und die Form vorgab; dieses wurde aus Sperrholzplatten hergestellt. Das Fundament ist eine einfache Betonplatte. Reverse Geometric Engineering Die Form der Mauerschale entstand im Wechsel von physischen und digitalen Modellen, wodurch die Vorteile beider Werkzeuge miteinander verbunden werden konnten. Der Formenreichtum, der sich bei der skulpturalen Arbeitsweise am physischen Modell erschließt, ist unvergleichlich; zudem ist das physische Modell besonders gut geeignet für die genaue und sichere intuitive Kontrolle der Form, weil es sich als Objekt im Raum unmittelbar der Wahrnehmung erschließt. Andererseits kann nur ein CAD-Modell eine exakte Formbeschreibung für den Entwurfs- und Herstellungsprozess liefern; es ermöglicht den durchgehenden Informationsfluss über alle Phasen der Planung bis zur Ausführung, und die numerische Modellierung des Tragverhaltens kann nur an diesem vorgenommen werden. Eine wesentliche Aufgabe lag somit in der Integration dieser verschiedenen Ebenen in einen durchgehenden Entwurfsprozess – dies wurde durch den Einsatz moderner Informationstechnik ermöglicht. Insbesondere ergab sich immer wieder die kritische Aufgabe, die Form des physischen Modells in ein CAD-Modell zu übertragen, indem diese basierend auf der Vermessung der Modelle am Rechner nachmodelliert wurde – ein Vorgang, der als „reverse geometric engineering“ bezeichnet wird. Dieses Verfahren ist durchaus anspruchsvoll, denn wie erwähnt ist die Form weitaus komplexer, als dies bei einer von vornherein innerhalb der CAD-Umgebung entwickelten Form der Fall wäre; insbesondere stellt die Software für die numerische Modellierung besondere Anforderungen an das CAD-Modell. 44 Freie Form und stabile Schalenform Ein weiterer Aspekt des Projekts ist die Frage eines Entwurfsprozesses für Schalenkonstruktionen, der trotz des engen Zusammenhangs zwischen Form und Tragverhalten den Architekten in die Lage versetzen kann, die Form solcher Konstruktionen zu bestimmen, und zugleich die aktuelle Architekturdiskussion reflektiert. Insbesondere wurde die Möglichkeit untersucht, eine Form zu finden, die in Bezug auf das Tragverhalten angemessen ist, ohne dabei von vornherein an eine optimale Schalenform gebunden zu sein. Die in diesem Projekt formulierte Position ist insofern auch als Beitrag dazu intendiert, die Rolle von Schalenkonstruktionen im architektonischen Repertoire zu revidieren. Offenbar lassen sich durch die Verwendung moderner Informationstechnik die Möglichkeiten des Schalenbaus aus architektonischer Sicht wesentlich erweitern. Zwischen dem Ansatz einer formoptimierte Konstruktion einerseits, bei der die Schalenform entsprechend dem Gleichgewichtszustand innerhalb der Konstruktion entwickelt wird, und andererseits der traditionellen biegesteifen Konstruktion, bei der die Form für das Tragverhalten eine untergeordnete Rolle spielt, wurde bei diesem Projekt ein „dritter Weg“ versucht. Dazu wurde die Form zwar grundsätzlich ausgehend von den ästhetischen Qualitäten entwickelt, dabei aber immer wieder mit der Stabilitätsfigur unter ähnlichen Randbedingungen verglichen, was mithilfe einfacher Hängemodelle erfolgte. Das Ziel, die Form dahingehend zu entwickeln, daß ein Standsicherheitsnachweis möglich war, wurde allerdings erst mithilfe der numerischen Modellierung erreicht. Dabei wurde das Tragverhalten der am Modell entwickelten Form untersucht und schrittweise durch geringfügige Änderungen der Form verbessert. Das Ergebnis dieses Prozesses wurde erneut in ein physisches Modell übertragen, an dem auch die letzten Modifikationen vorgenommen wurden. Das letzte Wort zur Form des Bauwerks wurde somit am physischen Modell gesprochen. Dadurch konnte gesichert werden, daß die Qualitäten, die im Formfindungsprozess am Modell entstanden waren, auch im ausgeführten Bau erhalten bleiben würden. Unbeabsichtigte Veränderungen an der Form im Verlauf der weiteren Planung konnten sicher ausgeschlossen werden, und insbesondere die Modifikationen, die vor allem zur Verbesserung des Tragverhaltens sinnvoll waren, immer endgültig auf ihre plastisch-räumliche Qualität und die Übereinstimmung mit den ursprünglichen Intentionen überprüft werden. Realisierung der freien Form in Mauerwerk Das Lehrgerüst wurde aus hölzernen Schalungsplatten hergestellt, die mithilfe der aus dem CAD-Modell generierten Schnittkurven zugeschnitten wurden; dazwischen konnten die Mauerschichten in den meisten Fällen freihändig gesetzt werden. Hierfür, sowie für die Anlage eines regelmäßigen Mauerverbandes, konnte auf die traditionelle Technik des Gewölbebau zurückgegriffen werden. Bei Anfertigung des Lehrgerüsts, Formkontrolle und Definition der Geometrie der Mauerschichten konnte eine durchgehende Prozesskette vom CAD-Modell bis zur Fertigung etabliert, und damit auch rationell gearbeitet werden. Diese Kette endete jedoch beim Versetzen der Ziegel, einschließlich des erforderlichen Zuschnitts an den Enden der Mauerschichten. Nur zur Formkontrolle wäre hier ein weiterer Einsatz moderner Informationstechnologie noch hilfreich gewesen. Das Mauern musste von Hand erfolgen; besonders mühsam war dabei die Herstellung der steil ansteigenden Mauerschichten, bei denen die frischen Stoßfugen stark gepresst wurden und daher mit Keilen gestützt werden mussten. Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Formkontrolle mussten an einigen Stellen auch bereits gesetzte Schichten wieder abgetragen und erneut gemauert werden. Überhaupt stellt das Mauern einer gekrümmten Fläche in Sichtmauerwerk allerhöchste Anforderungen an das räumliche Vorstellungsvermögen und die handwerkliche Geschicklichkeit der Ausführenden, und das freihändige Mauern Sponsoren/Materialspenden Wienerberger Ziegelindustrie -– Ziegel quick-mix Leipzig GmbH & Co.KG – Mörtel PERI GmbH – Holz- und Spanplatten Schöck Bauteile GmbH – Bewehrung Thyssen-Krupp – Arbeitsgerüst Kontakt: [email protected] Literatur: Nejati, M., J. Hoffmann und D. Wendland: Report on the structural modelling of the masonry shell „Space of Tranquillity“ (Arbeitsbericht). TU Dresden, Lehrstuhl Tragwerksplanung 2005 Schneider, F.: Die Mauerschale (Seminararbeit). TU Dresden, Lehrstuhl Baukonstruktion und Gebäudeerhaltung 2006 Wendland, D.: Model-based formfinding processes: 'Free forms' in structural and architectural design http://elib.uni-stuttgart.de/opus/volltexte/ 2001/761/ Wendland, D., W. Jäger, und C. Schulten: Experimenteller Bau einer frei geformten Mauerwerksschale. Mauerwerk 2007, H. 4, S. 178–185 Wendland, D.: Experimental Construction of a Free-Form Shell Structure in Masonry. In Proceedings IASS Symposium "Shell and Spatial Structures: Structural Architecture – Towards the future looking to the past", Venezia 2007 Wendland, D.: Lassaulx und der Gewölbebau mit selbsttragenden Mauerschichten. Neumittelalterliche Architektur um 1825–48. Petersberg: M. Imhof, 2008 (im Druck) der stark geneigten Schichten im Scheitelbereich erfordert besonderes Können. Diese Fähigkeiten ließen sich entwickeln: die angehenden Architekten haben sehr gut gemauert, aber der Aufwand an Arbeitszeit war hoch. Unter dem Gesichtspunkt der aufgewendeten Arbeitszeit wären Überlegungen zur Möglichkeit der Fortsetzung der Prozesskette bis zur Fertigung des Mauerwerks durchaus von Interesse, etwa im Sinne einer automatisierten Fertigung. Allerdings hätte eine Vorfertigung im Werk keine Vorteile gebracht, sofern diese ebenfalls manuell erfolgt wäre. Aber vielleicht ist die Rationalisierung der Arbeitszeit auch nicht unbedingt ohne Alternative: es hat durchaus seinen Charme, die Möglichkeiten der Technik dort anzuwenden, wo sie von außerordentlichem Nutzen sind, wie bei den beschriebenen wesentlichen Stadien des Planungsund Verifizierungsprozesses und bei der Formkontrolle, insbesondere dem kontinuierlichen Informationsfluss zwischen den verschiedenen Stadien – und dann virtuos auf „alte“ Werte zu setzen: menschliche Kreativität, Sensibilität, Geschicklichkeit und solides Handwerk. Learning by doing Das Projekt wurde in einer Reihe von Lehrveranstaltungen gemeinsam entwickelt und realisiert: Architekturstudenten haben die Schale entworfen, die Form und konstruktive Ausbildung entwickelt, und sie auch schließlich selbst gemauert. Initiiert wurde das Projekt während des „International Short Course on Architectural and Structural Design of Masonry“, der 2003 an der Architekturfakultät der TU Dresden als Teil des vom Deutschen Akademischen Auslandsdienst geförderten Projekts „Traditional and Innovative Structures in Architecture“ (IQN) am Lehrstuhl Tragwerksplanung durchgeführt wurde. 47 Beteiligte Teilnehmer Beatriz Aybar Romero, Eugen Böhmer, Neus García, Gundula Frauer, Ina Haase, René Heda, Marcus Kistner, Hartmut Kutschale, Georg Lindenkreuz, Jörg Möser, Florian Schneider, Ulrike Schinkel, Jan Schrader, Christian Schulz, Benjamin Sonntag, Tanja Stock, Eva Trebin Baupraktikum Ronald Dienel, Daniel Eckert, Daniel Fritz, Carina Fürstenau, Susanne Häbold, Maximilian Hansen, Lissy Hegewald, Mandy Hermann, Max Kreisch, Albrecht Linke, Conrad Lohmann, Marie Löwenherz, Nico Mieth, Alexander Peinelt, Jenny Poldrack, Sven Seidel, Tilmann Steger, Kristin Tröger, Stefanie Uhlig, Doreen Ulbricht, Thomas Werner, Thomas Weise, Michael Wicke Statik und numerische Modellierung am Lehrstuhl Tragwerksplanung TU Dresden: Prof. Wolfram Jäger, Mahmoud Nejati, Torsten Pflücke, Jens Hofmann, Lukasz Drobiec. Die Modellvermessung wurde teilweise am Institut für Produktionstechik, TU Dresden, durchgeführt. Ein besonderer Dank gebührt Maurermeister Hans-Albrecht Gasch für die von ihm gegebene Einweisung in die Kunst des Mauerns. Karl Robert Weißbach wurde am 8. April 1841 in Dresden geboren und starb ebenda am 8. Juli 1905. Nach dem Besuch der Realschule absolvierte er eine Lehre im Bauhandwerk und besuchte parallel dazu die Baugewerkschule. Danach arbeitete er zunächst im Atelier des Dresdener Hofbaumeisters Krüger. Daran schloss sich ein Studium an der Kunstakademie in Dresden bei Prof. Hermann Nicolai an. 1863 erhielt er dort als Auszeichnung ein akademisches Reisestipendium, das er für eine Italienreise nutzte, auf der vor allem die Bauwerke der italienischen Renaissance studierte. Durch seine Mitarbeit an der von Adolf Gnauth und Heinrich von Förster herausgegebenen Publikation „Die Bauwerke der Renaissance in Toskana“ war es ihm möglich, den Italienaufenthalt zu verlängern. Erst 1866 kehrte er nach Dresden zurück und arbeitete als Bauführer (Bauleiter) für seinen Lehrer Hermann Nicolai, so z.B. beim Bau der viel beachteten „Villa Meyer“ in Dresden (1867/68). Schließlich wurde Weißbach 1869 selbst Professor an der Kunstakademie; diese Stellung und das mit ihr verbundene Prestige gab er jedoch auf, als das sächsische Kultusministerium nach einigen Jahren der Akademie einen Lehrplan vorschrieb, mit dem er nicht einverstanden war. 1875 wurde er dann als Lehrer an der Hochbauabteilung des Königlichen Polytechnikums in Dresden tätig, aus dem später die Technische Hochschule Dresden hervorging. Neben seiner vielfältigen Lehrtätigkeit und einigen offiziellen Bauaufgaben arbeitete er nebenbei auch in selbstständiger Berufsausübung, so zwischen 1884 und 1891 in Gemeinschaft mit dem Architekten Barth, einem ehemaligen Schüler. In Weißbachs „privatem“ Atelier arbeiteten zeitweise auch einige später bekannt gewordene Architekten, z.B. Georg Weidenbach (*1853), Rudolf Schilling (*1859) und Kurt Diestel (*1862). Einer seiner Schüler war Oswin Hempel. Das vierflügelige Gebäude gehört zum Komplex der ehem. Mechanischen Abteilung, welche zur Erweiterung der Technischen Hochschule am Beginn des Jahrhunderts von Weißbach, Professor für Architektur, errichtet wurde. Im heutigen Zeuner-Bau war das Hauptgebäude, im Berndt-Bau (Helmholtzstraße 7) die Mechanisch-Technische Versuchsanstalt und im Görges-Bau (Helmholtzstraße 9) das Elektrotechnische Institut untergebracht. Außerdem gehörten zwei Maschinenlaboratorien und ein Elektrizitätswerk zu dem Ensemble. Der Zeuner-Bau ist wie die anderen Gebäude mit Ziegel verkleidet. Sandsteinerne Sockel, Fensterund Türgewände – die im Krieg zerstörten wurden nicht ersetzt – gliedern die Fassade. Die Formen des monumentalen Gebäudes sind leicht historisierend. 1930 wurde ein großer Hörsaal eingebaut und nach 1945 stockte man die Trakte zwischen den vorspringenden Eckrisaliten um ein Geschoss auf. 49 Georg-Schumann-Bau der TU Dresden Münchner Platz 1–3 Architekten: Oskar Kramer, 1902–07, O. Schubert, G. Münter, 1957–61 Das ehemalige Landgericht mit Untersuchungshaftanstalt besaß mit seinem Hauptgebäude und vier Flügeln einen kreuzförmigen Grundriss. Nachdem es 1945 z.T. zerstört worden war, wurde es für die TH umgebaut. Das neuromanische Hauptgebäude am Münchner Platz wirkt burgartig, doch einzelne Elemente erinnern an den Jugendstil. Der Südflügel, heute Hülsse-Bau, wurde vollkommen umgestaltet. Dabei gab man die Zellenstruktur auf, um Hör- und Zeichensäle einzurichten. Das Kernstück der inneren Erschließung bildet die im Kreuzungspunkt der vier Flügel errichtete Haupttreppenanlage, welche durch einen gläsernen Dachaufbau belichtet wird. Die Treppenspindel, eine Stahlbetonkonstruktion, wird von acht Säulen getragen. Im inneren Kreis sind zwei gegeneinander versetzte, aber parallele Wendeltreppen wirkungsvoll von Geschoss zu Geschoss geführt. 50 Beyer-Bau der TU Dresden George-Bähr-Straße 1 Architekt: Martin Dülfer, 1910–13 Der Beyer-Bau ist neben den chemischen Instituten das einzige Gebäude, welches von Dülfers „Hochschulstadt“ zur Ausführung kam. Mit ihrer Klinkerfassade orientierte sich die ehem. Bauingenieur-Abteilung an den älteren Instituten Karl Weißbachs. Ornamentartig vorkragende Ziegel und farbig gefasste Sandsteinund Sichtbetonflächen beleben das Äußere. Die abgewalmten Dächer und leicht gewölbten Flacherker sind dem norddeutschen Landhausbau entnommen. Der östliche Hauptblock umschließt zwei Innenhöfe, während der Flügelbau schmaler ausgebildet ist. Den Observatoriumsturm gliederte Dülfer mit Lisenen und verzichtete auf eine Verblendung. Karl-Wilhelm Ochs, der ihn wiederaufbaute, hob diesen Gegensatz zum Ziegelbau durch Putz und Glas noch stärker hervor. Besonderer Wert wurde auf die Gestaltung der Innenräume gelegt. Sichtbeton und dunkles Holz sowie die von Dülfer entworfenen Lampen schufen eine sachliche Atmosphäre. Martin Dülfer wurde 1859 in Breslau geboren. Er studierte von 1877–79 an der TH Hannover und von 1879–80 an der TH Stuttgart. Nach dem Militärdienst 1880/81 arbeitete Dülfer in dem Berliner Architekturbüro von Heinrich Kayser und Karl von Großheim, später in Breslau im Büro „Brost und Grosser“. 1885/86 vollendete er sein Studium an der TH München bei Friedrich von Thiersch. Seine selbstständige Tätigkeit begann Dülfer 1887 in München, er baute zunächst in der zeit- und regionaltypischen neobarocken Spielart des Historismus. Um 1900 wandte er sich dann dem Jugendstil zu, dessen florales, geometrisches und texturales Repertoire er mit barocken und klassizistischen Stilelementen zu einem individuell geprägten, barockisierenden Jugendstil verband. Es entstanden Fassadenentwürfe, Geschosswohnungsbauten, Geschäftshäuser und Villen für das gehobene Bürgertum. 51 Fritz-Foerster-Bau der TU Dresden Mommsenstraße 6 Architekt: Martin Dülfer, 1917–26 1902 erhielt Dülfer den Ehrentitel „Königlich Bayerischer Professor“. 1906 wurde er als Nachfolger von Karl Weißbach zum „ordentlichen Professor für das Entwerfen von Hochbauten“ an die TH Dresden berufen. Ab 1912 war Dülfer dort „Vorsteher“ der Hochbauabteilung, 1920–21 Rektor und unmittelbar danach zwei Jahre lang Prorektor der Hochschule. Er amtierte von 1908–12 als Vorsitzender des Bundes Deutscher Architekten (BDA). 1913 verlieh ihm die TH Dresden die Ehrendoktorwürde, eine zweite Ehrendoktorwürde erhielt er 1928 von der TH Berlin-Charlottenburg. 1929 wurde Dülfer an der Dresdener Hochschule emeritiert. Danach nahm die Öffentlichkeit erst wieder bei seinem 80. Geburtstag (1939) von ihm Notiz; obwohl er einer Freimaurerloge angehört hatte und dadurch eigentlich im Sinne der nationalsozialistischen Kulturpolitik als „unzuverlässig“ galt, wurde ihm zu diesem Anlass die „Goethemedaille“ verliehen. Martin Dülfer starb Ende 1942, beim Luftangriff auf Dresden 1945 kam seine Witwe Käte Dülfer ums Leben und auch der Nachlass Dülfers wurde dabei vernichtet. Umbau des Fritz-Foerster Baus zum Hauptgebäude der Architektonischen Fakultät (bis 2007) Thomas Will (Hg.): Der Fritz-Foerster-Bau als zukünftiges Domizil der Architekturfakultät der TU Dresden, Dresden 2004, (Auszug) „Errichtet als ein wichtiges Glied in der Kette der von Dresdner Professoren geplanten Hochschulbauten, belegt der Fritz-Foerster-Bau beispielhaft die städtebauliche und architektonische Entwicklung der TH in den 20er Jahren. Die CampusPlanung Dülfers von 1906–10 erfuhr nach dem 1. Weltkrieg mit dem Gebäude der Chemischen Institute eine sehr reduzierte, sparsame Umsetzung, die insbesondere an der heute noch ablesbaren städtebaulichen Achse von der GeorgeBähr-Straße zum Haupteingang des Gebäudes erkennbar ist. Stilistisch und bautypologisch ist der Foersterbau ein Dokument der Auseinandersetzungen in der Hochschularchitektur der Weimarer Republik. Der Foersterbau steht hier als ein Beispiel einer zwischen Reform und Bautradition, zwischen Sachlichkeit und monumentalem künstlerischem Ausdruck vermittelnden Backsteinarchitektur, wie wir sie im niederländischen und deutschen Expressionismus, etwa bei Fritz Höger, finden, und wie Dülfer selbst sie bereits bei seinem Stadttheater in Lübeck (1906– 08) erprobt hatte. Bei den Chemischen Instituten ist aber vor allem – in finanziell bedingter einfacher Form – die Bauweise der auf dem neuen Universitätsgelände bereits von Weißbach errichteten Hochschulgebäude, die sämtlich in Klinkern verkleidet waren.“ Quellen: www.das-neue-dresden.de/fritz-foerster-bau_tudresden.html 52 SLUB Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek Dresden Zellescher Weg 18 Architekt: Ortner&Ortner, 1999–2003 Mit der Zusammenführung der Sächsischen Landes-, Staats- und Universitätsbibliothek entsteht eine Bibliothek von europäischer Bedeutung. Um die große Baumasse in die parkähnliche Anlage des ehemaligen Sportplatzes möglichst ohne Beeinträchtigung der weiteren Freiräume zu integrieren, sind die wesentlichen Funktionen zwischen zwei Riegeln auf die Untergeschosse verteilt. Nur die zwei Natursteinquader mit Cafeteria, Magazin und Verwaltung ragen als klare Kuben aus den Rasenflächen heraus, die von horizontalen Oberlichtern der unterirdischen Erschließungs- und Lesesaalbereiche wie Wasserbecken historischer Schlossanlagen gegliedert wird. Der Eingang liegt unter einer Kolonnade der Stirnseite des westlichen Baukörpers und nutzt den Halbkreis der ehemaligen Laufbahn als vertieften Eingangshof. Das Foyer taucht den Besucher über eine Treppe unter einem Oberlichtsaal in die unterirdische gediegene Welt von Säulenreihen, Galerien und Stegen bis hin in den zentral gelegenen Lesesaal. Dieser dreigeschossige, von oben belichtete Lesesaal ist das Herzstück des Entwurfs, um den herum sich sämtliche Funktionen anordnen. Die Fassaden der zwei oberirdischen Gebäude sind mit Thüringer Travertin verkleidet. Unregelmäßige vertikale Nuten in den Natursteinplatten erinnern an Buchrücken in den Regalen traditioneller Bibliotheken oder Strichcodes als mediale Form der Informationsspeicherung. Gemeinsam mit den schmalen durch Silikon geschlossenen Fugen entsteht ein monolithisches Erscheinungsbild, das für eine konventionell konstruierte vorgehängte Fassade ungewöhnlich ist. Dieser strenge Bau ist eine Huldigung an die Rationalität, die die Architekten aus der vorrangig intellektuellen Beschäftigung mit dem geschriebenen Wort ableiten. Emotionalität und Sinnlichkeit werden dagegen unterdrückt, um die angestrebte Konzentration auf eine dichte Arbeitsatmosphäre zu intensivieren. Sehr schmale Fensterschlitze verhindern zudem eine mögliche Ablenkung durch zuviel Wahrnehmung von Außenwelt, worunter u.a. die Mitarbeiter des hinteren Verwaltungsflügels zu leiden haben. Das Bunkerhafte der Architektur manifestiert sich in den exorbitant hohen Energiekosten, die die künstliche Beleuchtung der weitgehend unterirdischen Leseräume verursachen. Eine gewisse Poesie stellt sich durch das Licht- und Schattenspiel der fein gefrästen Nuten zwischen den „Buchdeckeln“ ein. Doch die inhaltsleere „neutrale“ Textur erreicht durch die endlose Wiederholung des Themas keine wirkliche Lebendigkeit. Der Blick kann nicht verweilen und gleitet an der monolithischen Fassade ab. Die Abstraktion der äußerst strengen Form vermittelt lediglich den Gedanken von Reduktion. Manch einer findet jedoch gerade das ansprechend wie z.B. der Architekturkritiker Wolfgang Kil, der neben den funktionalen Vorzü- gen besonders die „statuarische Ernsthaftigkeit“ preist. Im Vergleich zur neuen Universitäts-Bibliothek in Magdeburg von Auer&Weber vermisst man jedoch, gerade was die Funktionalität angeht, ein geräumiges, einladendes Foyer, welches zur Kommunikation ermuntert. Selbiges ist in Dresden zu niedrig und unkommunikativ geraten. Desgleichen die enge Cafeteria. Diese im Äußeren betont sachlich-funktionale Architektur entbehrt eines wirklich künstlerischen Gegengewichtes, welches der Auseinandersetzung mit dem Wort ein Ziel, eine Richtung, eine ethische Richtschnur mitgeben würde. Jene bloße Anbetung eines wissenschaftlich-technisches Zeitalters ohne eine humanistische Verankerung birgt erneute Gefahr von sich verselbständigendem Forscherdrang. Doch die Leere des Vorplatzes am Eingang ist symptomatisch für einen reinen Zweckbau und letztlich für eine wenig visionsreiche bundesrepublikanische Gegenwart. Vielleicht wäre eine aussagefähige Botschaft gewesen, wie Aufklärung angesichts der Flut von weltweiten Publikationen und medial produzierten bzw. gespeicherten Wissens(müll) im neuen 21. Jahrhundert sinnvoll fortgeführt werden könnte. Ein sich Verstecken hinter der Beliebigkeit positionsloser Stein- (und Glas)kulissen kann aber keine Antwort auf drängende Herausforderungen der gemeinsamen globalen Zukunft sein. Der strenge Bau strahlt einen sehr kühlen Vernunftsrationalismus und die Herrschaft der abstrakten Moderne aus. Kalte Geometrie im Äußeren, im Inneren dagegen erreichen die Architekten mit schönen Materialien, wozu sogar der unverputzte Beton zählt, durchaus eine gewisse Wärme und wohlige sächsische Behaglichkeit. www.detail.de/Archiv/De/HoleArtikel/5275/ Artikel www.slub-dresden.de 54 Militärhistorisches Museum Olbrichtplatz 2 Arsenal: 1874–75 Architekt: Daniel Libeskind (und Hans-Günter Merz), 2003–10 Autor: Andreas Platthaus, FAZ 14. August 2003 (gekürzter Text) Durch die klassizistische Fassade wird schräg ein Keil getrieben, dessen Spitze sich wie ein Schiffsbug links neben dem Eingang auftürmt: 30 m hoch und damit 8 m mehr als die säulenverzierte Triumphbogenfront des Mittelflügels. Aus Stahlbeton wird dieser Keil geformt sein, doch rundum verglast und nachts erleuchtet, so daß die Spitze glühen wird über Dresden. Nach hinten durchschneiden zwei abfallende Flanken des Keils das Gebäude; die rechte durchdringt das Foyer und quert einen der beiden Höfe bis zum rechten Seitenflügel, die andere endet, nachdem sie den Mittelflügel touchiert hat, im linken Hof, und selbst hier noch übertrifft die Höhe des Keils den First des Altbaus. Die Entscheidung für Libeskind erfolgte ohne öffentliche Debatte, die das andere Dresdner Projekt des Architekten, einen Glasquader inmitten der Neustadt, noch verhindert hatte. Libeskind hat daraus gelernt; sein aktueller Entwurf erfüllt genau die Erwartungen des Auftraggebers. Aber Libeskind ist noch mehr gelungen: die Geschichte des Bauwerks selbst durch seine Architektur zum Sprechen zu bringen. Es ist die Geschichte von sächsischen und deutschen Kriegstragödien. Nördlich der Stadtgrenze entstand von 1873 bis 1879 die damals größte Kasernensiedlung Europas, die 1877 nach dem nun regierenden König „Albertstadt“ benannt wurde. Kern des 360 Hektar großen Areals ist das Arsenal, ein gewaltiger dreiflügliger Bau, eingerahmt und dadurch wie ein Solitär ausgestellt von eleganten Magazin- und Verwaltungsgebäuden. Der Bau wurde auf einem Plateau errichtet, das in der direkten Verlängerung der historischen Achse Schloß-Augustusbrücke–Bautzner Platz (heute Albertplatz) liegt. Wie eine Akropolis thront das 1876 vollendete Arsenal hoch über Dresden auf der Neustädter Elbseite, und weil der Bau im neoklassizistischen Tempelstil errichtet wurde, taufte der Volksmund die Anlage „Casernopolis“. Noch heute besticht die monumentale Inszenierung mit der breiten Freitreppe, die vom Olbrichtplatz zum Arsenalgebäude führt. Hat man den grässlichen Flachbau, der 1972 dem Haupteingang vorgebaut wurde, durchschritten, betritt man die ehemalige Geschützhalle im Erdgeschoß, wo 152 mächtige Sandsteinpfeiler kleine Kreuzgewölbe tragen. Der von außen leicht verspielt gestaltete Bau erweist sich im Inneren als klar gegliederte Zweckarchitektur zur Lagerung von Waffen. Kein Wunder, daß man die Bauplanung 1873 der Militärbaudirektion überlassen und namhafte Dresdner Architekten wie Hermann Nicolai und Gustav Rumpel lediglich für Detailarbeiten, vor allem an den Fassaden, verpflichtet hatte. In dem erstaunlichen Säulen- und Kuppelwald des Erdgeschosses haben im 20. Jahrhundert fünf verschiedene politische Systeme ihre jeweilige Sicht auf Militärgeschichte ausgestellt. Denn das Arsenal hatte schon kurz nach Fertigstellung seine militärische Funktion verloren. 1897 eröffnete im jetzt leeren Bau die „Historische Waffen- und Modellsammlung“, die während der Weimarer Republik zum „Sächsischen Armeemuseum“ umgestaltet wurde. Dessen Waffensammlungen erfreuten das Herz der Nazis, die das Gebäude 1940 zum „Heeresmuseum“ aufwerteten. Die sowjetischen Sieger ließen 1945 unmittelbar neben der Zufahrt zum Arsenal ein erstaunlich zurückhaltendes Denkmal für ihre Gefallenen setzen und gemeindeten den bis dahin autonomen Gutsbezirk Albertstadt nach Dresden ein. Die militärische Tradition des Ortes aber blieb gewahrt: erst durch die erneute Nutzung als Kaserne und dann von 1972 an durch die Wiedereröffnung des seit 1943 geschlossenen Heeresmuseums unter dem Namen „Armeemuseum der DDR“. Mit seinem Neubau des Imperial War Museum in Manchester hat der polnische Architekt bewiesen, daß er dem heiklen Thema Kriegsgeschichte gewachsen ist. Seitdem weiß man, daß die Aufschreie wegen der angeblichen Zerstörung des denkmalgeschützten Arsenals durch den Umbau voreilig waren. Denn der gigantische Keil, den sich die Bundeswehr 35 Millionen Euro kosten lässt, kommt ohne tragende Teile im Inneren des alten Gebäudes aus, obwohl er sich durch das gesamte Museum zieht. Er ist in bester Tradition des Hauses Fassadenarchitektur, denn hinter seinen Glaswänden bleibt nicht nur die Front des Arsenals erhalten, sondern der Libeskind-Umbau orientiert sich auch an den alten Etagenhöhen, so daß bis auf wenige Ausnahmen auch die Geschoßdecken vollständig bewahrt werden können – und damit auch der faszinierende Pfeilersaal des Parterres. Der Glaskeil im Museum symbolisiert keinen Triumph, sondern die Öffnung der demokratischen Armee nach außen und deren Transparenz nach innen – wenn auch auf den Computersimulationen von Hans-Günther Merz, der als Partner Libeskinds für die museale Konzeption des Entwurfs zuständig ist, die Wände des Keils im Inneren blutrot gestaltet sind. Besonders spektakulär sollen die „Vertikalen Ausstellungen“ wirken: Durchbrüche von bis zu vier Stockwerken im Keil, in denen Raketen und ähnliches präsentiert werden. Im neuen Teil des Museums wird ein so genannter Themenparcours gestaltet, der in acht bis zehn kleineren Abteilungen Militär als Kulturgeschichte darstellen soll. Quellen: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.08.2003 www.daniel-libeskind.com Photo Credits: ©SDL: Images 1–9 ©Lubic & Woehrlin Architekten „Beyond the Arsenal“ hat Libeskind sein Konzept getauft, und damit ist nicht nur die den Altbau in jeder Hinsicht überragende neue Architektur gemeint, sondern auch die Fortführung des Konzepts vom Arsenal als Lagerstätte von Heeresgut. Eine Million Stücke wird die Sammlung umfassen, statt bisher 5.000 m2 Ausstellungsfläche werden nach Abschluss des Umbaus im Jahr 2008 12.000 bereitstehen. Und es wird eine neue Touristenattraktion geben, die im „Café Dresdenblick“ in der Spitze des Keils ihren buchstäblichen Höhepunkt finden soll. Man möge, so Libeskind, seinen Entwurf als Verweis auf den Einschnitt verstehen, den die deutsche Militärgeschichte für Europa bedeutet habe, und auf die Zerstörung Dresdens. Tatsächlich zielt der Keil wie ein Pfeil auf die zerbombte Innenstadt, doch die direkte Linie zur Frauenkirche hat Libeskind pietätvoll vermieden. Den Blitze schleudernden Zeus will er nicht geben; nur Blicke sollen von seinem Keil aus über die Elbe in die Altstadt geworfen werden. Eine solch virtuose Kombination von alter und neuer Architektur kommt nicht zweimal. Die Stadt bekommt damit rechtzeitig zum Abschluss des Frauenkirchenwiederaufbaus ein neues Prestigeprojekt. Credits: Design Team Leader : Jochen Klein Design Team: Peter Haubert, Guillaume Chapallaz, Marcel Nette, Ka Wing Lo, Helko Rettschlag, Ina Hesselmann Joint Venture Partner: Architekt Daniel Libeskind AG Cost and Site Supervision: Lubic & Woehrlin Architekten, Berlin Structural Engineer: GSE Ingenieur-Gesellschaft mbh Mechanical/Electrical: Ipro Industrieprojektierung Civil Engineer: Arnold Consult Auditing Statics: Ing. Consult Cornelius-Schwarz-Zeitler GmbH Landscape Architect: Dipl.-Ing. Volker von Gagern Fire Protection Consultant: Ingenieurbuero Heilmann, Pirna Lighting Designer: Delux AG Exhibition Design: Prof. HG Merz, Stuttgart with Holzer Kobler Architekturen (Switzerland) Demolition: Bertram für Bau und Gewerbe Foundation, Steel Beams: Firma Bauer Spezialtiefbau Raw Construction: Hentschke Bau Steel Construction, Wedge: Gerhard Schilling Stahlbau und Montage Steel Construction, Floor Plates: Stahlbau Verbundtrager Facade: Josef Gartner GmbH, Gundelfingen 58 HELLERAU Gartenstadt Von Marion Nagel, Dresden (gekürzter Text) Fünf, sechs Kilometer vom Zentrum Dresdens entfernt liegt Hellerau. Ein großes Stück Wald, die Dresdner Heide, trennt die Neustadt mit ihren Grunderzeithäusern von Hellerau, rund 6000 Leute leben hier. Der Rundgang durch die Gartenstadt Helleraus beginnt dort, wo auch schon vor 100 Jahren das „Herz“ der Siedlung schlug, bei den Deutschen Werkstätten. Das ehemalige Fabrikgebäude erinnert mit seiner Form an eine Schraubzwinge und entstand ab 1909 innerhalb nur eines Jahres nach Entwürfen des Industriellen Karl Camillo Schmidt und des Architekten Richard Riemerschmid. Hier wurden anfangs Möbel, Wandverkleidungen und Hauseinrichtungen und später eine frühe Art der „Fertigteil-Holzhäuser“ in Serie gebaut. „Die Arbeitsbedingungen zu dieser Zeit waren hier geradezu revolutionär“, erzählt Clemens Galonska. Er ist selbst Architekt, lebt in Hellerau und führt interessierte Besucher regelmäßig durch die Siedlung. Das ehemalige dreigeschossige Fabrikgebäude ist eher schmal und erinnert an ein ländliches Gut. Innen verbreiten die großen Fenster eine wunderbare Tageslichtatmosphäre – ideal für die damalige Zeit. Jeder Arbeiter hatte eine eigene Werkbank, die Späne und Abfälle wurden gesammelt und unter dem Hof durch Kanäle zum „Spänebunker“ abtransportiert und später verbrannt. Mit der gewonnenen Energie wurde Wasser erhitzt und teilweise der Strom für Hellerau gewonnen. Das Maschinenhaus in dem vormals die großen Turbinen für die Stromerzeugung standen, ist heute ein zentraler Punkt für Veranstaltungen der Bewohner von Hellerau. Karl Camillo Schmidt war gelernter Tischler und grundete 1899 seine „Dresdner Werkstätten für Handwerkskunst“. Der im erzgebirgischen Zschopau Geborene hatte schon früh erkannt, daß die miserablen Lebensbedingungen der Arbeiter im ausgehenden 19. Jahrhundert in Mietskasernen und dunklen Hinterhöfen einen direkten Einfluss auf die Produktivität haben. In ihm reifte die Idee, die Wohn- und Lebensbedingungen seiner Arbeiter nach dem Vorbild der sogenannten „Lebensreformer“ zu verbessern und eine Siedlung ganz nach dem Modell der englischen „Garten- Fußend auf dem Gartenstadtgedanken von Ebenizer Howard, gründete der Unternehmer Karl Camillo Schmidt 1909 unweit von Dresden die Gartenstadtsiedlung Hellerau zusammen mit seinem Neubau seiner „Dresdner Werkstätten für Handwerkskunst“. Die Einheit von Wohnen und Arbeit, Kultur und Bildung, in einem von der Lebensreform geprägten Organismus, ist der gebaute Anspruch der Gartenstadt Hellerau. Als schon bedeutender Vertreter der Reformbewegung im Möbel-, Innenausbau und in der Handwerkskunst, sah Karl Camillo Schmidt in der Realisierung Helleraus eine Gelegenheit, Boden-, Wohnungs- und Sozialreformbestrebungen in einem Gesamtwerk umsetzen zu können. Der von Karl Camillo Schmidt beauftragte Architekt Richard Riemerschmid plante den Bau der Werkstätten und dazu eine Wohnsiedlung, mit Kleinstwohnhäusern für die Arbeiter, geräumigen Landhäusern, Markt, Geschäften, Wasch- und Badehaus, Praxen, Ledigenwohnheim, Schule und Schülerwohnheim. Heinrich Tessenow, Hermann Muthesius und Curt Frick gehören mit zu den renommierten Architekten, die in Hellerau ganze Straßenzüge beplanten. Reformbegeisterte aus ganz Europa kamen, um Zeuge der real praktizierten Lebensreform zu werden. Der Tod Wolf Dohrns und der Ausbruch des 1. Weltkrieges beendete die Sturm- und Drangzeit Helleraus. Mit einzelnen reformpädagogischen Konzepten und kulturellen Projekten konnte Hellerau in den Folgejahren kurzfristig noch an die anfänglichen Glanzzeiten anknüpfen. Ende der dreißiger Jahre wurde die Bildungsanstalt für Rhythmische Gymnastik von den Nationalsozialisten in einen Kasernenhof umgebaut, und nach 1945 von den russischen Besatzungsmächten weiter militärisch genutzt. Mit zeitgenössischen Darbietungen und jungen kulturschaffenden Institutionen vor Ort entwickelt sich das Festspielhaus heute zunehmend zu einem der wichtigen Veranstaltungsorte in Dresden. Die Deutschen Werkstätten knüpften in benachbarten neuen Werkhallen längst an ihre alte handwerkliche Traditionen an und sind international erfolgreich im hochwertigen Innenausbau tätig. Die historischen Räumlichkeiten der Werkstätten sind ein Pool für Ingenieur- und Dienstleistungsunternehmen geworden, die sich der Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit verschrieben haben. Ganz Hellerau ist heute ein Flächendenkmal, nicht ausschließend, daß auch Modernes entsteht; ist es doch gerade die Tradition von Hellerau, Neues und Zukunftsweisendes hervorzubringen. www.dresden-hellerau.de/src/hellerau.html www.hellerau.de/helleraubilder.htm stadt“ zu bauen. Der Grundgedanke dieses Modells ist es, die Vorteile des städtischen Wohnens mit den Vorzugen des Lebens auf dem Land zu verbinden. Schmidt beauftrage den Maler, Kunsthandwerker und Architekten Richard Riemerschmid, eine Siedlung, Werkstätten, sowie Gärten und Straßen zu entwerfen. 1909 erfolgte der erste Spatenstich für die Deutschen Werkstätten Hellerau, kurz danach standen die ersten Häuser. In der Straße „Am Grünen Zipfel“ erkennt man das Gartenstadtprinzip auf den ersten Blick. „Für mich ist das die schönste Straße in Hellerau“, meint Clemens Galonska. Sechs bis acht Häuschen stehen in einer Reihe auf jeder Seite der Straße, jede Familie hat einen eigenen Eingang und eine kleinen Vorgarten. „Gemessen an unseren heutigen Verhältnissen sind die Häusern, in denen die Arbeiter der Werkstätten mit bis zu zehn Personen wohnten eher klein“, so Galonska. Doch sie waren hell und trocken, der Weg zur Arbeit kurz und der kleine Gemüsegarten hinter dem Haus diente der Versorgung. Die Häuser waren einfach und funktional gebaut. Fertigteile, wie zum Beispiel die Fensterbänke, wurden in Serie produziert und sind bei allen Häusern der Straße gleich. So waren sie finanzierbar und die Miete für die Arbeiter erschwinglich. Schmidt, der Gründer von Hellerau, lebte wie seine Arbeiter in einem Haus in der Siedlung. Auch wenn es etwas größer ausfiel – das Grundmodell war das gleiche. Die kurzen Wege sind erhalten geblieben, hinter jedem Haus führt ein Netz von autofreien, grünen Gartenwegen durch die Siedlung. Nachbarschaftliche Kommunikation funktioniert bis heute über die niedrigen Gartenzäune hinweg. „Für die Studenten des Masterstudiengang Denkmalpflege und Stadtentwicklung der TU Dresden, ist Hellerau die beste Möglichkeit praxisnah viele Aspekte zu üben“, sagt Susanne Jaeger. Sie vertritt die Professur „Denkmalpflege und Bauforschung“ an der Universität. Bei Gesprächen mit den Bewohnern haben die Studenten herausgefunden, was die Qualitäten der Gartenstadt sind und wie sehr sich die Hellerauer mit ihrer Siedlung identifizieren. Die Ergebnisse wurden auf dem Kongress vorgestellt. Die aus Australien, Großbritannien, Deutschland und den Niederlanden angereisten Kongressteilnehmer rücken Themen wie Gemeinschaft, Identität, Überschaubarkeit und Nähe zum Arbeitsplatz kurz – eine großstadtkritische Haltung – in den Mittelpunkt. Die Stadtplaner von heute lernen aus den Erfahrungen, die man mit großstadtkritischen Formen – und nichts anderes ist Hellerau – gemacht hat. Quelle: www.stern.de/wissenschaft/mensch/:DresdenHellerau-Lebendige-Kritik-Großstadt 60 HELLERAU Festspielhaus Karl-Liebknecht-Straße 65 Architekt: Heinrich Tessenow, 1910–1912 Sanierung: Meier-Scupin & Petzet, 2002–2010 Das Festspielhaus Hellerau und die Anfänge des experimentellen Theaters von Cynthia Schwab (gekürzter Text) In neuem Glanz Sanierung Festspielhaus Hellerau in Dresden Hellerau – kaum ein Name ist so eng mit der deutschen Lebensreformbewegung am Beginn des 20. Jahrhunderts verbunden wie dieser. Hier entstand 1910 die Möbelfabrik „Deutsche Werkstätten“, hier wurde ab 1909 eine wegweisende Gartenstadt errichtet, und hier konnte 1912 das von Heinrich Tessenow entworfene Festspielhaus eingeweiht werden, in dem der Tanzpädagoge Emil-Jaques Dalcroze die „Schule für Rhythmus, Musik und Körperbildung Hellerau“ betrieb. Erfreulicherweise ist die Vitalität Helleraus auch heute noch ungebrochen. Die „Deutschen Werkstätten“ haben gerade ein neues Produktionsgebäude eingeweiht, die Gartenstadt präsentiert sich in frisch saniertem Glanz, und Anfang September (2006) ist auch das Festspielhaus seiner Wiederbelebung ein großes Stück näher gekommen. Denn an diesem Tag wurde hier das „Europäische Zentrum der Künste“ eingeweiht, das ein umfangreiches Programm von Ballettaufführungen, Konzerten und Theaterveranstaltungen anbieten will. Vorausgegangen war der Wiederbelebung eine wechselhafte Geschichte. Die zivile Nutzung des Festspielhauses währte nur bis 1935. Anschließend ergriffen nacheinander die Polizei, die SA, die SS, die Wehrmacht und schließlich die sowjetische Armee von dem Gebäude Besitz. Nach dem Abzug der Militärs 1992 war das Festspielhaus eine Ruine mit Putzschäden, löchrigen Dächern, maroden Decken, verrotteten Wasser- und Elektroleitungen. Umso mutiger war Wer das Festspielgelände in Hellerau betritt, und sei es zum ersten Mal, gerät unwillkürlich in den Sog dieser großartigen Anlage, deren spannungsreiche Mischung aus Verfall, Überformung und ungebrochener Repräsentanz den Atem der Geschichte spüren lässt. Ein ungewöhnlicher, versteckt gelegener Ort, scheinbar ohne Anbindung, in dessen einsamer Monumentalität jene kulturellen Visionen aufscheinen, die hier zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihre bauliche und praktische Umsetzung erfuhren. Das Festspielhaus und seine vorgelagerten Pensionshäuser, die nicht mehr komplett in ihrer ursprünglichen Formation erhalten sind, haben am Vorabend des 1. Weltkrieges wie ein Magnet Menschen aus ganz Europa angezogen. Dies geschah jedoch keineswegs in klösterlicher Abgeschiedenheit. Die damals weithin bekannte Erprobungsstätte einer künstlerischen und intellektuellen Avantgarde sowie sozialer Reformversuche ist untrennbar verbunden mit der Entstehung der ersten Gartenstadt Deutschlands, der Gartenstadt Hellerau, in deren Folge Architektur, Kunsthandwerk und Kunstgewerbe, Rhythmik, Musik und Bühnenästhetik zu einer höchst eigenwilligen Symbiose fanden. Etwa zur gleichen Zeit führte in Genf das Unbehagen an der Musik-Kultur Adolphe Appia und Emile Jaques-Dalcroze zusammen. In seinen Bühnenbildskizzen zu Richard Wagners Musikdramen entwickelte Appia die stilisierte, begehbare dreidimensionale Raumbühne mit moderner Lichtregie: eine Absage an die zweidimensionale Kulissenbühne, starre Raumstrukturen, überladene Prospekte und Naturalismen, die Tiefenwirkung und Stimmungen nur vorzutäuschen vermochten. Unter dem Einfluss von Jaques-Dalcroze entstanden 1909/1910 seine berühmten „Espaces rhythmiques“. Vor allem Wolf Dohrn war davon so beeindruckt, daß er Jaques-Dalcroze in Dresden im Oktober 1909 spontan anbot, seine Visionen in Hellerau zu verwirklichen. Von Anfang an war ja in Ergänzung des handwerklich-künstlerisch weit gespannten Programms der Werkstätten sowie der städtebaulichen Gesamtanlage ein Musik-Projekt vorgesehen, um dem Gemeinschaftsleben Identität stiftende, festliche Glanzpunkte zu geben. Jaques-Dalcroze entschied sich für Hellerau, denn dort bot sich ihm die einzigartige Chance, in einem eigenen Institutsgebäude den so sehnlich gewünschten Saal nach den Gestaltungsprinzipien der „Espaces rhythmiques“ zu realisieren. Das Festspielhaus sollte ein weiterer Baustein im Gesamtgefüge der Gartenstadt werden. Doch schließlich gelangte Tessenows 3. Entwurf nach langen Auseinandersetzungen zwischen Dohrn, Schmidt und Riemerschmid als Solitär, räumlich abgegrenzt von der ländlich-dörflich geprägten Architektur zur Ausführung. Der ornamentlose, streng durchkomponierte Bau samt den vorgelagerten Pensionshäusern, der bald internationale Beachtung fand, übersetzte Dalcrozes und Appias Vorstellungen in die Sprache der Architektur. Schul- und Übungsräume, nach Geschlechtern getrennte Bäder und lichtdurchflutete Wandelhallen, Foyer, Direktion und Bibliothek umschlossen von drei Seiten den großen Saal. Der lang gestreckte Raum mit versenkbarem Orchestergraben enthielt keine festen Installationen, weder Bühne noch Vorhang; frei bewegliche Bühnenelemente und Zuschauersitzreihen konnten je nach Erfordernis gruppiert werden. Decke und Wände waren mit weißen gewachsten Tuchbahnen ausgekleidet. Dahinter erzeugten Tausende von Glühbirnen ein diffuses, immaterielles Licht und gaben dem von jeglichem Naturalismus befreiten Raum Transparenz und Transzendenz. Das Beleuchtungssystem des georgischen Theatermalers Alexander von Salzmann, der auch das Emblem des Yin und Yang an den beiden Giebelseiten entwarf, ließ von völliger Dunkelheit bis strahlender Helligkeit stufenlos und abschnittsweise regulierbare Lichtstimmungen zu. 1912 gaben die Festspiele zum Abschluss des Studienjahres Gelegenheit zur ersten szenischen Erprobung. Innerhalb dieser 14 Tage konnten die Festivalbesucher nicht nur öffentliche Vorführungen der rhythmischen Gymnastik erleben, sondern auch den 2. Akt von Glucks Oper „Orpheus und Eurydike“. Im Festspielhaus waren kunstgewerbliche Arbeiten der Hellerauer Werkstätten zu sehen, Sommerkurse für Rhythmik-Absolventen schlossen sich an. Die Festspiele 1913 brachten schließlich den großen internationalen Erfolg. Schon in den Jahren zuvor waren auf der Suche nach neuen Impulsen zahlreiche Besucher nach Hellerau gekommen, so z.B. die Architekten Le Corbusier, Walter Gropius und Mies van der Rohe. In ihrem und im Gefolge der internationalen Schülerschaft entstand in der Gartenstadt eine Künstlerkolonie, aus der man zu ganz neuen Ufern aufbrechen konnte. 1913 wurden die Festspiele zum Treffpunkt der kulturellen Elite Europas: Hier begegneten sich Upton Sinclair und G.B. Shaw, Stefan Zweig und Martin Buber, Franz Werfel und Rainer Maria Rilke, es kamen u.a. Serge Rachmaninoff, Konstantin Stanislawski, Max Reinhardt, Gerhart Hauptmann und Oskar Kokoschka, Henry van de Velde, Else Lasker-Schüler, Ernst Rowohlt, die Pavlova und Rudolf von Laban. Wolf Dohrn starb 1914 bei einem Skiunfall in den Alpen. Jaques-Dalcroze kehrte nach Ausbruch des 1. Weltkrieges von Genf nicht mehr zurück. Das Festspielhaus mit seiner internationalen Ausstrahlung wurde zum ersten Mal Opfer der geschichtlichen Ereignisse. Bis die Nationalsozialisten Mitte der 30er Jahre das Antlitz der Gesamtanlage durch Ein- und Umbauten, Teilabriss und Neubau der Pensionshäuser zerstörten und das Gelände als Polizeischule missbrauchten, gab es zwar zahlreiche Versuche, die musikalisch-rhythmische Ausbildung fortzuführen und den experimentellen Charakter fortzuschreiben, aber Nimbus und Anziehungskraft einer aufregend neuen Bühnenkunst im Verein mit ihren künstlerischen und sozialen Implikationen waren verloren. Als nach dem 2. Weltkrieg die russische Armee in das Festspielhaus einzog und das Emblem des Yin und Yang durch den roten Stern ersetzte, war der „Mythos Hellerau“ fast nur noch im Gedächtnis all jener aufgehoben, die dorthin einstmals aufgebrochen waren, um am Entstehen einer neuen, besseren Gemeinschaft mitzuwirken. Trotz – oder wegen – seiner immensen Beschädigung hatte der Ort doch so viel Magie bewahrt, daß Ende der 80er Jahre Theaterleute, Choreografen und Kunstwissenschaftler aus Dresden und Ostberlin seine Wiederbelebung ins Auge fassten. Neben das Bild von der „verkeimten Russenkaserne“ stellten sie ihre Vision eines vitalen „Kunstlabors“, verbunden mit der vagen Hoffnung auf einen schrittweisen Abzug sowjetischer Truppen aus der DDR. Unterstützung erhielten sie nach der Wende von Gleichgesinnten aus der Schweiz, Frankreich, Italien und den alten Bundesländern. Schließlich wurde 1990 der „Förderverein für die Europäische Werkstatt für Kunst und Kultur“ aus der Taufe gehoben. 1992 konnte nach dem Abzug der GUS-Truppen die feierliche Aneignung des Geländes mit einem Fest und einer vom Bundesvermögensamt ausgestellten, befristeten Betretungsgenehmigung beginnen. Der Faden, den Dohrn, Jaques-Dalcroze, Appia und Tessenow am Anfang des Jahrhunderts gesponnen hatten, wurde an dessen Ende wieder aufgenommen. die Arbeit des 1990 gegründeten „Fördervereins für die Europäische Werkstatt für Kunst und Kultur Hellerau“, der sich umgehend um die Revitalisierung des Gebäudes kümmerte. Bereits 1992 fanden hier Kulturveranstaltungen statt, und 1994 konnte mit ersten Sanierungsarbeiten begonnen werden. Zunächst wurde das marode Dach durch ein Notdach gesichert, später erfolgten Schwammsanierungen, der Bau eines neuen Dachs, die Erneuerung der Heizungsanlage und der Innenräume. Für die weiteren Bauarbeiten wurde 2000 ein Realisierungswettbewerb veranstaltet, den das Münchner Büro Meier-Scupin& Petzet für sich entscheiden konnte. Nun, nach zwölfjährigen und 17 Millionen Euro teuren Sanierungsarbeiten, kann ein positives Fazit gezogen werden. Das Festspielhaus ist keine glatt sanierte Ikone, sondern ein Geschichtsdokument, das auch die Brüche seiner Nutzungsgeschichte offenbart. Der Besucher findet hier originale Wandbilder der sowjetischen Armee, Nebenräume, in denen noch immer die bröckelnde Atmosphäre der Verfallsphase regiert, und den großen Saal, der vor allem durch seine minimalistische Ästhetik besticht. Hier sorgen helle Holzfußböden, weiß getünchte Wände und hohe Fenster für einen neutralen Rahmen, der die unterschiedlichsten Veranstaltungen möglich macht. Bis zum endgültigen Abschluss der Bauarbeiten ist allerdings noch etwas Geduld gefragt. Denn die noch ausstehende Außensanierung wird erst 2010 beendet sein. Quelle: Matthias Grunzig, Baumeister 10/2006 Quelle: www.kunstforumhellerau.de/1/kurztext.php?lan g=2&area=1 62 HELLERAU Deutsche Werkstätten Schmidt´s Schmidt´s Das Schmidt's liegt im Gebäude-Ensemble Deutsche Werkstätten Hellerau, welches in Form einer großen Schraubzwinge erbaut wurde. Der wunderschöne Innenhof mit seinen drei riesigen Kastanienbäumen bietet einen perfekten Blick aus den großen Fenstern des Restaurants. Hier ist das Schmidt’s heimisch geworden. Neben den gleichnamigen weltberühmten Werkstätten für hochwertigen Innenausbau haben sich die Deutschen Dependancen internationaler Firmen niedergelassen. Neben Partnern von AMD und Infineon findet man auf dem Gelände insbesondere Unternehmen der Biotechnologie, innovativen Energiegewinnung, sowie Designer und Künstler. Außerdem verfügt das Gelände über mehrere Tagungsräume mit einer Kapazität bis zu ca. 100 Personen. Die Räume tragen die Namen berühmter Hellerauer, wie beispielsweise Riemerschmid oder Dalcroze. Im vergangenen Jahr kamen zudem eine Reihe interessanter neuer Gebäude in Holzbauweise hinzu. Deutsche Werkstätten Was war Hellerau? Zunächst ein Stück unberührter Heidelandschaft. Doch der Dresdner Möbelfabrikant Karl Schmidt erkannte in dem 6–7 km nördlich der Stadt Dresden gelegenen, weitläufigen Gelände auf Anhieb den geeigneten Ort zur Ansiedlung seiner expandierenden „Dresdner Werkstätten für Handwerkskunst“. Grund und Boden waren billig und boten Platz für ein groß angelegtes Projekt: die Gründung einer Gartenstadt nach englischem Vorbild. Schmidt, ein Mann mit äußerst moderner Unternehmensphilosophie, war ganz den zeitgenössischen lebensreformerischen Ideen verbunden. Sein erfolgreiches Möbelprogramm verband funktionale und ästhetische Ansprüche mit zeitgerechter maschineller Produktion. Entwürfe internationaler Künstler und der sensible, fach- und materialgerechte Umgang mit dem Werkstoff Holz sicherten den seriell gefertigten Werkstücken ihre hohe Qualität; das praktisch konzipierte Mobiliar war zerleg- und transportierbar sowie im Preis erschwinglich. Entsprach schon all dies einer kleinen Revolution, was den Geschmack gängiger Wohnungseinrichtungen betraf, so war die Gründung der Gartenstadt als städtebaulich, sozio-kulturell und ökonomisch durchkomponierter Gegenentwurf zu den menschenunwürdigen Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Stadt gedacht. Wohnen, Leben und Arbeiten in der Natur, in unmittelbarer Nähe seiner Produktionsstätten, Ausschluss jeglicher Bodenspekulation – das war Schmidts Devise. Die sozial durchmischte, infrastrukturell komplett ausgestattete Siedlung sollte vor allem seinen Arbeitern und Angestellten eine neue Heimat bieten und sich eng an deren Bedürfnissen orientieren. Die Ausarbeitung lag seit 1906 in den bewährten Händen des Architekten Richard Riemerschmid, als Entwerfer der Maschinenmöbel Marke „Dresdner Hausgerät“ den Werkstätten schon lange verbunden. Und mit dem universal gebildeten, weltgewandten, hochbegabten und kulturell ambitionierten Energiebündel Wolf Dohrn, einem „Menschenfischer neuer Ideen“, stand dem liebevoll „Holz-Goethe“ genannten Karl Schmidt ein weiterer Mann zur Seite, der sich dem Projekt ebenfalls mit Leib und Seele verschrieb. Der promovierte Philosoph und Volkswirtschaftler, Schmidts rechte Hand in dessen Unternehmen, sollte schon bald als dritter Mann im Bunde auch die Gründung des Deutschen Werkbundes vorantreiben und neben Riemerschmid als Mitgesellschafter der gemeinnützigen „Gartenstadtgesellschaft Hellerau GmbH“ das Projekt entscheidend prägen, indem er ihm eine weitere Dimension hinzufügte: die eines alternativen Lebensentwurfes schlechthin. Überlegungen zu Bildung, Erziehung und kultureller Betätigung existierten bereits, kamen jedoch erst später zur Sprache. 63 HELLERAU Richard Riemerschmid Richard Riemerschmid (1868–1957) 20. Juni 1868 in München geboren 1886–87 Militärdienst 1887–90 Studium an der Akademie der bildenden Künste ab 1890 freier Kunstmaler in München 1898 Mitbegründer der Vereinigten Werkstätten für Kunst im Handwerk in München 1902 Mitbegründer der Deutschen Gartenstadtgesellschaft 1907 Mitbegründer des Deutschen Werkbundes 1907–13 Leitung der Gesamtplanung der Gartenstadt in Hellerau Ab 1913 Direktor der Kunstgewerbeschule in München 1926–31 Leiter der Kölner Werkschulen 13. April 1957 in München gestorben Gilt Riemerschmids Interesse als Maler dem Spätimpressionismus und dem Pointilismus, so ist er als Innenausstatter, Möbelentwerfer und Architekt einer der wichtigsten Vertreter des deutschen Jugendstils. Zu den bekanntesten Werken aus dieser Zeit gehören der Musiksalon auf der deutschen Kunstausstellung in Dresden 1899, das Schauspielhaus in München 1900/01 und die Räume auf der Ausstellung der Dresdener Werkstätten 1903. Als sozial eingestellter Reformer interessiert er sich zunehmend für Fragen der maschinellen Produktion und der Herstellung von preisgünstigen Produkten, was ihn nach der Kunstgewerbe-Ausstellung in Dresden von 1906 auch dazu bewegt, den Deutschen Werkbund mitzubegründen, dessen Vorsitzender er von 1921–26 sein wird. Ebenfalls 1907 übernimmt er die Gesamtplanung der ersten deutschen Gartenstadt Hellerau bei Dresden, bei der auch Hermann Muthesius und Heinrich Tessenow mitwirken und die Vorbild für zahlreiche ähnliche Projekte in Deutschland wird. Ab 1909 ist er zudem am Bau der Gartenstadt Nürnberg beteiligt. Weitere Bauten wie die Luftfahrthalle in München (1925), das Funkhaus Deutsche Stunde in Bayern (1927) und der Pavillon für den Verlag Reckendorf auf der Pressa-Ausstellung (1928) entstehen. Mit seinen Möbeln und Inneneinrichtungen aus der Jugendstilzeit ebenso wie mit seinen Gartenstadtprojekten hat Riemerschmid die Gestaltung der deutschen Wohn- und Lebenswelt in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts entscheidend mitgeprägt und auf einer Erneuerung in den Bereichen Architektur, Design und Innenausstattung hingewirkt. Richard Riemerschmid, Gestalter des floralen Jugendstils, versuchte diese Grundgedanken Schmidts mit seinen eigenen Idealen zu kombinieren. Ein Organismus aus Ästhetik und Zweckmäßigkeit basierend auf Qualitätsanspruch und Stilbewusstsein. http://riemerschmid.5eins.de/riemerschmid_im _werkbund/gartenstadt-hellerau Foto: www.richard-riemerschmid.com/d/ index.shtml 64 HELLERAU Heinrich Tessenow Heinrich Tessenow (1876–1950) 7. April 1876 als Sohn eines Zimmermanns geboren 1909 Assistentenstelle an der TH Dresden Lehrer in der Baugewerkschule in Lüchow Lehrer an der Kunstgewerbeschule Trier Assistent von Martin Dülfer an der TH Dresden 1913 Professor an die Kunstgewerbeschule in Wien 1920 Leitung der Architekturabteilung der Akademie der Künste in Dresden 1926 Professor an der Technischen Hochschule Berlin 1925–27 Entwurf eines neuen Schulgebäudes in Klotzsche 1941 Verordnete Emeritierung, Rückzug nach Mecklenburg bis Kriegsende 1947 Professor an der Technischen Hochschule Berlin 30. November 1950 in Berlin gestorben Heinrich Tessenow gehörte in den lebhaften geistigen Auseinandersetzungen der ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts zu den führenden und interessantesten Architekten in Deutschland. Sein Wirken ist in die von England ausgehende, als geistige Besinnung und Erneuerung empfundene europäische Bewegung einzuordnen. Es war ein Besinnen auf Werte, die in der Verwirrung des Historismus und in der hektischen Suche nach „Stilen“ verloren gegangen waren. Mit seiner Vorstellung von neuen menschlichen Lebensformen wandte er sich in seinen Schriften, in seinen Planungen und mit seinen Bauten dem Wohnungsbau, insbesondere dem Kleinwohnungsbau, zu. Durch seine Schriften „Wohnungsbau“ (1909), „Hausbau und dergleichen“ (1916) und „Handwerk und Kleinstadt“ (1919) wurde er bekannt und erhielt Zugang zu bedeutenden Projekten. In Hellerau übertrug man ihm auch den Bau der Bildungsanstalt für rhythmische Gymnastik (Dalcroze-Institut), in dem neue pädagogische Ideen und revolutionäre Formen der Darstellenden Kunst ihren eigenen baulichen Ausdruck fanden. Das heutige Festspielhaus wird als ein Zeugnis einer neuen Architektur angesehen. Seine Wohnhäuser sind gekennzeichnet durch eine provozierende Einfachheit. 65 HELLERAU Hermann Muthesius Hermann Muthesius (1861–1927) 1861 in Großneuhausen/Thüringen als Sohn eines Maurermeisters/Bauunternehmers geboren bis 1875 Besuch der Volksschule und Sprachunterricht vom örtlichen Pfarrer Maurerlehre beim Vater, dann nach Realgymnasium in Leipzig Militärdienst 1 Jahr Studium Kunstgeschichte und Philosophie an der Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin bis 1887 Architekturstudium an der Technischen Hochschule Berlin, nebenher Arbeit bei Paul Wallot, dem Erbauer des Reichstages 1887–90 Angestellter einer Baufirma in Tokio, dann 4-monatige Asienreise 1891 2. Hauptprüfung für den Staatsdienst im Hochbau, Regierungsbaumeister 1896–1903 Technischer Attaché für Architektur der dt. Botschaft in London Oktober 1927 bei Baustellenbesichtigung durch Straßenbahnunfall gestorben In London verfasste er im amtlichen Auftrag zahllose Berichte über englische Architektur, Kunstgewerbeerziehung, Ausstellungen und auch ingenieurtechnische Neuerungen, die überwiegend im Zentralblatt der Bauverwaltung veröffentlicht wurden. Zugleich entwickelte er eine umfangreiche publizistische Tätigkeit, zu der neben zahlreichen Artikeln in einschlägigen Kunstzeitschriften die berühmte Streitschrift Stilarchitektur und Baukunst gehört. Das Hauptwerk dieser Zeit sind jedoch drei umfangreiche Werke über englische Baukunst, von denen das bekannteste „Das englische Haus“ wurde. Nach seiner Rückkehr erhielt Muthesius einen Ruf an die Technische Hochschule in Darmstadt als Professor für Kunstgeschichte, den er jedoch ablehnte, um als Geheimrat in das Preußische Handelsministerium zu wechseln, wo ihm bis zu seiner Pensionierung 1926 die Reform der Kunstgewerbeschulen oblag. Nebenher hat er als Architekt eine umfangreiche Tätigkeit entfaltet, wobei er überwiegend durch seine Landhäuser bekannt wurde. Aus einem 1907 gehaltenen Vortrag an der Berliner Handelshochschule entwickelte sich ein Skandal, der als „Fall Muthesius“ berühmt wurde und nach Protesten des wirtschaftlichen Interessenverbandes des Kunstgewerbes in einer mit Muthesius solidarischen Gegenbewegung die Gründung des Deutsche Werkbundes auslöste. 1908 wurde er als Mitglied in den Vorstand gewählt und hatte von 1910 –16 dort das Amt des zweiten Vorsitzenden inne. Mit seiner Einflußnahme auf die Kölner Werkbundausstellung von 1914 als auch seinem dortigen Vortrag „Die Werkbundarbeit“ der Zukunft entfachte er einen Proteststurm der Künstler, der als „Typenstreit“ berühmt wurde und den Werkbund an den Rand einer Spaltung brachte. Nach dem Krieg hat Muthesius zwar noch eine große Zahl vorwiegend klassizistischer Häuser gebaut und einige Bücher veröffentlicht, war aber in Anbetracht der neueren Entwicklungen der Architektur zum außenstehenden Beobachter geworden. Muthesius starb im Oktober 1927. 66 Sächsischer Landtag Bernhard-von-Lindenau-Platz 1 Architekt: Peter Kulka, 1991–94 Altbau: Barthold und Tiede, 1928–31 Platzgestaltung: Peter Kulka Peter Kulka Biographie 1937 geboren in Dresden 1958 Abschluß des Ingenieurstudiums, Fachrichtung Architektur 1964 Abschluß des Studiums der Architektur an der Hochschule für bildende und angewandte Kunst in Berlin-Weissensee 1964 Mitarbeiter von Hermann Henselmann am Institut für Typenprojektierung, Berlin 1965–68 Mitarbeiter im Büro von Hans Scharoun, Berlin seit 1969 Freier Architekt 1970–79 Partner in der Architektengemeinschaft Herzog, Köpke, Kulka, Siepmann, Töpper seit 1979 Eigenes Büro in Köln 1986–92 Universitätsprofessor für Konstruktives Entwerfen an der RWTH Aachen seit 1991 Eigenes Büro in Dresden seit 1996 Gründungsmitglied der Sächsischen Akademie der Künste seit 1996 Mitglied der Berliner Akademie der Künste 1997–98 Gastprofessor an der RWTH in Aachen 1998–00 Vorsitzender des Gestaltungsbeirats der Stadt Regensburg 2004 Mitglied des Gestaltungsbeirates der Stadt Trier Gastvorlesungen und Vorträge an zahlreichen Universitäten und Einrichtungen im In- und Ausland Mit der Wiedervereinigung Deutschlands musste die Unterbringung des sächsischen Landtages gelöst werden: Zunächst wurde das alte Ständehaus von Wallot in Betracht gezogen, doch fiel die Entscheidung, das 1928–31 von Barthold und Tiede im Stil der Neuen Sachlichkeit erbaute Landesfinanzamt zu rekonstruieren, das 1953–89 die Bezirksleitung der SED beherbergt hatte. Dieses Ensemble wurde zur Elbe hin u.a. mit einem Plenarsaal ergänzt – auch um diesen zentralen Bereich besser zu nutzen. Dazu gab es einen beschränkten Wettbewerb von 12 sächsischen Architekten, den der 1990 aus Köln nach Dresden zurückgekehrte Kulka gewann. Der Neubau strahlt Zurückhaltung und Bescheidenheit aus. Eine kräftige Geste des Schutzes unserer Demokratie symbolisiert jedoch das weit hervorstehende Flugdach am Eingang zum Neubau. Dieser soll im spannungsvollen Gegensatz zum schweren, steinernen Altbau leicht und transparent wirken. Funktion und Konstruktion werden nach den Prinzipien der Moderne offen gelegt. Zum Beispiel in den neuen Flügelbauten ist die offen liegende Stahlskelettkonstruktion mit roh belassenen Stahlbetondecken ein Gestaltungselement. Viel Glas soll viel nachvollziehbare Transparenz assoziieren. In den Sommermonaten allerdings kann man das Parlamentsgebäude von der Neustädter Elbseite kaum erkennen, so versteckt es sich hinter den Lindenbäumen. Eine kräftig akzentuierte Vertikale hätte den großen Stolz auf die 1989 besonnen erkämpfte Demokratie gut zum Ausdruck bringen können. Doch der Architekt Peter Kulka hat den Neubau horizontal gelagert. Eine vertikale Betonung des Neubaus wurde zugunsten des rückwärtig gelagerten, turmartigen Eckbaus aus dem Jahr 1931 verzichtet. Damit sollte die Gliederung des Terrassenufers mit niedrigen Baukörpern an der Elbe und höheren Bauteilen dahinter fortgesetzt werden. Im Inneren wird der mit Holz verkleidete Plenarsaal als runder amphitheaterartiger Bau konstruktiv sichtbar. Von außen wölbt sich das Rund gläsern um die Ecke. Vier massive Kreuzstützen halten ein monumentales Stahldach – ein Motiv entlehnt von der Berliner Neuen Nationalgalerie von Mies van der Rohe (1965–68). Für die Öffentlichkeit zugänglich sind das Restaurant und die Sonnenterrasse. Selbstverständlich ist die Besuchertribüne des Plenarsaals für Interessierte – mit Voranmeldung – bei den Landtagssitzungen zugänglich. Auch das Foyer wird oft mit verschiedenen Ausstellungen über die Geschichte und Gegenwart des sächsischen Parlamentarismus vielfältig genutzt. Ein offenes Haus in vielerlei Hinsicht. Der offene freie Vorplatz, benannt nach Bernhard Lindenau, wird als Demonstrationsplatz für verschiedene politische Äußerungen des Volkes genutzt. www.das-neue-dresden.de/landtagsachsen.html Der Altbau von 1931 für das Sächsische Finanz- und Zollamt stammt von Barthold und Tiede, die sonst in Dresden kein weiteres Bauwerk errichteten. Nach langen Hochhausdebatten in Dresden in den 20er Jahren konnte immerhin ein 7-stöckiger Turm mit 36 Meter Höhe errichtet werden, der kubisch aus der südöstlichen Ecke herausragt. Jan von Havranek („Das Neue Dresden 1919–49“) fand heraus, daß „laut einem Vermerk im Schriftarchiv des Landesamtes für Denkmalpflege Dresden die Fußbodenplatten aus dem Pavillon des Deutschen Reiches von Mies-van-derRohe für die Weltausstellung in Barcelona 1929 stammen“. Einen Gestaltungsakzent bietet zudem die Fensterreihung mit vorgezogenen Gewänden. Gegenüber dem historistisch-eklektizistischen Elektrizitätswerk mit seinem ornamentierten Turm stellte dieses Bürogebäude zur Entstehungszeit wohl einen starken Kontrast von demonstrativer Sachlichkeit dar. Wegen des ungünstigen Baugrundes und des hohen Grundwasserstandes an diesem elbnahen Standort erhielt das Gebäude einen Unterbau aus Stahlbetonpfählen (ca. 1.000 unter dem Altbau und 176 unter dem Neubau) mit einem Durchmesser von bis zu 1,20 Meter. Das komplett SED-dominierte sächsische Parlament tagte nach dem Krieg bis zu einer Auflösung 1952 im Gebäude des ehemaligen Luftgaukommandos in Dresden Strehlen, was nur zu etwa ¼ zerstört worden war. Danach wurde das Land Sachsen in drei „Bezirke“ aufgeteilt: Dresden, Leipzig und Karl-Marx-Stadt (Chemnitz). Der 1937 in Dresden geborene Architekt Peter Kulka baut z.Z. auch das Deutsche Hygiene Museum in Dresden um. Seit einiger Zeit ist er auch mit der Planung zum Wiederaufbau des Ostflügels vom Residenzschloss beschäftigt. 1964 arbeitete er bei Herrmann Henselmann im Institut für Typenprojektierung in Ostberlin und zwischen 1965 und 1968 bei Hans Scharoun in Westberlin. Seit 1979 betreibt Prof. Kulka ein eigenes Büro. 68 Zwinger Ostra-Allee, Sophienstraße Architekt: Matthäus Daniel Pöppelmann, 1709–28 Als „Zwinger“ wird im Festungsbau das von Gräben durchzogene Gelände zwischen den Stadtmauern bezeichnet, der für Feste und Spiele genutzt wurde. 1709 wurde in der Nachbarschaft des Zwingers zum Besuch des dänischen Königs eine hölzerne Festarchitektur errichtet. 1710 entwarf Matthäus Daniel Pöppelmann, seit 1680 in Dresden und seit 1705 Landbaumeister, als ersten dauerhaften Bau eine Orangerie. Die Gebäude, die in der Folgezeit für August den Starken entstanden, gehen in ihrer aufwändigen, prachtvollen Gestaltung weit über die ursprüngliche Funktion als Festplatz, Orangerie und schließlich Museum hinaus. Der Zwinger ist das berühmteste Bauwerk Dresdens und gehört zu den bekanntesten Kunstdenkmälern. Der verantwortliche Architekt Matthäus Daniel Pöppelmann sowie der Bildhauer Balthasar Permoser haben hier die architektonische Formensprache ihrer Zeit in einem Gesamtkunstwerk zusammengefasst. Ursprünglich sollte der Zwinger der Vorhof für eine nie ausgeführte Schlossanlage sein. Aus Platzgründen konnte die Zwingeranlage nicht von einem Garten umgeben werden, deshalb entstand dieser im Zwingerhof selbst. Bis 1847 war die Elbseite des Bauwerks durch eine hohe Mauer abgeschlossen, danach entstand nach den Plänen Gottfried Sempers die heutige Gemäldegalerie an dieser Stelle. Der annähernd quadratische Innenhof des Zwingers besitzt eine Breite von 107 und eine Länge von 116 m. Aus seinen Langseiten treten kleinere Seitenhöfe mit Segmentbogenschluss hervor, woraus ein kreuzförmiger Grundriss resultiert. An den Ecken der Langseiten befinden sich vier Pavillons (Mathematischer, Französischer, Naturwissenschaftlicher, Deutscher Pavillon), saalartige, eingeschossige Aufbauten über Bogenhallen, deren Rampen mit geschwungener Treppe vorgelagert sind. Über dem Gesims und vor den Schweifdächern zieren Figuren und Wappen aus der Werkstatt Balthasar Permosers die Bauten. Den Abschluss der apsidial geschlossenen Höfe bilden zwei Torpavillons. Der Wallpavillon, bei dem eine geschwungene Treppe zum ovalen Festsaal führt, entstand 1716 als bedeutendstes Werk Pöppelmanns. Hier löst sich das Bauwerk auf in eine lebendige Plastik. Als Bekrönung trägt Permosers sechs Meter hoher Herkules Saxonicus die Weltkugel. Das der Ostra-Allee zugewandte Kronentor ist der eigentliche Zugang zum Zwingerhof. Es ragt mit seiner zwiebelförmig geschwungenen Dachhaube aus der Langgalerie am Zwingergraben heraus. Die Langgalerie verbindet das Kronentor mit den Eckpavillons und Bogengalerien. Kronentor und Langgalerie erheben sich auf der ehemaligen Festungsmauer des Zwingergrabens, welcher im 19. Jahrhundert komplett zugeschüttet wurde. Erst bei der Restaurierung des Zwingers 1929 erfolgte eine Freilegung. Das Nymphenbad ist eines der Hauptwerke des Dresdner Hofbildhauers Balthasars Permosers. Seine Mitte bildet ein gegliedertes rechteckiges Wasserbecken, in das von der Höhe des Zwingerwalls von Becken zu Becken und über Kaskaden das Wasser herabstürzt. Am ganzen Zwingerbau von großer Bedeutung für den Gesamteindruck befinden sich meisterhaft gestaltete Treppenanlagen. Der später errichtete Glockenspielpavillon gegenüber ließ keine Steigerung mehr zu. 1924–36 wurde ihm ein Glockenspiel aus Meißner Porzellan, das schon Pöppelmann vorgesehen hatte, eingebaut. 1924–36 wurde der Zwinger unter Leitung des Architekten Hubert Ermisch und des Bildhauers Georg Wrba grundlegend restauriert, die Plastiken z.T. neu geschaffen. In der Bombennacht des Februar 1945 wurde der Zwinger so getroffen, daß er unwiederbringlich zerstört schien. Aber noch im gleichen Jahr begannen die Wiederaufbauarbeiten, die bis 1963 andauerten, geleitet von Ermisch. Das wesentliche Aussehen des Zwingers wurde jedoch beibehalten. 70 Semperoper eigentlich Hofoper Architekt: Gottfried Semper, 1871–78 Der erste Bau Gottfried Semper (1803–79) wurde 1834 – im Alter von 31 Jahren auf Empfehlung Karl Friedrich Schinkels – als Professor der Baukunst und Direktor der Bauschule nach Dresden berufen. 1838–41 entstand an der Stelle der heutigen Oper sein erstes Theater (Altes Hoftheater), das am 21. September 1869 einem Brand zum Opfer fiel. Der zweite Bau 1871–78 entstand die „Semperoper“, sein erstes Hauptwerk, das unter Leitung seines ältesten Sohnes Manfred Semper (1838–1913) von 1871–78 am Theaterplatz erbaut wurde – kurz vor Errichtung des Wiener Burgtheaters (1874–88). Zwei Dinge waren ihm wichtig, die Richtung weisend werden sollten für den Theaterbau des späten 19. Jahrhundert und teilweise danach: Die äußere Erscheinung sollte die funktionale Gliederung des Inneren zeigen. So wird die Rundform des vorgelagerten, 2-geschossigen Eingangs- und Foyerbereichs überragt vom ebenso vorgewölbten Zuschauerraum. Dieser wird seinerseits überragt vom Bühnenturm. Dazu kam die an römischen Theaterbauten orientierte Formensprache – die Architektur-Plastik wie die Säulenstellungen –, während die hohe Exedra über dem mittleren Eingangsportal die italienische Hochrenaissance zitiert. Der Theaterbau verfügt über eine prachtvolle Innenausstattung. Die Haupttreppenhäuser sind seitlich an den Hauptbaukörper angesetzt und von den Seiten aus zugänglich und portikusartig betont. Über dem Portal erhebt sich eine bronzene Pantherquadriga mit Dionysos und Ariadne von Johannes Schilling. Den mittigen Haupteingang flankieren Skulpturen von Ernst Rietschel. Sie stellen Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller dar. In der Nacht des 13. Februar 1945 ist der Bau nach dem Bombardement der Stadt ausgebrannt. Der dritte Bau Nach dem Zweiten Weltkrieg bereiteten 1946–55 Sicherungsarbeiten sowie konzeptionelle Studien 1968–76 den Wiederaufbau vor. Am 24. Juni 1977 erfolgte die Grundsteinlegung und der Wiederaufbau unter der Leitung von Chefarchitekt Wolfgang Hänsch. Anlässlich des 40. Jahrestages der Zerstörung konnte am 13. Februar 1985 die Semperoper mit Carl Maria von Webers Oper „Der Freischütz“ symbolisch wiedereröffnet werden – es war diese Oper, mit der das Opernhaus am 31. August 1944 geschlossen worden war. Obwohl sie schon Staatsoper war, erhielt die Oper zusätzlich nach der Wende den offiziellen Titel „Sächsische Staatsoper“. An die Rückseite wurde ein funktionales Gebäude angebaut. Es enthält Probebühnen, Werkstätten und Büros und Garderoben sowie einen Gastronomiebereich. Das extreme Hochwasser der Elbe im August 2002 fügte dem Opernhaus einen Schaden von 27 Millionen Euro zu. Schon drei Monate nach der Hochwasserkatastrophe eröffneten am 9. November 2002 statt wie geplant am 13. August Tänzer und die Sächsische Staatskapelle mit dem Ballett „Illusionen – wie Schwanensee“ die Spielzeit. Im Rahmen der 800-Jahr-Feierlichkeiten der Stadt Dresden fand am 13. Januar 2006 der erste Dresdner Opernball seit 1939 statt. Die Bestuhlung war durch Tische und Stühle ersetzt worden. Im Saal, auf den Rängen und in den Logen feierten ca. 2300 Gäste sowie auf dem Theaterplatz etwa 4000 Dresdner. Vom Theaterplatz aus bietet sich die Gelegenheit, zwei Bauten Gottfried Sempers vergleichend zu betrachten, die Gemäldegalerie am Zwinger als ein Frühwerk und die ein Viertel Jahrhundert später entstandene Oper als ein reifes Werk mit weit reichender Wirkung auf den zukünftigen Theaterbau. Quellen: - Prof. Horst Thomas - Broschüre zur Studentenexkursion 2007 der HS Karlsruhe nach Dresden und Prag mit Prof. Florian Burgstaller 72 Lipsiusbau Brühl´sche Terrasse Architekten: Constantin Lipsius, 1894, Auer+Weber+Partner und Rolf Zimmermann, 2005 Ausstellungsgebäude an der Brühl´schen Terrasse in Dresden Von Wolfgang Bachmann Pauschaltouristen (früher: Einreisende), die über die Altstadt-Fan-Meile der Brühlschen Terrasse flanieren, werden das riesige, unübersichtliche Ensemble, das lange Jahre marode und dem Publikum verschlossen auf bessere Zeiten wartete, irgendwie zu den barocken Desideraten der Dresdner Baugeschichte zählen. Aber nicht alles, was alt wirkt, ist unbedingt wertvoll. Schon zu ihrer Entstehungszeit waren die Kunstakademie und das Ausstellungsgebäude umstritten, und auch die Kriterien der Denkmalpflege haben sich bei der Sanierung gewandelt. Es erinnert an die Pariser Oper, aber auch an Reichstag und Berliner Dom. Ein Gebäude, das geradezu alle zur Zeit seiner Fertigstellung 1894 erreichbaren herrschaftlichen Stile vermengte. Der Begriff „Kolossalordnung“ bekam hier nach dem deutsch-französischen Krieg eine neue, übertragene Bedeutung. Seinem Architekten, Constantin Lipsius, der sich der fortgesetzten Kritik ausgeliefert sah und mehrere Überarbeitungen abliefern musste, wurde neben der Stilmelange für dieses „hässlichste Monumentalgebäude Dresdens“ vor allem die Konkurrenz zur Frauenkirche vorgeworfen. Die Baugeschichte erinnert an aktuelle Episoden aus der Branche. Lipsius starb völlig erschöpft noch vor der Fertigstellung des Gebäudes. Heute begegnen wir diesem imperialen Kauderwelsch eher leidenschaftslos, die prahlerischen Motive dieser Architektur sind uns fremd, aber eine lediglich ästhetische Bewertung würde dem Historismus auch nicht gerecht. Also kritische Masse für die Baugeschichte, um sich mit Karl Böttichers Grammatik „Die Tektonik der Hellenen“ (1852) auseinanderzusetzen. Für Studenten bietet das Gebäude eine Buchstabiertafel in Stilkunde. Nach der Zerstörung am 13. Februar 1945 wurde schon bald nach Kriegsende der weniger getroffene Akademietrakt provisorisch in Betrieb genommen. Das Ausstellungsgebäude, damals noch ungeteilt, bekam erst Ende der sechziger Jahre wieder eine Verglasung für seine legendäre „Zitronenpresse“ sonst blieb der ruinöse Zustand durch Stahlaussteifungen vor dem Zusammenbruch bewahrt. 1991 begannen die ersten Sicherungsmaßnahmen. Stahlsprieße und -klammern flankierten die maroden Sandsteinsäulen, die im Vestibül später durch glatte Betonstutzen ersetzt wurden. Statt einer bruchlosen Wiederherstellung blieben nach einer konzeptionellen Neubesinnung die Spuren der Zerstörung erhalten. Zurück in den Historismus? 1991 begannen Notsicherung und Restaurierungsarbeiten mit dem Ziel, den ursprünglichen Zustand vor der völkischen Überarbeitung durch die Nazis wiederherzustellen. Beauftragt wurde das Dresdner Groß-Büro IPRO, das den Rohbau durch Tragwerksergänzungen stützte, außerdem Dächer bzw. Glasdächer und vor allem die Fassaden instand setzte. Innen ging die „neutrale“ Sanierung (die später nach einem VOF-Verfahren weiter vergeben werden sollte) doch weiter; bedauerlicherweise wurde brüchiger Wandschmuck abgeschlagen, um ihn „wie neu“ zu ergänzen. Drei Jahre später kam die Hochschule zu einer besseren Einsicht, man fühlte sich offenbar unwohl bei der Vorstellung, künftig in puttenüberladenen Räumen einer schwülstigen Neorenaissance zu arbeiten. Der Bauherr sah das angesichts der immensen Wiederherstellungskosten auch so. Das neue Ziel war nun, dem Haus eine moderne Ausstattung zu geben, die zwar die vorhandene Substanz respektierte, aber zerstörte Elemente nicht zeitlos herbeisimulierte. Das sogenannte Oktogon unter der Kuppel, jetzt abgetrennt und unter Verantwortung der Hochschule, wurde bereits im Jahr 2000 von Pfau Architekten nach dieser Maßgabe vollendet. Hier lassen sich – zuletzt mit den Arbeiten von Klaus-Michael Stephan „Krieg und Frieden“ – hervorragend Ausstellungen einrichten. Die polygonalen Grundrissgeometrien mit den geflickten Ziegelwänden, die leisen farbigen Spuren der Bemalung und sparsamen schwarz glimmernden Stahleinbauten, mit denen die Gegenwart wie helfend das geschundene Gebäude stützt und ergänzt, sind eine überzeugende Aussage. Im letzten Jahr wurde schließlich oberhalb, auf der Terrasse (dem Sockel der ehemaligen Festung) der jetzt von den Staatlichen Kunstsammlungen bespielte Bauteil eröffnet. Rolf Zimmermann, mit Sanierungen in der Stadt bereits vertraut, traf auf Carlo Weber, der damals in Dresden eine Professur bekleidete, so kam die Allianz zwischen dem Stuttgarter und Dresdner Büro zuwege. Heute zeigt die Wiederherstellung des Ausstellungsgebäudes zwei Handschriften. Im Untergeschoss des Vestibuls nehmen grobschlächtige Säulen die Lasten auf. Die späteren Zutaten sind unauffällig und zurückhaltend, aber ohne scarpaeske Spielfreude. Epochenwende. Ehemals diente das Akademiegebäude anschaulich zur Vermittlung einer Stilund Architekturlehre, die bald nach Fertigstellung des Hauses überholt war. Die jetzigen Eingriffe üben sich in neutraler, fast roher Zeitlosigkeit. Statt romantisches High-tech zu zeigen, ist die Haustechnik im Boden und über der Staubdecke verborgen, nur unauffällige Düsen und Lichtschienen sind im großen Ausstellungssaal zu erkennen. Unten rechts der stählerne Kassentresen. Bauherr Freistaat Sachsen Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Auer+Weber+Architekten, Stuttgart und Rolf Zimmermann, Dresden www.auer-weber.de www.architekt-dresden.de Tragwerksplaner: Ingenieurbüro Kless Müller GmbH, Dresden HLS-Planung: AHS Ingenieurgesellschaft mbH, Falkenberg Elektroplanung: Bauplanung Sachsen GmbH, Ingenieurbüro Rathenow, Dresden Bauphysik: Müller-BBM, Langebrück Rohbauarbeiten: www.palm-gmbh.com Natursteinarbeiten: www.natursteine-schubert.de Beleuchtung: www.zumtobel.com Gefahrenmeldeanlage: www. Siemens.com Aufzüge: www.fbaufzuege.de Bruttogeschossfläche: 3350 m2 Gesamtkosten: 8,4 Mio Euro Fotos: Roland Halbe, Stuttgart Quelle: Baumeister, B10, 2006 Ein Skelett der Baugeschichte Im Zentrum liegt der große Ausstellungssaal. Er verbirgt unsichtbar die anspruchsvolle Technik über der Staubdecke und unter dem neuen Betonfußboden. Nur Lüftungsgitter vor den Wänden und Dralldrüsen in den fragmentarischen Gesimsvoluten lassen ahnen, daß hier keine anspruchslose romantische Hülle, sondern ein Museum mit akkuraten Anforderungen an Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Beleuchtung und Sicherheit mit minimalen Toleranzen eingerichtet wurde. Als neues Bauteil kam zwischen den beiden Scherwänden an der Ostseite eine Galerieebene dazu. Sie ist vorsichtig von den Umfassungswänden abgesetzt, ihre auskragenden Platten verjüngen sich zur Brüstung hin, was den Eindruck des später Hinzugekommenen ablesbar macht. Bis zur Höhe des Gesimses sind hier die Wände weiß verputzt, darüber zeigt unter dem horizontalen Glasdachanschluss ein dunkler Spritzputz die Höhe der früheren Schmuckprofile, deren fragmentarische Voluten sich wie eine alte schmutzige Lederhaut um ihre Armierung rollen. Auf die Galerie führt eine gerade Treppe, deren gegenläufig geschwungene Handläufe dem Weg etwas Musikalisches geben; zur anderen Seite, nach Westen, wo drei Kabinette die Ausstellungsfläche fortsetzen, führt eine schwarzstählerne Spindeltreppe nach oben zur Museumspädagogik. Wer sich noch erinnern kann, wie spannend der Martin-Gropius-Bau in Berlin vor seiner endgültigen Verschönerung ausgesehen hat, findet hier im Ausstellungsgebäude der Staatlichen Kunstsammlungen ein Pendant. In der gegenwärtigen Rodin-Ausstellung heißt es, die Werke des Bildhauers zeigten „Oberflächen, die mit Licht und Schatten spielen“. Die Architektur dieser Räume setzt das Spiel fort. Besondere Aufmerksamkeit wurde den verschiedenen Treppen gewidmet. Neben der vorhandenen ins Untergeschoss (wo sich Garderobenspinde und Toiletten befinden), die mit einem „Teppich“ aus MDF-Platten belegt wurde (links) gibt es zum Beispiel Wendeltreppen, die zur Museumspädagogik auf der Galerie oder als Fluchtweg weiterführen. Lageplan Längsschnitt Erdgeschoss Obergeschoss 76 Das Blaue Wunder die Blasewitz–Loschwitzer Brücke Die heutigen Dresdner Stadtteile Loschwitz und Blasewitz waren bis 1921 selbständige, lediglich durch die Elbe getrennte Gemeinden. Zwischen ihnen verkehrte eine stark frequentierte Fähre. Nach einer abgelehnten Petition der beiden Gemeinden für einen Brückenbau sah sich die sächsische Staatsregierung 1874 durch einige reiche Bürger aus Blasewitz, die auf eigene Kosten einen Ingenieur mit der Ausarbeitung von Plänen für eine Brücke beauftragten und sie dem Landtag vorlegten, wohl so stark unter Druck gesetzt, daß sie schließlich den Beschluss fasste, die Brücke endlich zu bauen. Die für den Bau zuständige Behörde war das sächsische Finanzministerium, mit der Ausarbeitung der Pläne wurde der Geheime Finanzrat Claus Köpcke betraut, der auch Professor für Ingenieurwissenschaften am Polytechnikum in Dresden war. Köpcke projektierte eine Brücke, die für die damalige Zeit wegen ihrer ungewöhnlichen Konstruktion und ihrer großen Spannweite als sensationell empfunden wurde. Das Blaue Wunder ist ein recht eigenartiges Bauwerk, das vom Konstruktionstyp her aber den Hängebrücken zugeordnet wird. Genauer gesagt ist es eine so genannte Bandeisenbrücke, weil die Fahrbahn nicht wie sonst bei Hängebrükken an Ketten oder Stahlseilen aufgehängt ist, sondern an einem Zugband aus vernieteten Flacheisen. Köpcke führte beim Entwurf des Blauen Wunders zahlreiche Neuerungen ein, die sich jedoch letztendlich nicht durchsetzen konnten. Insofern ist die Brücke ein Unikat geblieben und ist heute ein technisch wie historisch interessantes Anschauungsobjekt. Die Fahrbahn ist nicht wie sonst bei Hängebrücken an senkrechten „Hängern“ befestigt, sondern über ein zweifaches Strebenfachwerk an dem Eisenband aufgehängt. Am theoretischen Schnittpunkt von Ober- und Untergurt sowie an den Pylonspitzen befinden sich Gelenke mit Stahlfedern. Diese sind mit einer Art Bremse ausgestattet, die Bewegungen erst ab einer bestimmten Spannung im System zulässt. Ohne diese Bremse wäre die Brücke beweglicher und würde insbesondere bei stoßweisen Belastungen mehr schwingen. Da bei anderen Brücken mehrere Unglücksfälle dieser Art vorgekommen waren, hatte man zur damaligen Zeit ein besonderes Augenmerk auf gleichzeitig marschierende Personengruppen, wie z.B. Soldaten im Gleichschritt. Die Pylone des Blauen Wunders stehen auf Rollenkipplagern, so dass sie sich bei steigender Temperatur zur Brückenmitte hin neigen. Köpckes Entwurf wurde 1885 in einem Ausschreibungswettbewerb veröffentlicht, der von der Sächsischen Eisenbahnkompanie AG gewonnen wurde. Es verstrichen aber noch sechs weitere Jahre, bis schließlich 1891 unter der Leitung des Ingenieurs Hans Manfred Krüger (1852–1926) mit den Bauarbeiten begonnen wurde. Krüger und Köpcke waren ein eingespieltes Team, die gemeinsam mehrere große Brücken bauten. Zunächst mussten auf beiden Seiten der Elbe einige Häuser abgerissen werden um ausreichend Platz für die Baustelle zu schaffen. Die Bauteile für die ca. 3500 Tonnen schwere Stahlkonstruktion wurden in der Königin-Marien-Hütte in Cainsdorf vorgefertigt und an Ort und Stelle zusammengenietet. Bereits zwei Jahre nach dem Beginn der Bauarbeiten war die Brücke fertig und konnte einem zeitgenössischen Belastungstest unterzogen werden. Da es zur damaligen Zeit noch keine zuverlässigen Berechnungsverfahren gab, mit denen sich das statische Verhalten einer Brücke abbilden lies, kam jeder Belastungsprobe eine sehr große Bedeutung zu. Außerdem ging es auch darum, die Bevölkerung von der Tragfähigkeit der Brücke zu überzeugen. Man wollte ganz sicher sein, daß die Brücke im täglichen Betrieb niemals eine größere Last würde tragen müssen als bei der Belastungsprobe am 11. Juli 1893: 3 Dampfwalzen, 3 weitere Straßenwalzen samt Pferden, 3 Straßenbahnwagen, die mit Schiffsankern und Steinen beladen waren, 3 Sprengwagen samt Wasser und Zugtieren, einen voll besetzten Pferdebahnwagen und mehrere Kutschen, insgesamt ein Gewicht von 157 Tonnen. Außerdem marschierten noch Straßenpassanten und eine Kompanie des Dresdner Jägerbataillons über die Brücke. Die Brücke erwies sich mit einer maximalen Durchbiegung von 9 mm in der Mitte des Trägers als außerordentlich solide. Am 15. Juli 1893, wurde die Brücke unter großer Anteilnahme der Bevölkerung feierlich eingeweiht. Das Bauwerk wurde zu Ehren des damaligen sächsischen Königs auf den Namen „König-Albert-Brücke“ getauft. Ab 1918 hieß sie dann offiziell „Loschwitzer Brücke“ aber im Volksmund war sie immer das „Blaue Wunder“. Hartnäckig hält sich die Legende, der Name der Brücke sei erst dadurch entstanden, daß sich der ursprünglich grüne Anstrich über Nacht in die blaue Farbe verwandelt hätte. Da aber schon ab April 1893 in diversen Zeitungsartikeln Belege für die Farbe Blau vorhanden sind, kann man dieses Gerücht wohl eindeutig in den Bereich der Fantasie einordnen. Mit einer Spannweite von 141,5 m war sie eine der größten Brücken Europas und die Verwendung von Stahl sowie die besondere Konstruktion waren noch sehr ungewohnt. Die Bauarbeiten verschlangen die für damalige Verhältnisse gewaltige Summe von 2,25 Mill. Goldmark, die von den beiden Gemeinden und der sächsischen Staatsregierung getragen wurden. Um die Investition wieder hereinzuholen, wurde für jede Person, die die Brücke benutzen wollte, ein Brückenzoll erhoben. Dieser betrug Anfangs pro Person 2 Pfennige, für Gänse und Hühner ebenfalls 2 Pfennige und für Zugtiere 10 Pfennige. Durch den Zoll wurden reichlich Einnahmen erzielt, bis er im Jahre 1921 im Zuge der Eingemeindung der beiden Ortsteile zu Dresden wieder abgeschafft wurde. Ab 1895 wurde die Brücke auch von der elektrischen Straßenbahn und bald schon von immer mehr Kraftfahrzeugen benützt. Bis zum Jahre 1935 hatte der Verkehr so zugenommen, daß sich Fußgänger und Autos immer mehr in die Quere kamen. Eine Zeit lang wurde ernsthaft darüber nachgedacht, die Brücke abzureißen und durch eine Betonbrücke zu ersetzen. Schließlich entschied man sich jedoch dafür, lediglich auf beiden Seiten Gehwege anzubauen. In den fünfziger Jahren musste die Fahrbahn, die bis dahin aus Holzbohlen bestanden hatte, gegen Eisenbleche ausgetauscht werden und 1982 wurde das gesamte Mauerwerk gründlich saniert. Trotz aller Anstrengungen mehrten sich jedoch bald die Anzeichen für eine deutliche Überlastung der Brücke, die im April 1986 zunächst zur Einstellung des Straßenbahnverkehrs führte. Inzwischen ist die Nutzung der Brücke aber auch für alle Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 15 Tonnen generell verboten. Eine Ausnahme gibt es nur für Busse. Wie so viele Brücken die im 2. Weltkrieg von der einen oder der anderen Seite zerstört wurden, sollte auch das Blaue Wunder beim Rückmarsch der deutschen Truppen von der SS gesprengt werden. Durch ihr mutiges Eingreifen verhinderten die 2 Dresdner die Zerstörung des heute unter Denkmalschutz stehenden Bauwerks. Die Belastungsprobe am 11. Juli 1893 78 Villa Marie Fährgässchen1 Die toskanische Villa liegt am Fuße des „Blauen Wunders“. Der Garten rund um die bekannte Villa befindet sich oberhalb der weiten Wiesen, die vom „Blauen Wunder“ bis in die Innenstadt eine einzigartige Flusslandschaft bilden. Ein paar Meter von der Villa Marie entfernt halten die Dampfer der weißen Elbflotte. Als eines der bekanntesten Häuser in Dresden-Blasewitz entstand es vermutlich um 1860. Es wechselten mehrere Male die Besitzer. Die Villa ist ein solides, geräumiges Haus, mit einem Fachwerkdachgeschoß, einem Holztürmchen und zwei Balkonen. Die Bezeichnung „Villa Marie“ selbst taucht erst in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts auf. Der letzte Eigentümer wurde zu Zeiten der DDR enteignet und das Haus an die Kommunale Wohnungsverwaltung (KWV) übertragen. Als das Haus zunehmend verfiel und seine Bewohner das Weite suchten, schaltete sich zu Beginn der 80er Jahre die staatliche Bauaufsicht ein und erklärte die Villa für unbewohnbar. Ab 1982 begann die wahrscheinlich lebendigste Zeit für die Villa Marie. Einheimische Künstler um „Wanda“ (Claudia Reichardt) besetzten die Villa am Blasewitzer Elbufer; trotz mehrfacher Räumungsbefehle beherbergte die Villa fast zehn Jahre lang eine inoffizielle Galerie, bis diese im September 1987 verboten wurde. 1988 bis 1990 war des zweistöckige Haus Heimstatt der Galerie „fotogen“ („autogen“). Dabei plante die Stadt Dresden 1988 schon den Abriss der Villa. Dank einiger beherzter Denkmalpfleger und der illegalen Besetzer konnte dieses verhindert werden. Die seit dem Ende der siebziger Jahre vom Verfall bedrohte Villa avancierte in den Folgejahren zur Ruine. Seit dem Auszug der alternativen Dresdner Kunstszene stand die Villa leer. Die WOBA Südost – Nachfolger der KWV – erwog unter sehr fragwürdigen Umständen die Übereignung der Villa an das Kombinat Obst, Gemüse und Speisekartoffeln (OGS). Dieses wiederum plante die Villa als Gästehaus zu nutzen. Die Auflösung des Kombinates verhinderte das. Schließlich wurde die Villa Marie 1990 baupolizeilich gesperrt. 1991 wurde dem Alteigentümer auf seinen Restitutionsantrag (Rückübertragung) stattgegeben. Anfang 1992 erwarben der Münchner Immobilienmakler Otto Bantele und der Münchner Rechtsanwalt Peter Jäger die „Villa Marie“ und begannen 1993 mit der Restaurierung der Ruine. Ursprünglich als Wohnhausnutzung geplant, wurde die Idee, die Villa als „Galerie-Restaurant“ der Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen, umgesetzt. Die Restaurierung belief sich auf ein Investitionsvolumen von 1,8 Millionen Mark. Anfang Juni 1994 war die komplette Restaurierung des Gebäudes abgeschlossen. Klaus Karsten Heidsiek, der u.a. zehn Jahre Koch in einem 3-Sterne-Hotel in Mailand war, pachtete die Villa für sein Restaurant und seine Bar. Er wurde extra für diese reizvolle Aufgabe von den Eigentümern gewonnen. 79 Standseilbahn Körnerplatz, Loschwitz Die Standseilbahn in Dresden wurde Ende des 19. Jahrhunderts in Betrieb genommen. Damals wie heute verbindet sie das hoch über der Elbe thronende Dresdner Villenviertel Weißer Hirsch mit der Stadt entlang des Flusses. 547 m Fahrt mit der Standseilbahn bergauf werden belohnt mit einem traumhaften Blick auf die sächsische Landeshauptstadt. Hier, auf dem „Balkon Dresdens“, liegt Ihnen die Stadt zu Füßen. Wer verweilen möchte, um diesen Blick bei vorzüglichen Speisen und Getränken ausgiebig zu genießen, findet im Restaurant „Luisenhof“ an der Bergstation der Standseilbahn eine erste Adresse. Direkt unter Ihnen überspannt das berühmte „Blaue Wunder“ als eine der 6 Dresdner Elbbrükken die Elbe. Es verbindet den Körner- mit dem Schillerplatz. Von deren alten Backsteinfassaden geht ein außergewöhnlicher Reiz des alten Dresden aus. Bereits die Fahrt mit der Standseilbahn ist ein ganz besonderes Erlebnis. Denn vom Fuße der Elbhänge aus ist das Tal zwischen den Stadtteilen Weißer Hirsch und Oberloschwitz gar nicht wahrnehmbar. Erst wenn man in der Bahn Platz genommen hat und aus dem Tunnel der Talstation taucht, fällt es auf. Dann fährt man vorbei an der Rothen Amsel, einer Mühle im altdeutschen Stil, 1880 erbaut und tief im Taleinschnitt liegend. Und schon wird der Wagen weiter nach oben gezogen und begegnet dem talwärts fahrenden. An einer Ausweichstelle in der Mitte der Strecke treffen sich die beiden Wagen auf der sonst eingleisigen Strecke. Die Bergstation ist gleichfalls der Ausgangspunkt für einen Spaziergang durch das schöne Villenviertel und die hier beginnende Dresdner Heide. Hier oben liegen auch die Dresdner Elbschlösser, Musterbeispiele des Historismus: Schloss Albrechtsberg, die Villa Stockhausen – auch Lingner-Schloss genannt – und schließlich das Schloss Eckberg. Im Jahr 1895 eingeweiht, wurde die Bahn ursprünglich mit vier Personen- und zwei Güterwagen betrieben. Seit 1945 sind nur noch zwei Personenwagen im Einsatz. Im Unterschied zur Bergschwebebahn wird die Standseilbahn ausschließlich von der Bergstation aus gesteuert. Auf ihrer Fahrt passiert sie zwei Tunnel (96 m und 54 m) und überquert ein Brückenviadukt (102 m). Um die eingleisige Strecke gleichzeitig in beide Richtungen – bergauf und bergab – betreiben zu können, wurde eine so genannte Abt'sche Ausweiche eingerichtet. Ab 1960 wurde die erste deutsche Standseilbahn nach und nach modernisiert, 1993/94 fand eine umfassende Rekonstruktion statt. Höhenunterschied: 95 Meter Max. Neigung: 29 % Spurweite: 1000 mm Maximale Geschwindigkeit: 5 m/s Seillänge: 578 Meter 80 Tag 3 Zeitplan Samstag, 27.09.08 08.00 Uhr Frühstück und Auschecken 09.00 Uhr Fahrt nach Leipzig 10.15 Uhr Galerie für zeitgenössische Kunst – GfZK 1 + 2 Architekten: Bruno Eelbo, 1893, Peter Kulka, 1998, as-if Arch., 2004 mit Bus Karl-Tauchnitz-Straße 9–11 11.00 Uhr Zu Fuß zum Musikerviertel 11.15 Uhr Besichtigung Stadtvillen im Musikerviertel Architekten: König Wanderer, Fuchshuber + Partner u.a. Haydnstraße, Robert-Schumann-Straße u.a 11.45 Uhr Weiterfahrt zum Café Grundmann 12.00 Uhr Mittagessen im Café Grundmann mit Bus August-Bebel-Straße 2/Mahlmannstraße 16 13.15 Uhr Weiterfahrt zu den Buntgarnwerken 13.30 Uhr Besichtigung der Buntgarnwerke mit Bus Nonnenstraße Atrium, Lofts am Elsterufer Architekten: Fuchshuber + Partner Holbeinstraße Wohnprojekt Sweetwater Architekten: Weiß + Volkmann Holbeinstraße 14.15 Uhr Weiterfahrt nach Plagwitz 14.30 Uhr Besichtigung der Baumwollspinnereigebäude Architekten: Ottomar Jummel, Händel + Franke mit Bus Spinnereistraße 7 15.00 Uhr Weiterfahrt zur Konsumzentrale 15.15 Uhr Besichtigung Konsumzentrale Architekt: Fritz Höger mit Bus zu Fuß weiter Industriestraße 85–95 15.45 Uhr Besichtigung Stelzenhaus Architekten/Umplanung: Weiß + Volkmann Weißenfelserstraße 65 16.15 Uhr Weiterfahrt nach Lößnig 16.45 Uhr Besichtigung Rundling in Lößnig Architekt: Hubert Ritter, 1929/30 Führung: Dipl.-Ing. Ines Gillner, Leipziger Wohnungs- + Bauges. mbH mit Bus Siegfriedplatz 17.15 Uhr Weiterfahrt zur LWB vorbei am Völkerschlachtdenkmal 17.45 Uhr Vortrag „Stadtumbau Ost“ Dipl.-Ing. Ines Gillner, Leipziger Wohnungs- + Baugesellschaft mbH/LWB mit Bus Pragerstraße 21 18.00 Uhr Fahrt zum Renaissance Hotel Leipzig 18.30 Uhr Einchecken Renaissance Hotel Leipzig Großer Brockhaus 3, 04103 Leipzig 19.30 Uhr Spaziergang zum Restaurant Alte Nikolaischule 20.00 Uhr Abendessen im Restaurant in der Alten Nikolaischule Architekten: Storch, Ehlers + Partner Nikolaikirchhof 2, 04109 Leipzig, Telefon 0341/211 85 11 Zu Fuß zuruck zum Hotel mit Bus 82 Galerie für Zeitgenössische Kunst Karl-Tauchnitz-Straße 9–11 Architekt: Bruno Eelbo, 1893, Peter Kulka, 1998, as-if Architekten, 2004 GfZK 1 Der bekannte Geologe Hermann Credner, Professor in Leipzig, ließ sich 1893 durch den Architekten Bruno Eelbo die stattliche Villa am Johannapark im Stile der italienischen Renaissance errichten. Nach seinem Tode übernahm sie im Jahre 1914 der Verleger der Leipziger Neuesten Nachrichten, Edgar Herfurth. Bis heute ist der Name Herfurthsche Villa in Gebrauch. 1994, dreieinhalb Jahre nach Gründung des Fördervereins, gewann der 1937 in Dresden geborene Architekt Peter Kulka den Wettbewerb für den Neubau der Galerie, die an der Wächterstraße vorgesehen war. Finanzielle Schwierigkeiten zwangen den Verein schließlich, die eigentlich für diesen Zweck völlig ungeeignete Gründerzeitvilla zur Galerie umzubauen. Die so genannte GfZK 1 befindet sich in der von Peter Kulka umgebauten und 1998 eröffneten Gründerzeitvilla, die 1999 mit dem Architekturpreis der Stadt Leipzig ausgezeichnet wurde. Peter Kulka nahm bei seinem Umbau weitgehend auf die repräsentative, architektonische Struktur der Villa Rücksicht, straffte diese, behielt die Raumfolgen bei und erweiterte diese um Durchblicke und Sichtachsen im Inneren. Die Räume selbst sind klar gestaltet, die architektonischen Details reduziert, bis auf drei Räume (Salon Credner, Salon Herfurth, Café) wurde die Villa entkernt. Innen folgte Kulkas Gebäude dem Konzept des White Cubes. Er schuf Räume, die die volle Konzentration auf Kunst und deren ästhetische Qualitäten ermöglichen sollen. Der Anbau von Kulka setzt sich kontrastreich vom Jahrhundertwendebau ab. Architekt: as-if Architekten, Paul Grundei, Stephanie Kaindl, Christian Teckert, Berlin GfZK 2 Kleines Gebäude, große Themen: Nichts weniger als die Zukunft des Kunstmuseums, die Kritik am System der Architektenwettbewerbe und die Frage, was eigentlich „Flexibilität“ in der Architektur bedeuten kann – das sind die drei großen Themenfelder, auf denen die junge Architektengruppe as-if mit ihrem Erstlingswerk erfrischend radikale Positionen einnimmt. Dazu gehört Mut, ein solides intellektuelles Rüstzeug, vor allem aber ein Bauherr, der Experimente nicht nur duldet, sondern dazu anstiftet. Barbara Steiner, die Direktorin der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig (GfZK), hat die Bauherrenrolle sogar in einer Weise ausgedehnt, dass einem im Baugewerbe kein so recht passender Begriff einfallen will. Im Filmgeschäft würde sie im Abspann als Produzentin auftauchen (die Architekten wären die Regisseure), womit ihre Tätigkeit weitaus besser beschrieben wäre. Zu den ungewöhnlichen Konstellationen dieses Projekts gehört seine Vorgeschichte. Im Jahr 1990 geht aus dem „Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im Bundesverband der Deutschen Industrie“ die Initiative hervor, in Leipzig ein Zentrum für Gegenwartskunst zu etablieren. Treibende Kraft ist der Industrielle und Kunstmäzen Arend Oetker. Im Jahr 1994 findet ein Architekturwettbewerb zur Errichtung permanenter Ausstellungsräume statt, den der Kölner Architekt Peter Kulka gewinnt. Vier Jahre später ist der Umbau der ehemaligen Villa des Zeitungsverlegers Paul Herfurth abgeschlossen. Als im Jahr 2001 die österreichische Kunsthistorikerin Barbara Steiner die Leitung übernimmt, hat die GfZK bereits einen überregionalen Ruf als Ausstellungsort für Gegenwartskunst erworben. Kurz darauf stellte ein sächsischer Minister ihr unverhofft 2,5 Mio. Euro für die Erweiterung der Villa in Aussicht. Normalerweise hieße das: Es findet wieder ein Architekturwettbewerb statt. Doch durch die Umwandlung der GfZK in eine autonome Stiftung wurde das Verfahren der öffentlichen Hand entzogen und die Direktorin konnte die Architektengruppe as-if mit einem Direktauftrag ausstatten. Im Gespräch erklärt sie, dass Wettbewerbe nicht grundsätzlich abzulehnen seien. In diesem Fall aber waren ihre Vorstellungen eines zeitgenössischen Kunstraums bereits so weit ausformuliert, dass es ihr sinnvoller erschien, ohne Jury und großes Verfahren ein Büro auszuwählen und den Bau gemeinsam zu entwickeln. Den Einwand, das Instrument des Architekturwettbewerbs werde von Architekten als demokratische Errungenschaft hochgehalten, will die Direktorin nicht gelten lassen: Die Geschichte der GfZK habe gezeigt, dass der Erfolg des Ausstellungshauses von starken Einzelpersonen abhängig sei. Ein Wettbewerb wäre nicht demokratischer, sondern berge die Gefahr, dass eine formal exzentrische Lösung sich eher durchsetze als ein vielleicht unscheinbar erscheinendes Konzept, das aber weitaus intensiver die Anforderungen an einen Ausstellungsraum reflektiere. Da sie zuvor als Leiterin des Wolfsburger Kunstvereines bereits mit dem as-if-Teammitglied Christoph Teckert zusammengearbeitet hatte, einem Architekten, Künstler und Theoretiker, der dort eine erste Raumskizze realisieren konnte, waren ihre Präferenzen klar gesetzt. Autor: Oliver Elser erschienen in: Werner Durth: Architektur in Deutschland 2005, Deutscher Architekturpreis 2005, Stuttgart 2006 Bauwelt Preis 2007, aaa austrian architecture award, bau 2006, Auszeichnung zum Deutschen Architekturpreis, 2005 Architekturpreis der Stadt Leipzig zur Förderung der Baukultur, 2005 Quelle: www.architekturtexte.ch/www/home/overview Quelle Fotos: www.gfzk-online.de/de/ index.hp?menue=101 Mit der GfZK 2, dem Neubau der Galerie für Zeitgenössische Kunst, eröffnete 2004 ein neues Café. Das Konzept der wechselnden Gestaltung durch einen Künstler bzw. eine Künstlerin wurde auch in den neuen Räumen beibehalten. Nach Anita Leisz übernahm Jun Yang diese Aufgabe. Sein Café trägt den Namen „Paris Syndrom“. Dies charakterisiert ein Krankheitsbild japanischer Touristen, deren Sehnsucht nach Erfüllung ihrer Vorstellungen von Paris vor Ort enttäuscht wurde. Sie erleiden eine Art negativen Kulturschock, der nahe einer Traumatisierung ist. Der von Jun Yang gewählte Café-Name ist programmatisch für die gesamte Konzeption, steht diese doch für Wunsch und Sehnsucht bei einer gleichzeitigen Ernüchterung angesichts der Begegnung mit der jeweiligen Realität. Der Wunsch nach Unerreichbarem drückt ein Begehren aus, das sich nicht real einlösen lässt: Nachahmung und Nachbildung erzeugen ein Bild, eine Projektionsfläche für unerfüllte Sehnsucht. Die Sessel sind mit einem Louis-Vuitton-Imitat bezogen, pompös wirkende Lüster hängen an der Decke des Cafés, das mit Stuckelementen besetzt ist. Die Stühle erinnern an das Design von Charles und Ray Eames, die Fotografien an den Wänden zeigen berühmte Bauten der Architekturgeschichte, die an verschiedenen Orten der Welt nachgebaut wurden. Zeitschriften wie die französische „Vogue“ oder „Wallpaper“ liegen für die BesucherInnen aus und Coverversionen berühmter Songs rufen das Original ins Gedächtnis. Jeden Monat gibt es im „Café Neubau/Paris Syndrom“ die verschiedensten Veranstaltungen. Neben festen Formaten erhalten junge Bands, die vorwiegend aus dem Kunstkontext kommen, die Möglichkeit, ihre Musik zu spielen. Es finden Filmvorführungen und Lesungen statt. Quelle: www.gfzk.de Um zu verstehen, was den Bau von as-if nun tatsächlich und jenseits aller Theorie auszeichnet, ist ein kleiner Umweg in Form eines zehnminütigen Spaziergangs zu empfehlen. Denn ganz in der Nähe der Galerie ist nahezu zeitgleich das städtische Kunstmuseum fertiggestellt worden, der größte seit 1989 in den Neuen Bundesländern errichtete Museumsbau. Galerie und Museum stehen zueinander wie These und Gegenthese, Bau und Gegenbau. Am Sachsenplatz entstand eine pompöse, von den Berliner Architekten Hufnagel Pütz Rafaelian geplante Ruhmeshalle für die bedeutende Kunstsammlung der Stadt Leipzig, die zuvor im ehemaligen Reichsgericht untergebracht war, wo mittlerweile der Bundesgerichtshof residiert. Ein glasumhüllter Sichtbetonquader, der mit Lufträumen so verschwenderisch ausgehöhlt wurde, dass der Besucher sich fragt, wo denn eigentlich die Kunst abgeblieben ist. Die eigentlichen Ausstellungsräume sind zwar alles andere als bescheiden dimensioniert, doch sie fallen zunächst gar nicht auf, weil die Bauskulptur selbst alle Blicke aus sich zieht. Im Musikerviertel Leipzigs hingegen, in unmittelbarer Nähe zur Hochschule für Grafik und Buchkunst, der Geburtsstätte der „Leipziger Malerschule“, wurde für die GfZK ein Gebäude auf das parkähnliche Grundstück gesetzt, das von außen betrachtet als Schulerweiterungsbau aus den 1960er Jahren durchgehen könnte. Vom Boden ist es mit einer Fuge getrennt, als wäre die Konstruktion nur vorübergehend hier abgestellt worden. Statt pathetischer Gesten, die den Betrachter zu einem Winzling schrumpfen lassen, orientierten sich Architekten und Direktorin eher an den wohnzimmerhohen Räumen des dänischen Louisiana-Museums. Das Haus soll nicht überwältigen, sondern die Kunst aus der Sphäre der Hochkultur auf Augenhöhe herunterbringen. Der Feind heißt Erhabenheit, auch wenn er so scheinbar harmlos daherkommt wie im „white cube“, dem idealtypischen weißen Museumsraum der Moderne. Die Lösung des paradoxen Problems, für eine Institution ein neues Gebäude erreichten zu wollen, die ihrerseits für sich in Anspruch nimmt, „institutionskritisch“ zu sein, führt zu einem Innenraum, der den etwas ausgeleierten Begriffen der „Diskursivität“ und „Verhandelbarkeit“ überraschend neue Seiten abgewinnt: Mit einem verblüffenden Schiebewandsystem lassen sich für jede Ausstellung andere Wege, Belichtungssituationen und Raumstimmungen schaffen. Bis zu acht Meter lange Wandscheiben können verschoben werden, wodurch immer wieder neue Sequenzen und Zuordnungen entstehen. Es ist kaum fotografierbar, wie sehr sich der Innenraum dadurch ändert. Der Effekt ist so dramatisch, dass nur zu bedauern ist, dass die Wände nicht von den Besuchern bewegt werden dürfen. Nur wer zwischen zwei Ausstellungen die Möglichkeit hat, nach Herzenslust die Wände des leeren Gebäudes zu verschieben, der bekommt eine Ahnung davon, wie fundamental die Veränderungen sind, die das flexible Raumsystem hervorbringen kann. Wie alles an diesem Gebäude, ist auch seine Flexibilität in einen kleinen Theorieexkurs eingebettet: Denn hier wird nicht der neutrale, verwandelbare Raum auf Basis eines geometrischen Rasters angeboten, der beispielsweise im Pariser Centre Pompidou seinen Vorgänger hätte. Das Konzept erinnert eher an die Storefront Gallery von Vito Acconci und Steven Holl in New York (1993), wo der Ausstellungsraum zur Straße aufgeklappt und erweitert werden kann. In den unregelmäßigen Raumzuschnitten der GfZK steckt ein hohes Maß an künstlerischem Eigensinn. Zugleich aber erscheint die im Grundriss kaum nachzuvollziehende kristalline Raumstruktur in der Realität als völlig plausible Versuchsanordnung. Jede Position der Schiebewände ergibt eine neue Interpretation des Ausstellungsraums. Eine andere Referenz des Projekts sind die Pavillons des Künstlers Dan Graham. Auch in der GfZK überlagern sich die Spiegelungen in den Glasflächen und lassen Ausstellungsräume, Café und Kinosaal ineinander fließen. Statt den Blick durch Achsen zu bändigen, schweift er herum wie in einem Kaleidoskop. 85 KPMG Leipzig Beethovenstraße 1 Schneider und Schumacher Architekten, 1996/97 Das sechsgeschossige Gebäude für die KPMG in Leipzig befindet sich in einem gründerzeitlich geprägten Viertel südlich des Stadtringes. Zwischen Beethovenstraße und der mittelalterlich geprägten Münzgasse entstand auf einem spitzwinkligen Eckgrundstück ein Stahlbetonskelettbau mit Ganzglasfassaden, dessen geschwungener kristalliner Bug die erkerartigen Ausbildungen der umgebenden Gebäude modern interpretiert. Die flächenbündige Glasfassade zur Münzgasse lässt den Mittelteil der Gebäudefront zur überdimensionalen Vitrine werden und verbindet so den Platzraum mit dem Atrium des Gebäudes. Zwischen der doppelverglasten Außen- und der einfachverglasten Büroraumfassade öffnet sich die interne Halle, in welcher eine filigrane Erschließungsstruktur mit brückenähnli- chen Übergängen zu den Bürobereichen, eine spektakuläre Treppe und zwei gläserne Aufzugsschächte angeordnet sind. Durch den Lichthof sind Büroetagen von außen erkennbar. Die Anbindung an die Massivbauten der Münzgasse erfolgt durch eine Übergangszone aus halbtransparenten Paneelen und verschließbaren Sonnenschutzelementen. Das Zentrum des Gebäudes bildet das durch alle Geschosse reichende Atrium, das sich in der Detailbehandlung von Laufebenen, Treppen, Geländern usw. durch Transparenz und Geradlinigkeit, asketische Strenge und Klarheit auszeichnet. Galerie: Bildarchiv © Joerg Hempel Photodesign Quelle: http://joerg-hempel.com/gallery/A501 86 Stadtvillen im Musikerviertel Auf dem Unkrautgelände hinter dem einstigen Gästehaus für DDR-Funktionäre, auf dem früher Hubschrauber landeten, entsteht wieder ein Wohnareal. Das erste realisierte Gebäude ist die Stadtvilla von König Wanderer Architekten. Das Objekt entstand als erstes im Rahmen des städtisch initiierten Selbstnutzerprogramms auf dem Gelände, auf dem vor dem Krieg Gründerzeithäuser standen. Gemäß Bebauungsplan der parzellierten Gästehauswiese aus den 90er Jahren müssen die Häuser an der Grenze zum Bürgersteig stehen, im Abstand von 6 m zum nächsten Gebäude. Das Verhältnis von Wand- und Fensterflächen war festgelegt. Inzwischen sind einige dieser Stadtvillen mit unterschiedlicher Formensprache entstanden. Ambitionierte Entwürfe für weitere Stadtvillen werden auf großen Schildern auf verschiedenen Grundstücken am Rande der Wiese beworben. Investierwillige Bauherren, die sich für kühne, kubische, moderne Architektur interessieren sind rar. Architekten, die selbst als Bauträger auftreten können, hätten es auch hier leichter, anspruchsvolle Entwürfe zu verwirklichen. König Wanderer Architekten Der Wegweiser für die Zukunft der Gästehauswiese könnte die Haydnstraße 11–15 sein. In Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt entstand in 2003 das Konzept: ein Stadthaus für drei Familien. Der kompakte Baukörper mit der dunklen Klinkerfassade, die in verschiedenen Schieferfarben schimmert, wirkt wie ein moderner Monolith – Kontrapunkt zu Gründerzeithäusern und Plattenbauten in der Nachbarschaft. Die Ziegel bilden an allen vier Seiten die Haut des Monolithen, der sich zur Straße und zur Wiese öffnet und zu den Nachbarhäusern hin weitestgehend geschlossen bleibt. Zur Wiese hin bestehen die Ausfachungen in den Ziegel verkleideten Rahmen aus großzügigen erdfarbenen Holz- und Glaselementen, zur Straße hin sind sie dunkel. Die Wohneinheiten sind 5 m breit und umfassen vier Etagen. Die Deckenfelder im oberen Bereich sind zum Teil herausnehmbar, um die Wohnungen nach oben erweitern zu können. Schmale Treppen, klare Grundrisse, bündige Fensterund Türrahmen bestimmen das Bild. Schiebetüren und Einbauschränke sind ebenfalls von den Architekten entworfen. Das Haus ist mit Erdwärmesonden ausgestattet und für einen Aufzug vorgerüstet. Die notwendigen Stellplätze sind unter der 5 m tiefen Auskragung im Eingangsbereich platziert, die von vielen Bewohnern stattdessen als offener Fahrradabstellbereich genutzt wird. Die Architekten hoffen, dass es eine Art Bauaustellung wird. Keine beliebige Architektur, sondern ein Ensemble moderner Bauten, die sich klar positionieren. www.koenigwanderer.de www.fuchshuberpartner.de Fuchshuber + Partner Für die Bebauung des Eckgrundstückes Ferdinand-Rhode-Straße/Robert-Schumann-Straße im Musikerviertel von Leipzig haben sich zwei Bauherren gefunden gemeinsam die Bauaufgabe durchzuführen. Aus den Anforderungen des B-Planes heraus ist für dieses Grundstück ein Gebäude vorgesehen. Auf Grund der Größe wurde das Flurstück geteilt und es entstanden zwei Häuser in der Gesamterscheinung als eines. Die Nutzung der Gebäude erstreckt sich gemäß den Vorgaben an die Geschossigkeit über vier Ebenen, wobei das Erdgeschoss den Nebenräumen und Technik/Garage vorbehalten ist und die Wohnräume sich in den Obergeschossen befinden. Die Wohn- und Schlafebenen der beiden Nutzungseinheiten sind im Wechsel im 1. bzw. 2. Obergeschoss untergebracht. Die Dachterrassen mit angrenzendem Studio bilden jeweils den oberen Abschluss. Den Komfort zur Verbindung der Etagen bietet jeweils ein Aufzug. Bei der individuell auf die speziellen Bedürfnisse abgestellten Planung der einzelnen Grundrissebenen wurde auch im Hofbereich mit der Privatsphäre der Nutzer sensibel umgegangen. Die Gebäude sind in massivem Mauerwerk mit Wärmedämmung als Niedrigenergie- bzw. Passivhaus errichtet worden. Das sich in Fertigstellung befindliche Gebäude fügt sich eigenständig in die umliegende, offene Bebauungsweise ein. Durch das gemeinsame Entwickeln eines Gebäudetyps auf zwei in sich verschränkten Grundstücken ist der Spagat zwischen den planerischen Eckpunkten und einer großzügigen Bebauung gelungen. EG 1. OG 2. OG 3. OG 90 Café Grundmann August-Bebel-Straße 2/Mahlmannstraße 16 Das 1880 errichtete Wohngebäude bildet den Auftakt der noblen Bauten in der August-Bebel-Straße, die zu den schönsten Ensembles des Historismus und des Jugendstils in Leipzig gehört. Hier befindet sich das interessanteste Café-Interieur der Stadt Leipzig. Die im Original erhaltene Art-déco-Ausstattung stammt aus dem Jahr 1930. Der damalige Besitzer des typischen Wiener Cafés, der Konditormeister Lutze, ließ in diesem Jahr die edle hölzerne Wandverkleidung und die Stuckdecke einbauen sowie das heute noch im wesentlichen erhaltene Mobiliar aufstellen. Seit dem Jahr 1919 wird das Café ununterbrochen von Konditormeistern bewirtschaftet. Sowohl die immobile Ausstattung, d.h.: Decke, Wände etc., als auch die Möblierung wurden nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten restauriert. Besonderen Reiz bezieht das Interieur aus der Verwendung der Satin-Holz-Verkleidung der Wandflächen, die horizontalen Gliederungen sind dagegen aus Mahagoni gearbeitet. Satin-Holz ist eine ältere Modebezeichnung für eine Gruppe tropischer Hölzer, die in den 1920er Jahren gern verwandt wurden. Das Café ist seit dem Jahr 2000 nach seinem neuen Besitzer Eckehart Grundmann benannt. Bemerkenswert feinfühlig sind die neuen Radleuchter im Restaurantraum durch den Leipziger Künstler Stefan Francik als gelungene Art-déco-Adaption gestaltet. Quelle: www.cafe-grundmann.de 91 Industriearchitektur in Plagwitz In Leipzigs Westen hat sich mit dem Stadtteil Plagwitz ein ca. 90 Hektar großes Flächendenkmal der Industriearchitektur erhalten, das seinesgleichen sucht. Es war das erste planmäßig entwickelte, großräumige Industriegebiet Deutschlands. Das deutsche Unternehmertum ist eng mit der Geschichte von Plagwitz verbunden und wurde erheblich vom Gutsbesitzersohn und Rechtsanwalt Dr. Carl Erdmann Heine (1819–88) geprägt. Durch sein Engagement in den Jahren zwischen 1840 und 1880 wurde Leipzig zum Vorreiter der deutschen Industrialisierung. Schon früh zeigte sich Heine von der damals noch revolutionären Eisenbahn sowie der wirtschaftlichen Nutzung von Wasserwegen begeistert. So handelt es sich bei dem 1873 eröffneten Bahnhof Plagwitz-Lindenau um den ersten Industriebahnhof Europas. Heines Visionen ermöglichten den Bau eines Kanals, der zur Schaffung einer Schifffahrtsstraße von Leipzig nach Hamburg führen sollte. Ziel war, die in Leipzig produzierten Industriewaren über den Hamburger Hafen weltweit abzusetzen. Der Visionär erwarb in Plagwitz große Wiesen und Ackerland und nutzte diese für Wohnungsbau und Industrieansiedlung. Er legte das sumpfige Gebiet trocken und regulierte Wasserläufe. Weiterhin engagierte sich Heine stark für die Ansiedlung von Industrieunternehmen und kümmerte sich um deren Anbindung an die Wasserwege bzw. an das Schienennetz. Die Kombination von Wohnquartieren und Arbeitsstellen war einmalig und verhalf der Industrie – in Verbindung mit den idealen Transportwegen – zum stürmischen Aufbruch. Ab 1920 ließen Rüstungsindustrie, Aktienspekulation, Krieg und wirtschaftlicher Verfall der sozialistischen Planwirtschaft den Industriestandort immer mehr ins Hintertreffen geraten. Nach der Wende 1989 erfolgte endgültig der Niedergang von Plagwitz, das im Zweiten Weltkrieg nur geringfügig beschädigt wurde. Nachdem fast eineinhalb Jahrhunderte die Schornsteine geraucht hatten, folgte die Deindustrialisierung im Zeitraffer. Die Betriebe wurden liquidiert, die Bevölkerung wanderte ab und es kam zu hohem Leerstand und Abrissen. Über 90.000 Industriearbeitsplätze gingen in Leipzig verloren, davon ein großer Teil in Plagwitz. Der Stadtteil wurde totgesagt und schien endgültig dem Verfall preisgegeben. Gespenstische Häuser, leere Fabrikgebäude, vom Gras überwucherte Bahngleise und verschmutzte Gewässer prägten dessen Image. Nun waren abermals Visionen gefragt. Eine neue Gründerzeit begann. Die Baudenkmäler sowie die Gewässer und Gleisbogen, die in ihrer Gesamtheit den einzigartigen Charme von Plagwitz ausmachen, sollten renoviert und rekonstruiert werden. Die Stadt und zahlreiche Investoren starteten ein umfangreiches Aufbauprogramm. Im Jahr 2000 erhielt Plagwitz als externer Standort der Hannoveraner EXPO unter dem Motto „Plagwitz auf dem Weg ins 21. Jahrhundert – Quelle: www.leipzig.de Was für Hamburg die Speicherstadt, das ist für Leipzig – industriearchitektonisch gesehen – der Stadtteil Plagwitz mit seinen Fabriken der Jahrhundertwende. 1989, im Jahr der Wende, hatte Plagwitz 37.000 Bewohner. Von den etwa 800 hier vorhandenen Betrieben waren rund 40 Großbetriebe. Der Niedergang der Industrie, der Verfall der Stadt, eine extreme Umweltbelastung – dies alles waren Indizien für das Ende des Sozialismus. In Plagwitz wurden sie auf besonders deprimierende Art erlebbar. Mit dem fast völligen Wegbrechen der Industrie nach 1990 entstand eine städtebauliche Situation, die kaum Zukunftschancen in sich zu bergen schien. Auch die heruntergekommene Wohnbebauung schien in dieser unwirtlichen Umgebung wenig Sanierungsaussichten zu haben. Wer heute Plagwitz durchstreift, wird verblüfft sein. Nicht nur viele Wohnhäuser, sondern auch eine große Zahl von Industriebauten ist heute schon Instand gesetzt und neu genutzt. Diese Entwicklung ist geprägt von modernisierten Wohnungen der Wilhelminischen Epoche, von umgenutzten Industriearchitekturen und künftig auch von neuem Großgrün auf den von Karl Heine weitsichtig angelegten, künftig aber nicht mehr benötigten Gleisschneisen, deren Schienenstränge das Gebiet kammartig erschließen. Insbesondere die teils großartigen Industriebauten prägen das architektonische Milieu dieses Stadtteils. Quelle: Leipzig, Architektur von der Romanik bis zur Gegenwart, Wolfgang Hocquél, Passage Verlag, 2. Auflage Ein Stadtteil im Wandel“ weltweite Aufmerksamkeit und damit einen deutlichen Entwicklungsschub. Glücklicherweise überdauerten die meisten Bauensembles der Gründerzeit und der frühen Moderne die schwierigen Jahre und entfalteten nach ihrer Restaurierung bald den Reiz einer untergegangenen Welt. Heute kann man ehrfurchtsvoll die prachtvollen Backsteinbauten sowie die beeindruckenden Brücken über den Karl-Heine-Kanal bewundern, die Leipzig zur Hafenstadt machen sollten. In ehemaligen Fabrikhallen sind exklusive Lofts entstanden, in deren Höfen dank Wurzelheizung exotische Palmen gedeihen. Architektonisch bedeutsam sind u.a. die im Jahr 1866 gegründete „Wollgarnfabrik Titel & Krüger” (Nonnenstraße/Elsterstraße), das 1928 nach Entwürfen des Hamburger Architekten Fritz Höger erbaute Verwaltungsgebäude der Leipziger „Konsum-Zentrale” (Industriestraße 85–95) – eine grandiose Symbiose von Backsteinexpressionismus und Neuer Sachlichkeit – die 1880 gegründete „Maschinenbaufabrik Unruh & Liebig” (Naumburger Straße 28) und die zwischen 1879 und 1925 in der Nonnenstraße errichteten „Buntgarnwerke” – eines der größten Gründerzeitdenkmale Deutschlands. Wer eine Bootstour auf dem KarlHeine-Kanal macht, dem wird mit Sicherheit ein widerspenstiges Gebilde ins Auge fallen: Das 2003 nach einem Umbau eröffnete „Stelzenhaus” (Weißenfelser Straße) – ein ehemaliges Wellblechwalzwerk der Firma „Grohmann & Frosch” – wurde aufgrund Platzmangels Ende des 19. Jahrhunderts an einer Kanalbiegung errichtet. Getragen wird das streng funktionalistische Gebäude von wuchtigen Betonstützen. Die Entwicklung Plagwitz von einem Dorf zum Industriestandort lässt sich vier Epochen zuordnen: Die Industrialisierung 1840–70, Welthandel und Gründerboom von 1870–1918, Weltwirtschaftskrise und Kriegsmaschinerie von 1920–45, Aufstieg und Fall als Industriestandort nach dem Neubeginn von 1945–89. Das brache Industrieviertel hat sich inzwischen zu einem modernen, grünen, sozial verträglichen und begehrten Quartier für Wohnen, Arbeit und Freizeit umgewandelt, das in Deutschland seinesgleichen sucht. 93 Buntgarnwerke Architekten: Ottomar Jummel und später Händel & Franke, 1879–88 Die Buntgarnwerke Leipzig GmbH entstand 1990 aus der Umwandlung des Volkseigenen Betriebes Buntgarnwerke Leipzig, einem Textilkombinat mit 3 Standorten in Sachsen. In den Folgejahren wurde die Produktion nach Tschechien verlagert und die deutschen Standorte umgewidmet. Der Elster-Park in Leipzig ist mit seinen 100.000 m2 Brutto-Geschossfläche Europas größtes Industriedenkmal aus der Gründerzeit. Wasser durchzogen und zentral gelegen zählt er zu den aus zahlreichen Fernsehfilmen und Presseveröffentlichungen bekannten Sehenswürdigkeiten der Stadt Leipzig. Die Front an der Elsterseite der Nonnenstraße ist etwa 250 m lang und wird von mehrgeschossigen Spinnereigebäuden gebildet. Bemerkenswert ist der markante, kuppelbekrönte Turm am Haupteingang. Die kräftige Gliederung der Klinkerarchitektur durch helle, horizontale Putzstreifen und Natursteinelemente lässt den Bau ungewöhnlich gewaltig erscheinen. Die Anlage wirkt trotz der zeitlich weit auseinander liegenden Bauabschnitte insgesamt dennoch sehr einheitlich. Auch das 1922/23 gebaute Kesselhaus passt sich dem vorgegebenen Gründerzeitstil an. Der linke, östliche Eingang der Nonnenstraße ist von einem Vordach auf hohen schlanken Pfeilern betont. Vielfach ausgezeichnet gehörte der Elster-Park nicht nur zum weltweiten Themenpark der Expo 2000, sondern wurde auch in das Bewerbungskonzept zur Olympiade 2012 aufgenommen. In 2006 wurde das Ensemble dem internationalen DIFA Award (Platz 3) ausgezeichnet. Der Elster-Park liegt 1,5 Kilometer vom Rathaus und der Innenstadt entfernt am Nonnenpark. Vom Karl-Heine-Kanal und der Weissen Elster durchzogen bildet er ein Quartier, das seinesgleichen sucht. Sie finden dort heute u. a. Restaurants, Szenebars und eine Tanzschule, Loftbüros von 50 bis 5.000 m2, Wohnungen und ein Boardinghaus, Handel und Dienstleistungen, Ärtzehaus mit Apotheke. 1866 Gründung der Seiden-, Garn- und Tapisseriewarenhandlung C.A. Tittel am Markt 19 1869 Herr A. A. Krüger wird Teilhaber 1875 Erwerb des Grundstücks in Plagwitz in der Nonnenstraße 1878 Errichtung einer Fabrikation von Tapisseriewaren 1887 Gründung der „Sächsischen Wollgarnfabrik Tittel & Krüger Aktiengesellschaft“ 542 Beschäftigte produzieren 600.000 kg Tapisseriegarne im Jahr 1888–98 Bau weiterer Spinnereigebäude in Backsteinarchitektur mit dekorativer Natursteingliederung 1901 Umsatz des Betriebes bereits über 12 Mio. Reichsmark 1906–08 Verlegung der Berliner Filiale nach Leipzig, Bau des 2.Abschnittes auf der Schleußiger Uferseite (Hochbau Süd) 1911 etwa 2.000 Arbeiter und Angestellte 1923 noch etwa 1.000 Beschäftigte um 1926 Übernahme der Gebäude der Firma Phil. Penin in der Nonnenstraße 42/44, gegründet 1878 1938 Der Umsatz beträgt 25 Mio. RM, der Reingewinn 1,4 Mio. RM 1951 Die Wollgarnfabrik wird Treuhandbetrieb des Rates der Stadt 1950–52 Nach Einstellung der Produktion von Handstrickgarnen beginnende Vermietung umfangreicher Produktionsräume 1952–90 VEB Leipziger Wollgarnfabrik, anschließend Verschmelzung zur Mitteldeutsche Kammgarn, ab den 70er Jahren VEB (volkseigener Betrieb) Buntgarnwerke Leipzig 1990 Umwandlung des VEB Buntgarnwerke Leipzig in Buntgarnwerke Leipzig GmbH 1991 Verlagerung der Produktion von Sachsen nach Tschechien 1992 Privatisierung Quellen: Unterlagen des Sächsischen Staatsarchivs Leipzig, www.buntgarnwerke.de/html/historie.html 94 Lofts am Elsterufer Holbeinstraße Gregor Fuchshuber & Partner Für die verschiedenen Baukörper der ehemaligen Buntgarnwerke existierten seit der Aufgabe des Betriebes im Jahr 1991 die unterschiedlichsten Nutzungskonzepte. Letztendlich wurde für den Hochbau Süd ab 1998 die nunmehr fertig gestellte Umnutzung in ein Wohngebäude realisiert. Gestalterisch und entwurfstechnisch wurden dabei in vielfältiger Hinsicht neue Wege beschritten: Ziel war, die Außenhülle mit ihrer Fenstergestaltung, die durch Kriegseinwirkung und Nachkriegsreparaturstau weitgehend vermauert waren, wiederherzustellen und gleichzeitig im Inneren für die Wohnnutzung angemessene Belichtung und Belüftung herzustellen. Darüber hinaus sollten, soweit vorhanden, die originalen Ausstattungsdetails (Tore, Treppenhäuser, Decken) weitestgehend erhalten bleiben. Auch der bauliche Charakter des Fabrikgebäudes und insbesondere die technisch extrem anspruchsvolle, gewölbte Stahlbetondeckenkonstruktion blieben im Neubau unverändert sichtbar. In die etwa 5 m hohen Fabriketagen wurden mehrgeschossige Wohneinheiten eingefügt, die funktional und gestalterisch überzeugen und am Markt gut angenommen werden. Der Gebäudeteil Hochbau Süd der Buntgarnwerke ist in einer Eisenbetonkonstruktion 1906 in Straßburg durch die Firma Züblin geplant worden. Hinter einer konventionellen Ziegelfassade mit dekorativen Putzbändern verbirgt sich ein für die Bauzeit hochmodernes Stahlbetonskelett mit 2-schaligen Decken. In die ehemals ca. 40 m breiten und 100 m langen Industriehallen wurde zur Belichtung der errichteten Wohneinheiten ein Innenhof eingeschnitten. Die ca. 5 m hohen Räume wurden innenhofseitig durch eine Galerie unterteilt und verfügen im Gegensatz zur geräumigen Wohnhalle fassadenseits über eine gegliederte Zimmerstruktur nach Wunsch des Nutzers. Der Zugang erfolgt über die nach innen auskragenden Laubengänge. Der filigrane Aufzugsturm, der sowohl die Erschließungslaubengänge, als auch die metallenen Fluchtstege auf den Zwischenebenen anbindet, ist gestalterisch das bestimmende Element des Innenhofes. Die originalen Ausstattungsdetails Tor, Verblechungen und Schmuckelemente wurden originalgetreu wiederhergestellt. In den Treppenhäusern wurden ebenfalls die originalen Geländer modernen Sicherheitserfordernissen angepasst und mit Handläufen versehen. Insbesondere auf die Ausbildung der Putzschalen wurde großer Wert gelegt. Der Charakter des Industriebaus bleibt spürbar. Im Inneren der Wohnungen ist klar abzulesen, was originaler Bestand und was Neuzufügung ist. Die Decken sind unverputzt, die originale Schalungsstruktur ist sichtbar. Die Wohnungstrennwände wurden in sichtbar belassenem Kalksandstein-Fasenmauerwerk ausgeführt und farblich vom Altbestand abgesetzt. Darüber hinaus wurde bei der Materialauswahl und bei der Wahl der Formensprache Wert darauf gelegt, einen Einklang zwischen der funktionalen, vorgefundenen Architektursprache und einer möglichst klaren, stringenten Lösung der Neueinbauten zu finden. 95 Sweetwater Stadthäuser an der Weißen Elster, Fertigstellung 2006 Architekten: Weis & Volkmann Architektur mit Ernst Scharf, Arch 42 www.leipzig.de/de/buerger/stadtentw/projekte/wettbewerb/architektur Im Kontext des Umbaus der Stadt Leipzig von der hochverdichteten Industriestadt zum urbanen Wohnort stellt das Projekt „Sweetwater“ ein bemerkenswertes Beispiel vor: Hier wurde ein Grundstück entwickelt, das groß genug ist, ein kleines Wohnquartier am Wasser ins Leben zu rufen. Obwohl die Grundstücksfläche mit an angelsächsischen Vorbildern orientierten Reihenhäusern gut ausgenutzt wird, bleibt dennoch auch ausreichend Raum für private und öffentliche Freiflächen. Dabei ist insbesondere hervorzuheben, dass durch die Anordnung und Proportionierung der Bauten auch bestehende Räume abgerundet und akzentuiert werden und ein neuer kleiner Stadtplatz als Quartierszentrum eingefügt wurde. Das „Sweetwater“ bildet mit seinen dreigeschossigen Zeilenbauten in der Nachbarschaft massiver Industriebauten aus dem 19. Jahrhundert natürlich eher einen Fremdkörper. Aber es gelingt, eine neue Stadtinsel zu bilden, die in sich schlüssig ist, ein attraktives, alternatives Wohnangebot macht und sich offen in das Gewebe der bestehenden Stadt integriert. Darüber hinaus bietet „Sweetwater“ wirtschaftlich erschwinglichen Wohnraum in einer sehr attraktiven zentralen Lage. Der Mut und Innovationswille der Architekten und vor allem auch der Entwickler ist vorbildhaft und soll mit einer Anerkennung gewürdigt werden. Lobende Erwähnung beim Architekturpreis 2007 der Stadt Leipzig. 96 Baumwollspinnerei Spinnereistraße 7 Mit der Produktion wuchs auch die Zahl der Menschen in der Spinnerei. Arbeiten in der Baumwollspinnerei hieß letztlich auch dort leben. So arbeiteten die Männer ca. 14, die Frauen ca. 11 Std. am Tag. Das nähere Umfeld der Spinnerei wurde Piependorf genannt. Die Frauen trugen alle Schürzen, lange Röcke und viele Kämme im Haar. Gegen Morgen, nach Austragung von etlichen Faustkämpfen, gab es dann „Kranke“ und „Verletzte“. Eine stichhaltige Begründung zum „Blaumachen“ war also gegeben. Wie gesagt, es war ja alles so billig. In den Mittagspausen, in welchen beim Pfeifer-Louis auch oft getanzt wurde, und zum Feierabend standen am Eingang zur Spinnerei die Straßenhändler und boten Apfelsinen, Bücklinge, oder auch Gipsfiguren und Textilien feil; es war alles da. Der Freitag war der große Tag. Mittags bekamen die Frauen ihren Lohn, zum Feierabend die Männer. Da wurde „gelebt“. Mittags lachten der Bäcker und der Obsthändler, am Abend die Gastwirte. Sonnabends hatte die Kantine die Ehre. Für ein Mark bekam man die halbe Welt. Die Piependorfer Eingeborenen lebten wie eine große Familie, keiner war reicher, keiner war ärmer als der andere. Sie vermehrten sich, rauften auch manchmal und standen vom Freitag bis Die Spinnerei ist eine historische Fabrikanlage, die in den Jahren 1884 bis 1907 zur größten kontinentaleuropäischen Baumwollspinnerei gewachsen war. Nach ihrer Gründung im Jahre 1884 wuchs im Westen von Leipzig eine regelrechte Fabrikstadt mit über 20 Produktionsgebäuden, Arbeiterwohnungen, Kindergärten und einer Erholungssiedlung heran. 1907 hatte die Fabrik ihre größte Ausdehnung erreicht. Auf rund 100.000 m² Bruttogeschossfläche wurde mit 240.000 Spindeln Baumwolle verarbeitet. Bis zu 4.000 Menschen haben hier bis 1989 im Drei-Schichtbetrieb gearbeitet. Nach der Wiedervereinigung wurde die Produktion eingestellt. Das eigentliche Fabrikgelände der Spinnerei mutet regelrecht wie eine kleine Fabrikstadt an. Es handelt sich um eine geschlossene Quartierbebauung auf rd. 6 ha Größe. Die Spinnerei ist eingegrenzt durch die Spinnereistrasse, die Thüringer Straße, die alte Salzstrasse und die Saalfelder Straße. Das Fabrikgelände zeigt sich nach Außen verschlossen und ist im Inneren bestanden mit 20 Einzelgebäuden. Neben den vier ehemaligen großen Spinnereien, heute die Hallen 7, 14, 18 und 20, gibt es weitere 16 ehemalige Funktionsgebäude. Von ursprünglich 24 Gebäuden sind diese noch erhalten. Fast alle Gebäude wurden als sehr massive Backsteinbauten errichtet. Der komplexe Erhaltungsgrad der historischen Bausubstanz hat nach dem Niedergang der Baumwollgarnproduktion in den frühen 90er Jahren eine langsame aber kontinuierliche Wiederbelebung und schonende Sanierung der Fabrik ermöglicht. Oft geht es sogar mehr ums Konservieren als ums Sanieren. Ein wichtiges Anliegen des Sanierungszieles ist es möglichst viel zu bewahren und trotzdem gute Bedingungen für die neuen Mieter zu schaffen. Sonntag unter dem Einfluß des Alkohols. Die Gegend war in Leipzig berüchtigt und deshalb gemieden. Nur die Friedhofsbesucher kamen und gingen. Wer Sonntags ausging nach der inneren Stadt, der musste sozusagen Spießrutenlaufen. In der Thüringer-Straße lugten tausend Augen, vom gewaltigen Betriebskrankenkassenmann Scheer bis zur letzten Hausfrau. Man mußte doch sehen, was die Vorübergehenden auf dem Leibe hatten. Ich sagte schon, es war eine ärmliche Welt. Die Romantik war geringer Natur, die Poesie kümmerlich. Und doch sah und hörte der Aufmerksame soviel, als er zu einem ganzen Roman brauchte. Es war ja doch der Abglanz der großen Welt von draußen. Bis 1899 waren ein Kindergarten und weitere Arbeiterwohnhäuser entstanden. Eine 21 Mann starke Musikkapelle und der „Männerchor Frohsinn“ wurden ins Leben gerufen und werden gerne zu betrieblichen Gelegenheiten herangezogen. 1903 setzt ein Streik den 10 Stunden Arbeitstag durch. www.spinnerei.de http://de.wikipedia.org/wiki/Leipziger_Baumwollspinnerei Künstler, die heute die neue Leipziger Schule prägen, fanden und finden bis heute die idealen Atelierräume und die nötige Ruhe für ihre Arbeit. Kreative wie Architekten, Drucker, Designer und Modemacher haben sich mit viel Eigeninitiative ihren idealen Lebens- und Arbeitsbereich geschaffen. Kleine Handwerksbetriebe sowie die verschiedensten Dienstleistungsbetriebe fanden in der Spinnerei das geeignete Umfeld. Gastronomie, Theater- und Tanzgruppen, Kunst- und Kulturinitiativen, kleine spezielle Läden und individuelle großflächige Wohnlofts bewirken neben der einzigartigen Architektur der komplexen Fabrikstadt den Charakter einer ausgesprochen charmanten Urbanität. Viele der heute weltbekannten Namen der Neuen Leipziger Schule waren die Pioniere der Revitalisierung. Inzwischen sind über die Hälfte aller Flächen wieder vermietet. Zu einem großen Schwerpunkt innerhalb der Spinnerei haben sich die Kunstproduktion, die Kunstpräsentation und der Kunsthandel entwickelt. Über 100 professionelle Künstler allein aus dem Bereich der bildenden Künste arbeiten in dem Areal. 13 Galerien und Ausstellungsflächen, Galerie EIGEN + ART, Dogenhausgalerie, Galerie Matthias Kleindienst, die Galerie b2, die maerzgalerie, ASPN, FRED London/Leipzig, Filipp Rosbach Galerie, PIEROGI Leipzig, Kavi Gupta Galerie (Chicago), LADEN FUER NICHTS und das kostendeckend arbeitende SPINNEREI archiv massiv sowie die Non-profit Fläche der Stiftung Federkiel in der Halle 14 präsentieren Kunst aus Leipzig und aus aller Welt. Abgerundet wird das Bild durch die Ansiedelung des Künstlerbedarfshandels boesner, der inzwischen zum wichtigen Versorger für die vielen Künstler am Ort geworden ist. 98 Konsumzentrale Sonderheft Expo 2000 - Auswahltext 2 Bernd Sikora Flaggschiff (gekürzter Text) Die Leipziger Konsumzentrale des Architekten Fritz Höger Eine interessante Verbindung zwischen dem Expo-Außenstandort Leipzig-Plagwitz und dem Zentrum der EXPO 2000, Hannover, bietet der Erweiterungsbau der Konsumzentrale in Leipzig-Plagwitz, der zwischen 1929 und 1933 vom Architekten Fritz Höger gebaut wurde. Den Auftrag für das Verlagshochhaus in Hannover erhielt Höger auch auf Grund des Ruhms, den er durch das Hamburger Chilehaus (1921–24) erlangt hatte: Hier hatte er gezeigt, dass er den „Geist des Ortes“ durch die dort spezifischen Gestaltungsformen und die gebietstypischen norddeutschen Klinker auf besondere Weise herausarbeiten konnte. Die an einen Schiffsbug erinnernde Ostseite des vielgeschossigen Chilehauses brachte für Höger und Hamburg ein höchst wirkungsvolles Markenzeichen. Andere vermögende Auftraggeber wollten diesen Effekt ebenfalls für sich nutzen. Für den von der norddeutschen Landschaft, ihrer Bautradition und ihrem Handwerk geprägten und mit expressiven Elementen des Art déco arbeitenden Höger ergab sich so für mehrere Jahre eine äußerst günstige Auftragslage. Es ist interessant, dass nach 1933 in Deutschland nicht nur die im Stil der internationalen Moderne tätigen Architekten, wie beispielsweise Walter Gropius und Erich Mendelsohn, sondern auch der sich auf die norddeutsche Klinkerarchitektur beziehende Höger (Goebbels fand seine Bauten „sowjetisch“) von der faschistischen Kulturpolitik abgelehnt wurden. Die Nazis bevorzugten an römischen und klassizistischen Architekturen orientierte Formen, wie sie bereits vor 1914 geschaffen worden waren. Doch zunächst waren es Högers Bauten in Hamburg und Hannover, die Anlass zur Einladung für die Teilnahme am Wettbewerb für den Erweiterungsbau der Leipziger Konsumzentrale boten. Höger gewann den 1. Preis und konnte in drei Baustufen seine Planung realisieren. Sicher waren es auch die Perspektivzeichnungen, die zum Wettbewerbserfolg Högers geführt haben, thematisierten sie doch das Motiv „Schiff“ gegenüber dem Chilehaus auf neue Weise als stromlinienförmig orientierte Schichtung der Decks eines Schiffs, das vorüberzieht. Der damals äußerlich relativ charakterlose Vorort Plagwitz befand sich im Aufbruch: Der Kanal sollte bis nach Hamburg geführt werden, und dafür wurde der Lindenauer Hafen ausgebaut. Tempo, zu erreichendes Ziel – diesen Gedanken griff Höger auf, ganz im Geiste des erfolgsorientierten Vorstands der Genossenschaft. Der italienische Höger-Monograph Piergiacomo Bucciarelli sieht in der 1992 erschienenen deutschen Übersetzung in der Konsumzentrale einen deutlichen Bezug zu Erich Mendelsohn und auch zum Roxy-Palast (1929) Martin Punitzers, „einem der repräsentativsten Beispiele der Berliner Neuen Sachlichkeit“. Der Besucher von Leipzig-Plagwitz findet mit der Konsumzentrale einen Bau, ohne dessen Reflexion der Blick auf die Architektur um 1930 und den Architekten Fritz Höger unvollständig wäre. Leipzig macht es dem Besucher heute auch leichter, Zugang zum Architekten und zu seinem Bau zu finden. Noch vor einem Jahrzehnt verband das Konsumareal 2 von maroden Gebäuden gesäumte Straßenschluchten. Nur wenigen mag bis zu dieser Zeit das Besondere der Klinkerfront mit den „Schüsselglas-Scheiben“ aufgefallen sein. Inzwischen ist gegenüber ein Stadtteilpark entstanden. Er führt bis zum Karl-Heine-Kanal, der nun- mehr wieder eine, wenn auch bescheidene, Personenschifffahrt ermöglicht und in unmittelbarer Nähe des Konsumbaus eine Anlegestelle erhalten wird. Nun stellt sich mit der gewonnenen Fernansicht der Sinnzusammenhang her, wird Högers inhaltlicher Entwurfsansatz erst verständlich: Das symbolträchtige Bild erinnert an Großraumfähren oder Containertransporter mit ihren aufgesetzten Führungsbrücken. Die Architektur ergibt sich aus der Funktion „Lagern und Verteilen“. Auch die Detailformen und Farbgebungen sind der Motivwelt von Reederei und Kontor, von Schiff und Meer entlehnt: Die Fußbodenkeramik der Eingangshalle weist den Farbton von den Wettern ausgesetzten Schiffsböden auf, die Wandfliesen zeigen das Blaugrün von Wasser und Eisbergschmelze. Das Treppengeländer ähnelt Stahltrossen mit einem Poller am festen Ufer. Handläufe und Poller sind mit Messing veredelt. Keine scharfen Kanten und Zacken gibt es mehr, alle Rahmungen sind gerundet. Wandvertäfelungen mit Wurzelfurnier befinden sich vor elegant geformten Funktionseinbauten. Das Portal besitzt blattgoldbelegte Bänder aus Klinker. Auf dem „Oberdeck“ befindet sich der Saalaufbau, gerundet und kühn gen Westen, zum Weltmeer gerichtet. An der Seitenflanke ist der Mast des Flaggschiffs angesetzt. Der Konsumverein hatte die 1933 und nach 1945 oktroyierten Strukturänderungen überlebt. Selbst wenn heute das rege Leben der einstigen Güterproduktion, der Verpackung und Verteilung nicht mehr nachvollziehbar ist, entsteht doch eine Dienstleistungsstruktur neuer Art für die heute etwa 150.000 Konsum-Mitglieder und die erhoffte große Zahl neuer Mieter im Haus. Mit Stolz kann der Vorstandsvorsitzende Stephan Abend vom Konzept einer behutsamen, denkmalgerechten Sanierung, die sich auf die in einer Ölpapierrolle unter Schutt wieder aufgefundenen Originalpläne Högers stützen kann, und von modernen Nachnutzungsstrategien, die der beauftragte Projektentwickler MAKO verfolgt, berichten. Das Areal hält auch – über den Innenhof – die Entdeckung der Konsumgeschichte parat. Durch die erhaltene Putzfassade des ersten Baubestands wird die Geschichte bis ins Jahr 1884 nachvollziehbar. Damals war am 8. Mai der „Consum-Verein für Plagwitz und Umgegend“ gegründet worden. Durch eine umsichtige Finanzpolitik konnte der Verein sehr bald seine positive Bilanz erweitern, die Mitgliedschaft erhöhen und etliche Filialen einrichten. Nach der 1890 erfolgten Eingemeindung von Plagwitz erhielt er den Namen „Konsumverein Leipzig-Plagwitz und Umgegend“. Aus dieser Zeit stammt der rote Ziegelbau am schmalen Ostende des Hofs. 1903, im Jahr eines großen Brands auf dem Gelände, schlossen sich die deutschen Konsumvereine zu einem Zentralverband zusammen. Der Leipziger Verein wurde eines der stärksten und erfolgreichsten Mitglieder. Er produzierte unter anderem Leipziger Konsumbrot und ließ für sich produzieren, verpackte und verteilte zum eigenen Gewinn und zum Nutzen seiner Mitglieder. Dem Erweiterungsbedarf konnte durch zusätzliche Flächenkäufe und die nach Högers Plänen errichteten Bauten entsprochen werden. Die Lagerhausfassade greift mit waagerechten Lichtbändern und Bullaugenfenstern ebenfalls das Schiffsmotiv auf. Der flachere Einschnitt in der Front macht deutlich, dass der Gesamtentwurf nach 1933 nicht restlos umgesetzt werden konnte. Der Eckturm mit dem Verwaltungstrakt und einer großen Turmuhr vervollständigt das einer Hafensituation nicht unähnliche Bild. Aber zwischen Außen- und Innenfront zeigt sich an einer Stelle ein scheinbarer Widerspruch, denn der gründerzeitliche Putzbau ist an der Industriestraße nicht erkennbar. Geschickt hat Höger ihn mit einer massigen Klinkerfassade umbaut. Die Fassade steht auch bei allen Erweiterungsbauteilen vor dem Tragwerk. Eine gesonderte Fassadenhaut, vorgestellt oder vorgehängt, erweist sich auch bei heutiger Industriebauarchitektur als sinnvoll. Högers Planungskonzept für den Leipziger Bau ist deshalb nicht nur wegen der Thematisierung der Motive Schiff, Wasser und Hafen, sondern auch wegen der dauerhaften und umnutzbaren Bauweise für den heutigen Besucher interessant. Quelle: www.leipzigerblaetter.de/volltext/textex_2.html 100 Stelzenhaus Weißenfelserstraße 65 Architekten: Hermann Böttcher, 1939, Weis + Volkmann, 2001–03 Schwebende Halle der Moderne, Stelzenhaus in Leipzig Industriedenkmale haben bekanntlich ihren ganz eigenen Charme. In stillgelegten Hochöfen, Gasometern, Stollen oder Werkhallen spiegeln sich Jahrhunderte der Wirtschafts- und Sozialgeschichte wider. Die gerne als „Kathedralen der Arbeit“ betitelten, manchmal riesigen Anlagen faszinieren uns umso mehr, wenn sie auch von architektonischer Qualität sind und ihre eigene Ästhetik entfalten. Dies gilt zum Beispiel für das „Stelzenhaus“ in Leipzig-Plagwitz. Es wurde 1939 als Fabrik zur Zinkherstellung und Wellblechwerk erbaut und gilt als hervorragendes Beispiel für Industriearchitektur in der Nachfolge der klassischen Moderne. Die Stahlbetonkonstruktion mit Sichtmauerwerk und Stahlfenstern besteht aus zwei Hallen, einem Verbindungsbau, einer Plattform und einem Bürogebäude. Aus Platzmangel erbaute Architekt Hermann Böttcher die Stahlbetonkonstruktion auf hohen Stelzen, die dem Komplex seinen Namen gaben: Die massive Lagerhalle schwebt gewissermaßen über dem Wasser des Karl-Heine-Kanals – eine Seltenheit. Die Gegend hatte sich seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem ausgeprägten Industriestandort entwickelt. Das auf ein mittelalterliches Dorf zurückgehende Plagwitz war zuvor ein beliebtes Leipziger Ausflugsziel, wo viele Bürger ihre Landhäuser erbauten, Gärten anlegten und auf den Wasserstraßen Gondelfahrten unternahmen. Das sumpfige Gebiet wurde schließlich auf Initiative des Rechtsanwaltes Karl Heine (1819–88) planmäßig erschlossen. Heine ließ den nach ihm benannten Kanal anlegen, 1871 kam die Eisenbahn, an der in Plagwitz der erste Industriebahnhof Europas eröffnet wurde. Das „Stelzenhaus“ wurde ursprünglich für die Firma Grohmann und Frosch erbaut, nach 1945 vom VEB Bodenbearbeitungsgeräte genutzt und stand schließlich leer. Sächsischer Staatspreis 2004 Hieronymus-Lotter-Preis 2004 Lobende Erwähnung Deutscher Umbaupreis 2004 Lobende Erwähnung Leipziger Architekturpreis 2003 location Tatort, 2002 location Soko Leipzig, 2003 102 Stadtumbau im Gebäudebestand der LWB Dipl.-Ing. Ines Gillner, Prokuristin und Leiterin Baukoordinierung , Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Prager Straße 21 Die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB) wurde 1990 als 100 % Tochtergesellschaft der Stadt Leipzig gegründet. Der Gesellschaftszweck ist damals wie heute die Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit sozialverträglichem Wohnraum. Heute besitzt die LWB einen Anteil von 11 % der Wohnungsbestände, die am Leipziger Markt teilnehmen. Die Entwicklung des Wohnungsbestandes der LWB von 1990 bis 2008 ist geprägt von: - Sanierung von 23.000 WE - Verkauf von 54.000 WE (Zwischenerwerber, Investitionsvorrang, Bauträger, normalem Verkauf, Versteigerung) - durch Rückgabe/Vergleiche Abbau von 42.000 WE mit Restitutionsanspruch (4.159 Gebäude). Heute befinden sich rund 40.000 Wohnungen im Kernbestand der Gesellschaft. Der Vermietungsgrad hat sich bei 80,7 % eingepegelt. Die sanierten Wohnanlagen weisen einen Leerstand von rund 4,2 % auf. Die teilsanierten Gebäudebestände zeigen einen Leerstand von durchschnittlich 7 %. Dieser sehr gute Vermietungsgrad ist unter anderem ein Ergebnis der Stadtumbauaktivitäten der Gesellschaft. Wie wurde dem Leerstand entgegen gewirkt? - Einteilung des Gesamtbestandes in die Geschäftsfelder Kernbestand und Verwertung - Organisatorische Optimierung des Kern-/Verwertungsbestandes - Stadtumbau in enger Abstimmung mit der Stadt Leipzig: Dazu gehören: Abriss, Verkauf, Sanierung - zügige Vermögensklärung. Seit dem Jahr 2000 wird in der Stadt Leipzig mit dem Stadtentwicklungsplan (STEP), der gebietsweise die Probleme und Defizite aufzeigt, aber ebenso die vorhandenen Qualitäten und Potenziale hervorhebt, gearbeitet. Dieser STEP wurde für den Teil Großsiedlungen gemeinsam mit den Eigentümern erarbeitet. Die Abbruchaktivitäten der LWB bewegen sich exakt entlang des STEP. Bis 31.12.2007 wurden 9.384 WE abgerissen. Für die Abrisse stehen Fördermittel aus dem Stadtumbau Ost Programm und aus Städtebauförderung zur Verfügung. Zusätzlich ist entsprechend § 6a Altschuldenhilfegesetz mit dem Abriss der Gebäude eine Entlastung von Altschulden möglich. Zur Erreichung der Stadtumbauziele ist in den Verwaltungsvorschriften auch die Nachnutzung der Abrissgrundstücke geregelt. Mietwohnungsbau darf für die folgenden 10 Jahre nicht errichtet werden und eine einfache bis qualitätvolle Begrünung ist aus den Fördermitteln zu finanzieren. Daraus ergeben sich folgende Wege zur Verwertung der Freiflächen: - Es gibt Grundstücke, die mit Gestattungsvereinbarungen für 5–15 Jahre von der Stadt Leipzig genutzt und betreut werden. - Auf einigen freigelegten Grundstücken entstehen Stadthäuser (selbst genutztes Eigentum). - Mietergärten und Parkplätze wurden geschaffen. - Es gibt aber auch Grundstücke, die lediglich eine Rasensaat erhalten haben. Die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft erhielt im letzten Jahr eine Anerkennung im Rahmen des Bauherrenpreises für ein gelungenes Stadtumbauprojekt im Westen der Stadt. In dieser denkmalsgeschützten Siedlung aus den 50er Jahren wurde, wie an anderen Standorten auch, der Abriss von Gebäuden mit Sanierung der verbleibenden Substanz verknüpft. Entstanden ist eine Wohnanlage mit Qualität im Innen- und Außenbereich, die nach Fertigstellung zügig vermietet war. www.lwb.de 104 Nibelungenring in Leipzig Architekt: Hubert Ritter 1929/30 Visionär des Städtebaus Hubert Ritter Am 17.3.1886 in Nürnberg geboren, gilt Hubert Ritter als Visionär des Städtebaus. Er gestaltete als Stadtbaurat in den Jahren 1926/34 das Gesicht Leipzigs wesentlich mit und gehört zur Generation jener Architekten, die als Wegbereiter die moderne Architektur in Deutschland prägten.Viele interessante Bauten sind Ritter zu verdanken, so z.B. das Neue Grassimuseum (1925/27), das Westbad in Lindenau (1925/ 26), die beiden Kuppeln der Großmarkthalle (1927/29), die Pädagogische Hochschule in der Karl-Heine-Straße (1928), das im Krieg zerstörte Planetarium im Zoo sowie mehrere Schulen und Krankenhäuser wie z.B. das St. Elisabeth in Connewitz. Als städtebauliche Meisterleistung gilt jedoch der „Rundling“ in Lößnig, eine eindrucksvolle Anlage mit 624 Wohnungen. Sie gehört zu den herausragenden stadtplanerischen Leistungen der Moderne. Eine herausragende Siedlung der Moderne in Leipzig ist der „Rundling“. Hubert Ritter, seit 1924 Stadtbaurat und bekennender Anhänger der Moderne, die in Leipzig mit seinen großen Gründerzeitquartieren nur schwer Fuß fassen konnte, plante und erbaute sie 1929/30. „Seine Einzelbauten, seine Wohn- und Stadtquartiere wurden aus der städtebaulichen Situation; aus dem Ort; für den Ort entwickelt. Dadurch wurden sie ihrerseits zu einem Ort, einem Ort mit Charakter.“ Der Lößniger Rundling ist ein typisches Produkt der Versuche, für die Bewohner ein architektonisches Symbol als Ausdruck der Gemeinschaft zu schaffen. Die Bebauung folgt in konzentrischen Kreisen dem hügeligen Bodenprofil, wobei dies durch die Höhe der Gebäude im inneren Ring noch verstärkt wird. Die Häuser wurden in traditioneller Bauweise errichtet und die Grundrisse (elf Standardgrundrisse) folgen den mit der Kreisform wechselnden Ausrichtungen der Wohnungen, um optimale Besonnungsverhältnisse entstehen zu lassen. Die Aufteilung der Freiflächen erfolgte so, dass die Eigenart des „Rundlings“ unterstrichen wird. Der Innenring umschließt einen Rundplatz, der früher mit einem großen Planschbecken in der Mitte versehen war. Die Siedlung befand sich durch Kriegsschäden und unterlassene Instandhaltung während der DDR Zeit in einem bedauernswerten Zustand. Im Jahr 1992 begann die Sanierung durch die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB). 122 Wohnungen und eine Tiefgarage wurden in Anlehnung an die vorhandene Architektur neu gebaut. In den folgenden Bauabschnitten wurden 969 Wohnungen in den Bestandsgebäuden saniert. Im Jahr 1996 erhielt die LWB für das Projekt „Sanierung und städtebauliche Ergänzung des Rundlings“ den Bauherrenpreis für „Hohe Qualität und tragbare Kosten“ vom Bund der Architekten, dem Gesamtverband der Wohnungswirtschaft und dem Deutschen Städtetag. Neubau und Sanierung wurden begleitet von Herrn Dr. Leonhardt, dem zuständigen Denkmalspfleger und dem Planungsbüro Schmitz Aachen als beauftragten Architekten. Nach seinem Studium an der Technischen Hochschule München war Ritter 1913 als Stadtbaumeister in Köln tätig. Nachdem jedoch seine Promotion am Widerstand des damaligen Kölner Oberbürgermeisters Konrad Adenauer 1924 scheiterte, bewarb er sich im Oktober desselben Jahres in Leipzig und trat dort seinen Dienst an. Sein Ziel war die Neuordnung der scheinbar unkontrolliert wachsenden Stadt, indem er ihr einen Rahmen für die zukünftige Entwicklung vorgab. Der darauffolgende Generalbebauungsplan von 1929, welcher von der Stadt verabschiedet und als „baupolitisches Programm auf lange Sicht“ auszugsweise veröffentlicht wurde. Für eine Stadt mit 700.000 Einwohnern war das damals ein Novum. Ritters Anliegen war es, den historischen Stadtkern zu erhalten. Im Südosten der Stadt plante Ritter einen durchgehenden Grünzug von der Ringpromenade bis zum Gelände des Völkerschlachtdenkmals. Verwaltungs- und Geschäftshäuser sollten künftig am Promenadenring entstehen. Dieses Konzept des „City-Rings“ prägt Leipzig noch heute. Nachdem die Wiederwahl Ritters als Stadtbaurat im November 1930 scheiterte, promovierte er 1932 über den „Krankenhausbau der Gegenwart“ und wurde dadurch weit über die Grenzen Deutschlands bekannt. 1940 wurde er zum „Beauftragten für den Generalbebauungsplan der Stadt Krakau“ ernannt, von 1941–44 war er Stadtbaurat in Luxemburg. Nach dem Zweiten Weltkrieg und seiner Rückkehr nach Leipzig widmete sich Ritter den Planungen für den Wiederaufbau des Johannisplatzes und des Universitätsklinikviertels. 1952 übersiedelte er nach München. Hier starb er am 25.5.1967. Quelle: www.LTM-Leipzig.de (Presseportal)(presse 08/013/02.08) Roland Ostertag, Hubert Ritter, Leipzig, Unbefriedete Vergangenheit, Deutsches Architektenblatt 1994 106 Völkerschlachtdenkmal Prager Straße Architekten: Entwurf: Bruno Schmitz, 1897, Ausführung: Clemens Thieme, 1913 Das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig erinnert an die erste große Massenschlacht der Menschheitsgeschichte. Über eine halbe Million Soldaten aus fast ganz Europa standen sich im Oktober 1813 auf den Schlachtfeldern um Leipzig gegenüber. Mehr als 120.000 Menschen haben während der blutigen Kämpfe oder anschließend durch Hunger und Seuchen ihr Leben verloren. Im Herbst 1813 wird bei Leipzig Weltgeschichte geschrieben. Die verbündeten Armeen Russlands, Preußens, Österreichs und Schwedens stehen Napoleons Streitmacht gegenüber. Vom 16. bis zum 19. Oktober kämpfen eine halbe Million Soldaten um das künftige politische Schicksal Europas. Tagelang toben erbitterte Schlachten und Gefechte um die Dörfer vor den Mauern der Stadt. Schließlich muss Napoleon der Übermacht seiner Gegner weichen. Rund 110.000 Menschen bezahlen die Schlacht mit ihrem Leben. Daten: Grundsteinlegung: 18. Oktober 1898 Einweihung: 18. Oktober 1913 Höhe: 91 m Höhe der Kuppelhalle (Innenhöhe): 68 m Fundamentplatte: 70 × 80 × 2 m Anzahl der Fundamentpfeiler: 65 Gesamtzahl der Stufen bis zur Plattform: 500 Fußbreite: 126 m Masse aller baulichen Anlagen: 300.000 t Anzahl der verbauten Natursteinblöcke: 26.500 Menge des verbauten Betons: 120.000 m³ Kosten: 6 Millionen Goldmark Seit dem frühen 19. Jahrhundert spielt das historische Ereignis Völkerschlacht im Bürgertum eine wichtige Rolle. Im Jahre 1913 wurde das Völkerschlachtdenkmal von Kaiser Wilhelm II. in Anwesenheit des sächsischen Königs und weiterer Fürsten deutscher Staaten sowie der Vertreter Österreichs, Rußlands und Schwedens eingeweiht. Das weithin sichtbare Wahrzeichen der Stadt steht an der Stelle, an der Napoleon am 18. Oktober 1813 seinen Gefechtsstand hatte. Auf den Betonpfeilern, auf die der Denkmalshügel aufgeschüttet ist, lastet ein Gewicht von ca. 300.000 t. Vor dem Mahnmal wurde ein Wasserbecken angelegt, das die Tränen der Völker, die um die Opfer der Schlacht trauerten, symbolisiert. Die Innenhalle mit ihren 68 m Höhe gliedert sich in drei Ebenen. Die erste Ebene ist eine Krypta, die an die Gefallenen erinnern soll. Auf der zweiten Ebene findet man eine Ruhmeshalle für das deutsche Volk und darüber befindet sich die Kuppelhalle. Der Monumentalbau wurde von Clemens Thieme ausgeführt. Die Entwürfe stammten vom Berliner Architekten Bruno Schmitz. Die Figuren, die jeweils eine Charaktereigenschaft darstellen, wurden zum Teil vom Breslauer Bildhauer Christian Behrens gefertigt. Das Völkerschlachtdenkmal, in dessen Kuppel (Fußdurchmesser 28 m) auch Konzerte stattfinden, kann besichtigt werden (Mai bis Oktober: 10–17 Uhr, November bis April: 9–16 Uhr). Nach 500 Stufen Aufstieg kann man von der Plattform die herrliche Rundsicht über Leipzig und Umgebung genießen. Rückseite vor dem Umbau 108 Nikolaischule Gasthof Alte Nikolaischule Nikolaikirchhof Architekten: Umbau und Sanierung Storch Ehlers + Partner, 1990–94 Straßenfassade nach dem Umbau Längs- und Querschnitt Die Nikolaischule wurde 1511/12 als erste Leipziger Stadtschule errichtet. Nach Umbau und Erweiterung des Gebäudes standen den Knaben vom 17. bis 19. Jahrhundert nur 4 Schulstuben zum Unterricht zur Verfügung. Sie waren im EG und im 2. OG eingerichtet, während der Rektor mit seiner Familie die gesamte erste Etage bewohnte. Eine Schulaula ebenso wie der, bis dahin noch gänzlich fehlende, Karzer standen erst seit 1827 mit der Anbindung des benachbarten Eckhauses zur Verfügung. Zu den berühmten Nikolairanern (Schüler der Nikolaischule) gehörten im 17. Jahrhundert Gottfried Wilhelm Leibniz und Christian Thomasius, im 18. Jahrhundert Johann Gottfried Seume und 1828 bis 1830 der in Leipzig geborene Richard Wagner. Sie wurden von bedeutenden Zeitgeistern unterrichtet, die als Schola Nicolaitana nicht selten an der benachbarten Universität zusätzlich ein Lehramt begleiteten. Zu den heutigen Räumen des Gasthauses „Alte Nikolaischule“ zählt das ehemals geräumigste Klassenzimmer im Erdgeschoß links des Haupteinganges, das bis 1827 in Ermangelung eines Schulsaales auch als Auditorium für öffentliche Veranstaltungen, für Examen und als Rednersaal genutzt wurde. Bibelinschriften auf den Wandflächen und verzierten Natursteinkonsolen gehörten neben einer schlichten Holzdecke zur bescheidenen Ausstattung der Schulstube. Die Möblierung dieses so genannten Großen Auditoriums beschränkte sich Ende des 18. Jahrhunderts auf zwei Schränke, drei schwarze Schreibtafeln, fünf Tafeltische und entsprechend lange Bänke. Nach einer Beschreibung des Magisters Friedrich Gottlob Hoffmann wurde um 1840 hier die 6. Klasse unterrichtet, aber „auch die allgemeinen Gebet- und Redeübungen gehalten“. 1872 zog das Nikolaigymnasium in ein neues Gebäude. Die Erdgeschoßstube wurde in der Folgezeit als Amtsstube vermietet. Ab 1897 war hier die Erste Leipziger Sanitätswache des Samaritervereins untergebracht. Die 5. Klasse wurde im so genannten kleinen Auditorium rechts des Einganges unterrichtet. Die Arkaden waren dem Raum erst 1906 mit Einrichtungen der Wachstube der Königlichen Garnisonswache vorgeblendet worden. Das alte Klassenzimmer erhielt dabei eine völlig neue Gestalt. Die Erdgeschoßgewölbe im westlichen Gebäudeteil wurden nicht für Schulzwecke genutzt. Der Städtische Rat vermietete sie im 18. Jahrhundert als Kaufgewölbe, seit 1816 auch als Messelokale. 1858 war zu diesem Zweck die Erdgeschoßzone des gesamten Eckhauses mit Schaufenster geöffnet worden. Im Zusammenhang mit der Umnutzung des gesamten Gebäudes nach Auszug der Nikolaischule mietete die Erste Leipziger Polizeiwache diese Räume. Als Ergebnis der Sanierung des alten Schulhauses von 1991 bis 1994 entstanden in der Leipziger Innenstadt ein neues kulturgeschichtliches Ausflugsziel und eines der bekanntesten Restaurants der Stadt. Im Jahre 1990 war die Alte Nikolaischule unbenutzt. Sie war wegen Baufälligkeit gesperrt. Vom Glanz der ältesten Bürgerschule Deutschlands war nichts geblieben. Innenfassade Treppenhauswand (Brandwand) Detail Wendeltreppe Treppenhaus Die Aufgabe, den Bau mit Leben zu füllen, wurde von der Kulturstiftung Leipzig gestellt. Das Gebäude sollte zu einem kulturellen Anziehungspunkt werden: Kulturcafé im Erdgeschoß, Gerätesammlung der Universität im Keller, die Antikensammlung im 1. Obergeschoß, dazu Vortrags- und Studienräume und schließlich im Dach die Sächsische Akademie der Wissenschaften. Das Konzept bestand darin, Alt und Neu miteinander zu verschränken. Im Laufe der Arbeiten traten verschiedene historische Fundstücke zutage, die in die Konzeption integriert werden konnten: eine wundervoll bemalte Holzdecke aus der Renaissance, farbig gefaste Putzfelder in den Obergeschossen. Ursprünglich sollte in Absprache mit den zukünftigen Nachbarn ein Lichthof dem rückwärtigen Treppenhaus Helligkeit spenden. Nach der Rückgabe des Nachbargrundstücks an Alteigentümer, musste umdisponiert werden. Eine geschlossene Brandwand wurde verlangt. Doch Widerstände können beflügeln: Es entstand trotzdem ein Lichthof: belichtet von oben. Ein steiler moderner Raum wurde gegen die gelagerten historischen gesetzt. 1995 1995 1995 1997 Architekturpreis AK Sachsen Architekturpreis der Zementindustrie Sächsischer Staatspreis Deutscher Architekturpreis www.storch-ehlers-partner.de/projekte/ alte-nikolaischule_leipzig_preise.php 110 Tag 4 Zeitplan Sonntag, 28.09.08 08.00 Uhr Frühstück und Auschecken Gepäck im Hotel abstellen 09.00 Uhr Spaziergang durch das Graphische Viertel Führung: Dipl.-Ing. Arch. Volker Meyer zu Allendorf 09.15 Uhr Besichtigung Grassi-Museum mit Innenhöfen Architekten: Zweck + Voigt, Sanierung: Ilg, Friebe, Nauber Dresdnerstraße 11–13 Besichtigung Gutenbergschule Architekt: Otto Droge Gutenbergplatz 6/8 Haus des Buches Architekten: HPP, Hentrich-Petschnigg & Partner KG und Angela Wandelt Gerichtsweg 28 Besichtigung Schumann Haus Inselstraße 18 Besichtigung Reclam-Karree Architekt: Max Bösenberg Inselstraße 22 12.30 Uhr Mittagessen im Restaurant Castellum 1776 Im Kellergewölbe einer ehem. Druckerei Hans-Poeche-Straße 2, Nähe Hotel und Hbf 14.00 Uhr Gepäckabholen im Hotel und zu Fuß zum Hbf Leipzig 14.30 Uhr Ankunft im Hbf Leipzig Ende der Exkursion 112 Grassi-Museum Johannisplatz 5–11 Architekten: Carl William Zweck + Hans Voigt, Oberleitung Stadtbaurat Hubert Ritter, 1929, Ilg Friebe Nauber, 2005–07 Hubertus Adam Die Blütezeit des Grassi-Museums in Leipzig währte nur ein Jahrzehnt. 1929 war der ausgedehnte Komplex östlich des Stadtzentrums eingeweiht worden, der die Museen für Kunsthandwerk, Völker- und Länderkunde und Musikinstrumente umfasste. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs begann die Evakuierung der Kunstwerke; 1943–45 erhielt das Gebäude schwere Bombentreffer. Weil Fremdnutzer in das notdürftig wiederhergestellte Bauwerk einquartiert worden waren, konnte der Ausstellungsbetrieb in den fünfziger Jahren nur auf minimaler Fläche beginnen. Die Stadtverwaltung ignorierte die Bedeutung des Museums für Kunsthandwerk vollends: Nach einem Heizungsschaden 1982 wurde die Präsentation geschlossen. Nach 1989 verbesserte sich die Situation nur langsam: Das erste mit der Sanierung betraute Architekturbüro erwies sich als inkompetent. An dessen Stelle trat David Chipperfield, der ein sensibles Konzept für die Wiederherstellung und Ergänzung des Gebäudekomplexes entwickelte. Doch das Projekt des im Museumsbereich erfahrenen Londoners scheiterte an den Kosten: Stadt, Land und Bund konnten sich über die Finanzierung nicht einigen. Im Jahr 2000 zog das Museum für Kunsthandwerk, das seit 1994 fünf Räume im Grassi-Museum nutzte, in ein innerstädtisches Provisorium um. Endlich begann die Sanierung des Gebäudes – nunmehr nach Plänen des ortsansässigen Büros Ilg Friebe Nauber. Im Oktober 2005 war die Arbeit der Gebäudehülle abgeschlossen. Nach weiteren zwei Jahren, die für die Restaurierung und Installation der Exponate verwendet wurden, konnte die nun als Museum für angewandte Kunst firmierende Institution 2007 ihre Dauerausstellung eröffnen. Eine der wichtigsten europäischen Sammlungen für Kunsthandwerk und Design kehrte damit nach mehr als sechs Jahrzehnten in die Öffentlichkeit zurück. Obwohl das Haus als 2. deutsches Kunstgewerbemuseum schon 1874 gegründet wurde, verdankt es seine Bedeutung vor allem Richard Graul, der zwischen 1896 und 1929 als Direktor amtierte. Er war die treibende Kraft für den Museumsneubau, da der aus dem Erbe des Mäzens Johann Dominic Grassi finanzierte Neurenaissancebau am Königsplatz zu klein geworden war. Der neue, um mehrere Höfe gegliederte Komplex, den die Architekten Carl William Zweck und Hans Voigt unter Oberleitung des Stadtbaurats Hubert Ritter realisierten, oszilliert zwischen moderater Moderne und Art déco und gilt als einer der wenigen deutschen Museumsneubauten aus der Zeit der Weimarer Republik. Den Bezugspunkt des breit gelagerten Ensembles, dessen Flügel sich zwischen zwei Ausfallstraßen aufspreizen, bildete einst die 1963 gesprengte Johanniskirche. Nach Plänen von Ritter sollte das Grassi-Museum den Ausgangspunkt einer Stadterweiterung Richtung Osten bilden, die nie realisiert wurde. Seit 2005 erstrahlt das Gebäude mit seiner rekonstruierten Dachbekrönung in neuem Glanz. Schade nur, dass die Architekten wegen des Kostendrucks Eingriffe in die Substanz akzeptierten. Weil wechselnder Lichteinfall konservatorische Probleme erzeugt, entschied man sich für ein leichter und kostengünstiger zu handhabendes Kunstlichtmuseum. Dass die einstigen Fenster indes in diesen Zonen aus der Fassade völlig getilgt wurden, ist skandalös und zeugt kaum von politischem Verantwortungssinn. Die Präsentation, wie schon zu Zeiten Grauls chronologisch arrangiert, folgt einer klassischen Abfolge, ohne eine neue Sichtweise anzubieten: Kleinkunst der Antike, gotische Schnitzplastik, Majoliken der italienischen Renaissance, Trinkgefässe des Barock, Porzellan des Rokoko, Möbel des Klassizismus, Kunsthandwerk des Historismus sind wichtige Themen. Die Leipziger Gestalter HeinzJürgen Böhme und Detlef Lieffertz haben mit Vitrinen und Podesten einen abwechslungsreichen Parcours inszeniert. Die meisten Wände sind hell gestrichen, doch mitunter werden in kojenartigen Formationen Akzente in Gelb, Rot oder Blau gesetzt. Zum Teil orientierte man sich bei der Präsentation an Grauls Konzept der Stilräume und fügte die Exponate zu stimmigen Ensembles – etwa im Saal der italienischen Renaissance, wo zu den in Vitrinen ausgestellten Majoliken eine venezianische Holzdecke sowie zwei in die Wände eingebaute Kamine treten. Zu Ausstellungsstücken, welche die internationale Entwicklung des Kunsthandwerks dokumentieren, treten Meisterwerke aus Sachsen. Dazu zählen die spätgotische Schnitzplastik von Peter Breuer ebenso wie der Leipziger Ratsschatz und der grandiose „Triumph des Kreuzes“ von Balthasar Permoser. Die Zeit des Klassizismus ist mit Denkmälern und Denkmalentwürfen des einflussreichen Leipziger Akademiedirektors Adam Friedrich Oeser und Möbeln von Friedrich Gottlob Hoffmann gut vertreten; einen besonderen Höhepunkt stellt der um 1795 ausgestattete römische Saal aus Schloss Eythra dar. Bis zum Jahr 2010 soll sich die Ausstellungsfläche mit den Rundgängen zu den Themen Asien sowie Jugendstil bis Gegenwart nochmals verdoppeln. Ein Ausschnitt aus den Sammlungen des 20. Jahrhunderts ist schon jetzt im Pfeilersaal zu sehen. Die Rekonstruktion der für den Raumeindruck dieses expressionistischen Interieurs wichtigen Lichtdecke sowie die Wiederherstellung der von Josef Albers entworfenen, streng geometrischen Treppenhausverglasung stehen zu Recht ganz oben auf der Wunschliste der Museumsleitung. Quelle: www.nzz.ch/nachrichten/kultur/aktuell/ aus_der_versenkung_ans_licht 114 Gutenbergschule Berufliches Schulzentrum Gutenbergplatz 6/8 Architekt: Otto Droge, 1929 Im Osten an den Alten Johannisfriedhof angrenzend, wurde die Schule am 29. Juni 1929 „zur Herausbildung eines tüchtigen gewerblichen Nachwuchses“ eingeweiht, erläutert eine Erinnerungstafel in der Eingangshalle des Erdgeschosses. Auftraggeber war der Verein Leipziger Buchdruckereibesitzer. Die Entwürfe lieferte Otto Droge. Das viergeschossige Hauptgebäude und die flacheren, vorgezogenen Flügelbauten (der nördliche entstand erst nach 1945) umschließen eine rechteckige, begrünte Hofanlage. Die hellen Putzfassaden sind unter Verwendung von rotem Rochlitzer Porphyrtuff gegliedert, die Fensterreihungen werden geschossweise horizontal betont. Seitlich ist die Hauptfassade in zeittypischer Weise turmartig überhöht und mit einer Normaluhr dekoriert. Auch die obligate, seitlich angeordnete Fahnenstange fehlt nicht. In der Gestaltung des Gebäudes vereinigen sich unterschiedliche stilistische Strömungen der 1920er Jahre, wie Neue Sachlichkeit und funktionelles Bauen sowie darüber hinaus im Inneren Art déco und Backsteinästhetik. Das Gebäude gehört heute zur Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur, Fachrichtung Polygraphie. Quelle: Leipzig Architektur von der Romanik bis zur Gegenwart, Passage Verlag, 2. Auflage Hier im östlichen Vorstadtbereich konzentrierten sich bis zur Zerstörung im zweiten Weltkrieg die Bauten der polygraphischen Industrie und der Verlage. Heute ist dieses Gewerbe hier kaum noch vertreten. Nur die Fragmente des nach 1945 vereinfacht wieder aufgebauten Buchgewerbehauses an der Prager Straße gegenüber der Ingenieurschule lassen noch etwas vom ursprünglichen Aussehen dieses 1900 von E. Hagberg im Stile der deutschen Neorenaissance errichteten Baus erkennen. Ganz verschwunden ist heute die stattliche Buchhändlerbörse, die sich, an die heutige Prager Straße grenzend, anschloss. Dieser malerische Neorenaissancebau, 1886 bis 1888 von den Berliner Architekten H. Kayser und K. von Großheim errichtet, wurde ebenfalls am 4. Dezember 1943 ein Opfer der Bomben. Hier entstand 1993 bis1996 das Haus des Buches. Erhalten hatte sich am Gutenbergplatz 3–7 das in den Jahren 1938 bis1940 nach Entwurf von Curt Schiemichen errichtete lang gestreckte BugraMessehaus, das der Ausstellung polygraphischer Maschinen diente. Durch eine zu Beginn der 1990er Jahre begonnene und nicht beendete Baumaßnahme präsentiert es sich derzeit als Investruine. 115 Haus des Buches Gerichtsweg 28 Architekten: HPP - Hentrich-Petschnigg & Partner und Angela Wandelt,1995/96 Das Haus des Buches in Leipzig wurde im März 1996 eröffnet und den Bürgern der Stadt Leipzig übergeben. Es befindet sich im ehemaligen Graphischen Viertel auf historischem Grund: hier stand bis zur Bombennacht vom 4. Dezember 1943 das 1888 im Renaissancestil errichtete Buchhändlerhaus, Sitz der Buchhändlerbörse, die 1825 als einer der ältesten deutschen Wirtschaftsverbände in Leipzig gegründet wurde. Mit der Zerstörung dieses Hauses verlor die Messestadt nicht nur eines ihrer prächtigsten Monumentalbauwerke – begraben wurde eine Epoche, in der Leipzig noch ganz selbstverständlich als „Mittelpunkt des deutschen Buchhandels“ galt. Die Wende kam mit dem politischen Umbruch: 1990 erinnerte man sich im Zuge der Fusionsverhandlungen der Börsenvereine in Leipzig und Frankfurt am Main alter Leipziger Traditionen. 1993 gab der symbolische erste Spatenstich das Signal für ein ehrgeiziges Projekt, mit dem der Börsenverein des Deutschen Buchhandels sich zum „Leipziger Platz“ bekannte und gemeinsam mit dem 1990 gegründeten Kuratorium „Haus des Buches“ e.V. einen Ort schuf, an dem Bücherfreunde und Büchermacher einander begegnen können. Drei in Höhe und Grundriss unterschiedliche Baukörper werden im Erdgeschoß durch eine dreieckige flache Foyerzone zusammengefasst. Hinter dem Eingang am Gerichtsweg befinden sich ein großzügiger Empfangsbereich und ein etwas höher gelegtes Literaturcafé. Ein siebengeschossiger, turmartiger Baukörper betont den Zugang an der Prager Straße. Er ist bewusst etwas aus der Bauflucht gerückt. Westlich anschließend, parallel zur Prager Straße, öffnet sich der lang gestreckte, kammartige Baukörper mit zwei Innenhöfen zur Straße. Dies ist eine für Leipzig neuartige, ungewöhnliche Lösung. Die beiden begrünten Höfe sind an der offenen Straßenseite durch riesige Glaswände wieder geschlossen, so dass sich ein dynamischer Wechsel von Klinker- und Glasfassaden ergibt. Das Gebäude beherbergt das Kulturamt der Stadt und Büros der Buchbranche. Das rote Klinkerensemble gehört zu den bemerkenswerten Neubauten der letzten Jahre. Die Architekten wurden 1998 mit dem BDA-Preis Sachsen geehrt. 116 Schumann-Haus Inselstraße 18 Das Schumann-Haus ist ein interessanter Sachzeuge für die in den 1830er Jahren im Osten Leipzigs einsetzende Stadterweiterung. Die lnselstraße könnte man als eine Hauptachse der neuen Friedrichstadt ansehen. Hier siedelte sich vor allem das mittlere Bürgertum an. Nach den Bauakten zu urteilen, wurde das Haus 1838 „vor dem Grimmaischen Thore“ von dem Maurermeister Friedrich August Scheidel errichtet, der hier auch bis 1846 wohnte. Das fünfzehnachsige, dreigeschossige, freistehende Gebäude gehört zu den bedeutenden erhaltenen Bauschöpfungen des Klassizismus in Leipzig. Es ist das vielleicht schönste Wohnhaus dieser Epoche. Den markant aus der Fassade heraustretenden fünfachsigen Mittelrisalit gliedern in den Obergeschossen sechs kannelierte Pilaster in Kolossalstellung mit korinthischen Kapitellen. Zwischen den Kapitellen sind Reliefplatten mit szenischen Darstellungen angeordnet. Darüber liegen ein kräftiger Architrav mit Girlandenschmuck und ein weit ausladendes Gesims. Über dem Mitteleingang ist die Beletage durch einen dreiachsigen Balkon auf Konsolen mit einem zeittypischen Rautengitter betont. Die besondere Würde der Architektur entsteht durch den überhöhten Mittelrisalit, dessen Architrav die Traufkante unterbricht und von einem belvedereartigen Aufsatz bekrönt wird. Der Leipziger Denkmalschützer Jens Müller hat vermutet, dass der damalige Stadtbaudirektor Albert Geutebrück Einfluss auf die Gestaltung genommen haben könnte, da dieser u. a. eine Bauinspektion durchgeführt hat. In diesem Hause wohnten Robert und Clara Schumann von 1840 bis 1844, vermutlich im 1. Obergeschoß rechts. Das junge Paar, das sich am 12. September 1840 in der Kirche von Schönefeld (heute Stadtteil von Leipzig) trauen ließ, verbrachte hier die ersten glücklichen Jahre, bevor es Ende 1844 nach Dresden übersiedelte. Das Schaffen von Clara Wieck und Robert Schumann ist eng mit Leipzig verbunden. Im Jahre 1833 stellte Clara Wieck in einem eigenen Konzert im Gewandhaus erstmals ein Werk von Robert Schumann (1. Satz der 1. Sinfonie) der Öffentlichkeit vor. Im folgenden Jahr gründete Schumann die Neue Zeitschrift für Musik. Im Jahre 1843 berief ihn Felix Mendelssohn Bartholdy an das neu gegründete Konservatorium für Musik in Leipzig. In der Schumann-Wohnung waren u. a. Franz Liszt, Hector Berlioz, Richard Wagner und Felix Mendelssohn Bartholdy zu Gast. Eine kleine Gedenkstätte in den teilweise authentisch restaurierten Räumen der ersten Etage wird von einem Schumann-Verein betrieben. 117 Reklam-Karree lnselstraße 22 Architekt: Max Bösenberg, 1887–1905 Sanierung: Bunk-Hartung-Partner, 1993–95 Seit dem 19. Jahrhundert war das Graphische Viertel im Osten Standort von Verlagen und Druckereien. Die imposante Dreiflügelanlage ließ der Verleger Anton Philipp Reclam durch Max Bösenberg von 1887 bis 1905 errichten. Der Haupteingang an der lnselstraße ist durch einen repräsentativen Mittelrisalit aus Sandstein mit plastischem Schmuck betont. Über dem mittleren Tor befindet sich im Rundbogenfeld ein Relief, das die missionarische Funktion des Buches versinnbildlicht. Die Medaillons links und rechts über den Seiteneingängen stehen unter dem Thema Buchdruck und Buchhandel. Den oberen Abschluss der Mittelachse bildet eine von zwei Löwen flankierte Uhr. Der rechte Seitenrisalit ist mit einem Goethe-Schiller-Medaillon zwischen Lorbeerzweigen geschmückt. Im Segmentgiebel darüber steht das Monogramm „R“ für den Verlagsnamen. Es wird von Sphinxen gerahmt. Beim wieder aufgebauten Risalit an der linken Seite wurde auf den plastischen Schmuck verzichtet. Die Fassaden aus gelben Klinkern mit roten Gliederungen, den Sandsteinrisaliten der Hauptfront, Gesimsen und Treppenhäusern bilden ein äußerst beeindruckendes städtebauliches Ensemble. Nach einer Bombardierung im zweiten Weltkrieg, bei der ein Teil der Fassade sowie das Dachgeschoß zerstört wurden, zog der Verlag nach Stuttgart, produzierte aber auf dem alten Gelände in Leipzig die berühmten, preiswerten Reclam-Bücher weiter. In den 1960er Jahren wurde dieser Gebäudekomplex dann dem Graphischen Großbetrieb lnterdruck angegliedert. Nach der Wende im Herbst 1989 wurde das Haus verkauft und saniert. Außerdem wurde das weiträumige Areal durch eine stadtvillenartige Bebauung mit Wohn- und Geschäftshäusern ergänzt. Von 1993 bis 1995 waren die Architekten Bunk-Hartung-Partner aus Bad Homburg mit der Wiederherstellung des ursprünglichen Reclam-Ensembles betraut. Auch das alte Heizhaus im Hof wurde saniert. Die neu errichteten Gebäude greifen mit ihrem gelb geklinkerten Sockelbereich die traditionelle Farb- und Materialgebung auf und erzielen mit ihren weißen Putzfassaden ein ausgewogenes Erscheinungsbild. 1996 wurde das Reclam-Karree mit dem Hieronymus-Lotter-Preis für Denkmalpflege der Kulturstiftung Leipzig ausgezeichnet. Eine Gedenktafel in der Grünanlage zur Kreuzstraße erläutert: „In diesem Gebäude wirkte und arbeitete Anton Philipp Reclam/geboren 28.6.1807/gestorben 5.1.1896/Begründer der weltberühmten Reclambibliothek“. 118 Grafischer Hof Restaurant Castellum 1776 Reudnitzer Straße/Hans-Poeche-Straße Der Grafische Hof vereint auf einem Gelände von ca. 5000 qm an der Reudnitzer Straße Ecke Hans-Poeche-Straße verschiedene Unternehmen aus den Bereichen Kunst, Kultur, Medien, Handel und Gastronomie. Zukünftig soll Arbeiten und Wohnen unter einem Dach stattfinden, so dass durch die gewerbliche wie auch private Nutzung die ehemaligen „Graphischen Werkstätten“ Leipzigs wiederbelebt werden. Im Grafischen Hof befinden sich Einrichtungsläden für stilvolles Wohnen und Gartenmöbel. Gemütliches Wohnen in den kälteren Monaten verspricht ein Fachhandelsgeschäft und Meisterbetrieb für Kamine, Kaminöfen, Kachelöfen und Schornsteine. Im Ambiente der alten Heizanlage, lädt die Galerie im Heizhaus regelmäßig zu Kunstausstellungen, Konzerten und Lesungen ein. Im Hof finden Kunst- und Designmärkte statt. Tonstudios, Musikverlage, Tanzstudios für Stepptanz und Flamenco, Werbeagenturen, Künstler, Architekten und Innenarchitekten, Designer, ein Keramikstudio, Druckereien und die Werkstätten der Buchkinder Leipzig e.V. bieten die Möglichkeit zur kreativen Zusammenarbeit. Das Gelände wird gerne für Filmarbeiten genutzt. Ebenso beherbergt der Grafische Hof das Restaurant „Castellum 1776“, das in den weitläufigen Kellerräumen italienische Speisen vor dem Hintergrund von historischen Backsteinwänden und -gewölben anbietet. 119 Quellenverzeichnis Architekturführer Dresden, Dietrich Reimer Verlag, Berlin www.architekturtexte.ch Architekturführer Dresden, Lupfer et. Al. Hg./ Berlin 1997 www.baunetz.de „Berichte zum Wiederaufbau der Frauenkirche zu Dresden – Konstruktion des Steinbaus und Integration der Ruine“, Herausgeber: Fritz Wenzel, Universitätsverlag Karlsruhe www.buntgarnwerke.de Broschüre zur Studentenexkursion 2007 der HS Karlsruhe nach Dresden und Prag mit Prof. Florian Burgstaller www.coophimmelblau.at Falk Jäger; Glas Nr. 4 (2007) www.cafe-grundmann.de www.daniel-libeskind.com www.das-neue-dresden.de Foster & Partners; industrieBAU 2 (2005) http://db.uni-leipzig.de Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.08.2003 www.detail.de Informationsmappe Förderverein Bau der Synagoge Dresden e.V. www.dresden-hellerau.de Leipzig, Architektur von der Romanik bis zur Gegenwart, Wolfgang Hocquél, Passage Verlag, 2. Auflage www.freundeskreis-synagoge-dresden.de Thomas Will: „Rekonstruktion der europäischen Stadt? – Zur Diskussion um den Dresdner Neumarkt“ www.hellerau.de Unterlagen des Sächsischen Staatsarchivs Leipzig http://joerg-hempel.com Vitzthum, M., Voland, P., Foster & Partners; Stahlbau 75 (2006) www.kunstforumhellerau.de www.gfzk.de www.leipzig.de www.leipzigerblaetter.de www.LTM-Leipzig.de www.lwb.de www.nzz.ch www.richard-riemerschmid.com http://riemerschmid.5eins.de www.rundkino-dresden.de www.schloss-eckberg.de www.slub-dresden.de www.spiegel.de www.spinnerei.de www.stern.de www.wikipedia.de 120 Leipzig Stadtplanauszug 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 City-Hochhaus, Restaurant „Panorama Tower“ GfZK 1+2 (Galerie für zeitgenössische Kunst) Stadtvillen im Musikerviertel Café Grundmann Buntgarnwerke mit „Atrium“ und Wohnprojekt „Sweetwater“ Baumwollspinnerei Konsumzentrale „Stelzenhaus“ „Rundling“ in Lößnig Völkerschlachtdenkmal LWB, Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Renaissance Hotel Leipzig Restaurant in der Alten Nikolaischule Graphisches Viertel mit Grassi-Museum, Gutenbergschule, Haus des Buches, Schumann-Haus, Reclam-Karee 121 Dresden Stadtplanauszug 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Hauptbahnhof Dresden Prager Straße mit Rundkino, UFA-Kristallpalast u.a Frauenkirche Neue Synagoge Brühl´sche Terrassen, Lipsiusbau, Ausstellungsgebäude, Kunstakademie Hotel Westin Bellevue Dresden Baustelle Waldschlösschenbrücke Restaurant Schloß Eckberg Campus TU Dresden SLUB Zentralbibliothek Militärhistorisches Museum Gartenstadt Dresden-Hellerau Sächsischer Landtag Semperoper und Zwinger Restaurant Villa Marie an der Loschwitzer Brücke „Blaues Wunder“ 122 Teilnehmer/-innen Professoren-Exkursion Dresden-Leipzig 25.09. bis 28.09.2008 Nr. Titel Nachname Vorname FB FH/TU 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Prof. Dr.-Ing. Prof. Dipl.-Ing. Prof. Dipl.-Ing. Prof. Dipl.-Ing. Prof. Dr. Prof. Dipl.-Ing. Prof. Dipl.-Ing. Prof. Dipl.-Ing. Prof. Dipl.-Ing. Prof. Dipl.-Ing. Prof. Dipl.-Ing. Prof. Dipl.-Ing. Prof. Dipl.-Ing. Prof. Dr.-Ing. Prof. Dr.-Ing. Prof. Dipl.-Ing. Prof. Dipl.-Ing. Prof. Dr.-Ing. Prof. Dipl.-Ing. Prof. Dr.-Ing. Prof. Dipl.-Ing. Prof. Dipl.-Ing. Prof. Dr.-Ing. Prof. Dipl.-Ing. Prof. Dipl.-Ing. Prof. Dipl.-Ing. Prof. Dipl.-Ing. Dipl.-Ing. Dipl.-Ing. Arch. Bulenda Dittrich Dunkelau Edelmann Fierz Freischlad Fuchs Günster Kawamura Kowalewsky Leonhardt Meier Meissner Mosler Nelskamp Neuleitner Raff Riediger Romero Schaub Scheiblauer Steinhilber Techen Thomas Weber Zenner Zoller Pröll Vogler Thomas Horst Wolfgang Albert Peter Volker Hartmut Armin Kazuhisa Jobst Matthias Richard Andreas Friedo Heinz Nikolaus Hellmut Hans-Georg Stephan Hans-Joachim Anne Christin Ursula Holger Horst Günter Norbert Friedrich Michael Waltraud BI A A BI A A A A A A A A A BI BI BI A BI A BI A A A A A A A BI A Hochschule Regensburg GSO Hochschule Nürnberg FH Frankfurt FH Mainz Universität Karlsruhe Hochschule Darmstadt GSO Hochschule Nürnberg Hochschule Karlsruhe FH Mainz FH Mainz FH Frankfurt SRH Hochschule Heidelberg Hochschule Karlsruhe GSO Hochschule Nürnberg Hochschule Biberach FH Regensburg FH Wiesbaden Hochschule Biberach HTWG Konstanz Hochschule Biberach FH Frankfurt HFT Stuttgart FH Frankfurt GSO Hochschule Nürnberg FH Wiesbaden FH Kaiserslautern FH Regensburg Ziegel Zentrum Süd Ziegel Zentrum Süd 123 Impressum Herausgeber © Ziegel Zentrum Süd e.V. Konzeption Dipl.-Ing. Architektin Waltraud Vogler Recherche und Exkursionsvorbereitung Dipl.-Ing. Architektin Waltraud Vogler Dipl.-Ing. Michael Pröll Margret Kaiser Layout und grafische Beratung D.SIGNstudio Edigna Aubele, München Druck Druckerei Fritz Kriechbaumer, Taufkirchen AnsprechpartnerInnen: FB Architektur FB Bauingenieurwesen Sekretariat Waltraud Vogler, Dipl.-Ing. Architektin, Geschäftsführerin Michael Pröll, Diplom-Ingenieur Margret Kaiser Ziegel Zentrum Süd e. V. Beethovenstraße 8 80336 München Fon 089/74 66 16 - 11 Fax 089/74 66 16 - 60 [email protected] www.ziegel.com Wir bedanken uns herzlich bei allen Personen, die uns bei der Recherche, der Vorbereitung der Exkursion und durch Vorträge und Führungen unterstützt haben. Besonderer Dank gilt: Frau Prof. Anthusa Löffler, Herrn Prof. Horst Thomas, Herrn Prof. Dr. Thomas Bulenda und Herrn Dipl.-Ing. Arch. Volker Meyer zu Allendorf. Die Herstellung und das Papier der Broschüre „Professoren-Exkursion 2008“ des Ziegel Zentrum Süd e.V. sind zertifiziert nach den Kriterien des Forest Stewardship Councils (FSC). Der FSC schreibt strenge Kriterien bei der Waldbewirtschaftung vor und vermeidet damit unkontrollierte Abholzung, Verletzung der Menschenrechte und Belastung der Umwelt. Da die Produkte mit FSC-Siegel verschiedene Stufen des Handels und der Verarbeitung durchlaufen, werden auch Verarbeitungsbetriebe von Papier, z.B. Druckereien, nach den Regeln des FSC zertifiziert. www.ziegel.com