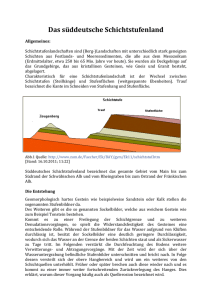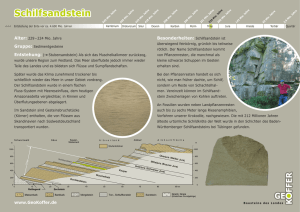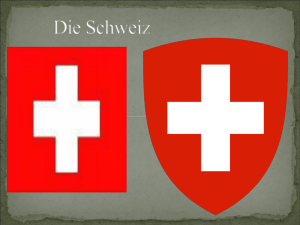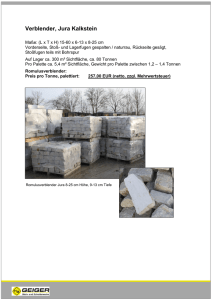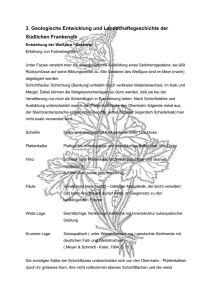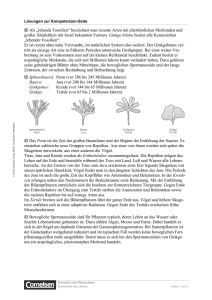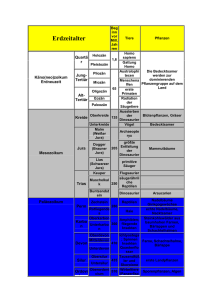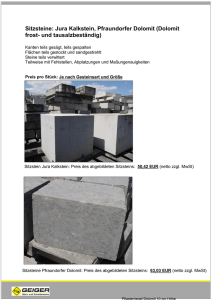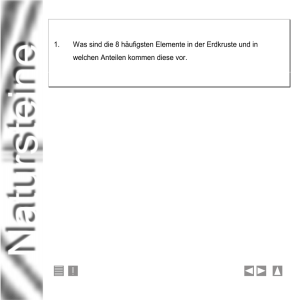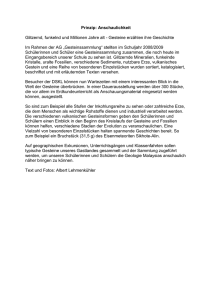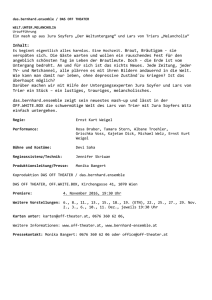Geotope im Regierungsbezirk Stuttgart - 4
Werbung

12 Geotope im Regierungsbezirk Stuttgart 4 Untersuchungsgebiet 4.1 Land- und Stadtkreise LfU zusammensetzt (s. u. Abb.1). Diese Land- und Stadtkreise gehören drei verschiedenen Regionen an : Region Franken (Nr.1-5), Region Ostwürttemberg (Nr. 6 und 7) und Region Mittlerer Neckar (Nr. 8 bis 13). Das Untersuchungsgebiet ist identisch mit dem Regierungsbezirk Stuttgart, der den NE-Teil des Bundeslandes Baden-Württemberg bildet und sich aus 11 Landkreisen sowie 2 Stadtkreisen 1 3 5 4 2 8 Regierungsbezirk Karlsruhe bereits erschienen seit 1984/2000 9 6 10 11 13 12 7 Regierungsbezirk Tübingen Regierungsbezirk Freiburg Bo de ns ee Abb. 1: Untersuchungsgebiet (Regierungsbezirk Stuttgart mit den Land- und Stadtkreisen 1-13, im NE von BadenWürttemberg) : Landkreis Main-Tauber (1), Landkreis Schwäbisch Hall (2), Landkreis Hohenlohe (3), Landkreis Heilbronn (4), Stadtkreis Heilbronn (5), Landkreis Ostalb (6), Landkreis Heidenheim (7),Landkreis Ludwigsburg (8), Landkreis RemsMurr (9),Stadtkreis Stuttgart (10), Landkreis Böblingen (11), Landkreis Esslingen (12), Landkreis Göppingen (13). LfU 4.2 Untersuchungsgebiet • Albuch und Härtsfeld • nördliche Kuppige Flächenalb • zentraler Teil der Lonetal-Flächenalb. Naturräumliche Gliederung Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich in NNW-SSE-Richtung vom Maintal bis zum Donautal und in WSW-ENE-Richtung etwa vom Nagoldtal bis zum Wörnitztal (Maximalwerte). Von NW nach SE gehört das Gebiet den Neckar- und Tauber-Gäuplatten, dem Schwäbischen Keuper-Lias-Land sowie der Schwäbischen Alb an. Im N reicht es bis in den randlichen Sandstein-Odenwald und im SE bis in das randliche Donauried hinein. Die drei o. a. natürlichen Großräume verlaufen etwa parallel von SW nach NE. Ihre Abgrenzungen wurden großenteils nach geologischen Gesichtspunkten festgelegt. Ihre Untergliederung in kleinere Naturräume beruht hauptsächlich auf morphologischen Gegebenheiten. 4.3 Der zu den Neckar- und Tauber-Gäuplatten zählende Teil des Untersuchungsgebietes lässt sich von N nach S in folgende Naturräume gliedern : • Tauberland und östlicher Teil des Baulands • Kocher-Jagst-Ebene • Hohenloher-Haller Ebene • nordöstlicher Kraichgau • Strom- und Heuchelberg • Neckarbecken • nordöstliche Obere Gäue. Das Schwäbische Keuper-Lias-Land liegt fast vollständig innerhalb des Untersuchungsgebietes und bildet dessen zentralen Bereich. Hier setzt es sich aus folgenden Naturräumen zusammen (von N nach S) : • • • • • • • • Schwäbisch-Fränkische Waldberge Schurwald und Welzheimer Wald Östliches (Schwäbisches) Albvorland Westrand des Ries Stuttgarter Bucht Die Filder nördlicher Schönbuch Mittleres (Schwäbisches) Albvorland. Der zur Schwäbischen Alb gehörende SE-Teil des Untersuchungsgebietes kann naturräumlich von N nach S wie folgt unterteilt werden : 13 Geologischer Aufbau und erdgeschichtliche Entwicklung Das Untersuchungsgebiet liegt im Kernbereich der Südwestdeutschen Großscholle (CARLE 1955), d.h. innerhalb ihrer generell nach SE flach eingekippten, mesozoischen Schichttafel. Auf Grund dieser etwa vom Oberen Jura bis ins Pleistozän dauernden Einkippung und unterschiedlicher Verwitterungsresistenz der Gesteinsschichten entstand infolge großflächiger Abtragung die Südwestdeutsche Schichtstufenlandschaft. Entsprechend dem Abtauchen der Schichten nach SE streichen hier in gleicher Richtung zunehmend jüngere Gesteine aus (Abb. 2). Insgesamt erschließt das Untersuchungsgebiet Gesteine, die den vier Formationen Trias, Jura, Tertiär und Quartär angehören (Tab. 1). Hierbei handelt es sich fast nur um Sedimentgesteine. Ausnahmen bilden Magmatite des "Schwäbischen Vulkans" und Impaktgesteine der Meteoritenkrater Ries und Steinheimer Becken, die jeweils dem Tertiär zuzuordnen sind. Am Aufbau des Schichtstufenlands sind nur Gesteine des Mesozoikums beteiligt, das sich aus Trias, Jura und Kreide zusammensetzt. Ablagerungen der Kreide sind im Untersuchungsgebiet jedoch nicht nachgewiesen. Abb. 3 zeigt eine vereinfachte geologische Übersichtskarte des Regierungsbezirks Stuttgart. 14 Geotope im Regierungsbezirk Stuttgart ª ª Holozän ¬ Pleistozän ª Jungtertiär ¬ Alttertiär ª im Untersuchungsgebiet « ¬ nicht nachgewiesen « ª Weißer Jura (Malm) Quartär « Neozoikum < « Tertiär ¬ ª Mesozoikum LfU Kreide < Jura < Brauner Jura (Dogger « ¬ Schwarzer Jura (Lias) « ª Keuper « < Muschelkalk Trias ¬ ¬ Buntsandstein Tab. 1: Stratigraphischer Bereich der im Untersuchungsgebiet zutage tretenden Gesteine. NW SE Schichtstufenland Albtrauf Grundgebirge B un ts andste in Musch elkalk Keuper Weißer Ju ra B raune r Jura Schwar ze r Ju ra Molassetrog Tertiär Abb. 2: Schematisches NW-SE-Profil der Südwestdeutschen Schichtstufenlandschaft mit angrenzenden geologischen Einheiten (Grundgebirge von Schwarzwald, Odenwald und Spessart / Tertiär des Molassetrogs; permische Gesteine unberücksichtigt). LfU Untersuchungsgebiet Den flächenhaft größten Anteil des Untersuchungsgebietes nehmen bei gesonderter Betrachtung des Quartärs Gesteine der Trias ein und hier wiederum diejenigen des Keupers, der im zentralen Bereich zutage tritt. Das Hauptvorkommen des Muschelkalks schließt sich dem Schichtstufenbau entsprechend im W und N dem Keuper an, während der Buntsandstein hauptsächlich im N als relativ kleiner Bereich dem Muschelkalk folgt. Gesteine des Jura bilden flächenhaft den zweitgrößten Anteil im Untersuchungsgebiet. Sie lagern dem Keuper auf und schließen sich hier deshalb diesem nach SE an. Zu etwa gleichen Teilen treten Unterer (schwarzer) und Oberer (weißer) Jura auf. Während ersterer das Albvorland einnimmt, bildet Oberer Jura die Albhochfläche. Zwischen beiden vermittelt der Mittlere (braune) Jura als schmal ausstreichendes Band den Albaufstieg vom Vorland zur Hochfläche. Tertiäre Gesteine treten nur im S und SE des Untersuchungsgebietes und mit geringer flächenhafter Verbreitung auf. Quartäre Ablagerungen überdecken als jüngste Bildungen bis auf viele kleine Ausnahmen (= Aufschlüsse präquartärer Gesteine) das gesamte Untersuchungsgebiet. Im Folgenden werden die am Aufbau des Untersuchungsgebietes beteiligten Systeme (ehem. Formationen) regionalgeologisch in der Reihenfolge abnehmenden Alters kurz abgehandelt. Hierbei finden auch durch Revisionen überholte, aber in geologischen Karten noch benutzte stratigraphische Begriffe Verwendung. Eine zusammenfassende Darstellung der Geologie von Baden-Württemberg findet sich bei GEYER & GWINNER (1986) sowie plakativ „wie unser Land entstand“ bei STIER, BEHMEL & SCHOLLENBERGER (1989) 4.3.1 Trias Die charakteristische Dreiteilung der Trias in Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper geht 15 auf ihre Ausbildung in Deutschland zurück ("Germanische Trias"). Ihre Gesteine entstanden im Germanischen Becken, einem mitteleuropäischen Sedimentationsgebiet, das sich nach der Variszischen Faltung im Zechstein (Ober-Perm) herausbildete und sich im Laufe der Trias erweiterte. Unter subtropischem bis semiaridem Klima entwickelte sich der Muschelkalk durchgehend marin, während Buntsandstein und Keuper festländisch beeinflusst sind. Mit Ausnahme des biostratigraphisch (Fossilien) gut belegbaren Oberen Muschelkalks wird die gesamte Trias lithostratigraphisch (nach Gesteinsausbildung) gegliedert. 4.3.1.1 Buntsandstein Der südwestdeutsche Anteil des Buntsandsteins wurde im südlichen Randbereich des Germanischen Beckens abgelagert. Hier griff der Buntsandstein, dessen Beckenzentrum in Niedersachsen lag, im Bereich der Rheinischen Tiefenfurche zwischen den Hochgebieten (vor allem Gallische Schwelle im Westen und Vindelizische Schwelle im Südosten) als zungenförmiges Teilbecken immer weiter nach Süden über, bis schließlich Verbindung zur alpinen Geosynkline entstand. Hierbei wurden auch zunehmend randliche Bereiche der umgebenden Hochgebiete überdeckt. Der südwestdeutsche Buntsandstein setzt sich überwiegend aus fein- bis mittelkörnigen Sandsteinen zusammen. Den übrigen Teil bilden Tonund Siltsteine sowie untergeordnet Konglomerate und chemische Sedimentgesteine. Die typische rotbraune Farbe der Sandsteine wird durch einen Eisenoxidbelag der Sandkörner hervorgerufen. Die fast immer in Sandsteinanschnitten zu erkennende Schrägschichtung lässt auf fluviatilen Transport aus südlichen Richtungen schließen, wobei sich die Transportmassen oft flächenhaft im Sedimentationsraum ausbreiteten. 16 Geotope im Regierungsbezirk Stuttgart N 0 10 LfU Tauberbischofsheim 20 30 km ber Tau Künzelsau Heilbronn Crailsheim Schwäbisch Hall t Jags Ko che r Mu rr Rems Stuttgart Schwäbisch Gemünd Heidenheim Fils Böblingen nz Bre Albtrauf Ausstrichslinie geol. Grenzen Kliff-Linie Vulkanite Tertiär Impaktgesteine Sedimentgesteine Abb. 3: Geologische Übersichtskarte des Regierungsbezirks Stuttgart Weißer Jura Muschelkalk Schwarzer u. Brauner Jura Buntsandstein Keuper LfU 17 Untersuchungsgebiet ª Oberer Buntsandstein (so) º Obere Röttonsteine < Rötquarzit > (so2) « ¼ ¬ Untere Röttonsteine Plattensandstein (so1) Mittlerer Buntsandstein (sm) ª Oberer Hauptbuntsandstein (sm2) (Hauptbuntsandstein) ¬ Unterer Hauptbuntsandstein (sm1) Unterer Buntsandstein (su ) ª im Untersuchungsgebiet ¬ nicht aufgeschlossen Tab. 2: Gliederung des Buntsandsteins im Untersuchungsgebiet. Dieser war teilweise wasserbedeckt wie Tonablagerungen, Rippelmarken und andere Merkmale beweisen. Hiermit ergibt sich das Bild eines mit zahlreichen Seen durchsetzten, kontinentalen Sedimentationsbeckens. Fossilien und Steinsalzpseudomorphosen belegen ein semiarides bis arides Klima. Dies wird durch das Vorkommen von Netzleisten einstiger Trockenrisse unterstrichen. Der im Untersuchungsgebiet bis zu 600 m mächtige Buntsandstein (Mächtigkeitszunahme von 0 im SE bis 600 im N) tritt nur S des Mains, im NE-Sporn des Odenwalds, bis etwa zur Linie Külsheim-Werbach-Neubrunn flächenhaft zutage. Kleine Vorkommen befinden sich am SW-Rand des Untersuchungsgebietes bei Hausen im Würmtal (Ostrand des Nordschwarzwälder Buntsandsteingebietes) sowie in dessen Norden bei Lauda und Ingelfingen. In den letzten beiden Fällen handelt es sich um Buntsandsteinaufbrüche innerhalb des Muschelkalks, d.h. um geologische Fenster. Diese sind durch ihre Lage im Fränkischen Schild, einem Hebungsraum mit flacher Aufwölbung, sowie durch die hier tiefe Zertalung der Muschelkalkplatte bedingt. Zur stratigraphischen Gliederung des Buntsandsteins werden lithologische Merkmale verwendet, weil Fossilien schon wegen ihres geringen Vorkommens nicht herangezogen werden können. Seine Großgliederung in Unteren, Mittleren und Oberen Buntsandstein erfolgt auf Grund von Sedimentationszyklen mit jeweils nach oben abnehmender Korngröße. Für das Buntsandsteinvorkommen im N des Untersuchungsgebietes kann die vereinfachte Gliederung in Tabelle 2 gelten (nach RUTTE & WILCZEWSKI,1983) Der Untere Buntsandstein wurde in der Tiefbohrung Ingelfingen durchteuft (Mächtigkeit nahezu 200 m), steht aber in Aufschlüssen des Untersuchungsgebietes nicht an. Der Mittlere Buntsandstein zeigt als basale Folge (Unterer Hauptbuntsandstein, sm1) rote, feinbis grobkörnige Sandsteine, die nur wenige Tonund Siltsteinzwischenlagen aufweisen und massig absondern. Diese Sandsteine sind unter der Bezeichnung Miltenberger Sandsteine bekannt und wurden in großen, jetzt aufgelassenen Steinbrüchen an der Uferstraße des Mains als Bausteine gewonnen. Stellenweise sind hier größere Netzleistenflächen aufgeschlossen. Der Obere Hauptbuntsandstein (sm2) setzt sich aus mehreren, teilweise geröllführenden und mit Ton- und Siltsteinzwischenlagen versehenen Sandsteinfolgen zusammen. Sein oberster Teil wird als Felssandstein bezeichnet, ein harter Sandstein, der Felsbildungen, Geländekanten sowie Blocksammlungen verursacht und des- 18 Geotope im Regierungsbezirk Stuttgart ª (Hauptmuschelkalk) Semipartitus-Schichten (mo3) < nodosus-Schichten (mo2) Oberer Muschelkalk ¬ Mittlerer Muschelkalk LfU → salinarer Zyklus (mm) ª Unterer Muschelkalk Trochitenschichten (mo1) orbicularis-Schichten (mu3) < Wellenkalk (mu2) ¬ Wellendolomit (mu1) Tab. 3: Untergliederung des Muschelkalks im Untersuchungsgebiet. halb bekannt ist. In Aufschlüssen zeigt dieser Sandstein oft plastisch herauswitternde Schrägschichtungsstrukturen. Stratigraphisch entspricht er dem Hauptkonglomerat im Schwarzwald. Der Obere Buntsandstein lässt sich in den Plattensandstein (so1) und die auflagernden Röttonsteine (so2) untergliedern. Im unteren Grenzbereich des Plattensandsteins kommen stellenweise Karneol- und Dolomitkonkretionen vor (fossile Bodenbildung), die zur Grenzziehung mitbenutzt werden. Der Plattensandstein besteht aus überwiegend mittelkörnigem Sandstein mit Glimmeranreicherungen auf Schichtflächen, die plattige Absonderung hervorrufen. Dickbankige Bereiche werden z.T. heute noch in kleineren Steinbrüchen als Bausandstein abgebaut. Die Röttonsteine werden durch den Rötquarzit, einen bis über 10 m mächtigen verkieselten Sandstein mit Spurenfossilien (Chirotheriensandstein), in Untere und Obere Röttonsteine getrennt. Es handelt sich um rotbraune Ton- und Siltsteine mit Sandsteinzwischenlagen, Reduktionshorizonten und lokal vorkommenden Gipsund Steinmergellagen. Im obersten Bereich belegt die Myophorienbank, ein dolomitischer Kalk mit marin-brackischen Fossilien, den zum Muschelkalk überleitenden Meeresvorstoß. Aufschlüsse der Röttonsteine befinden sich bei Lauda, Höhefeld (Landkreis Main-Tauber) und Ingelfingen (Landkreis Hohenlohe). 4.3.1.2 Muschelkalk Mit der Wende Buntsandstein/Muschelkalk vollzog sich in Südwestdeutschland eine Faziesänderung von fluviatil-limnischen zu vollmarinen Sedimentationsbedingungen, die durch eine Meeresingression aus dem polnischen Raum hervorgerufen wurde (Öffnung der oberschlesischen Pforte). Dieses flache Nebenmeer des Germanischen Beckens ingredierte unter aridem Klima über das durch den Buntsandstein ausgeglichene Relief. Infolge erhöhter Verdunstung und geringer klastischer Sedimentzufuhr entstanden fast nur karbonatische Ablagerungen. Schließlich kam es bei kulminierender Verdunstung unter zu geringem Wassernachschub zu einem Eindampfungszyklus mit Dolomit-, Gips-, Anhydrit-, und Salzabscheidungen. Danach drang durch Öffnung der Burgundischen Pforte im Süden das Meer aus der alpinen Geosynkline nach Norden in das Germanische Becken ein und ermöglichte das Einwandern der mediterranen Fauna. Insgesamt ergibt sich also für den Muschelkalk das Bild eines durch erhöhte Temperaturen und Salzkonzentrationen gekennzeichneten Binnenmeeres mit schmalen Verbindungswegen zum offenen Weltmeer. Der im Untersuchungsgebiet bis über 200 m mächtige Muschelkalk (Gliederung siehe Tab. 3) tritt überwiegend etwa nördlich der Linie Möckmühl-Creglingen bis zum bei Welzheim beginnenden Buntsandstein, also im Taubergrund zutage. Ein kleineres Vorkommen liegt am SW- LfU Untersuchungsgebiet Rand des Untersuchungsgebietes nahe der Ostgrenze der Nordschwarzwalds. Schließlich legten Neckar, Kocher und Jagst in ihren tief in die große Keuperfläche eingeschnittenen Tälern Muschelkalk fast bis zur NW-Grenze des Jura frei (vom flächenhaften Vorkommen im N nach S bis etwa zur Linie Stuttgart-Crailsheim). Der im Taubergrund bis über 80 m mächtige Untere Muschelkalk besteht zu einem erheblichen Teil aus grauen dünnschichtigen Kalken (mu2), die nach unten in Ton- und Kalksteine mit dolomitischen Bereichen (mu1) und nach oben in Mergel (mu3) übergehen. Die gesamte Folge ist zyklisch aufgebaut und weist konglomeratische, oolithische sowie aus Schill bestehende Zwischenlagen auf, die zur stratigraphischen Feingliederung herangezogen werden. Wellenkalkaufschlüsse zeigen wellenartig verformte Schichtflächen (namengebend) mit Rillen und Riefen, Rinnenanschnitte sowie weitere Sedimentationsmerkmale, die zusammen mit den o. a. grobkörnigen Zwischenlagen auf eine Sedimentation im Gezeitenbereich des Muschelkalkmeeres schließen lassen. Innerhalb des Untersuchungsgebietes lassen sich im Unteren Muschelkalk drei Faziesbereiche unterscheiden. Die im mu1 und mu2 dolomitischen und sandige Freudenstädter Fazits zeigt beckenrandliches Sedimentationsmilieu an und reicht von S nach N bis etwa zur Linie Ludwigsburg-Braunsbach a. K. - Rothenburg ob der Tauber , wobei sie im Bereich der unteren Tauber als schmaler Sporn (Tauber-Barre) unter Mächtigkeitsreduktion nach NW vorgreift. Westlich der Tauber-Barre liegt die im mu1 nach NW zunehmenden Kalkgehalt aufweisende Mosbacher Fazies vor, während östlich davon die Meininger Fazies mit überwiegend kalkig entwickeltem mu vorherrscht. Morphologisch tritt der Wellenkalk insbesondere in Tälern hervor. Hier verursacht er an Prallhängen steile Böschungen. Der Mittlere Muschelkalk stellt mit seinem Salinarzyklus (Dolomit, Anhydrit, Gips, Salz) einen bedeutenden Bodenschatz dar. Innerhalb des Untersuchungsgebietes sind die Steinsalzlager am mächtigsten in der Heilbronner Mulde entwickelt, wo sie auch untertage abgebaut werden. 19 Fehlt jedoch eine genügend mächtige Gesteinsüberdeckung, ist das Salzgebirge durch bewegtes Wasser ausgelaugt und liegt nur noch als Residualgestein vor. Hierbei sind Mächtigkeitsreduktionen um bis zu über 60% festzustellen. In den seltenen Übertage-Aufschlüssen stehen als Residualgestein in ihrer Lagerung stark gestörte (infolge Hohlraumversturz) dolomitische, Stink-, Schill- und Zellenkalke zusammen mit Mergel und Residualton, manchmal auch Gips an. Geomorphologisch macht sich der Mittlere Muschelkalk durch wellige Verebnungen und Erweiterung von Talquerschnitten bemerkbar. Der Versturz von Hohlräumen pflanzt sich oft im Hauptmuschelkalk über größere Mächtigkeiten nach oben bis zur Erdoberfläche weiter, wo dann großräumige Schichtverbiegungen die Folge sind (Auslaugungstektonik). Ist der Mittlere Muschelkalk in Talhängen angeschnitten, zeigt der überlagernde Muschelkalk wegen fehlendem Widerlager meist talwärts geneigte Schichtung. Schließlich geht auch die Entstehung zahlreicher Dolinen ursächlich auf die Auslaugung des Mittleren Muschelkalks zurück. Über dem infolge lebensfeindlicher Entstehungsbedingungen weitgehend fossilfreien Mittleren Muschelkalk lagert der fossilreiche Obere Muschelkalk. Im Untersuchungsgebiet steigt seine Mächtigkeit bis auf über 90 m an. Er setzt sich hauptsächlich aus dichten Kalksteinen (aus Kalkschlamm entstanden; teilweise mit höherem Tongehalt) und bioklastischen Kalksteinen (teilweise oolithische Schalentrümmerbänke) zusammen, die in der Profilfolge einen lebhaften Wechsel zeigen. Tonstein, Mergel sowie Dolomit kommen untergeordnet vor. Der Obere Muschelkalk verursacht eine flächenhaft große Schichtstufe, in deren Tälern er meist Felswände bildet. Im Untersuchungsgebiet stellt er das wirtschaftlich am meisten genutzte Gestein dar, so dass es bei der großen Anzahl aufgelassener wie in Betrieb befindlicher Steinbrüche an Aufschlüssen nicht fehlt. Die auch als Hauptmuschelkalk bezeichnete Schichtenfolge ermöglicht auf Grund ihres Fossilgehalts zunächst eine Untergliederung in Trochitenschichten, nodosus-Schichten und semipartitus- 20 Geotope im Regierungsbezirk Stuttgart Schichten. Eine weitergehende, besonders detaillierte Unterteilung kann erfolgen, wenn die zahlreichen biostratigraphischen Leithorizonte mit lithostratigraphischen Horizonten in Bezug gesetzt werden. Im Untersuchungsgebiet zeigen einzelne Profilbereiche des Hauptmuschelkalks regional unterschiedliche, fazielle Entwicklungen, die in Abhängigkeit von der paläogeographischen Lage jeweils verschiedene Sedimentationsbedingungen repräsentieren. Die Trochitenschichten (mo1; auch Trochitenkalk oder Unterer Hauptmuschelkalk genannt) zeichnen sich durch in bioklastischen Bänken angereicherte Vorkommen von Trochiten (Seelilienstielglieder) aus. Während im oberen Profilbereich meist dichte Kalke mit Mergelfugen den Raum zwischen den Bioklastiten ausfüllen, sind es im unteren Drittel überwiegend Mergel (Haßmersheimer Schichten). Letztere keilen nach Osten und Norden Richtung Mainfranken und Crailsheim aus, wo sich die Trochitenbänke zu massigem Trochitenkalk entwickeln. Oben schließen die Trochitenschichten mit der Spiriferina-Bank, einem wichtigen und bis über die Grenzen des Untersuchungsgebietes hinausreichenden Leithorizont, ab. Nodosus- und semipartitus-Schichten (mo2 und mo3) können als Oberer Hauptmuschelkalk zusammengefasst werden. Dieser weist im Untersuchungsgebiet verschiedene Faziesentwicklungen auf, die sich überwiegend auf die semipartitus-Schichten beziehen. Am auffälligsten ist die durch mächtige Schillablagerungen gekennzeichnete Quaderkalkfazies, deren Westteil dem Gebiet zwischen Gammesfeld im S und Grünsfeld im N angehört. Es sind flache Grobsedimentschübe, welche die aus Mergelkalken und Tonmergeln bestehende Normalfazies in erheblichem Maß verdrängen und deren Sedimentation ursächlich mit der unmittelbar südlich gelegenen Gammesfelder Barre (einer Meeresuntiefe, die sich schon im mu als Tauber-Barre bemerkbar machte) in Zusammenhang steht (RUTTE & WILCZEWSKI, 1983). LfU Nach Westen und Norden schließt sich an die Quaderkalkfazies (etwa NW der Linie Krautheim-Weikersheim) die beckennähere Tonfazies Mainfrankens an. Südlich dieser Linie liegt das östliche Gebiet der beckenzentralen Kochendorfer Fazies, die einen hohen Anteil an Tonstein und dichtem Kalkstein sowie an deren Mischungsreihen aufweist. Schließlich folgt nach S (etwa ab der Linie Gammesfeld-Braunsbach) die Kalkfazies. Diese Linie stellt gleichzeitig die ungefähre Nordgrenze des Trigonodus-Dolomits dar, der nach S einen zunehmend größeren Profilbereich im Oberen Hauptmuschelkalk einnimmt. Im N klingt die Dolomitisierung unter Einsatz der Fränkischen Grenzschichten, dem jüngsten Schichtglied des Oberen Muschelkalks, aus. Den Übergang bildet der Trigonodus-Kalk. Die Fränkischen Grenzschichten zeigen mit ihren Ton- und Kalksteinen den tiefsten Bereich des Meeres am Ende der Muschelkalkzeit an (BACHMANN & GWINNER,1979). Die jüngste Muschelkalkbildung ist das mo/kuGrenzbonebed, ein nur wenige Zentimeter mächtiger Leithorizont mit angereicherten Knochenresten von Vertebraten u.a.. Dieser Horizont lagert teilweise diskordant auf den liegenden Schichten. 4.3.1.3 Keuper Mit dem Keuper setzte nach dem marin entwickeltem Muschelkalk wieder festländisch beeinflusste Sedimentation ein. Im Vergleich zum Buntsandstein war das Germanische Becken nun weiter und flacher geworden (BRINKMANN 1966) und es lagerten sich gegenüber den eintönigen Buntsandsteinfolgen unter verschiedensten Sedimentationsbedingungen (marin, brackisch, fluviatil, limnisch, äolisch) faziell vielfältige Gesteine ab. Diese sind zum größten Teil klastisch (hauptsächlich Silt-, Sand- und Tonsteine). Den kleineren Teil bilden Mergelstein, Kalkstein, Gips und Anhydrit. Die fazielle Vielfalt zeigt sich deutlich in den für den Keuper typischen, bunten und abwechs- LfU Untersuchungsgebiet lungsreichen Gesteinsfarben sowie in der Form einzelner Lithosome. Der vielfache Wechsel der Sedimentationsbedingungen kann auf mehrfache isostatische Änderungen zwischen Germanischem Becken und umgebenden Abtragungsgebieten zurückgeführt werden. Letztere sind auf Grund sedimentärer Merkmale (z.B. Schrägschichtung) z.T. als Liefergebiet der Sandsteine (Fennoskandisches Festland im Norden und Böhmische Masse sowie Vindelizisches Land im Südosten) bekannt. Insgesamt ergibt sich für den süddeutschen Teil des Germanischen Beckens im Keuper das Bild einer flachen Senke, die durch kurzzeitige Meeresüberflutungen und große Seenlandschaften meist seichte Wasserbedeckung aufwies. Infolge fehlender Frischwasserzufuhr kam es zu erhöhten Salzkonzentrationen und damit zu Gipsausscheidungen. Von den Abtragungsgebieten herkommende Flüsse mündeten in die Senke und luden dort ihre Sandfracht überwiegend als Deltaschüttungen ab. Entsprechend den durch die klastischen Gesteine vorgegebenen, schlechten Fossilisationsbedingungen sowie infolge teilweise lebensfeindlichem Ablagerungsmilieu weist der Keuper einen nur geringen Fossilgehalt auf. Dieser besteht zum größeren Teil aus pflanzlichen Fossilien. Der im Untersuchungsgebiet bis über 450 m mächtige Keuper (Mächtigkeitszunahme von S nach N) tritt etwa zwischen den Linien Möckmühl-Creglingen im Norden und StuttgartEllwangen im Süden großflächig zutage und nimmt den zentralen Hauptteil ein. Der lebhafte Gesteinswechsel zeichnet sich auch morphologisch ab, indem verwitterungsresistente Sandsteine einerseits Geländeterrassen mit entsprechenden Verebnungen und andererseits bei geringer lateraler Ausbreitung lang gestreckte Höhenzüge verursachen. Wasserstauende Ton- und Siltsteine sind flächenhaft erodiert und bilden Steilhänge von Terrassenstufen und tief eingeschnittenen Tälern und Klingen. Bei weitgehender Zertalung von Schichtstufenflächen sind teilweise nur noch inselartige Restvorkommen von Sandsteinen vorhanden. Letzte- 21 re bilden dann Hochflächen von Zeugenbergen. Gipsvorkommen bewirken flachwellige Landschaftsformen, lokale Aufweitungen von Tälern sowie Dolinen, die durch Nachsinken des Hangenden in durch Subrosion entstandene Hohlräume hervorgerufen werden. Die Gliederung des Keupers erfolgt mangels (Leit-) Fossilien nach lithostratigraphischen Merkmalen (Tab. 4). Hierbei ist neben dem lebhaften vertikalen Fazieswechsel auch ein solcher in horizontaler Richtung anzuführen, der nicht in die schematische Gliederung eingeht. Der auch als Lettenkeuper bezeichnete Untere Keuper bildet auf der HauptmuschelkalkSchichtstufe weite Verebnungen (MuschelkalkLettenkeuper-Flächen) wie z.B. die Hohenloher Ebene, weist jedoch meist mächtige Quartärbedeckungen auf. Seine besten Aufschlüsse befinden sich in z.T. in Betrieb befindlichen Muschelkalksteinbrüchen, wo er als Abraum über dem Muschelkalk (Deckschichten) noch mitangeschnitten ist. Der Lettenkeuper setzt sich im Wesentlichen aus Ton- und Siltsteinen (grau, braun, grünlich) mit zwischengeschalteten, teils dolomitischen Kalksteinen sowie Sandsteinen zusammen. Letztere treten hauptsächlich in der Profilmitte des Lettenkeupers auf (LettenkeuperHauptsandstein) und bestehen überwiegend aus einer Wechselfolge von Sandsteinen und sandig-siltigen Tonsteinen ("Normalfazies"). Lokal sind die Sandsteinbänkchen jedoch zu dickbankig-massigem Sandstein entwickelt ("Flutfazies"), der früher vielerorts als Werksandstein gewonnen wurde. Verbindet man die Vorkommen des Lettenkeuper-Hauptsandstein in "Flutfazies", so gelangt man nach WURSTER (1968) zu einem System von Sandsteinsträngen, das als deltaartige Ablagerung von aus nördlichem Liefergebiet transportierten Sanden gedeutet wird. In den Sandsteinen bzw. in deren obersten Bereich treten oft kohlige Pflanzenfossilien auf, die zu kleinen kohligen Lagen angesammelt sein können. Hierbei handelt es sich wahrscheinlich größtenteils um als Treibgut transportierte Pflanzenreste (BACHMANN & GWINNER, 1979). Frühere Abbauversuche dieser kleinen Kohle- 22 Geotope im Regierungsbezirk Stuttgart Rät Oberer Keuper (ko) ª (km5) Knollenmergel « (km4) Stubensandstein « Mittlerer Keuper (km) LfU ª < (km3) Obere Bunte Mergel º < Kieselsandstein « ¬ > Bunte Mergel Untere Bunte Mergel¼ ¨ (km2) Schilfsandstein ¬ (km1) Gipskeuper Lettenkeuper Unterer Keuper (ku) Tab. 4: Untergliederung des Keupers im Regierungsbezirk Stuttgart. Der Mittlere Keuper stellt mit seiner Mächtigkeit von bis über 250 m (Lettenkeuper bis über 30 m; Rät bis ca. 10 m) und hinsichtlich seiner flächenhaften Verbreitung die wichtigste Schichtenfolge des Keupers dar. Der starke Wechsel der Gesteine in der Vertikalen ermöglicht die Untergliederung in eine größere Anzahl von Schichtgliedern. Im Wesentlichen handelt es sich um eine Folge von Ton-Mergel-Gesteinen mit zwischengeschalteten Kalkstein-und Steinmergelbänkchen und von Sandsteinen, die unten mit einem Gipslager (km1) beginnt. Die Folge weist einen lebhaften, schichtgebundenen Farbwechsel (grau, rotbraun, violett, grün, gelb) und unterschiedlichste Verwitterungsresistenzen auf. Der Mittlere Keuper baut im Wesentlichen das Keuper-Bergland auf, eine durch Schichtstufen und Verebnungsflächen geprägte Landschaft, die ihren geologischen Aufbau deutlich durch die Morphologie nachzeichnet. delt sich um eine Folge bunt gefärbter Mergel mit Ton- und Siltsteinen, die anhand zwischengeschalteter Gipsvorkommen, Steinmergel-, Dolomit- und Sandsteinbänken weitgehend gliederbar ist. Das größte Gipsvorkommen liegt im basalen Bereich (Grundgipsschichten),eine bis 10 m mächtige Folge mit eingelagerten Mergel-, Ton- und Steinmergellagen, die mancherorts (z.B. Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall) abgebaut wird. Der Mittlere Gipshorizont zeigt nur noch lokale Gipsvorkommen in Form einzelner Bänkchen, Linsen oder Knauern. Weiter nach oben ist der Gipskeuper als gipsarm zu bezeichnen. Dieses km1-Profil liegt jedoch nicht immer vor, weil Gips durch Wasser oberflächlich und unterirdisch (Subrosion) aufgelöst und somit die Gesamtmächtigkeit reduziert wird. Durch Subrosion und nachsackendes Hangendes werden flachwellige Landschaftsformen erzeugt, die im Norden und Westen das Keuper-Bergland umsäumen. Hierbei bewirken jedoch schon geringmächtige Steinmergel-, Dolomit- und Sandsteinbänke durch Geländekanten und kleinere Verebnungen morphologische Unterbrechungen wie z.B. die "Engelhofer Platte" (quarzitische Sandsteinbank über dem Mittleren Gipshorizont; locus typicus NE Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall). Der Gipskeuper (km1) besitzt mit etwa 150 m seine größte Mächtigkeit im Kraichgau. Es han- Über dem Gipskeuper folgt als nächstes Schichtglied des Mittleren Keupers der Schilf- vorkommen führten zu der Bezeichnung "Lettenkohle" für den Unteren Keuper. Die Fauna des Lettenkeupers enthält neben Vertebratenresten (Fische, Amphibien und Reptilien) überwiegend Fossilien eines marinbrackischen Ablagerungsmilieus. LfU Untersuchungsgebiet sandstein (km2), eine dem LettenkeuperHauptsandstein gleichende Sandsteinfolge, die ebenso wie dieser in "Normalfazies" und in "Flutfazies" vorkommt und ebenfalls dem Fennoskandischen Festland im Norden entstammt (BACHMANN & GWINNER,1979). Der überwiegend gleichmäßig feinkörnige Schilfsandstein besitzt u.a. wegen seines Glaukonitgehalts meist eine grünliche Farbe und zeigt oft Schrägschichtung. Zusammen mit dem Fossilinhalt sprechen diese Merkmale für eine deltaartige Sandablagerung in einem marinen Becken. Die selten aufgeschlossene "Normalfazies" ist eine Wechselfolge von Sandsteinen und sandigen Silt- und Tonsteinen, also ein durch Stillwasserstadien gekennzeichnetes Ablagerungsmilieu. In der "Flutfazies" schwillt der Schilfsandstein lokal zu dickbankig-massig absondernden Sandsteinpaketen an und steht in zahlreichen aufgelassenen Steinbrüchen an, wo er früher als Werkstein gewonnen wurde. Die eigentlich falsche Bezeichnung "Schilfsandstein" ist auf das hier häufigste Pflanzenfossil Schachtelhalm zurückzuführen, das mit Schilf verwechselt wurde. Als drittes Schichtglied des Mittleren Keupers lagern über dem Schilfsandstein die Bunten Mergel (km3). Es sind überwiegend rotbraune Mergel, Ton- und Siltsteine mit Sandstein- und Steinmergelbänken, die durch den 0,1 m (im W) bis ca. 25 m (im E) mächtigen Kieselsandstein (km3s) in Untere (km3u) und Obere (km3o) Bunte Mergel untergliedert werden. Die Unteren Bunten Mergel können von unten nach oben in Dunkle Mergel, Rote Wand (locus typicus im Stuttgarter Raum) und Lehrbergschichten gegliedert werden, wovon im Untersuchungsgebiet hauptsächlich der obere Profilbereich aufgeschlossen ist. Dies beruht darauf, dass der überlagernde Kieselsandstein in Klingen oft Wasserfälle verursacht, wobei sein Liegendes mancherorts tief erodiert ist (z.B. im NSG Wieslaufschlucht). Mit den nur wenige Meter mächtigen und aus grünen Mergeln und hellgrünen Steinmergelbänken bestehenden Lehrbergschichten setzt ein deutlicher Farbumschlag von rotbraunen nach grauen und grünen Gesteinen ein. 23 Der den Lehrbergschichten und damit den Unteren Bunten Mergeln auflagernde Kieselsandstein (km3s) ist nur teilweise kieselig gebunden, sodass härtere und weichere Bereiche festzustellen sind. Hauptsächlich in Profilmitte sind ihm Mergel zwischengeschaltet. Er ist über Engelhofer Platte und Schilfsandstein der dritte Stufenbildner im Keuper-Bergland. Entsprechend seinen petrographischen Merkmalen (schlechter Rundungs- und Sortierungsgrad) ist der Kieselsandstein als Schichtflutablagerung zu deuten. Seine Aufschlüsse sind vorwiegend natürlichen Ursprungs und beschränken sich hauptsächlich auf Klingen, wo er insbesondere mit einer kieseligen Basisbank Wasserfälle verursacht, sowie auf Hangabrisse, die durch die instabilen Unteren Bunten Mergel im Liegenden bedingt sind. Dem Kieselsandstein lagern als Dritter und oberer Teil des km3 die Oberen Bunten Mergel (km3o) auf. Es ist eine Wechselfolge von grauen bis grünen Mergeln und Steinmergelbänkchen, die untergeordnet auch rötliche Mergel, Dolomitlagen und Gipsresiduen enthält und seltener aufgeschlossen ist. Das wohl bekannteste Schichtglied des Mittleren Keupers im Regierungsbezirk Stuttgart ist der über den Bunten Mergeln folgende Stubensandstein (km4), eine bis über 100 m mächtige Folge von Sandsteinen, die insbesondere im mittleren Teil Einschaltungen von Ton- und Mergelgesteinen aufweist und in vier Sandsteinkomplexe (1. bis 4. Stubensandsteinhorizont) unterteilt werden kann. Generell nimmt die Mächtigkeit der Sandsteine von Osten nach Westen ab, sodass im Kraichgau nur noch gering mächtige Sandsteinhorizonte in vorherrschenden Mergeln und Steinmergeln vorliegen (Steinmergelkeuper). Seine deutlichste fazielle Differenzierung zeigt der Stubensandstein in den Löwensteiner Bergen (BACHMANN & GWINNER,1979). Morphologisch stellt der Stubensandstein über Engelhofer Platte, Schilfsandstein und Kieselsandstein eine Vierte, jedoch differenzierte Schichtstufe des Mittleren Keupers im Keuper-Bergland dar. Die Bezeichnung Stubensandstein ist auf die Verwendung lockerer Sandsteinbereiche (überwiegend im 3. und 4. Stubensandsteinhorizont) 24 Geotope im Regierungsbezirk Stuttgart als Fegsand zurückzuführen, der früher meist in Gruben und teils untertage gewonnen wurde. Der 1.Stubensandsteinhorizont besteht aus überwiegend kalkig gebundenem und damit relativ hartem Sandstein, der als "Fleins" bezeichnet wird und früher in zahlreichen kleinen Steinbrüchen abgebaut wurde. In seinem unteren Bereich zeigt er lokal Aufarbeitungshorizonte mit Mergelgeröllen und -stücken, die den Oberen Bunten Mergeln entstammen. Nach Westen schalten sich vor allem im unteren Teil zunehmend Mergel und Steinmergel ein und der Sandstein wird feinkörniger. Morphologisch verursacht der "Fleins" Verebnungen und Wasserfälle. Der 2. Stubensandsteinhorizont kann mit dem 3. als Mittlerer Stubensandstein zusammengefasst werden, der durch zwischengelagerte und teils auskeilende Mergel einen unruhigen Aufbau zeigt. In einzelnen Steinbrüchen von z.T. beachtlicher Größe wird er noch zur Sandherstellung abgebaut. Zwischen 1. und 2. Stubensandsteinhorizont befinden sich rotbraune Mergel, die bei Mainhardt mit über 14 m die größte Mächtigkeit erreichen (Mainhardter Mergel) und kalkige Einschaltungen enthalten. Stratigraphisch entsprechen sie einer Mergelfolge im Westen, die im Kraichgau als Leithorizont die oolithische Bank und im Stromberg als Äquivalent die OchsenbachSchicht enthält (SCHWEIZER & KRAATZ,1982). Der petrographische Aufbau des 2. Stubensandsteinhorizonts zeigt eine von unten nach oben abnehmende Härte der meist schräggeschichteten Sandsteine sowie eine gleichgerichtete Zunahme an Mergeln. Paläontologisch zeichnet sich die Gesteinsfolge durch fossile Hölzer (Kieselholz im Osten) und Vertebratenfossilien (im Westen) aus. Über ihr lagert lokal das aus Kalkund Mergelbruchstücken bestehende und als Leithorzont dienende "Kalkkonglomerat" (BACHMANN & GWINNER,1979), das auch am Stromberg, jedoch nicht im Kraichgau vorhanden ist. LfU Der 3.Stubensandsteinhorizont stellt mit seinen vorwiegend tonig gebundenen, z.T. grobkörnigen und schräggeschichteten Sandsteinen mit Mergelzwischenlagen die Fortsetzung des 2. Stubensandsteinhorizontes dar. Ihm entspricht im Kraichgau eine nur geringmächtige Sandsteinlage. Darüber lagern die auch im Westen vorhandenen "Unteren bzw. Falschen Knollenmergel". Der 4. Stubensandsteinhorizont besteht aus überwiegend tonig gebundenem Sandstein und besitzt eine meist gelbliche Gesteinsfarbe, die durch Pyrit hervorgerufen wird. Lokale Erzvorkommen (z.B. bei Wüstenrot) wurden früher wegen ihres (geringen) Gehaltes an Edelmetallen abgebaut. Als oberster Sandsteinkomplex des Stubensandsteins und damit des Mittleren Keupers macht er sich morphologisch besonders deutlich bemerkbar, da die überlagernden Knollenmergel flächenhaft erodiert sind. Somit verursacht er Hochflächen mit randlich tief eingeschnittenen Klingen für das Gestein typische, grottenartige Hohlkehlenbildung, welche die Bezeichnung "Höhlensandstein" begründen. Im Westen des Untersuchungsgebietes stellen Äquivalente des 4. Stubensandsteinhorizontes die auffälligste Sandschüttung des Steinmergelkeupers (4 m verkieselter Sandstein im Kraichgau; 20 m Sandstein im Stromberg) dar (SCHWEIZER & KRAATZ,1982). Mit dem Knollenmergel (km5) schließt der Mittlere Keuper oben ab. Die überwiegend rotbraunen Mergel enthalten Steinmergelknollen und sind wegen ihrer Rutschungen nach Wasserzutritt bekannt. Wo der flächenhaft abgetragene Knollenmergel infolge Überdeckung durch Rät oder Unteren Jura noch erhalten ist, zeigt er im Ausstrich stets Rutschungen mit etwa hangparallelen Querfalten, sodass wellige Oberflächenformen vorliegen und Aufschlussprofile fehlen. Der Obere Keuper (Rät) weist im Untersuchungsgebiet nur geringe Mächtigkeit und lückenhafte Verbreitung bzw. inselartige Restvorkommen auf, sodass die Formationsgrenze Trias/Jura sowohl als Grenze Knollenmergel/Lias als auch als Grenze Rät/Lias vorliegt. LfU Untersuchungsgebiet Im Wesentlichen handelt es sich um nur wenige Meter mächtige Sand- und Tonsteine, die unter marinen Sedimentationsbedingungen abgelagert wurden. Die gelblichen, dickbankigen bis plattigen Sandsteine wurden früher in kleinen Steinbrüchen abgebaut, von denen heute nur noch wenige Restprofile erhalten sind. Mit dem marinen Rät beginnt der Wechsel vom festländisch beeinflussten Keuper zu den vollmarinen Sedimentationsverhältnissen des Jura. 4.3.2 Jura Das durch die aus südlicher Richtung stammende Rät-Transgression entstandene Jurameer löste als jungmesozoisches Schelfmeer die Epoche des Germanischen Beckens ab (BRINKMANN,1966). Mit Beginn des Jura wurde Süddeutschland aus nördlicher Richtung über die "Hessische Straße" (zwischen ardennischrheinischer Masse im W und Böhmischer Masse im E) zunehmend überflutet. Infolge ausgeprägter Wasserschichtung entstanden im untersten Bereich dieses Flachmeeres bituminöse Schiefer. Unter fortschreitender Transgression wurden aus nördlichen Abtragungsgebieten klastische Sedimente abgelagert. Mit der Schließung der "Hessischen Straße" entstand die Mitteldeutsche Landbrücke, die das süddeutsche vom nördlichen Jurameer trennte. Damit ging die Öffnung des süddeutschen Jurameeres nach Süden einher und es erfolgte eine Angliederung an die Tethys. Nach anfänglicher Bildung von gebankten Kalksteinen und Mergeln in tieferen Meeresbereichen breitete sich eine zusehends nach Süden übergreifende und Mächtigkeitszunahmen bewirkende Schwammfazies aus. Die hierdurch entstandenen Massenkalke stellen Schwammriffe eines reich gegliederten submarinen Reliefs dar, das nachfolgend durch die Bildung gebankter Kalke größtenteils wieder ausgeglichen wurde. Mit Ausgang des Jura erfolgte durch den Rückzug des Meeres nach Süden eine weitgehende 25 Regression, die den süddeutschen Raum trockenlegte. Innerhalb des Untersuchungsgebietes sind jurassische Gesteine etwa südlich der Linie Böblingen-Ellwangen, also im Bereich der Schwäbischen Alb und deren Vorland flächenhaft verbreitet und nehmen somit nach dem Keuper den nächst größeren Teil ein. Die Jura-Formation Südwestdeutschlands ist eine überwiegend aus Kalksteinen, zu einem kleineren Teil aus Mergeln, Ton- und Sandsteinen bestehende, fossilreiche Gesteinsfolge, die Mächtigkeiten bis über 800 m aufweist (GEYER & GWINNER, 1968) und nach lithologischen Gesichtspunkten in Unteren (Schwarzen), Mittleren (Braunen) und Oberen (Weißen) Jura gegliedert wird. Diese drei Abteilungen können auf Grund lithologischer und paläontologischer Merkmale jeweils in Stufen, Unterstufen, Zonen und Subzonen weitgehend untergliedert werden (s. Tab. 5). Morphologisch machen sich im Schichtstufenland jurassische Gesteine am deutlichsten wirksam, indem sie die Schwäbische Alb mit ihrem steil ansteigenden Nordrand (Albtrauf) aufbauen. Sie verursachen eine morphologisch differenzierte Schichtstufe, wobei der Weiße Jura den steilsten Anstieg, die Albtraufkante und die Albhochfläche bildet. 4.3.2.1 Schwarzer Jura Der Schwarze Jura weist im Untersuchungsgebiet Mächtigkeiten bis über 100 m auf und setzt sich überwiegend aus Tonsteinen und Mergeln zusammen. Im unteren Profilbereich sind Sandund Kalksteine zwischengeschaltet. Sein flächenhaftes Vorkommen liegt hauptsächlich im Albvorland, reicht aber lokal zungenförmig weit in das Keuper-Bergland hinein, wo einzelne Berge z.T. noch isolierte Reste ("LiasInseln") tragen. Angulatensandstein und Gryphaeenkalk des unteren Schwarzjura verursachen ausgeprägte Geländekanten mit weiten anschließenden Verebnungen, wobei sie den liegenden Knollenmergel vor Abtrag schützen. 26 Geotope im Regierungsbezirk Stuttgart Hangende Bankkalke ζ3 Obere Weißjuramergel (Zementmergel) ζ2 Liegende Bankkalke ζ1 Obere Felsenkalke ε 1-2 Untere Felsenkalke γ 1-4 Mittlere Weißjuramergel (Kimmeridge-Mergel) γ 1-3 Wohlgeschichtete Kalke (Oxford-Kalke) β 1-2 Untere Weißjuramergel (Oxford-Mergel) α 1-2 LfU Untertithonium Oberer Jura Kimmeridgium (Weißer Jura) (Malm) Oxfordium ζ 1-2 Callovium Obere Braunjuratone ε 1-2 Bathonium Oolithische Laibsteinschichten δ 1-2 Kalksandige Braunjuratone γ 1-2 Sandflaserige Braunjuratone β 1-3 Untere Braunjuratone (Opalinuston) α 1-2 Obere Schwarzjuramergel (jurense-Mergel) ζ Posidonienschiefer ε 1-3 Obere Schwarzjuratone δ 1-2 Untere Schwarzjuramergel (numismalis-Mergel) γ Untere Schwarzjuratone (turneri-Tone) β 1-2 Gryphaeenkalke (Arietenkalke) α3 Angulatensandsteine mit Angulatentonen α2 Psilonotentone α1 Mittlerer Jura Bajocium (Brauner Jura) (Dogger) Aalenium Toarcium Pliensbachium Unterer Jura (Schwarzer J.) Sinemurium (Lias) Hettangium Tab. 5: Untergliederung des Jura im Regierungsbezirk Stuttgart (n. GEYER & GWINNER 1984) Das besonders weite Vorspringen des unteren Schwarzjura südlich Stuttgart nach NW beruht auf dessen tektonisch geschützter Tieflage im Fildergraben. Die jüngeren Schichtglieder treten nahe vor dem Albtrauf zutage. Infolge des instabilen Knollenmergels erfolgten am Rande der durch Taleinschnitte stark zerlappten Verebnungen lokal Rutschungen, die Abrisskanten und damit natürliche Aufschlüsse des Schwarzjura hinterließen. Nur noch selten sind seine Sand- und Kalksteine durch ehemalige Steinbrüche angeschnitten. Die übrigen Schichtglieder des Schwarzen Jura bestehen fast nur aus Tonsteinen und Mergeln, sodass sie mit Ausnahme des Posidonienschiefers (der heute noch in Steinbrüchen abgebaut wird) hauptsächlich in Bachrissen anzutreffen sind. LfU Untersuchungsgebiet Der Schwarze Jura α besteht im Wesentlichen aus Tonsteinen mit tonigen Mergeln, Sandsteinen und Kalksteinen sowie kalkigen Aufarbeitungslagen, die z.T. als Leithorizonte dienen. Während Kalksteine im obersten Profilbereich vorkommen, sind Ton- und Sandsteine eigentlich über das Gesamtprofil verteilt, aber im unteren Teil (Tonsteine) bzw. im mittleren Teil (Sandsteine) angereichert. Letztere setzen sich nach BLOOS (1976) aus im Prinzip linsenförmigen Sandsteinkörpern verschiedenster Größe zusammen und besitzen bei Plochingen, wie der gesamte Schwarzjura α auch, ihre maximale Mächtigkeit. Die Untergliederung des Schwarzjura α erfolgt auf Grund lithologischer und paläontologischer Merkmale von unten nach oben in Psilonotentone (α1), Angulatensandsteine (α2) und Gryphaeenkalke (α3). Die über dem Knollenmergel bzw. dem Rät mit einer kalkigen Aufarbeitungslage (Psiloceratenbank) transgressiv beginnenden Psilonotentone bestehen aus sandig-siltigen Tonsteinen und tonigen Mergeln, die lokal Sandsteinkörper (Esslinger, Mutlanger und Ellwanger Sandstein) erhalten. Die Angulatensandsteine setzen sich aus mehreren Sandsteinkörpern sowie zwischenlagernden Tonsteinen und Mergeln zusammen und beginnen unten wie α1 mit einer Kalksteinbank als Aufarbeitungshorizont (Leithorizont "Oolithenbank"). Die Sandsteine sind überwiegend feinkörnig, kalkig gebunden und verwittern gelblich. Sie sind im Hauptsandstein bis zu ca. 7 m mächtig. Unterhalb dessen finden sich noch die Sandsteinkörper des Nassacher, Oberberkener und des Gmünder Sandsteins. Obwohl die Sandsteine früher in zahlreichen Entnahmestellen abgebaut wurden (es wurden sogar einzelne Bänke abgebaut wie der Vaihinger Pflasterstein), sind sie nur noch selten in Steinbrüchen anzutreffen. Etwa dieselben Aufschlussverhältnisse finden sich bei den Gryphaeenkalken, einer Folge von fossilreichen Kalksteinbänken mit schiefrigen Tonstein- und Mergelzwischenlagen, die im obe- 27 ren Teil einen kleineren Sandsteinkörper (Plochinger Sandstein) aufweist. Der Schwarze Jura β zeigt keine nennenswerten Aufschlüsse im Untersuchungsgebiet. Die als Untere Schwarzjuratone bezeichneten Gesteine bestehen aus einer einförmigen Folge von Tonsteinen und Mergeln, die nur selten durch geringmächtige kalkige Lagen unterbrochen werden. Schwarzjura γ und δ führen international die Bezeichnung Pliensbachium, dessen locus typicus bei Pliensbach (Landkreis Göppingen) im gleichnamigen Bachriss vorliegt. Es setzt sich aus den Unteren Schwarzjuramergeln (γ) und den Oberen Schwarzjuratonen (δ) zusammen, die jeweils härtere kalkige Lagen besitzen und sich durch Pyritvorkommen auszeichnen. Der Schwarze Jura ε ist unter der Bezeichnung Posidonienschiefer als wichtige und weltbekannte Fossillagerstätte bekannt. In ihnen sind z.B. Ichthyosaurier mit Weichteilen und Fische fossil erhalten. Einmalige Fossilfundstücke sind im Museum am Löwentor in Stuttgart und im Museum Hauff in Holzmaden ausgestellt. Angaben über die Fossilführung der Posidonienschiefer finden sich z.B. bei HAUFF(1981). Es handelt sich um eine Wechselfolge von schiefrigen Tonmergeln, die durch Bitumen- und Pyritgehalt dunkelgrau gefärbt sind, und von z.T. bitumenhaltigen Kalksteinbänken, die lokal als Laibsteinlagen vorliegen. Sie entstand unter euxinischen Bedingungen in einem Flachmeer, das infolge stagnierender Strömung Wasserschichtung und damit faulschlammähnliche Bildungen im unteren Wasserbereich ermöglichte. Die besten Aufschlüsse der Posidonienschiefer stellen in Betrieb befindliche Steinbrüche in der Umgebung Holzmadens dar, in denen noch der "Fleins", ein harter, etwa 20 cm mächtiger und gut in Platten spaltbarer Schieferbereich als Naturstein gewonnen wird. Die Gesamtmächtigkeit der Posidonienschiefer liegt bei etwa 14 m. Natürliche Aufschlüsse sind selten und allein durch Bachrisse und Prallhänge gegeben. 28 Geotope im Regierungsbezirk Stuttgart Der Schwarze Jura ζ (Obere Schwarzjuramergel) besteht aus blättrigen Mergeln mit zwischengeschaltenen kalkigen Bänkchen und zeigt damit eine Änderung des Sedimentationsmilieus zu sauerstoffreicheren Verhältnissen an. Die Gesteine treten morphologisch nicht in Erscheinung und sind sehr selten aufgeschlossen. 4.3.2.2 Brauner Jura Als mittlere Abteilung des Jura wird der Braune Jura wie auch die übrigen Abteilungen nach der auch heute noch verwendeten Untergliederung in sechs Stufen (Bezeichnung durch griechische Buchstaben α bis ζ) nach QUENSTEDT unterteilt. Im Untersuchungsgebiet tritt der Braune Jura etwa entlang der Linie Nürtingen-Aalen als schmales Band zutage. Hier vermittelt er morphologisch wie auch am übrigen Albtrauf zwischen Albvorland und Steilanstieg des nördlichen Albrandes. Infolge dieser Gegebenheiten ist er zumeist von Hangschutt überdeckt und besitzt selten natürliche Aufschlüsse. Lithologisch handelt es sich beim Braunen Jura um eine (z.T. sandige) Tonsteinfolge mit Zwischenschaltungen von eisenhaltigen Kalksandsteinen und Eisenoolithen als Aufarbeitungshorizonte, was deutliche Änderungen der Sedimentationsverhältnisse belegt. Die gesamte Gesteinsfolge zeigt Mächtigkeiten bis über 200 m, die im Bereich der Mittleren Alb ihr Maximum finden. Eisenhaltige Zwischenschaltungen konzentrieren sich auf etwa den mittleren Profilbereich. Ihr früherer bergmännischer Abbau hinterließ an mehreren Stellen alte Stollen (Aalen, Wasseralfingen, Geislingen). Die auch unter der Bezeichnung Opalinustone bekannten Unteren Braunjuratone bilden den Braunen Jura α, der unmittelbar vor dem Albtrauf zutage tritt und dort unruhig-wellige, oft tief zertalte Landschaftsformen verursacht. NW Aalen verbreitert sich im sog. "Welland" sein durchschnittlich 1-2 km breiter Ausstrich auf bis über 5 km. In der etwa 10 m mächtigen, gleichförmigen Tonsteinserie kommen oft in Lagen angereicherte und z.T. angebohrte Toneisensteingeoden LfU sowie eisenhaltige Kalkmergelsteinkongretionen vor (ETZOLD,1980). Von unten nach oben ist eine Zunahme an Sand und Kalk festzustellen. Fossilien zeigen oft typische Erhaltung mit weißen, z.T. opaleszierenden Schalen. Die durch Pyrit- und organischen Gehalt überwiegend dunkelgrauen, oft schiefrigen Tonsteine werden lokal noch zur Herstellung von Ziegelsteinen abgebaut. Weitere Aufschlüsse bieten Bachrisse mit Prallhängen. Der Braune Jura β (Sandflaserige Braunjuratone) besteht im Untersuchungsgebiet hauptsächlich aus sandflaserigen bis sandigen Tonsteinen, die Einschaltungen von eisenschüssigen Sandsteinen (namengebend für die frühere Stufenbezeichnung "Eisensandstein-Serie"), eisenoolihischen Schichten und Schalentrümmerlagen besitzen. Die Sandsteine sind über die gesamte Profilhöhe verteilt und werden von unten nach oben als Zopfplatten-, Unterer Donzdorfer-, Personaten- sowie Oberer Donzdorfer Sandstein ausgeschieden. Über dem Opalinuston bilden sie als unterste Schichtstufe des Braunen Jura den Hangfuß des Albtraufs. Trotz zahlreicher früherer Abbaustellen sind sie heute nur noch selten aufgeschlossen. Die ehemals bei Aalen, Wasseralfingen und Geislingen gewonnenen Eisenerze gehören zur eisenoolithischen Fazies des süddeutschen Braunjura β, die durch spezielle Sedimentationsbedingungen im Flachmeerbereich (z.B. stärkere Wasserbewegung, Vorhandensein bestimmter Eisenkonzentrationen, Wechsel zwischen Sedimentation und Aufarbeitung) gekennzeichnet ist. Die Herkunft des Eisens wird auf lateritische Verwitterung im relativ nahe gelegenen Festland (Böhmische Masse und Vindelizische Halbinsel im Osten, Rheinisch-ardennisches Festland und Vogesenschwelle im Westen) zurückgeführt. Die Ooide bestehen aus Steineisen und besitzen überwiegend Quarzkörner als Kerne (ETZOLD,1980). Daneben vorkommende Limonitsandsteine sollen teilweise durch Imprägnation entstanden sein. Im Untersuchungsgebiet lagern die in mehreren Flözen angereicherten Eisenoolithe zumeist Sandsteinkörpern auf, sodass sich annähernd eine zyklische Abfolge mit jeweils nach oben zunehmendem Eisengehalt LfU Untersuchungsgebiet und ebenfalls zunehmender Korngröße ergibt. Starke vertikale und laterale Fazieswechsel ermöglichen jedoch keine weitgehenden Parallelisierungen. Die Typusregion des aus Braunjura α und β bestehenden Aaleniums ist die nähere Umgebung Aalens. Der als Kalksandige Braunjuratone bezeichnete Braunjura γ verursacht über den Sandsteinterrassen des Braunjura β oft Hangverflachung und kleinere Verebnungen. Die etwa 10 bis 20 m mächtige Stufe setzt sich überwiegend aus Tonsteinen und Mergel zusammen, denen Kalksteinhorizonte zwischengelagert sind, und die unten mit einer lokal eisenoolithischen Schalentrümmerbank beginnen. Die Aufschlussverhältnisse sind schlecht. Keine besseren Aufschlussverhältnisse bieten die Oolithischen Laibsteinschichten (Braunjura δ), eine in östlicher Richtung von etwa 30 m bis unter 10 m Mächtigkeit abnehmende Schichtenfolge, die hauptsächlich aus dunklen Tonsteinen besteht und mit eisenoolithischen Mergelkalken durchsetzt ist. Letztere sind teilweise wichtige Leithorizonte und sind lokal in Laibsteinlagen übergeführt. Die Schichtenfolge verursacht lokal die zweite Braunjuraschichtstufe, vereinigt sich aber teilweise mit dem Braunjura γ zu einer Stufe. Die damit verbundenen Verebnungen befinden sich unmittelbar vor dem Steilanstieg des Albtraufs. 29 bis etwa 600 m ist er ungefähr doppelt so mächtig wie Schwarzer und Brauner Jura zusammen und baut den eigentlichen Albkörper, die markanteste, höchste und jüngste Großstufe des süddeutschen Schichtstufenlandes, auf. Er tritt somit in der NE streichenden Stirn der Schwäbischen Alb und in deren flach SE fallenden Hochfläche zutage. Weitere Vorkommen sind Weißjurareste auf teilweise tektonisch bedingten Ausliegerbergen vor dem Albtrauf. Dieser verläuft im Untersuchungsgebiet etwa entlang der Linie Neuffen-Lauchheim und grenzt östlich an das Nördlinger Ries, einen tertiären Meteoritenkrater. Die aus Kalksteinen und Mergel bestehenden Gesteine des Weißen Jura können zwei zeitgleichen Magnafazies zugeordnet werden (GEYER & GWINNER,1984), die in den einzelnen stratigraphischen Bereichen jeweils verschieden stark hervortreten. Die erste Magnafazies ist durch die sedimentologische Normalausbildung mit deutlich gebankten Kalkstein-MergelWechselfolgen gegeben, während die Zweite als bankig bis massige, z.T. diagnetisch veränderte Schwamm- und Korallen-Magnafazies bezeichnet werden kann und als häufigstes Gestein den Massenkalk aufweist. 4.3.2.3 Weißer Jura Auf die Regression des Jurameeres folgt der große, bis heute andauernde Zeitabschnitt, in dem insbesondere der Weiße Jura festländischer Verwitterung, Abtragung und Verkarstung ausgesetzt war. Der Nordrand der Weißjuratafel weicht unter Änderung des Entwässerungssystems nach Süden bis zum heutigen Albtrauf zurück und ihre Kalksteine und Mergel verkarsten tiefgreifend. Zeugen dieser Vorgänge sind zum einen teilweise tektonisch bedingte Weißjuravorkommen nördlich des Albtraufs sowie zahlreiche Karsterscheinungen wie Trockentäler, Karstsenken, Dolinen, Höhlen, Karstspalten, Karstquellen und Bachschwinden, die insgesamt den Weißen Jura kennzeichnen. Der Weiße Jura stellt im Untersuchungsgebiet hinsichtlich Geomorphologie, Mächtigkeit und Gesteinsausbildung die auffälligste jurassische Abteilung dar. Mit einer Gesamtmächtigkeit von Das Gesamtprofil des schwäbischen Jura zeigt drei Bereiche, in denen Mergel vorherrschen (Untere, Mittlere und Obere Weißjuramergel) und die jeweils von Kalksteinkomplexen überlagert sind. Eine weitergehende Untergliederung Braunjura ε und ξ können als Obere Braunjuratone zusammengefasst werden. Sie bestehen aus Tonsteinen und Mergeln sowie zwischengeschalteten, eisenooidführenden Laibsteinbänken und eisenoolithischen Lagen. Die Gesamtmächtigkeit nimmt von etwa 20 m im Westen auf etwa 5 m im Osten ab. Da der schmale Ausstrich dieser Gesteine stets durch Weißjurahangschutt überdeckt ist, fehlt es an Aufschlüssen. 30 Geotope im Regierungsbezirk Stuttgart kann wie bei den anderen beiden Juraabteilungen nach QUENSTEDT vorgenommen werden. Die Schichten des Weißen Jura α werden als Untere Weißjuramergel oder als Oxfordmergel bezeichnet und streichen am Hangfuß des Albtraufs aus, wo sie jedoch überwiegend von Hangschutt bedeckt sind. Die bis ca. 80 m mächtige Schichtfolge besteht aus überwiegend hellgrauen Mergeln und Kalkmergeln, in die sich nach oben zunehmend Kalksteinbänke einschalten. Die Schwamm-Magnafazies ist im Weißjura α des Untersuchungsgebietes nicht vertreten. Wegen ihrer geringen Verwitterungsresistenz und ihrer Lage am Hangfuß besitzen die Unteren Weißjuramergel nur gelegentlich Aufschlüsse. Diese sind durch Hangabrisse infolge Rutschungen gegeben, zeigen aber nie ein Gesamtprofil. Die Grenze zum Braunen Jura ist nirgends aufgeschlossen. Der Weiße Jura β besteht aus den Wohlgeschichteten Kalken (Oxfordkalke), einer in ihrer Mächtigkeit von NE nach SW (ca. 15 m bis 30 m) zunehmende Kalkstein-Mergel-Wechselfolge, die in ihrer Erscheinungsform als gebankte Kalksteine mit Mergelfugen deutlich gekennzeichnet ist. Die überwiegend ebene Bankung hält weit durch, sodass z.T. Bank-für-BankParallelisierungen auf größere Distanzen realisierbar sind (SCHMIDT-KALER 1962, WEILER 1957). Diese Normalfazies wird lokal durch verschwammte Bereiche oder einzelne Schwämme unterbrochen. Morphologisch bilden die Wohlgeschichteten Kalke den ersten steilen Hanganstieg am Albtrauf und enden oben meist mit einer gut erkennbaren Geländekante. Lokal verursachen sie aber auch an die Kante anschließende Schichtflächen-Verebnungen (βTerrassen) wie z.B. westlich Geislingen a.d. Steige. Die Wohlgeschichteten Kalke bieten gute Aufschlussverhältnisse, die sowohl durch aufgelassene Steinbrüche (z.T. mit vollständig aufgeschlossenem Weißjura β) als auch durch natürliche Aufschlüsse gegeben sind. Letztere sind hauptsächlich tief eingeschnittene Quellnischen und durch Erdrutsche oder Bergstürze entstandene Hangabrissflächen. Als wichtigste Karst- LfU sohlschicht stauen die Unteren Weißjuramergel Wasser, sodass im stratigraphischen Grenzbereich Weißjura α/β Karstquellen austreten. Durch die instabilen Mergel im Liegenden und infolge rückschreitender Erosion entstanden in den Wohlgeschichteten Kalken Quellnischen mit bis zu über 20 m hohen Steilwänden (z.B. Bauernloch E Neuffen). Die Austrittsstellen dieser Schichtquellen sind z.T. Eingänge größerer Karsthöhlen (z.B. Mordloch NE Geislingen a.d. Steige mit einer Gesamtlänge von über 2000 m).Die Entstehung von Hangabrissflächen in den Wohlgeschichteten Kalken beruht ebenfalls auf der Instabilität der Unteren Weißjuramergel in Verbindung mit ihrer Funktion als Wasserstauer. Wie beim Weißen Jura α sind auch die Schichten des Weißen Jura γ (Mittlere Weißjuramergel) durch das Vorherrschen von Mergeln und Kalkmergeln gekennzeichnet, in die sich Kalksteinbänke zwischenschalten. Die in der Mittleren Alb bis etwa 60 m mächtige und in der Ostalb bis ca. 20 m Mächtigkeit abnehmende Schichtfolge streicht im Steilanstieg der Alb aus und verursacht dort gelegentlich Hangverflachungen, ist aber überwiegend durch Hangschutt verdeckt, sodass Aufschlüsse selten sind. Die Mittleren Weißjuramergel sind fossilreich und weisen im Bereich der Mittleren Alb ihren höchsten Tongehalt auf. Ähnlich wie bei den Wohlgeschichteten Kalken im Liegenden ist die Schwammfazies nur durch lokal vorkommende verschwammte Partien und einzelne Schwammstotzen vertreten, während in der Westalb stellenweise die gesamte Schichtfolge in Schwammfazies vorliegt und dort die Bezeichnung "Lochenfazies" trägt. Mit dem als Untere Felsenkalk bezeichneten Weißjura δ setzt im Untersuchungsgebiet neben der bestehenden Normalfazies die Schwammund Korallen-Magnafazies erst richtig ein, wobei Schwamm- Stromatolithkalke, Zuckerkörnige Kalke und Dolomite in Massenkalkausbildung vorliegen. Mergelführende Partien der Normalfazies sind dann in Flaserkalke übergeführt, die durch flaserige Schichtung, Einzelschwämme, LfU Untersuchungsgebiet Kalkkrusten und Führung von Schwammnadeln gekennzeichnet sind. Die Normalfazies ist durch eine bis etwa 50 m mächtige Schichtfolge gegeben, die überwiegend aus Kalksteinbänken mit nach oben abnehmenden Mergelzwischenlagen besteht und oben mit dickbankigen Kalksteinen ("Quaderkalk") abschließt. Letztere lagern auf der Glaukonitbank, einem meist zweigeteilten, glaukonitischen Kalkmergelhorizont, der infolge Verwitterung stets eine Hohlkehle bildet und lokal sogar noch im Massenkalk zu erkennen ist. Die Massenkalkausbildung ist besonders im oberen Weißjura δ weit verbreitet und bewirkt Mächtigkeitserhöhungen, die das Gesamtprofil des Weißjura δ bis auf über 100 m anschwellen lassen können. Es handelt sich vor allem um Schwamm-Stromatolith-Riffe, die sich aus kuppigen bis turmartigen Formen mit dazwischenliegenden Biostromen zusammensetzen. Letztere zeigen oft annäherungsweise Bankung an. Lateral gehen diese biohermalen Bildungen mit Übergängen in Normalfazies über. Zuckerkörnige Kalke und Dolomite weisen Übergänge auf und stellen Sekundärbildungen dar. Sie sind auch in der Normalfazies zu finden. Morphologisch macht sich der Weißjura-δMassenkalk besonders bemerkbar, indem er mit zahlreichen Felsenkränzen die Oberkante des Albtraufs sowie die Oberkante der in die Albhochfläche eingetieften Täler bildet. Desweiteren tritt er in der randlichen Albhochfläche zutage, wo er kuppige Oberflächenformen verursacht und mit zahlreichen Dolinen intensive Verkarstung anzeigt, die insbesondere durch das Vorhandensein vieler Höhlen und Karstspalten in den Felsenkränzen deutlich wird. Eine weitere Erscheinungsform des Weißjura-δ-Massenkalks sind knapp unterhalb der Oberkante des Albtraufs vorkommende Felsgruppen und Einzelfelsen, die stellenweise als durch die Verwitterung gut herauspräparierte Felsnadeln oder turmförmige Partien vorliegen und Riffeinzelformen darstellen können. Im Weißen Jura ε, den Oberen Felsenkalken, herrscht wie im oberen Weißjura δ die massige 31 Schwammfazies noch vor, sodass die Grenzziehung zwischen beiden Stufen oft schwierig ist. Der basale Bereich ist z.T. dolomitisch ausgebildet und verursacht lokal eine weitere Felsenreihe über denen der Unteren Felsenkalke. Sein hauptsächliches Vorkommen liegt auf der Albhochfläche, wo er am nördlichen Randbereich größere Flächen einnimmt und oft von Verwitterungslehm überdeckt ist. Der in der Regel ca. 30 m und bei Massenkalkausbildung bis über 50 m mächtige Weißjura ε zeigt im Bereich der Ostalb eine Sonderausbildung, die durch das Vorkommen von Kieselknollen (unregelmäßig schichtparallel angereichert oder massenhaft vorkommend) in massigem bis undeutlich gebanktem Kalkstein gekennzeichnet ist und als Weißjura-Kieselkalk bezeichnet wird. Neben seiner Hauptverbreitung im Weißjura ε greift er stratigraphisch noch in dessen Liegendes und Hangendes über. NW Böhmenkirch sind die Kieselknollen stellenweise so stark vertreten, dass sie den Kalkstein nahezu verdrängen. Ihre Entstehung wird mit diagenetischen Vorgängen in kieselschwammhaltigen Kalken begründet. Weißjura-Kieselkalke sind in mehreren, meist aufgelassenen Steinbrüchen aufgeschlossen. Den oberen Abschluss des schwäbischen Jura bildet der Weiße Jura ζ,dessen jüngste Schichten noch vor Ende der Jurazeit sedimentiert wurden. Die aus Kalksteinen und Mergeln bestehende Schichtenfolge nimmt im Untersuchungsgebiet große Teile der Albhochfläche ein und verursacht dort eine flachere Morphologie als die Oberen Felsenkalke. Neben der bestehenden Normalfazies ist die Schwamm- und Korallenfazies noch relativ weit verbreitet, klingt aber nach oben zusehends aus. Während die Schwammfazies schon mit dem Unteren Weißjura einsetzt, ist das Vorkommen der Korallenfazies auf den Weißjura ζ beschränkt. Zu Letzterer zählen auch oolithische Trümmerkalke, eine lokale Sonderfazies. Auf Grund lithologischer Merkmale können die Schichten des Weißjura ζ von unten nach oben in die Liegenden Bankkalke (ζ1), die Oberen Weißjuramergel (ζ2) und die Hangenden Bank- 32 Geotope im Regierungsbezirk Stuttgart kalke (ζ3) untergliedert werden. Ihre Grenzen sind jedoch nicht immer mit Zeitgrenzen identisch. Die Liegenden Bankkalke bestehen aus einer bis über 50 m mächtigen Folge von Kalksteinund Mergelkalkbänken mit Mergelfugen, die in ihrer Ausbildung an die Wohlgeschichteten Kalke (Weißer Jura β) erinnern. In der Nähe von Massenkalkvorkommen finden sich oft brekziöse Bereiche, deren Entstehung mit submarinen Gleitungen begründet wird. Abweichend von dieser Normalfazies treten die Schwammfazies mit aus Schwammstromatolithen bestehendem Massenkalk und die Korallenfazies mit Riffen und Riffschuttdecken auf, wobei die Riffe dem Massenkalk oft auflagern und beide in die Oberen Weißjuramergel hineinragen. Die vor allem auf der Ostalb vorkommende Korallenfazies lässt auf Bildungsbedingungen in geringen Wassertiefen schließen. Den mittleren Teil des Weißjura ζ bilden die Oberen Weißjuramergel, eine bis über 120 m mächtige, mergelige Schichtfolge, die im Untersuchungsgebiet mit den Zwischenkalken und dem Brenztaloolith zwei Sonderbildungen zeigt. In ihrer Normalausbildung bestehen die auch als Zementmergel bezeichneten Oberen Weißjuramergel aus Mergel und Kalkstein sowie deren Mischungsreihe und weisen deshalb wechselnden Kalkgehalt auf. Ihre Sedimentation erfolgte über einem starken submarinen, durch Massenkalkriegel entstandenen Relief in lagunärer Fazies. Hohlformen dieses Reliefs werden als ζSchüsseln bezeichnet (MALL,1968),die wiederum in Haupt-, Teil- und Sekundärschüsseln entsprechend der Vollständigkeit der Schüsselsedimente unterteilt werden können. Auf Grund dieser Reliefformen liegt eine Verzahnung zwischen Massenkalk und geschichteter Fazies vor. Nach dem Maximum des Schwammwachstums im Weißen Jura δ4 gibt es einen weiteren Höhepunkt im Weißjura ζ1, der diese "Schüsseln" aufbaut. Erst im Weißjura ζ3 läuft mit dem Vorkommen einzelner Schwämme ihr Wachstum aus. In der Ostalb werden die Oberen Weißjuramergel lokal durch die Zwischenkalke, eine bis etwa LfU 60 m mächtige Folge gebankter Kalksteine in ein Unteres und ein Oberes Mergellager getrennt. Hiermit zeigt sich ein starker lateraler und horizontaler Fazieswechsel an, der von erheblichen Mächtigkeitsschwankungen begleitet wird. Die Zwischenkalke sind in Steinbrüchen bei Steinweiler und Mergelstetten gut aufgeschlossen. Neben der durch Flaserkalk und Massenkalk vertretenen Schwammfazies tritt in den Oberen Weißjuramergeln besonders die Korallenfazies mit Korallenriffbildungen, korallenführenden Kalksteinen und Mergeln sowie Riffschuttablagerungen mit oolithischen Trümmerkalken hervor. Letztere führen teilweise Korallen und weisen mit dem in der Umgebung Heidenheims anstehenden Brenztaloolith ihre größte Mächtigkeit (ca. über 60 m) auf. Es handelt sich um dickbankige bis massige Kalksteine mit teils gerundeten Echinodermen-, Brachiopoden- und Lamellibranchiatenbruchstücken sowie Ooiden in einer kristallinen oder feinkörnig-dichten Grundmasse (BEURER,1963). Teilweise deutlich auftretende Schrägschichtungsstrukturen lassen auf Ablagerung großer Detritusmassen in strömendem Wasser schließen. Stratigraphisch ist das Hauptvorkommen des Brenztalooliths den Oberen Weißjuramergeln zuzuordnen, mit denen er sich lateral verzahnt und die er lokal fast vollständig verdrängt. Mit dem oberen Teil des Weißjura ζ, den Hangenden Bankkalken, schließt der Schwäbische Jura noch vor Ende der Jurazeit ab. Die Obergrenze dieser durch Mergelfugen deutlich gebankten Kalksteine ist nirgends aufgeschlossen und es liegen Mächtigkeiten bis über 50 m vor. Ihr hauptsächliches flächenhaftes Vorkommen liegt entsprechend des Schichtstufenbaus im südöstlichen Raum des Untersuchungsgebietes, wo sie z.T. durch Geländekanten begrenzte Hochflächen bilden. Am Südrand fallen diese Kanten großenteils mit der Klifflinie des Miozänmeeres (Voralpensenke) zusammen. Die Kalksteine sind teilweise oolithisch und gehen lokal seitlich in den Brenztaloolith über, der stratigraphisch noch nach unten in ζ1 und nach oben in ζ3 hineinragt. LfU Im Alttertiär erfolgten nach beginnender Einsenkung des Oberrheingrabens erste Ablagerungen in der Voralpensenke (Molassetrog), wobei in beiden Regionen zeitweise marine Sedimentationsbedingungen herrschten. Durch die Bildung des Oberrheingrabens änderte sich das bisher epigenetische Entwässerungssystem des aufgetauchten mesozoischen Schichtpaketes, das bereits ein generelles Einfallen nach Süden mit Übergang in den Molassetrog zeigte. Während die deckende Weißjuraplatte vom heutigen Albtrauf ausgehend noch weit nach Norden reichte (Beweise liefern Weißjurareste, z.B. der Langenbrückener Senke im Kraichgau), bildete sie im Süden durch ihr gleichgerichtetes Abtauchen die Nordgrenze der Molassemeere, insbesondere im Untermiozän, in welchem das jüngere Molassemeer (Obere Meeresmolasse) die Klifflinie, eine an vielen Stellen von Tuttlingen im SW bis über Giengen im NE erkennbare Steilküste schuf. Ihr bester Aufschluss befindet sich in Heldenfingen (Landkreis Heidenheim),wo noch Bohrmuschellöcher tertiären Alters erhalten sind. Südlich dieser Klifflinie sind im Untersuchungsgebiet noch Ablagerungen der Oberen Meeresmolasse erhalten. Die Schwammfazies klingt mit einzelnen Stotzen und Massenkalkkuppeln, die teilweise als Spitzen größerer Massenkalkkomplexe die Hangenden Bankkalke durchstoßen, aus. Korallenkalke kommen bereichsweise im Verband mit Trümmeroolithen vor. Da im Untersuchungsgebiet Gesteine der Kreidezeit nicht nachgewiesen sind, stellen die Hangenden Bankkalke hier die jüngsten mesozoischen Sedimente dar. Nach ihrer Ablagerung folgt also eine lange, bis heute andauernde Epoche der Abtragung und Verwitterung des als flacher Rumpf landfest gewordenen Gebietes der heutigen Schichtstufenlandschaft, deren morphologische Grundzüge sich im Tertiär herausbildeten. 4.3.3 Tertiär Tertiäre Gesteine des Untersuchungsgebietes (Gliederung siehe Tab. 6) treten nur in dessen südlichem und südöstlichem Randbereich und in geringer flächenhafter Verbreitung zutage. Sie lassen sich in Sedimentgesteine (marine Sedimente der Voralpensenke und terrestrische Sedimente),vulkanische Gesteine (größtenteils Tuffe, zu einem geringen Anteil liquidmagmatische Gesteine) und in durch Meteoriteneinschlag entstandene oder beeinflusste Gesteine (Impaktgesteine des Ries und des Steinheimer Beckens) unterteilen und sind überwiegend dem Jungtertiär zuzuordnen. Pliozän Im Jungtertiär, insbesondere im Miozän, herrschte in Süddeutschland eine rege vulkanische Tätigkeit, die innerhalb des Untersuchungsgebietes durch das Vorkommen zahlreicher Schlote des aus über 300 kleinen Schloten bestehenden "Schwäbischen Vulkans" (Gebiet º > Miozän ¼ Oligozän º Eozän Paläozän Tab. 6: Gliederung des Tertiärs. 33 Untersuchungsgebiet > ¼ Jungtertiär Alttertiär 34 Geotope im Regierungsbezirk Stuttgart Urach-Kirchheim) belegt ist. Bis in die 60-er Jahre d. Jh. wurden Ries und Steinheimer Becken noch als vulkanische Bildungen diskutiert, bis sich ihre Entstehung als Folge von Einschlägen kosmischer Körper erwies. Im Obermiozän entstanden durch Meteoriteneinschläge die Krater des Ries und des Steinheimer Beckens mit Durchmessern von 25 km bzw.3 km, wobei große Mengen an Auswurfmassen ihre nähere Umgebung überdeckten. In den Kratern und in genügend tief erodierten Vulkanschloten bildeten sich Seen und damit nachfolgend limnische Sedimente. Fluviatile Sedimente liegen als Reste von Schotterdecken (z.B. der Urbrenz) oder als Sand- und Tonfüllungen von Karstspalten und anderen Karsthohlräumen vor. Insbesondere im Obermiozän und im Pliozän erfolgte eine kräftige Hebung und eine damit einhergehende Verkarstung, wobei sich unter lateritischer Verwitterung Bohnerztone bildeten, die heute in Karsthohlräumen oder als deckenförmige Ansammlungen in flachen Mulden der Albhochfläche anzutreffen sind und oft Säugetierknochen enthalten. Mit ausgehendem Tertiär war infolge des durch den Einbruch des Oberrheingrabens neu entstandenen Entwässerungssystems und infolge verstärkter Hebung und Südkippung der mesozoischen Schichttafel im Jungtertiär das Schichtstufenrelief durch Abtragung und Verwitterung bereits weitgehend herauspräpariert. Die vulkanischen Gesteine des Untersuchungsgebietes, das in seinem südlichen Randbereich noch etwa die Nordhälfte des "Schwäbischen Vulkans" einnimmt, sind größtenteils Basalttuff-Füllungen der durch Gasausbrüche entstandenen zahlreichen Schlote. Der Basalttuff setzt sich aus Aschen, Lapilli und aus mitgerissenen Bruchstücken des durchschlagenen Nebengesteins zusammen, das lokal auch als große Sinkschollen in den Schloten liegen kann. Das in den Schlotfüllungen vorhandene Nebengestein besteht überwiegend aus Deckgebirge und selten aus zusätzlich beigemengten Grundgebirgsbruchstücken. Ist jüngeres Nebengestein im Schlot vorhanden als das in der Umgebung des Schlotes anstehende, ergeben sich Anhaltspunkte über das Ausmaß der Abtragung in LfU dem betreffenden Gebiet. So beweisen Weißjuragesteine im nördlichsten Schlot bei Scharnhausen/Filder (Landkreis Esslingen), dessen Anschnitt jetzt im Mittleren Keuper liegt, dass im Miozän Weißjuragesteine hier noch über 20 km weiter nach Norden reichten als heute. Die nur selten bis auf heutige Anschnitthöhe der Schlote emporgestiegene, liquidmagmatische Komponente ist kaum aufgeschlossen. Das in Gängen vorkommende, früher als Basalt angesprochene Gestein wird heute als Melilithit bezeichnet (GEYER & GWINNER,1984). Sein bester Aufschluss befindet sich bei Owen (Landkreis Esslingen; Steinbruch Feuerbölle). Wegen der zumeist fehlenden liquidmagmatischen Komponente wurden die Schlote "Vulkanembryos" genannt. Die rundlichen Schlotquerschnitte besitzen Durchmesser von einigen Zehner Metern bis maximal 1300 m (durchschnittlich ca. 300 m). Die Hauptansammlung der das Grund- und Deckgebirge durchsetzenden Schlote konzentriert sich etwa im 20 km-Umkreis von Urach, ist also auf der Mittleren Alb und deren Vorland gelegen. Im Albvorland, wo diese Durchschlagsröhren oft von weniger verwitterungsresistenten Gesteinen des Schwarzen und des Braunen Jura umgeben sind, sind ihre Tuff- und Nebengesteinsfüllungen oft als Härtlinge herauspräpariert. Dagegen bilden sie auf der Albhochfläche in den umgebenden Kalken meist flache Senken und wirken wasserstauend, was zu Moorbildungen führte (z.B. Schopflocher Moor). Die üblicherweise durch vulkanische Ausbrüche entstehenden Trichter mit Wällen von Auswurfmassen und nachfolgender Seenbildung (Maare) sind nirgends erhalten. Als Beweis dafür, dass es Maare gegeben hat, gelten limnische Ablagerungsreste im sog. Randecker Maar, dem größten Schlot des "Schwäbischen Vulkans". Der am Albtrauf gelegene Maarkessel, dessen Sedimentfüllung durch den zum Albvorland fließenden Zipfelbach schon weitgehend ausgeräumt ist, enthält noch kaum aufgeschlossene Reste limnischer Sedimente (Süßwasserkalke, Tonsteine und Dysodile), die mit verschwemmten und verlehmten Tuffen verzahnt sind. LfU Untersuchungsgebiet Das Vorkommen von (erbohrten) Thermalwässern (z.B. Beuren, Landkreis Esslingen) steht im Zusammenhang mit dem "Schwäbischen Vulkan", in dessen Bereich eine positive Wärmeanomalie vorliegt. Die Impaktgesteine des Ries und des Steinheimer Beckens sind durch Meteoriteneinschläge neu zusammengesetzte oder umgeformte Gesteine. Während das Steinheimer Becken auf der Ostalb und damit im Untersuchungsgebiet liegt, gehört zu letzterem nur der westliche Randbereich des Rieskraters. Seine Impaktgesteine unterscheiden sich von denen des Steinheimer Beckens grundsätzlich durch das Vorhandensein von Grundgebirgsmaterial und Gesteinen der Trias (insbesondere des Keupers), der Kreide und des Tertiärs, die den jurassischen Gesteinen beigemengt sind. Desweiteren weisen sie einen viel höheren Grad der Stoßwellenmetamorphose als die Impaktgesteine des Steinheimer Beckens auf, was ebenfalls auf die unterschiedliche Größe und Aufschlagskraft der Meteoriten zurückzuführen ist. Durch den Aufprall und das Eindringen der Meteoriten in die Erdkruste entstanden tiefe Einschlagkrater (Ries ca. 400 m, Steinheimer Becken ca. 200 m), wobei Auswurfmassen bis zu 50 km weit (Ries) geschleudert wurden. Die durch den Aufprall erzeugten Druck- und Temperaturerhöhungen verursachten Veränderungen in den betroffenen Gesteinen (Metamorphose), die z.T. sogar schmolzen. In den Kratern entstanden durch Grundwasser und Niederschläge zunächst abflusslose Seen und damit limnische Ablagerungen, von denen heute infolge fluviatiler Ausräumung z.T. nur noch Reste anstehen. Hierauf beruht die jetzt flache Schüsselform der ehemaligen Krater. Die im Untersuchungsgebiet liegenden Impaktgesteine des Ries befinden sich im westlichen Kraterrandbereich (vom Kratervorland ausgehend bis ca. 2 km innerhalb des Kraterrandes) und können in Bunte Trümmermassen (sedimentäre Auswurfmassen, bestehend aus allochthonen Schollen, Bunter Brekzie und Gries) und Kristalline Trümmermassen (aus Grundgebirge zusammengesetzte Auswurfmassen, bestehend aus allochthonen Grundgebirgsschollen 35 und polymikten Kristallinbrekzien mit Suevit als Sonderausbildung) unterteilt werden (CHAO et al.,1983), wobei erstere den größten Anteil der Auswurfmassen bilden. Die nicht mehr an ihrem Entstehungsort gelegenen Schollen liegen meist noch in ihrem ursprünglichen Gesteinsverband vor und sind meist in kleinerstückigem Gemenge, in der Bunten Brekzie eingelagert. Feinkörnige Brekzien werden, insbesondere wenn sie aus Weißjurakalken bestehen, als Gries bezeichnet. Die kristallinen Trümmermassen setzen sich überwiegend aus Schollen zusammen. Die mengenmäßig untergeordneten polymikten Kristallinbrekzien sind überwiegend aus Grundgebirgsmaterial bestehende Gesteine und treten in Gangform oder als Ausfüllung zwischen disloziierten Schollen, seltener als kleine Vorkommen innerhalb sedimentärer Auswurfmassen zutage. Polymikte Kristallinbrekzien mit zu Glas geschmolzenen Gesteinsanteilen werden als Suevit bezeichnet, der durch das Vorkommen von bis mehreren dm großen Glasbomben mit Flugform näher gekennzeichnet ist. Die Impaktgesteine des Steinheimer Beckens bestehen ausschließlich aus jurassischen Gesteinen, vorwiegend aus Weißjura, und können in allochthone Schollen, Bunte Brekzie und Gries unterteilt werden. Die kraterauswärts disloziierten Schollen blieben als geschichtete Kalksteine mehr oder weniger im Verband, zeigen aber lokal Faltung und Vergriesung und sind am inneren Kraterrand aufgeschlossen. Im Kraterzentrum entstand durch den Einschlag ein aus Gesteinen des Schwarzen, Braunen und vorwiegend Weißen Juras bestehender Zentralhügel (Steinhirt und Klosterberg), der sich aus Schollen und Brekzien aufbaut, aber keine Schollenaufschlüsse besitzt. Auf dem Zentralhügel wurden durch die Druckerhöhungen der Stoßwelle entstandene Strahlenkalke gefunden. Bei der Bunten Brekzie unterscheidet man zwischen derjenigen, die sich außerhalb des Kraters absetzte, und der in den Krater zurückgefal- 36 Geotope im Regierungsbezirk Stuttgart lenen Primären Rückfallbrekzie (GROSCHOPF & REIFF,1966), die den größten Anteil ausmacht. Sie setzen sich zu einem geringen Anteil aus Braunem Jura und zum größten Teil aus Weißem Jura zusammen, zeigen lokal Vermischung beider Gesteinsgruppen und sind teilweise sekundär durch kalkige Bindemittel verfestigt. Der lokal vorkommende Gries besteht hauptsächlich aus stark beanspruchtem Massenkalk und konzentriert sich entsprechend den vorhandenen Aufschlüssen auf den Beckenrand, wo er z.T. graduell in unbeeinflusstes Gestein übergeht. Die hauptsächlich am Beckenrand und am Zentralhügel noch erhaltene, restliche sedimentäre Füllung des Steinheimer Beckens besteht aus kaum noch aufgeschlossenen gebankten Kalken, Kalksanden ("Schneckensande") und Algenkalken. Bei den "Schneckensanden" handelt es sich um teils verfestigte, fossilreiche Kalksande, in denen lokal kleine Algenstotzen und verkieselte Partien vorkommen. Sie enthalten in großen Massen winzige fossile Schneckengehäuse (Planorben) und eine reiche Vertebratenfauna. Ihr bester Aufschluss ist die Pharion´sche Sandgrube am südlichen Ortsrand Steinheims (paläontologische Grabungsstelle). Algenkalke entstanden als bis zu 10 m hohe Riffe (Steinhirt) in Flachwasserzonen des Zentralhügelbereichs (GROSCHOPF & REIFF,1982). Von der über 400 m mächtigen Sedimentfüllung des Rieskraters sind innerhalb des Untersuchungsgebietes Algenkalke aufgeschlossen. Sie entstanden in flacheren Wasserzonen in der Nähe des Kraterrandes und treten morphologisch als Hügelkette SW Goldburghausen in Erscheinung. Die tertiären Sedimentgesteine des Untersuchungsgebietes setzen sich hauptsächlich aus Ablagerungen der Oberen Meeresmolasse, Bohnerztonen, fluviatilen Sanden und Schottern sowie aus den bereits aufgeführten limnischen LfU Sedimentfüllungen des Randecker Maars, des Ries und des Steinheimer Beckens zusammen. Die im älteren Jungtertiär entstandenen Ablagerungen der Oberen Meeresmolasse sind im Südosten des Untersuchungsgebietes bei Dettingen und Ballmertshofen (Landkreis Heidenheim) aufgeschlossen. Es handelt sich um schwach verfestigte, marine Sande, die lokal herauswitternde Kreuzschichtungsstrukturen und eingeregelte Schalentrümmer aufweisen. Das damalige Meer der Voralpensenke hinterließ eine heute als Geländekante erkennbare, ehemalige Küstenlinie (Kliff) auf dem südlichen Albkörper, welche die Grenze zwischen der nördlich gelegenen Kuppenalb und der südlich gelegenen Flächenalb bildet. An flacheren Vorstufen dieser fossilen Steilküste sind lokal in Massenkalk eingetiefte Löcher von Bohrmuscheln und Bohrwürmern erhalten. Daran schließt die flach S fallende Brandungsplattform an, die meist von Sanden der Oberen Meeresmolasse überlagert ist. Weitere Vorkommen der Oberen Meeresmolasse sind von Auswurfmassen des Rieskraters überdeckt und im Kontaktbereich mit diesen vermengt, wobei lokal auch in kleinerem Ausmaß Teile der Oberen Süßwassermolasse enthalten sein können. Das Vorhandensein größerer Vorkommen von Bohnerztonen in Reliefhohlformen der Albhochfläche war im vorigen Jahrhundert Anlass zu einem regen Erzbergbau, von dem noch zahlreiche kleine Tagebaugruben und Pingen erhalten sind. Desweiteren findet man Bohnerztone als Füllung vieler Karstspalten. Die in Verwitterungsschichten der Kalksteine konkretionär entstandenen Bohnerze sind erbsen- bis bohnenförmige Brauneisensteinstückchen, die sich in meist rotbraunen Tonen und Lehmen anreicherten. Eine flächenmäßig größere Verbreitung haben Feuersteinlehme, die Verwitterungsprodukte der Weißjurakieselkalke (Weißer Jura ε) sind. Bohnerztone und -lehme sowie Feuersteinlehme werden als umgelagerte Verwitterungsrückstände angesehen. LfU Untersuchungsgebiet Fluviatile Sande und Schotter tertiären Alters sind selten und nur auf der Albhochfläche aufgeschlossen, wo sie als Sandfüllungen einiger Karstspalten oder als Reste alter Schotterterrassen anstehen. Das bekannteste Vorkommen sind die Ochsenbergschotter, die N Heidenheim über 100 m über der Talsohle der Brenz liegen und Ablagerungen der Urbrenz darstellen, deren Ursprung sich im Albvorland befand. 4.3.4 Quartär Das in die Abteilungen Pleistozän ("Eiszeitalter") und Holozän (jüngere Abteilung einschließlich Gegenwart) gegliederte Quartär überdeckt als jüngste Formation größtenteils die älteren Gesteine. Während des Pleistozäns befand sich das Untersuchungsgebiet im periglazialen Raum, also außerhalb der vereisten Bereiche. Die pleistozänen Bildungen können in fluviatile und äolische Ablagerungen, Sauerwasserkalke und eiszeitliche Verwitterungsbildungen unterteilt werden. Fluviatile Ablagerungen sind hauptsächlich durch Terrassenschotter, Kies- und Sandablagerungen von Flüssen gegeben. Meist handelt es sich um künstliche und seltener um natürliche Aufschlüsse. Aufgeschlossen sind Schotter des Neckars bei Stuttgart BadCannstatt, wo sie von Travertin überlagert sind, sowie bei Heilbronn, wo sie als "Frankenbacher Sande" leicht verfestigt vorliegen. Die nach Fossilfunden in das Altpleistozän gestellten Goldshöfer Sande kommen im Bereich AalenEllwangen vor. Sie stellen aus Stubensandstein und Sandsteinen des Schwarzen und Braunen Juras entstandene Ablagerungen der Urbrenz dar. Gute Aufschlüsse finden sich nur in aktiven Sandgruben. 37 kalke entstanden in Interglazialen als Mineralwasserabsätze von Quellen, die Mittlerem und Oberem Muschelkalk entstammen. Der Travertin liegt in Form mehrerer, verschieden großer und verschieden alter Komplexe vor, die als Sinterterrassen in diesem Abschnitt des Neckartals gebildet wurden teilweise durch Lehmzwischenlagen untergliedert werden. Durch die unterschiedliche relative Höhenlage der einzelnen Vorkommen, ihre Verbandsverhältnisse mit Neckarschottern, Lößüberlagerung und Fossilfunde liegen genaue stratigraphische Zuordnungen vor (REIFF 1955,1965). Als eiszeitliche Verwitterungsbildungen sind kleinere Blockansammlungen des Buntsandsteins, der Keupersandsteine und der Kalksteine des Muschelkalks und des Juras zu erwähnen, die durch verstärkte Frostverwitterung und Abgleiten der Blöcke infolge Solifluktion ihres Untergrundes entstanden. Desweiteren entstanden im Pleistozän lokal mächtige Hangschuttdecken, die meist aus lehmigem Gesteinsschutt bestehen und talwärts krochen. Auf der Schwäbischen Alb liegt an Hangfüßen stellenweise fast reiner, splittriger Kalksteinschutt in größeren Massen vor, der lokal in geringem Maß noch abgebaut wird und z.T. durch Kalksinter leicht verfestigt ist ("Nägelesfels"). Äolische Bildungen pleistozänen Alters sind z.T. mächtige Lößdecken, die als feinkörnige Massen aus Schotterflächen der Oberrheinebene ausgeweht wurden und sich auf den Muschelkalk-Lettenkeuper-Flächen und am Fuß der Keuperberge absetzten. Der größte Aufschluss befindet sich bei Heilbonn-Böckingen. Unter den holozänen Bildungen treten neben den kaum aufgeschlossenen jungen Schotterterrassen, Auelehmen, Hangschuttmassen und Böden insbesondere zahlreiche Vorkommen von Süßwasserkalken (Kalksinter) hervor, die sich größtenteils noch rezent vergrößern. Das poröse Gestein entsteht in der Umgebung kalziumhydrogenkarbonatreicher Quellen infolge Ausfällung, wenn durch Erwärmung und erhöhte Durchbewegung des Wassers oder durch Assimilation von Pflanzen (insbesondere Moose) Kohlensäure entzogen wird. Wie bei dem unter gleichen Voraussetzungen entstandenen Bad Cannstatter Travertin bildeten sich mächtige, terrassenförmige Ablagerungen. Die letzte Abbaustelle dieses früher geschätzten Bausteins wurde Ende der 80-er Jahre aufgelassen. Die im Stuttgarter Nordosten anstehenden, als Cannstatter Travertin bekannten Sauerwasser- Als weitere holozäne Bildungen sind schließlich noch die in abflusslosen Hohlformen über was- 38 Geotope im Regierungsbezirk Stuttgart serstauendem Gestein (Lehm, Basalttuff) entstandenen Moore kleineren Ausmaßes zu erwähnen, von denen das auf der Albhochfläche in LfU einem Vulkanschlot gelegene Schopflocher Moor als Einziges abgebaut wurde.