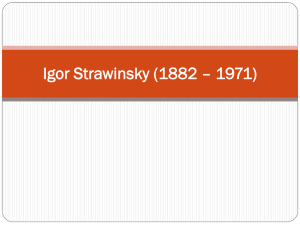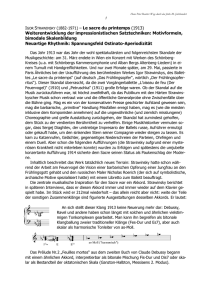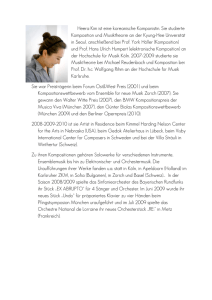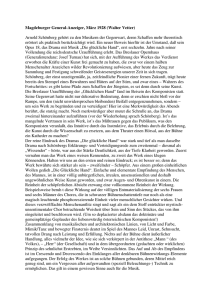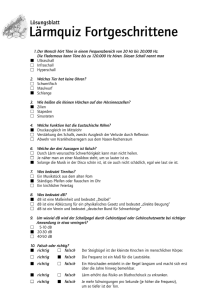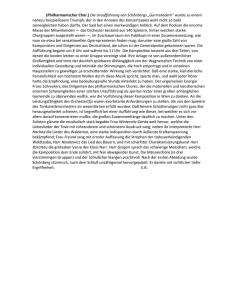NEUE MUSIK
Werbung

R u d o l f ,; S t e p h a n
NEUE MUSIK
Versuch
einer kritischen Einführung
2., durdigesehene Auflage
M it einem Nachwort
V A N D E N H O E C K & R U P R E C H T IN G Ö T T IN G E N
LC-3 AMGELS3, CAU.F0RN1A
R md e I f S t ep b a n
•wurde 1925 in Bochum■geboren , rnttchs jedoch in H eid el­
berg a u f, ■
w o er neben v ielfä ltig er m usikalischer T ätig­
keit: 1.944 das Studium d er M usikwissenschaft begann,
das er 1950 mit d er P rom otion in G öttin gen ahsebloß.
Danach war er zeitweilig Stipendiat., zeitweilig lebte er
als freier Mttsikschriftsteller, bis er 1963 an d er Uni­
versität G ottingen habilitiert wurde. Seit 1967 w irk t er
als ord. P rofessor fü r Masik-wissenschaft an d er Freien
U niversität Berlin, Seine Hauptarbeitsgebiete sind die
M usik des M ittelalters und d ie N eue Musik, E r ist
erster Vorsitzender des
>e M usik und
Musikerziehung {Darms '
ffentlichmgen
er herausgibt, verantr <• - •
'-xtisgeber der
er des Neuen
Schönberg-Gesamtausgazc ____
Handbuchs der Musikwissenschaft.
N eueste Veröffentlichungen: Verzeichnis d er musikalischen W erke Arnold- Schönbergs (Wien. 1973, u n iversal
E d itio n ): A rn old Schonberg (W ien 1974, E lisabeth
L a fte ).
K k in e V a n ä e n b o u k - R c ih 1Q49
© Vasidsnhoeck Bz. Ruprecht, V : -' / ■ ....1958.
'r r.r.::._ :i in G etm any, — A lle Hechte TOtbehaken,
O hne an särüddicbe G enehm igung des Verlages ist es n ich t gestattet,
das B u ch o d erT ciie darausauffbic-OGetakustoeaeciaanisehem "Wege
r a T erv ieifaitigen ,— G esam thetstellung : Hubers: Bz Co..Gcttingcn,
IS B N 3-525-33 135-5
I
Immer wieder wird die Klage erhoben, „Neue Musik“ sei eigent­
lich unverständlich. Nicht nur bornierte Selbstgefälligkeit, die
alles Fremde als im Grunde minderwertig von sieb weist, flüchtet
sich hinter diese Aussage» sie ist auch Ausdruck ehrlicher Ver­
wunderung. Darum hat sie wohl eia Anrecht darauf, erklärt zu
werden. Es ist vielleicht zweckmäßig, zuerst einmal Betrach­
tungen darüber anzustellen, warum dieses oder jenes Musik­
werk von anerkannt höchstem Rang, etwa Beethovens Sym­
phonie in c-Moll oder Mozarts Serenade „Eine kleine Nacht­
musik“, so wesentlich populärer ist als andere gleichrangige Kom­
positionen der gleichen Komponisten. Wenn man voraussetzt,
daß zur großen Musik nicht nur schöne Melodien gehören, ja,
daß diese nicht einmal unbedingt besonders wichtig sind, son­
dern daß vor allem formale Kriterien (im weitesten Sinne) wertkonstitutiv sind — diese Erkenntnis verdankt man vor allem
August Halm — , so wird man einsehen müssen, daß ein Über­
blicken des Formverlaufs zur vollen Aufnahme von Musik un­
erläßlich ist. Damit ist nicht gesagt, daß man die Form unbedingt
auf dem Weg über die Analyse erkennen muß — was freilich
vielfach sehr nützlich ist — , man kann sie ebenso spontan er­
fahren. Allerdings bestätigt uns selbst ein so gebildeter Musiker
wie Em st Krenek, daß sich ihm erst durch gründliches ana­
lytisches Studium gewisser Werke deren ästhetische Schönheiten
ganz erschlossen hätten. Und wirklich vermittelt ja eine Analyse
zunächst einmal die Bekanntschaft mit einem Werk, so daß man
ihm. dann bei einer Aufführung als etwas Vertrautem begegnet.
Im Grande ist es jedoch gleichgültig, auf welchem Wege man
za einer Erkenntnis der Form kommt, durch Analyse, durch
wiederholtes Hören oder „spontan“. (Unter Form sind hier
natürlich nicht die Schemata der musikalischen Formenlehre ge­
meint, sondern die Gesamtheit der Beziehungen der einzelnen
Teile zueinander.) D a ein großer Teil des Publikums spontan
nur sehr wenig bewußt hört, da weiterhin brauchbare Analysen
3
nur den Fachleuten zur Hand smd3 endiiui die Fähigkeit, selbst
sinnvoll zu analysieren wenig verbreitet ist, so bleibt nur das
wiederholte Hören als gangbarer Weg zum Eindringen in musi­
kalische Werke. Dieses wiederholte Hören erschließt — voraus­
gesetzt, daß der Hörer nicht nur auf die Themen wartet, die
der Konzertführer zitiert — das gesamte Stück: man gewinnt
eine Übersicht. Weit -wichtiger als das Erkennen von Themen
oder sonst hervorstechenden Teilen ist das Erkennen dessen, was
den Zusammenhang und damit den Sinn stiftet. Die einzelnen
Abschnitte, ja die einzelnen Takte, haben eine bestimmte Funk­
tion im Ganzen einer Komposition. Um sie beim Hören zu
realisieren, ist es erforderlich, immer dieses Ganze zu überblicken
und das jeweils Einzelne im Zusammenhang aufzunehmen. Das
ist ohne besondere Schwierigkeit nur möglich bei Kompositionen,
die eine etwas handgreifliche formale Gestaltung aufweisen:
diese bringen es dann auch zu größerer Popularität, wie etwa
gerade die fünfte Symphonie Beethovens, die leider durch allerlei
Schlagworte und Titel wie „Schicksalssymphonie“ („So klopft
das Schicksal an die Pforte . . „Kampf und Sieg“ und andere
mehr etikettiert ist. Niemand wird behaupten wollen, daß diese
Symphonie etwa der „Hammerklaviersonate“ ästhetisch über­
legen sei, aber sie macht ihr den Rang in der Gunst des Publi­
kums streitig, weil sie weniger kompliziert ist (ohne indes simpel
zu sein).
Wenn wir hier einmal davon absehen, daß vom Publikum auch
solche Kompositionen dauernd gefordert werden, die überhaupt
keine oder doch nur sehr wenig formale Qualitäten aufweisen
—■ was ein anderes, hier weitabführendes Problem wäre — , so
zeigt das Verlangen des Publikums nach Aufführung immer der­
selben Werke an sich ein richtiges Verhalten zur Kunstweit an.
Dazu wußte schon der Verfasser der „Pseudo-Aristotelischen
Probleme über Musik“ (2. Jahrhundert nach Christi Geburt)
Treffliches zu bemerken. Carl Stumpf, der diese Texte erst
richtig erschloß, berichtet:
»Daß uns bekannte Melodien lieber sind als unbekannte, erklärt P ro­
blem 5 zunächst daraus, daß der Singende uns wie einer erscheint, der
ein Zie! trifft, und daß wir das Treffen besser kontrollieren können,
wenn wir das Gesungene kennen. Dies aber (das Treffen des Zieles) sei
angenehm zu beobachten. (Unter dem Ziel ist hier wohl nicht nur die
Tonhöhe, sondern der ganze Vortrag gemeint . . . ) Eine zweite E r­
klärung stützt sich darauf, daß es (das Wiederhören) angenehmer ist
als das Lernen, weil dies ein Erlangen, jenes ein Gebrauchen (der
Kenntnis) und ein Wiedererkennen ist. Ferner sei auch das Gewohnte
angenehmer als das Ungewohnte.“
Stumpf lobt mit Recht die Sauberkeit der psychologischen Zer­
gliederung in diesem „Problem“. Was aber ist „das Gewohnte“
in der Musik? Hier müssen wir unterscheiden zwischen, der ein­
maligen formalen Beschaffenheit einer Komposition, die uns
bekannt ist, und der allgemeineren Grundlage, auf der eine
solche Komposition ruht. Die allgemeine Grundlage ist das Ton­
system, die Summe aller Tonbeziehungen, in gleicher Weise Vor­
aussetzung und Produkt der jeweiligen Komposition. Alle Musik
vom 17. bis zum beginnenden 20. Jahrhundert ist, yon den über­
geordneten Tonbeziehungen aus betrachtet, ziemlich eng mit­
einander verwandt; sie beruht auf einem sich allerdings ständig
modifizierenden Tonsystem. Im Bereich seiner Gültigkeit sind
wir aufgewachsen, in ihm sind wir gewohnt, uns musikalisch zu
verständigen und Gehalte mehr oder weniger schnell zu reali­
sieren, genau so wie etwa in der neuhochdeutschen Sprache. Der
Glaube, unser Tonsystem sei etwas Natürliches, und alle anderen
Tonsysteme seien rudimentäre Vorformen, Entartungserschei­
nungen oder unbeträchtliche Nebendinge, ist längst als naiv und
falsch erkannt. Ältere Tonsysteme verhalten sich zu dem uns
geläufigen etwa wie das Althochdeutsche zum Neuhochdeutschen,
fremde, exotische, wie fremde Sprachen zur deutschen. Wir ver­
stehen sie nicht spontan, sondern müssen sie erlernen, wenn wir
willens sind, die Gehalte der auf ihnen basierenden Kompo­
sitionen in uns aufzunehmen. Spontan erfassen wir nicht einmal
die akustische Realität: wir hören uns ungewohnte Intervalle
m die gewohnten zurecht. So erscheint uns etwa ein javanisches
Siendrostüdi, das auf der aus temperierten Oktavfünfteln (ge­
nauer |/2) bestehenden Fünftonleiter basiert, pentatonisch, das
heißt als aus Ganztönen und kleinen Terzen gefügt, ein sia­
mesisches Stück, das die Töne der siebenstufig temperierten Skala
(y*2) verwendet, diatonisch, wir hören also die jeweils gleich­
großen Intervalle, die kleiner als ein Ganzton aber größer als
ein Halbton sind, tatsächlich als Ganz- und Halbtöne. Die frem­
den Tonstufen haben also für uns zunächst keine musikalische
5
Wirklichkeit; sie gewinnen sie erst, wenn wir das akustische
Phänomen als solches richtig auffassen.
Was ein Tonsystem eigentlich, ist, kann hier nicht auseinandergesetzt werden, aber es sollen wenigstens einige Grundeigensdiaften genannt werden. Von zentraler Bedeutung ist der Ton­
vorrat, also das, was man als Tonleiter schematisch zusammen­
stellen kann. Unser Tonvorrat sind die zwölf Halbtöne, heute
die temperierten Oktavzwölftel (A|/2), Für die musikalische
Komposition ebenso wichtig sind aber die (unterschiedlichen)
Beziehungen, die zwischen den einzelnen Tönen bestehen, Es
handelt sich, dabei um eine Hierarchie von Tonbeziehungen, wie
sie uns im allgemeinen als Konsonanz-Dissonanz-Gegensatz, der
im Verlauf der Musikgeschichte nicht konstant blieb, andeu­
tungsweise "bekannt ist. In unserem System, dem Dur-MollSystem, finden diese Tonverwandtschaften in Akkordverwandt­
schaften sichtbaren Ausdruck: daß ein Dominantseptimenakkord
(in C-Dur: g— h— d—f) die Tendenz hat, sich in den Grunddreiklang (c— e— g) aufzulösen, gilt uns daher für ausgemacht. T at­
sächlich ist diese Auflösung nur in einem historisch näher zu be­
stimmenden Zeitraum unseres Tonsystems „logisch“. (Nach
Hindemiths Lehre, die glauben machen will, ein Tonsystem sei
ein Stück gottgeschaffene Natur, ist diese Auflösung bloße Will­
kür.) Alle Momente der musikalischen Artikulation, der Schlußbildung usw. haben ihre Funktion nur im Bereidi eines bestimm­
ten Entwicklungsstandes eines (unseres) Tonsystems, ln weichem
Grade der musikalische Zusammenhang das einzelne Moment
bestimmt, erweist die verschiedene Auffassung an sich eindeu­
tiger akustischer Sachverhalte. Die große Terz c— e, für uns
reine Konsonanz, kann und muß in einem bestimmten Zusam­
menhang als verminderte Quart (c-—fes oder ins— e), also als
scharfe Dissonanz aufgefaßt werden.
Der Riemannsche Begriff der „Scheindissonanz“ ist ebenso wie
der der „Auffassungskonsonanz“ Ausdruck dieser Mehrdeutig­
keit. Unsere Empfindungen sind also, wie bereits gesagt, an
ganz bestimmte tonsprachliche Gegebenheiten gebunden. Ähn­
lich wie wir einem bestimmten Satz, der ein uns geläufiges
Vokabular und eine uns bekannte Syntax verwendet, einen be­
stimmten. Sinn entnehmen, so lösen bestimmte ’ion&omBinationen, vorausgesetzt, daß wir uns im Bereich einer uns ge­
6
läufigen Tonsprache befinden.; bestimmte Eindrücke aus. Diese
Eindrücke sind von unserer musikalischen Erfahrung abhängig.
Einem Araber, der nur seine einheimische Musik kennt, sagt
eine Beethovensche Symphonie oder eine Badische Fuge über­
haupt nichts; sie ist für ihn Lärm, der nach bestimmten, ihm
unbekannten Prinzipien organisiert sein mag: sie hat für ihn
eine vielleicht absurde musikalische Wirklichkeit.
Ein Tonsystem ist, wie schon angedeutet, nicht unveränderlich;
es ist vielmehr einer andauernden Wandlung unterworfen. Das
wußte schon Eduard Hanslick, als er 1854 in seinem Traktat
„Vom Musikalisch-Schönen“ schrieb:
„Es gibt keine K üsst, -welche so bald und so viele Formen verbraucht
w ie die Musik. Modulationen, Kadenzen, Iatert-altforochreitungen,
Harmoniefolgen nutzen sich in 50, ja 30 Jahren, dergestalt ab, daß der
geistvolle Komponist sich deren nicht mehr bedienen kann und fort­
während zur Erfindung neuer, rein musikalischer Züge gedrängt wird.
Man kann von einer Menge Kompositionen, die hoch Eber dem Alitags­
tand ihrer Zeit stehen, ohne Unrichtigkeit sagen, daß sie einmal
schön waren“ (I.A . 1854, 41).
„Aus diesem Prozeß ergibt sich, daß auch unser Tonsystem im Zeit­
verlauf neue Bereicherungen und Veränderungen erfahren wird. Doch
sind innerhalb der gegenwärtigen Gesetze noch so vielfache Evolutionen
möglich, daß eine Änderung im W esen des Systems sehr femiiegend
erscheinen dürfte. Bestände z.B . die Bereicherung in der .Emanzi­
pation der Vierteltöne' . . . so würde Theorie, Kompositionslehre and
Ästhetik der Musik eine total andere“ (1. c. 87 f.).
Nim, das 20. Jahrhundert hat auch die Vierteltöne gebracht, und
manche Komponisten verfügen sogar, vermöge elektronischer
Tonerzeugung, über das absolute Kontinuum der Tonhöhen im
ganzen Hörbereich. Fraglich erscheint allerdings noch, ob man
damit überhaupt sinnvoll komponieren kann. Wenn man aber
von der elektronischen Musik, der Viertel-, D rittel- und Sechstel tonmusik absieht — und das ist einstweilen noch gestattet — ,
so muß man feststellen, daß sidi das Tonsystem in unserem
Jahrhundert zwar erheblich verändert hat — man denke nur
an das Phänomen der sogenannten Atonalität — , daß wir uns
aber prinzipiell noch immer im gleichen Tonsystem befinden,
denn es wird noch immer mit dem gleichen Tonvorrat gearbei­
tet. Audi die Tonbeziehungen haben sich nicht grundsätzlich
verändert. Was sieb verändert hat, ist vor allem, die Einstellung
der Komponisten zu den Tonbeziehungen. Sie geben sich nicht
mehr der gestuften Vielfalt der Beziehungen, hin, sondern bevor­
zugen die entfernteren Verwandschaften. Um 1910 war der
chromatische Tonvorrat längst vollständig erschlossen, aber das,
was man damals als eine neu errungene Freiheit ansah, war tat­
sächlich die Freiheit vom Zwang der Tonbeziehungshierarchie,
die Freiheit von eingeschliffenen Formeln. Die Tonbeziehungen
wurden nicht geleugnet, auch nicht die unterschiedlichen Bezie­
hungen egalisiert — das ist unmöglich — , sondern lediglich die
Bevorzugung der einfachen Beziehungen aufgegeben. Die früher
vorherrschende Quintbeziehung trat nun zurück oder wurde
mindestens verschleiert. Aus welchen Gründen dies geschah, ist
bekannt und durch, das Hanslids-Zitat angedeutet. Um aber
jeder Komposition einen gewissen H alt zu geben, führte Arnold
Schönberg in den Zwanzigerjahren die Methode der „Kompo­
sition mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen“ ein, welche
die Tonbeziehungen komplizierter und komplexer musikalischer
Gebilde einigermaßen regelt (bei einfachen ist sie sinnlos).
Mag dies Verfahren aus einer Verabsolutierung der motivi­
schen Arbeit erwachsen sein, die ihrerseits wieder die Verände­
rungen innerhalb des Tonsystems reflektierte, so ist doch seine
Funktion innerhalb einer Komposition kein einfacher Tonali­
tätsersatz, auch, kein Ersatz für die motivische Arbeit, sondern
ausschließlich Regulierung der Tonbeziehungen. Daher ist auch
verständlich, daß jederzeit Umkehrungen und Transpositionen
der „Reihe“, der Grundlage aller Zwölftonkomposition, mög­
lich sind, daß sie sowohl melodisch wie auch harmonisch in E r­
scheinung treten kann und Tonwiederholungen prinzipiell ge­
stattet sind.
"Wenn nun — wie wir eingangs sahen — selbst Musik mit recht
handgreiflichen formalen und motivischen Beziehungen bei ge­
wohnten tonsprachlichen Verhältnissen nur dann einigermaßen
aufgefaßt werden kann, wenn sie formal nicht allzu .kompliziert
und wenn sie häufiger zu hören ist, um wieviel schwieriger hat es
der Hörer erst mit einer Musik, die auf anderen als den gewohn­
ten tonsprachlichen Beziehungen beruht, in formaler Hinsicht
dazu viel komplizierter ist und überdies relativ selten aufgeführt
wird! Nicht einmal die Hauptwerke Arnold Schdnbergs sind
mit einer gewissen Regelmäßigkeit im Konzertsaal zu hören,
und nur wenige sind in Deutschland auf Grammophonplatten
verfügbar. Es bietet sich also dem Hörer kaum etwas, woran er
sich haken könnte. Wie soll er unter solchen Umständen die not­
wendige Beziehung zwischen jedem kompositorischen Detail
und der ohnehin nicht mehr den Schemata der Formenlehre fol­
genden Gesamtform auffassen können? Wenn nun ein Musik­
freund versucht, sich in eine ihm fremde musikalische Welt einzu­
leben, sei es nun alte, neue oder eine gewisse exotische Musik, so
bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich studierend und hörend
mit ihr zu befassen. „Gefällt sie ihm nicht, erscheint sie ihm zu
fremd, so ist dies kein Unglück, oder wenigstens ist es nicht un­
natürlich, und daraus kann ein Tadel weder für den Hörer noch
für die Musik abgeleitet werden. Es ist sogar besser, man gebe
die Tatsache offen zu, als daß man sich in Illusionen hineinstei­
gere oder snobistisch zu verstehen meine, wozu einem der Zu­
gang verschlossen ist“ (Jacques Handschin). Bis zum eigentlichen
Verstehen können, wie Handschin weiter ausführt, Jahre er­
forderlich sein, „doch zum Trost diene uns, daß wir ja keines­
wegs verpflichtet sind, dies alles in uns aufzunehmen“.
*
%
*
„Nach und nach müssen wir uns in diese vergangene, reiche Welt ein­
leben, um sie immer besser zu verstehen. Vorerst kapieren wir sie
höchstens . . . Wir bewundern die Schönheiten des Satzes, . . . aber wir
können unser modernes Stufenbewußtsein, unser harmonisches Funk­
tionsgefühl nicht in der Garderobe abgeben, und das müßten wir
eigentlich, um diese Musik naiv zu hören und wirklich als Kunst aufzunehmen. Also hören wir sie leider mit unvermeidlicher Befangenheit.
Daß man als Musiker keine nur aufnehmende Natur, kein wahlloser
Allesfresser ist, keine glatte Tafel, in die jedes historische Seminar
seine Eindrücke ritzen kann, sondern ein von einem bestimmten Kultur­
erbe lebender . . . und von ihm umgrenzter Mensch ist, gerade das ist’s,
was einen hindert, sich von dem historisch Fernen mit der Leichtigkeit
ergreifen zu lassen, die der große Vorteil der minder Musikalischen
ist. Der nur halb oder dreiviertel Musikalische hat’s gut. Er merkt
kaum, was vorgeht. Er hört ohne Kontrolle, ohne Erstaunen, ohne
Widerstände. Um so übler ist der Musiker dran. Daß man beispiels­
weise ein Stück beenden kann, indem man vom Leitton zum Grund­
ton übergeht, aber diesen Grundton von der unteren Quint stützen
9
läßt and damit eigentlich in der Subdominante schließt, das begreift er
theoretisch sehr gut, aber nicht gefühlsmäßig. Er ,kapiert* den Schluß,
aber er versteht ihn nicht.“
Dies schrieb der überaus musikalische, aber sehr konservative
Alexander Herrsche (Trösterin Musika, 2. Aufl. 1949, 9 f.) über
die Musik des 14. Jahrhunderts, genauer über die des großen
Gtullaume de Macfaaut. Gehen wir noch, weiter zurück, bis zur
Musik der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert, so bemerken
wir za unserer Verwunderung, daß die Terz — in der neueren
Musik Inbegriff des Wohlklangs — meist aufgelöst wird und
zwar in der Regel in den. Einklang. Die Terz wurde als Disso­
nanz behandelt und in dieser Hinsidit durchaus der Sekund
gleichgesetzt; ja, man hat den Eindruck, daß im dreistimmigen
Satz ein „Dreiklang“ als schärfere Dissonanz empfunden w urde
als der Quart-Quintklang. Wenn wir ein Stück dieser Zeit
hören, fassen wir natürlich dennoch den Dreiklang als das uns
nädistliegende, vertrauteste Gebilde, als Konsonanz, auf, hören
also auch hier befangen. Nur durch eine Verbindung unseres
Wissens von der Funktion des Klanges und dem akustischen
Eindruck können wir uns von unseren Hörgewohniieiten distan­
zieren. Wenden wir uns gar einer exotischen Musik zu, so sind
die Schwierigkeiten noch erheblich größer, wenn auch nicht prin­
zipiell anders.
Der sogenannten „Neuen Musik“ gegenüber liegen die Verhält­
nisse ähnlich. Das Paradoxe freilich ist, daß sie uns als zeitlich
Nächstliegendes so fremd ist. Aber dies ist wohl nur eine Folge
der Tatsache, daß man seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts
in immer steigendem Maße auch die Musik der Vergangenheit
weiterpflegt und sie nicht einfach vergißt oder als altmodisch
und überwunden erklärt. Man ist sogar in zeitlich immer entfern­
tere Bereiche vorgedrungen und hat das Bedürfnis nach Neuem
durch das unbekannte Alte befriedigt. Die Schwierigkeit bei der
Neuen Musik beruht nun zum großen Teil auch noch darauf,
daß die W erke der verschiedenen Komponisten verschieden ge­
hört werden wollen, die Eigenarten der Komponisten dem
Publikum aber natürlich nicht genügend vertraut sind. W enn
schon die Namen Bach, Beethoven, Schumann, Liszt beim Hörer
sofort eine bestimmte Einstellung bewirken, so sind ihm Stra10
winsky, Hindemith, Bartdk, Schönberg, um nur Beispiele zu
nennen, meist eben nur in Bausch und Bogen „Neue Musik“.
Wenn wir nun die klangliche Eigenart verschiedener Kompo­
nisten neuer Musik etwas eingehender charakterisieren, werden
wir zugleich verschiedene typische Möglichkeiten kennenleraea,
die für die Neue Musik von Bedeutung sind.
Strawinsky zum Beispiel, der heute zu den beliebtesten neueren
Komponisten zählt, sucht vor allem das Publikum zu über­
raschen. Das relativ traditionelle Äußere seiner Musik weckt
Erwartungen, die dann nicht eingelöst werden. Kantilenen läßt
er vielfach nicht von den Violinen oder Klarinetten, sondern
von Posaunen, Fagotten, Trompeten oder Piccoloflöten vor­
tragen, dauernd wird der „natürliche“ Fluß der rhythmischen
Entwicklung abgebrochen und durch Einschübe mit anderer
ZäUzeit gestört, häufig erscheint die klangliche Einkleidung nur
als Mittel zur Hervorhebung bestimmter Rhythmen, ohne daß
eigentlich eine harmonische Entwicklung stattfände — sie würde
ja auch vom Eigentlichen, dem Rhythmus, ablenken — , später,
namentlich seit der „Geschichte vom Soldaten“, spielt Stra­
winsky mit bestimmten Formeln älterer Musik. Diese Formeln
werden aber in einen neuartigen Zusammenhang gestellt. U r­
sprünglich waren sie Ausgangspunkt einer musikalischen Ent­
wicklung (etwa im alten Concerto grosso), bei Strawinsky
werden sie aneinandermontiert, ohne daß eine Entfaltung zu­
stande käme. Dieses spielerische Moment sichert den Werken
Strawinskys bei einem aufgeschlossenen Publikum immer einen
gewissen Erfolg, selbst dann, wenn nicht nur Formeln der älte­
ren Musik, sondern auch reguläre Themen übernommen werden.
Es ist dabei prinzipiell gleichgültig, ob sie von Pergolesi, Tsdiaikowsky oder Rossini ausgeborgt wurden. Das HarmonischLogische, auf das gerade im 19. Jahrhundert so viel Kraft ver­
v/endet wurde, spielt, wie schon angedeutet, für Strawinsky eine
untergeordnete Rolle. Zwar ist er in seinen Werken seit dem
Bläseroktett (1924) ziemlich zahm geworden, aber auch in
diesen Werken herrschen andere als die traditionellen Tonbe­
ziehungen. Der letzte Satz des konzertanten Duos für Geige
und Klavier, „Dithyrambus“, schließt mit einem regulären Dominantseptakkord. D er Klang e— gis— a, der eigentlich nach
A-Dur oder a-moll aufgelöst werden müßte, wird in einen
il
Klang übergeleitet, der zwar die Töne des a-Moll-Dreiklangs
enthält, aber die Terz C als Grundton aufweist. Ein noch nachklingendes g wird seinerseits wieder mit der Terz versehen, und
so erscheint der Klang ,C— C — c’—g’— a’—r i— e” . Das a’
wird über h’ zu c55 geführt, die Terz g’— h’ zu b’— c”, und,
damit das g nicht verlorengeht, wird es dem Baß in Oktavver­
setzung zugefügt: so entsteht der Dominantseptakkord von F~
Dur (oder -Moll), also der Klang c— e—g—-b als Schlußakkord!
Die Auflösung nach F-Dur (oder f-Moll) soll möglicherweise
nicht mitgehört werden, doch ist das leichter gesagt als getan.
Vielleicht ist es aber gerade der Schwebezustand, den der nicht
aufgelöste, aber auflösungbedürftige Akkord bewirkt, der vom
Komponisten als Effekt gewünscht wird. Dies Beispiel kann
zeigen, wie bei Strawinsky zunächst das Unerwartete eintritt
und dann das Erwartete ausbleibt. Und doch ist dies alles an­
dere als bloße Willkür. Warum soll man aus dem Bereich des E
nicht in den des C hinüberwechseln? Wenn man sich einmal
eingehört hat, ist diese Fortsdireitung auch musikalisch durchaus
einleuchtend (sie entspricht zudem der schon von Handschin
festgestellten Tendenz Strawinsky s, die Terzbeziehung der
Quintbeziehung (iberzuordnen). Gerade an solchen Kleinigkeiten
zeigen sich die eigentlichen Schwierigkeiten beim Hören Neuer
Musik. Aber es sind in der Tat noch Kleinigkeiten, gemessen an
dem, was andere Komponisten (und auch Strawinsky an ande­
ren Stellen) bieten.
II
Wenn wir versuchen, die Beziehungen einzelner Komponisten
zum Tonmaterial zu betrachten, so ist es vielleicht zweckmäßig,
unsere Aufmerksamkeit zunächst einigen Werken zu widmen,
bei deren Konzeption und Komposition sich die Autoren selbst
Beschränkungen auferlegten. Wir wählen zuerst Werke von Igor
Strawinsky und Paul Hindemith aus, die eine strenge Begren­
zung des Tonraumes (und also auch des Tonvorrats) erkennen
lassen; dann ist leicht zu sehen, wo der einzelne Komponist den
selbstgesteckten Rahmen zu sprengen trachtet, schließlich sogar
zu erkennen, warum dies geschieht. Die Stücke, mit denen wir
es zunächst zu tun haben, sind zwar klein, bieten dafür
12
aber große Vorteile: sie sind leicht zu spielen, bequem zu über­
schauen und dodi mit künstlerischer Ambition verfaßt; und
schließlich das Wichtigste: wir können jeden Ton genau über­
prüfen und uns so vergewissern, was wir eigentlich hören. Mit
den bei der Betrachtung dieser kleinen Stücke gewonnenen Ein­
sichten wollen wir dann versuchen, auch größere musikalische
Zusammenhänge zu verstehen.
Gegen Ende des dritten Kapitels der „Musikalischen Poetik“
schreibt Strawinsky:
„ . . . Ich brauche nur eine theoretische Freiheit. Man gebe mir etwas
Begrenztes, Bestimmtes, eine Materie, die meiner Arbeit insofern
dienen kann, als sie im Rahmen meiner Möglichkeiten liegt. Sie bietet
sich mir mit ihren Grenzen dar. Es ist an mir, ihr nur die meinigen auf­
zuerlegen . . . Meine Freiheit besteht also darin, midi in jenem engen
Rahmen zu bewegen, den ich mir selbst für jedes meiner Vorhaben ge­
zogen habe.
Ich gehe noch w eiter: meine Freiheit wird um so größer und um­
fassender sein, je enger ich mein Aktionsfeld abstedce und je mehr
Hindernisse ich ringsum aufrichte. Wer mich eines Widerstandes be­
raubt, beraubt mich meiner Kraft, je mehr Zwang man sich auferlegt,
um so mehr befreit man sich von den Ketten, die den Geist fesseln“
(Schriften 202 f.).
Da Strawinsky kaum jemals sich strengeren Bindungen unter­
warf als in seinen kleinen Klavierstücken „Die fünf Finger“,
wollen wir diese zunächst betrachten. In seinen „Erinnerungen“
erzählt der Komponist:
„In Garches, wo ich den Winter 1920/21 verbrachte, . . . schrieb ich
eine Sammlung kleiner Kompositionen für Kinder, die ich unter dem
Titel ,Die fünf Finger“ veröffentlicht habe. Es sind acht sehr einfache
Melodien, die so gesetzt sind, daß die Finger der rechten Hand, wenn
sie erst richtig auf den Tasten liegen, während einer Periode oder
auch während des ganzen Stücks ihre Lage nicht mehr zu verändern
brauchen, während die linke Hand, die die Melodie begleitet, ganz
leichte harmonische und kontrapunktische Figuren auszuführen hat.
Diese kleine Arbeit machte mir viel Spaß. Sie soll mit ganz einfachen
Mitteln im Kinde das Vergnügen wecken an einer Melodie und an
der Art, wie sie auf eine rudimentäre Begleitung bezogen ist“ (Schrif­
ten 90).
Der genaue Titel der Sammlung lautet: „Les cinq doigts; Huit
piices trcb faciles sur cinq notes pour piano (1921).“ Inhaltlich
sind es Genrestücke; ein Marsch (2), ein Siziiiano (4), eine T a­
rantella (7) und ein Tango (8); die anderen bringen teilweise
volkstümliche Themen, z.B . das „rassische“ Lento (6) oder
das Andaatino (1). Schließlich darf man auch hervorheben, daß
die kleine Sammlung die Nachbarschaft der anderen W erke
jener Zeit nicht verleugnet, die zu den vierhändigen Klavier­
stücken, die später instrumentiert als Orchestersuiten bekannt
wurden, zu „Pulcinella“ und, vor allem zur „Geschichte vom
Soldaten“.
Wie ungezwungen sich. Strawinsky auf so eng umgrenztem Feld
bewegt, ist erstaunlich, selbst wenn man sich daran erinnert, daß
diese Fähigkeit charakteristisch für die Petersburger Schule war.
im ersten Stück, Andantino, einem nach der üblichen Formen­
lehre kleinen, dreiteiligen Lied (A—B—A), kommt Strawinsky
mit dem diatonischen Tonvorrat von c— g aus, also in jeder
Hand mit je fünf Tönen. Das ist merkwürdig genug, und wir
stellen es als wesentlich fest: In der ganzen Komposition gibt
es keine einzige Alteration. Dennoch, ist man keinen Augen­
blick im Zweifel, daß es sich um ein Werk aus unserem Jah r­
hundert handelt:
B e i s p ie l 1. ig or Strawinsky: .Les cinq doigts (Die fünf Finger),
Nr. 1, Andantino, Takt 1— 11
Das Stück, dessen ersten Teil wir mitteilen, steht in C-Dur, aber
die Begleitung bringt dies nicht ungetrübt zum. Ausdruck. Viel­
mehr geht die Tendenz des
14
der traditionellen Harmonik den Klang interessanter zu ge­
stalten. Die Trübung wird dadurch erreicht, daß sowohl den
„natürlichen“ Dreiklangstönen Hebentöne im Sekundabstand
zugesellt werden — etwa im zweiten Takt das g’ — , als auch,
daß mit den Bruchstücken des Dreiklangs einer unerwarteten
Tonstufe — etwa im dritten Takt mit der zweiten (d-MolI)
statt der fünften (G-Dur) — begleitet wird und daß dieser
Klang dann ebenfalls noch getrübt — im dritten Takt durch
e’ — erscheint. Besonders charakteristisch ist ferner, daß Bin­
nenschlüsse mit Akkordbestandteilen begleitet werden, die der
Melodie nicht zugehören. Dem d” des fünften Taktes etwa ge­
hört als richtiger Akkord die fünfte Stufe von C-Dur als Harmonisation zu, aber Strawinsky begleitet mit den Tönen der
vierten, funktionsharmonisch gesprochen: es wird ein eindeutig
dem Dominantbereidh. zugehöriger Ton der Melodie mit der
Subdominante vermischt1.
Betrachten wir die Melodik. Das ganze Sätzchen umfaßt elf
Takte. Es zerfällt in zwei Teile (T. 1— 5, 6— 11), die durch'ein
Zäsurzeichen von einander abgetrennt sind. Was zunächst ein­
mal auffällt, ist neben der Ungleichheit der Teile der Taktwech­
sel, genauer, der in den 2/i-Takt eingeschobene s/*-Takt. Redu­
zieren wir die Melodie auf die sie konstituierenden Motive, wie
sie durch die Bögen angezeigt werden, so bemerken wir auch
hier eine unterschiedliche Größe, einen Wechsel von Drei-, Vierund Zweivierteigruppen. Durch diesen Wechsel bekommt die
Melodik etwas Preziöses; sie scheint am freien Ausschwingen
gehindert durch, vorzeitige Unterbrechung des Bewegungsimpul­
ses. Audi das ist eine Folge der dem ganzen Sätzchen zugrunde
liegenden Konstruktion. Auf ähnliche Weise wie Strawinsky
im Harmonischen das „natürlich.“ Erscheinende verschmäht,
weicht er ihm. auch im rhythmisch-metrischen Autbau einer
Periode aus. Es ist nicht schwer, sich das gewöhnliche Modell
des ganzen Abschnitts zu rekonstruieren; dabei ist es ganz
gleichgültig, ob Strawinsky bei der Komposition von ihm aus­
ging oder nicht. Die beiden Dreiviertelgruppen legen von allem
Anfang an nahe, daß wir es eigentlich mit einem Stück im Drei­
vierteltakt zu tun haben. Versucht man eine Rekonstruktion des
(imaginären) Modells, so ergibt sich eine übersichtliche Achttaktperiode. Vor dem letzten Takt dieses Abschnitts ist indes­
15
sen noch ein Zusatztakt eingeschoben, der gew iß
Kompositionsmodell angehörte, dennoch aber leicht
zu erkennen ist und beliebig entfernt werden könnte
dings die Veränderung einer Note — c” in d” —
gehenden Takt zur Folge hätte):
schon dem
als Zusatz
(was aller­
Im voran­
ft
B e i s p i e l 2.
Nun wird klar, worin die kompositorische Leistung bei diesem
Stück eigentlich besteht. Gerade weil wir das hier rekonstru­
ierte Modell eigentlich als das „Natürliche“, oder sagen wir bes­
ser als das Naheliegende (aber sehr Banale) erkennen, werden
wir die Differenzen in jedem einzelnen Punkt als Reiz empfin­
den2. Die Melodik wurde bei der Ausarbeitung des Modells zur
Komposition am wenigsten tangiert — es fielen nur zwei Töne
aus — , das metrische Schema dagegen umgeworfen, die H ar­
monik durch Stufenmischung gewürzt, aber beides nur soweit,
daß wir ein (bescheidenes) ästhetisches Vergnügen darüber emp­
finden, um das eigentlich Erwartete geprellt worden zu sein.
Die beiden folgenden, ebenfalls ln C-Dur stehenden Stücke er­
weitern geringfügig den Tonraum, das Allegretto (3) im un­
teren System um einen Ton (h— g’), das Allegro (2), ein kleiner
Marsch, um zwei Töne (a— g’); beide zeigen aber noch immer
keine Alteratlonszeidien. Die anderen Stücke vergrößern den
Tonumfang noch mehr: das Moderato (5), das Lento (6) und
das Pesante (8), ein Tango, fordern in der rechten Hand Lagen­
wechsel, so daß ein erheblich größerer Tonvorrat verfügbar
wird. Allerdings zeigt sich hier dann auch eine Neigung zu grö­
ßerer harmonischer Variabilität. Das Lento (6) mit seiner konse­
quenten Mischung von D-D ur und d-Moll, dieses ln der linken,
jenes in der rechten Hand*, und der Tango mit seiner Vorliebe
für verminderte Dreiklänge,
w
J-L-v'l ib-dli-i.io-//.I- 1Äb.0 w!VrJ. XiJ.S”0
men der Sammlung dar, ja gelegentlich scheint sich Strawinsky
sogar, wenn auch nur vorübergehend, der Bitonalität zu
nähern.
Versuchen wir vorläufig zusammenzufassen: Obwohl Stra­
winsky programmatisch nur „über fünf Noten“ schreiben will,
drängt er danach, den Quintumfang zu erweitern. Durch seine
metrischen Manipulationen, zu denen auch noch die Verschie­
bung einer Spielfigur gezählt werden muß (besonders im Alle­
gro Nr. 2), so daß in einem System von betonten und halb­
betonten leichten Werten (Akzenten) das Motiv eine wech­
selnde Lage einnimmt, aber auch durch seine harmonischen Ver­
anstaltungen, wird die natürliche Entfaltung behindert, ja un­
möglich gemacht. Dadurch entsteht das, was man allgemein
als „statisch“ empfindet und bezeichnet, ganz im Gegensatz zu
der sich dynamisch entfaltenden Musik des vergangenen Jah r­
hunderts. Diese Verfahren geben dem Komponisten die Mög­
lichkeit, leicht überschaubare Formen zu schaffen, die, mögen
sie auch noch so primitiv sein, solcher Tonsprache durchaus an­
gemessen sind.
Wer die ganze Sammlung durchmustert, wird aber noch einen
anderen Eindruck gewinnen: die Formelhaftigkeit des motivischen
Materials. Diese Formelhaftigkeit hat durchaus ihren ästhetischen
Reiz: sie ist ein Spiel mit bekanntenModelien. Wenn Strawinsky
einen Tango oder einen Marsch schreibt — er tat dies mehr­
fach — , so schafft er keine neuen Ausdruckscharaktere, die die
alten hinter sich lassen, sondern er zeigt, nicht ohne Ironie, die
gängigen in ihrer ganzen Einfalt; er treibt, indem er sie zer­
beult, rhythmisch verschiebt, „falsch“ harmonisiert, mit ihnen
ein mutwilliges Spiel und macht dadurch darauf aufmerksam,
daß sie eigentlich schon obsolet sind. Dieser Tendenz verdanken
seine besten Werke, etwa die „Geschichte vom Soldaten“, deren
bedeutendes Libretto, von C. F. Ramuz, ebenfalls eine Montage
von altbekannten Märchenmotiven ist, ihre unvergleichliche
Gewalt.
Während Strawinsky versucht, durch Denaturierung von Rhyth­
mik, Harmonik und Melodik etwas Neues zu schaffen — wo­
bei allerdings nicht übersehen werden darf, daß gerade in die­
ser Negation des Gewöhnlichen sich eine innige Beziehung zu
17
Ihm bekundet — , strebt Hindemith danach. Bewährtes in neuer
Zusammenstellung zu zeigen,
Hindemiths „Kleine Klaviermusik“ (1929), der ■wir uns jetzt
zuwenden, besteht aus einer Folge von zwölf „leichten Fünfton­
stücken“, die aber mit denen Strawinskys kaum etwas gemein­
sam haben. Die ,kleine Klaviermusik' ist ziemlich systematisch
aufgebaut: Die Tonartordnung erinnert: an Bachs Wohltempe­
riertes Klavier, mit dem aber die einzelnen. Stücke weit weniger
zu schaffen haben als etwa die „Reihe kleiner Stücke“ op. 37,2
(1 9 2 7 ) und „Ludus tonalis“ (1943)4. Bei einigen der Hindemithschen Fünftonstücke fällt die Tatsache auf, daß sie in einer
anderen Tonart beginnen als schließen (Nr, 2; Dis— CIs; 4;
B— Es; 10: A —E etc.), ein bemerkenswerter Sachverhalt, der
auch schon einige Sätze der „Reihe kleiner Stücke“ kennzeichnete
(N r.5: G—-H; 10: D — A), aber erst später, In den grundsätz­
lich modulierten Interludien des „Ludus tonalis“ durch die Ge­
samtanlage des Zyklus gerechtfertigt wurde.
Hlndemith schrieb also wie Strawinsky Fünftonstücke, aber er
meint damit nicht die TonzahL sondern die Distanz: Fünf tonstück heißt für ihn nichts anderes als Stück Im Quintumfang, ja,
gleich im ersten Stück geht er sogar so weit, den umfang der
übermäßigen Quint zu beanspruchen. W ir betrachten auch Her
das erste Stück und teilen die erste Hälfte mit.
M äßig schnell
B e i s p i e l 3. Faul Hlndemith: Kleine K lavierm usik,
N r. 1, M äßig schnell, T ak t 1— 7
18
Salon in den beiden ersten Takten hat Hindemith in der Ober­
stimme den gesamten chromatischen Tonvorrat Im Bereich der
Quinte c”— g” erschlossen, ohne jedoch •
— und darauf ist beson­
ders zu achten — in Chromatik zu verfallen. Gleich zu Beginn
erscheint hier die bewußte Dur-MoUmischung, während Im
zweiten Takt die Folge des”— ges” — eine sonst wenig ge­
bräuchliche, dem (lokrlsdien) h-Modus zugehörige Wendung —
als Trübung der Tonalität aufgefaßt werden kann, die Ihre
Funktion darin hat, die im fünften Takt beginnende Ober­
leitung nach dem tonalen Zentrum Ces vorzubereiten. Im vier­
ten Takt gehört die Wendung g” — des”— c” zum phrygischen
Geschlecht (e-Modus) und die Begleitfigur (g’— fis’—g5) zum
lydisdien (f-Modus). Es ist besonders darauf z« achten, daß in
dieser Passage nicht nur die einzelnen Töne der verschiedenen
diatonischen Modi in Erscheinung treten (phrygische Sekund:
des; lydische Quart: fis; lokrisdie Quint: ges, neben Dur- und
M oli-Terz), sondern daß alle Intervallschritte modal erklärbar
sind. In den wenigen Takten unseres Beispiels erscheinen dabei
alle möglichen Modi innerhalb des Quintraums. Dorisch und
Mixolydisch (d- und g-Modus) können nicht erscheinen, da sie
sich innerhalb des Quintraums nicht darstellen lassen, weil sich
das Dorische durch, die große Sext bei kleiner Septime von
unserem Moll, Mixolydisch durch die kleine Septime von
unserem Dur unterscheiden. Wir können also sagen: Hindemith
hat sich in dem mitgeteilten Tonsatz tatsächlich aller möglichen
diatonischen Wendungen bedient und dabei den Quintraum
vollständig chromatisch erschlossen. E r will Chromatik eben
nicht als Freiheit von den diatonischen Formeln — das wäre
etwa die konsequente Gegenposition zu Strawinsky — , son­
dern möchte alle Möglichkeiten diatonisch tonaler Satzgestal­
tung nutzen.
Der Unterschied zwischen Strawinsky und Hindemith läßt sich
vielleicht, soweit es sich um Ihre Einstellung zum überlieferten
Tonsystem handelt, in folgender Weise zusammenfassen: Hinde­
mith errichtet Biatonik auf der Grundlage der Chromatik, Stra­
winsky betradhtet Chromatik als Erweiterung der Diatonik.
Gemeinsam ist ihnen die Anerkennung der „natürlichen“ Gravi­
tation aller Intervalle — dies bezeugen etwa Hmdemiths
19
„Reih.en‘% wie er sie (etwas gewaltsam) in seiner „Unterweisung
im Tonsatz“ ableitet —, ab er H indem ith räum t den traditionel­
len Qmnt-(Quart-)Beziehungen einen noch bedeutenderen Platz
ein. Strawinsky bezieht alles auf die diatonischen Dur-MollSfcalen and Kadenzen, während für Hindemith alle diatonischen
Tongesdilechter (Modi) gleichberechtigt nebeneinander stehen
und sidi andauernd vermischen; er hat dadurch die Möglichkeit,
schnell jede gewünschte „Modulation“ (oder Ausweichung) durch­
zuführen, so wie wir es in Beispiel 3 sehen, wo die (relativ dem
Grandton fern stehende) lokrisdie zweite und fünfte Stufe (des
und ges) ln die „normalen“ umgedeutet werden, indem sieh der
Grundton um einen Halbton tiefer verlagert (von C nach Ces).
W ill man diese Tendenz Hindemiths näher bestimmen, so könnte
man vielleicht paradox sagen, daß er die Chromatik zur Grund­
lage einer neuen Diatonik gemacht hat. Hlndemith ist von Hause
aus DIatonlker. aber die Macht der alten Tongesdilechter ist ge­
brochen. Dur und Moll sind Ihm nicht mehr „polare Gegensätze“,
sondern neben allen anderen diatonischen Geschlechtern, dem
dorischen, phrygischen, lydlschen und mixolydischen gleich­
berechtigte diatonische Aspekte eines Grundtons, einer Tonali­
tät. In seinen früheren Werken bevorzugte Hindemith vielfach,
um keinem Geschlecht den Vorrang vor dem anderen zu geben,
Schlüsse im Einklang oder der leeren Quint, später, seit etwa
1930, hat er dem Dur-Geschlecht seine alte Vorherrschaft wieder
weitgehend eingeräumt. Dadurch erscheinen dann die anderen
Modi oft nur mehr als Trübungen des Durgeschlechts.
Als Beispiel konsequenter Modusmischung sei hier der Anfang
des Vorspiels zum Einieltungschor des „Lehrstücks“ (1929), einer
Vorform von Bertolt Brechts „Badener Lehrstück vom Einver­
ständnis“ und zugleich Schlußnummer des Radiohörspieis „Lradberghfiug“ mitgeteilt und besprochen.
D a der Anfangsakkord nur aus C — c— c’— c5' besteht, bleibt das
Tongeschlecht ungewiß, aber die beiden Wechselnoten der Ober­
stimme, b ’ und a’, sind, c als Grundton vorausgesetzt, nur als
dorisch oder mixolydisch zu erklären; das gleich folgende es"
der Oberstimme beweist, daß wir es mit dem dorischen Modus
zu tun haben. Der Fortgang der Melodie wechselt vielfach das
Tongeschlecht: des”— c” —b*— as’— g’ Ist phryglsch, während
20
B e i s p i e l 4. Paul H indem ith: Lehrstück,
N r. 1, Bericht vom Fliegen, T ak t 1— 6
die beiden restlichen Noten des Taktes sowohl als Dur als auch
als Mixolydisch aufgef aßt werden können, der dritte Takt und
die beiden ersten Noten des vierten sind abermals phrygisdh, die
folgenden Noten und die drei ersten Viertel des nächsten lydisch
und der Abschluß der ganzen Phrase abermals phrygisch. Wür­
den wir hier auch die anderen Stimmen auf die gleiche Art ana­
lysieren, so müßten wir feststellen, daß selten — zum Beispiel
in der zweiten Hälfte des dritten Taktes — alle Stimmen dem
gleichen Modus zagehören; meist sind verschiedene Geschlechter
miteinander kombiniert. Dies ist die Ursache der zahlreichen
ungewohnten Querstände, etwa e— es (Dur- und Moll-Terz),
as— a (bei herrschendem Molldiarakter „reine“ und dorische
Sext) und des— d (phryglsche und normale Sekund). Wir können
jetzt vielleicht verstehen, daß die konsequente Mischung aller
diatonischen Modi zu einer eigentümlichen Tonsprache führen
muß, deren charakteristisches Merkmal es Ist, über den gesam­
ten chromatischen Tonvorrat zu verfügen, ohne jedoch darum
schon Chromatik zu sein.
Aber es bleibt zu fragen, ob und gegebenenfalls wie man mit
dieser Tonalität sinnvoll komponieren kann. Ihre historische
Ableitung Ist nicht schwierig, Ist es doch längst allgemein be­
kannt, daß Robert Franz und Johannes Brahms kirchentonale
21
melodische und, daraus abgeleitet, harmonische Wendungen,
dieser vornehmlich, dorische, jener ptirygisdae, liebten. Sie
färbten so auf charakteristische Wesse insbesondere ihre Lied­
melodik, ohne jedoch von allen oder auch nur mehreren Modi
gleichzeitig Gebrauch zu machen5. Die Folge davon war, daß
sie ihre Tonsprache um neuartige Wendungen von hohem kolo­
ristischen Reiz bereicherten und namentlich zu einer Kräftigung
der harmonischen INebenstufen gelangten, während Hindemith
zwar jetzt auf dem Umweg über die Kombination der verschie­
denen diatonischen Tongeschlechter über den chromatischen Ton­
vorrat verfügt, ihn aber, indem er DIatonik suggeriert, nicht
systematisch erschließt. Die koloristischen Wirkungen der ein­
zelnen Modi sind durch dauernde Modusmischung neutralisiert
und aufgehoben. Hindemith kann zwar grundsätzlich jede chro­
matische Stufe erreichen, aber durch die Nutzung der Möglich­
keit dauernden Wechsels wird die melodische Kontinuität ge­
stört und die harmonische Konstruktion ■willkürlich. Alles er­
scheint getrübt, denn die Nebenstufen erhalten, da sie jederzeit
durch eine andere ersetzt werden können, kein neues, zusätz­
liches Gewicht®. Das aber rächt sich. Entweder ist Hindemith
genötigt, einen ganzen Tonsatz durch einen Orgelpunkt zusammenzuiialten oder mechanisch das harmonische Fundament
zu verändern — .hierher gehören die stufenweise schreitenden
Baßgänge, wie sie etwa im Anschluß an unser Beispiel 4 bei
gieichbleibender Oberstimme (sie entspricht Takt 1) die Folge
G-, B-, As-, Ges- und F-Dur, also eine „phry gische“ Folge von
Durdreiklängen stützen — , oder aber der Satz gerät In ein un­
verständliches harmonisches Durcheinander. Dieses Durchein­
ander ist jedoch keine „Atonalität“, sondern ausschließlich die
folge schlecht ausgewogener tonaler Verhältnisse, Ein klares
Beispiel ist das letzte der „Fünf Stücke für Streichorchester“ op.
44 Nr. 4 (1927), das w ir trotz seiner frühen Entstehungszeit
wohl berechtigt sein dürfen auszuwählen, da es sich auf der der
ersten Auflage (193 7) des theoretischen Teils der „Unterweisung
im Tonsatz“ beigegebenen Liste von Werken findet, die angeb­
lich die In jenem Buch vorgetragenen Ansichten von der Technik
des Tonsatzes realisieren, l
de uns dieses Stuck die
Möglichkeit, noch andere Fragen zu erörtern.
22
III
W ir betrachten als nächstes einige Konzertsätze von Hindemith
und Strawinsky, wobei wir sehen werden, daß sich die bereits
festgesteilten Übereinstimmungen und Unterschiede im kompo­
sitorischen Verfahren beider Komponisten erneut bestätigen.
.Ms erstes Beispiel wählen wir das letzte der „Fünf Stücke
für Streichorchester“ von Hindemith, das wegen seiner engen
Anlehnung an ein historisches Vorbild besonders instruktiv ist.
Das Stück beginnt In c-Moli mit dorischer Seiet (a) und phrygischer Sekund (des), Ist also stark kirchentonartlich getärbt.
Der letzte Ton des ersten Taktes, e, wird, da er mit einem as,
der normalen (äolischen) MoIIsext, in der Baßstimme gleich­
zeitig auftritt, nicht als Durterz aufgefaßt, sondern als Mittel
zur Erreichung der 4; Stufe, als V orhalt zu f. Auf dieser Stufe
angekommen, die hier, merkwürdig genug, wieder im Moll­
geschlecht erscheint, findet man wieder die dorische Sext (d in
der Mittelstimme) und die phrygische Sekund (ges, als fis ge­
schrieben, ebenfalls in einer Mittelstimme), während dann In den
Überleitungsfiguren des dritten Taktes auch die Durterz er­
scheint. Die Takte 4 bis 7 basieren auf der 7. Stufe von C-Dur,
und bei dieser Gelegenheit erfährt man also, daß dem Mollenarakter des Anfangs gar keine wesentliche Bedeutung zu­
kommt, sondern daß es sieh um eine einfache C-Tonalität han­
delt, für die Dur, Moll, jfhrygisch und Dorisch nur verschiedene
Aspekte eines Grandtons sind. Nun, fast drei ganze Takte hält
das Stück auf dieser 7. Stufe inne. . . Dann folgt (T. 7) eine Repe­
tition des Themenkopfes auf der 3. Stufe (In Moll), mit sofort
anschließendem (überraschendem) Übergang zur 6. Stufe (a),
während man doch eine Befestigung der in Takt 8 vorüber­
gehend erreichten (äolischen) 7. Stufe (b) erwartete. Schließlich
wird das Ritorneli abermals durch eine Repetition des Kopf­
themas (Vordersatz) eben auf jener schon früher erwarteten
7. Stufe (b) beschlossen, aber wie stets moduliert Hlndemith auch
hier nach, einer anderen Stufe, der 3. In Moll, also nach es. Der
ganze Komplex, das Ritorneli, gibt sich uns als ein großer
Modulationsteil zu erkennen, der auf Umwegen von der 1. zur
3. Stufe (von c-Moli nach es-Moli) moduliert. Es fragt sich aber
jetzt, ob einer derartige Anlage geeignet ist, eine „Form“ zu
tragen. Modulation bedeutet soviel wie Übergang, aber hier ist
der formal tragende Abschnitt als Überleitungsteil angelegt. Der
Vordersatz, der eigentlich die Grundstufe der Tonart befestigen
sollte, leitet gleich zur 4. Stufe über, und diese selbst erscheint
abgeschwächt durch das Vorherrschen eines ihr nicht angemes­
senen Tongeschlechts. Überdies läßt der Komponist durch merk­
würdige Phrasierung die tonalen V erhältnisse noch unklarer er­
scheinen. Der Vordersatz beginnt niedertaktig, der Nachsatz
auftaktig. Dieser Auftakt hat aber hier derartiges Gewicht —
einmal, weil der Vordersatz eben über keinen Auftakt verfügt,
zweitens, weil der Auftakt „Leitton“ Ist und drittens, weil er
länger ist als die einzelnen Töne der folgenden Figuren — ,
daß das Verhältnis von Vorder- und Nachsatz für jenen noch
ungünstiger wird. Er kann gerade das nicht leisten, worauf
Hindemith den größten Wert legt, nämlich tonale Ordnung zu
schaffen. Diese 13 Takte, das gesamte Ritomell also, berühren
die Grundstufe nicht einmal einen einzigen T ak t lang. Man
könnte jetzt vielleicht einwenden, daß eben gerade die neu­
artige Anlage das eigentlich Hindemlthsehe an diesem Tonsatz
sei und infolgedessen einen neuen Wert repräsentiere. Dem­
gegenüber wäre aber daran zu erinnern, daß hier nicht nur die
Form von historischen Vorbildern übernommen wurde, sondern
auch der Melodietypus.
Die rüstige gleichmäßige Bewegung der Achtel und Sechzehntel
ist nur dann sinnvoll, wenn ihr ein ebenfalls (wenigstens einiger­
maßen) gleichmäßiger Stufenwechsel entspricht, denn erst dieser
Harmoniewechsel gliedert die gleichförmige Bewegung. Indem
aber hier ein wenig ausgewogenes Verhältnis zwischen den ein­
zelnen Abschnitten besteht, verwirrt sich der musikalische Pro­
zeß. Die gleichmäßige Bewegung, bei der die Zäsuren über­
spielt werden, verhindert das Erfassen der harmonischen E r­
eignisse.
Die Gesamtform dieses Hindemithschen Streldierstücks folgt
ziemlich streng der alten Vivaldlsdien Konzertform, Hier ein
Schema, in dem die Tonalität der entsprechenden Abschnitte mit­
geteilt ist:
24
1. R itorn eli
T u tti
T a k t — 13
c
1. E pisode
Solo
14-24 25-35 36-48
es
f
e
2. Episode
3. Ritorneli
2. R itorneli
Tutti
Solo
T u tti
(verkürzt) 1. T h . 3. T h . 2. T h .
105— 117
60-78 79-88 89-104
49— 59
c
d
e
b
g
Coda
Solo
T u tti
xi8—122 123— 125
g-^c
Man sieht also drei Tutti-Bitornelle auf den wichtigsten tonalen
Stufen beginnen., was aber kaum irgendwelche Bedeutung hat,
da diese Stufen, wie wir sahen, nur ganz kurz berührt werden.
Die modulatorische Anlage der Rltornelie erzwingt sogar eine
Coda, denn nur wenn das letzte Ritorneli auf der 6. Stufe be­
gänne, würde es auf der Grundstufe endigen. Das aber brächte
neue Schwierigkeiten: Würde das Sdilußritornell tatsächlich auf
der 6. Stufe beginnen und auf der 1. schließen, so hätte niemand
den Eindruck eines bestätigten Schlusses. Darum läßt Hindemith
das letzte Ritorneli in Analogie zum ersten auf der Grundstufe
(c) beginnen und auf der dritten schließen, moduliert dann aber
anschließend in einem kleinen Soloabschnitt zur 5. Stufe (g),
womit eine Analogie zum Anfang des zweiten Ritornells ge­
geben ist, und schließt die ganze Komposition mit einer Repe­
tition des Ritomellvordersatzes auf der Grundstufe ab.
Dieses Streicherstück, das in einem Schul werk steht, also in jeder
Hinsicht mustergültig sein sollte, ist tatsächlich ein Dokument
für jene jahrzehntelang geübte Praxis der naiven Übernahme
alter Formen. Damit soll keineswegs gesagt sein, daß es auf
jeden Fall unsinnig Ist, sich alter Formen zu bedienen, sich von
ihnen anregen zu lassen oder sie auch nachzuahmen. Freilich
wird stets die Gefahr des Kunstgewerblichen drohen, selbst dann,
wenn derartige Versuche mit größerem Feingefühl unternommen
werden, als es Hindemith bei der Komposition dieses Stückes
bewies1.
Igor Strawinsky folgt in einigen seiner Konzerte nicht eigent­
lich dem Vivaldischen Typus der Konzertform, sondern der ent­
wickelteren und komplizierteren Form Bachs, ohne freilich jede
Erinnerung an die einer anderen historischen Entwicklungsstufe
angehörenden Sonatenform zu verdrängen. Zwei 'Werke der
Dreißigerjahre, der Zeit also, in der der Neoklassizismus all­
gemeine Weltgeltung hatte, mögen hier dafür einstehen.
Wie Strawinsky den musikalischen Prozeß auslöst, ist überaus
bezeichnend,, Der erste Satz des Violinkonzerts von 1931 'be­
ginnt nach zwei Einleitungstakten sogleich mit dem Hauptthema,
das regelgerecht aus Vorder- und Nachsatz besteht. Beide zeigen
die tür Strawinsky charakteristischen metrisdien Verschiebun­
gen, die durdi Erweiterungen und V erkiirzungen entstehen. Diese
metrischen Verschiebungen dokumentieren deutlich die Beschädi­
gung des traditionellen rhythmisch-metrischen Systems. Indem
sie im Rahmen einer konstanten Taktgliederung — hier Ist es
ein Vt-Takt •
— stattfinden, wird diese selbst illusorisch. Das
Schema der ersten fünf Takte des Themas mag dies zeigen, Die
Begleitakkorde sind abwechselnd Hörnern und Fagotten über­
tragen. In der ersten Takthälfte spielen sie jeweils den Akkord
fis— g— d’, in der zweiten fis— a— d\ Beide Akkorde verhalten
sich also zueinander wie Vorhalt und Auflösung. Da aber die
ganze Passage mit der zweiten Hälfte eines Taktes beginnt, steht
am Anfang die aufgelöste Form, Dieser mechanische Klangwech­
sel ist übrigens das einzige Moment, das die Taktgliederung recht­
fertigt. Da indessen die Vortragsbezeichnung sempre sf. anzeigt,
daß allen Akkorden der gleiche Akzent zu geben ist, wird sie In
gewisser Weise zugleich wieder aufgehoben. Die Schläge 1 und 3
{nach Achteln gezählt) erhalten zwar doch wieder ein Über­
gewicht gegenüber 2 und 4, aber die qualitative Differenz zwi­
schen 1 und 3 ist zerstört. Dem entspricht die Anlage des eigent­
lichen Themas. Der Niederschrift zufolge beginnt es auftaktig,
hätte also, wäre das alte metrische System noch unbeschädigt,
seinen Hauptakzent nach dem Kopfmotiv auf dem ersten Achtel
der Hegenden Noten, während bei der Wiederholung des Motivs
der Akzent auf dem ersten Sechzehntel und auf dem dritten
Achtel läge. Daß eine solche Auffassung nicht den wahren musi­
kalischen Sachverhalt trifft, Hegt auf der Hand und wird dar­
über hinaus noch von allen vergleichbaren Stellen, dem Einsatz
des 1. Solos (Ziffer 3), des 2.T u tti (Z. 7), des 2, Solos (Z. 11) und
der Reprise (Z. 36) bewiesen. Dem ersten Tutti, das eben be­
trachtet wurde, entspricht nur das 3. Tutti (Z. 16), hei dem aber
das Thema stets auftaktig aufgefaßt werden muß, auch wenn es,
wie bei der Wiederholung des Kopfmotivs niedertaktig geschrie­
ben Ist.
26
Man wird sich fragen dürfen, warum der Komponist sich nicht
die Mühe gemacht hat, sein Stück durch. Taktwechsel, vor dem
er doch sonst nicht zurücksdareckt, sinngemäß zu metrisieren und
damit auch zu phrasieren. Für den Na&satz des 1. Tutti (Z. 2}
gilt genau dasselbe wie für den betrachteten Vordersatz, Kein
zwingender Grund ist anzugeben, warum der Beginn auftaktig
und die beides Repetitionen des Nachsatzmotivs niedertaktig
erscheinen. Die Akzente liegen bei dem auftaktigen und dem
ersten niedertaktigen Beginn ganz gleich (und zwar deutlich
synkopisdi), um dann erst bei der zweiten (verkürzten) Wieder­
holung den Niedertakt, also die Zählzeit 1, zu markieren.
Metrisch instandgesetzt, müßte der ganze Themenkomplex, das
erste Tutti, etwa durch folgende Taktwechsel bezeichnet werden
(wobei die Pause nach Ziffer 1 dem vorangehenden Einleitungs­
takt zugesdiiagen werden müßte): */*, 4/4, s/&, 3/i, Vt, Vs, wobei
der letzte Takt (9/s) ein um ein Achtel verkürzter 5/4-Takt ist
(also */4 + Vs). Auf diese Weise metrisiert, würden die musi­
kalischen Sach'verhalte klarer: allerdings würde sich dann, bei
auch weiterhin konsequenter Metrisierung zeigen, daß sich in
den durdtführungsartigen Passagen die metrischen Verhältnisse
ungemein vereinfachen, (übrigens hat Strawinsky auch manche
Stellen vernünftig metrisiert, etwa bei Z. 6, der Modulation vom
l.S o lo zum 2. Tutti, v/ährend unmittelbar nach 2 .7 der */4-Takt
etwas zu früh eingeschoben ist.)
Die Stelle Z. / ist in der Strawinsky-Literatur wiederholt als
»Seitenthema“ bezeichnet worden, während doch die Soloviolme
nur einen Kontrapunkt zum Hauptthema spielt. Dennoch ist
dies vielleicht in einem übertragenen Sinn richtig. Nähme man
an, der Satz sei in Sonatenform geschrieben, was indessen aber
nicht zutrifft, so käme dieser Stelle die Bedeutung des SeitenSsltZSS ZU* Dennoch ist sie so wenig ein Seitensatz wie der Mittelteil (Z. 18 ff.) eine Durchführung.
Der erste Satz des Konzerts für Kammerordiester in Es (1938),
das zu Strawinskys bekanntesten neoklassizistisdien Werken
zählt, lehnt sich noch stärker als das Violinkonzert an Bach an.
Die Thematik zeigt gewisse äußerliche Ähnlichkeiten mit den
Werken des Köthener Kapellmeisters und der Soio-Tutti-Kontrast ist, ganz wie in einigen der Brandenhurgischen Konzerte,
liquidiert. Während aber die Teile eines Badischen Konzert­
themas (Ritomells) einen harmonischen Vorgang repräsentieren
— dies ist sogar in gewissem Umfang bei dem Hauptthema von
Strawinskys Violinkonzert der Fall! —, herrscht hier voll­
ständiger harmonischer Stillstand, der es ermöglicht, jedes ein­
zelne Glied durch ein anderes zu ersetzen, die einzelnen Bestand­
teile also beliebig miteinander zu vertauschen. Herbert Eimert
hat in seinem Versuch einer Analyse (Melos 14, 1947, 247— 250)
darauf hingewiesen, wie die melodische Veränderung in den
ersten zwölf Takten durch die wechselnde Anordnung der ein­
zelnen Glieder des Themas zustande kommt. Auf diese Weise Ist
aber nicht nur die Hauptstimme dieses Themas zusammengesetzt,
sondern auch alle anderen musikalischen Bestandteile, besonders
die Simultankombination der verschiedenen Motive aller be­
teiligten Stimmen. Die Motive, die zunächst konzertierend mit­
einander abwechseln, Streicher- und Holzbläsermotive, werden
alsbald miteinander kombiniert, besser gesagt, Immer näher zu­
sammengeschoben, bis sie schließlich In T. 9 gleichzeitig er­
scheinen. Wollte man die Technik näher bestimmen, so müßte
man sagen, es handele sich um ostmate Figuren, die wechselnd
miteinander kombiniere werden. Tatsächlich sind auch alles nur
zu Motiven verfestigte Spielfiguren, deren Substanz der Es-DurDreikiang ist. Durch das Immer dichtere Zusammenriicken ent­
steht sogar etwas wie eine Steigerung, aber aus ihr wiederum
resultiert nichts, sie Ist Selbstzweck ohne formale Bedeutung,
ein kunstgewerblicher Schnörkel. Bei Z. 2 Ist motivisch wieder
der ursprüngliche Zustand hergestellt, aber formal beginnt die
Überleitung zum Solothema, die dadurch eingeleitet wird, daß
das Hauptthema neu (dissonant) harmonisiert und durch Synkopierungen etwas entstellt erscheint. Eigentlich erwartet man,
daß die an dieser Stelle auftretenden Dissonanzen eine Modu­
lation elnleiten. Das aber Ist, merkwürdig genug, nicht der Fall.
Vielmehr tritt nach einigen harmonischen und metrischen Extra­
vaganzen, die zu dem zuvor ziemlich eindeutig vorherrschenden
Es-Dur kontrastieren — das thematische Geschehen ist nicht viel
mehr als eine getrübte Sequenz — , das zweite Thema ebenfalls
in Es-Dur ein. Dieser kurze musikalische Gedanke Ist im Sinne
der Konzertform ein Soiothema. Es Ist In der für Strawinsky
so überaus bezeichnenden Weise aus einem metrisch verscho­
benen und sequenzierten Dreitomnotlv gebildet und umfaßt
Insgesamt vier Takte. Der Motivkern, das Dreitonmotiv,
besteht in seiner originalen Gestalt aus einer aufwärts gerich­
teten großen Terz, die als Vorhalt zur Quart dient, nimmt aber
im Verlauf seiner Verarbeitung auch andere Intervalle für sich
in Anspruch, etwa die kleine Terz als „Vorhalt“ zur großen.
Dieses Thema wird kurz verarbeitet und durch konzertante Zu­
satzstimmen bereichert und moduliert schließlich nach D-Dur.
Bei 2 .7 beginnt dann eine durch das Hauptmotiv des zweiten
Themas eingeleitete Episode, in der zunächst die Hörner und
dann die Streicher kantabel, das Fagott dagegen mit konzer­
tierenden, gebrochenen Akkorden hervortreten. Nach einer dreitaktigen Überleitung folgt eine variierte Wiederholung des
eigentlichen Ritornells, dann, bei 2 .1 3 , eine Fuge mit zwei
Durchführungen. Der Motivkopf des Fugenthemas ist aus dem
Hauptmotiv des Solothemas gebildet. Die erste Fugendurch­
führung verbleibt im Dominantbereich (C —F), die zweite leitet
zurück in den Tonika-Subdominantbereich (Es—As), um dann
bei 2 .2 0 in die Reprise des Solothemas in Es-Dur einzumünden.
Darauf folgt zunächst das Ritornelithema (verkürzt, Z. 22), an­
schließend abermals das zweite Thema, das hier eigentlich über­
flüssig ist, da damit doch die Reprise eingeleitet wurde und end­
lich eine (angehängte) Coda (Z. 24) mit einer Überleitung zum
zweiten Satz. Es ist kaum notwendig, noch einen weiteren
Konzertsatz Strawinskys vollständig zu analysieren, da doch
immer wieder ähnliche kompositorische Situationen auftreten.
Überblickt man die Strawinskyschen Konzertsätze — der des
Kammerkonzerts in Es fand einen Nachfolger im Hauptsatz
des Septetts von 1953, das Hilmar Schatz (Melos 25, 1958, 60
bis 63) jüngst analysierte —, so taucht die Frage auf, was für
eine Formkonzeption Strawinsky eigentlich verwirklichen
wollte. In den Konzertsätzen Strawinskys durchdringen sich
nämlich die Bestandteile dreier wichtiger, aber deutlich zu tren­
nender Formen, der Konzertform, der Sonatenform und der
Form der Da-capo-Arie. Die Arienform hat schon Bach in
seinem Violinkonzert E-Dur auf das Instrumentalkonzert über­
tragen, ein Experiment, dem schon darum nichts 'Willkürliches
anhaftet, weil diese Form selbst wieder teilweise der Konzert­
form verpflichtet war. Bachs Vorbild folgt wiederum Stra­
winsky in seinem Violinkonzert. Wer aber zu häufig alten Vor­
29
bildern nacheifert, muß es sich gefallen lassen, an ihnen ge­
messen zu ■werden.
Die thematischen Verknüpfungen, b ei Bach von äußerster Portgeschrittenheit und Konsequenz, sind bei Strawinsky äußerlich,
die Themen selbst konventionell. Wo (In diesem Rahmen) profi­
liertere musikalische Gedanken auftreten, wie etwa im Haupt­
thema des Violinkonzerts oder dem Soiothema (Z .4) des Kam­
merkonzerts, sind sie so beschaffen, daß man nicht versteht,
warum sie dissonant begleitet werden. Damit werden aber auch
alle modulatorischen Operationen, die mit H ilfe dieser Disso­
nanzen — meist sind sie das Ergebnis von Stufenmischung —
ausgeführt werden, unangemessen; das heißt Form und Motiv
stehen im Verhältnis des Widerspruchs. Eine Entwicklung der
musikalischen Gedanken kann also gar nicht stattfinden, da die
einzelnen Momente der Komposition nicht zusammenstimmen.
Die Formen selbst tragen darum auch allenthalben Spuren der
Gewalttätigkeit. Die metrischen Verschiebungen sind keine Ent­
wicklungen oder Variationen, sondern nur ein Notbehelf, um
die konventionelle Kompositionstechnik zu cachieren. Daraus
erklärt es sich, daß gerade die Überleitungen bei Strawinsky so
wenig überzeugend geraten.
Nach alledem dürfte es kaum wundernehmen, daß richtige
Durchführungen bei Strawinsky kaum je anzutreffen sind. An
ihre Stelle treten melodiöse Partien (Kammerkonzert Z. 7, Vio­
linkonzert Z. 20) oder Fugati, respektive mißlungene Fugen
(Kammerkonzert 2 . 13, Septett Z. 4). Über die Kantilenen Stra­
winskys mag ich mich nicht äußern, die Fügen und Fugati, die
allesamt zu kurz geraten sind, müssen dagegen auf ihre formale
Bedeutung hin untersucht werden. Es bedarf dazu eines Hin­
weises auf kompositorische Details bei Bach. Im l.S a tz des
3 .Brandenburgischen Konzerts beginnt T .78 ein ganz kurzes
Fugato mit einem eigenen Thema, das vom Hauptmotiv des
Satzes kontrapunktiert wird. Das Fugato dauert nur 8 Takte,
aber was für eine bedeutende Funktion kommt ihm zu! Das
Fugato selbst Ist ein auskomponiertes Crescendo, auf dessen.
Höhepunkt das Hauptthema des Satzes hinzugefügt wird. Die
produzierte Spannung löst sich in einem unerhört kühnen» rein
harmonisch konzipierten Abschnitt (87— 90), dessen Gewalt für
seine Zeit wohl einzigartig Ist. Dieser Komplex wirkt noch In
30
dem folgenden Abschnitt, dem letzten vor dem Einsatz der
Reprise nach, der erst die volle Entfaltung des thematisch kon­
trastierenden Materials bringt und es wahrhaft durchführt.
In Strawinskys Septett, das sich hier besonders zum Vergleich
anbietet, folgen aas dem Fugato (2 .4 ), das mit einer sechsstimmigen Engführung durch den Quintenzirkel (von f bis e)
schließt, ein paar Akkorde, sonst nichts! Dann setzt die Reprise
ein, ganz so, als ob nichts geschehen wäre.
Es ist im Grunde gleichgültig, welches Werk von Strawinsky
man näher analysiert; die formale Gestaltung ist immer primi­
tiv, das heißt willkürlich gefügt, denn kaum ein musikalisches
Ereignis läßt sich ursächlich aus dem vorhergehenden ableiten.
Die motivische Arbeit ist zu schwach, um formkonstitutiv zu
wirken — die Themen selbst lassen allerdings auch kaum eine
andere als eine konventionelle Verarbeitung zu — , die H ar­
monik hat, seitdem die Funktionsharmonik machtlos wurde,
ebenfalls kaum noch formtragende Bedeutung. Die Folge davon
ist einerseits das Einschrumpfen der Form, das nichts mit Kon­
zentration zu schaffen hat, anderseits ihre Willkür.
Diese Willkür zeigt sich schon in der Yertauschharkeit der ein­
zelnen Motive oder Motivbestandteile. Es ist freilich auch hier
nicht die Vertauschbarkeit an sich, die formwidrig ist, sondern
ausschließlich der Umstand, daß der Austausch musikalisch nicht
motiviere wird und auch keine Konsequenzen nach sich zieht.
Aach bei Bach findet man gelegentlich. Motivtausch. Im Konzert
für zwei Klaviere C-Dur setzt Bach in der Reprise (T. 122 ff.)
an die Stelle der Vordersatzfortspinnung das Solothema, aber
dieses musikalische Ereignis, das jedem aufmerksamen Hörer
bewußt wird, ist Ziel der Entwicklung des ganzen Satzes.
Dem wird gewöhnlich entgegnet, daß Strawinsky Entwicklung
und Steigerung eben nichts bedeuten. Mag sein, daß er sie nicht
erstrebt; — dennoch wird man im Da-capo-Teil des Violin­
konzerts oder etwa in der Reprise des Kammerkonzerts eine
Steigerung erblicken müssen, nur ist sie eben nicht genügend vor­
bereitet. Audi wird man fragen müssen, warum Strawinsky etwa
im Kammerkonzert das Fugato-Thema aus dem Solothema ab­
geleitet hat, warum er zwei Fugendurchführungen schreibt und
in der zweiten alle Stimmen oktavierr, wenn nicht doch eine
Steigerung intendiert ist.
31
Während Strawinsky und Hindemith relativ einfache musi­
kalische Inhalte mit einfachen musikalischen Mitteln ausdrüdten,
somit also auch relativ leicht za verstehen sind, bedürfen andere
Komponisten, etwa Claude Debussy, Alexander Skrjabin und
Arnold Schönberg differenzierterer Mittel. Das Werk Debussys
zeigt eine teilweise ganz neuartige Einstellung zum Tonmaterial.
Die für unsere Betrachtung interessantesten Teile seines Oeuvres
sind diejenigen. In denen er bewußt auf die Verwendung des
gesamten chromatischen Tonvorrats verzichtet. Nach dem Vor­
bild einiger russischer Komponisten, Modest Mussorgskijs und
Wladimir Rebikoffs, aber auch fernöstlicher Musik, die, wis wir
sahen, zum Teil über halbtonlose temperierte Skalen verfügt,
hat Debussy des öfteren Abschnitte miteinander konfrontiert,
die einen grundsätzlich verschiedenen Tonvorrat aufweisen. Es
ist zwar nicht zu verkennen, daß sich in diesem Verfahren noch
Reste der alten Art der Gegenüberstellung mehrerer Tonarten
verbergen, aber das wesentlich Neue bei Debussy ist, daß quali­
tativ verschiedene „Systeme“ einander gegenübergestellt -werden.
Uns interessieren hier weniger die Kompositionen, In denen
einzelne diatonische Modi einander ablösen, etwa unser ge­
wöhnliches Dur-Geschlecht und einer der uns archaisch an­
mutenden Kirchentöne — wobei wir nicht verkennen, daß auch
den kirchentonalen Partien eine erhebliche Bedeutung zuKommt — , sondern jene, in denen wir einen Systemwechsel be­
obachten können.
Das Klavierstück „Volles“ (Preludes 1/2) ist in seinen Außen­
teilen ( T .l — 41 und 48— 64) ganz und gar auf der Ganzton­
leiter errichtet (c— d— e— fis— gis—als), v/ährend der Heine
Mittelteil (T. 42— 47) rein pentatonisch (es— ges— as— b— des)
angelegt Ist, Mit Ausnahme von vier Einleitungs- 'and drei
Schlußtakten ruht das ganze Stück auf einem ,B als Orgelpunkt,
was aber nicht verhindert, daß wir, während die Außenteile nur
gelegentlich als getrübtes B-Dur erscheinen, den ganzen pentatonischen Mittelteil als unvollständiges es-Moii hören. Ais einer
der konsequentesten Versuche, von der alten diatonischen Ord­
nung loszukommen, ist dieses Klavierstück von höchster Bedeu­
tung. Wir finden in ihm keinerlei Anklänge aa die alte Modaü-
tat, und daß wir im Mittelteil ein unvollständiges Moll hören,
ist wahrscheinlich. nur eine Folge unserer Gewöhnung an dieses
Tongesdileditj denn uns steht die Pentatonik, da sie ganz und
gar auf der Quintverwandtsdiaft beruht, näher als die Ganzton­
leiter, die die Quintverwandtsdiaft bekanntlich vollständig Igno­
riert. Konstitutiv für die Ganztonskala ist in Debussys „Volles“
durchaus die große Terz, nicht aber die ausschließlich zur Melo­
diebildung benutzte große Sekund. So ist es verständlich, daß
der übermäßige Dreiklang klanglich vorherrscht. Dennoch er­
scheinen die auf der Ganztonleiter basierenden Teile nicht aharmonisch, denn wie von ferne klingt gelegentlich der Nonen­
akkord mit disalterierter Quint (c— e— ges— gis—b— d) durch.
Gerade aber durch die unvermittelte Gegenüberstellung von
Ganztonreihe und Pentatonik entsteht ein eigentümlicher Effekt:
'Während in den Rahmentellen die große Terz (ohne die sie
zum Dreiklang ergänzende Quint) vorherrscht, wirkt der auf
der Quint basierende kurze Mittelteil mit seiner Mollfärbung
berückend. Und damit sehen wir auch, was Debussy In diesem
Stück veranschaulichen wollte: er zeigt die auch in der traditio­
nellen Musik so wichtigen Intervallbeziehungen in einem ganz
neuen Licht und vermag darüber hinaus noch einen bestimmten
Bildgehalt, den fiatterder Segel im Abendwind bei plötzlichem,
kurzem Aufleuchten des letzten Sonnenstrahls, zu suggerieren.
Das Klavierstück. „Cloches a travers les feuilles“ (Images II/l)
zeigt bei grundsätzlicher Ähnlichkeit im Detail eine etwas ab­
weichende Anlage, Es beginnt mit verschiedenen, aus der Ganz­
tonleiter (f—g— a— h— eis— dis) gebildeten, kontrapunktisch
miteinander verbundenen, skalenmäßig auf- und absteigenden
Tonreihen, In die plötzlich Im 6. Takt ein „systemfremdes“ c”
an pointierter Stelle eingeführt wird. In Takt 9, einem Ober­
leitungstakt, erscheint dieses c” abermals mit einem d5 In der
Begleitung; beide Töne dienen der Vorbereitung des in Takt 10
ganz schnell aufeinanderfolgenden c-Moll-C-Dur-Wechsels, der
aber sogleich wieder zurückgenommen wird, indem nach Takt 11,
einer genauen Wiederholung von Takt 9, in T ak t 12, unter Bei­
behaltung der gleichen rhythmischen und motivischen Anlage
der Nonenakkord über As mit reiner und tiefalterierter Quint
(statt es: eses, als d geschrieben) erklingt. Wir hören also an
dieser Stelle so etwas wie eine nachträgliche Rechtfertigung des
33
das ganze Stück einleitenden Ganztonkomplexes. Darüber hin­
aus wird an dieser Stelle auch der historische Zusammenhang mit
der traditionellen Musik deutlich. Schon aas dem hier An­
gedeuteten kann man erkennen, wie verschiedenartig Debussy
ein und dasselbe Runstmittel, hier die Ganztonreihe, ver­
wendet.
Betrachten wir schließlich noch ein drittes Werk von Debussy,
„Pagodes“ (Estampes 1). Grundlage dieses Stückes ist die
anhemitonische (halbtonlose) Pentatonik (h— eis— dis—fis— gis),
aus der alle formkonstitutiven musikalischen Gedanken (Themen
und Motive) gebildet werden, Bereits Im 5. Takt erscheint In den
Begleitharmonien ein a, das aber nur als Vorbote der beiden
m den Takten 7— 10 erscheinenden Töne ais und e autzufassen
ist. Tatsächlich ist also hier die Pentatonik in Diatonik (H-Dur)
übergegangen; die folgenden Takte kehren allerdings wieder
zur Pentatonik zurück, In der anschließenden Episode wird
der Tonvorrat abermals erweitert und zwar um die Töne eis, g
( = fisis) und a. Diese Töne treten während des ganzen Stückes
nur in den (eingeschobenen) Episoden auf und haben also für die
Gesamtkonzeption nur sekundäre Bedeutung. Wer das Stück
auf diese Weise analysiert, wird feststellen, daß der (der alten
Diatonik) entsprechende Tonvorrat — die pentatonische Reihe
mit h als Grundton — stets die Tendenz zeigt, sich nach H-Dur
zu entwickeln, d. h, zu erweitern, während die den „Episoden“
zugehörenden Zusatztöne ais Alterationen im üblichen Sinn an­
zusprechen sind. Der ästhetische Reiz dieses Stückes beruht auf
der Dynamik des Tonmaterials und der einleuchtenden formalen
Konfrontation der verschiedenen Stadien seiner Entfaltung.
Wesentlich ist, daß die Pentatonik als Grundlage dient, daß sie,
ganz abgesehen von den (zahlreichen) Partien Innerhalb des
Stückes, Anfangs- und Schlußtakte allein beherrscht. Am An­
fang wird sie langsam, „aufgebaut“ — erst sind es zwei Töne
fh— fis), womit bereits die Tonalität fixiert Ist, dann wird ein
dritter (gis) hinzugefügt und im 3, Takt sind endlich alle fünf
Töne gegeben — , und am Schluß steuert alles auf den pentatonischen Fünfklang zu, der als Schlußakkord figuriert. Dieser
Klang, der das gesamte konstitutive Tonmatenal zusammen­
faßt. wird bereits vorher durch die lebhafte fünkcönlge Figu­
ration der Schlußtakte erzeugt, ehe er am Schluß tatsächlich als
34
Akkord auftritt. Die besondere Eigenschaft dieses Akkords ist es,
nicht wie unsere traditionellen Drei-, Vier- und Fünfklänge
durch Terzsdiidirung entstanden zu sein, sondern durch Quint­
schichtung, Die Lage der einzelnen Töne läßt ihn jedoch wieder
als Verwandten des (durch Terzschichtung entstandenen) Undezimenakkords erscheinen.
Ein Vergleich dieser drei Stücke Debussys zeigt, daß in „Pa~
godes“ doch noch, wenn auch nur in wenigen Episoden, Chro­
matik anklingt, in „Cloches a travers ies feuiUes“ keine Neigung
mehr zur Chromatik besteht, während in „Voiles“ sowohl
„Chromatik“ als auch die landläufige siebenstufige Diatonik
konsequent vermieden sind. Dies entspricht durchaus der stetigen
Entwicklung Debussys von der Chromatik zur Diatonik: die
„Estampes“ erschienen 1903, das zweite Heft der „Images“ 1.907
und der erste Band der „Preludes“ 1910.
Während Debussy Skalen in Akkorde umbildet, d, h. den gesam­
ten Tonvorrat in gleicher Weise zur Skala (oder Spielfigur)
und zum Akkord verwendet, womit dem alten Prinzip, nur
eine Tonauswahl zur Akkordbildung zu verv/enden, der erste
Schlag versetzt wird, geht Alexander Skrjabin in seinen Wer­
ken, etwa seit op. 58 (1909), den entgegengesetzten Weg. In die­
sen Spätwerken unternimmt Skrjabin den Versuch, das für eine
bestimmte Komposition charakteristische Tonmaterial aus
e in e m Akkord zu entwickeln. Dieser Akkord, trotz seiner Ab­
leitung aus den sonst für die Akkordbildung nicht herangezo­
genen, entfernteren Obertönen häufig ein entfernter Verwandter
des Dominantseptakkords (oder auch des Nonenakkords), wird
transponiert, aufgeteilt und klanglich in Figurenwerk aufgelöst.
Alles ist auf diesen Akkord bezogen und gewinnt seine form­
konstitutive Kraft aus dieser Beziehung. Der Grundakkord ist
auf jeden Fall eine Dissonanz (mit allerdings einwandfrei hör­
barem Grundton), der aber die Funktion einer Konsonanz zu­
gemutet wird. Die Tonalität ist zwar nicht aufgegeben, aber
durch die geringere V ersehmelzung des Klanges erscheint der
jeweilige Grundton weniger aufdringlich, die Tonalität ist also
verschleiert. (Dieser Eindruck: wird durch den wunderbar schwere­
losen, freilich höchste Anforderungen stellenden Klaviersatz
noch verstärkt.) Auch im Verhältnis der Grandtöne treten immer
mehr die entfernteren Verwandtschaften in den Vordergrund,
so daß die Quint ihre formkonstitutive Kraft allmählich ein­
büßt und sogar vielfach durch den Tritonus ersetzt wird. Wesent­
lich ist bei dieser Kompositionstechnik, daß es dennoch zu einer
sinnvollen harmonischen Entwicklung kommt. Skrjabin hat es
immer verstanden, die Akkordfortschreitungen als „logisch“ er­
scheinen zu lassen, Indem er die Transpositionen von Akkord­
teilen so einführte, daß der Vorhaltcharakter einzelner Töne
ausgenutzt wurde, also Immer ein gewisses Drängen spürbar
bleibt, während andere Komponisten, die eine ähnliche Klang­
technik anwandten, gerade den traditionellen Drang eines
Akkords in den anderen aufheben wollten.
Die Wiener Komponisten um Arnold Schönberg entwickelten
gleichzeitig mit Skrjabin, vielleicht sogar schon früher, eine ganz
ähnliche Klangtechnik. In der Wahl Ihrer Grundakkorde waren
sie zwar großzügiger als der russische Komponist, dafür aber
verzichteten sie vielfach auf eine Transposition der Akkorde
und haben diese Technik überhaupt nicht so konsequent ent­
wickelt. Einmal hat sich Schönberg ihr allerdings ganz und
gar anvertraut, nämlich in den beiden kürzesten seiner klei­
nen Klavierstücke op. 19, deren Analyse wir Hugo Leidatentritt (Die Musik 25/1, 1932/33, 405—413) verdanken. Das
zweite Stück dieser Sammlung zeigt die Technik des Klang­
zentrums, reduziert auf das Widerspiel von großer und kleiner
Terz. Jeder einzelne Ton dieses Stückes ist mit einem der gleich­
zeitig auftretenden oder darauffolgenden Töne durch Terzbezie­
hung verknüpft, und bei den kantabel hervortretenden Wendun­
gen, insbesondere in Takt 2 und 3, ist die Beziehung kleine Terz—
große Terz unmittelbar melodisch ausgeprägt (d—fis— dis / a—
c— as); es Ist dies eine jener für die Musik um 1910 so überaus
charakteristischen Tonfolgen8. Im 6. Stück steht dem dreitömgen
Quartenakkord (g—c’— f resp. transponiert c'— t5— b’) ein
Klang gegenüber (am Anfang und linde a'— fis"— h” ), der die
Neigung hat, sich in den Septakkord h— dis—fis— a zu ver­
wandeln. Mit dieser Komposition ist aber schon ein Grenzfail
gegeben, da die gewählten Akkorde kaum mehr ais bloße Grund­
lage des Stückes angesehen werden können, sondern schon iast
mit ihm identisch sind.
Die vielleicht schönsten Beispiele tür diese Technik im Wiener
Schönbergkreis sind m Anton Weberns Georgeüedern op. 3 und
36
op. 4 (1907— 1909} enthalten. Webern wählt natürlich (wie
Skrjabin und Sdiönberg) eine Dissonanz als „Klangzentrum“
für eine ganze Komposition oder einen Kompositionsabschnitt.
Dieses Klangzentrum übernimmt auch hier zunächst die Funk­
tion des Grunddreikiangs der Grundstufe, wird aber häufig
aiteriert und durch Vorhalte, Durchgänge und Wechselnoten be­
stätigt. Gelegentlich werden auch ganze Komplexe transponiert.
So basiert z.B. das ganze Lied „Im Morgentaun trittst du her­
vor“ op. 3 ,4 auf einem einzigen Fünfklang (f— h— g— e— b).
Was für reiche Möglichkeiten sich bei der Auskomposition dieses
Grandklanges ergeben, läßt ein flüchtiger Blick auf diesen Akkord
erkennen, da er sämtliche Intervalle zur Verfügung stellt:
Quint und Quart (f— b und e— h), kleine Terz und große Sext
(e— g). große Terz und kleine Sext (g—h), große Sekund und
kleine Septime (f— g), kleine Sekund und große Septime (e— f,
b— h) sowie den Tritonus (f— h und b— e). Darüber hinaus
findet sich sowohl ein Moll dreiklang (e— g— h), der, wird der
Akkord spiegelbildlich, umgekehrt, zum Durdreiklang wird, als
auch ein Septakkord, allerdings ohne die leicht entbehrliche
Quint (g—h— f). Man kann also sagen, daß sich der Komponist
mit diesem einen Akkord ein Tonmaterial zurechtlegte, das
ihm gestattete, jede gewünschte Tonbeziehung herzustellen.
Natürlich hat Webern diesen Akkord nicht mechanisch voraus­
gesetzt, sondern durchaus der jeweiligen kompositorischen Situa­
tion angepaßt. Besonders bedeutsam ist dabei, daß der Ton f
des Grundklanges vielfach die Neigung zeigt, sich in fis zu ver­
wandeln, eine Neigung, der Webern nicht nur im Schlußklang
nachgibt, sondern bereits beim Höhepunkt des Liedes im 3. Takt.
Hier bringt die Melodie der Singstimme die Töne des Grund­
klanges eine kleine Sekund aufwärts transponiert: g”— c” —
as’— f’— h.
Die Melodiebildung wird bei Webern aber meist nur indirekt
von einem derartigen Klangzentrum bestimmt: Vielfach folgt
sie eigenen Gesetzen, deren Konsequenzen in gewisser Weise
sogar zum Klangzentrum kontrastieren. Dennoch besteht selbst­
verständlich eine Beziehung zwischen klanglicher und melo­
discher Konstruktion. Da das Klangzentrum bei Webern ge­
wöhnlich ein recht komplizierter Klang ist, kann es als Grund­
lage für eine sehr differenzierte chromatische Melodik dienen.
37
Die Melodik hat dabei sogar die Tendenz sich nach bestimmten
Prinzipien der alten M odalität zu richten. Bemerken, wir zu­
nächst die Tendenz, Anfangs- und Schlußton auf die gleiche
Stufe zu setzen, ferner die Neigung, den umgrenzten Tonraum
— wenigstens am Anfang eines Gesanges — mit all seinen diromanschen Stufen auszufüllen. Alles dies trifft in den ersten vier
Takten des Liedes „So ich traurig bin, weiß idh nur ein D ing“
op. 4,4 zusammen: Klangzentrum in der Begleitung, chroma­
tische Ausfüllung des Ton.raum.es der Singstimme (cf—gis’),
Identität von Anfangs- und Schlußton der Phrase.
Sehr fließend und zart {«!•««> m'i
t)
i
PP
So ich
trau-rig bm
= = —
weiß ich nur
ein
--------—-Pp'
w v
Ding;
pp (
B e i s p i e l 3. A n to n W ebern: .Lied nach einem G edicht von
Stefan G eorge op. 4, N r. 4, 'Takt 1— i
Aber nicht nur sdhlidhte Identität von Anfangs- und Schlußton,
sondern auch Bauprinzipien nach Analogie der tonalen Sätze
und Perioden treten hier in Erscheinung. Dies können w ir eben­
falls an unserem Beispiel studieren. H ier fördern die außer­
ordentlichen formalen Q ualitäten der Georgesdien Lyrik die
musikalische Formbildung. Freilich sind bisweilen (vor allem in
op. 3,5) noch Reste der alten Tonalität spürbar: so lassen sich
dommantische Beziehungen und Oktavierungen nachweisen und
— was noch bedeutsamer ist — Leittonbeziehungen, die jetzt
allerdings nicht mehr an die Kadenzformeln gebunden sind.
Eine ähnlich gelungene konstruktive Abrundung eines Viertak­
ters finden wir in dem Lied „Ihr tratet zu dem H erde“ op. 4,5.
H ier ist aber das Streben nach tonaler Abrundung durch iden­
tische Ecktöne zurückgetreten hinter das Verfahren, die diroma38
tischen Nebentöne, die eigentlich als V orhalte zu denken sind,
nicht mehr „aufzulösen“. Charakteristisch für den Tonsatz in
den frühen Liedern Webems ist außer den bereits genannten
Momenten vor allem das aus der klassischen Instrumentalmusik
wohlbekannte Verfahren der durchbrochenen thematischen Ar­
beit. Sie findet sich in einer größeren Anzahl dieser Lieder, be­
reichert durch kontrapunktische Techniken (besonders in op. 3,1
und 3,2). Dabei gelingen Webern gleich Musterstöcke differen­
zierter Form, wie etwa op. 3,1, „Dies ist ein Lied für didi
allein“. H ier hat die Singstimme eine Melodie, die sich auf das
Schema ab(b)ccba reduzieren läßt. Es versteht sich bei dem
damaligen Stand fortgeschrittenen Komponierens von selbst,
daß es keine genauen Wiederholungen und Reprisen gibt, son­
dern stets nur Varianten. In dem bereits genannten Lied op. 3,4
ist die thematische Arbeit mit der Technik des Klangzentrums
besonders wirkungsvoll kombiniert.
Die drei eben genannten Momente, die Technik des Klangzen­
trums, stufenreiche Chromatik und entwickelte thematische Ar­
beit, führen unm ittelbar an die Schwelle der Zwölftontechnik.
Alban Bergs „Fünf Orchesterlieder nach Ansichtskartentexten
von Peter Altenberg“ o p .4 (1911— 1912) sind in dieser H in­
sicht tatsächlich ein Schlüsselwerk. Das zweite Lied
Sahst du nach dem G ewitterregen den Wald?!?!
Alles rastet, b lin k t und ist schöner als z u v o r ,------Siehe, Fraue, au dl du brauchst G ew itterregen! —
zeigt eine repräsentative Auswahl der für die Musik jener Zeit
charakteristischen melodischen Figuren.
w en ig b e w eg tf-
Sahst du nach dem Ge-wit - ter-re-gen den
Waid?!?!
B e i s p i e l 6. A lban B erg: O rchesterlied nach einem T ex t von
Peter A lten b erg op. 4, N r. 2, Singstim m e T ak t 1— 3
Als Anfangsmotiv » a « dient ein Dreitongebilde, das kleine und
große Terz, sowie die kleine Sekund umschreibt, also in geeig­
neter Konstellation nicht nur das D ur- und Mollgeschlecht re­
39
präsentieren kann, sondern auch Dur-Moll-Mischtmg und (um­
gekehrt) eine Terz mit D ur- und M ollgrundton im Sekundabstand. Das M otiv » b « macht die chromatischen Nebentöne ver­
fügbar, » c « schließlich ist eine höchst bedeutsame Version des
Quartenakkords — man findet Ihn schon bei Webern op, 3,4
T. 8 —, der aber auch durchaus in seiner Normalform, der ein­
fachen Quartenfolge, oder mit Hochalteration des letzten Mo­
tivtons erscheint. Das M otiv » a’« ist die transponierte Umkeh­
rung des ersten Motivs. Aus diesem motivischen Material, das
noch bereichert wird durch einige konventionelle Mittel (diato­
nische Dreiklänge und ‘den verminderten Septakkord), Ist das
ganze Lied leicht abzuleiten.
Betrachten w ir alle diese Motive auf Ihre übergeordneten Ton­
beziehungen hin, so sehen wir, daß eigentlich erst der Gegensatz
von Terz- und Quartbeziehung den K ontrast schafft, während
die Sekund als neutrale Basis dient. Das traditionelle Verhältnis
von Konsonanz und Dissonanz Ist also auch hier umgekehrt.
Das Vorspiel zum ersten Lied beginnt mit einem in verschie­
dene Ostinatokomplexe aufgespaltenen Eifkiang ■
— als einziger
Ton fehlt, soweit der Klavierauszug erkennen läßt, der Ton
gis •—, dessen einzelne Bestandteile unabhängig voneinander
transponiert werden.
Das dritte Lied
O ber die G renzen des Ali
blicktest du sinnend hinaus;
H attest nie Sorge um H o f und Haus!
Leben und T raum vom L e b e n ----------- plötzlich ist alles a u s -----------O ber die G renzen des All
blickst du noch sinnend h in a u s !-----------
weist eine dem Text entsprechende dreiteilige Form auf. In sei­
ner Mischung von Poesie und Prosa (rhythmische Reimprosa)
ist dieses Gedicht überaus charakteristisch iü r Altenberg. Gleich­
gültig, ob es nun bewußt konstruiert oder improvisiert Ist
— wie so vieles bei diesem Dichter —, die Pentameter am An­
fang und Schluß wirken mindestens ebenso to n n bildend wie der
Reim. Beide Rahmentelle haben jeweils als Begleitung zu der bis
auf die Verkürzung der N otenw erte identischen, zunächst engräumig-diromatisehen, dann aber sogleich m die äußerste Höhe
40
und Tiefe ausgreifenden Melodie der Singstimme den gehal­
tenen und sich allmählich auflösenden, respektive den sidi kon­
stituierenden Zwölftonakkord. D er M ittelteil, ebenso wie der
Text zweiteilig, ist streng deklamierend gehalten. Beide Motive
der Singstimme in diesem M ittelteil sind aus der Melodie des
ersten Teils abgeleitet. Die Technik des Klangzentrums ist hier
auf andere Weise als bei Schönberg ins Extrem vorgetrieben,
aber dam it zugleich auch einigermaßen aufgehoben. Aus dem
Zw ölftonakkord kann gar nichts mehr folgen, da er, O ktav­
versetzungen einzelner Töne vorausgesetzt, jede beliebige Ton­
kombination zuläßt. Wenn aber alles in gleicher Weise sinnvoll
ist, hat die Technik des Klangzentrums ihren eigentlichen Sinn
verloren; denn das, was die Technik leisten soll, nämlich durch
die Beschränkung des Materials Möglichkeiten zu eröffnen, wird
hier gerade nicht mehr geleistet. Aus dem Zwölfklang resul­
tiert denn auch konsequenterweise überhaupt nichts. Alles was
sich im M ittelteil musikalisch zuträgt, läßt sich leicht aus der
Melodie des ersten Teils ableiten, die aber selbst doch nur eine
der (unzähligen) Möglichkeiten der melodischen Ausgestaltung
des Klangzentrums ist. Indem aber eine beliebige aus dem
zwölflönigen Klangzentrum abgeleitete Tonfolge konstitutiv
für die Melodik der Komposition w ird, ist eine entscheidende
Vorstufe der Zwölftontechnik erreicht.
Das fünfte Altenberglied — eine ausführliche Analyse bot Rene
Leibowitz in The Musical Q uarterly 34, 1948, 487—505 — ist
eine Passacaglia, m it der sich Berg wiederum von einer ganz
anderen Seite der Reihentechnik nähert. Seit Schuberts „Doppel­
gänger“ findet m an in der Vokalmusik den Ostinato mehrfach
wieder als Formprinzip. Schönberg h a t ihn im zehnten seiner
George-Lieder „Das schöne Beet betracht’ ich m ir im H arren “
deutlich hervortreten lassen, während er ihn in der „Nacht“ des
„Pierrot lunaire«9 mehr versteckte als präsentierte. Audi die
Passacaglia Bergs ist sehr frei. Ih r Thema
g—as—b—cis—e
erscheint keineswegs in allen zehn Variationen, vielmehr tritt
gleich in der ersten anstelle des Themas ein neuer musikalischer
Gedanke hervor, der alle zwölf Töne der chromatischen Skala
umfaßt, also auf einer Zwölftonreihe zu basieren scheint. Im
weiteren Verlauf des Liedes Ist das Passacagliathema nur noch
gelegentlich, etwa in der vierten Variation, deutlich hörbar.
Das ganze Lied ist m it seinen 55 Takten die umfangreichste
Komposition des ganzen Zyklus, und — trotz aller Kühnheit —
die konventionellste. Zw ar ist das überlieferte Formsdhema, das
schon Schubert zerbrach, nicht restauriert, sondern verwandelt,
aber es bleibt die Tendenz zur formalen Geschlossenheit, die
dann später im „Wozzeck“, in dem sieb, ja ebenfalls eine Passa­
caglia findet, triumphiert. Dennoch eröffnet diese Passacaglia
eine ganz neue Perspektive: Berg läßt nämlich das Thema nicht
nur als melodische Tonfolge, sondern auch als Akkord, als ge­
trübten verminderten Septakkord, in Erscheinung treten. Damit
sind die motivische Arbeit und die Technik des Klangzentrums
auf der Grundlage eines alten technischen Konstruktionsprin­
zips, eben der Passacaglia, miteinander verschmolzen. Noch sind
freilich nicht alle melodischen Gestalten, etwa die Zwölftonfolge
des Anfangs, aus dem eigentlichen thematischen Kern abgelei­
tet, doch w ird deutlich sichtbar, was Berg anstrebte: die musi­
kalisch auffaßbare Verwandlung einer Melodie In einen Akkord,
ganz ähnlich dem Verfahren Debussys In dem Klavierstück
„Pagodes“. Dabei kann es aber dennoch kaum zweifelhaft sein,
daß für Berg der A kkord das Prim äre war.
*
Ä
Das grundsätzliche Zurücktreten der einfachen Tonbeziehungen
hinter die komplizierteren ist vielleicht überhaupt das allge­
meinste Kennzeichen der Neuen Musik. Die konsequente An­
erkennung dieses Sachverhalts hat die Zwölftontechnlk entste­
hen lassen, von der heute noch immer gelegentlich behauptet
wird, sie diene der Vorherbestimmung der Tonhöhen. Nichts
ist irreführender und von der Hauptsache ablenkender als diese
vielfach gedankenlos nacherzählte Phrase. Die Tonhöhen wer­
den durch die jeweils einer Komposition zugrunde liegenden
Reihen eben gerade nicht geregelt, sondern ausschließlich Ton­
beziehungen. So läßt sich schon allein aus den von den ein­
zelnen Komponisten gewählten Reihen vieles über die Eigenart
des jeweiligen Komponisten ablesen.
Betrachtet man die Reihen Schönbergs, so wird man feststellen,
daß alle möglichen Intervalle auftreten, vielleicht mit einer ge­
42
wissen Bevorzugung der Sekunden, der Septimen und des Tritonus; dieser tritt z.B. in der Reihe der Klaviersuite o p .25 und
der des 3. Streichquartetts op. 30 zweimal an wichtiger Steile,
in der des Violinkonzerts op. 36 sogar dreimal auf, fehlt dafür
aber in der Reihe des Walzers op. 23,5, Schönbergs erster Zwölf tonkomposition, und der des 4. Streichquartetts op. 37. Aller­
dings gibt es auch Reihen, In denen konsonante Tonbeziehungen
im Vordergrund stehen. Das Klavierstück op. 33 a (1929) be­
ruht auf der Reihe
b—f—c—h—a—fis—cis— dis—g—as—d—e.
Diese Reihenanlage mit drei Q uinten (b—f, f—c und fis—cis)
erleichtert es Schönberg, durch die Konfrontierung der Quintbeziehung mit entfernteren ergreifende Wirkungen zu erzielen.
Das Verhältnis zwischen den einfachen und den komplizierten
Beziehungen h at sidx aber, wie bereits angedeutet, gegenüber
der traditionellen Musik gerade umgekehrt; die entfernteren
(komplizierteren) Beziehungen sind übergeordnet und erschei­
nen als das Normale, die einfachen dienen als Reizmittel. In
T. 14/15 des genannten Stücks, dem Anfang eines fünftaktigen
Satzes, ist eine geradezu erlösende W irkung der Quinten zu be­
merken: b '—es—As— (es—As—)des’ und von hier ab nach d,
wo sich der Zielton dieser Melodie mit dem durchgehaltenen bs
vereinigt. Die H aupttöne der Begleitung, c’ und P, geben ihren
musikalischen Sinn erst später zu erkennen. Die Parallelstelle
T. 21/22, lil der die Quinten durch andere Intervalle ersetzt
sind, zum Teil durch Septimen, mündet in den reinen Quintklang, nicht den leeren, meist läppisch klingenden Q uint-O ktavklang, sondern in einen Ausschnitt aus dem Quintenzirkel: des—
as—es’—b’—f”—c’” . Klanglich derart ausgewogene Stellen fin­
det man in allen W erken Schönbergs, etwa dem 3. Q uartett
(4. Satz T. 129 ff.) oder dem Violinkonzert (T. 24 ff.), wo ihnen
allemal eine bedeutende Funktion für die Gesamtform zu­
kommt. Keine der angeführten Stellen enthält aber irgendwo
einen reinen Dreiklang: er wurde von Schönberg bewußt ver­
mieden (aber auch hier bestätigt eine Ausnahme die Regel). In
seinen frühen Zwölftonkompositlonen bemüht sich Schönberg,
deutliche tonale Schwerpunkte und kadenzähnliche Formeln zu
umgehen, selbst wenn diese durch die Reihe nahegelegt wurden.
43
Ein überaus instruktives Beispiel bietet dafür die Gavotte aus
der Klaviersuite op. 25, T .4/5, Die Reihe der Suite
e—f—g—des—-ges—es—as—d'—li—c—a—b,
die meist in drei Viertongruppen aufgeteilt w ird und außer in
der Grundgestalt und Umkehrung, der krebsgängigen Gestalt
und dem Krebs der Umkehrung nur noch in den dazugehörigen
Tritonustranspositionen erscheint, zeigt, wie gesagt, Tritoni an
entscheidenden Stellen, der denn ja auch als „halbe O k tav “ sehr
geeignet ist, die Stelle einzunehmen, die früher der Q uint zu­
kam. T räte nun an entscheidender Stelle eine Konsonanz auf,
so würde sie das ganze künstliche Gebäude einstürzen lassen.
Eine derartige Klippe kann nun Schönberg in den genannten
Takten der G avotte nur dadurch umschiffen, daß er den Reihen­
zwang durchbricht.
n s te
5
r ^
— j— j—~t—
___
-----=
* /
B e i s p i e l 7. Arnold Schönberg: Suite fü r K lavier op. 25, 2, Satz,
G avotte, T a k t 4— 5
Die ganze Stelle basiert auf der Tritonustransposition der
Grundgestalt der Reihe (b—h—cis—g / c—a—d—as / f—ges—
es'—e). Aus der ersten Viertongmppe der Reihe ist die Ober­
stimme, aus der zweiten die Unterstimme und aus der dritten
die Mittelstimme der Akkorde abgeleitet, so daß jeweils die
Schlußtöne aller Relhenauschnltte übrigbleiben. Die folgenden
drei Töne lassen leicht erkennen, welche Töne zu welchen Stim­
men gehören: der erste zur mittleren, der zweite zur oberen
und der dritte zur unteren. Das ergäbe als Abschluß des ersten
Viertakters der G avotte eine (durch zwei O ktaven getrennte)
kleine Terz. Indem Schönberg regelwidrig den vorletzten Ton
von g’ zu ges5 tiefalteriert, verhindert er die Schlußterz, die
hier fraglos als Kadenzformel wirken müßte.
*
*
*
Die Ausschließung der konsonanten Akkorde kann ich nicht mit einem
einzigen physikalischen G rund rechtfertigen, aber mit einem w e it ent­
scheidenderen künstlerischen. Es Ist das nämlich eine Frage der öko­
44
nomie. N adi meinem Formgefühl (uad idi bin unbescheiden genug,
diesem bei meinem Komponieren das alleinige Verfügungsrecht ein­
zuräumen) w ürde die Anführung auch n u r eines tonalen Dreiklangs
Konsequenzen nach sich ziehen und einen Raum in Anspruch nehmen,
der innerhalb meiner Form nicht zur Verfügung steht. Ein tonaler
Dreiklang erhebt Ansprüche auf das Folgende und, rückwirkend, auf
alles Vorhergehende, und man -wird nicht verlangen können, daß ich
alles Vorhergehende umstoße, weil eia unversehens passierter DreiMang in seine Rechte eingesetzt werden soll. D a irre ich midi lieber
gleich gar nicht; so w eit ich das vermeiden kann. Jeder Ton h at die
Tendenz, Grundton, jeder Dreiklang Grunddreiklang zu werden.
Wollte ich aus dem Auftreten auch n ur diese eise Konsequenz ziehen,
so könnte der Gedanke unversehentlich auf ein falsches Geleise ge­
schoben werden; wovor Formgefühl und Logik midi bis jetzt bewahrt
haben. Gleich. bei meinen ersten Versuchen habe ich das gespürt und
ia meiner Harm onielehre unter anderem damit begründet, daß die
konsonanten Akkorde neben den vieltönigen leer and trocken wirkten.
Ich halte es aber trotz meinem heutigen Standpunkt nicht für aus­
geschlossen, auch die konsonanten Akkorde mitzuverwenden: sobald
man eine technische Möglichkeit gefunden hat, ihre formalen An­
sprüche entweder zu erfüllen oder zu paralysieren. (Arnold Sdiönberg,
in: 25 Jahre Neue Musik, Jahrbuch der Universal-Editicn 1926, 28 f.)
Alban Berg hat versucht, die formalen Ansprüche der konso­
nanten Akkorde zu erfüllen, Anton Webern sie zu paralysieren.
Das beweisen schon ihre Reihen. Berg w ählt für die „Lyrische
Suite für Streichquartett“ und die zweite Komposition des Ge­
dichts „Schließe mir die Augen beide“ von Theodor Storm die von
Fritz Heinrich Klein ausfindig gemachte Allintervallreihe, d. h.
eine Reihe, in der alle Intervalle von der kleinen Sekund bis
zur großen Septime In einer Richtung auftreten; die Reihe des
Violinkonzerts enthält In direkter Aufeinanderfolge je einen
Dur- und einen M oll-Dreiklang sowie einen Ausschnitt aus der
Ganztonskala; die ersten sieben Töne der Reihe der Konzertarie
„Der Wein“ (nach Baudelaire-George) sind die vollständige har­
monische d-Moll-Skala. Im Violinkonzert w ar Berg geradezu
gezwungen, die Zwölftontechnik mit den Forderungen der kon­
sonanten Akkorde zu versöhnen, da im letzten Teil des Werkes
notengetreu ein vierstimmiger Kirchenliedsatz von Johann
Sebastian Bach eingebaut und dann variiert ist. W ir betrachten
■45
hier eine kleinere Komposition, das bereits genannte Stornilied, das für uns den Vorteil hat, bis in alle Einzelheiten über­
schaubar zu sein.
Dieses Lied ist Bergs erste Auseinandersetzung m it der Sdbönbergsdien Methode, mit zwölf nur aufeinander bezogenen
Tönen zu komponieren. Die unmittelbaren Modelle können
demnach nur diejenigen Zwölftonkompositionen Schönbergs
sein, die um diese Zeit bereits Vorlagen, also das »Sonett“ aus
der „Serenade“ op. 24, der „W alzer“ aus den Klavierstücken
op. 23 and die Klaviersuite. Der Gesangspart ist in Bergs Lied
genauso behandelt wie der in Schönbergs „Sonett“, d.h. die
Reihe läuft einfach mehrmals hintereinander ab. Von der Mög­
lichkeit der Transposition oder Umkehrung etc. w ird hier kein
Gebrauch gemacht. Die Reihe selbst ist jene Allintervallreihe, die
auch den strengeren Teilen der lyrischen Suite für Streichquartett
als Grundlage d ien t10. Sie lautet:
Die Anlage der Klavierbegleitung ist prinzipiell die des Sdiönbergschen Walzers. Die Reihe tritt auch hier geschlossen auf,
wenn sie auch — analog dem Anfang des genannten Walzers —
nicht mit dem ersten, sondern mit dem siebten Ton beginnt11.
Doch erlaubt sich Berg hier schon verschiedene Freiheiten, z.B.
macht er von der Lizenz der Akkordwiederholung Gebrauch,
indem er die Regeln des Orgelpunkts und der Tonwiederholung
nach dem 'Vorbild des 3. und 4. Satzes der Schönbergschen K la­
viersuite ausdehnt (T. 3/4). In T akt 6 ff. erscheint auch die Krebs­
gestalt, T ,11 ft. die Transposition um eine kleine Terz nach
oben. Die folgenden vier Takte sind als „M ittelteil“ freier ge­
staltet.
Audi In diesem Lied sehen w ir also die Tendenz, strenge und
Ireie Teile zu verbinden, wie dies dann später auch in der lyri­
schen. Suite der Fall ist. Die Kiangtolge g/ais-—cis—fis (es
handelt sich um einen Durdreiklang mit vorausgehendem obe­
ren chromatischen Nebenton des Grundtons) ist, wie man sie
auch auflösen will, m der Reihe und Ihren Nebenformen nicht
vorhanden. D er dritte Teil des Liedes — das sind die letzten
fünf Takte — ist prinzipiell nach
inert wie der erste, nur mit noch
realisiert sich in langen Liegetön«
46
Wandlung von Melodie in Akkord. Als Beispiel mag Mer eia
Ausschnitt (T. 9— 12) dienen, die Übergangsstelle vom ersten in
den zweiten Teil.
B e i s p i e l 8. A lban B erg: „Schließe m ir die Ä ugen beide“
nach einem G edicht v o n T h e o d o r S torni (2. K om ­
position), T ak t 9— 13
In der Singstimme erscheinen in dem Beispiel von den Reihen­
tönen der 4.— 12. und darauffolgend der l.T o n . Im untersten
System sehen w ir nach dem 12. Ton den Ablauf der ganzen
Reihe, deren sieben letzte Töne als A kkord liegenbleiben; in
der Oberstimme folgen die: Töne 9-—12 und anschließend die
Töne 1—3 der Grandgestalt. Die Töne 4 und 5 werden vom
unteren System übernommen; dann folgt die Oktavversetzung
47
des Fünfklanges, der zusammen mit den liegenden Tönen den
Zwölf klang ergibt. — N un beginnt der M ittelteil; Im. oberen
System der Begleitung sehen w ir die Terztransposition der Um­
kehrung (Töne N r, 8— 12 und 1 und 2), in der Unterstimme
jenen bereits oben erwähnten, nicht aus der Reihe ableitbaren
Akkord.
W ir können also feststellen, daß dieses Werfe technisch dem
„W alzer“ und dem „Sonett“ Schönbergs nahesteht, aber in ge­
wissen technischen Details wie Transposition, Krebs und er­
weiteren Orgelpunktwirkungen durchaus schon die Errungen­
schaften der Schönbergschen Klaviersuite verwertet. Rein tech­
nisch gesehen äußert sich in der Verwendung einer Allinter­
vallreihe das Bergsehe Streben nach möglichster Freiheit im Sy­
stem: er will über alle Intervalle verfügen und stets die Mög­
lichkeit zu konsonanter Dreiklangsbildung haben. Dies führt
ihn schon in diesem Lied zu der, nadi dem damaligen Stand
der Theorie unzulässigen Verwendung von Reihenfragmenten,
die w ir z.B. in unserem Beispiel in der Oberstimme der Beglei­
tung vor dem E intritt des 'Zwölfklanges feststellen können.
Freilich ließen sich die Töne f—e—c ebenso wie g—a auch als
Orgelpunkt interpretieren. Viel wichtiger als die Entscheidung
dieser Frage scheint aber die Erkenntnis der Tatsache, daß Berg
durch solche Verfahrensweise tiefsinnige K ritik am System übt.
Später hat er es dann unter der H and umgestaltet, indem er
das Konsonanzverbot umging. Ja, selbst ein Vergleich der von
Berg verwendeten Reihe m it den frühen Schönbergschen Reihen
läßt den Unterschied erkennen.
Aus keiner der Schönbergschen Reihen läßt sich, wie w ir sahen,
unmittelbar eine konsonante Dreiklangsfoige ableiten, während
in der Bergsdien sowohl der a-Moll- als auch der es-Moli-Dreiklang enthalten ist. Bei der Umkehrung der Reihe ergibt dies
dann C-D ur und Ges-Dur, in der ausschließlich verwendeten
Terztransposition demnach A -Dur und Es-Dur. Daraus ist denn
auch zu ersehen, warum Berg gerade diese Transposition wählte
und nicht die einfache Umkehrung: nur auf diese Weise sind
ihm nämlich D ur und Molidreiklang auf derselben Stufe ver­
fügbar. Daraus dürfen wir schließen, daß Berg es wesentlich auf
diese Dreiklänge abstelite.
Die Bemerkungen über die Dreiteiligkeit des Liedes bezogen
sich ausschließlich auf die reihenmäßige Konstruktion. Vom
rein musikalischen Standpunkt aus betrachtet ist das Lied natür­
lich dem Gedicht entsprechend zweiteilig. Beide Abschnitte von
je 10 Takten münden in den Zwölf klang; das Ende des ersten
Ist in unserem Beispiel enthalten.
In der Widmung dieser beiden Storm-LIeder spricht Berg von
„dem ungeheuren Weg, den die Musik von. der tonalen Kompo­
sition zu der ,mit 12 nur aufeinander bezogenen Tönen', vom
C-Dur-Drelklang zum M utterakkord zurückgelegt h a t“. T at­
sächlich steht die erste Komposition dieses Stormsdien Gedichts
in C-Dur, und der M utterakkord ist nichts anderes als der
Zwölftonakkord, der alle 11 Intervalle um faßt und dessen
horizontale Anordnung die Allintervallreihe, die oben mitge­
teilt wurde, ergibt. Aus dem Text des Bergschen Schreibens
scheint hervorzugehen, daß tatsächlich dieser „M utterakkord“
und nicht die Allintervallreihe Ausgangspunkt der Kompo­
sition war. Genauer: Der Singstimme liegt die Reihe, dem K la­
vierpart der M utterakkord zugrunde. Aber an den komposito­
risch entscheidenden Stellen pausiert ja die Singstimme und der
Zwölfklang beherrscht das Feld. Bei der Besprechung des
3. Altenbergliedes w urde zu zeigen versucht, daß tatsächlich
der Zwölfklang der eigentliche Ausgangspunkt für die Kompo­
sition des Liedes w ar; auch in dem Storm-Lied ist, ganz Im
Sinne jener früheren Werke, der Zwölfklang („M utterakkord“)
das „Klangzentrum“. Dam it erklären sich auch alle Freiheiten
der Tonfolge In der Klavierbegleitung (Takt 11 ff.), da ja, setzt
man die Technik des Klangzentrums als konstitutiv voraus, die
melodische Folge der Töne durchaus sekundär ist. D aß Berg
sich dennoch in den Außentellen an die Folge der Allintervall­
reihe hält, ist eine zusätzliche, freiwillige Beschränkung, analog
(nicht identisch!) der motivischen K onstruktion der Singstimme
im Altenberg-Lied. Das ganze Ist also ein Versuch, die vor­
wiegend harmonisch orientierte Technik des Klangzentrams mit
der vorwiegend „linearen“ der Dodekaphonie zu verschmelzen.
Aber es scheint, daß die Technik des Klangzentrums im StormLied nicht ausschließlich auf dem M utterakkord basiert, sondern
ganz allgemein auf dem Zwölfklang. In unserem Beispiel sahen
w ir den ersten Zwölfklang, er ist tatsächlich der (umgekehrte)
M utterakkord. D er zweite Zwölfklang, der Sdilußakkord des
Liedes, ist aber anders konstruiert: E r enthält nur zehn verschie­
dene Intervalle; die Q uarte ist zweimal vorhanden, dafür fehlt
die große Sekund. Es handelt sich also um eine einigermaßen
freie Umkehrung des M utterakkords12.
Anton Webern versuchte, ganz im Gegensatz zu Berg, die An­
sprüche der Konsonanzen zu paralysieren. D ie Reißen seiner
Spätwerke vermeiden grundsätzlich die reine Q uint und Q uart
und manche, z.B. die des Chorwerks „Das Augenlicht“ op.
26, die des Streichquartetts op. 28 und der Orcaestervariationen op. 30 auch den Tritonus. In seinen ersten „großen*, der
Zwölftontedinik folgenden Instrum entalwerken, hat Webern
Dreiklänge durchaus vermeiden wollen und durch die lebhafte
Veränderung des musikalischen Prozesses auch die auftretenden
Terzen, Quinten und Q uarten so eingebaut, daß sie nicht be­
sonders auffallen. W er etw a den Anfang des Streichtrios op. 20
genau analysiert, w ird zw ar Terzen und Q uarten finden, aber so
eingeführt und aufgelöst wie in den Zeiten strengster Dissonanz­
behandlung die ärgsten Mißklänge, In diesem Streichtrio ist der
Klang derartig aufgesplittert, sei es durch große Intervalle,
Pizzicati und Flageolets, sei es durch eine ganz neuartige A rtiku­
lation, daß die Konsonanzen kaum als solche wahrgenommen
werden. In der Symphonie op. 21 liegen etwas andere V erhält­
nisse vor; es ist nicht mehr ganz jener zerstäubte Klang des
Trios, sondern ein ruhig fließender Tonsatz, der veränderte Be­
dingungen für die Aufnahm e der einzelnen Tonbeziehungen
schafft. In diesem W erk kann man den seltenen Fall eines zw ar
auffälligen, aber doch keineswegs falsch klingenden Dreiklangs
studieren.
In einem Tonsatz, in dem durchweg Sekunden und Septimen
nebst ihren O ktaverweiterungen vorherrschen, der aber immer­
hin wirkungsvoll durch gelegentlich kurz auftretende Terzen
„Farbe“ erhält, erscheint in T akt 50 des 1, Satzes, also ziemlich
gegen Schluß, die Terz c—es, die in diesem Zusammenhang
nicht unbedingt als c-Moll gehört w ird; dazu tritt im folgenden
T akt ein e, so daß ein Dur-Moll-Mischklang entsteht. Dieser
freilich erklingt nur kurz, denn der A kkord wird schnell in
einen Sekundklang (cis— d—e) aufgelöst, aber schon gegen Ende
50
f
V io illk ,
f
J
B eispiel 9. Anton Webern: Symphonie op. 21,
1. Satz, Takt 50—56
des Taktes 52 hört man den Klang d—dis—fis (dis = es), der im
folgenden T akt in den reinen h-M oll-Dreiklang übergeht, dann
aber wiederum in einen Sekundklang (cis— d) aufgelöst wird. Aus
dem Klang des Taktes 54 (c—es—e; es = dis) entwickelt sich in
T akt 55 zunächst die Terz c—e, um dann kurz den ganzen CD ur-Dreiklang folgen zu lassen, der aber sogleich in einen vermin­
derten Dreiklang (cis— e—g) aufgelöst w ird. Indessen erkennt
man doch an der folgenden Oberleitung (Violine, Baßklari­
nette), daß auch hier wiederum Q uarten eine erhebliche Rolle
spielen. Es bestätigt sich also das. was man bei ähnlichen Stellen
in Schönbergs W erk feststellen kann, etwa dem Beginn des
Adagiosatzes aus dem 3. Q uartett: daß die G rundtöne der
nebeneinander stehenden konsonanten Klänge nur sehr ent­
fernt miteinander verw andt sind. Meist stehen sie in Tritonusoder Halbtonbeziehung.
Auflösung der Konsonanzen (Quinten, Q uarten, Sexten, Ter­
zen und Dreiklänge) in Dissonanzen und entfernte Beziehungen
der G randtöne konsonanter Tongruppen sind also die beiden
Mittel, die Ansprüche eben der konsonierenden Klänge zu para­
lysieren.
51
ln seinem späten Streichquartett hat Webern das zweite Mittel
allein angewandt;
B e i s p i e l 10. A n to n W ebern: Streichquartett op. 28»
1. Satz, T ak t 1— 15
Die ersten 15 Takte des Q uartetts weisen an Zusammenklängen
vornehmlich Terzen und Sexten — die enharmonische Verwechs­
lung zahlreicher Töne, die in diesem Zusammenhang wohl er­
laubt ist, vorausgesetzt— und zweimal eine Dissonanz auf, näm­
lich die große Septime h—b im 4. und 11. Takt. W ährend in fast
allen Fortschreitungen der Grundtöne, denen man manche Einzel­
teile gleichsetzen muß, die entfernteren Beziehungen überwiegen
(am Anfang g—fis/a—as), gehen den Dissonanzen wie immer
auch verschleierte kadenzartige Bildungen voraus, in denen die
Quintverwandtschaft oder eiae betonte Terz Verwandtschaft, die
in der Reihe nicht vorgesehen ist, dominiert. Die zweite Septime
(T. 11) fängt die Stufenfolge ges—as—des ( = fis—gis—cis),
also die einfachste Kadenzformel auf, die erste den fast über­
deutlichen Terzschritt des—b, dem noch die Oberquinte voran­
ging (as), und ermöglicht so, daß der Tonsatz überhaupt weiter­
gehen kann. Diese Technik des Tonsatzes hat sich also gegenüber
der Symphonie dahingehend modifiziert; daß nicht m ehr der kon­
sonante Klang, sofern er überhaupt auftritt, an sich auflösungs­
bedürftig ist (d.h. in eine Dissonanz verwandelt wird), sondern
nur noch konsonante Grundtonverhältnisse. Ein weiterer Un­
terschied ist der, daß im Q uartett die Konsonanzen im Zusam­
menklang, wenigstens soweit es sich um Zweiklänge handelt,
vorherrschen. In den überwiegend dreistimmigen Akkorden,
insbesondere in der Coda (Takt 96 ff.), ist die Dissonanz wieder
in ihre Rechte eingesetzt. Betrachtet man also den ganzen Satz,
so w ird doch, der weitgehend konsonierende Anfang in den
dissonanten Schluß aufgelöst13.
Obwohl hier keine Zwölftonanalyse des Q uartetts von Webern
gegeben werden soll, kann auf die Mitteilung der Reihe nebst
ihrer Gliederung, wie sie als erster Rene Leibowitz erkannte,
nicht verzichtet werden.
%>
y
”
i
i r::
.... ~
; A__________ ______ «=Umkehrung von A
B
r.
..
r
= A (transponiert) ;
Krebs der Umkehrung von B
B e i s p i e l 11. Reihe des Streichquartetts o p . 28, v o n A n to n W ebern
Eine Analyse des ersten Satzes dieses Q uartetts bot H erbert
Eimert (Die Reihe 2, 1955, 97— 102), deren bedeutsamster Teil
die Statistik der sukzessiven, durch Motive begrenzten Inter­
valle ist. Diese Statistik zeigt das Überwiegen der kleinen
Nonen und großen Septimen und das vollständige Fehlen von
Quinten, Quarten, Tritoni, aber auch von großen Sekunden und
kleinen Septimen. Leider hat Eimert die simultan erklingenden
Intervalle gar nicht berücksichtigt und vor allem das seltsame
'Vorherrschen der Terzen, Sexten und Dezimen (im Zusammen­
klang) überhaupt nicht erwähnt. Wie mir scheint, besteht zwi­
schen der Melodik und der „H arm onik“ •— wenn man diesen
Ausdruck hier gestatten will — ein nicht zu überhörender
Widersprach. Die klangliche Erscheinung ist einigermaßen sinn­
fällig, wie übrigens auch die Rhythm ik; — die Melodik da­
gegen, die unm ittelbar aus der Reihe abgeleitet ist, und die in­
strumentale Disposition (Instrum entation) sind allerdings sehr
kompliziert, Überdies macht die einigermaßen festgehalteneTonhöhenordnung, die der Reihenabfolge hinzugefügt w ird, den
Eindruck des Mechanischen, der auch durch die rhythmisch- me­
trische Verschiebung und Verkürzung, die in gewisser Weise an
Strawinsky erinnert, nicht verdeckt werden kann. Das kompo­
sitorische Verfahren macht hier, wie übrigens Theodor W.
Adorno bereits verschiedentlich feststeilte, einen etwas starren
und leblosen Eindruck. Vielleicht sind es gerade diese Sachver­
halte, die jüngst Strawinsky nach fast vierzigjährigem Igno­
rieren zu einem Verehrer Weberns werden ließen. Auf jeden
Fall, erscheint hier die außerordentliche klangliche Differenzie­
rung, das beste an Weberns Kunst, wie eingefroren,
V
Eine der größten musikalischen Errungenschaften der Neuzeit,
genauer des 18, und 19. Jahrhunderts, w ar die Ausbildung einer
von außermusikalischen Beziehungen unabhängigen Formenwelt,
die es ermöglichte, musikalische Kunstwerke zu schaffen, die,
in sich sinnvoll gegliedert, eine zeitliche Ausdehnung erreichen,
wie sie früheren Zeiten ganz unbekannt war. Zu einem Sym­
phoniesatz Beethovens, Bruckners oder Mahlers gibt es ia der
älteren Musik kein Gegenstück. Schon seit dem Beginn des
18, Jahrhunderts ging die allgemeine Entwicklung der Tonsprache
auf Formerweiterang aus, und wer sich etwa der W andlung der
K onzertform bei Bach gegenüber Vivaldi erinnert, mag ermessen,
welcher kompositorischen Anstrengungen es bedurfte, um grö­
ßere musikalische Formen vollständ:~ J— hzuartikulieren. Die
Basis aller musikalischen Formen <
zeit: ist die harmo­
nische Konstruktion. Alle Formen,
ie wirklich relevant
sind, verfügen über ein harmonisches (modulatorisdhes) Schema,
das dann mit thematischem M aterial erfüllt wird. Das Thema­
tische (oder Motivische) bezeichnet, wie schon August H alm er­
kannte, das Spezifische des einzelnen Werks, während das H a r­
monische das Allgemeine, Gattungsmäßige repräsentiert.. Zwar
kennt auch die H arm onik spezifische, nur bestimmten Werken
54
zugehörige Details, aber der harmonische Plan weist grundsätz­
lich über das einzelne Werk hinaus. Ebenso können natürlich
auch verschiedene Werke über teilweise identisches oder ähn­
liches thematisches M aterial verfügen, ohne daß dies den spe­
ziellen C harakter des Thematischen berührte; denn, mögen
auch die Themen verschiedener Werke miteinander verw andt
sein, so ist das Thematische als Gesamtheit, also auch die Verarbeiung, Durchführung und Kombination der Themen und
Motive, in zv/ei Werken niemals identisch.
Eines der wichtigsten Probleme der Neuen Musik besteht nun
darin, auch ohne formtragende H arm onik zu vernünftiger
formaler Gestaltung zu gelangen. Es ist bekannt, daß, nach­
dem das 18. Jahrhundert die wichtigsten Formen ausgebildet
hatte, im. 19. die H arm onik immer weniger geeignet er­
schien, die sich ständig erweiternden Formen zu tragen. Ge­
rade bei den entscheidenden Komponisten verstärkte sich die
schon bei Beethoven bemerkbare Neigung zu immer größerer
thematischer Dichte, eine Entwicklung, die in einigen der frühen
Werke Schönbergs, etwa dem 1. Streichquartett in d-MolI op. 7
und der 1, Kammersymphonie in E-D ur op. 9, ihren Höhepunkt
erreichte.
Ais Sdiönberg die aite Tonalität aufgab, bot sich ihm die Mög­
lichkeit, entweder auf die thematischen Verarbeitungstedbniken,
die sich ja schließlich im Bereich der traditionellen, harmonisch
fundierten Formen-weit entwickelt hatten, zu verzichten oder
sie beizubehalten. D er Verzicht, den er zunächst wählte, hatte
ein radikales Einschmmpfen der Form zu Folge, es sei denn,
daß im Bereich: der Vokalmusik die literarische Vorlage die
Möglichkeit des Zusammenhalts bot. Später ist Sdiönberg wie­
der zur konsequenten thematischen Konstruktion zurückgekehrt,
ja, das von ihm entwickelte V erfahren einer „Komposition mit
zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen“ stellt direkt eine Ver­
absolutierung der thematischen Beziehungen dar. D er Zwang,
jede N ote thematisch zu legitimieren, w ar der eigentliche Motor
zur Entwicklung der Reihentedmik. Es darf aber nicht über­
sehen werden, daß diese Entwicklung den Begriff des Thema­
tischen unerhört erweiterte, denn die Reihe selbst ist nichts
eigentlich Thematisches mehr, sondern allenfalls seine Basis. Die
Rechentechnik an sich erzwingt keine thematische Arbeit mehr,
obwohl sie historisch aus Ihr abgeleitet werden muß, ja, sie ist
sogar vollständig unabhängig von Ihr. Sie Ist zu der Grundlage
geworden, auf der sich die eigentliche, musikalisch relevante
thematische Arbeit erst zuträgt. Darüber hinaus ist die Form
einer Reihenkomposition von der Reihe grundsätzlich unab­
hängig. Die Rechentechnik selbst Ist nichts weiter ais eine H and­
habe zur vollständigen Erschließung des verfügbaren chroma­
tischen Tonvorrats und eine Festlegung der wichtigsten für das
einzelne W erk konstitutiven Tonbezlehungen ohne feste Bezie­
hung auf einen Zentralton.
Wie es scheint, hat sich Schönberg über die mögliche konstruktive
Bedeutung des Zwölftonverfahrens getäuscht. Er neigte dazu,
die historische Ableitung mit der Sache selbst gleichzusetzen.
Schon 1925 schrieb er:
„Von allem Anfang an w ar ich mir H a r darüber, daß für den Entfall
der tonalen Gliederungsbeheife ein Ersatz gefunden werden muß, der
ermöglicht, wieder größere Formen zu bauen. Denn da die Länge ein
relativer Begriff, aber eine Dimension der Musik ist, da Musikstücke
somit lang oder kurz sein können., kann der Aasweg der kurzen Stücke
nur ein gelegentlicher sein. D avon ausgehend bin ich zur Komposition
mit zw ölf Tönen gelangt.“ (Jahrbuch der Universal-Edition 1926, 29.)
1937 heißt es In dem bekannten Brief an den amerikanischen
Musikschriftstelier Nicolas Sionimsky:
„Der Methode, mit zwölf Tönen zu komponieren, gingen viele Vorversuche voraus. D er erste im Dezember 1914 oder Anfang 1915, als Ich
die Skizze zu einer Symphonie en tw a rf. Das Scherzo dieser Sym­
phonie basiert auf einem Thema von zw ölf Tönen. Es w ar aber nur
eines der Themen. Ich war noch weit von der Idee entfernt, ein solches
G rundthem a für ein ganzes W erk als zusammenhanggebendes M ittel
zu verwenden. Seither w ar ich bestrebt, die Struktur meiner Musik
bew ußt auf einen einheitlichen Gedanken zu stellen, der nicht nur
alle ändern Gedanken enthält, sondern auch ihre Begleitung, ihre
Akkorde. Es waren viele Versuche nötig, das auszuführen, aber nur
sehr wenige w urden veröffentlicht. Dabei wurde mir plötzlich der
w ahre Sinn meines Bestrebens bewußt: Einheit und O rdnung w aren
es, die midi unbewußt diesen Weg geführt hatten . . .“ (Zitiert nach
Rufer 26.)
Aus diesen Dokumenten geht aber nur hervor, wie und warum
die Zw ölftontedm ik entstand, nicht aber, was sie tatsächlich
56
leistet. Vielleicht meint Sdiönberg» die Zwölftontedinik ermög­
liche an sich, die Gestaltung größerer Formen, vielleicht war er
aber auch nicht willens, die Zwölftontedinik und die thematische
Arbeit auseinanderzuhalten. Was von Schönberg und seinen
Schülern bewiesen wird, ist jedenfalls nicht mehr, als daß die
Zwölftontedinik zusammen m it strenger motivischer Arbeit
größere Formen zuläßt. Dennoch müssen w ir die beiden Aspekte
der Sache möglichst auseinanderhalten. Die Form der großen
Werke Schönbergs wird nicht durch die Zwölftontedinik, son­
dern einzig durch die motivische A rbeit ermöglicht. Die Schwie­
rigkeit der Trennung beider Aspekte beruht auf der Tatsache,
daß bei Schönberg die thematische Arbeit und die Zwölftonkonstruktion in einem nicht einfach zu bestimmenden Verhältnis
zueinander stehen.
Die Reihe soll, den programmatischen Äußerungen zufolge,
die Tonalität ersetzen. Tonalität und Reihe sind aber grund­
sätzlich verschiedene Dinge. W ährend im Bereich der D urM oll-Tonalität die natürlichen, das Tonsystem konstituierenden
Tonbeziehungen grundsätzlich den entfernteren übergeordnet
sind, ferner sich im Lauf der Entwicklung ein kompliziertes
Beziehungssystem ausgebildet hatte, das aber vom einzelnen
W erk grundsätzlich unabhängig gedacht werden kann, ver­
sucht die Zwölftonreihe bestimmte Tonbeziehungen für eine
bestimmte Komposition als konstitutiv vorauszusetzen. Es leuch­
tet ein, daß dies nur dann sinnvoll sein kann, wenn dadurch im
Gegensatz zur gewohnten Beziehungshierarchie, etwas Neues ge­
stiftet wird, das in ein Spannungsverhältnis zu den für das Ton­
system konstitutiven Beziehungen tritt. Um dies deutlich in Ersdieinung treten zu lassen, bestand für die frühen Zwölftonkompositionen das Konsonanzverbot und ergab sich später die
Notwendigkeit, die konsonanten K länge umzufunktionieren.
Man kann vielleicht allgemein folgendes Verhältnis von Ton­
system und Dodekaphonie annehmen: Durch die jeweils einer
Komposition zugrunde liegende Reihe w ird ein bestimmtes Span­
nungsverhältnis zwischen der unserem Tonsystem natürlichen Be­
ziehungshierarchie und der durch die Reihe formulierten Be­
ziehungsfolge hergestellt. Die Reihe ersetzt nicht die Tonalität,
sie stiftet auch keine neue, sondern schafft eine neue Ordnung der
57
Tonbeziehungen. Diese ist aber nicht allgemeinverbindlich, son­
dern für jedes Werk, wenn auch bisweilen nur durch Nuancen,
verschieden.
Die Reihe selbst ist kaum mehr als ein abstraktes Schema, das
als die Voraussetzung für die Themen und die thematische
Arbeit angesehen werden darf. Die mannigfachen Möglichkeiten
der Themenbildung aus der Reihe von einfachem Abspielen bis
zur Tonauswahl (bei der die restlichen Töne der Begleitung zu­
fallen) zeigen, daß das eigentlich Thematische sowohl direkt als
auch indirekt aus der Reihe abgeleitet werden kann. Denn wenn
auch die Begleitung fast immer motivisch ausgearbeitet ist, so
bleibt sie doch Begleitung, und es ist für das musikalische Auf­
fassen zunächst ganz gleichgültig, ob das eigentliche Thema und
die Begleitung aus ein und derselben Reihengestalt abgeleitet
oder ob zwei Reihengestalten m iteinander kombiniert sind.
Wichtig ist zunächst die musikalische Bedeutung des einzelnen
Motivs, nicht die Beziehung zur Reihe. Das zeigt dann auch die
Formkonstruktion. Sie erhält ihren Sinn erst durch die thema­
tische Arbeit; diese wiederum ermöglicht es, durchaus verschie­
denartige Partien zu bilden, die jeweils die Funktion von Sätzen,
Perioden oder auch von Überleitungsgruppen übernehmen kön­
nen. Mag sich auch in den rondoartigen Schlußsätzen des Bläserqaxntetts op. 26 und des 3. Streichquartetts op. 30 von Sdiön­
berg ein klassizistisches Moment finden, so darf man doch nicht
vergessen, daß die Überleitungen, die sich, an die ersten H au p t­
sätze anschließen (op. 30/4, T. 13 fr.; o p .26/4. T. 11 ff.), den Ein­
tritt des ersten Couplets (op. 30, T. 18) oder eine Wiederholung
des Hauptsatzes (op. 26, T. 18) musikalisch plausibel vorbereiten.
Audi Steigerungen sind sehr wohl möglich. Man betrachte etwa
die Schlußsteigerung in dem genannten Q uartettsatz ab T, 163,
wo zunächst die Repetition des Hauptsatzes erscheint und dann
in T. 171 die Einführung eines kontrastierenden Gedankens und
dessen allmähliche Steigerung mit H ü te von Sequenzen erfolgt,
bis schließlich auf dem H öhepunkt (T. 186) der allerdings
variierte, jetzt endlich von seinem ursprünglichen, obligaten
Akkompagnement befreite H auptsatz einsetzt.
Theodor W. Adorno hat in seiner „Philosophie der Neuen
M usik“ (I.A . 1949, 6 3 ff.) tiefsinnige K ritik an der Form­
58
gestaltung der Schönbergsdhen Zwölftonkompositionen geübt,
aber vielleicht doch die Bedeutung dieser Kompositionstechnik
für das einzelne W erk überschätzt. So konnte er schreiben:
»Jeder T od. ist durch, die Reih.enbezieb.ung thematisch erarbeitet
und keiner ist ,frei‘ “ (65). W äre die Reihe lediglich eine Ton­
folge, so träfe dies fraglos zu. Sie ist aber nicht nur eine Folge
von Tönen, sondern vor allem eine von Intervallen, eine einiger­
maßen festgelegte Folge von Tonbeziehungen. Gerade dieser
Umstand ermöglicht es, daß die verschiedenen musikalischen
Gebilde mehr oder weniger fest an die Reihe gebunden sind.
Steilen w ir uns einen Reihenausschnitt g—fis—d-—c vor, so ist
ein Motiv, das diese vier Töne hintereinander bringt, unm ittel­
bar ans der Reihe abgeleitet, während das M otiv g—c mit fis—d
in der Begleitung relativ lose an die Reihe gebunden, also nur
m ittelbar aus ihr abgeleitet ist, da es die in der Reihe selbst
nicht hervortretende Quintbeziehung in den Vordergrund rückt.
D aß Sdhönberg gerade durch solche Operationen wirklich Form
schafft, zeigt die Analyse fast eines jeden Satzes. Kaum ist es ein
Zufall, daß im Finale des 3. Quartetts, wenige Takte vor dem
letzten H öhepunkt (T. 178 f.), Tritoni die Baßquinten verbinden,
während unm ittelbar von dem Ende des Satzes (T. 202 f.) ein
O rgelpunkt m it liegender Quint den Schluß vorbereitet. Durch
solche Hervorhebungen nicht in der Reihe selbst angelegter
Tonbeziehungen erhält Sdiönberg die Möglichkeit der For­
mung. Ein besonders instruktives Beispiel ist das Rondo­
thema des Bläserquintetts, das Sehönberg (Style 120) selbst
analysierte. Seine schwierige Melodie w ird durch ein in Q uintsdiritten sich ergehendes Baßfundam ent zusammengehalten.
Die Q uint ist zw ar in der ausschließlich aus Sekunden, Ter­
zen und Septimen gebildeten Reihe nicht vorgesehen, aber
Sdiönberg gewinnt sie, indem er jeweils den ersten und siebten
Reihenton m iteinander konfrontiert. Er erhält so, da der zweite
Reihenabschniit die Quinttransposition des ersten ist. reguläre,
aber dennoch nicht archaisierende „Quintschrittsequenzen“ ! D aß
derartige, nicht direkt aus der Reihe abgeleitete Sachverhalte
Bedeutung für die Form gewinnen können, ist eine Folge der
thematischen Konstruktion. Der Satz Adornos, „Die T otalität
der thematischen Arbeit in der Vorformung des Materials macht
59
jede sichtbare thematische Arbeit in der Komposition selbst zur
Tautologie“ (I.e.) scheint m ir darum kaum die ganze W ahrheit
zu treffen.
Dieser Satz Adornos ist bereits in die Geschichte eingegangen.
Die jüngsten Komponisten haben sich ihn ganz offensichtlich zu
Herzen genommen. Sie komponieren wie Schönberg um 1910
und später Alois H äba athematisch, haben sich aber gleichzeitig
auch wieder von der Zw ölftontedinik emanzipiert. Ihren pro­
grammatischen Äußerungen zufolge knüpfen diese Komponisten
— w ir meinen hier Pierre Boulez, Luigi Nono und Karlheinz
Stockhausen — bei Anton Webern an, aber es ist sicher, daß
auch andere Komponisten, vor allem Debussy, O livier Messiaen
und Edgar Varese einen bestimmenden Einfluß ausübten und
wohl auch noch ausüben. Immerhin schufen diese Komponisten
schon bedeutende, durch ganz neuartige Ausdruckscharaktere
fesselnde Werke.
Wollen w ir etwas über diese „neue“ Neue Musik — wie man sie
gelegentlich genannt hat — ausmachen, so müssen w ir einige
Werke genauer betrachten. Es kommen für uns aus praktischen
Gründen vor allem Klavierwerke in Betracht, obwohl sie, wie
es scheint, keineswegs das wirklich Relevante dieser Richtung
sindM. W ir wählen hier die Klavierstücke von Stockhausen, von
denen bisher nur einige wenige (N r. 1—4,11) erschienen sind.
Betrachtet man diese Studie unvoreingenommen, so fällt zu­
nächst die unerhörte rhythmische Kompliziertheit auf. Triolen,
Quintoien, Septolen und noch viel ungebräuchlichere U nter­
teilungen der metrischen Einheiten herrschen in befremdendem
Umfang vor, und bisweilen muß man sich fragen, ob es über­
haupt einen Menschen gibt, der diese Angaben auch nur einiger­
maßen korrekt befolgen kann. In den Klavierstücken I—IV ist
jeweils das Grundzeitmaß unveränderlich, was erkennen läßt,
daß durch diese Unregelmäßigkeit der Tondauer Temposchwan­
kungen auskomponiert sind. Jedenfalls entsteht der Eindruck
des rhythmisch Amorphen. Aber nicht nur die Rhythm ik w irkt
hier merkwürdig ungreifbar, sondern auch die Tonhöhen- und
iautstärkenorganisation. Vielfach stehen sich so kurze und in so
60
extremer Lage erklingende Töne gegenüber, daß man die Be­
ziehungen zu den benachbarten Tönen nicht mehr realisieren
kann«
D a aber allgemeine Beschreibungen nutzlos sind, wollen wir
wenigstens ein Stück näher betrachten. Das kürzeste der von
Stodkhausen bisher veröffentlichen Klavierstücke, das hier voll­
ständig reproduziert werden kann, hat für uns den außerordent­
lichen Vorzug, die sonst so häufigen rhythmischen und dyna­
mischen Extreme zu vermeiden. Außerdem liegt es in einem Be­
reich, der vom O hr noch relativ bequem kontrolliert werden
kann. Versuchen wir, so gut es geht, uns darin zurechtzufinden.
rn
rfh
>3 1
f
•U
V &
«y »
T“
f
v.-
,
'w
g j -------- r ^ = i
i 4)
1
H*
P
®
r
/
V
?
» /
fc .
1
m f
te /J »
f
g—
5 3 1.
frrf® ----
m f
nf f *
'S8®®?
15 7:5
m fm f
1
161
m ff
P
n fP
A
f
r
f
f
f
i s p i e l 12. Karlheinz Stockhausen: Klavierstück III, vollständig
Das Stück verfügt über keine Tempoangabe, soll aber, wie auch
alle anderen des Heftes, so schnell wie möglich gespielt werden.
Ais Richtpunkt dient der kleinste zu spielende Wert. D aran
Vier-Fünftel einer Achtelnote, entweder kurze, starke Akzente
sollten sich aber doch ■wohl nur die Pianisten beim öffent­
oder gar kein neuer Toneinsatz. Dadurch entsteht eine Steige­
rung oder Spannung, die in den beiden folgenden Takten gelöst
lichen V ortrag halten. Zunächst dürfte es zweckmäßig sein, schön
wird. Dieser zweite Abschnitt des ersten Teils (T. 3—4) ist, ob­
langsam zu spielen und jede einzelne Tongruppe sorgfältig aus­
zuhören. Spielt man gleich so schnell wie möglich oder hört man
gleich nur aus vier Tönen bestehend, harmonisch konzipiert, in­
unvorbereitet eine derartige Interpretation, so ist zu befürchten, dem auf den A uftakt e gleichzeitig die große und kleine Terz,
g und gis’ folgen. Der Ton ges” des 4. Takts wird als Ober­
daß .man überhaupt nichts w&hrnimmt.
Das vorliegende Klavierstück III von Stockhausen um faßt 16 leitung empfunden. (Zu der Beziehung des ges zu der voraus­
Takte mit 55 Tönen. Die Tonfolge der beiden ersten Takte: gehenden um e zentrierten Gruppe erinnere man sich dessen, was
(1) a—h—d—as—b—a (2) gis—li etc. zeigt sogleich, daß es sich, oben über die Einleitungstakte des Q uartetts op. 28 von Webern
bei diesem Stück um keine Zwölftonkomposition im stren­ ausgeführt wurde.) W ir sehen also in diesem ersten Formteil
gen Sinne handeln kann, denn der letzte Ton des 1. Takts und trotz aller Verschleierungen eine übersichtliche Gliederung und
die beiden ersten des zweiten erscheinen bereits doppelt. Zählt sogar etwas wie Innendynam ik: Aus einer gegliederten, rhyth­
man die einzelnen Töne des Stücks ab, so ergibt sich Folgendes: misch pointierten Melodie entwickelt sich ein rhythmisch wenig
c und fis erscheinen je 2mal, cis (des) 3mal, d und g je 4mal, es hervortretender, harmonischer Komplex.
(dis), f und a je 5mal, e, b (als) und h je 6mal und as (gis) 7mai. Dem entspricht der Schlußteil (T. 13— 16). In T akt 13 bemerkt
Dieser Befund erweist dann allerdings eindeutig, wie fern dieses man wiederum einen auf gespaltenen Dur-Moll-Mischklang (ohne
Stück dem Schönbergschen Zw ölftonverfahren steht, dessen Q uint), diesmal auf der Basis b (als), die als eine A rt V orhalt
Funktion es doch unter anderem auch ist, die einzelnen Töne zu dem isolierten as figuriert. Der darauf folgende melodische
einigermaßen gleichberechtigt nebeneinander zu stellen. Bei der Abschnitt bringt neben, dem auskomponierten R itardando keine
Betrachtung der Tonhöhen — bisher achteten w ir ja nur auf die charakteristischen Figuren hervor. Melodische oder rhythmische
Tonorte — finden w ir ebenfalls keine Regelmäßigkeit: es er­
Spannung ist nicht mehr zu bemerken. Die Beziehungen der
scheinen in dem Stück z. B. h zweimal, h” dreimal und h” ’ ein­
einzelnen Töne zueinander sind relativ unkompliziert und
mal, also überhaupt kein h’ und kein H , die doch beide im Be­
können so ihre Schlußfunktion erfüllen.
reich des gewählten Ambitus verfügbar gewesen wären. D er
Sind die harmonisch konzipierten Takte der Außenteile durch
Ambitus, der von A bis IT” reicht, w ird durch die beiden letzten
teilweise verschleierte Dur-Moll-Mischklänge (ohne Quint) ge­
Töne markiert. Dennoch kann man nicht sagen, die Form­
kennzeichnet, so enthält der Mittelteil auch noch andere, eben­
konzeption des Stücks bestünde in einer ständigen Ausweitung
des Tonraumes, denn der zweithöchste Ton (gis’”) erscheint be­ falls aus der älteren Neuen Musik wohlbekannte Klänge. Die
reits im zweiten T akt als erste N ote. Die Form des Stücks lehnt T akte 5—7 bringen zunächst (natürlich durchbrochen) den Bsich vielmehr, wie verschleiert auch immer, an die alte, drei­ Dur-D reiklang mit beigefügtem Tritonus, dann folgt die Terz
h-dis (es), die w ir als unvollständigen Dur-Dreiklang auffassen
teilige Liedform an.
D er erste Teil um faßt die Takte 1—4; er ist zweigliedrig. Die und schließlich eine Kombination der F-Dur- und der f-Mollbeiden Anfangstakte führen eine jener für Stockhausen so cha­ Terz. Takt 8 bringt wieder einen durch den Tritonus getrübten
rakteristischen Melodien vor, in die man sich gut einhören kann, B,Dur-Dreiklang, T akt 9 endlich eine Kombination von Es-Durda sie in sich sinnvoll gegliedert sind. Diese Melodie ist wieder­ und es-Moll-Terz. Man hört also als tonale Ereignisse in diesem
um zweigliedrig und in gewisser Weise sogar kontrastreich. Im ersten Abschnitt des Mittelteils die Folge B—F(f)—B—Es(es),
ersten T akt entfallen bei ruhiger Bewegung auf die wichtigsten das heißt, in die Terminologie der Funktionsharmonik über­
Taktteile normale Notenwerte, im zweiten, mit dem A uftakt- tragen: Tonika-—Dominante-—Tonika—Subdominante,
62
63
D er zweite Abschnitt des Mittelteils scheint zunächst weniger
klar. Er beginnt in T akt 10 mit dem durchbrochenen E-DurDreikiang mit beigefügtem Tritonus (ais); dann erfolgt eine
Wendung in den Subdominantbereich, nach a-Moil. In T akt 11
schließlich findet ein überaus charakteristischer Vorgang statt:
nadi dem vorangehenden c—a w irkt die Gruppe e—cis’—g’
wie eine Vervollständigung des a-Dur-Moll-Septimenklanges,
aber das folgende gis scheint die Gruppe e—cis’—g’ ais getrübtes
cis-Moü wirken lassen zu v/ollen. Selbst wenn man getrübtes
cis-Moll hört, so kommt, ihm doch nur eine untergeordnete Be­
deutung zu. Im folgenden T akt (12) hören w ir ein durch­
brochenes H -D ur, das durch den liegenden Vorhalt e’ zu dis ge­
trübt ist. Somit erscheint also der zweite Teil des Mittelabschnitts
als Folge von E—A(a)— [cis— ]H (Tonika—Subdominante—
Tonikaparallele—Dominante), also einer ebenso plausiblen
Harmoniefolge wie im ersten Teil des Abschnitts.
Die Gesamtkonzeption des Klavierstücks III von Stockhausen
ist also nicht länger mehr zweifelhaft. Im ersten Abschnitt können
wir die allmähliche Festigung der Tonalität E(e) hören; an­
schließend folgt ein um B zentrierter Abschnitt. Rückgreifend
auf E entfaltet sich kurz ein neuer Teil, bis dann wieder der
Schlußteil bei B(b) anknüpft, um sich, endlich in zunächst un­
bestimmter Region zu verlieren. Jetzt erkennen wir auch die
Funktion der den Dreiklängen beigefügten Tritonustöne, die im
Mittelabschnitt bemerkbar waren: sie stellen die Beziehung zu
dem tü r das Stück ebenfalls konstitutiven anderen tonalen Zen­
trum her. Insgesamt ist also festzuhalten, daß zwei tonale Zen­
tren im Tritonusabstand existieren, die jeweils einmal abschnitt­
weise erklingen und durch die quintverwandten Akkorde Sub­
dominante und Dominante voll ausgeprägt erscheinen. Aber die
beiden tonalen Zentren sind doch nicht ganz gleichberechtigt,
denn am Ende überwiegt das E. Die ganze Komposition beginnt
mit der Tonfolge a—b und schließt auch mit ihr ab; so wird das
tonale Zentrum, das in den beiden melodisch konzipierten An­
fangs- und Schlußtakten selbst nicht erscheint, wenigstens deut­
lich umschrieben.
Wenn hier dieses Stück so ausführlich betrachtet wurde, so ins­
besondere um zu zeigen, was musikalisch tatsächlich vorliegt.
Was die kleine Form betrifft, so haben wir gesehen, daß Stock­
64
hausen sie wohl za bewältigen vermag. Aber ebenso wie die
größeren Klavierstücke schon weit problematischer sind, scheint
es, als habe er jüngst vor dem Formproblem kapituliert. Die
jüngsten Stücke bevorzugen eine einfache Reihung von G rup­
pen, und im Klavierstück X I (1957) ist die eigentliche Form­
bildung dem Interpreten und damit dem Zufall überantwortet.
Dieses Klavierstück besteht aus 19 unterschiedlich langen G rup­
pen, die zusammenhanglos auf einem großen N otenblatt aufgezeichnet sind. Die einzelnen Gruppen sind so komponiert, daß
sie in verschiedener Lautstärke und verschiedenem Tempo ge­
spielt werden können und vom Interpreten in beliebiger Auf­
einanderfolge Yorgetragen werden sollen. D er Komponist
schreibt dazu:
„D er Spieler schaut absichtslos auf den Papierbogen und beginnt mit
irgendeiner zuerst gesehenen Gruppe; diese spielt er mit beliebiger
Geschwindigkeit (die kleingedruckten N oten immer ausgenommen),
G rundlautstärke und Anschlagsform. Ist die erste G ruppe zu Ende,
so liest er die darauf folgenden Spielbezeichnungen für Geschwindig­
keit (T°), G rundlautstärke und Ansdilagsform, schaut absichtslos
weiter zu irgendeiner der anderen G ruppen und spielt diese, den drei
Bezeichnungen gemäß.
M it der Bezeichnung ,absichtslos von G ruppe zu Gruppe w eiter­
schauen' ist gemeint, daß der Spieler niemals bestimmte Gruppen m it­
einander verbinden oder einzelne auslassen will. Jede G ruppe ist mit
jeder der 18 anderen Gruppen verknüpfbar, so daß also auch jede
Gruppe mit jeder der sechs Geschwindigkeiten, G rundlautstärken und
Anschlagsformen gespielt werden kann.
W ird eine Gruppe zum zweitenmal erreicht, so gelten eingeklammerte
Bezeichnungen: meist sind es Transpositionen um eine oder zwei
O ktaven (8 va . ..) (2 okt . . . ) aufw ärts oder abwärts, für unteres
und oberes System jeweils verschieden; es werden Töne hinzugefügt
oder weggelassen.
W ird eine G ruppe zum drittenm al erreicht, so ist eine der möglichen
Realisationen des Stückes zu Ende. Dabei kann es sich ergeben, daß
einige G ruppen nur einmal oder noch gar nicht gespielt w urden . . .“
(Melos 25, 1958, 69).
Ob ein Pianist, der die technisch äußerst schwierigen Gruppen
studiert haben muß, sich also auf dem N otenblatt schon gut
auskennt, wirklich noch absichtslos auf das Blatt schauen kann,
65
bleibt zweifelhaft. Außerdem ist es für den H örer ohnehin ganz
gleichgültig, ob der Vortragende Pianist die Gruppen tatsächlich
absichtslos spielt oder sich an einen zuvor zurechtgelegten Plan
hält. Auf jeden Fall kommt es bei der Aufführung dieses Stücks
zu Wiederholungen und unter bestimmten Umständen sogar zu
Reprisen. Allerdings hat der Komponist hei manchen Gruppen
Vorsorge getroffen, daß die Wiederholungen variiert werden.
M an erinnert sich bei dieser Gelegenheit aber daran, daß einst
"bei Stockhausen Wiederholung und V ariation ln gleicher Weise
verpönt waren. Dieser neue Versuch, dem Interpreten einen
größeren Anteil an der endgültigen Gestaltung des Kunstwerks
zu geben, den In seltsamer Verblendung Bouiez In seiner dritten
Klaviersonate noch überbot, ist tatsächlich, ein Verzweiflungsakt,
das Eingeständnis der Unmöglichkeit, noch verbindliche Formen
zu schaffen. Wer die umfangreicheren Kompositionen von Stock­
hausen, etwa die „K ontra-Punkte“ oder die „Zeitmaße“ hört,
fragt sich vielleicht, ob hier die Form überhaupt noch einen Sinn
hat. Das Dilemma, das einst die bedeutendsten Komponisten
nach 1920 bewog, älteren Formen zu folgen, wird Mer auf radi­
kale Weise gelöst: die Form selbst w ird abgeschafiL Die in glei­
cher Welse willkürliche und konventionelle Anlage der neuen
Formen — denn schließlich kommt ja bei Stodshausens Klavier­
stück X I doch so etwas wie ein freies Rondo heraus — w ird dem
Zufall, der als Freiheit deklariert wird, überlassen.
Noch viel bedeutsamer Ist allerdings die Tatsache, daß dieser
Verzicht auf Form auch den Sinn des Tonsatzes selbst in M it­
leidenschaft zieht. Es läßt sich leicht nadiprüfen, In wie außer­
ordentlich großem Ausmaß das richtige Tempo eines Musik­
stücks, das keineswegs einet genauen. Festlegung bedarf, die
Komposition selbst bestimmt. Die Schwerpunkte eines Ton­
satzes befinden sich an bestimmten Stellen und die Geschwindig­
keit des Vortrags bestimmt die Dichte Ihrer Aufeinanderfolge
und umgekehrt. Man mag einmal versuchen, ein. wohlbekanntes
Stück, sei es von Beethoven oder Sdiönberg, wesentlich zu schnell
oder zu langsam zu spielen, um sofort einzusehen, worum es
hier geht. Es gibt zw ar Kompositionen, denen keine Vortrags­
bezeichnungen und Tempoangaben beigefügt sind, z. B. die
Werke Bachs, aber es Ist dennoch ganz ausgeschlossen, Irgend­
eines dieser Stücke sowohl presto als auch largo zu spielen.
66
Spielt man zu langsam, fällt die Komposition auseinander, spielt
man zu schnell, so hört man nur noch eine abstrakte Bewegung,
nicht mehr aber die formkonstitutiyen harmonischen oder die
motivischen Beziehungen. Wenn auch die jüngsten Komponisten
weder Modulationen und Kadenzen noch motivische Beziehun­
gen kennen — daß freilich bisweilen doch noch etwas Ähnliches
bei ihnen auftaucht, sahen wir oben bei der Behandlung des
Klavierstücks III von Stockhausen •—, so müssen doch irgend­
welche andere Faktoren dafür einstehen. Stockhausen selbst bezeichnete es einmal ais seine Formkonzeption, „verschiedene
Gestalten im gleichen. L idit“ zu zeigen und nicht wie früher
„gleiche Gestalten in verschiedenem Licht“. Dieses „Licht“, in
der neuesten Terminologie „Struktur“ genannt, muß sehr ab­
strakt sein, wenn es, ohne seine form konstitutive K raft einzu­
büßen, gestattet, einen bestimmten Tonsatz in den verschieden­
sten Tempi zu spielen. Vielleicht leistet aber dieses neue Form­
prinzip nur so wenig, daß es tatsächlich gleichgültig ist, in
{welchem Tempo, in welcher Lautstärke und mit was für einer
^A rtikulation gespielt wird. Die Zukunft w ird erweisen, was die
„Strukturen“ tatsächlich leisten, was sie als Ersatz für die auf­
gegebenen formkonstitutiven Momente, H arm onik und thema­
tische Arbeit, zu bieten haben. W ir können nichts weiter tun,
als die Musik anzuhören und uns darüber Rechenschaft zu geben,
was w ir eigentlich hören. Einstweilen ist noch vieles ganz unklar,
denn, wie Boulez einmal treffend sagte: „Von so erschlichener
Schnelligkeit ist Erkenntnis nicht.“
ANMERKUNGEN
1 Ein eindrucksvolles Beispiel für Stufeamischung ist eine Passage aus
dem H auptsatz der Klaviersonate von Strawinsky (1924) T ak t 15— 17,
in der Reprise T akt 128— 130. W illi Schuh hat in seinen schönen
„Beiträgen zur H arm onik Igor Strawinskys“, Schweizerische Musik­
zeitung 92, 1952, 243—253; bes. 248 f. mehrere Beispiele für JPolyfunktionalität“, wie er es nennt, zusammengestellt und versucht sie im
Anschluß an Strawinskys Äußerungen im 2. K apitel der „Musikalischen
P oetik“ zu erklären.
2 In den Märschen der „Geschichte vom Soldaten“ und der vierhändigen
Klavierstücke („Trois pieces“ N r. 1) — dieses Stück eröffnet dann auch
die zweite Orchestersuite — verfährt Strawinsky ebenso, w ährend er
in den W alzern der gleichen Werke auf rhythmisch-metrische Dena­
turierung verzichtet und lediglich die Formelhaftigkeit gewisser melo­
discher Phrasen, die meist etwas verzerrt erscheinen, H armoniefolgen
und rhythmischer Komplexe hervorkehrt. Dies ist offensichtlich der
Punkt, an dem Hindemith mit seiner „Kleinen Kammermusik für
fünf Bläser“ op. 24,2 (1922) anknüpfte.
Schließlich sei aber noch daran erinnert, daß die Melodie des erstes
Fünftonstücks deutlich auf das H auptthem a des zweiten Teils von „Le
Sacre du Printemps“ verweist, das erstmals Ziffer 84 (Seite 75) der
P artitur au ftrk t und im weiteren V erlauf in ganz verschiedener Takt­
gliederung erscheint. Die Begleitfiguren bei Ziffer 91 (Seite 80) machen
aber wahrscheinlich, daß ursprünglich ein einfacher V iervierteltakt
vorlag und alles andere als Akzentverschiebung (mit gelegentlichen
rhythm ischen und melodischen Varianten) aufgefaßt w e rd en soll.
* Z u dieser Technik vergleiche man Schuhs „Beiträge“, 245 f.
4 Im Anschluß an K. H errm ann, Die Klaviermusik der letzten Jahre,
1934, 28, sei hier darauf aufm erksam gemacht, daß sich H indem ith in
den Fünftonstücken, vor allem den Nummern 3, 4 und 7, Baxtok
näherte. Man vergleiche also Mindemitbs 3. Stüde mit dem A ndante­
teil, das 4. mit dem Allegro molto des ersten, 1916 komponierten,
aber erst 1930 veröffentlichten der „Drei Rondos über Volksweisen“
von Bartok. Vielleicht ist dies der einzige Fall in H indem iths W erk.
Bartök hat sich dagegen H indem ith mehrfach genähert, zunächst m
seinen klassizistischen „Zwiegesprächen“ aus den „Neun kleinen K la­
vierstücken“ (1926), dann aber vor allem in seinem, späten „Orchester­
konzert“ (1943).
5 Nicht nur Brahms und Franz benutzten kirchentonale Wendungen,
sondern auch die Neudeutsdien, vor allem Wagner im „Parsifai“, so-
68
wie zahlreiche slawische Komponisten, besonders Mussorgskij. Von
hier gingen sie dann in die Tonspradhe Debussys (and Bartoks) über,
wo sie, neben Partien aus ganz anderen Skalen, der haifotonlosen F ünf­
tonreihe and der Ganztonskala, einen bedeutenden P latz einnahmen.
(Cf. A. GoMa: Musik unserer Zeit, 1955, 93 ff.; W .D andsert: Claude
Debussy, 1950, 85 ff. und E. von. der H üll: Bela Bartök, 1930). Übrigens
findet man in einigen der neuesten Werke Strawinskys, namentlich in
den beiden mittelalterlichen Vorbildern verpflichteten Werken, der
„Messe“ (1948) und der »K antate“ nach anonymen englischen 'Testen
des 15. and 16. Jahrhunderts (1952) modale Wendungen. Besonders
auffallend sind die sieben phrygischen Takte, die das Präludium und
die Interludien der K antate einleiten.
6 In der Musik unseres Jahrhunderts spielen auch noch andere Skalen
eine gewisse Rolle. Im Werk Bartoks, namentlich in Voiksliedbearbeitungen, findet man gelegentlich die in der Popularliteratur als Zigeuner­
tonleiter bekannte Skala c—d—e—fis—g—as—h, also unsere Moll­
reihe mit lydisdier Q uart, die in der osteuropäischen Volksmusik eine
beachtliche Rolle spielt. Daneben gibt es aber auch willkürliche K on­
struktionen. Alexander Tscherepnin legt seinem „K am m erkonzert“
op. 35 (1925) eine „neunstufigeTonleiter (D ur-M oll-Tonart)“ zugrunde:
d—es—f—fis—g—a—b—h—cis, die nichts anderes als eine D ur-M ollMisdiung mit phrygischer (statt reiner) Sekund ist. Die Skala scheint
aber weniger darauf abgestelit, die drei Modi zu mischen, als eine
regelmäßige Folge von H alb- und G anztonabständen durchzusetzen.
Gegen diese Tonleiter lassen sich natürlich viele Bedenken anmeiden,
vor allem gegen ihre „unnatürliche“, w eder auf Quintverwandts-chaft
noch, auf T em peratur basierende, regelmäßige K onstruktion. Zur
Rechtfertigung der phrygischen Sekund, die das D ur-M oll gefährdet,
ließe sich vielleicht daran erinnern, daß bereits D vorak eine Vorliebe
fü r M ollsubdom inanten in D ur h atte (z.B. Symphonie G -D ur op. 88,
2. Satz) und hieraus der Wunsch zu erklären ist, auch die Terz der
doppelten Subdom inante zum Skalenton zu erheben.
7 In seinen späteren Werken ist H indem ith zu vernünftigerer harm oni­
scher Disposition übergegangen, hat dabei aber sehr viele bewährte
und konventionelle M ittel aufgegriffen. Selbst die einst karikierten
Blechbläserapotheosen haben sich wieder eingestellt. In den besten der
späteren W erke sind diese alten M ittel w irkungsvoll eingesetzt, aber
vielfach klingt auch direkt die komm erzielle U nterhaltungsm usik an,
etwa in der „K onzertm usik fü r Streichorchester u n d Blechbläser“
op. 50, einem der formal gelungensten Werke, P artitu r S. 26 ff. (Strei­
cher), 45 f. (l.H o rn , ein Motiv Gershwins!) und S. 48, bei D (Vio­
linen und Celli), ohne daß es zu einer künstlerischen Einschmelzung
dieser niederen Musik, wie etwa bei Berg, käme. In der Symphonie
„Mathis der M aler“ hat sich das, was man treffend H indem iths k o n ­
zertanten Stil nannte, m it dem Idiom der N eudeutschen Schule des
vergangenen Jahrhunderts verbunden. Das späte W erk H indem iths
w äre darüber hinaus n u r im Zusamm enhang m it den Theorien der
69
U nterw eisung kritisch zu würdigen, auf die M er aber nicht ein­
gegangen zu w erden braucht, da die Voraussetzungen, aus denen
H indem ith seine Ansichten entwickelt, längst als falsch erk an n t sind.
W er dennoch sich m it H indem iths Spatwerk beschäftigen will, der sei
auf zwei A ufsätze in der Schweizerischen Musikzeitung 90, 1950 v er­
wiesen: A, von Reck, K onstruktive Dichte in H indem iths M athisSymphonie (p. 85—92) und W. Kolneder, H indem iths S treichquartett
5 in Es (92—96), sowie auf die im bibliographischen A nhang zitierten
A rbeiten,
8 cf. auch die Analyse dieses Stückes in Erpfs „ S tu d ie n ...“, 187ff.
[Neuerdings auch A. Krieger, Schönbergs Werke für Klavier, 1968,
24 ff.]
8 cf. R. Tenschert, „Eine Passacaglia von A rnold Sdiönberg“, Die
Musik 17/11, 1925, 590—594.
10 cf. F. H . Klein, „Die Grenze der H albtonw elt“, Die Musik 17/1,
1924/25, 281—286; H . F. Redlichs N achw ort zu r Neuausgabe der
Stormlieder Bergs, 1955. Die damalige Ansicht, dies sei die einzig
mögliche Allintervallreihe w urde von E.Krenek, Ober neue Musik,
1937, 72 ff, korrigiert, der an dieser Stelle ausführlicher über solche
Reihen, handelt; cf. ferner H . Jelinek, „A nleitung. . .“, I, 1952, 1 4 f.
und 19 ff.
11 Ober diesen Stand der Zwölftontedinik unterrichtet man sich auch
heute noch am besten an H and von E. Steins Aufsatz „Neue Form ­
prinzipien“ von 1924, der verschiedentlich gedruckt w urde und heute
am bequemsten in H . PL Stucfcensdimidts „Neue M usik“ 1951, 358
bis 385, zugänglich ist.
12 Zum Verständnis der Form konzeption des Liedes ist noch beson­
ders hervorzuheben, daß die beiden Zwölftonakkorde an formal ent­
scheidenden Punkten, nämlich den Schlüssen der beiden Abschnitte,
erscheinen, also, w orauf auch andere Eigenschaften des Tonsatzes ver­
weisen, als das Ziel der gesamten Tonbewegung angesehen werden
müssen. Dies gibt uns vielleicht die Berechtigung, einen der w ohl an­
stößigsten Sachverhalte der späteren Bergsdien Kompositionstechnik
zu erklären, die Tatsache, daß die O per „Lulu“ auf m ehreren Reihen
basiert. Wer in den einschlägigen W erken von Reich, Leibowitz und
Redlich die hödist merkwürdigen Bergsdien Ableitungen der ver­
schiedenen Reihen aus der Grundreihe betrachtet, der w ird den Ein­
druck einer gewissen m athematischen W illkür nicht ios, v o r allem
deshalb, weil die einzelnen Reihen ja tatsächlich keinerlei reale Be­
ziehungen zueinander haben. Betrachtet man aber den Zwölftonakkord (der ja schließlich ziemlich am Ende der O per — in der
P a rtitu r der „Lulu-Suite“ p. 130 — sogar erscheint) als das Ziel der
Entwicklung und als eigentliche Erfüllung des musikalischen P ro­
zesses, folglich alle Reihenmanipulationen als sekundär, so löst sich das
Problem fast von selbst; denn für einen vom Zwölfklang ausgehenden
70
Komponisten sind die Reihen ja nur beliebige Ausschnitte von be­
grenzter Verbindlichkeit, und es ist lediglich eine Frage der Ökonomie,
ob er eine oder mehrere Reihen aus dem Zvrölfkiang ableitet, nicht
aber eine Frage von prinzipieller Bedeutung.
1S In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, daß in
keinem der Spätwerke Weberns den Konsonanzen eia so breiter Raum
gegönnt ist, wie gerade in diesem Streichquartett. Die Klaviervaria­
tionen op. 27 räum en allerdings sogar den Q uarten wieder einen ge­
wissen Platz ein —■obw ohl die Reihe dieses W erks keine Q u a rt ent­
h ält —, aber dieses Intervall zeigt auch hier wieder sein altes D oppel­
gesicht: es w ird je nach dem Zusam m enhang als Konsonanz oder als
Dissonanz aufgefaßt [Nachtrag 1973: Weberns Analyse seines Q uar­
tetts op. 28 hat F. Döhl gefunden und publiziert, zuerst in seiner ver­
vielfältigten Dissertation (Weberns Beitrag zur Stilwende der Neuen
Musik, Göttingen 1966), dann in seinem Beitrag ,Zum Formbegriff
Weberns1 im W ebern-Heft der Österreich. Musikzeitschrift (27, 1972.
H . 3).]
14 Die Äußerungen Messiaens über die 2. Klaviersonate von Boulez
findet man bei A. Golea, Musik unserer Zeit, 1955, 190 f. [Nachtrag
1973: Mittlerweile sind alle Klavierstücke von Stockhausen im Druck
erschienen.].
BIBLIOGRAPHIE
(Auswahl)
Allgemeines. T. W. Adorno, Philosophie der Neuen Musik, 1949, 2. A.
1958; id. Dissonanzen, 1956, 2, A. 1958; A. Golea, M usik unserer Zeit,
1955; H.H.Stuckensdimidt, Neue Musik, 1951; K .H .W ö rn er, Neue
Musik in der Entscheidung, 2. A. 1956.
Schnften der Komponisten. B.Bartok, Weg und Werk, Schriften und
Briefe, ed. B. Scabolsci, 1957; P. H indem ith, Die U nterw eisung im
Tonsatz I, 2. A. 1940; A. Schönberg, Harmonielehre, 1911, 3. A. 1922;
id. Style and Idea, 1950; id. Die formbildenden Tendenzen der H a r­
monie, 1957; I. Strawinsky, Leben und Werk — von ihm selbst, 1957
(zit. als „Schriften“).
Monographien, a) H arm onik, Polyphonie. H .E rp f, Studien zur H a r­
monie und Klangtechnik der neueren Musik, 1927; E. von der Niill,
Moderne H arm onik, 1932; A. Jakobik, Zur Einheit der Neuen Musik,
1957; R. Leibowitz, Infroduction ä la musique de douze sons, 1949;
J. Rufer, Die Komposition mit 12 Tönen, 1952; H . Jelinek, Anleitung
zur Zwöiftonkomposition I, 1952; E. Krenek, Zwölfton-Kontrapunkt-Studien, 1952; G .Perle, The harmonic problem in twelwe-tone
music, The Music Review 15, 1954, 257—267; T.W . Adorno, Die
Funktion des K ontrapunkts in der Neuen Musik, 1957, abgedr. im
M erkur 12,1958; S. Günther, Moderne Polyphonie, 1930.
b) Personen (Bartök- und Debussyiiteratur ist nicht verzeichnet).
W.Reich (mit T. W. Adorno und E.Krenek), Alban Berg, 1938; H .F .
Redlich, Aiban Berg, 1957; H . Strobel, Paul H indem ith, 2. A. 1931,
3. A. 1948; R. Stephan, H indem iths Marienleben, The Music Review'
15,1954,275—287; N .C azden, H indem ith and N ature, ib. 288—306;
t.W ellesz, Arnold Schönberg, 1921; R. Leibowitz, Schoenberg et son
ecole, 1947; I'.W .Adorno, Arnold Schönberg, in: Prismen, 1955; id.
Arnold Sdiönberg, in: Die großen Deutschen 4, 1957; id. Zum Ver­
ständnis Schönbergs, Frankfurter Hefte 10, 1955, 418—429; H . Flei­
scher, Igor Strawinsky, 1931; J.Handsdiin, Igor Strawinsky, 1933;
ü. H . White, Igor Strawinsky, 1950; H.Lindlar, Igor Strawinskys
sakraler Gesang, 1957; Strawinsky in Amerika, ed. H.Lindlar, Musik
der Zeit 12, 1955; Anton Webern, ed. H . Eimert, Die Reihe 2, 1955.
Ausschließlich mit neuer Musik befassen sich die Zeitschriften „Melos“,
ed. H . Strobel bei B. Schott’s Söhne, Mainz, und die Schriftenreihe
„Musik der Z eit“, ed. H . Lindlar bei Boosey und Hawkes, Bonn. Die
Reihe „Die R eihe“, ed. H . üimert bei der U niversal Edition, Wien,
bietet fast ausschließlich „Inform ationen über serielle M usik“.
(Nachtrag 1973)
Allgemeines. T. W. Adorno, Der getreue K orrepetitor, 1963; U. Dibelius Moderne Musik 1945— 1965, 1966; Das musikalisch Neue und
die Neue Musik, ed. H . P. Reinecke, 1969; Die Musik der Sechziger­
jahre, ed. R. Stephan, 1972.
Schriften der Komponisten. P. Boulez, W erkstatt-Texte, 1972; A.
Schönberg, Modelle für Anfänger im Kompositionsunterricht, 1972;
K.Stockhausen, Texte, 3 Bände, 1963— 1971; I.Straw insky: Gespräche
mit R. Craft, 1961; A. Webern, Wege zur Neuen Musik, 1960.
Monographien.
Personen. W. Reich, A. Berg, Leben und Werk, 1963; T. W. Adorno,
Berg, der Meister des kleinsten Übergangs, 1968; A. Briner, Paul
Hindem ith, 1971; W. Reich, Sdiönberg oder der konservative Revolu­
tionär, 1968; A. Krieger, Schönbergs Werke für Klavier, 1968; R.
Brinkmann, A. Schönberg, Drei Klavierstücke op. 11, Studien zur
friihen A tonalität, 1969; E. H . White, Stravinsky, the Composer and
His Works, 1966; F. Wildgans, Anton Webern, 1967; E. Budde, A.
Weberns Lieder op. 3, Untersuchungen zur frühen A tonalität, 1971;
F. Döhl, Zum Formbegriff Weberns. Weberns Analyse des Streich­
quartetts op. 2 8 . . . , in: Österreich. Musikzeitschrift 27, 1972, H . 3
( = Webern-Sonderheft), S. 131— 148.
73
N A C H W O R T ZUR ZW EITEN AUFLAGE
Das Büchlein, 1958 zum ersten Male erschienen» seit vielen Jah­
ren vergriffen, erscheint hier in nahezu unveränderter Gestalt.
(N ur einige Versehen wurden berichtigt.) Es trifft heute, andert­
halb Jahrzehnte nach seiner Niederschrift, auf eine veränderte
Zeitlage. In den fünfziger Jahren herrschte im Musikleben noch
der musikalische Neoklassizismus, um den es jetzt sehr still ge­
worden ist. Eine Umwertung hat stattgefunden, von deren
Ausmaß sich damals niemand eine Vorstellung machen konnte.
Dennoch sah der Verfasser keine Veranlassung, das damals Ge­
schriebene zu verändern. Der Versuch, die neue Musik mit
traditionellen Kategorien zu erklären, erscheint ihm auch heute
noch sinnvoll. Da.ß es der einzig sinnvolle sei, hat er nie ge­
glaubt.
Was hier als Neue Musik bezeichnet wird ist es heute nicht
mehr im. Sinne der Chronologie. Viel Neues und ganz N eu­
artiges hat sich im letzten Jahrzehnt hervorgetan. Vielfach wird
es „Neueste Musik“ oder auch „Postserielle Musik“ genannt.
Diese Musik ist weithin gekennzeichnet durch die Tendenz, jeg­
lichen Kunstanspruch aufzugeben. Den Rahmen der vorliegen­
den kritischen Einführung in dieser Richtung zu erweitern,
hätte der Grundkonzeption widersprochen, ging es doch hier
gerade um die Mittel, die künstlerische Wirkungen hervor­
bringen. Mit der Zurücknahme des künstlerischen Anspruchs in
der jüngsten Musik hat sich zugleich sowohl die Zahl ihrer
Apologeten beträchtlich vermehrt, als auch der Kreis der H örer
vergrößert. Dies ist besonders zu beobachten, seitdem eine An­
näherung weiter Bereiche der Kunstmusik (unter den verschie­
densten Schlagworten) an solche der kommzerielien U nterhal­
tungsmusik stattfindet. Diese Vorgänge sind gewiß sehr bedeu­
tungsvoll, aber sie stehen m keinem direkten Zusammenhang
mit den hier behandelten Fragen.
Das Neueste, was hier besprochen wird, ist ein frühes Klavier­
stück von Stocknausen, iis wäre dem. Autor nur lieb, wenn Leser
sich die Mühe machten, die gleichzeitig erschienene mit neuen
Begriffen operierende Analyse des gleichen Stücks von Dieter
Schnebel nadizulesen (Die Reihe, hrsg. von H. Eimert, Heft 4,
74
1958, 122— 129). Sie ist für den an Fragen der Entwicklung des
Tonsatzes und der Musikanschauung der Fünfzigerjahre Inter­
essierten noch Immer sehr aufschlußreich. Doch hilft sie auch dem
H örer oder dem Spieler?
Für den Autor w ar diese Schrift ein Schritt auf dem Weg der
Annäherung von Musikwissenschaft und Neuer Musik. Er hatte
ihn schon viel früher gesucht und ist ihn seither weitergegangen.
Über die besonderen Schwierigkeiten der Analyse und Bewer­
tung, die die neueste Musik bereiten, hat er sich in einem Vor­
trag geäußert, der In der Zeitschrift „Musica“ (26, 1972, 225 ff.)
veröffentlicht worden Ist.
Das Büchlein, das nicht nur gekauft, sondern offenbar auch Yiel
gelesen wurde, hat die ihm bestimmte Aufgabe erfüllt. Es wäre
erfreulich, wenn es nun, da es wieder greifbar ist, erneut wirken
könnte für eine Neue Kunst, die sich nicht schämt, eine zu sein.
Berlin-Dahlem, im Januar 1973
75
Rudolf Stephan
REGISTER
Adorno, Th. W. 54, 58—60
Altenberg, P. 39 (s. Berg)
Aristoteles, s. Pseudo-Aristoteles
Jelinek, H . 70
Bach, j. S. 7, 10, 27, 29, 30, 31,
54, 66
B artök,B. 11, 68, 69
Baudelaire, Ch. 45
Beethoven, L. van 3, 4, 7, 10, 54,
66
Berg, A. 39—42 (Altenberglieder), 45—50 (Stormlieder), 70 f.
(Lulu)
Herrsche, A. 10
Boulez, P. 60, 66, 67, 71
Brahms, J. 21, 68
Brecht, B. 20
Bruckner, A. 54
Danckert, W. 69
Debussy, C. 32 f. (Preludes I),
33 f. (Images ID , 34 f. (Estampes), 42, 60, 69 '
D vorak, A. 69
Eimert, H . 28, 53
E rpf, H . 70
Franz, R. 21, 68
George, St. 36, 41
Golea.A . 69, 71
Haba, A. 60
H alm , A. 3, 54
Handsdiin, J. 9, 12
Hanslick, E. 7 f.
H erm ann, K. 68
H indem ith,P. 6, 11, 12, 18—20
(Fünftonstücke), 20 f. (Lehr­
stück), 22—25 (Fünf Stücke für
Streichorchester), 32, 68, 69 f.
76
Klein, F. H . 45, 70
Kolneder, W. 70
Krenek, E. 3, 70
Leibowitz,R. 41, 53
Leichtentritt, H . 36
Liszt, F. 10
Machaut, G. de 10
Mahler, G. 54
Messiaen, O. 60, 71
M ozart, W". A. 3
Mussorgskij, M. 32, 69
N ono, L. 60
N üll, E. von der 69
Pergoiesi, G. 11
Pseudo-Aristoteles 4 f.
Ramuz, C. F. 17
Refaikoff, W. 32
Reck, A. von 70
Redlich, H . F. 70
Riemann, H . 6
Rossini, G. 11
Rufer, J. 56
Schatz, H . 29
Schönberg, A. 8, 11, 32, 36 (Kla­
vierstücke op. 19), 4 2 ff., 43
(Klavierstück op. 33a), 46, 55—
60 (Z w ölftontedm ik: 3. Q uar­
tett, Bläserquintett), 66, 70
Schubert, F. 41
Schuh, W. 68
Schumann, R. 10
Skrjabin, A. 32, 35 f.
S io nim sky , N . 56
Stein, E. 70
Stockhausen, K. 60—64 (Klavier­
stück III), 64—68 (Klavier­
stück XI)
Storm, Th. 45 (s. Berg)
Stuckensdimidt, H . H . 70
Stum pf, C. 4 f.
Strawinsky, I. 11 f. (Konzertan­
tes Duo), 12— 17 (Die fünf
Finger), 18 ff., 23, 25, 26—31
(Konzertsätze: Violinkonzert,
Kammerkonzert in Es, Sep­
tett), 54, 68
T ensdiert,R . 70
Tsdiaikov?sky,P. 11
Tsdierepixin, A. 69
Varese, E. 60
Vivaldi, A. 24, 54
Wagner, R. 68
Webern, A. (von) 36—39 (Ge­
orgelieder), 45, 50 f. (Sympho­
nie), 52 ff. (Streichquartett), 54,
71