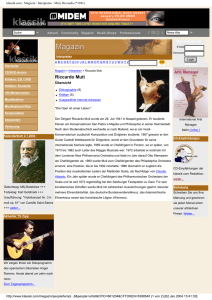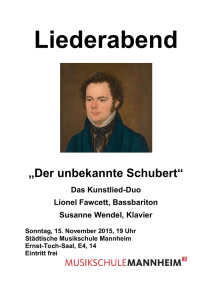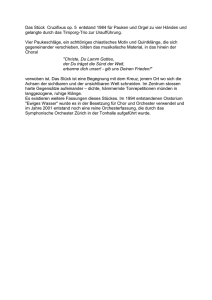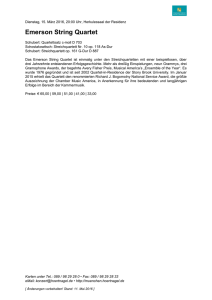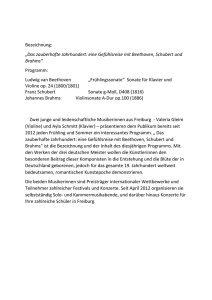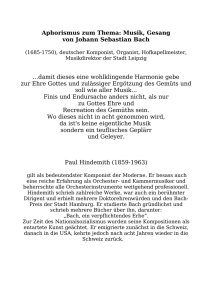Programmheft herunterladen
Werbung

Franz Schubert · Zwischenaktmusik Nr. 3 B-Dur zu Rosamunde D 797 · Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks · Paul Hindemith · Nobilissima visione Orchestersuite nach der Musik der Tanzlegende · Am 10.02.2007 Marsch · Pastorale · RICCARDO MUTi · So klingt nur Dortmund. 2,50 E KONZERTHAUS DORTMUND · Samstag,10.02.2007 · 20.00 Dauer: ca. 1 Stunde 45 Minuten inklusive Pause Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks Riccardo Muti DIRIGENT Abo: Orchesterzyklus I Wir bitten um Verständnis, dass Bild- und Tonaufnahmen während der Vorstellung nicht gestattet sind. 4I5 Franz Schubert (1797–1828) Zwischenaktmusik Nr. 3 B-Dur zu »Rosamunde« D 797 Andantino Sinfonie Nr. 7 h-moll D 759 »Unvollendete« Andante moderato Andante con moto -Pause- Paul Hindemith (1895 –1963) »Nobilissima visione« Orchestersuite nach der Musik der Tanzlegende Einleitung und Rondo: Sehr langsam – Mäßig schnell Marsch und Pastorale: Lebhaft – Lebhaft – Langsam Passacaglia: Feierlich bewegt Richard Strauss (1864 –1949) »Tod und Verklärung« Tondichtung für großes Orchester op. 24 Franz Schubert (Porträt von Wilhelm August Rieder, 1825) 6I7 Programm 8I9 Sinfonische Miniatur Franz Schubert Zwischenaktmusik Nr. 3 B-Dur zu »Aus dem Schönen bricht der Schrecken« Franz Schubert Sinfonie »Rosamunde« D 797 nr. 7 h-moll D 759 »Unvollendete« Rosamunde, eine als Hirtin aufgezogene Prinzessin, soll die Herrschaft auf Zypern antreten. Der Statthalter Fulgentius erweist sich als neidischer Tyrann, der ihre Herrschaft durch Intrigenspiel und Gewalt zu vereiteln versucht. Angeekelt von all den Hinterhältigkeiten zieht sich Rosamunde wieder in die Einsamkeit der Hirtenwelt zurück, wo sie jedoch vor Fulgentius‘ Nachstellungen auch nicht mehr sicher ist. Erst durch die Hilfe von Alfons, dem Fürsten von Candia, den Rosamundes Vater aufgefordert hatte, die Rechte seiner Tochter zu vertreten und um ihre Hand anzuhalten, misslingt ein von Fulgentius geplanter Vergiftungsversuch – und der Wille des verstorbenen Königs wird schließlich erfüllt. Soweit der Handlungsverlauf der »Rosamunde – Fürstin von Cypern« von Helmina von Chezy (1783–1856). Noch während der Endproben zu Carl Maria von Webers Oper »Euryanthe«, für welche die Autorin ein wenig erfolgreiches Libretto verfasst hatte, erhielt sie vom Theater an der Wien den Auftrag für dieses »Romantische Schauspiel mit Musik«. Für die Musik sah Josef Kuppelwieser, der als Sekretär des Intendanten des Theaters an der Wien großen Einfluss auf die Produktionen des Hauses hatte, Franz Schubert vor, der das Angebot 1823 annahm und innerhalb weniger Wochen neun Einzelnummern komponierte – darunter drei Entr‘actes (Zwischenakte), eine kurze Instrumentalnummer, zwei Ballette, ein Sololied und drei Chöre. Die literarisch fragwürdige Qualität des Textbuches, das dem Trivialgenre romantischer Schauerdramatik zuzuordnen ist, wurde bereits bei der Uraufführung bemängelt und die Produktion blieb derart erfolglos, dass sie sofort wieder abgesetzt wurde. Der originale Text des Stückes galt lange als verschollen, und mit dem Schauspiel geriet zunächst auch Schuberts Musik in Vergessenheit – bis zu einer Wiederaufführung im Jahre 1867 durch den Wiener Hofkapellmeister Johann Herbeck. Die dritte Entr‘acte-Musik, die als sinfonische Miniatur durchaus auch für sich bestehen kann, ist in einer fünfteiligen Rondoform angelegt und bezieht sich inhaltlich auf »Rosamundes Rückkehr aus den Gefährdungen und Intrigen am Hofe in das Land ihrer Kindheit, in ein Märchenland des Friedens und der Harmonie« (Walter Dürr). Dass die lyrisch-verinnerlichte Kantilene des Hauptthemas Schubert besonders am Herz gelegen haben muss, beweist das Wiederauftauchen dieser Thematik in verschiedenen anderen Werken wie in dem so genannten »Rosamunde«Streichquartett a-moll D 804 oder dem dritten Impromptu aus D 935. »Die Spuren des Glücks auf einer dunklen Folie rühren, verwirren und schmerzen in einem. Nichts schreckt ihn mehr, keine Finsternis, keine Einsamkeit. Trotz und Trauer flankieren ihn als unsichtbare Weggefährten. Aus dem Schönen bricht der Schrecken, aus dem Gesang das furchtbare Schweigen«, schreibt Peter Härtling in seinem Essay »Franz Schuberts sinfonischer Roman« über die Sinfonie h-moll. Die Schroffheit der Wortwahl mag verwundern angesichts einer Komposition, die als »ohrwurmseliges« Werk in der Publikumsgunst ganz oben rangiert. Doch: Hört man genauer hinein in diese Musik, so wird schnell klar, dass sie alles andere als harmlos ist und dazu einige Rätsel aufgibt. Zu diesen gehört bereits die Entstehungsgeschichte. Das Jahr 1822 sollte für Schubert ein Schicksalsjahr werden, an dessen Ende die Gewissheit stand, an Syphilis, also sehr schwer erkrankt zu sein. Nach einem langen Krankenhausaufenthalt mied er Wien, zog sich zunächst nach Hütteldorf, im Sommer 1823 dann nach Steyr zurück. Vollendet waren nur zwei Sätze der h-moll-Sinfonie. Die Frage, ob die Erkrankung Schubert zwang, die Arbeit niederzulegen, oder ob es nicht auch die Einsicht, ja das Erschrecken darüber gewesen sein könnte, dass ihm hier Beispielloses gelungen war, lässt sich nicht beantworten. Dass Schubert die Sinfonie nicht als vollendet betrachtete, beweisen Skizzen zum Scherzo. Vermutet wurde außerdem, dass er einen möglichen Final-Entwurf als erste Entr‘acte-Musik zu »Rosamunde« abgezweigt hat. Das Manuskript der ersten beiden Sätze gab Schubert aus der Hand. 10 I11 Werke Ab 1824 hielt es sein Freund Anselm Hüttenbrenner unter Verschluss, so dass die Uraufführung erst am 17. Dezember 1865 in Wien stattfinden konnte. Die beiden Sätze sind so regelmäßig gebaut wie nur irgendein sinfonischer Satz, die einzelnen Abschnitte deutlich zu erkennen. Doch was sagt diese Erkenntnis darüber aus, was sich innerhalb dieser scheinbar sicheren Grenzen abspielt? Bereits die Tonart ist alles andere als gewöhnlich. Für Beethoven ist sie die »schwarze Tonart« und Schubert bringt sie in seinen Liedern immer wieder mit einer düster-melancholischen Atmosphäre von Einsamkeit und Tod in Verbindung (vgl. z. B. ›Grablied auf die Mutter‹, ›Einsamkeit‹ aus der »Winterreise« oder ›Der Doppelgänger‹). Bereits das dunkle Unisono der Bässe zu Beginn weist in diese Richtung. Was folgt, ist das erste Thema, aber es ist von einer völlig neuen Art. In eine Begleitung eingewoben, die 27 Takte lang mit nur einer Unterbrechung eine Klangfläche ausbreitet, erklingt eine lyrische Melodie, die schon nach sechs Takten eine seltsame Eintrübung erfährt: Sie prallt auf ein Hindernis, wird weiter getragen, prallt wieder auf und ist am Ende, ohne ein eigenes Ende gefunden zu haben. Bereits hier wird die latente Gefährdung spürbar, der Schubert seine Themen noch im glückvollsten Singen aussetzt. Es gibt nur wenige Werke dieser Epoche, in denen alle Vermittlung so völlig fehlt. Bemerkenswert auch die Generalpause im zweiten Thema: Die schöne, ländlerische Melodie bricht plötzlich ab. Schubert gönnt ihr keine Fortsetzung, lässt sie im Nichts zerbrechen, einem Nichts, dem er den Aufschrei eines aggressiven c-moll im h-moll-Satz entgegensetzt. War bisher Stille die Abwesenheit von Musik, so ist sie hier viel mehr. Ein Viertakter berührt zunächst nur Tonika und Dominante, wird leicht verändert wiederholt und bringt die Dominante zur Subdominante. Diese scheint weiterzuführen, weg vom harmonischen Ausgangspunkt und dem immer Gleichen des symmetrischen Taktgruppenbaus. Es ergibt sich ein Ungleichgewicht: die Erweiterung der Wiederholung um einen fünften Takt. Führt die Veränderung aus der Tonart heraus, so bringt Schubert im angeklebten Takt aber die Harmonik wieder in die Haupttonart zurück. Er findet keinen Weg ins Freie, die Musik tritt auf der Stelle, durchschaut die Ausweglosigkeit ihrer Modulationsregeln, mit denen sie überall hingelangen könnte – und damit nirgends. Die Musik fällt sich selbst ins Wort. Dieses Verstummen stellt – gefolgt von einem schmerzhaften Erschrecken – in der Musik dar, was nicht mehr Musik ist. Anders als Beethoven entwickelt Schubert seine Themen nicht motivisch-thematisch. Sie sind von Anfang an in ihrer Endgestalt da, in sich gerundet und kontrastierend aneinandergereiht. Doch die Kontraste sind nur scheinbar vorhanden, hängen doch sämtliche Themen 12 I13 motivisch eng zusammen und bewirken so die bemerkenswerte gedankliche und emotionale Einheitlichkeit der Sinfonie. Auch der zweite Satz steht in Tempo, Taktart und im lyrischen Ton dem ersten nahe. Auch hier kreisen die Themen in einer musikalischen Landschaft, deren Boden gefährliche Abgründe offenbart. Und doch eröffnet er eine völlig andere Sphäre von fast überirdischer Schönheit, eine »Welt glückseligen Traums, stiller und doch ungemein sehnsüchtiger Melancholie« (Wolfram Steinbeck). Entstanden ist eine Komposition, in der eine ungreifbare Sehnsucht und ein tiefer Schmerz zu einer dunkel getönten musikalischen Realität zusammenfließen, die von einer zunehmenden Heimatlosigkeit kündet. 5743 Anz_12_Tenoere_sw 01.09.2005 12:34 Uhr Seite 1 Die 12 Tenöre BMW Niederlassung Dortmund Nortkirchenstraße 111 · 44263 Dortmund Tel. 0231 9506-0 · www.bmw-dortmund.de www.bmwdortmund.de Freude am Fahren Werke Die Umkehr des Heiligen Franz von Assisi Paul Hindemith »Nobi- lissima Visione« Als Paul Hindemith im Jahre 1937 Florenz besuchte, fühlte er sich von Giottos Fresken über das Leben des Heiligen Franz von Assisi in der Kirche Santa Croce zutiefst beeindruckt. Und als ihn wenig später der Tänzer und Choreograph Léonide Massine um ein Ballett für die Ballets Russes de Monte-Carlo bat, schlug er ihm die Geschichte des Franziskus vor. Nachdem er die anfänglichen Bedenken Massines zerstreuen konnte, verabredeten sie für den September 1937 ein Treffen in Positano. Hierfür entwarf Hindemith ein detailliertes Szenarium, das sich allerdings vom endgültigen Entwurf weitgehend unterscheidet. Das Werk sollte ursprünglich aus zwei Teilen bestehen: der prosaischen Lebensführung des Franziskus und seiner Wandlung. Als zentrale Szene entwarf Hindemith ähnlich wie in »Mathis der Maler« eine Traumszene, die Franz veranlasst, sein Leben zu ändern. Der endgültige Entwurf führt dagegen die Entwicklung des Franziskus in der bündigen Abfolge einzelner Bilder vor. Die Szene mit der entscheidenden Wandlung lautet nun: »Die Rohheit des Soldatenlebens, die Grausamkeit des Krieges erfüllen ihn mit Abscheu; er gerät, da er ohnmächtig zur Hilfe ist, an den Rand der Verzweiflung. Die Erscheinung dreier symbolischer Frauengestalten zeigt ihm, dass ihm anstatt der Lorbeeren kriegerischer Taten ein Leben tiefmenschlicher Frömmigkeit und Hingabe beschieden ist.« Seine Grundidee war, die Sinnbildhaftigkeit des mythischen Stoffes zu beschwören. Die Choreographie Massines war von plakativer Symbolik und zugleich Herbheit, die der strengen Schlichtheit der Komposition Hindemiths entsprach. Aus den elf musikalischen Nummern des Ballettes fasste Hindemith fünf Stücke zu einer dreisätzigen Suite für Orchester zusammen. Der erste Satz umfasst die Nr. 8 ›Meditation‹ und Nr. 10 ›Kärgliche Hochzeit‹ (zwischen Franz und der Frau Armut), der zweite Satz Nr. 4 ›Marsch‹ und Nr. 5 ›Erscheinung der drei Frauen (Demut, Keuschheit, Armut)‹. Wie das Ballett schließt auch die Suite mit einer Passacaglia, die im Ballett mit dem Titel ›Incipiunt laudes creaturam‹ (›Die Lobgesänge der Geschöpfe heben an‹) überschrieben ist und zum feierlichen Einzug in den Himmel erklingt. Das religiöse Thema mit seinem apotheotischen Finale übte möglicherweise auf Hindemith eine derartige Anziehungskraft aus, weil er sich zum Zeitpunkt der Komposition in einer vergleichbaren Situation wie Franz befand: Umgeben von Machtwahn und Brutalität, in seinem Heimatland angefeindet, suchte er nach einem Ausweg, den er noch 1938 mit seiner Emigration in die Schweiz fand. 14 I 15 »Todesstunde eines Künstlers« Richard Strauss Tondichtung »Tod und Verklärung« An der Hofkapelle der Residenzstadt Meiningen hatte Richard Strauss als Assistent Hans von Bülows 1885 seine ersten Dirigier-Erfahrungen gemacht. In Meiningen war es auch, wo ihn Alexander Ritter, ein entfernter Verwandter und Parteigänger Wagners und Liszts, zur »Musik als Ausdruck« bekehren sollte, die der Grazer Musikästhetiker Friedrich von Hausegger der klassizistisch getönten Lehre »Vom musikalisch Schönen« des Wieners Eduard Hanslick entgegenhielt. In diesem Manifest der Neudeutschen Schule entdeckte Strauss, »daß der Weg von dem ›Ausdrucksmusiker‹ Beethoven über Liszt führt, der mit Richard Wagner richtig erkannt hatte, daß mit Beethoven die Sonatenform bis aufs Äußerste erweitert worden und bei seinen Epigonen [...] ein leeres Gehäuse geworden war«. Und weiter: »Neue Gedanken müssen sich neue Formen suchen – dieses Liszt‘sche Grundprinzip seiner sinfonischen Werke, in denen tatsächlich die poetische Idee auch zugleich das formbildende Element war, wurde von da ab der Leitfaden für meine eigenen Arbeiten. [...] Es gibt nämlich gar keine sogenannte Programmusik. Dies ist ein Schimpfwort im Munde aller derer, denen nichts Eigenes einfällt.« Dieses recht eindeutige Plädoyer für die formale Revolution, die das Schaffen Liszts im Bereich der Sinfonik hervorgerufen hatte, markiert nicht nur einen Wendepunkt in der Freundschaft Strauss‘ zu Hans von Bülow (der sich, je älter er wurde, zunehmend auf die Seite von Johannes Brahms schlug), sondern auch im Schaffen des jungen Komponisten, der eben noch mit einer f-moll-Sinfonie den formalen Idealen der Klassik gehuldigt hatte. Mit der Uraufführung seiner Tondichtung »Don Juan« am 11. November 1889 in Weimar erzielte Strauss schließlich seinen ersten großen Erfolg und damit seinen Durchbruch als Komponist. Zu diesem Zeitpunkt lag das Manuskript einer weiteren Komposition bereits fast fertig auf seinem Schreibtisch: »Tod und Verklärung«. Auch diese im Juni 1890 in Eisenach zum Tonkünstlerfest des Allgemeinen Deutschen Musikvereins uraufgeführte Tondichtung basiert auf einer außermusikalischen Idee – dem Sterben und Tod eines Künstlers. Nicht das später von Alexander Ritter verfasste und dem Erstdruck der Partitur vorangestellte Gedicht, sondern vielmehr Strauss‘ eigene Worte, die er 1894 in einem Brief an Hausegger formulierte, sind als das eigentliche Programm der Tondichtung anzusehen: »Es war vor sechs Jahren, als mir der Gedanke auftauchte, die Todesstunde eines Menschen, der nach den höchsten Zielen gestrebt hatte, also wohl eines Künstlers, in einer Tondichtung darzustellen. Der Kranke liegt im Schlummer schwer und unregelmäßig atmend zu Bette; freundliche Träume zaubern ein Lächeln auf das Antlitz des schwer Leidenden; der Schlaf wird leichter; er erwacht; gräßliche Schmerzen beginnen ihn wieder zu foltern, das 16 I 17 Fieber schüttelt seine Glieder; als der Anfall zu Ende geht und die Schmerzen nachlassen, gedenkt er seines vergangenen Lebens: seine Kindheit zieht an ihm vorüber, seine Jünglingszeit mit seinem Streben, seine Leidenschaften und dann, während schon wieder Schmerzen sich einstellen, erscheint ihm die Frucht seines Lebenspfades, die Idee, das Ideal, das er zu verwirklichen, künstlerisch darzustellen versucht hat, das er aber nicht vollenden konnte, weil es von einem Menschen nicht zu vollenden war. Die Todesstunde naht, die Seele verlässt den Körper, um im ewigen Weltraume das vollendet in herrlicher Gestalt zu finden, was es hienieden nicht erfüllen konnte.« Diese Programmnotizen verraten ein romantisches Künstlerbild. Menschliches und geistiges Wesen des Künstlers stehen in einem zum Scheitern verurteilten Widerspruch. Die »höchsten Ziele« lassen sich im irdischen Dasein nicht verwirklichen. Das Ideal muss Torso bleiben. Die Krankheit bietet Anlass zu Rückblick und Bilanz. Die grandiose Verklärung am Ende, die an die Schlüsse Richard Wagners erinnert, bleibt ohne den Hinweis auf die romantische Vorstellung einer Kunstreligion unverständlich. So lässt sich der Verlauf der Komposition, der dem Schema der klassischen Sonatenhauptsatzform angenähert ist, durchaus im Sinne Romain Rollands als »das ewige Leiden der kämpfenden Seele mit ihren inneren Dämonen und ihrer Befreiung im Schoße der Kunst« verstehen, aber auch als ein Sich-Beziehen auf Beethovens Modell »Durch Nacht zum Licht«. Später, 1931 distanzierte sich Strauss von der außermusikalischen Idee und behauptete, ausschlaggebend sei »das musikalische Bedürfnis« gewesen, »nach ›Macbeth‹ (beginnt und schließt in d-moll), ›Don Juan‹ (beginnt in E-Dur und schließt in e-moll) ein Stück zu schreiben, das in c-moll anfängt und in C-Dur aufhört! Qui le sait?« Werke 18 I 19 BIOGRAFIEN Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks 1949 gegründet, erreichte das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Eugen Jochum, seinem ersten Chefdirigenten, rasch hohes künstlerisches Niveau. Neben dem klassischromantischen Repertoire gehörte von Beginn an auch die Zeitgenössische Musik zu den zentralen Säulen des Orchesters: Im Rahmen der 1945 von Karl Amadeus Hartmann gegründeten »musica viva« führten u.a. Strawinsky, Milhaud, Hindemith sowie in jüngerer Zeit Kagel und Berio eigene Werke auf. Nachfolger Jochums wurde 1961 Rafael Kubelík, der verstärkt tschechische Musik ins Repertoire aufnahm und mit dem ersten Mahler-Zyklus, den ein deutsches Orchester auf Schallplatte einspielte, bahnbrechend für die Mahler-Rezeption wirkte. Von 1983 bis 1992 setzte Sir Colin Davis Akzente mit Werken von Berlioz und englischen Komponisten wie Elgar und Vaughan Williams. Durch die ökonomisch konzentrierte Arbeit Lorin Maazels (Chefdirigent von 1993 bis 2002) erlangte das Orchester eine technische Perfektion, die es heute zu einem der besten der Welt zählen lässt. Ein neuer Abschnitt in der Geschichte des Orchesters hat 2003 begonnen, als der gemeinsame Wunschkandidat aller Musiker, Mariss Jansons, neuer Chefdirigent wurde. Für seine Konzerte in München ebenso wie für die zahlreichen Gastauftritte in den führenden europäischen Musikmetropolen sowie im Herbst 2005 auf einer Japan-, China- und im Herbst 2006 auf einer Amerika-Tournee erhält er regelmäßig begeisterte Kritiken. Gemeinsam mit Mariss Jansons ist das Symphonieorchester bis 2009 »Orchestra in residence« bei den »Osterfestspielen« des »Lucerne Festivals«. Es hat zahlreiche, zum Teil preisgekrönte Schallplattenaufnahmen vorgelegt, im Sommer 2006 erschien Mariss Jansons‘ Zyklus mit allen Sinfonien Schostakowitschs, an denen das Symphonieorchester mitgewirkt hat. Neben den Chefdirigenten prägten und prägen eine internationale Elite von Gastdirigenten das Orchester, so Sir Georg Solti, Leonard Bernstein, Carlo Maria Giulini, Carlos Kleiber, Riccardo Muti, Esa-Pekka Salonen und Franz Welser-Möst. Riccardo Muti Riccardo Muti wurde in Neapel geboren, wo er am Konservatorium »San Pietro a Majella« bei Vincenzo Vitale Klavier studierte. Er studierte Komposition und Dirigieren am Mailänder Konservatorium »Giuseppe Verdi« bei Bruno Bettinelli und Antonio Votto. 1967 gewann Muti – als erster Italiener – den prestigeträchtigen »Guido Cantelli«-Dirigierwettbewerb in Mailand. Im folgenden Jahr wurde er zum Chefdirigenten des »Maggio Musicale Fiorentino« ernannt, eine Position, die er bis 1980 innehatte. Bereits 1971 wurde Riccardo Muti von Herbert von Karajan eingeladen, bei 20 I 21 den »Salzburger Festspielen« zu dirigieren. Als Nachfolger von Otto Klemperer war Muti von 1972 bis 1982 Chefdirigent des Philharmonia Orchestra London, anschließend bis 1992 als Nachfolger von Eugène Ormandy Music Director des Philadelphia Orchestra. Von 1986 bis 2005 war Muti Musikalischer Direktor des Teatro alla Scala. Unter seiner Leitung sind so wichtige Projekte wie die Mozart/Da Ponte-Trilogie sowie Wagners kompletter »Ring« realisiert worden. Neben dem klassischen Repertoire brachte er viele weniger bekannte und vergessene Werke zur Aufführung, darunter hervorragende Werke der Neapolitanischen Schule des 18. Jahrhunderts wie auch Opern von Gluck, Cherubini, Spontinti und zuletzt Poulencs »Les dialogues des Carmélites«. Mit dieser Produktion gewann Muti den beliebten »ABBIATI«- Kritikerpreis. Die lange Zusammenarbeit mit der Scala wurde im Dezember 2004 mit der triumphalen Wiedereröffnung der renovierten Scala mit Antonio Salieris »Europa riconosciuta« gekrönt, einem Werk, das ursprünglich für die Eröffnung des Theaters 1778 komponiert wurde. Während seiner außergewöhnlichen Karriere hat Riccardo Muti alle wichtigen Orchester der Welt dirigiert. Besonders eng ist er mit den Wiener Philharmonikern verbunden, mit denen er seit 1971 bei den »Salzburger Festspielen« auftritt. Als er das Orchester anlässlich des 150-jährigen Bestehen des Wiener Musikvereins dirigierte, wurde ihm der »Goldene Ring« des Orchesters als Zeichen besonderer Wertschätzung und Anerkennung überreicht – eine Ehre, die bisher nur einigen wenigen Dirigenten zuteil wurde. 2004 gründete Riccardo Muti das Luigi Cherubini-Orchester, dessen Mitglieder die besten jungen italienischen Musiker sind. Im Januar 2006 wurde Riccardo Muti zum Künstlerischen Leiter der »Pfingstfestspiele« in Salzburg ernannt. Besonders wichtig ist Muti soziales und humanistisches Engagement. Unter dem Motto »Le vie dell‘Amicizia« (»Pfade der Freundschaft«) organisiert er gemeinsam mit dem »Ravenna Festival« Konzerte an Orten, die Symbol für problematische politische Ereignisse unserer Zeit sind: Sarajevo (1997), Beirut (1998), Jerusalem (1999), Moskau (2000), Jerewan und Istanbul (2001), New York (2002), Kairo (2003), Damaskus (2004), El Djem (2005). An diesen Orten musiziert Riccardo Muti gemeinsam mit Chor und Orchester des Scala, des »Maggio Musicale Fiorentino« und Musikern von »Europe United«, einem Ensemble, das sich aus Stimmführern und Solisten der wichtigsten Europäischen Orchester zusammensetzt. Riccardo Muti ist »Cavaliere di Gran Croce« der Italienischen Republik, Träger der »Gran Medaglia d‘Oro« der Stadt Mailand sowie des Bundesverdienstkreuzes. Er ist Mitglied der französischen Ehrenlegion und wurde durch Königin Elisabeth II. von England zum »Knight of the British Empire« erhoben. Das Mozarteum in Salzburg hat ihn für seine Verdienste um die Interpretation der Musik Mozarts mit seiner Silbermedaille ausgezeichnet. Riccardo Muti ist Ehrenmitglied der Wiener Hofmusikkapelle und der Wiener Staatsoper. Russlands Präsident Putin hat ihn mit dem Freundschaftsorden und der Staat Israel mit dem »Wolf«-Preis für Kunst ausgezeichnet. BIOGRAFIEN 22 I 23 BIOGRAFIEN Grosse Orchester – Grosse Dirigenten Archaische Musik Spätestens seit dem Erfolgsfilm »Rhythm is it« ein Werk, das Jung und Alt begeistert: Strawinskys »Le Sacre du Printemps«. Das Orchestre de Paris unter Christoph Eschenbach bringt es zusammen mit Beethovens »Pastorale« auf den Spielplan des KONZERTHAUS DORTMUND. Fr 23.02.07 · 20.00 Spätromantische Klänge Nach seinem umjubelten Auftritt als Begleitung des Heldentenors Ben Heppner kehrt das Rotterdam Philharmonic Orchestra zurück, diesmal unter seinem Chefdirigenten Valery Gergiev. Auf dem Programm stehen Wagners »Wesendonk-Lieder« und Mahlers Sinfonie Nr. 1 »Der Titan«. Kostenlose Kinderbetreuung – Anmeldung unter T 0231 22 696 261. So 04.03.07 · 16.00 Christoph Eschenbach 24 I 25 Weiterhören Texte Anne do Paço Fotonachweise Titel © Hans-Dieter Göhre S. 4 I5 © Hans-Dieter Göhre S. 8I9 © Hans-Dieter Göhre S. 22 © Hans-Dieter Göhre S. 24 © Michael Tammaro · The Philadelphia Orchestra Association Herausgeber KONZERTHAUS DORTMUND Geschäftsführer und Intendant Benedikt Stampa Redaktion Claudia Beißwanger · Franziska Graalmann Konzeption Kristina Erdmann Anzeigen Milena Ivkovic · T 0231-22696-161 Druck Gustav Kleff GmbH & Co. KG · Dortmund Wir danken den beteiligten Künstleragenturen und Fotografen für die freundliche Unterstützung. Es war nicht in allen Fällen möglich, die Bildquellen ausfindig zu machen. Rechteinhaber bitte melden. Druckfehler und Änderungen von Programm und Mitwirkenden vorbehalten! Impressum Konzerthaus dortmund philharmonie für westfalen brückstrasse 21 I 44135 Dortmund t 0231- 22 696 200 I f 0231- 22 696 222 [email protected] www.konzerthaus-dortmund.de